
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
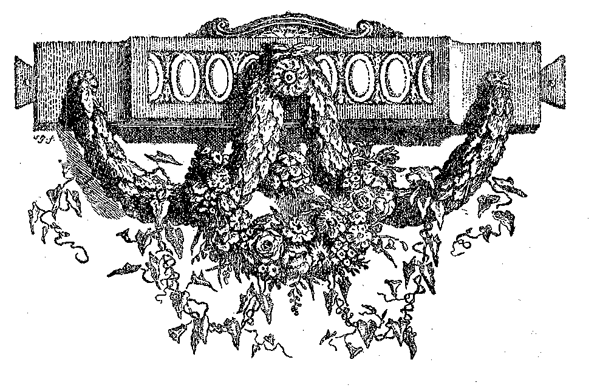
»Von Werten, die wir zu würdigen verstehen, tragen wir einen Keim in uns selber.«
Ganz Straßburg atmete auf, als am 7. Mai des Jahres 1770 gegen Mittag endlich der ewige Regen aufhörte und die Sonne, wenn auch noch blaß und schwächlich, durch den Nebel hindurchschaute. Denn in wenigen Stunden sollte die reizende Marie Antoinette von Österreich, seit drei Tagen dem französischen Kronprinzen vermahlt, auf ihrem Wege nach Paris durch Straßburg kommen, um hier beim ersten Schritt in ihr künftiges Königreich festlich begrüßt zu werden. Seit dem frühen Morgen schon waren die Straßen angefüllt von Leuten, die unter ihren Regenschirmen, mit Verwandten und Freunden breit eingehenkelt, umherzogen und alle Vorbereitungen für den Einzug mit Neugier, Bewunderung und Ängsten betrachteten: Würde nicht alles durchweicht und unansehnlich sein, noch ehe Maria Theresias verwöhnte Tochter es zu sehen bekam?
Jetzt war auch diese Sorge behoben, und die Straßburger konnten sich ungehindert ihrer Erwartung eines glänzenden Schauspiels hingeben. Eilig wurden noch die Verzierungen an den Häusern angebracht, die sich nicht in den Regen hinausgewagt hatten, Teppiche herausgehängt, die Straßen frisch mit Grün und Blumen bestreut; auf den Plätzen schüttelten die Zelte, in denen abends die Würstchen zur Volksspeisung gebraten werden sollten, sich die Tränen ab und begannen zu glänzen; die Fähnchen trockneten, wurden leicht und flatterten. Alles sah lustig aus und erwartungsvoll.
Und jetzt beginnen die Glocken des Münsters ihr machtvolles Zwölf-Uhr-Läuten. Dann mischt sich St. Stefan ein, Jung St. Peter, Alt St. Peter; und zu den katholischen Stimmen gesellt sich mit ernstem Rhythmus die protestantische St. Thomaskirche und die neue Kirche des protestantischen Gymnasiums. Wie ein Netz von Klängen wirft es sich über die alte Stadt. Trutziges Dröhnen, vereint mit lockendem Gesang. Ganz so wie drunten die wuchtigen, kantigen Türme der mittelalterlich deutschen Zitadelle um die graziösen welschen Bauten der Franzosen stehn.
Die Glocken haben ausgeläutet.
Je weiter die Zeit vorrückt, um so lebhafter wird das Gedränge in den Hauptstraßen und auf den Plätzen, durch die der Zug kommen soll. Da die Straßen für Fuhrwerk verboten sind, sieht man Kavaliere und Damen der Gesellschaft, die sonst nur in Wagen oder Portechaisen sich fortbewegen, vorsichtig und ein bißchen hochmütig über das feuchte Pflaster stelzen, um sich zu den Freunden zu begeben, bei denen sie zur Schau geladen sind. Mancher weißseidene Strumpf bekommt da einen Schmutzfleck, manche Schleppe einen Rand. Die Damen haben ihre hohen Puffenfrisuren und winzigen Hütchen zu schützen vor den herabbaumelnden Beinen der Buben, die sich an Vorsprüngen und Schnitzwerk der alten Giebelhäuser eingenistet haben und da droben lärmen wie ungeduldige Spatzen. Sie beneiden die schleppenlosen Faltenröcke der Bürgermädchen, die sich in ihren Schoßtaillen und farbigen Brokatschürzen auf schwarzen Stelzenschühchen zierlich fortbewegen und recht gut wissen, wie hübsch ihnen das gestickte Häubchen am Hinterkopf und das helle Brusttuch steht.
Und jetzt strömen die Landleute der Umgegend in die Stadt hinein. Sie bringen ein durchaus deutsches Bild in das städtische Gemisch von elsässischer Tradition und neuer Pariser Mode hinein. Die Männer tragen zum langen dunkeln Rock die bunte Weste, die Kappe und blaue oder rote Strümpfe unter ihren samtnen Kniehosen. Die Frauen mit breitem Faltenrock, enggeschnürter dunkler Taille und rotem Brustlatz segeln in ihren großen seidenen Schürzen, die Hände vor dem Magen wie in der Kirche, andächtig daher; die Töchter tragen die schwarze, kleidsame Elsaßschleife über dem reichen Haar, das ohne Puder und Locken in dichten Flechten um den Kopf liegt. Sie würden es unanständig finden, ihr Haar nach Pariser Art zu türmen.
Immer zahlreicher ist der Zuzug der Landleute jeder Art. Sie kommen in Postkutschen, Leiterwagen, Einspännern, Halbchaisen, Korbwägelchen, in eleganten Schloßkutschen. Dazwischen alte, geräumige Landkarossen, denen man es ansieht, daß sie nur bei ganz seltenen Gelegenheiten aus der Remise gezogen werden. Vor dem Steintor sind provisorische Ausspannungen entstanden, Bretterverschläge für Pferde und Wagen. Denn die Einfahrt in die Stadt ist verboten. Die drei Unterstände dort aber sind bereits überfüllt, und bei jedem neuen Ankömmling spielen sich dramatische Szenen ab zwischen Torwächtern und Abgewiesenen, die je nach ihrem Temperament verzweifeln oder wüten, Ein Betrunkener belästigt alle mit wüstem Schimpfen. Einer hat das Messer gezogen und fuchtelt wild umher.
Eben rumpelt ein altertümliches Gefährt schwerfällig und harmlos in das lärmende Getriebe dort hinein. Auf dem Bock sitzen zwei. Die Zügel hält ein etwa dreizehnjähriger rotwangiger Knabe, ehrbar wie ein kleiner Erwachsener gekleidet, der nun anhält und zwischen dieser aufgeregten Menge vergebens versucht, seine Ratlosigkeit unter einer pompösen Miene zu verbergen. Sein Gefährte, ein blasser, ernsthafter Jüngling in schwarzem Kandidatenrock, macht gleichfalls ein bedenkliches Gesicht. Auch die beiden gutgenährten, aber betagten Schimmel wenden mißtrauisch die Köpfe gegen die schreienden und herumfuchtelnden Menschen. Dergleichen sind sie nicht gewöhnt draußen in ihrem stillen Sesenheim, wo sie meist nur Heu und Korn und Mist fahren. Oder pflügen. Sonntags spannt dann der Knecht sie ans Korbwägelchen, damit der gute Pfarrer Brion seine Gemeinden in den entfernteren Kirchdörfern besuchen kann. Und manchmal geht es, heidi, in den Wald, zum Rhein, auf irgendein Landgut in der Nähe. Lustige junge Leute, die lachen und singen und die Pferde streicheln.
Dies hier aber gefällt ihnen nicht!
»Verboten durchzufahren!« Der Torwächter streckt die Hellebarde vor, mit einer Bewegung, in der ganz Frankreich befiehlt. In der französischen Uniform aber steckt ein gutmütiges Elsässergesicht. Wagt es einer daraufhin, dennoch mit seinem Wagen hindurchzuflitzen, so kriegt er den dazugehörigen echten Elsässer Zorn zu spüren. Das Fünffrankenstück, das ihm ein gräflicher Lakai in die Hand gesteckt hat, wirft der Soldat zu Boden und spuckt darauf.
Inzwischen ist der Knabe vom Kutscherbock heruntergeklettert, hat die Zügel in die schmalen zarten Hände des Kandidaten gelegt, tritt nun wie ein kleiner Held vor den Torwächter und erklärt ihm mit heftiger Beredsamkeit: er sei der Christian Brion. Hinein in die Stadt müsse er mit dem Wagen. Es sei verabredet, bei dem Onkel Schöll auszuschirren, der Ratsherr sei. Und also doch wohl in der Stadt ein Wörtchen mitzusprechen habe? Er bläht sich wie ein kleiner Truthahn und kommt sich sehr wichtig vor. Aber der Wachtsoldat lacht nur:
»Ah, guckmal, dem Pfarrer Brion sein Jüngster seid Ihr? Euch hab' ich noch in Kamisölchen und Hemdzipfel in Sesenheim auf dem Anger umherlaufen sehen. Und mit den Mamsells habe ich in der Schule gesessen. Vor sechs Jahren hat Pfarrer Brion mich eingesegnet.«
»Seid Ihr's, Jakob Klein?« Die Stimme tönt aus dem Wagen heraus wie ein silbernes Glöckchen. Und nun entläßt die dunkle Kutsche ein Mädchen, hell wie der Frühlingstag selber, in den sie hinaustritt. Eine süße Heiterkeit liegt auf ihrem zartfarbigen Gesicht mit den strahlend blauen, großen Augen. Und als sie nun in die volle Sonne tritt, leuchtet ihr Haar, das sich an den Schläfen anmutig lockt und in vielgewundenen Flechten um den schmalen Kopf gelegt ist, wie eine Goldhaube über der klaren Stirn. Die Leute ringsum blicken, mitten aus ihrem Unmut heraus, freundlich auf das liebliche Geschöpf. Sie machen ihr sogar Platz, als sie mit ihrem leichten, liebenswürdigen Schritt auf den Wachtsoldaten zugeht: »Grüß Gott, Jaköble. Und habt Ihr nicht bald Urlaub, daß man Euch wieder einmal in Sesenheim sieht? Euer Vetter Schorsch Klein in Drusenheim wartet schon lang auf Euch. Und unser Bärbel hat sich noch immer keinen andern Schatz angeschafft.«
Jakob Klein lachte über das ganze Gesicht. Unwillkürlich trat er ein bißchen zur Seite. Als aber jetzt Christian in die Hände klatschte: »Wir dürfen durch!«, wurde die Miene des Soldaten plötzlich streng und dienstlich. »Verboten durchzufahren«, rief er scharf. Die Brions sah er gar nicht mehr an.
»Er hat recht,« sagte Friederike zu Christian, dem Tränen der Wut in die Augen traten, »er ist halt doch Elsässer Blut und kein galanter Franzos.«
Mit ein paar Schritten war sie am Wagen und sprach hinein. Beschwichtigend. Erklärend. Wieder öffnet sich der Schlag der alten müden Kutsche. Eine feurige Brünette springt mit einem Satz heraus, etwas älter als die Blonde. Sie guckt mit ein paar kecken Augen um sich und fängt sogleich zu schelten an: ›Was denn das für Zustände seien hier? Stundenlang habe man zusammengepreßt gesessen und nun solle man wohl gleich wieder umkehren?‹
Sie brachte das so komisch heraus, daß die Umstehenden lachten. Derweil hatte sich auch der Kandidat eilig vom Bock herunterbegeben, als müsse er dem jungen Mädchen noch nachträglich aus dem Wagen helfen.
Die lacht. »Wenn ich auf Sie hätte warten wollen, lieber Marx!« Die beiden sind miteinander versprochen. Sobald der junge Theologe eine Stelle hat, wird Verlobung und Hochzeit gefeiert werden. Denn »zu einer Pfarre gehört sich eine Knarre«, sagt das nicht sehr höfliche Sprichwort.
Salome Brion oder, wie sie meist genannt wird, »das Sälmel« sieht in ihrer enggeschnürten Miedertaille, schneeweißem Brusttuch und grünseidnem Faltenrock mit schwarzer Schürze bunt und frisch aus wie ein Apfel. Gleich nach ihr ist ein etwa 14jähriges Mädchen ausgestiegen, das ein wenig schwächlich aussieht. Die eine Schulter ist höher als die andere, was ihr ein mühseliges Ansehen gibt. Sie jammert: »Mein linkes Bein ist mir eingeschlafen. Geh her, Friederike, führ' mich ein bissel. Wie mit lauter Nadeln sticht's da drinnen.«
Friederike ist schon bei ihr. »Armes Sophiele! Wirklich eingeschlafen?« Sie schüttelt sanft den hingestreckten Fuß. »Wach' auf, wach' auf!«
»Du mußt fest darauf treten,« sagt sie dann tröstend, »wirst sehn, dann geht's.«
Und es geht wirklich.
Ganz zuletzt ist noch die Mutter ausgestiegen, schlank und wohlgewachsen wie Friederike, aber ohne deren lichte Freundlichkeit in Miene und Bewegung, Etwas Gemessenes, beinah Hochmütiges lag in der Art, wie sie sich in ihren Schal wickelte, als wolle sie die Berührung mit diesen Menschen hier vermeiden. Sie hielt ernstlich Rat mit Marx, was man wohl tun könne? Ihre reichgarnierte Haube sowie das dunkle Seidenkleid hatten etwas Vornehmes. Das Sälmel, jetzt ganz übermütig, lachte über alles. Während Marx und Christian dann in der Nähe Umschau hielten nach einer Unterkunft für Kutsche und Pferde, packte Friederike die mitgebrachten Erfrischungen handlicher, so daß man sie im Pompadour gut unterbringen könne. Sie war keinen Augenblick aus ihrer heiteren Gelassenheit geraten.
»Sieh da,« sagte sie plötzlich lächelnd, »da kommt schon die Rettung. Ich sehe den Vetter Gottlieb, der uns sucht. Er wird sicher Rat wissen.« Salome geriet sogleich außer sich vor Freude, riß ihr Taschentuch hervor und schwenkte es wie ein Schiffbrüchiger. Auch die Mutter winkte lebhaft.
Jetzt hatte der Vetter sie entdeckt, wand sich zu ihnen durch und begrüßte sie wie erlöst. »Endlich! Seit einer Stunde laufe ich hier schon herum und gucke nach Ihnen. Die Eltern mit den Schwestern sind nach dem Metzgertor gegangen, um den Zug gleich zu sehen, wenn er da durch die Ehrenpforte kommt. Aber ich hatte keine Ruh. Immer mußte ich dran denken, daß Ihr hier draußen festsitzt und womöglich zu allem zu spät kommt.«
Frau Brion warf einen wohlgefälligen Blick auf den stattlichen Neffen, der breitschultrig und mit prallen Waden dastand wie das Bild der Gesundheit. Zu Friederikens 18. Geburtstag neulich hatte er bei den Eltern um sie angehalten. Aber der Vater hatte gemeint, das Riekchen sei noch viel zu jung zum Heiraten. Die Mutter hatte ihn dann beiseitegenommen und ihn auf später vertröstet. Einen besseren Schwiegersohn als diesen braven, tüchtigen Menschen, der wie ein Herr auf seinem kleinen Pachtgut saß, hätte sie sich gar nicht wünschen können. Freilich, Friederike war zart und zur Landwirtschaft wenig geeignet. Aber hatte sie selbst sich nicht auch erst in das Landleben und in die Mühen der großen Wirtschaft hineinfinden müssen? Ihr Mann freilich hätte sein Riekchen am liebsten unter eine Glasglocke und in den Zierschrank gestellt!
Mit seiner Frau hatte er nie so viel Umstände gemacht!
Der verdrossene Zug um den Mund der überarbeiteten Frau wurde schärfer.
Langsam kamen sie vorwärts.
Die Straßen hier draußen sahen wenig festlich aus. Erst als man sich der inneren Stadt näherte und über die Kanalbrücke nach dem Broglieplatze durchdrang, sah man Girlanden und Teppiche an den Häusern, Lichte an den Fenstern zur abendlichen Illumination und an den prächtigeren oder wichtigeren Gebäuden die Lämpchenreihe, die nach Dunkelwerden die Fassade in Flammen nachziehen sollte. Alles Zukunftsschönheiten, bei denen man sich nicht weiter aufhält. Lustiger ist der Anblick in den Hauptstraßen, wo erwartungsvolle Damen auf den schmalen Altanen der Patrizierhäuser Platz genommen haben, dicht aneinander gereiht. Ihre buntstrahlenden Krinolinenkleider schwingen langsam hin und her. Wie große seidene Glocken sehen sie aus, die man da zur Begrüßung aufgehängt hätte. Die Köpfchen der Damen aber mit ihrem gewaltigen Federschmuck erscheinen von unten wie Wolken-Engel zwischen weißen Schwingen.
»Man hätte sich ebenfalls sollen ein bissele mehr nach der Mode anziehn«, sagte das Sälmel verdrießlich, »wie eine Magd sieht man aus gegen die da oben.« Aber Friederike meinte: »Wir sind hübsch genug, so wie wir sind! Das französische Zeug steht uns nicht. Es ist so unnatürlich.«
»Und wir sind ja hergekommen, um zu sehen; nicht um gesehen zu werden!« fügte Marx hinzu, der immer ein bißchen lehrhaft war.
Auf einmal schreit das Sophiele laut auf: »Sie kommen, sie kommen!«
Ein einzelner Reiter, wunderschön auf glänzendem Pferd, das unter seinem Purpursattel mit gebeugtem Nacken dahersprengt, ist aus irgendeinem Grunde in der freigelassenen Baum-Allee des Broglie erschienen. Er verschwindet im Tor des Rathauses. »Sie kommen!« schreit das junge Ding noch einmal. Christian gibt ihr einen ärgerlichen Schubs. Er ist ganz rot geworden. So fest packt er sie am Arm, daß es kneift und sie »Au« sagt. Aber die Menge glaubt dem kleinen Mädchen. Sie setzt sich gegen den Dom des Bischofschlosses in Bewegung. Dort wird die Dauphine heute wohnen. Bis dorthin wird der Zug ihr feierliches Geleit geben.
Die Brions und ihre beiden Kavaliere werden geschoben, festgekeilt und wieder vorwärtsgestoßen. Alles in jener seltsam stummen und aufgeregten Art, wie sie einer wartenden zahlreichen Menge eigen ist. Jetzt stehen sie an einen der Weinbrunnen geklemmt; ein Delphin, aus dessen Nüstern der Wein sprudeln soll. »Delphin heißt auf französisch Dauphin«, erklärt Marx den beiden Jüngsten. »Das habt ihr doch in der Schule gehabt?«
Sie sagten beide »Ja«, wußten aber von nichts. Dagegen lasen sie mit Hingebung die Verse, die an Urnen und Säulen aufgemalt waren. Christian las:
»Frohlocket ihr Bürger,
Dauphine kömmt an,
Bestreuet mit Kränzen
Die ebene Bahn.«
Gottlieb hatte Friederike zu einem Schmucktempelchen geführt, auf dem ein Genius thronte, der ein feuerrotes Herz mit gelben Flammen am Arme hängen hatte.
»Mein Herz ist einem
Nur allein geweiht«, stand da.
»Nur meinem Bräutigam,
deß Liebe mich erfreut.«
»Gefällt Ihnen das, Vetter?« fragte Friederike. »Ich mag's nicht leiden, wenn die Empfindungen des Herzens so fest müssen vorherbestimmt werden am Hochzeitstage wie die Reihenfolge der Tänze. Mich dünkt, das müsse alles ganz von selber kommen.« Sie unterbrach sich wie erschreckt. »Wer ist das?« fragte sie, auf einen Trupp junger Leute blickend, der, die Menschenmauer durchbrechend, vorbeikam. Studenten schienen es zu sein. Aber von sehr verschiedenem Alter, Anzug und Gebaren. Friederike sah nur den einen, dessen großes Feuerauge sie gestreift hatte. Sie hätte über sein Gesicht nichts aussagen können, so flüchtig nur war es ihr zugewandt. Aber da er nun weiterschritt, die junge, biegsame Gestalt mit freien, ungestümen Schritten tragend, meinte sie nie etwas Lebendigeres gesehen zu haben. »Wer ist das?« fragte sie noch einmal. Zu gleicher Zeit löste sich aus dem Trupp, der weiterschritt, eine schmächtige Gestalt heraus und bewegte grüßend den Hut, den er in der Hand trug. Er kam heran. Gottlieb faßte den unscheinbaren kleinen Menschen bei den Schultern: »Bonjour, Vetter Weyland. Auch unterwegs? Das ist recht.« Die Mutter gab ihm die Hand. Ob er denn nicht bald einmal wieder nach Sesenheim käme? Das Giebelstübchen sei immer bereit für Gäste. »Mit wem sind Sie denn hier, Vetter?« fragte Salome. Und Friederike erkundigte sich zum dritten Male: »Ja, wer ist das?« »Mein Mittagstisch. Fast lauter Mediziner, Studiengenossen. Nur der Große, Schöne da in der Mitte ist ein Jurist. Aus Frankfurt; wohlhabender Leute Kind. Und ein Besonderer, sag' ich euch. Goethe heißt er.«
»Er sah aus wie ein recht unternehmender Mensch«, bemerkte Marx.
»Ist er auch. Immer den Kopf voll Anschläge. Über seine Streiche kommt man aus dem Lachen nicht heraus. Und dann wieder redet er Dinge, daß man Maul und Nase aufsperrt. Ein Geist voll Feuer mit Adlersflügeln.«
»Ei, ei,« meinte Gottlieb, der den stillen Vetter gern neckte, »der Weyland redet auch schon Geniedeutsch, wie es jetzt in den Almanachen Mode sein soll. Und dein Goethe dichtet wahrscheinlich ebenfalls?«
»Geraten. Verse, soviel du willst. Auch Theaterstücke. Alles aus dem Leben herausgegriffen. Grade als wäre die ganze Welt ein Bilderbuch für ihn, aus dem er abschreibt. Und was man mit dem Goethe sieht, das sieht man für sein ganzes Leben.« Sein unbedeutendes Gesicht glänzte förmlich.
In seine Worte klang Musik herein, die erst schwach, dann langsam stärker werdend vom Metzgertor herauftönte. Fanfarenstöße, Posaunen, Trompeten. Jetzt kamen sie wirklich! Während die Leute sich in die Münstergasse stürzen, um dem Zug, der den Umweg über den Münsterplatz machen wird, zu begegnen, zieht Gottlieb Schöll seine Gesellschaft schnell in ein altes Haus hinein, das einen verborgenen Durchgang hat nach stillen Gassen, rennt mit ihnen über Höfe, daß die Hühner gackern, die Tauben flattern, jagt enge Gänge durch zwischen Mauern, hinter denen Hunde ihnen wütend nachbellen, durchläuft ein zweites Haus und siehe – man ist glücklich am Münsterplatz gelandet, auf dem sich der Aufzug in seiner ganzen Pracht entfalten kann.
Lauter klingen die Trompeten, Kanonenschüsse, Glocken. Schon hört man das begeisterte »Vive, sie lebe!« deutlich herübertönen. Man fühlt die Schritte der herankommenden Soldaten den Boden erschüttern.
Und nun in voller Maisonne das Blitzen des Militärs, das die Spitze bildet. Voran die königliche Leibgarde, die Anführer zu Pferde, Kürasse und Rosse wie aus Bronze, die Mannschaft zu Fuß. Das funkelt und weht: Degen, Fahnen, Mäntel, Federbüsche, Soldatenbeine, rhythmisch emporfliegend. Pauken dröhnen, Trompeten jubilieren, Trommeln wirbeln, das Volk schreit seinen Gruß.
Friederike zog ihren Arm aus dem Gottliebs, der sie führen wollte. Sie sah sich nach Weyland um. Aber der war verschwunden. Wahrscheinlich seinen Freunden nachgegangen. Schade! Er hätte sicher noch mehr erzählt von diesem merkwürdigen Herrn Goethe. ›Was man mit dem Goethe sieht, das sieht man fürs Leben?‹ Wenn er doch heute hier wäre, neben ihr ginge, sie mit seinen Dichteraugen sehen lehrte!
»Gefallt's Ihnen auch, Bäschen?« fragte Gottliebs gute Stimme. »Sie sind auf einmal so still geworden.«
Vorreiter kommen, Pagen, leuchtend in ihren roten, mit den königlichen Lilien bestickten Phantasiekostümen. Die ersten auf zwölf schwarzen Pferdchen mit Silberzügeln, ihnen folgen andere zwölf auf schneeweißen Rößlein mit roten Zügeln.
Und nun sie selber, die junge Fürstin in ihrer Märchenkutsche, ganz aus Glas und Gold. Von Kopf bis zu Fuß kann man sie sehen, wie sie mit strahlendem Lächeln die Grüße des Volkes erwidert, mit ihren Damen plaudert, die ihr gegenübersitzen, und immer wieder das mit einem Paradiesvogel geschmückte hochfrisierte Köpfchen neigt. Ihr Kleid ist blauer Damast, mit Edelsteinen übersät. Es funkelt, wenn sie sich bewegt. Ein hermelingefütterter rosa Seidenmantel, an der Schulter befestigt, fällt in schweren Falten zur Seite nieder. Alle, an denen sie vorüberfährt, brechen in Jubel aus. Auch die Prachtkutsche des Bischofs wird begrüßt, die, mit vier Rappen bespannt, mit geschmückter Dienerschaft und Troß vorüberzieht. Ihm folgt die katholische Geistlichkeit, farbig, goldglitzernd, dann die protestantische, in ruhigem Schwarz. Später Universitäts-Dekane und Rektor, die Spitzen der Bürgerschaft, die Zünfte mit ihren Wahrzeichen. Es wollte kein Ende nehmen. Und so viel Hin- und Widergrüßen. Jeder Zuschauer hatte Freunde und Verwandte im Zuge.
Jetzt drängte die Menge nach dem Barfüßerplatz, die Tänze der Zünfte zu sehen. Die Brions ließen sich nicht mitreißen. Diese Tänze hatte man schon oft bewundert. Und man durfte Madam Schöll nicht warten lassen, die zum Essen eingeladen hatte. Marx verabschiedete sich. Fr wohnte in Straßburg bei seiner Familie, war nur in Sesenheim ein paar Tage zu Besuch gewesen und mit den Brions hergefahren.
Es war ein gutes vergnügtes Mahl gewesen bei den Schölls im alten Giebelhause des Schiffsleutstaden. Dann, während die Mutter sich, wie Bruder und Schwägerin, ein Ausruh-Schläfchen gönnte, machte das junge Volk sich wieder auf, durch die Stadt zu ziehen. Salome namentlich verlangte die Ehrenpforte am Metzgertor zu sehen, von deren umständlichem Bau und Ausputz ihr Marx ausführlich erzählt hatte. So ging's denn diesmal gegen das Badische hin. Voran Christian zwischen seinen beiden Bäschen Jeanne und Margret eingehenkelt, die sich in Ermangelung erwachsener Kavaliere die dreiste Art des Brionschen verwöhnten Jüngsten, der noch dazu einziger Sohn ist, gefallen ließen. Gottlieb folgte mit den beiden Sesenheimer Mädchen. Das Sophiele war bei den Schölls geblieben. Sie sollte ihre Kräfte sparen für die Illumination heut abend. Man ging hinter den heut feiertäglich verlassenen braunhölzernen Verkaufsbüdchen, die mit geschlossenen Gittern dastanden, die dunklen »Lauben« entlang, kam zum »alten Fischmarkt«, dann an der »großen Metzig« und dem burgähnlichen, mittelalterlichen »Kaufhaus« mit allen seinen neuen Anbauten vorbei zur Ill. Friederike blieb stehen. Sie vermißte die Waschschiffe, die sonst hier standen mit ihrem Heißwasserdampf, den emsigen Weibern mit bloßen Armen, die miteinander lachten. Nun ging's über die »Rabenbrücke«. Christian erzählte eben den Kusinen, daß drüben im Gasthof zum Raben vor 30 Jahren der preußische König Friedrich der Große logiert habe. Das gehörte zu den wenigen Dingen, die ihn in der Geschichtsstunde interessiert hatten. Kusine Jeanne aber bedeutete ihn, es sei unschicklich, gerade heute von diesem König von Preußen zu sprechen, der gegen die Mutter der Marie Antoinette so lange Krieg geführt und überhaupt weder Religion habe noch Lebensart.
Nun war man vor der Ehrenpforte angelangt. Gottlieb berichtete, man habe die Wallmauer zurückrücken und die Gräben zu beiden Seiten zuschütten müssen, um die Breite für den Galawagen zu schaffen. Man blieb vor der Göttin Maja stehen, die über dem mittleren Schwibbogen schwebte und den Mai darstellen sollte. Sie hatte ein blaues, mit Lilien besticktes Gewand und streute aus einem Füllhorn Blumen auf die Straße, Salome las laut den Spruch am Postament:
»Wird Frankreichs Lilienflor
In stetem Lenze stehn,
Ja werden Land und Volk
Die besten Zeiten sehn.«
»Wie muß es doch schon sein, so gefeiert zu werden!« rief sie. »wenn unsereiner heiratet, machen die Leut' ›Polterabend‹, Scherben werfen sie einem vor die Tür. Viel lustiger wär's doch, wenn alle Leut' einem so schön taten und so viel Glück voraussagten, wie heut der Marie Antoinette.«
»Und Sie, Friederike?'« fragte Gottlieb dringlich, »wie wollen Sie es halten bei Ihrer Hochzeit?«
Sie lachte. »Ob Verse oder Scherben, wenn nur der Mann recht ist. Aber darauf kommt's an.« Er sah sie in bittender Frage an. Sie achtete es nicht. »All dieses Übertriebene mag ich nicht«, fuhr sie fort. »Ja, es ängstet mich beinah. Wie eine Überschwemmung ist das, die über die schönsten Gärten und die reifsten Felder fährt.« Sie war ganz blaß geworden. Als ahne sie hinter diesem Schmeicheln und Jubilieren das blutige Schicksal des jungen Paares, das man heute feierte. Und das einst von seinem Volk verwünscht, vom Thron gestoßen, in den Kerker geworfen und zuletzt auf das Schafott geschleppt werden sollte.
Kusine Jeanne lachte. »Das Riekchen ist abergläubisch! Eine Schande für eine Pfarrerstochter.« Die sanftere Margret aber schmiegte sich liebevoll an sie heran. »Gelt? Man denkt manchmal so Sachen?«
Friederike sah vor sich hin. Es war sonst ihre Art niemals gewesen, »so Sachen« zu denken. Sie nahm den Tag, so wie er kam und freute sich an ihm. Heute aber fühlte sie sich ganz herausgerissen aus dem Alltag. Auch in ihr war Fest, war Märchen. Ganz so wie auf dem grünen Anger, zu dem sie jetzt durch das Tor herausgetreten waren, wo im lichten Silbernebel der jetzt wieder ganz verhüllten Sonne muntre Paare sich im Tanze drehten. Alle lachend und sorglos, als kennten sie nickt Mühe, Arbeit und Verdruß. Nur Tanz. Die Musik war ländlich, an einem Steintisch fiedelten die Musikanten hinter ihren Weinkrügen.
Unsere kleine Gesellschaft setzte sich ein wenig abseits vom Trubel unter stillen Bäumen nieder. Das Silber überflorte immer stärker Fluß und Stadtbild und ließ die runden Schwarzwaldberge wie dunkle Wolken erscheinen. Allmählich dunkelte es. Salome trieb, man müsse in die Stadt zurück. Hier und da wurden schon leuchtende Lämpchenketten sichtbar, die die Staden bekränzten. Und jetzt, wie mit Feuertropfen in die Luft getüpfelt, die Silhouette des Münsters. Jedes Portal, jeder Fensterbogen. Von der Plattform sprühen Fackeln ihre glänzenden Fanale herüber. Man sieht den Turmstumpf, kahl, wie abgebrochen, während der Turm, der einzig fertiggebaute, von innen aus zu leuchten beginnt. Kühn und schlank hebt er sich in glühender Zeichnung in die Luft. Ein in den Himmel weisender schimmernder Gottesfinger. Selbst von hier aus kann man deutlich das zierlich stolze Gerank der kunstvollen Steinarbeit erkennen. Es ist etwas Feierliches in dem Anblick. Niemand spricht. Die Tanzenden haben aufgehört, die Musik schweigt. In der durchsichtiger werdenden Dämmerung steht die Menge dicht beisammen mit emporgerichteten Gesichtern, die vom Feuerschein erhellt sind. Und wieder hat Friederike Brion das Gefühl: Heute ist Feiertag. Ein Tag, der mich angeht. Mehr als alle früheren. –
In der Stadt war schon wieder alles auf den Beinen. Man ging an der Ill entlang dem Schöllhause zu. Das Wasser war ganz durchtanzt von all den goldenen Lichtern, die sich in ihm spiegelten. Und jetzt, da man am Staden weitergeht, dem Bischofschlosse zu – – was ist das? Zauberei? Der Flußarm, auf den die bischöfliche Terrasse herausgeht, ist verschwunden; statt dessen ist da ein plötzlich entstandener Ziergarten zu sehn mit Blumenbeeten, Kübelbäumchen, zierlicher Balustrade und kleinen Tempelchen. Gegenüber, gerade da, wo das Schöllsche Haus sonst stand, befinden sich luftige Säulenhallen, die drei prächtige Ehrenpforten verbinden. Dahinter öffnet sich der Blick auf einen monddurchleuchteten Park, der niemals früher dort war, mit Springbrunnen, Ruhebänken, Statuen und Grotten.
Märchen! Wieder ein Feiertagsmärchen! dachte Friederike. Gottlieb war selig, daß er und seine Schwestern das Geheimnis so gut bewahrt hatten. Er erklärte jetzt, der Ziergarten sei einfach auf Brettern über rasch zusammengefahrenen Pontonbrücken vergänglich aufgebaut. Und der Park nichts anderes als eine transparente Riesenkulisse. Um dieser Überraschung willen habe er sie heute vormittag listig von hinten ins Haus geführt, so daß sie von den Vorbereitungen nichts gewahr geworden wären.
Friederike wehrte ab: »Laßt mir mein Wunder!«
Im Hause war Vater Scholl sehr übler Laune. Überall stänke es nach der leimigen Malfarbe, und warum man ihm, zum Vergnügen der Dauphine von Frankreich, in seinem guten ehrlichen alten Elsaßhause die Luft absperren dürfe mit der Riesenkulisse aus Pappe und Ölpapier?
Die ganze Zeit während des Essens schalt er auf die Regierung. Ging auch danach nicht mit, die Illumination zu sehen, sondern setzte sich grollend zur Lampe in seine Arbeitsstube. Er nahm es Frau und Schwester übel, daß sie nicht bei ihm zu Hause blieben, schalt sie vergnügungssüchtige Närrinnen, ließ sich einen neuen Schoppen Wein aus dem Fasse bringen und nickte einsam scheltend ein.
Er schlief noch, als die Seinen lustgesättigt und ein wenig müde nach Hause kamen und nun eifrig zu erzählen begannen: von Namenszügen aus Licht, Wappen, Häuserverzierungen, den weinfließenden Brünnlein, den Bratzelten, dem Gedränge und Gestaune, als überall das Feuerwerk sprühte und knatterte, und wen man getroffen, was dieser und jener gesagt. Vater Scholl hielt sich die Ohren zu. »Ihr schwätzt alle durcheinand. Man wird ganz drehicht davon.« Erst als Friederike ihm ein paar komische Episoden beschrieb, die man erlebt hatte: eine Perücke, die vom Kopf gefallen war, und die ein Übermütiger auf einen Baum gehängt, und ähnliche harmlos-derbe Scherze, taute der Alte auf. Er begann von den Promotionen zu sprechen, denen er als Magistratsperson beizuwohnen hatte. Von dem Versammeln in den Zunftstuben, den feierlichen Aufzügen mit Musik. Und erwärmte sich dermaßen bei der Beschreibung, daß er, nun ganz in Feststimmung, selbst in den Keller ging, guten Wein heraufholte und eigenhändig seinen Gästen einschenkte. »Dein Riekchen versteht's mit den Männern«, sagte die Frau Rat leise zu Frau Brion. Die blickte erstaunt auf. »Sie ist selbst immer vergnügt«, sagte sie dann, »und kann's nicht leiden, wenn eins mürrisch ist.«
Und so war es wirklich. Friederike mußte Heiterkeit um sich verbreiten. So wie die Sonne Helligkeit. Aus ihrer Natur heraus. Ganz ohne Absicht.
Abends beim Zubettgehen war dann noch ein großes Gelärme in dem Zimmer der beiden jungen Mädchen, in dem auch Salome und Friederike einquartiert waren. Jedes Schwesternpaar schlief in einem der großen französischen Betten, die ebenso breit wie lang sind. Die Mädchen, aufgeregt von dem langen ereignisreichen Tage, sprangen in ihren langen Nachthemden wie toll umher, sangen, erzählten, warfen sich mit Kopfkissen, flochten sich dann gegenseitig das Haar. Und dann liefen die Haustöchter noch rasch in die Speisekammer, noch »Guts« zu holen, zum Knabbern und Schlürfen.
Die Schölls erzahlten dabei von dem großen Rathausfest, das der Magistrat kürzlich gegeben, mit köstlicher Bewirtung und Tanz. Sie waren erst am hellen Morgen nach Haus gekommen. Sogar die Mutter. Sie wollte auf den Vater aufpassen, der leicht, wenn er getrunken hatte, gegen Frankreich lärmte und sich mißliebig machte.
Salome seufzte: »Man kommt zu nichts mehr, wenn man Braut ist!« Sie betrachtete im Spiegel ihre langen braunen Zöpfe.
Auch die Kusinen seufzten. Neidisch. Sie waren älter als die Sesenheimer Mädchen und hätten eine sichere Heiratsaussicht sehr geschätzt. Aber es wollte sich keine zeigen. Jeanne, die Älteste, war unansehnlich und hatte eine säuerliche Art, die abstieß; die Jüngste, hübscher und liebenswürdiger, war neben der herrschsüchtigen Schwester schüchtern geworden. Sie redete kaum. Dazu kam die strenge Frömmigkeit der Mutter, die derbe unbekümmerte Art des Vaters, der – Elsässer mit Leib und Seele – bei jeder Gelegenheit gegen die französische Regierung auftrat und deshalb den jungen Herren, die ihr Fortkommen suchten, als Schwiegervater nicht willkommen war.
So schlichen denn die drei zuletzt verdrossen zu Bett. Nur Friederike hatte ihr strahlendes Lächeln behalten. Sie suchte noch nichts und wollte noch nichts, was sie nicht in sich selber besessen hätte. So schlief sie ruhig ein.
Mitten in der Nacht aber fühlte das Sälmel sich bei der Hand gefaßt und so stark gezogen, daß sie fast aus dem Bett gefallen wäre. Und Friederikes Stimme sagte in das Dunkel hinein: »Das sieht man für sein Leben.« –
Am nächsten Morgen wußte sie nichts mehr davon.
