
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Herzog von Vallombreuse wurde vorsichtig in eine Sänfte gesetzt, nachdem ihm der Wundarzt den Arm verbunden und in eine Binde gelegt hatte. Seine Wunde war, obwohl sie ihn auf einige Wochen außerstand setzte, den Degen zu führen, durchaus nicht gefährlich, denn die Klinge hatte, ohne Arterie oder Nerv zu verletzen, nur das Fleisch durchbohrt. Allerdings bereitete ihm die Wunde viel Schmerzen, den heftigsten Schmerz aber litt sein Stolz. Oft neigte er unterwegs sein bleiches Gesicht heraus, um die Träger anzuspornen; diese aber gingen ihren gleichmäßigsten Schritt und suchten stets die ebensten Stellen heraus, um die geringste Erschütterung zu vermeiden, was aber den Verwundeten nicht abhielt, sie »Esel und Ochsen« zu nennen und ihnen eine Tracht Hiebe zu versprechen, denn sie schüttelten ihn, wie er behauptete, hin und her wie Salat in einem Korbe.
Zu Hause angelangt, wollte er sich nicht zu Bette legen, sondern lehnte sich, durch Kissen unterstützt, auf ein Sofa. Auf einem Klappstuhl neben seinem Freund sitzend, reichte ihm der Chevalier von Vidaline von Viertelstunde zu Viertelstunde einen Löffel voll von dem durch den Arzt verordneten stärkenden Tranke.
Vallombreuse schwieg, aber man sah, daß ein dumpfer Zorn in ihm kochte – trotz der Ruhe, die er zu heucheln bemüht war. Endlich machte seine Wut sich in den heftigen Worten Luft:
»Begreifst du es, Vidaline, daß dieser magere, gerupfte Storch, der von seinem verfallenen Schloß hinweggeflogen ist, um nicht darin zu verhungern, mich auf diese Weise mit seinem langen Schnabel durchbohrt hat – mich, der ich mich mit den feinsten Klingen unserer Zeit gemessen, der ich stets ohne eine Ritzwunde von dem Kampfplatz zurückgekommen bin, hingegen manchen Gegner in den Armen seiner Sekundanten mit verdrehten Augen zurückließ?«
»Selbst der Glücklichste und Gewandteste hat einmal seinen Unglückstag«, antwortete Vidaline salbungsvoll.
»Ist es aber nicht eine Schmach,« fuhr Vallombreuse immer heftiger fort, »daß dieser lächerliche Komödiant, dieser elende Krautjunker, der auf dem Theater in ekelhaften Possen mit Fußtritten und Schlägen regaliert wird, den bis jetzt unbesiegten Herzog von Vallombreuse kampfunfähig gemacht hat? Es muß dies ein Fechter von Profession sein, der sich in die Haut eines Possenreißers gesteckt hat.«
»Sie kennen seinen wahren Stand, und der Marquis von Bruyères bürgt dafür«, entgegnete Vidaline. »Dennoch aber setzt seine unvergleichliche Gewandtheit mit dem Degen auch mich in Erstaunen, denn sie übertrifft alles, was wir bis jetzt auf diesem Gebiet gekannt haben. Weder Girolamo noch Paraguante, die berühmten Fechtmeister, übertreffen ihn.«
»Ich wünschte, meine Wunde wäre schon geheilt,« hob der Herzog nach augenblicklichem Schweigen wieder an, »damit ich ihn von neuem fordern und mich revanchieren kann.«
»Das wäre ein gewagtes Unternehmen, zu dem ich Ihnen nicht raten möchte«, sagte der Chevalier. »Es könnte Ihnen leicht eine Schwäche im Arm zurückgeblieben sein, die Ihre Aussicht auf den Sieg sehr vermindern würde. Dieser Sigognac ist ein furchtbarer Gegner. Er kennt jetzt Ihr Spiel, und die Sicherheit, die ein erster Vorteil gibt, wird seine Kraft verdoppeln. Nun ist der Ehre genug getan, das Renkontre ist ein ernstes gewesen. Lassen Sie es dabei bewenden!«
Vallombreuse sah im stillen die Richtigkeit dieser Gründe ein. Er hatte selbst die Fechtkunst, in der er Vorzügliches zu leisten glaubte, genugsam studiert, um zu begreifen, daß sein Degen, wie gewandt er auch wäre, niemals die Brust Sigognacs erreichen würde. Er mußte, trotz seines Ärgers, diese staunenswürdige Überlegenheit einräumen. Er sah sich sogar gezwungen, sich im stillen zu sagen, daß der Baron ihn geschont und, anstatt ihn niederzustechen, ihm bloß eine Wunde beigebracht habe, die ihn kampfunfähig gemacht. Diese Großmut reizte und erbitterte den Herzog. Besiegt! Ein solcher Gedanke raubte ihm fast den Verstand. Er stimmte anscheinend den Ratschlägen seines Freundes bei, an dem düstern, bösartigen Ausdruck seines Gesichtes aber konnte man erraten, daß sein Gehirn schon die Umrisse zu irgendeinem schwarzen Racheplan entwarf.

»Nun werde ich eine schöne Figur vor Isabella machen«, sagte er, indem er sich zwang zu lachen. »Mit diesem von ihrem Galan durchstochenen Arme! Der invalide Kupido hat bei den Grazien kein Glück.«
»Vergessen Sie diese Undankbare!« bemerkte Vidaline. »Im Grunde genommen konnte sie ja nicht voraussehen, daß ein Herzog auf den Einfall kommen würde, sich in sie zu verlieben. Werden Sie vor allen Dingen erst wieder gesund, dann wollen wir weiter über diese Dinge sprechen. Das viele Reden greift Sie zu sehr an. Versuchen Sie ein wenig zu ruhen, und schlagen Sie sich alles andere aus den Gedanken. Der Arzt würde mich für einen schlechten Krankenwärter erklären, wenn ich Ihnen nicht Ruhe des Geistes sowohl als des Körpers empfehlen wollte.«
Der Verwundete sah die Richtigkeit dieser Bemerkung ein. Er schwieg, schloß die Augen, und es dauerte nicht lange, so schlief er ein.
Sigognac und der Marquis Bruyères waren ruhig in die Herberge »Zum französischen Wappen« zurückgekehrt, wo sie als verschwiegene Ehrenmänner kein Wort von dem Duell verlauten ließen. Die Wände aber, von denen man sagt, daß sie Ohren haben, scheinen nicht minder Augen zu haben, wenigstens sehen sie ebensogut, als sie hören. An jenem anscheinend einsamen Orte hatte mehr als ein neugieriger Blick den Verlauf und Ausgang des Kampfes verfolgt. Das müßige Leben in der Provinz erzeugt viele jener unsichtbaren oder wenig bemerkten Fliegen, die an den Orten, wo etwas geschehen soll, herumsummen, und dann die Nachricht davon überall verbreiten. Beim Frühstück schon wußte ganz Poitiers, daß der Herzog von Vallombreuse in einem Zweikampfe mit einem unbekannten Gegner verwundet wurde. Sigognac, der sehr zurückgezogen in dem Gasthofe lebte, hatte dem Publikum bis jetzt bloß seine Maske, aber nicht sein Gesicht gezeigt. Das Geheimnis reizte die Neugier in nicht geringem Grade, und die Phantasie entwickelte eine ungemeine Tätigkeit, um den Namen des Siegers zu entdecken. Niemand aber kam auf den anscheinend ungereimten Gedanken, daß der wahre Sieger kein anderer als jener Kapitän Fracasse sei, über den man am Abend soviel gelacht hatte. Ein Duell zwischen einem so vornehmen Herrn und einem Komödianten wäre als etwas zu Ungeheuerliches erschienen, als daß man auch nur im entferntesten hätte daran denken können. Obschon man den Gegner nicht gesehen, wurde man doch nicht müde, seine Tapferkeit, Gewandtheit und vornehme Erscheinung zu rühmen. Die Damen, die sich alle über das Benehmen des jungen Herzogs mehr oder weniger zu beklagen hatten, denn er gehörte zu jenen Priestern, deren boshafte Laune den Altar beschmutzt, da sie ihren Weihrauch verbrannt haben, fühlten sich förmlich begeistert für den Unbekannten, der die ihnen im stillen zugefügten Beleidigungen rächte. Gern hätten sie ihn mit Lorbeeren und Myrten gekrönt.
Indessen da nichts unter der Sonne verborgen bleibt, sondern endlich alles an den Tag kommt, so erfuhr man es auch in dem vorliegenden Falle von Meister Bilot. Der hatte von Jacques, dem Diener des Marquis, gehört, der bei der Unterredung Sigognacs und seines Herrn beim Souper der Soubrette zugegen gewesen, daß der unbekannte Held, der Besieger des jungen Herzogs von Vallombreuse, kein anderer sei, als der Kapitän Fracasse, oder, besser gesagt, ein Baron, der aus Liebe Engagement bei der wandernden Schauspielergesellschaft des Sieur Herodes genommen. Den Namen hatte Jacques vergessen. Es war ein Name, der, wie in der Gascogne sehr viele, mit ‑gnac endete; daß es aber ein Baron sei, dies wußte er ganz bestimmt.
Diese wahre, obschon romantische Geschichte hatte in Poitiers großen Erfolg. Man interessierte sich für diesen wackern jungen Edelmann, der eine so gute Klinge führte, und als im Theater der Kapitän Fracasse auftrat, bewies, noch ehe er den Mund aufgetan, ein lang anhaltender Beifall die Gunst, in der er beim Publikum stand. Auch Isabella wurde mit lauterem Beifall als gewöhnlich empfangen, so daß ihr unter der Schminke die Schamröte in die Wangen stieg. Ohne ihre Rolle zu unterbrechen, beantwortete sie diese Beweise von Gunst durch eine bescheidene Verbeugung und ein anmutiges Senken des Kopfes.
Herodes rieb sich vor Freude die Hände, und sein breites fahles Gesicht strahlte wie der Vollmond, denn die Einnahme war glänzend. Alle Welt wollte diesen famosen Kapitän Fracasse sehen, diesen Schauspieler und Edelmann, der sich weder vor Knüppeln noch vor Degen fürchtete und sich als tapferer Verteidiger der Schönheit nicht scheute, sich mit einem Herzog zu messen, der bis jetzt der Schrecken der Tapfersten gewesen. Blasius dagegen versprach sich von diesem Triumph keine guten Folgen. Er fürchtete, und zwar nicht ohne Grund, Vallombreuses Rachsucht, die sicherlich bald Mittel fand, der Truppe irgendeinen schlimmen Streich zu spielen.
»Irdene Töpfe«, sagte er, »müssen, wenn sie auch nicht bei dem ersten Zusammenstoß zerbrechen, es doch vermeiden, sich mit eisernen herumschlagen zu wollen, denn Metall ist härter als Ton.«
Herodes aber, der auf den Beistand Sigognacs und des Marquis vertraute, nannte ihn einen Feigling, Zitterer und Zähneklapperer. Die Schauspieler kehrten in die Herberge zurück, und Sigognac brachte Isabella bis an ihr Zimmer, in das sie ihn gegen ihre Gewohnheit mit eintreten ließ. Eine Aufwärterin zündete ein Licht an, legte Holz aufs Feuer und entfernte sich dann bescheiden.
Als die Tür sich hinter ihr geschlossen hatte, faßte Isabella die Hand des Barons, drückte sie mit mehr Kraft, als man ihren zarten, schlanken Fingern zugetraut hätte und sagte, während ihre Stimme vor Bewegung zitterte:
»Schwören Sie, sich nicht mehr um meinetwillen zu schlagen. Wenn Sie mich so lieben, wie Sie sagen, so schwören Sie es!«
»Das ist ein Eid, den ich nicht leisten kann«, sagte der Baron. »Wenn irgendein Verwegener es wagt, die Ehrerbietung gegen Sie zu verletzen, so werde ich ihn züchtigen, wie ich muß, wäre er Herzog, wäre er Prinz.«
»Bedenken Sie,« hob Isabella wieder an, »daß ich weiter nichts bin als eine arme Komödiantin, die den Zudringlichkeiten des ersten besten ausgesetzt ist. Die durch die Sitten des Theaters leider nur allzusehr gerechtfertigte Meinung der Welt ist die, daß hinter jeder Schauspielerin eine Dirne steckt. Sobald eine Frau den Fuß auf die Bretter gesetzt hat, gehört sie der Öffentlichkeit an. Gierige Blicke mustern ihre Reize, beurteilen ihre Schönheit, und die Phantasie bemächtigt sich ihrer wie einer Geliebten. Jeder glaubt, weil er sie kennt, auch von ihr gekannt zu sein. Dies sind Dinge, welche man dulden muß, weil man sie nicht ändern kann. Verlassen Sie sich darauf, daß ich fortan durch zurückhaltendes Benehmen die Zudringlichkeit der vornehmen Herren aller Art in ihre Grenzen bannen werde, und versprechen Sie mir wenigstens, sich nicht mehr wegen unerheblicher Beweggründe der Gefahr aussetzen zu wollen. Oh, mit welcher Unruhe und Angst erwartete ich Ihre Rückkehr! Ich wußte, daß Sie sich mit diesem Herzog schlagen wollten, von dem jeder mit Angst spricht. Zerbine hatte mir alles erzählt. Böser Mensch, mich auf diese Weise zu martern! Diese Männer denken nicht an die armen Frauen, wenn ihr Stolz in Frage kommt. Sie gehen, ohne unser Schluchzen zu hören, ohne unsere Tränen zu sehen, taub, blind, grausam. Wissen Sie, daß ich Ihren Tod nicht überlebt hätte?«
Die Tränen, die schon bei dem Gedanken an die von Sigognac bestandene Gefahr, in Isabellas Augen glänzten, und das krampfhafte Zittern ihrer Stimme ließen erkennen, daß sie die Wahrheit sprach. Gerührt durch diese aufrichtige Leidenschaft, zog der Baron, indem er Isabella mit seiner freigebliebenen Hand umschlang, sie an seine Brust, ohne daß sie Widerstand leistete, und seine Lippen berührten ihre Stirn, während er ihren Atem an seinem Herzen fühlte.
So blieben sie einige Minuten in eine Ekstase versenkt, die ein weniger ehrerbietiger Liebhaber als Sigognac ohne Zweifel ausgenützt hätte. Ihm aber widerstrebte es, diese durch den Schmerz erzeugte keusche Hingebung zu mißbrauchen.
»Trösten Sie sich, teure Isabella,« sagte er in zärtlich heiterem Tone, »ich bin nicht tot und habe sogar meinen Gegner verwundet, obwohl er für einen sehr guten Fechter gilt.«
»Ich weiß, Sie besitzen ein tapferes Herz und eine feste Hand«, hob Isabella wieder an. »Ich liebe Sie und scheue mich nicht, es Ihnen zu sagen, fest überzeugt, daß Sie meine Offenheit achten und keinen Vorteil daraus ziehen. Als ich Sie so traurig und so verlassen in jenem düstern Schloß sah, in dem Ihre Jugend hinwelkte, fühlte ich zärtliches, wehmütiges Mitleid mit Ihnen. Das Glück verführt mich nicht; sein Glanz schreckt mich zurück. Wären Sie glücklich gewesen, so hätte ich mich vor Ihnen gefürchtet. Bei jenem Spaziergang im Garten, in dem Sie das Dorngestrüpp vor mir auf die Seite bogen, pflückten Sie mir eine kleine wilde Rose, das einzige Geschenk, das Sie mir machen konnten. Ich ließ eine Träne darauf fallen, ehe ich es an meiner Brust befestigte, und schweigend gab ich Ihnen dafür meine Seele.« Da Sigognac diese schönen Worte hörte, wollte er die schönen Lippen, die sie gesprochen hatten, küssen, Isabella aber machte sich ohne affektierte Sprödigkeit, wohl aber mit jener bescheidenen Festigkeit, der ein Mann von Ehre stets nachgibt, von ihm los.
»Ja, ich liebe Sie,« fuhr sie fort, »aber nicht auf die Weise anderer Frauen. Mein Ziel ist nicht mein Vergnügen, sondern Ihr Ruhm. Ich bin es zufrieden, daß man mich für Ihre Geliebte hält, denn dies ist der einzige Beweggrund, der Ihre Gegenwart unter dieser Komödiantentruppe rechtfertigen kann. Was kümmere ich mich um verleumderische Reden, wenn ich nur meine Selbstachtung bewahre und mich tugendhaft weiß. Ein Makel wäre mein Tod. Zweifellos ist es das edle Blut in meinen Adern, das mir diesen Stolz einflößt, der bei einer Komödiantin allerdings sehr lächerlich sein mag, aber ich bin nun einmal so.«
Obschon schüchtern, war Sigognac doch jung. Diese reizenden Geständnisse, die einem Gecken nichts gesagt haben würden, erfüllten ihn mit wonnigem Taumel. Eine lebhafte Röte stieg in seine gewöhnlich so bleichen Wangen. Es war ihm, als wenn Flammen vor seinen Augen zuckten; in den Ohren summte es ihm, und er fühlte die Schläge seines Herzens bis in die Kehle herauf. Gewiß zog er Isabellas Tugend nicht in Zweifel, aber er glaubte, ein wenig Kühnheit werde über ihre Bedenklichkeiten triumphieren. Er hatte sagen hören, daß die Schäferstunde, wenn sie einmal geschlagen hat, nicht wiederkehrt. Er sah Isabella vor sich in dem ganzen Glanze ihrer strahlenden, leuchtenden Schönheit wie eine sichtbare Seele, wie den auf der Schwelle des Paradieses stehenden Engel.
Er ging auf sie zu und umschlang sie mit krampfhafter Glut. Isabella versuchte nicht, sich zu wehren. Sie neigte sich bloß rückwärts, um den Küssen des jungen Mannes auszuweichen und heftete einen vorwurfsvollen, schmerzlichen Blick auf ihn. Aus ihren schönen blauen Augen drangen Tränen, reine, echte Perlen der Keuschheit, die ihre plötzlich bleich gewordenen Wangen herab bis auf Sigognacs Lippen rollten. Ein gepreßtes Schluchzen hob ihre Brust, und ihr ganzer Körper sank zusammen, als ob sie einer Ohnmacht nahe wäre.

Der Baron setzte sie erschrocken in einen Lehnstuhl, kniete vor ihr nieder, ergriff ihre Hände, die sie ihm überließ, bat sie inständig um Verzeihung, entschuldigte sich mit dem Ungestüm seiner Jugend, mit einem augenblicklichen Rausch, den er bereute und durch die vollkommenste Unterwürfigkeit büßen würde.
»Sie haben mir sehr wehe getan«, sagte Isabella endlich mit einem Seufzer. »Ich hatte soviel Vertrauen zu Ihrem Zartgefühl. Das Geständnis meiner Liebe hätte Ihnen genügen und Ihnen eben durch seine Offenheit sagen sollen, daß ich entschlossen sei, ihr nicht nachzugeben. Ich hätte geglaubt, daß Sie mir gestatten würden, Sie nach meiner Weise zu lieben, ohne meine Zärtlichkeit durch sinnliche Aufwallungen zu erschrecken. Dieser Sicherheit haben Sie mich nun beraubt. Ich zweifle allerdings nicht an Ihrem Wort, aber ich wage nicht mehr, meinem Herzen Gehör zu schenken. Und doch war es mir so süß, Sie zu sehen, Sie zu hören, Ihre Gedanken in Ihren Augen zu lesen! Ihre Schmerzen waren es, die ich mit Ihnen zu teilen wünschte, um die Freuden andern zu überlassen. ›Unter allen diesen gemeinen, ausschweifenden, sittenlosen Männern‹, sagte ich bei mir selbst, ›gibt es wenigstens einen, der an die Keuschheit glaubt und das, was er liebt, zu achten weiß.‹ Dies träumte ich. Ich, die Schauspielerin, unaufhörlich durch widerwärtige Aufmerksamkeiten verfolgt, glaubte eine reine Neigung hegen zu können. Ich wollte Sie nur bis an die Schwelle des Glücks führen und dann wieder in den Schatten zurücktreten. Sie sehen, daß ich keine großen Ansprüche machte.«
»Anbetungswürdige Isabella,« rief Sigognac, »jedes Ihrer Worte läßt mich meine Unwürdigkeit immer tiefer empfinden. Ich habe dieses Engelsherz verkannt; ich sollte die Spur Ihrer Füße küssen. Aber fürchten Sie nichts mehr von mir. Der Gatte wird das Feuer des Liebhabers zu dämpfen wissen. Ich besitze nichts als meinen Namen. Er ist rein und makellos wie Sie. Wenn Sie ihn annehmen wollen, so gehört er Ihnen.«
Sigognac lag immer noch vor lsabella auf den Knien. Bei diesen Worten bog sie sich zu ihm herab, faßte ihn mit einer Bewegung überwallender Leidenschaft beim Kopfe und drückte ihm einen raschen Kuß auf die Lippen. Dann erhob sie sich und ging einige Schritte im Zimmer hin und her.
»Sie werden also mein Weib sein!« sagte Sigognac, trunken durch die Berührung dieses Mundes, der frisch war wie eine Blume und doch feurig wie eine Flamme.
»Niemals, niemals!« antwortete Isabella mit außergewöhnlicher Erregung. »Ich werde mich einer solchen Ehre dadurch würdig zeigen, daß ich sie ablehne. Sie achten mich also? Sie würden also wagen, mich mit hoch erhobenem Haupte in die Räume zu führen, in denen die Bildnisse Ihrer Ahnen hängen, in die Kapelle, in der sich die Gruft Ihrer Mutter befindet?«
»Wie?« rief der Baron, »Sie sagen, daß Sie mich lieben, und Sie wollen weder meine Geliebte noch mein Weib sein?«
»Sie haben mir Ihren Namen angeboten, dies genügt. Ich gebe ihn Ihnen zurück, nachdem ich ihn einen Augenblick in meinem Herzen bewahrt habe. Einen Augenblick lang bin ich Ihr Weib gewesen und ich werde niemals einem andern gehören. Während ich Sie küßte, sagte ich mir selbst, ich hatte kein Recht auf so viel Glück in dieser Welt. Für Sie, teurer Freund, wäre es ein großer Fehler, wenn Sie sich mit einer armen Komödiantin wie ich beladen wollten, der man, wie rein und ehrenwert sie auch sein möchte, doch ihr Theaterleben stets zum Vorwurf machen würde. Sie sind der letzte Sprößling eines edlen Geschlechts, und Ihre erste Pflicht ist, Ihr durch widrige Schicksale herabgekommenes Haus wieder zu heben. Als ich Sie durch einen zärtlichen Blick bestimmte, Ihr Schloß zu verlassen, dachten Sie an weiter nichts als an eine kleine Liebelei und Galanterie. Dies war sehr natürlich. Ich aber, die ich der Zukunft vorauseilte, dachte an etwas ganz anderes. Ich sah Sie in prachtvoller Kleidung mit einem schönen Amte vom Hofe zurückkehren. Sigognac gewann wieder seinen alten Glanz. Im Geiste riß ich den Efeu von den Mauern, erneute die Schieferdächer der alten Türme, hob die herabgefallenen Steine empor, vergoldete wieder die verblichenen Störche Ihres Wappenschildes und nachdem ich Sie bis an die Grenzen Ihrer Ländereien geführt, verschwand ich, indem ich einen Seufzer unterdrückte.«
»Ihr Traum wird in Erfüllung gehen, edle Isabella, aber nicht so wie Sie sagen, denn diese Entwicklung wäre eine zu traurige. Sie werden vielmehr zuerst, Ihre Hand in die meine gelegt, jene Schwelle überschreiten, von der das Dorngestrüpp des Verfalls und des Unglücks verschwunden sein wird!«
»Nein, nein, irgend eine schöne, edle und reiche Erbin, Ihrer in jeder Beziehung würdig, wird es sein, die Sie mit Stolz Ihren Freunden zeigen werden, und von der niemand mit schadenfrohem Lächeln sagen wird: Ich habe sie da oder da ausgepfiffen oder ihr applaudiert!«
»Es ist grausam von Ihnen, so zu sprechen«, sagte Sigognac. »Was kann es Barbarischeres geben, als den Himmel zu öffnen und wieder zu schließen? Aber ich werde diesen Entschluß zum Wanken bringen!«
»Versuchen Sie dies nicht«, hob Isabella mit sanfter Festigkeit wieder an. »Er ist unerschütterlich. Ich würde mich selbst verachten, wenn ich ihm entsagte. Begnügen Sie sich daher mit der reinsten, aufrichtigsten und uneigennützigsten Liebe, die jemals das Herz eines Weibes beseelt hat, aber verlangen Sie nichts weiter. Ist es denn so peinlich,« setzte sie lächelnd hinzu, »von einer Naiven geliebt zu werden?«
»Sich geben und sich völlig verweigern, in denselben Becher diese Süßigkeit und diese Bitterkeit, diesen Honig und diesen Wermut; nur Sie sind eines solchen Gegensatzes fähig.«
»Ja, ich bin ein seltsames Mädchen«, hob Isabella an. »Das habe ich von meiner Mutter. Aber so wie ich bin, muß man mich nehmen. Also, abgemacht, und da es schon spät ist, gehen Sie in Ihr Zimmer und treffen Sie die nötigen Abänderungen in dem Stück, das wir nächstens spielen wollen und in dem einige Verse weder mit meinem Aussehen noch mit meinem Charakter harmonieren. Ich bin ihre kleine Freundin, seien Sie mein großer Poet!«
Bei diesen Worten zog sie aus einem Schubfache eine mit einem rosenfarbenen Bande zusammengebundene Rolle, die sie dem Baron von Sigognac übergab.
»Jetzt küssen Sie mich und gehen Sie,« sagte sie, indem sie ihm die Wange darbot. »Sie werden für mich arbeiten, und jede Arbeit ist ihres Lohnes wert.«
In sein Zimmer zurückgekehrt, brauchte Sigognac lange Zeit, ehe er sich von der Gemütsbewegung erholen konnte, die dieser Auftritt ihm verursacht hatte. Er war gleichzeitig verzweifelt und entzückt, strahlend und düster, im Himmel und in der Hölle, er lachte und weinte, erfüllt von den stürmischsten und widersprechendsten Gefühlen. Die Freude, von einer so schönen Person und einem so edlen Herzen geliebt zu werden, ließ ihn frohlocken, aber die Gewißheit, niemals sie besitzen zu dürfen, stürzte ihn wieder in tiefe Niedergeschlagenheit. Allmählich beruhigten sich diese wild aufgeregten Wogen, und er ward wieder ruhig. Seine Gedanken nahmen die von Isabella gesprochenen Worte eines nach dem andern wieder auf, um sie näher zu erwägen, und das von ihr heraufbeschworene Bild des neu erbauten Schlosses Sigognac bot sich seiner erhitzten Einbildungskraft mit den lebhaftesten und stärksten Farben dar. Er war wie aus einem Traume erwacht.
Die Fassade des Schlosses strahlte weiß im Sonnenschein, und die neuvergoldeten Wetterfahnen stachen glänzend gegen den blauen Himmel ab. Pierre stand mit einer kostbaren Livree angetan zwischen Miraut und Beelzebub unter dem großen Wappentor und erwartete seinen Herrn. Aus den so lange erloschenen Schornsteinen stiegen lustige Rauchwolken empor und zeigten, daß das Schloß mit einer zahlreichen Dienerschaft bevölkert und daß der Überfluß darin zurückgekehrt war. Er sah sich selbst in einem ebenso eleganten als prachtvollen Kleid mit funkelnder Stickerei, während er Isabella, die ein wahrhaft fürstliches Gewand trug, dem Schlosse seiner Ahnen zuführte. Eine Herzogskrone glänzte auf ihrer Stirn. Isabella aber schien deswegen nicht stolzer zu sein, sondern bewahrte ihre zärtliche, bescheidene Miene und hielt in ihrer Hand die kleine Rose, das Geschenk Sigognacs, das trotz der Zeit nichts von seiner Frische verloren. Als das junge Paar sich dem Schlosse näherte, kam ein Greis von dem ehrwürdigsten und majestätischsten Ansehen, auf dessen Brust mehrere Orden funkelten und dessen Züge Sigognac gänzlich unbekannt waren, einige Schritte aus der Vorhalle hervor, wie um die Neuvermählten willkommen zu heißen. Was aber den Baron ganz besonders wunder nahm, war, daß neben dem Greis ein junger Mann von der stolzesten Haltung stand, dessen Züge er nicht sogleich erkannte, der ihm aber sehr bald der Herzog von Vallombreuse zu sein schien. Der junge Mann lächelte ihnen freundlich zu und hatte nicht mehr seinen übermütigen Ausdruck. Die Gutsuntertanen riefen unter lebhaftesten Freudenbezeugungen: »Es lebe Isabella! es lebe Sigognac!«
Plötzlich ließ durch den Tumult des Beifallsrufes eine Jagdfanfare sich hören, und es dauerte nicht lange, so kam eine Amazone, deren Züge große Ähnlichkeit mit denen Yolandes hatten, aus dem Dickicht hervorgesprengt. Sie streichelte den Hals ihres Pferdes mit der Hand, ließ es langsamer gehen und ritt so an dem Schlosse vorüber. Sigognac folgte unwillkürlich mit den Augen der stolzen Jägerin. Je mehr er sie aber ansah, desto bleicher und farbloser wurde die Vision. Yolande verschwand vor Isabellas Wirklichkeit wie eine verworrene Erinnerung. Die wahre Liebe verscheuchte die ersten Träume des Jünglingsalters.
In der Tat hatte in diesem verfallenen Schlosse, in dem das Auge sich nur an dem Schauspiel der Verödung und des Mangels weiden konnte, der Baron traurig, halb im Schlafe und mehr wie ein Schatten als wie ein Mensch bis zum Tage seiner ersten Begegnung mit Yolande de Foix, die auf der öden Ebene jagte, gelebt. Bis dahin hatte er nur von der Sonnenhitze gebräunte Bäuerinnen, schmutzige Hirtenweiber gesehen, Weibspersonen, aber keine Frauen. Diese Vision hatte den Jüngling geblendet, als wenn er in die Sonne geblickt hätte. Fortwährend hatte er vor seinen Augen, selbst wenn er sie schloß, diese strahlende Gestalt tanzen gesehen, die ihm andern Sphären anzugehören schien. Yolande war allerdings unvergleichlich schön und wohl geeignet, noch ganz andere Kavaliere zu bestricken, als einen armen Krautjunker, der in den zu weiten Kleidern seines Vaters auf einem hektischen Gaul spazieren ritt. Bei dem durch seine groteske Erscheinung hervorgerufenen Lächeln hatte Sigognac aber gefühlt, wie lächerlich er sich machen würde, auch nur die geringste Hoffnung auf diese übermütige Schönheit zu nähren. Er hatte deshalb Yolande gemieden, oder sich, um sie zu sehen, ohne von ihr bemerkt zu werden, hinter einer Hecke oder einem Baumstamm verborgen, an den Wegen, die sie gewohnt war mit ihrem Gefolge von Kavalieren einzuschlagen. An diesen Tagen kehrte er voll bitterer Traurigkeit im Herzen, bleich, niedergeschlagen und wie krank in das Schloß zurück, setzte sich in den Winkel des Kamins und sprach oft stundenlang kein Wort.
Das Erscheinen lsabellas in dem Schloß hatte diesem unklaren Bedürfnis nach Liebe, das die Jugend quält und in der Untätigkeit sich an Unmöglichkeiten klammert, ein Ziel gegeben. Die Anmut, die Sanftheit, die Bescheidenheit der jungen Schauspielerin hatte Sigognac in der innersten Seele gerührt, und er liebte sie wirklich sehr. Sie hatte die Wunde geheilt, die Yolandes Verachtung ihm geschlagen.
Nachdem Sigognac längere Zeit diesen Träumereien nachgehangen, rüttelte er sich aus ihnen auf, und nicht ohne Mühe gelang es ihm endlich seine Aufmerksamkeit auf das Stück zu heften, das Isabella ihm zur Überarbeitung einer Stelle gegeben hatte.
Er strich mehrere Verse, die mit dem Aussehen der Trägerin nicht in Einklang standen, und ersetzte sie durch einige andere. Er strich auch die Liebeserklärung des Anbeters ebenfalls als kalt und hölzern und schrieb dafür eine andere, die weit natürlicher, leidenschaftlicher und wärmer war, denn er richtete sie in seinen Gedanken an Isabella selbst.
Diese Arbeit beschäftigte ihn bis tief in die Nacht hinein, doch erledigte er sie zu seiner Zufriedenheit und wurde dafür den nächstfolgenden Tag durch ein freundliches Lächeln Isabellas belohnt, die sofort die Verse zu lernen begann, die ihr Dichter, wie sie ihn nannte, für sie geschrieben.
Bei der Vorstellung an diesem Abend war die Zuschauermenge noch beträchtlicher als am Abend vorher.
Der Ruf des Kapitäns Fracasse, des Besiegers des Herzogs von Vallombreuse, stieg mit jeder Stunde und erreichte eine fabelhafte Höhe. Einige junge Edelleute, Feinde des Herzogs, sprachen davon, die Freundschaft dieses tapferen Kämpfers zu suchen und ihn einzuladen, mit ihnen im Wirtshause zu zechen. Mehr als eine Dame ging mit dem Gedanken um, ihm ein galantes Briefchen zu schreiben und hatte bereits fünf oder sechs mißratene Konzepte ins Feuer geworfen. Kurz, er war Mode, und man schwur nur noch bei seinem Namen.
Es lag ihm an dem Erfolge, der ihn aus dem Dunkel, in dem er gern geblieben wäre, hervorzog, durchaus nicht viel, aber es war ihm auch nicht möglich, sich ihm zu entziehen. Er mußte sich dareinfügen. Einen Augenblick lang hegte er den Gedanken, sich zu verstecken, und nicht auf der Bühne zu erscheinen. Er dachte aber auch zugleich an die Verzweiflung, in die er dadurch den Tyrannen versetzen würde, der über die ungeheuren Einnahmen, die er jetzt machte, ganz außer sich war, und dieser Umstand hielt ihn ab, seinen Plan auszuführen. Diese wackeren Schauspieler, die ihm in seinem Elende beigestanden, hatten unstreitig ein Recht, von dem unerwarteten Enthusiasmus, den er erregte, Nutzen zu ziehen. Deshalb fügte er sich in seine Rolle, band seine Maske vor, schnallte seinen Degen um, zog seinen Mantel über die Schulter und wartete, bis der Regisseur ihm sagen würde, daß er an der Reihe sei.
In der Hoffnung, den Kapitän Fracasse zu erobern, hatten die Damen der Stadt sich auf das Schönste herausgeputzt. Nicht ein einziger Diamant blieb in seinem Etui, und alles glänzte und funkelte auf mehr oder weniger weißen Brüsten und auf mehr oder weniger schönen Köpfen, die aber alle von dem lebhaften Wunsche zu gefallen beseelt wurden.
Eine einzige Loge war noch leer, gerade die beste im ganzen Saale, und die Augen der Zuschauer richteten sich neugierig nach dieser Richtung. Herodes schien, indem er ein wenig hinter dem Vorhange hervorlugte, nur noch auf diese nachlässigen Zuschauer zu warten, um das Zeichen zum Beginn des Stückes zu geben, denn nichts ist abscheulicher im Theater, als dieses verspätete Kommen der Zuschauer, die dann mit Geräusch ihre Plätze einnehmen und dadurch die Aufmerksamkeit von der Bühne ablenken.
Eben als der Vorhang aufging, nahm eine junge Dame in der Loge Platz, und neben sie setzte sich mühsam ein alter Herr von ehrwürdigem, patriarchalischem Ansehen. Langes weißes Haar fiel in silbernen Locken von den Schläfen des alten Herrn, während der obere Teil des Schädels blank und kahl war wie Elfenbein. Es war leicht, in diesem Greise einen Onkel zu erraten, der sich durch eine trotz ihrer Launen angebetete Nichte in eine Hofmeisterin verwandelt sah. Wenn man sie so beide, die Dame schlank und leicht, ihn schwerfällig und mürrisch, sah, so dachte man unwillkürlich an Diana mit einem alten, halbgezähmten Löwen an der Leine zu ihrer Seite, der lieber in seiner Höhle läge und schliefe, anstatt sich so in der Welt herumführen zu lassen, der sich aber in sein Schicksal ergeben hatte.
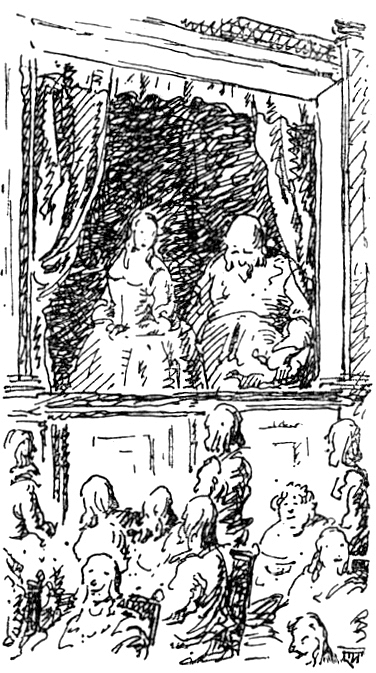
Das Kostüm der jungen Dame bewies durch seine Eleganz Reichtum und Rang ihrer Trägerin. Schon war der ganze Saal von dieser Schönheit geblendet, obschon sie noch nicht ihre Maske abgenommen hatte. Was man aber sah, entsprach dem Übrigen. Das zarte, feingeformte Kinn, der vollendete Schnitt des Mundes, dessen Erdbeerenröte durch die Nähe des schwarzen Samtes der Maske gewann, das längliche, anmutige und feine Oval des Gesichts, die ideale Vollkommenheit eines wunderniedlichen Ohres, das man von Benvenuto Cellini in Achat gemeißelt glauben konnte, – alles dies war ein hinreichender Beweis von beneidenswerten göttlichen Reizen.
Bald nahm, offenbar durch die Wärme des Saales belästigt, oder vielleicht weil sie den Sterblichen eine Gnade erzeigen wollte, die junge Gottheit das neidische Stück Samt ab, das die Hälfte ihres Glanzes verdunkelte. Nun sah man ihre herrlichen Augen, deren durchsichtige Sterne zwischen den langen Wimpern von gebräuntem Gold glänzten, und ihre von fast unbemerkbarer Röte angehauchten Wangen, neben denen die Farbe der frischesten Rose erdig und fahl erschienen wäre.
Es war Yolande de Foix. Yolande sandte einen Blick über den aufgeregten Zuschauerraum und stützte sich mit dem Arm auf den Rand der Loge und mit der Wange auf die Hand in einer Stellung, die den Ruf eines Bildhauers oder Bildschneiders begründet hätte, wenn ein Künstler, wäre es nun ein Grieche oder Römer, überhaupt eine Attitüde von dieser ungewollten Anmut und dieser natürlichen Eleganz erfinden könnte.
»Vor allem, lieber Onkel, bitte ich dich, nicht einzuschlafen«, sagte sie mit halber Stimme zu dem alten Herrn, der sofort die Augen aufriß und sich auf seinem Platze emporrichtete. »Es wäre dies nicht liebenswürdig gegen mich und widerspricht den Gesetzen der altmodischen Galanterie, die du doch fortwährend rühmst.«
»Sei unbesorgt, liebe Nichte«, entgegnete der alte Herr. »Wenn die Fadheiten und Gemeinplätze, die diese Kulissenreißer, deren Leistungen mich sehr wenig interessieren, zum besten geben, mich allzusehr langweilen, so brauche ich ja nur dich anzusehen, um sofort wieder munter zu werden.«
Während dieses Gespräches Yolandes mit ihrem Onkel trat der Kapitän Fracasse, der wie ein weit aufgerissener Zirkel marschierte, bis dicht an die Lichter vor, rollte die Augen wütend hin und her und geberdete sich auf die groteskeste Weise, die man sich denken kann.
Lauter Beifall brach bei dem Erscheinen des beliebten Schauspielers sofort von allen Seiten los, und die Aufmerksamkeit wandte sich einen Augenblick von Yolande ab. Sigognac war ganz gewiß nicht eitel, und sein Adelsstolz verachtete dieses Komödiantenhandwerk, zu dem ihn die Notwendigkeit zwang. Dennoch kann man nicht behaupten, daß sein Selbstbewußtsein sich durch diesen warmen und geräuschvollen Beifall nicht ein wenig geschmeichelt gefühlt hätte. Als das Händeklatschen aufgehört hatte, sandte der Kapitän Fracasse in den Zuschauerraum jenen Blick, den der Schauspieler niemals zu werfen verfehlt, um sich zu überzeugen, ob die Bänke gut besetzt sind, und um die heitere oder mürrische Stimmung des Publikums zu erraten, wonach er sein Spiel einrichtet und sich Freiheiten gestattet oder versagt.
Plötzlich war es dem Baron, als würde er geblendet. Die Lichter wurden groß wie Sonnen und schienen dann gegen den leuchtenden Hintergrund förmlich schwarz zu werden. Die Köpfe der Zuschauer, die er verworren zu seinen Füßen erblickte, verschwammen in eine Art gestaltenlosen Nebel. Ein siedendheißer und gleich darauf eisigkalter Schweiß benetzte ihn von der Wurzel des Haares bis zur Ferse. Seine Beine, die plötzlich weicher geworden zu sein schienen als Baumwolle, knickten unter ihm zusammen, und er glaubte, der Fußboden des Theaters reiche ihm bis an den Gürtel herauf. Sein ausgetrockneter Mund hatte keinen Speichel mehr, ein eiserner Ring schnürte ihm die Gurgel zusammen, und die Worte, die er sprechen sollte, flogen scheu und wild durcheinander aus seinem Gehirn wie Vögel aus dem plötzlich geöffneten Käfig. Kaltblütigkeit, Selbstbeherrschung, Gedächtnis – alles war mit einem Male hinweg. Es war, als ob ihn ein unsichtbarer Blitzstrahl getroffen hätte, und es fehlte nicht viel, so wäre er tot mit der Nase in die Lichter hineingestürzt. Er hatte Yolande de Foix bemerkt, die ruhig und strahlend in ihrer Loge saß und ihre schönen grünlich blauen Augen auf ihn geheftet hielt.
Er blieb stumm, verdutzt und verblüfft stehen, zum großen Erstaunen Scapins, der in der Meinung, dem Kapitän Fracasse sei plötzlich das Gedächtnis untreu geworden, ihm leise die ersten Worte der Tirade soufflierte.
Das Publikum glaubte, der Schauspieler verlange, ehe er anfinge, eine zweite Salve von Beifall, und begann in die Hände zu klatschen und mit den Füßen zu stampfen und lautestes Triumphgeschrei zu machen, das man jemals in einem Theater gehört. Dies gab Sigognac Zeit, sich wieder zu sammeln. Er machte eine gewaltige Willensanstrengung und setzte sich wieder in den Besitz seiner Mittel und Fähigkeiten.
»Wir wollen wenigstens den Ruhm unserer Schmach ernten«, sagte er bei sich selbst, indem er sich fest auf die Füße stellte. »Es fehlte nur noch, vor ihr ausgepfiffen und mit faulen Äpfeln und Eiern beworfen zu werden. Vielleicht erkennt sie mich gar nicht hinter dieser gemeinen Maske. Wer würde auch in diesem rot und gelb gestreiften Kostüme eines dressierten Affen einen Sigognac vermuten? Vorwärts denn und Mut gefaßt! Wenn ich gut spiele, so wird sie mir applaudieren, und dies wird auch ein schöner Triumph sein.«
Dann ließ er seine große Tirade los, mit so eigentümlicher und unerwarteter Intonation und einer so komischen, verteufelten Wut, daß das Publikum laut Bravo schrie, und selbst Yolande, obschon sie tat, als ob sie an dergleichen Possen keinen Geschmack fände, sich nicht enthalten konnte, zu lächeln. Der unglückliche, verzweifelte Sigognac schien durch die Übertreibung seines Spiels und den Wahnsinn seiner Rodomontaden sich selbst äffen und die Verhöhnung seines Schicksals bis zu der äußersten Grenze treiben zu wollen. Würde, Adel, Selbstachtung, Ahnenstolz – alles warf er von sich und trat darauf mit wahnsinniger, grausamer Freude herum.
Nur Isabella hatte erraten, was die Unruhe und Aufregung des Barons erweckt hatte – die Anwesenheit jener übermütigen Jägerin, deren Züge sich ihrem Gedächtnis nur zu tief eingeprägt hatten. Während sie ihre Rolle auf der Bühne spielte, wendete sie daher ihre Augen verstohlen nach der Loge, wo mit dem verächtlichen ruhigen Stolze einer ihrer selbst sicheren Vollkommenheit die hochmütige Schönheit thronte, die sie in ihrer Demut nicht ihre Nebenbuhlerin zu nennen wagte. Sie fand sogar einen bittern Genuß daran, diese unbesiegbare Überlegenheit im stillen anzuerkennen und sagte sich, kein Weib könnte mit einer solchen Göttin durch ihr Äußeres wetteifern.
Sigognac hatte sich vorgenommen, Yolande nicht anzusehen, denn er fürchtete plötzlich wieder, die Geistesgegenwart zu verlieren und sich öffentlich eine beschämende Entgleisung zuschulden kommen zu lassen. Er war im Gegenteil bemüht, sich zu beruhigen, indem er seine Augen, sooft seine Rolle es gestattete, auf die sanfte und gute Isabella gerichtet hielt.
Diese Qual hatte aber auch ein Ende. Der Vorhang fiel, und als Sigognac, der fast erstickte, in die Kulissen zurücktrat und seine Maske abnahm, waren seine Kameraden von der seltsamen Veränderung seiner Züge betroffen. Er war leichenblaß und sank wie ein lebloser Körper auf eine zufällig in der Nähe stehende Bank nieder.
Da Blasius sah, daß er einer Ohnmacht nahe war, so holte er rasch eine Flasche Wein und sagte, daß in derartigen Fällen nichts wirksamer sei als ein paar Schlucke vom besten. Sigognac gab jedoch durch eine Gebärde zu verstehen, daß er nur Wasser wolle.
»Das ist eine verdammte und höchst schädliche Diät«, sagte der Pedant. »Wasser ist wohl für Frösche, Fische und Enten gut, niemals für Menschen. Jede Wasserflasche sollte mit der Aufschrift versehen sein: ›Mittel zum äußeren Gebrauch.‹ Ich stürbe sofort bei lebendigem Leibe, wenn ich von dieser faden Flüssigkeit auch nur einen Tropfen genösse.«
Die Schlußfolgerungen des Pedanten hielten den Baron jedoch nicht ab, ein Glas Wasser hinunterzustürzen. Die Frische des Getränkes stellte ihn vollkommen wieder her, und er begann weniger scheue Blicke um sich zu werfen. Isabella, die sich mittlerweile für das zweite Stück angekleidet hatte, ging in diesem Augenblick an Sigognac vorüber und warf ihm, ehe sie die Bühne betrat, einen so teilnahmsvollen, zärtlichen und leidenschaftlichen Engelsblick des Trostes zu, daß er Yolande darüber ganz vergaß und sich nicht mehr unglücklich fühlte.

Der Marquis von Bruyères war auf seinem Posten, und wie eifrig beschäftigt er auch während der Vorstellung war, Zerbine zu applaudieren, so versäumte er im Zwischenakte doch nicht, Yolande zu begrüßen, die er kannte, und mit der er zuweilen auf die Jagd ritt. Er erzählte ihr, ohne den Baron zu nennen, das Duell des Kapitäns Fracasse mit dem Herzog von Vallombreuse in allen Einzelheiten, die er als Sekundant eines der beiden Gegner natürlich besser kannte als sonst jemand.
»Sie spielen den Verschwiegenen zur Unzeit«, antwortete Yolande. »Ich habe längst erraten, daß der Kapitän Fracasse niemand anders ist als der Baron von Sigognac. Sah ich ihn doch seinen Eulenturm in Gesellschaft dieser Person, dieser Zigeunerin verlassen, die mit so heuchlerisch frommer Miene die Liebhaberin spielt!« setzte sie mit ein wenig gezwungenem Gelächter hinzu. »Und befand er sich nicht zugleich mit den übrigen Komödianten in Ihrem Schlosse? An seiner albernen Miene hätte ich ihm niemals angesehen, daß er ein so vollkommener Schauspieler und so tapferer Kämpfer ist.«
Während der Marquis mit Yolande plauderte, ließ er seine Blicke in dem Saal umherschweifen, den er von hier besser überschauen konnte als von dem Platz, den er gewöhnlich, um Zerbinens Spiel besser folgen zu können, hinter den Violinen einnahm. Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf die maskierte Dame, die er bis jetzt noch nicht bemerkt, weil er selbst den Zuschauern, von denen er nicht sehr bemerkt zu sein wünschte, fast immer den Rücken zukehrte. Obschon die maskierte Dame unter ihren schwarzen Spitzen gleichsam begraben war, so glaubte er doch in der Haltung und Bewegung dieser geheimnisvollen Schönheit etwas zu erkennen, das ihn in unbestimmter Weise an die Marquise, seine Gemahlin, erinnerte.
»Ach, was da!« sagte er bei sich selbst, »die muß ja im Schlosse Bruyères sein, wo ich sie zurückgelassen.«
Indessen ließ sie an einem Finger der Hand, die sie kokett auf den Rand der Loge gelegt hatte, einen ziemlich großen Diamanten funkeln, den sie gewöhnlich zu tragen pflegte. Durch diese Wahrnehmung doch ein wenig beunruhigt, beurlaubte sich der Marquis bei Yolande und dem alten Kavalier, um sich Gewißheit zu verschaffen. Er ging jedoch hierbei nicht schnell genug, denn als er die Loge erreichte, war das Nest leer und der Vogel ausgeflogen. Die Dame war aufgescheucht und fort. Obschon ein sehr philosophischer Ehemann, kam der Marquis doch auf allerlei Gedanken.
»Sollte sie wirklich in diesen Leander verliebt sein?« murmelte er. »Zum Glück habe ich den Gecken schon im voraus durchprügeln lassen und bin ihm folglich nichts schuldig.«
Dieser Gedanke gab ihm seine Heiterkeit wieder, und er ging hinter den Vorhang zu der Soubrette, die sich schon wunderte, daß er noch nicht da war.

Nach der Vorstellung begab sich Leander, der über das plötzliche Verschwinden der Marquise mitten in der Vorstellung beunruhigt war, auf den Platz vor der Kirche an die Stelle, wo der Page ihn gewöhnlich mit dem Wagen abholte. Er traf hier den Boten, der ihm einen Brief und eine kleine, sehr schwere Schachtel zustellte und dann so rasch in der Dunkelheit verschwand, daß der Komödiant an der Wirklichkeit der Erscheinung hätte zweifeln können, wenn nicht der Brief und das Paket in seinen Händen zurückgeblieben wären. Leander rief einen Lakaien heran, der eben mit einer Laterne vorbeiging, um seinen Herrn aus einem benachbarten Hause abzuholen, erbrach mit hastiger, zitternder Hand das Siegel, näherte das Papier der Laterne, die der Lakai ihm vor die Nase hielt, und las folgende Zeilen:
»Lieber Leander!
Ich fürchte, daß mein Gemahl mich im Theater trotz meiner Maske erkannt hat. Er heftete seine Blicke so unverwandt auf meine Loge, daß ich mich in aller Eile entfernte, um nicht von ihm ertappt zu werden. Die Klugheit, diese Feindin der Liebe, gebietet, daß wir uns heute nacht in dem Pavillon nicht sehen. Man könnte Ihnen auflauern, Ihnen nachschleichen, ja, Sie vielleicht umbringen, abgesehen von den Gefahren, die mir selbst dabei drohen könnten. Warten wir glücklichere und bequemere Gelegenheiten ab, und tragen Sie einstweilen die dreifache goldene Kette, die mein Page Ihnen zustellen wird. Möge sie, sooft Sie den Schmuck um den Hals hängen, Sie an die Person erinnern, die Sie niemals vergessen, sondern stets lieben wird – die Person, die für Sie keinen anderen Namen führt als
Marie.«
»Ach, nun ist also mein schöner Roman zu Ende«, sagte Leander bei sich selbst, indem er dem Lakai, der ihm die Laterne geliehen, ein Trinkgeld gab. »Das ist schade. Ach, reizende Marquise, wie lange würde ich dich geliebt haben!« fuhr er, als der Lakai sich entfernt hatte, fort. »Das eifersüchtige Schicksal gestattet es aber nicht. Sei unbesorgt, teures Wesen! Ich werde dich nicht durch Zudringlichkeit in Verlegenheit oder Gefahr bringen. Dieser Tyrann von Ehemann würde mich ohne Erbarmen niederstechen und dann das Eisen selbst in deine weiße Brust stoßen. Nein, nein, nichts von diesen Greueltaten, die sich besser für das Theater als für das gewöhnliche Leben eignen. Sollte mir auch das Herz verbluten, so werde ich doch nicht suchen, dich wiederzusehen, sondern mich begnügen, diese Kette zu küssen, die weniger zerreißbar und schwerer ist als die, welche uns einen Augenblick lang umschlungen gehalten. Wieviel mag sie wohl wert sein? Nach der Schwere zu urteilen, wenigstens tausend Dukaten.«
Und begierig, seine goldene Kette bei Licht funkeln zu sehen, begab er sich mit Schritten, die bei einem Liebhaber, der soeben seinen Abschied bekommen hatte, sehr ruhige und bedächtige genannt werden mußten, in die Herberge »Zum französischen Wappen« zurück.
Als Isabella in ihr Zimmer trat, fand sie mitten auf dem Tisch eine Kassette. Ein zusammengefaltetes Blatt lag unter einer der Ecken des Kästchens, das sehr kostbare Dinge enthalten mußte, denn es war schon an und für sich eine Kostbarkeit. Das Papier war nicht versiegelt und enthielt die wie von zitternder Hand, die des freien Gebrauches entbehrt, geschriebenen Worte: »Für Isabella.«
Die Röte der Entrüstung stieg in die Wangen der Schauspielerin beim Anblicke dieser Geschenke, durch die mehr als eine Tugend wankend geworden wäre. Ohne auch nur aus weiblicher Neugier das Kästchen zu öffnen, rief sie Meister Bilot, der noch nicht schlafen gegangen war, sondern ein Souper für einige Herren bereitete, und sagte ihm, er solle dieses Kästchen mitnehmen und dem Eigentümer zurückgeben, denn sie wolle es auch nicht eine Minute länger in ihrem Besitze dulden. Der Gastwirt spielte den Erstaunten und schwur hoch und teuer, daß er nicht wisse, wer dieses Kästchen hierhergebracht, obschon er vermute, woher es komme. In der Tat war es Dame Leonarda, an die der Herzog sich gewendet, denn er meinte, ein altes Weib setze oft etwas durch, was selbst dem Teufel nicht gelinge, und sie war es, die das Juwelenkästchen heimlich auf den Tisch gestellt hatte.
»Nehmen Sie das weg,« sagte Isabella zu Meister Bilot; »geben Sie dieses widerwärtige Geschenk dem zurück, der es geschickt hat, und vor allem lassen Sie kein Wort davon gegen den Kapitän verlauten! Obschon mein Verhalten durchaus unsträflich gewesen ist, so könnte er doch in Zorn geraten und Dinge unternehmen, durch die mein Ruf leiden würde.«
Meister Bilot bewunderte die Uneigennützigkeit der jungen Schauspielerin, die Geschenke, gemacht, einer Herzogin den Kopf zu verdrehen, nicht einmal ansah, sondern verächtlich zurückschickte wie taube Nüsse. Er verabschiedete sich auf die ehrerbietigste Weise, ganz so, wie er eine Königin begrüßt haben würde; so sehr setzte diese Tugend ihn in Erstaunen.
Aufgeregt und fieberhaft öffnete Isabella, nachdem Meister Bilot sich entfernt, das Fenster, um in der kühlen Nachtluft das Feuer ihrer Wangen und ihrer Stirn zu löschen. Ein Licht glänzte durch die Äste der Bäume an der schwarzen Fassade des Schlosses Vallombreuse, ohne Zweifel in der Wohnung des verwundeten jungen Herzogs. Das Gäßchen schien ganz menschenleer zu sein, dennoch glaubte Isabella mit dem feinen Ohr der Schauspielerin, das gewöhnt ist, das Murmeln des Souffleurs im Fluge zu erhaschen, eine gedämpfte Stimme zu hören, die sagte:
»Sie schläft noch nicht.«
Beunruhigt durch diese Worte bog sie sich ein wenig zum Fenster hinaus, und es war ihr, als sähe sie im Dunkel am Fuße der Mauer zwei in Mäntel gehüllte menschliche Gestalten, die sich völlig unbeweglich hielten wie steinerne Statuen am Portal einer Kirche. Am andern Ende des Gäßchens entdeckten ihre durch die Furcht geschärften Augen trotz der Finsternis eine dritte unheimliche Gestalt, die aufzupassen schien. Als die rätselhaften Wesen sich bemerkt sahen, verschwanden sie, oder versteckten sich sorgfältiger, denn Isabella sah und hörte nichts weiter. Ermüdet durch das Hinausschauen und in der Meinung, daß sie vielleicht doch nur der Spielball einer nächtlichen Täuschung gewesen, schloß sie leise das Fenster, verriegelte ihre Tür von innen, setzte das Licht neben ihr Bett und legte sich nieder, erfüllt von einer unbestimmten Angst, die sie selbst durch alle Vernunftgründe nicht beschwichtigen konnte. Eine bange Ahnung schnürte ihr die Brust zusammen. Wenn sie nicht gefürchtet hätte, verspottet zu werden, so wäre sie aufgestanden und hätte sich zu einer ihrer Kolleginnen begeben, aber Zerbine war nicht allein, Serafina war ihr nicht gewogen, und Leonarda flößte ihr instinktartigen Widerwillen ein. Sie blieb daher die Beute unaussprechlicher Befürchtungen.
Dann faßte sie wieder Mut und schaute sich rings im Zimmer um, wo nirgends etwas Verdächtiges oder Übernatürliches zu bemerken war. In dem oberen Teile einer der Wände des Zimmers war ein rundes Fenster, ein sogenanntes Ochsenauge, angebracht, das ohne Zweifel bestimmt war, irgendein dunkles Kabinett zu erhellen. Dieses Fenster sah in dem schwachen Lichtschimmer auf der schwarzgrauen Wand aus wie der ungeheure schwarze Stern eines Zyklopenauges und schien das Tun und Treiben der jungen Dame zu belauern. Isabella konnte nicht umhin, unverwandt dieses schwarze, finstere Loch zu betrachten, das übrigens mit zwei gekreuzten Eisenstangen vergittert war. Von dieser Seite her war also nichts zu fürchten. Dennoch glaubte Isabella in einem gewissen Augenblick im Hintergrunde dieses Schattens zwei menschliche Augen funkeln zu sehen.
Bald kam ein braunes Gesicht mit langem, schwarzem, verworrenem Haar durch eine der engen Abteilungen des Eisengitters hindurch. Dann folgte ein magerer Arm, dann die Schultern, und ein kleines Mädchen von acht bis zehn Jahren streckte, indem sie sich mit der Hand am Rande der Öffnung festhielt, ihren armseligen schwachen Körper längs der Wand so lang als möglich aus und ließ sich dann auf den Fußboden fallen, ohne dabei mehr Geräusch zu machen, als eine Feder oder eine Schneeflocke, die zu Boden fällt.
Aus der Unbeweglichkeit der vor Angst gleichsam versteinerten Isabella schloß die Kleine, daß sie schliefe, und als sie sich dem Bett näherte, um sich zu überzeugen, ob dieser Schlaf ein fester wäre, malte sich außerordentliches Erstaunen in ihrem schwarzbraunen Gesicht.
»Die Dame mit dem Halsband!« sagte sie, indem sie die Perlen berührte, die an ihrem magern braunen Halse klapperten, »die Dame mit dem Halsband!«
Isabella erkannte, obschon halbtot vor Furcht, sofort das kleine Mädchen, das sie in der Herberge »Zur blauen Sonne« und auf der Straße nach Bruyères in Agostins Gesellschaft gesehen. Sie wollte um Hilfe rufen, die Kleine hielt ihr aber die Hand auf den Mund.
»Schreie nicht; du läufst keine Gefahr. Chiquita hat gesagt, daß sie der Dame, die ihr die Perlen gegeben, als sie sie ihr stehlen wollte, niemals den Hals abschneiden würde.«
»Aber was willst du hier, unglückliches Kind?« fragte Isabella, indem sie beim Anblick dieses schwachen, gebrechlichen Wesens, das nicht sehr furchtbar sein konnte und übrigens eine gewisse wilde seltsame Dankbarkeit gegen sie an den Tag legte, ihre Kaltblütigkeit bis zu einem gewissen Grade wiedergewann.
»Den Riegel zurückziehen, den du alle Abende vorschiebst«, hob Chiquita im ruhigsten Tone wieder an und als ob ihr an der Rechtmäßigkeit ihres Handelns nicht der mindeste Zweifel beiginge. »Man hat mich hierzu ausersehen, weil ich behend und schlank bin wie eine Natter. Es wird nicht viel Löcher geben, durch die ich nicht hindurchkriechen könnte.«
»Und warum hat man dich beauftragt, den Riegel zu öffnen? Um mich zu bestehlen?«
»O nein«, antwortete Chiquita mit verächtlicher Miene. »Es sollte geschehen, damit die Männer dann in dein Zimmer hereinkommen und dich fortschleppen könnten.«

»Mein Gott, ich bin verloren!« rief Isabella jammernd und die Hände ringend.
»Nein, durchaus nicht,« sagte Chiquita, »denn ich werde den Riegel zugeschoben lassen. Sie werden nicht wagen, die Tür zu sprengen. Dies würde Lärm machen, und man würde kommen und sie festnehmen. So dumm sind sie nicht.«
»Aber ich hätte dann geschrien; ich hätte mich an die Wand angeklammert; man würde mich gehört haben!«
»Ein Knebel in den Mund erstickt das Geschrei,« sagte Chiquita mit dem Stolze eines Künstlers, der einem Ignoranten ein Handwerksgeheimnis erklärt; »eine Decke um den Leib macht alle Bewegungen unmöglich. Das ist sehr leicht. Der Stallknecht war bestochen und sollte die Hintertür öffnen.«
»Aber wer hat dieses schändliche Komplott geschmiedet?« fragte die arme Schauspielerin, ganz entsetzt über die Gefahr, in der sie geschwebt hatte.
»Der vornehme Herr hat Geld gegeben, oh, viel Geld! ganze Hände voll«, antwortete Chiquita, deren Augen von habgierigem, wildem Glanze funkelten. »Doch gleichviel, du hast mir dieses schöne Halsband geschenkt, und ich werde nun zu den andern sagen, du schläfst nicht, es ist ein Mann in deinem Zimmer, und der Streich kann nicht ausgeführt werden. Dann werden sie fortgehen. Laß mich dich ansehen. Du bist schön, und ich liebe dich, ja, ich liebe dich sehr, beinahe ebensosehr als Agostin. Sieh da,« sagte sie, indem sie das in dem Wagen gefundene Messer auf dem Tische liegen sah; »du hast das Messer, das ich verloren habe, das Messer meines Vaters. Behalte es; es ist eine gute Klinge. Wen diese Natter sticht, für den hat die Apotheke kein Heilmittel. Siehst du, die Zwinge dreht man so, und dann führt man den Stoß so, von unten nach oben, denn dann dringt das Eisen besser ein. Trage es in deinem Mieder, und wenn dir dann jemand etwas tun will, ritsch! schlitzest du ihm den Leib auf.«
Und die Kleine begleitete ihre Worte mit angemessenen erläuternden Gebärden. Diese in der Nacht, in dieser seltsamen Situation von dieser hagern und halbverrückten kleinen Diebin gegebene Messerlektion wirkte auf Isabella wie ein Alpdruck, den man im Schlafe vergebens von sich zu schütteln sucht. »Halte das Messer so in der Hand und die Finger dicht geschlossen. Man wird dir nichts tun. Jetzt will ich wieder gehen. Leb wohl und denke zuweilen an Chiquita.«
Die kleine Spießgesellin Agostins rückte einen Stuhl an die Wand, stieg darauf, stellte sich auf die Zehen, erfaßte die Gitterstange des runden Fensters, krümmte sich wie ein Bogen, stemmte die Fersen an die Wand und gewann durch eine schnellende Bewegung den Rand des Ochsenauges, durch das sie verschwand.
Isabella erwartete mit Ungeduld den Tag und konnte kein Auge zutun, so sehr hatte dieses seltsame Ereignis sie aufgeregt. Der übrige Teil der Nacht verging aber in aller Ruhe.

Als sie am Morgen in den Speisesaal hinaufkam, waren ihre Kollegen durch die Blässe und den dunklen Ring um ihre Augen betroffen. Man drang mit Fragen in sie, und sie erzählte ihr nächtliches Abenteuer. Sigognac geriet in die größte Wut und sprach nur noch davon, das Haus des Herzogs von Vallombreuse zu demolieren, den er für dieses verruchte Attentat ohne weiteres verantwortlich machte.
»Nach meiner Ansicht,« sagte Blasius, »können wir nun nichts Besseres tun, als unsere Dekorationen zusammenpacken und uns in den Ozean von Paris verlieren oder vielmehr retten. Hier gestalten sich die Dinge immer schlimmer.«
Die übrigen Komödianten waren ganz derselben Meinung wie der Pedant, und die Abreise wurde auf den folgenden Tag festgesetzt.
*