
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
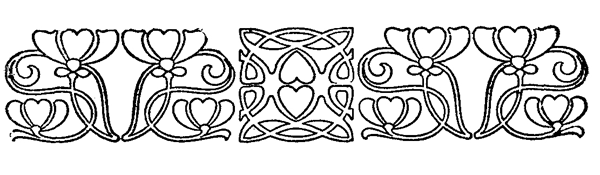
Während die eben geschilderten Szenen sich auf dem Gute Sellhausen zutrugen, war der ehemalige Besitzer desselben und jetzt enterbte und verwaiste Sohn, ohne die geringste Ahnung von denselben zu haben, schon längst in seine nächste Heimat eingezogen, wenn wir das gastliche Haus des biederen Meiers mit diesem Worte bezeichnen dürfen, da Bodo von Sellhausen nur wenige Tage daselbst zu verweilen den Vorsatz gefaßt hatte.
Selbst des Meiers munteres Wesen, sein freundlicher Zuspruch und das sichtbare Bestreben, seines jungen Freundes Aufmerksamkeit vom inneren Grübeln ab nach der fröhlichen Außenwelt zu leiten, waren nicht imstande gewesen, diese Umwandlung so schnell zu bewirken, und hauptsächlich waren es zwei Gedankenrichtungen, in denen sich der zurzeit noch trübe Geist des Legationsrats tummelte, ja die auch noch später, als er sich schon in des Meiers gastlichem Hause wohl gebettet fand, mit immer frischer Gewalt an seinem Herzen rissen.
»Du bist nicht des Mannes Sohn, den du bisher für deinen Vater gehalten hast,« sagte er sich wiederholt, »wessen Sohn aber bist du dann?«
Und wenn er sich an der Lösung dieses Rätsels vergeblich müde gearbeitet, tauchte der zweite Gedanke in ihm auf und rief ihm zu: »Wo ist das freundliche Augenpaar so rasch geblieben, welches dir wie die Sonne bisher deinen Pfad erleuchtete, und wird dir wenigstens diese Sonne bald wieder aufgehen, nachdem so manches andere Licht ohne Rückkehr auf deinem Wege erloschen ist?«
Während diese zwei Fragen Bodos Seele immer wieder von neuem beschäftigten und sich, da keine gewünschte Antwort vernommen ward, jeden Augenblick tiefer und schmerzlicher in ihm einnisteten, ließ der Meier seinen Gast fast keine Sekunde aus den Augen, ja er beobachtete ihn mit einer seltsamen Aufmerksamkeit und schon unterwegs bewies er sich gesprächiger als sonst, suchte allerlei neue Anknüpfungspunkte hervor und war besonders bemüht, die zuletzt erlebten Ereignisse so viel wie möglich aus der Gesichtslinie des jungen Mannes zu schaffen. Dabei lag in dem Tone, mit welchem er sprach, eine fast überwallende Herzlichkeit, als hielte er sich mit Gewalt zurück, seine ganze Seele dem lieben Freunde aufzuschließen, und sein Auge belebte ein so hell leuchtender Strahl, wie ihn nur derjenige in seinen Blick zu legen fähig ist, der den festen Willen und die reinste Absicht hat, einem anderen ein aufrichtiger Tröster zu sein. Bisweilen sogar schien in diesem Blick ein geheimnisvolles Etwas zu liegen, als wollte er sagen: »Wenn ich könnte, wie ich möchte, so nähme ich gern einen Teil der Last, die dich bedrückt, auf meine Schultern, denn stark und willig bin ich genug dazu, allein ich darf nicht und eben deshalb tust du mir doppelt leid!« –
Der kurze Weg nach Allerdissen war mit den raschen Pferden bald zurückgelegt. Da man den Meier mit dem befreundeten Gaste im Hause erwartete, so war es natürlich, daß zahlreiche Hände bereit waren, beide mit Aufmerksamkeit zu empfangen, und Bodo gewahrte auf den ersten Blick, daß er hier jedermann herzlich willkommen war.
Als beide im Innern der großen Tenne vom Wagen gestiegen waren, reichte der Wirt seinem Gaste die Hand und sagte mit festem, warmem Drucke:
»So, mein Freund, da sind wir bei mir. Ich heiße Sie heute noch tausendmal freudiger willkommen, als da Sie mein Haus zum ersten Male betraten, denn wir kennen uns nun schon beide genauer, und mancherlei Freude und Leid hat unsre Herzen fest mit einander verkittet. So folgen Sie mir denn in das Innere des Hauses und tun Sie, als ob Sie unter dem eigenen Dache wären. Was ich habe und besitze, soll auch für Sie vorhanden sein, falls Sie damit vorlieb nehmen wollen.«
Bodo dankte gerührt mit wenigen Worten und trat nun durch den hinteren Küchenraum der mächtigen Tenne, wo alles in emsigster Tätigkeit war und Leben und Weben von Aufgang der Sonne bis in die sinkende Nacht herrschte, in das erste Zimmer ein, in welchem der Meier wohnte und seine häuslichen Geschäfte zu ordnen pflegte. Jedoch hielt er sich diesmal nicht darin auf, schritt vielmehr rasch hindurch und führte seinen Gast unmittelbar in das zweite, geräumige Gartenzimmer, wo sie damals geplaudert und welches der Wirt als der abwesenden Tochter gehörig bezeichnet hatte.
Bodo blickte sich wehmütig und doch mit hochaufschlagendem Herzen darin um. Alles stand und lag wie damals, alles sah behaglich, schmuck und einladend aus, als wäre die schöne Besitzerin nur einen Augenblick daraus abwesend, um sogleich wiederzukommen und die kurz vorher unterbrochene Tätigkeit von neuem zu beginnen. Die Morgensonne schien warm und klar in die offenen Fenster herein, durch die Bäume draußen rauschte ein leichter Wind und schaukelte anmutig die schweren Zweige, an denen reichliche Frucht hing, die sich schon lieblich unter den Strahlen der Augustsonne zu röten begann.
»Hier,« sagte der Meier, mit der Rechten rings um sich her deutend, »sollen Sie wohnen, mein lieber Freund. So habe ich es mir ausgedacht und damit wünschte ich Sie befriedigt zu sehen. Hier habe ich Sie stets in meiner unmittelbaren Nähe und bin immer bei der Hand, wenn Sie meine Gesellschaft wünschen sollten. Gertrud ist nicht da und so steht das Zimmer, eins der freundlichsten im Hause, leer, und ich selbst habe gern Leben und Menschen um mich her, die mich verstehen und die ich liebe. Das Mädchen wird mit meiner Anordnung hoffentlich zufrieden sein und nicht zürnen, daß wir uns ihre Abwesenheit auf diese Weise zu nutze machten.«
Bodo fühlte sich in diesem behaglichen Raume wohltätig und heimisch zugleich angehaucht, wo sein Geist ja nur die beste Gesellschaft haben konnte, und er dankte dem Meier mit herzlichen Worten für seine ungewöhnliche Aufmerksamkeit. Bald darauf wurden seine Koffer in das nebenanliegende Schlafzimmer gebracht und der Meier bestand darauf, daß er gleich das Notwendigste und Liebste beiseite lege, »denn so liebe ich es,« sagte er. »Man fühlt sich erst warm in einer neuen Wohnung, wenn man seine kleinen Bedürfnisse in gewohnter Weise um sich her untergebracht hat, und das soll hier bald getan sein. Wohlan denn, ich helfe, fangen Sie an – hier haben Sie leere Kasten und Schubfächer genug und da steht der Schreibtisch, ohne den Sie nun einmal nicht leben können – ich habe gesorgt, daß Sie Raum genug überall finden.«
Bodo konnte nicht anders und so begab er sich daran, des Meiers Wunsch zu erfüllen, der ihm rüstig zur Hand ging, so daß die erste Arbeit bald beendigt war.
Während dieses kleinen Geschäfts fuhr der Meier unter andern also zu sprechen fort: »Ich habe nun folgenden Vorschlag,« sagte er. »Wenn wir hier fertig sind, frühstücken wir und dann setzen wir uns beide zu Pferde und reiten über die Felder und Wiesen hin. Ich habe drüben in der Mühle an den Bergen zu tun und es wird bei gutem Wetter ein hübscher Weg sein, den wir zusammen zurücklegen. Sind Sie damit einverstanden?«
»Vollkommen, lieber Meier. Sie sollen über meine ganze Zeit zu gebieten haben, und ich füge mich in alles.«
»O nein doch – nicht fügen bloß müssen Sie sich, auch alles gern tun, was zu tun ist.«
»So stimme ich Ihnen auch darin bei – ich tue alles gern, was Sie zu tun mir vorschlagen, denn so lange ich bei Ihnen bin, habe ich Zeit in Fülle.«
Der Meier lachte unwillkürlich über diese Worte, was Bodo, da er es bemerkte, sich eigentlich nicht erklären konnte; jedoch schwieg er und kramte emsig weiter.
Wie der Meier aber gesagt, so geschah es. Man frühstückte, wie es auf dem Lande in jener Gegend üblich ist, kräftig und reichlich, setzte sich dann zu Pferde und trabte munter ab, über die halmlosen Felder und grünen Wiesen hin, den blauen, malerisch ausgezackten Bergen des Teutoburger Waldes zu, wo der Meier am schon beschriebenen Forellenbach eine Wassermühle besaß, deren Werk und Betrieb er besichtigen wollte, da er gerade einen Bau daran unternahm. Auch auf diesem Ritte zeigte er sich unterhaltend wie nie und das treuherzige Wesen des einfachen und naturwüchsigen Mannes machte einen tiefen Eindruck auf den empfänglichen Geist seines Gastes.
Als sie gegen ein Uhr mittags etwas ermüdet zurückkamen, erwartete Bodo eine Überraschung, da er das kurz Vergangene fast ganz aus dem Auge verloren hatte. Fräulein Treuhold war mit ihren Mägden von Sellhausen angelangt und begrüßte ihren Herrn und den Vetter mit den herzlichsten Worten, wobei indessen die in letzter Zeit zur Gewohnheit gewordenen Zähren wieder eine kleine Rolle mitspielten. Auf den Legationsrat wirkte ihre erste Erscheinung freilich etwas trübe ein, zumal er von ihr hören mußte, was an diesem Morgen auf Sellhausen vorgefallen, so lange sie dagewesen sei; als man aber erst gespeist hatte und dann im Garten unter einem an Früchten überreichen Apfelbaume den Kaffee trank und eine Zigarre rauchte, dabei gemütlich plauderte, und der Treuhold Glück, wieder bei ihrem Herrn zu sein, in rührender Herzlichkeit zum Vorschein kam, da wurden alle wieder heiterer gestimmt und namentlich der spannkräftige Geist Bodos fühlte sich lebhaft angeregt und gab sich den neuen Eindrücken seines hiesigen Aufenthalts mit sichtbarer Befriedigung hin.
Eine Stunde später ließ der Meier zwei frische Pferde vorführen und schlug seinem Gast noch einen kleinen Ritt in einer anderen Richtung als am Morgen vor. Bodo war sogleich bereit; man stieg in die Sättel und ritt ab. Der kleine Ritt dehnte sich aber wieder zu einem recht großen aus, und als die beiden Männer am Abend heimkehrten, schmeckte ihnen das nahrhafte Essen vortrefflich und auch des Meiers feuriger Wein tat seine Schuldigkeit, so daß unser Freund sich bald in seinem weichen Bette von dem einschläfernden Fittig der Nacht umfächelt fühlte, ohne daß er wußte, wo der erste Tag seiner Heimatlosigkeit geblieben war, vor dessen unabsehbarer Länge er schon am frühen Morgen die größte Besorgnis gehegt hatte.
*
In ähnlicher Weise wurden von den beiden Männern die nächsten drei Tage auf Allerdissen verlebt, und in dieser ganzen Zeit schien es, als ob der Meier es darauf angelegt habe, seinem Gaste keinen Augenblick Ruhe zu gönnen und ihn fast nie allein zu lassen, um ihm so alle Gelegenheit zu benehmen, seinen Gedanken nachzuhängen oder seine Phantasie auf vergangene oder verlorene Dinge zurückzuführen.
Schon am frühen Morgen, gleich nach dem ersten Frühstück, stieg man entweder zu Pferde oder setzte sich in den Wagen, um da oder dort irgend ein Geschäft zu verrichten, deren der Meier gerade in dieser Zeit unzählige und immer höchst wichtige zu haben schien. Auch wusste er es stets so einzurichten, daß man erst kurz vor der Speisestunde nach Hause kam und dann gleich ein anderer, zumeist die Treuhold, den Legationsrat in Anspruch nahm. Nach Tisch tauchte urplötzlich eine neue notwendige Besichtigung in der Ferne auf und wiederum ging es frisch hinaus, um erst am Abend, wenn es schon dunkelte, daheim zu sein.
Glücklicherweise begünstigte das Wetter diese Unternehmungen ungemein, der einladendste Sonnenschein lag auf Wald und Flur und Bodo fand so viel Abwechslung in diesem tätigen Bewegen, daß ihm jede Stunde fast einen neuen Genuß, eine neue Anregung bot, wobei namentlich die reizenden Umgebungen des Meierhofes einen großen Einfluß auf sein Gemüt übten. Bald heitere, bald ernste, immer aber ruhige und wohltuende Gespräche verkürzten diese Ausflüge, allerlei Zustände und Verhältnisse kamen auf die Tagesordnung, und hierbei hatte Bodo hinreichende Gelegenheit, die Mannigfaltigkeit der Kenntnisse, den Reichtum an Erfahrung und die umfassende Bildung seines Wirtes zu bewundern, sogar auf Feldern, die von seiner ländlichen Zurückgezogenheit weit ab zu liegen schienen und doch von ihm fleißig angebaut und ergiebig ausgebeutet waren.
Wenn der Meier mit dieser Art, die nächsten Tage rasch verfließen zu machen, die Absicht verbunden, eine Erheiterung seines Gastes herbeizuführen und sein Gemüt zu beruhigen, so gelang ihm dieselbe vollkommen, und das sah er zu seiner eigenen Befriedigung sehr bald ein. Die Wirkung war fast eine wunderbare und wenigstens im Äußern stellte sich Bodo gerade wie in früheren glücklicheren Tagen dar. Das tätige Leben rings um ihn her, das er vom Morgen bis Abend stets vor Augen hatte, gab ihm selbst Lust und Neigung zum Leben unter Menschen wieder, die Ruhe der im stillen schaffenden Natur, der Friede, der über den fernen blauen Bergen, den schweigenden Wäldern und grünen Auen ausgebreitet lag, führte seine Seele selbst wieder zur Ruhe und zum Frieden zurück, und wenn er nach langem Umherstreifen abends spät endlich sein Zimmer betrat, um sich vielleicht einsam zu fühlen, so erweckte wiederum das Bewußtsein, von Gertruds Besitztümern umgeben zu sein und in dem Raume zu atmen, worin sie selbst einst geatmet, eine stille Freude in ihm, die vollkommen geeignet war, so manchen Kummer niederzudrücken, der dann und wann in unbelauschten Pausen, gleichsam wie ein Dieb in der Nacht sein Herz beschleichen wollte. Mit dieser stillen Freude kehrte dann wohl auch mitunter eine leise, scheu in der Ferne auftauchende Hoffnung künftigen häuslichen Glückes ein, die Lichter der Zukunft strahlten durch die Schatten der Gegenwart herüber, und was Wunder, daß diese selbst allmählich dadurch an Dichtigkeit und Umfang verloren, bis endlich die männliche Seele unseres Freundes sich frei und losgerungen hatte, und er wieder mit neuer Elastizität den Wert auch seines jetzigen Daseins begriff.
Nur ein einziger Umstand war geeignet, seine zunehmende Behaglichkeit nicht ganz zum Durchbruch kommen zu lassen, und die allmähliche Wahrnehmung und Bestätigung desselben reizte sein Nachdenken wieder nach einer anderen Richtung hin auf. Bodos Herz war voll bis zum Überfließen von der lieblichen Erscheinung, die ihm in den letzten Wochen auf Sellhausen das Leben versüßt, und am liebsten hätte er ohne Unterlaß von ihr gesprochen und dann, in glücklicher Stunde, vielleicht dem Meier sein volles Herz in offenem Bekenntnis dargelegt. Allein diese Stunde schien nicht kommen zu wollen, der Meier war, seltsam genug, zu gar keinem dauernden Gespräch über seine Tochter zu bewegen. Sobald Bodo nur von ferne auf sie hindeutete, sprang er ab und suchte die Aufmerksamkeit des Redenden auf einen ganz andern Gegenstand zu leiten. Ebenso wich er den direkteren Fragen auf eine überaus geschickte Weise aus und am dritten Tage ihres Zusammenseins geschah dies auf eine so auffallende Art und mit einer Bodo nicht entgehenden, fast verlegenen Miene, daß dieser beinahe eine bestimmte Absicht dahinter vermutete und natürlich auf der Stelle schwieg.
Dieses erzwungene Schweigen über etwas aber, was ihm so nahe am Herzen lag und wodurch er wider Willen zum Grübeln gereizt wurde, war es eben, was ihn noch allein verstimmte und endlich am vierten Tage seines Aufenthaltes auf Allerdissen in eine gewisse Unruhe ausartete, die dem Meier nicht länger entgehen konnte und ihn endlich auch zu irgend einer Frage darüber veranlassen mußte.
Bodo hatte bis zu diesem Tage mit stillfroher Erwartung irgend einer Nachricht von Gertrud entgegengesehen, zumal ihr Vater ihm gesagt, daß sie seinen Brief erhalten habe. Da jedoch keinerlei Nachricht eintraf, mußte einige Sorge in ihm entstehen, daß irgend ein Hindernis vorliege, was dieses Schweigen bewirke und – mochte der Meier nun von seiner Tochter sprechen wollen oder nicht, den Grund dieses Schweigens mußte Bodo zu entdecken versuchen.
Als daher beide am Abend dieses Tages von einem ihrer weitesten Ausflüge zurückkehrten, Bodo, in Gedanken versunken, nicht gleich auf irgend eine Frage des Meiers eine Antwort hören ließ, sah dieser ihn verwunderungsvoll von der Seite an und ihm fiel die ernste und zugleich unruhige Miene seines jungen Freundes auf. Von plötzlicher Teilnahme überrascht, ließ er sich zu der Frage verleiten, was ihn denn zu dieser Unruhe bewege, und da sagte Bodo ganz ehrlich:
»Lieber Meier, Sie haben ganz richtig bemerkt, ich bin in einiger Unruhe und diese nimmt sogar mit jeder Stunde zu, da mich niemand davon befreien will, selbst wenn er vielleicht die Macht dazu hätte.«
Aus diesen Worten erkannte der Meier nur zu leicht, daß er wahrscheinlich eine Bahn betreten habe, die er für jetzt nicht betreten gewollt, und so blickte er mit deutlicher Verlegenheit auf den Hals seines Rappens nieder. »O, o,« sagte er sanft, »das tut mir ja leid.«
»Und da Sie mich doch einmal gefragt, was mich unruhig macht,« fuhr Bodo fort, »so sollen Sie es hören, wenngleich es mich bedünken will, als ob Sie meine Mitteilung nicht gerade haben befördern wollen. Lassen Sie mich also gerade heraus sprechen. Mich beunruhigt es sehr, daß ich bis jetzt keine Antwort auf meine Zeilen erhalten habe, die Sie selbst, wie Sie sagten, Ihrer Tochter zukommen ließen.«
»Ah, ist es das!« sagte der Meier, wie vor sich hin sprechend und dabei den Kopf rasch nach der Seite wendend.
»Ja, das ist es. Ich habe zwar nicht direkt in jenen Zeilen um eine Antwort gebeten, aber der Inhalt war doch von der Art, daß ich mit ziemlicher Bestimmtheit auf eine solche rechnen konnte. Können Sie mir nun irgend eine Erklärung hierüber geben, so bitte ich Sie, es zu tun, Sie erfreuen und beruhigen mich zugleich damit.«
Der Meier hatte sich wieder gesammelt und sah den warm Redenden freundlich an, aber doch lag in seinem treuen blauen Auge ein kleiner, seinem ganzen Wesen widersprechender Rückhalt, und Bodos schnellem Auge entging derselbe nicht.
»Sie haben recht,« sagte er, »ich weiß auch nicht, warum sie nicht schreibt; selbst mich scheint sie in ihrer neuen Lage vergessen zu haben. Allein, wenn ich es mir recht überlege, gibt es auch wieder eine Entschuldigung für sie. Sie hält sich bei einer kranken Verwandten auf und hegt und pflegt sie. Das hält sie vom Schreiben zurück; wenn sie aber einmal erst dazu kommt, werden wir genug zu lesen kriegen; denn die Kleine ist bisweilen sehr redselig.«
Der Meier beliebte in seiner Verlegenheit zu scherzen, und das gewahrte Bodo sehr wohl. Aber den Scherz damit auch bei ihm hervorzulocken, gelang jenem nicht, vielmehr war und blieb er vollkommen ernst dabei. Er wollte auch eben in jenem vorigen Gedankengange weiter vorschreiten, als der Meier sich plötzlich wieder zu ihm wandte und mit einer neuen Abschweifung zum Vorschein kam, die diesmal Bodo wirklich zu fesseln imstande war.
»Aber da fällt mir ein,« sagte er, »daß übermorgen schon der achte August ist und daß wir dann wieder nach B... müssen, um die Abschriften des Testaments entgegenzunehmen. Sie treffen dann nochmals mit den Baronen zusammen – haben Sie daran schon gedacht?«
»O ja, leider, und das ist mir sehr unangenehm.«
»So? Nun dann umgehen Sie es doch. Geben Sie mir eine schriftliche Legitimation, daß ich Ihr Stellvertreter bin, und ich mache das Geschäft für Sie ab. Wie, behagt Ihnen das nicht?«
Bodo sann einen Augenblick nach. »Gewiß,« erwiderte er, »aber dann müssen Sie auch meine Gelder in Empfang nehmen, die ich nun endlich doch wohl beanspruchen muß, um den guten Sachwalter nicht länger damit zu beschweren. Wollen Sie auch das?«
»Von Herzen gern. In meinem eisernen Schrank liegen sie sicher genug, und von mir können Sie das Geld jederzeit wieder erhalten, wenn Sie es anderweitig verwenden wollen.«
»Abgemacht. Sie sollen die Legitimation haben, sobald wir zu Hause angekommen sind, dann brauchen wir über die unangenehme Sache gar nicht weiter zu reden. Doch noch eins, lieber Meier. Am achten August ist auch die Frist abgelaufen, bis wohin ich mich mit Ihrem Schweigen über meines Vaters und meine Verhältnisse begnügen muß. Werden Sie auch darin Ihre Freundespflicht erfüllen und mir jeden Aufschluß über die Rätsel meines Lebens geben, den Sie mir geben können?«
»Gewiß. Wenn ich übermorgen nachmittag oder abend von B... zurückkomme, wollen wir Ihres Vaters Papiere aus dem Schranke nehmen. Sie sollen sie lesen, und was dann noch mündlich hinzuzufügen ist, soll geschehen. Sind Sie damit zufrieden?«
»Vollkommen, und dann habe ich mich lange genug hier geruht, um mit frischen Kräften ins neue Leben zu treten.«
Der Meier nickte schweigend Beifall, wenige Minuten später aber hatte man das Gehöft von Allerdissen erreicht. An der Tür des ersten Zimmers kam die Treuhold den beiden Männern entgegen und überreichte dem Meier einen Brief. »Sie waren beide kaum fortgeritten,« sagte sie, »da kam er.«
»Wer hat ihn gebracht?«
»Der Postbote, wie gewöhnlich.«
Der Meier warf einen Blick auf die Adresse und steckte ihn dann in die Tasche. Bodo ging auf sein Zimmer, um jene Legitimationsscheine zu schreiben, und unterdessen las der Meier den rasch erbrochenen Brief.
Als Bodo nach einigen Minuten wieder in das bereits erleuchtete Zimmer des Meiers trat, wo man zu speisen pflegte, fand er diesen allein und sinnend langsam auf und nieder gehen. »Hier sind meine Bescheinigungen, lieber Meier,« sagte er, »und nun tun Sie damit, was Sie versprochen haben. Aber Sie hatten ja einen Brief erhalten – war er vielleicht von Gertrud?«
»Nein,« erwiderte der Meier, rasch und entschlossen den Kopf erhebend, »er war nicht von der Kleinen, aber doch von jemandem, den Sie kennen. Er kam von der Cluus.«
»Ah! Von Frau Birkenfeld!« rief Bodo mit eigentümlich betroffenem Gesicht.
»Ja, von ihr, und offen gestanden, sie beschwert sich eigentlich über Sie. Zunächst fragt sie, ob ich nicht wüßte, wo Sie sind, und dann verwundert sie sich über etwas, worüber ich mich auch schon gewundert, nämlich, daß Sie sie noch nicht besucht haben, nachdem Sie Sellhausen verlassen mußten. Sie habe bestimmt erwartet, schreibt sie, und ich dächte, sie hätte nicht so ganz unrecht mit ihrem sanften Vorwurf – wie?«
Bodo blickte sichtbar befangen vor sich nieder, als sänne er über die Worte nach, die er gebrauchen wollte, um sich dem Meier verständlich zu machen, dann aber erhob er rasch wieder das Auge und sah denselben mit seiner offensten Miene an. »Mein lieber Freund,« sprach er langsam und bedächtig, »es mag wohl so scheinen, daß ich diesen Vorwurf verdiene, aber in Wahrheit verdiene ich ihn nicht. Glauben Sie etwa nicht, daß mich ein gewisses Schamgefühl abhielt, dieser guten Frau jetzt unter die Augen zu treten, ach nein! Es ist vielmehr ein ganz anderes Gefühl, das sie wohl entschuldigen wird, wenn sie davon Kenntnis nehmen sollte. Meine Seele war in Wahrheit – so sehr ich mich bemühte, es zu verbergen – zu tief erschüttert, um in den ersten Tagen nach jener Testamentseröffnung schon vor irgend einen, mir mehr oder weniger fremden Menschen zu treten. Als ich Frau Birkenfeld noch fleißig besuchte, war ich glücklich, durch nichts behindert, im vollen Sinne frei und mein eigener Herr. In diesem Zustande konnte ich die alte Frau erheitern. Jetzt aber, wie ich nun einmal bin, kann ich das nicht, und ich möchte ihr durch mein dumpfes Wesen keine trübe Stunde bereiten. Da haben Sie meine Entschuldigung – weiter gibt es keine.«
»So, so,« sagte der Meier, seinen Spaziergang wieder antretend. »Es mag wohl so sein,« fuhr er nach einer Weile wieder fort, »ich glaube Ihnen, aber einen Rat, denke ich, muß ich Ihnen doch geben. Gehen Sie lieber nach der Cluus, sobald wie möglich, wer weiß, wie lange die alte Frau noch lebt. Daß Sie ihr eine trübe Stunde bereiten, brauchen Sie nicht zu befürchten, ach nein! Sie erwartet von niemandem eine Aufheiterung und ist in sich selbst heiter und zufrieden genug. Vielleicht sogar gelingt es ihr besser, als irgend einem anderen, heilsam auf Sie einzuwirken, denn sie kennt und versteht das menschliche Herz, und mit Kummer und Sorgen hat sie auch genügende Bekanntschaft gemacht. Möglicherweise kommen Sie dann erheitert hierher zurück und beginnen« – hier lächelte der Meier unwillkürlich, ohne daß Bodo es sah – »Ihr neues Leben mit um so frischeren Kräften. – Wissen Sie was?« fuhr er plötzlich noch herzlicher fort, »ich habe einen Vorschlag. Wenn ich übermorgen nach B... fahre, begleiten Sie mich nach der Cluus. Wir nehmen ein Pferd mit, und Sie reiten dann wieder zurück, wann es Ihnen beliebt. Dann haben wir beide den Tag gut angebracht, und abends treffen wir munter hier wieder zusammen und erzählen uns unsere verschiedenen Erlebnisse – wie?«
»Dem stimme ich bei,« versetzte Bodo, »und nun ist es beschlossen. Sie holen mir mein Testament und mein Geld, und ich hole mir, wie Sie sagen, Heiterkeit – was kann man mehr verlangen?«
Er wollte noch weiter reden, aber die Treuhold erschien und fragte, ob die Herren bereit wären, das Abendbrot einzunehmen.
»Ja, alte gute Treuhold!« rief der Meier mit wunderbar aufgeklärtem Gesicht. »Und bringe uns eine Flasche vom besten – du verstehst!«
*
Noch am späten Abend dieses Tages, nachdem sein Gast ihn schon verlassen hatte und zur Ruhe gegangen war, setzte sich der Meier an seinen Schreibtisch und schrieb einen langen umständlichen Brief. Am nächsten Morgen um fünf Uhr aber ließ er einen seiner Hofleute aufsitzen und denselben an den Ort seiner Bestimmung tragen.
Außer jenem ihm von der Treuhold überlieferten Briefe aber hatte der Meier noch einen anderen erhalten, und von dem gab er Bodo vorläufig keine Kenntnis, um ihm am nächsten Morgen eine kleine Überraschung zu teil werden zu lassen. Er hatte nämlich schon vor zwei Tagen an Baron Grotenburg nach Sellhausen geschrieben und um den Verkauf des alten Braunen gebeten, indem er zugleich eine Summe angab, die er dafür zahlen wolle, wenn der Baron seinen Wunsch zu erfüllen geneigt sei. Kurz vor Tische nun hatte ihm einer seiner Hofleute gemeldet, daß der Braune von einem Diener des Barons mit Sattel und Zaumzeug gebracht worden sei, mit ihm zugleich ein Brief, den er seinem Herrn einhändigte. In diesem Briefe nun stand, daß der Baron erfreut sei, dem Meier einen kleinen Beweis seiner freundschaftlichen Gesinnung geben zu können, und um mit ihm ganz und gar auf den besten nachbarlichen Fuß zu kommen, werde er sich erlauben, am nächsten Morgen Punkt zehn Uhr dem Meier einen Besuch abzustatten.
Diese Zeilen waren auf eine Art und Weise abgefaßt, daß der Meier fast in Erstaunen geriet, denn so viel Höflichkeit und Artigkeit hatte er von dem vornehmen Herrn nicht erwarten können. Ja, es lag sogar ein scheinbar herzlicher Ton in dem kurzen Schreiben – und der allein ließ den ehrlichen Meier besorgen, daß des Barons Willfährigkeit, das Pferd zu verkaufen, und seine Absicht, ihn am nächsten Morgen zu besuchen, einen ganz anderen Zweck als bloß das Bestreben andeute, eine nachbarliche Verbindung anzuknüpfen. Wie dem aber auch sein mochte, der Meier war zum Empfange des Barons auf jede Weise gerüstet, und es handelte sich bei ihm fürs erste nur darum, seinen bisherigen Gast um zehn Uhr auf einige Stunden aus dem Hause zu schaffen, da er ihm aus reinem Zartgefühl nicht nur den Anblick des Barons ersparen, sondern ihm sogar sein eigenes Zusammentreffen mit demselben verschweigen wollte, um ihn aus seiner kaum erlangten Ruhe nicht wieder aufzurütteln.
Zu diesem Zwecke hatte er eine kleine List ersonnen, und diese wurde am frühesten Morgen des anderen Tages auf folgende Weise ausgeführt.
Als der Legationsrat um sechs Uhr in des Meiers Zimmer trat, fand er denselben mit einer langen Rechnung beschäftigt. Nach der ersten Begrüßung fiel Bodos Auge darauf, und er fragte sogleich:
»Schon so früh mit Zahlen beschäftigt? Das wäre für mich kein angenehmer Beginn eines so schönen Tages.«
»Das ist es auch für mich nicht, lieber Freund, und es ist gut, daß meine heutige Arbeit nicht auf morgen fällt, sonst wäre ich in eine arge Klemme geraten.«
»Haben Sie denn so viel zu tun?« fragte Bodo arglos.
»Ja, und ich soll sogar an zwei Orten zugleich sein. Das grenzt an Hexerei, nicht wahr?«
»Kann ich Ihnen vielleicht eine Arbeit abnehmen?« fragte Bodo freundlich.
Der Meier sah so ehrlich wie möglich, aber doch dabei errötend seinen zuvorkommenden Gast an und sagte dann: »Wenn Sie wollen, ja, warum nicht?«
»Was soll ich tun? – geben Sie her!«
»Sie sollen nach der Mühle reiten, wenn Sie Lust dazu haben, dem Baumeister, der jetzt dort beschäftigt ist, diese Berechnung bringen und ihn bitten, mir, wenn er sie durchgesehen, sein Ja oder Nein gleich zurückzusenden. Das ist viel verlangt, nicht wahr? O freilich, und ich will lieber irgend einen meiner Leute damit beauftragen.«
»O nein,« sagte er rasch, »lassen Sie mich das übernehmen. Ich reite gern allein, der Weg ist angenehm, das Wetter prächtig – also warum nicht? Wann soll ich fort?«
»Vor neun Uhr nicht, wenn Sie denn doch einmal darauf bestehen. Bis dahin habe ich etwa mit der Berechnung und dem Anschreiben selbst zu tun.«
»Gut, aber dann kann ich vor ein Uhr nicht wieder hier sein.«
»Das tut auch nichts, übereilen Sie sich nicht, reiten Sie con amore. Ich komme auch erst um ein Uhr von ... zurück, wo ich ein anderes notwendiges Geschäft vollbringen muß, das meine persönliche Gegenwart verlangt.« –
So trank man denn den Kaffee, ging eine Stunde hinaus auf das Feld, und dann setzte sich der Meier an seine Berechnung, während Bodo einige Briefe an fernlebende Freunde schrieb, wozu er heute seit langer Zeit wieder die erste Neigung in sich spürte.
Wie erstaunte er aber, als er, nachdem ihm etwa um halb zehn Uhr gemeldet, daß sein Pferd in der Tenne bereit sei, mit dem Meier heraustrat – den Brief an den Baumeister schon in der Tasche tragend – und nun seinen alten Braunen gesattelt wie sonst darin stehen sah.
»Meier!« rief er. »O, das ist hübsch von Ihnen! Ah, nun durchschaue ich Ihre kleine List – Sie haben mich einmal wieder mit meinem alten Braunen wollen allein sein lassen, und darum muß ich nach der Mühle!«
Der Meier lachte herzlich und drückte die ihm dargebotene Hand des jungen Mannes. »So etwas mögen Sie recht haben, aber doch nicht ganz,« sagte er. »Allerdings spielte der Braune heute eine Hauptrolle, aber Ihr Ritt nach der Mühle war doch gewiß sehr notwendig.«
»Nun er soll auch ausgeführt werden. Also der Baron ist willig gewesen, den Braunen zu verkaufen?«
»Sie sehen es ja, da steht er und freut sich, Sie wieder tragen zu können. Ich bot dem Herrn einen anständigen Preis und da ließ er die Ware, ich wußte es ja.«
»Aber Sie dürfen sie nicht behalten, ich nehme sie für mich zu demselben Preise in Anspruch.«
»Das wollen wir uns noch überlegen, lieber Herr, ich bin bisweilen etwas knauserig. Zuerst reiten Sie nur nach der Mühle und morgen nach der Cluus; dahin soll der Braune auch mit, dann wird Ihnen der Weg um so weniger langweilig. Und nun Gott befohlen! Auf Wiedersehen am Mittag!«
*
Kaum hatte der Legationsrat das Gehöft verlassen und war auf seinem guten Braunen in freudigerer Stimmung, als er sie bisher gehabt, abgeritten, so kehrte der Meier mit ernster Miene in sein Zimmer zurück, bestellte das vorher für ihn gesattelte Pferd ab und erklärte, für jetzt zu Hause bleiben und erst um zwölf Uhr reiten zu wollen. Nachdem er nun ein hübsches Röllchen Gold aus seinem Schranke genommen, in ein Papier gewickelt und auf den Tisch gelegt hatte, an dem sein vornehmer Besuch sitzen sollte, rüstete er sich, denselben zu empfangen, den er noch nie auf seinem Hofe gesehen und dessen Anliegen – er ahnte es bereits – ihn in eine viel ernstere Stimmung versetzte, als er sie je diesem Manne gegenüber gehabt.
»Ah, das Wasser muß ihm hoch bis an den Hals gehen,« sagte er, »sonst würde er nicht zu mir kommen – der Baron zu dem Bauer. Nun, die Wirkung war vorauszusehen und zu gut berechnet, als daß sie nicht hätte eintreffen sollen. Es ist gleich zehn Uhr und der Herr wird hoffentlich pünktlich sein, damit das Haus um zwölf Uhr wieder von ihm frei ist. Er komme, ich bin bereit.«
Der Baron war pünktlich, das Wasser mußte ihm also wirklich bis an den Hals gehen, wie der Meier sagte, und damit hatte der praktische Mann die Wahrheit bis ins Herz getroffen. Baron Grotenburg hatte eigentlich nur achtundvierzig sorgenlose und glückliche Stunden verlebt, seitdem er das Gut Sellhausen geerbt; von dem Augenblick an, wo er es selbst betrat, begann sich ihm das so sonnenhell geträumte Glück in düstere Nebel zu hüllen. Die alte Geldnot, die er nun ein für allemal überwunden zu haben glaubte, brach mit neuer Gewalt hervor, und von dem Moment der großen Kündigung an, hatte er sozusagen keine Minute Ruhe vor dem verhängnisvollen Gespenst einer Zukunft gehabt, wie er sie sich so drohend und schreckenerregend in seinen elendesten Lebensmomenten nie hatte träumen lassen.
Was half ihm nun der schöne ererbte Besitz, wenn er kein bares Geld daraus ziehen, keinen Baum fällen und verkaufen durfte und außerdem noch ungeheure Zinsen bezahlen mußte, die kaum die erste aus dem Getreide gezogene Summe deckte? Nein, hier mußte Rat geschafft werden, wenn man nicht verzweifeln sollte, man mußte Geld zusammentreiben, von welcher Seite es auch sei, nur um dem gefürchteten Termin der Zahlung des gekündigten Kapitals mit ruhigem Herzen entgegensehen zu können.
Seine Schwäger halfen ihm bei diesem Unternehmen, so viel in ihrer Macht stand. Alle drei fuhren schon am Tage nach der Kündigung bei ihren Bekannten und Freunden umher, klopften an alle Türen mit zarterem oder härterem Finger an, baten mit freundlichen Gesichtern überall um liebevolle Aufnahme, aber der Himmel weiß, wie es kam, alles bare Geld schien plötzlich aus der Welt verschwunden zu sein, und alle kurz vorher noch so wohlhabenden Leute waren mit einem Schlage von schrecklichen Verlusten heimgesucht worden, so daß sie selbst nur mit Mühe ihr kümmerliches Dasein fristen konnten. Nur mit größter Kraftanstrengung gelang es den drei Baronen, etwa 10 000 Taler zusammenzuscharren, von denen Pilatus XXII. den besten Teil geliefert, freilich erst nachdem ihm Baron Grotenburg mit Hand und Mund einen sehr schönen Teil seines Besitzes verpfändet, den er auf diese Weise »an den Mann« zu bringen niemals für möglich und mit seinem Ehrgefühl verträglich gehalten hatte.
Wer hätte auch dem verschwenderisch und leichtsinnig mit dem Gelde umgehenden Mann, was aller Welt bekannt war, eine so große Summe borgen wollen, da ihm keinerlei Sicherheit dafür geboten und keine neue Hypothek auf das belastete Gut aufgenommen werden konnte? Freunde im wahren Sinne des Wortes besaß er außer seinen Schwägern keine, alle begüterten Nachbarn hatten seit Jahren mehr oder weniger unter der Zuchtrute seines Hochmuts und des Dünkels seiner Frau und Tochter gelitten, er hatte sich mit keinem auf den rechten Fuß zu setzen vermocht, da er bei jeder Gelegenheit das hervorragende Alter und den Glanz seiner Familie geltend machte und auf die unbekannten Leistungen seiner Vorfahren ein Gewicht legte, das nur eine demütigende Rückwirkung auf andere Familien äußern und ihm sogar diejenigen entfremden mußte, auf die er früher mit herablassendem Stolz als seinesgleichen geblickt hatte.
Allein nicht nur die vergeblichen Bemühungen um eine so große, erst in Zukunft zu zahlende Summe erregten augenblicklich die große Sorge in ihm, nein, eine viel näher liegende war dicht an ihn herangetreten und diese nahm alle Tage in so erschrecklicher Ausdehnung zu, daß er endlich ganz wirr wurde und zuletzt fast der Verzweiflung anheim fiel. Denn kaum war das Gerücht seiner großen Erbschaft, natürlich um das Zehnfache gesteigert, wie ein Lauffeuer durch das ganze kleine Ländchen geflogen, wobei man sich noch seltsame Geheimnisse über die eigentliche Natur dieser Erbschaft zuflüsterte, so kamen von allen Seiten Gläubigerscharen herbei, forderten ungestüm die Bezahlung der seit Jahren geliehenen Summen und drohten sogar mit Exekution, wenn nicht wenigstens ein Teil davon auf der Stelle abgetragen würde.
Was sollte der arme Baron diesem Drängen gegenüber anfangen, wie sollte er sich retten aus dem Chaos, das mit jeder Stunde verworrener sich um ihn her aufzutürmen begann, wozu konnte er sich noch entschließen, als da Hilfe zu suchen, wo er sie früher, hätte ihm irgend jemand dazu den Vorschlag gemacht, mit Verachtung und Entrüstung zurückgewiesen haben würde?
Alles in allem berechnet, gab es nur noch drei Wege für ihn, auf denen er möglicherweise zum gewünschten Ziele gelangen konnte. Der eine davon führte zum Hofe von Allerdissen, der zweite nach der Cluus und der dritte endlich nach der Residenz, um dort die Gnade des Fürsten zu beanspruchen, der ihn früher so oft holdselig angelächelt und ihm sogar einmal in heiterer Laune gesagt haben sollte: »Eigentlich sind wir Vettern, mein lieber Grotenburg, denn Ihre Vorfahren sind mit den meinigen wiederholt verschwägert gewesen.« Ja, diese erhabene Verschwägerung solle und mußte noch als letzter Rettungsanker in Betracht gezogen werden, aber dazu war er erst entschlossen, wenn die beiden andern Hilfsquellen sich – o schrecklich, es nur zu denken – als unergiebig erwiesen haben würden.
Wir haben es hier zuvörderst nur mit dem ersten Wege des Barons zu tun und, wie schon gesagt, traf der edle Herr pünktlich auf Allerdissen ein, um »dem lieben Meier« einen freundnachbarlichen Besuch abzustatten, den er, um ihn sicher zu Hause zu treffen, einen Tag vorher angekündigt hatte. Der Meier saß in seiner Wohnstube bei der Arbeit, als ihm die Ankunft des Barons gemeldet wurde. Er rührte sich nicht von der Stelle, sondern befahl nur, den Herrn zu ihm zu führen, und erst als derselbe in die Tür trat, stand er von seinem Platze auf und ging ihm mit ernster, zurückhaltender Miene entgegen, da er sich vorgenommen, weder in Blick noch Wort von vornherein eine Freundlichkeit zu äußern, der das Ende der Unterhaltung doch nur widersprechen mußte.
Der Baron sah angegriffen, überbürdet, in höchstem Maße von innerer Sorge gequält aus; sein Gesicht war blaß, sein Auge blickte unstät und fast furchtsam, und seine sonst so vornehme Haltung war einer bescheideneren gewichen, die in dem Augenblick, als er dem großen athletischen Manne gegenübertrat, der so selbstbewußt einherging und fest auf den Füßen stand, sogar eine gewisse Demut erkennen ließ, die sicher nicht in der Natur des Herrn lag, vielmehr nur eine angenommene Maske war, um mittels derselben leichter zum vorgesteckten Ziel zu gelangen.
»Mein lieber Meier,« rief er schon, als er noch halb in der Tür stand und ihm dabei gleichsam sehnsüchtig beide Hände entgegenstreckte, »Sie sind also wirklich zu Hause, ah, das ist gut, und sehen Sie, da bin ich auch. Nun ja, ich muß Ihnen doch als neuer Nachbar den ersten Besuch machen – das ist in der Ordnung – und ich setze voraus, daß Sie die Freundschaft, die Sie mit den Bewohnern von Sellhausen von jeher gepflegt, auch auf mich übertragen werden, he?«
»Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Baron!« entgegnete der Meier, ohne auf die vorgelegte Frage einzugehen, und als der Besuch seinen Sitz da eingenommen, wo das Geld lag und wohin der Meier ihn geführt, setzte sich dieser ihm selbst gegenüber, mit unerschütterlicher Ruhe die verzerrten Züge des Barons betrachtend, der sich alle Mühe gab, eine Sorglosigkeit und Herzlichkeit an den Tag zu legen, von denen im Augenblick doch nicht die geringste Spur in seiner Seele vorhanden war.
Da der Meier nach jenen wenigen Worten nun schwieg, glaubte der Baron die Unterhaltung wieder aufnehmen zu müssen, obgleich ihm dieser steife Empfang nicht so recht behagen wollte. »Ja,« fuhr er fort, »und die Veranlassung zu meinem frühen Besuch hat bloß der kleine Handel geboten, wozu Sie mir eine so angenehme Gelegenheit geliefert haben. Das Pferd ist doch bei Ihnen eingetroffen?«
»Gewiß, Herr Baron, und hier liegt schon die von mir dafür gebotene Summe bereit.«
Der Baron warf hastig einen begierigen Blick auf das kleine dicht vor ihm liegende Päckchen, lächelte süßlich, streckte langsam die Hand danach aus, und als er es darin hielt, wog er es bedächtig und dann, gleichsam damit spielend und es aus einer Hand in die andere werfend, ließ er es plötzlich in irgend einer Tasche verschwinden, ohne daß der aufmerksame Meier wahrnehmen konnte, wo es geblieben war.
»Aber, mein lieber Freund,« fuhr der Baron nach einigem Zögern fort, »was wohnen Sie hier hübsch! Welche Einrichtung voll Eleganz und Komfort, wahrhaftig, das hätte ich gar nicht erwartet. Überhaupt, Bester, was für ein Hof! Ich bin ganz erstaunt gewesen, als ich ihn betrat und in Ihrer mächtigen Tenne die schönen Pferde und Kühe sah – ganz mein Geschmack das, meine Freude! Auf Ehre, es wird nur an Ihnen liegen, daß ich mir recht oft diesen Genuß gönne und Sie als meinen besten Freund betrachte. Ich werde mir dann stets ein Glas frischer Milch ausbitten – die trinke ich so gern, wie ich überhaupt die Einfachheit in jedem Genusse des Lebens liebe.«
»Wollen Sie vielleicht gleich jetzt ein Glas Milch haben?« fragte der Meier ruhig und den armen Mann fast mit Teilnahme betrachtend, dessen Unruhe jeden Augenblick zunahm und der sich vergebens bemühte, auf irgend eine Weise die schwerwiegende Gunst seines Nachbars zu gewinnen.
»Wenn ich darum bitten darf – ich werde es dankbar annehmen.«
Der Meier trat an den Schellenzug und läutete. Gleich darauf trat die schmucke Stubenmagd herein, und als der Meier ein Glas frischer Milch befahl, brachte sie es rasch auf einem blitzblank polierten Teller von Bronze, den der arme Baron beinahe für echtes Gold gehalten hätte, so lebhaft schwebte ihm überall das kostbare Metall vor Augen.
Hatte der Baron nun einen sehr großen Durst oder tat er nur so, genug, er trank das mächtige Glas auf den ersten Zug fast zur Hälfte leer, und als habe man ihm dadurch eine große Labung verschafft, setzte er sich gleich darauf fest in seiner Sofaecke zurecht, um flüchtig die Art und Weise zu überlegen, wie er nun seinem Hauptziele nahe kommen wolle. Er schien sie bald gefunden zu haben, denn vertraulich lächelnd sagte er plötzlich:
»Und nun, mein lieber Freund und Nachbar, will ich Ihnen einmal etwas erzählen, was Sie in Verwunderung setzen und ganz gegen Ihre Erwartung sein wird, wie es auch gegen die meinige war. Hm ja! Sie wissen doch, wir sahen uns – morgen sind es acht Tage – zum letzten Mal – nur höchst flüchtig freilich – auf dem Gericht zu B..., wo mir unser guter alter Sellhausen, Ihr und mein Freund, aus verwandtschaftlichen Rücksichten sein Gut vermachte, nachdem sein Adoptivsohn – ich beklage den jungen Mann aus tiefstem Herzensgrunde – die Hand meiner Tochter so unüberlegt von sich gewiesen hatte. Nun ja, ich war trotzdem sehr erfreut über dieses Vermächtnis, das gestehe ich offen, aber was denken Sie, was mir gleich darauf begegnet? Sie werden es kaum glauben und gleich mir halb aus der Haut fahren. Daß einige Schulden auf dem Gute standen, wußte ich längst, und das ist auch ganz natürlich; daß ich aber die Einsicht davon erst morgen im Hypothekenbuch nehmen sollte, wunderte mich anfangs, obgleich ich nichts Arges dabei dachte. Nun sehen Sie. Kaum bin ich achtundvierzig Stunden nach Eröffnung des Testaments, wie es dasselbe vorschreibt, in mein Eigentum eingezogen, da erscheint ein frecher breitspuriger Sachwalter des Hauptgläubigers und begeht die unerhörte Taktlosigkeit, mir in neunzig Tagen das ganze darauf stehende Kapital zu kündigen, und zwar in einer Summe bestehend, die mir die Haare zu Berge trieb. Unter uns gesagt, ich hätte nicht gedacht, daß der alte Sellhausen, der manchmal den Mund so voll nahm, so viel Schulden gehabt. Na, was sagen Sie nun dazu?«
»Was soll ich dazu sagen, Herr Baron?« erwiderte der Meier mit kühlem Gleichmut. »Die Kündigung geschah etwas früh, allerdings, aber wer weiß, wie die Sache zusammenhängt?«
»Ja, ja doch, das mag schon sein, aber die Hauptsache ist und bleibt, wie soll ich eine so große Summe in so kurzer Zeit aufbringen? Ein Vierteljahr geht wie eine Windsbraut vorüber. Holz darf ich nicht schlagen, der Erlös aus dem vorhandenen Getreide, nur zum teil verwendbar, da ich doch meine ersten Einrichtungen bar bezahlen muß, reicht bei weitem nicht aus – zu Juden kann ich nicht gehen, da ich keine Hypothek mehr aufnehmen darf – meine Freunde sind, unter uns gesagt, selbst nur arme Schlucker – und wer gibt mir nun, was ich notwendig gebrauche?«
Der Meier lächelte, als ob er die Verlegenheit des Barons nicht vollkommen begreife. »Sollte es nicht zuerst Ihre Verwandte auf der Cluus, die Frau Birkenfeld, tun?« fragte er mit einer Gemächlichkeit, deren Ironie nur dem in diesem Augenblick so aufgeregten Baron entgehen konnte.
Dieser fuhr wie von einem harten Schlage getroffen zurück. »Meine Tante, die Birkenfeld?« sagte er. »O nein doch! Die alte Hexe dreht jeden Groschen dreimal in der Hand um, ehe sie ihn ausgibt – aber sehen Sie, da habe ich einen ganz anderen Plan. Wo die alten Freunde nicht ausreichen, muß man neue zu Hilfe nehmen. Wie wäre es also – lassen Sie mich gerade heraus sprechen – Sie kennen ja Sellhausen – wissen, was es trägt und einbringt – wie wäre es, wenn wir beide – wie wir vorher einen kleinen Handel so schnell abgeschlossen, jetzt einen großen schlössen! Wenn ich Ihnen, sage ich – einen Teil des Gutes – insgeheim – kein Mensch braucht davon zu wissen – die Hälfte der Gutseinkünfte jährlich verpfändete – Ihnen sicher stellen wollte – und wenn Sie mich dann – o lassen Sie mich es ehrlich und im Vertrauen aussprechen – aus der Not zögen und die Summe bis zum ersten November beschaffen hülfen – wie?«
Der Baron lehnte sich erhitzt und vor innerer Angst schwitzend in das Sofa zurück. Es war ihm wenigstens gelungen, auszusprechen, was ihm so schwer auf der Seele gelegen. Jetzt trocknete er sich erst die Stirn mit einem feinen Batisttuch und sah dann den Meier mit klotzenden Augen an, als könne er kaum den Augenblick erwarten, wo derselbe den Mund auftun würde.
Dieser Augenblick kam bald. Fest lehnte sich der Meier in seinen Stuhl zurück, sah den Baron streng und kalt an und sagte mit so klingender Stimme, daß sie dem Hörenden wie ein Messer in das Ohr schnitt: »Herr Baron! Sie sind halb und halb aufrichtig gegen mich gewesen – ich will es ganz gegen Sie sein. Sie haben sich mit Ihrem Vorschlage an den unrechten Mann gewandt. Ich tue nichts insgeheim weder für mich, noch gegen den Vorteil anderer – was ich tue, kann immer die Welt wissen. Vor allen Dingen aber tue ich nichts gegen die Gesetze der Moral, des gesunden Menschenverstandes und der Pflicht – Ihre vorgeschlagene Verpfändung des geerbten Gutes aber – noch dazu insgeheim – wäre auch gegen das Gesetz des Staates, da das Kodizill Ihres Testators sich deutlich genug über diesen Punkt ausgesprochen hat.«
Der Baron sah dem ehrlichen Mann in das dunkler gewordene Gesicht – er wollte schon weiter reden, da hob der Meier beschwichtigend die Hand gegen ihn auf und fuhr fort: »Ich bin noch nicht zu Ende, Herr Baron! Es gibt auch noch einen anderen Grund, warum ich Ihnen das Geld nicht vorstrecken kann, welches Sie von mir verlangen – ich würde damit eine Inkonsequenz begehen, die ich vor niemandem rechtfertigen könnte, am wenigsten vor dem, der zumeist außer Ihnen bei der Sache beteiligt ist – vor Ihrem Gläubiger!«
»Wie so denn das?« fragte der Baron angstvoll.
»Aufrichtig gesagt, ich hatte bis vor kurzem selbst 30 000 Taler auf Sellhausen stehen, habe diese aber dem Hauptgläubiger zediert, da er wünschte – zu guten Zwecken – die ganze Forderung in Händen zu haben. Was würde nun dieser Gläubiger, was würde das Gericht sagen, wenn ich – hinter seinem Rücken zu Ihren Gunsten ihm sein Vorhaben paralisieren wollte, dadurch, daß ich Ihnen die Mittel gewährte, ihn zu befriedigen, wie?«
»Aber, mein Lieber,« rief der Baron hitzig, »das ist mir ja ganz neu. Wem haben Sie denn diese 30 000 Taler zediert?«
»Dem Hauptgläubiger, sage ich Ihnen, der Ihnen jetzt die ganze Summe auf einen Schlag gekündigt hat.«
»Ja, ja doch, aber wer ist denn das?«
»Das werden Sie morgen aus dem Hypothekenbuch erfahren, Herr Baron.«
»Ach, das verfluchte Hypothekenbuch! Ja, ja doch, morgen werde ich es erfahren, aber ich möchte es heute schon wissen.«
»Von mir erfahren Sie es nicht, mein Herr!« sagte der Meier kurz und stolz, da der Baron zuletzt einen herrischen Ton gegen ihn angenommen hatte.
»Aber, mein lieber Freund, bedenken Sie doch, wie Sie mir gleich einem irdischen Gott helfen könnten. Welch ein Ruhm wäre das für Sie! Meine ganze Familie bewahren Sie vor dem Ruin, Sie machen sich dadurch in der ganzen Umgegend einen Namen – gewinnen einen großen neuen Freundeskreis – der ganze Adel des Landes würde Sie preisen –«
»Herr Baron,« unterbrach ihn der Meier, noch stolzer als vorher das Haupt erhebend, »ich will von Ihrem ganzen Adel nicht gepriesen sein, ich will mir nicht in Ihrem Sinne einen Namen machen, denn ich besitze ihn schon in meinem Sinn, und was Ihre Familie betrifft, so war sie wahrscheinlich in ihrer besten Blüte, wenn sie überhaupt so weit hinaufreicht, nicht edler als die meine, die schon vor tausend Jahren ihre Ritter zählte, und ich gestehe keinem Barone das Recht zu – auch Ihnen nicht – mir in meinem eigenen Hause ins Gesicht hinein zu sagen, daß er sich höher dünke als ich mich dünke, ohne es durch Taten beweisen zu können. Mein Adel, obgleich ich nur ein sogenannter Bauer bin und nichts weiter sein will, liegt in mir, in meiner Moral, in meiner Seele, in meinen Handlungen, während der Ihre, Herr Baron, ganz allein in dem liegt, was Ihre Vorfahren, nach Ihrem Glauben wenigstens, getan oder nicht getan haben. Sie allerdings mögen sich in Ihren eigenen Augen für einen Edelmann halten, mir aber, Herr Baron, ist ein edler Mann lieber, der rechtschaffen ist, ehrlich in Handel und Wandel sich erweist und keinem seiner Nächsten einen Vorschlag macht, wie Sie ihn mir eben ins Gesicht zu schleudern gewagt – das haben Sie Ihrer geheimen Verpfändung von Sellhausen zu danken, Herr Baron!«
Der Baron war ganz starr und steif geworden. Er hatte sich erhoben und sah dem Meier fast drohend ins Gesicht. Aber noch einmal kam ihm seine mißliche Lage ins Gedächtnis, und er schluchzte mehr als er sprach: »Aber, bester Mann, wie können Sie mich so falsch, so ganz falsch verstehen? So meinte ich es ja gar nicht! Ich etwas gegen die Gesetze tun, ich, der loyalste Mann im ganzen Lande? Ei, das wäre ja ganz wider Recht und Gewissen. Jedoch, bedenken Sie noch einmal meine Lage – sie ist, ich gestehe es Ihnen feierlich – verzweifelt! Was wird denn aus meinem ganzen Erbe, wenn ich am ersten November die 80 000 Taler nicht bezahlen kann?«
»Was daraus werden muß!« sagte der Meier streng, der auch aufgestanden war.
»Nun – sprechen Sie es aus!«
»Sellhausen kommt unter den Hammer, und Sie haben wenigstens die Freude gehabt, es neunzig Tage Ihr Gut zu nennen und eine hübsche Summe beim Verkaufe in die Tasche zu stecken. Das ist so klar, wie die Sonne am Himmel da oben.«
»Ein schöner Profit, wo man zehnmal so viel sicher in Händen gehabt – auf Ehre! Und Sie wollen nichts tun, um mich vor diesem Jammer zu bewahren?« flehte der Baron.
»Nichts, Herr von Grotenburg, gar nichts. Wenn ich auch wollte, ich könnte es nicht, und wenn ich auch könnte, ich wollte es nicht. Da haben Sie meine ganze freundnachbarliche Entscheidung.«
Der Baron senkte vor diesen mit energischer Stimme und männlicher Sicherheit gesprochenen Worten den Kopf. Das erste Ziel war verfehlt, es blieb ihm nur noch das zweite übrig, ehe es zum dritten und letzten ging. »Die arme Amalie!« dachte er. »Ich kann ihr nicht helfen und hätte es doch so gern getan. – Sie haben also Ihr letztes Wort gesprochen?« fragte er noch einmal.
»Mein allerletztes, und mit solchen Anträgen beehren Sie mich niemals wieder.«
»So leben Sie wohl!« sagte der Baron höhnisch vornehm grinsend, im Innern aber sagte er: »Hol' ihn der Teufel! Ich habe es vorher gewußt. Der Mensch ist ein Bauer und hat keine edlen Gefühle, kein Herz, keine Ehre – wie unsereins! Ach, warum habe ich mich so erniedrigt und meine Perle vor die Säue geworfen.«
Der Meier begleitete den Baron bis zur Zimmertür, weiter keinen Schritt. Als der Baron abgefahren war, ließ er sein Pferd satteln und, einer kräftigen Bewegung benötigt, setzte er es in scharfen Galopp, um in weitem Bogen nach der Mühle an den blauen Bergen zu reiten und da seinem Freunde zu begegnen, ohne ihn das mindeste von dem eben Erlebten merken zu lassen.
![]()