
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
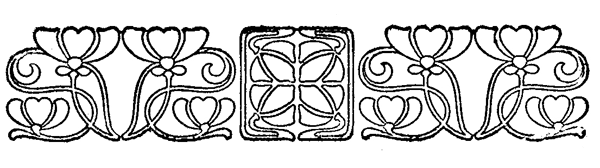
Auf den drückend heißen Tag war eine wundervolle, süß milde Nacht gefolgt, die von dem strahlenden Vollmond feenhaft erleuchtet und noch unendlich verschönert wurde. Der nächtliche Himmel dehnte sich mit seinen zahllosen Sternenheeren in gleichfarbiger Bläue weit über die ruhende Erde aus, und diese selbst sandte als freudige Opfergabe ihren tausendfältigen Duft nach dem so dankbar lächelnden Firmamente empor. Eine milde halbdurchsichtige Klarheit breitete sich zwischen beiden aus und verschmolz sie lieblich miteinander, wie am Tage die unabsehbare Ferne die grüne Erde mit dem dunkelblauen Himmel zu einem wohltuenden Ganzen verschwimmen läßt. Kein Lüftchen regte sich dabei, die Blätter und Blüten ruhten nach dem heißen Sommertage, und ein unendlich befriedigendes Schweigen herrschte ringsum in der ganzen Natur, auf die sich der wohltuende Schlummer niedergesenkt.
Doch nein, nicht ganz schwieg und schlummerte es in den stillen Lüften, denn aus der Ferne drangen verschiedene Töne zu dem wachenden Ohr der Menschen herüber, aber sie beängstigten es nicht, wie bei Tage oft die Fülle der Stimmen in der belebten Natur es so unangenehm berührt. Von verschiedenen kleinen Gewässern her ließ sich, durch die Ferne unendlich gemildert, das melancholische Gequak der Frösche vernehmen, und die kleinen Wellen des Stromes, der seine Fluten unaufhaltsam dem Meere zusendet, murmelten ihr melodisches Lied leise und wohltönend zur Höhe herauf, auf der das wohnliche Sellhausen lag.
Den herrlichsten Genuß aber gewährte der Anblick der zitternden Lichtreflexe, die der Mond auf diesen ewig beweglichen Wellen hervorzauberte, denn in einem langen, fast unabsehbaren Streifen, wie von Gold glitzernd und von Diamanten funkelnd, zogen sie gleich einer leuchtenden Schlange mit den Windungen des Flusses dahin, die sich erst in meilenweiter Ferne in matt rosigem Schimmer verlor.
Wenige Augenblicke später, nachdem die lärmvolle Gesellschaft das gastliche Haus verlassen, weilte auf diesem Anblick und lauschte diesen sanften Tönen ein menschliches Auge und Ohr mit unendlich süßer Befriedigung. Bodo hatte nur wenige Worte mit der emsig beschäftigten Treuhold gewechselt und ihr auf Befragen seine volle Zufriedenheit in betreff ihrer Anordnungen kund getan, dann hatte er sich eine Zigarre angezündet und war auf die oberste Terrasse des Gartens geeilt, wohin ihn ein unwiderstehliches Verlangen und das Bedürfnis nach innerer und äußerer Ruhe zog.
Er hatte in der Tat nicht nur einen höchst unruhigen und qualvollen, sondern wie er meinte, auch nach verschiedenen Richtungen hin einen höchst bedeutungsvollen und wichtigen Tag verlebt. Es gab da so vieles zu bedenken, zu erwägen, im Innern zurechtzulegen, denn nicht nur glaubte er in den vielfachen ihm zu teil gewordenen Besuchen reichlichen Stoff zum Nachdenken zu finden, sondern es wollte ihn bedünken, als seien auch seine bisher völlig dunklen Empfindungen, so dunkel, daß er sich noch in keiner Weise Rechenschaft von ihnen abgelegt, zu klareren Gefühlen zum Durchbruch gekommen.
Daß die Grotenburgsche Familie ihn heute ohne alle Vorverkündigung und in solchem Pompe überfallen, war gewiß kein zufälliges und bedeutungsloses Ereignis. Seine guten Augen waren jederzeit tätig und aufmerksam gewesen und hatten Blicke an den Gästen bemerkt, die ein gewisses geheimes Einverständnis untereinander, eine Absicht, die man konsequent verfolgte, ein bestimmtes Ziel, das man vor Augen hatte, verrieten.
Was das für eine Absicht und für ein Ziel sei, schien ihm nicht schwer zu erraten, allein es lag doch in dem ganzen Benehmen der Leute, namentlich in dem gedrückten Wesen des Barons Grotenburg selber eine gewisse Besorgnis vor irgend etwas, die Bodo nicht ganz klar in das ihn umgebende Verhältnis schauen ließ. Einen ganz anderen Eindruck dagegen hatte das gewöhnliche Betragen des lustigen Barons Haas auf ihn gemacht. Dieser Mann schien ihm der Vorkämpfer in dem Kriege zu sein, der zwischen ihm und jener Partei auszubrechen drohte, und der Feldzugsplan wie das Ziel dieses vorlauten Lebemanns war allerdings schon leichter ins Auge zu fassen. Unbedingt hatte er daher, da er sich kräftig genug fühlte, dem in der Ferne winkenden Kampfe entgegenzutreten, die Zusage seiner Teilnahme an dem Feste des dreißigsten Juli gegeben, eines Festes, welches dem ersten August, dem Tage der Testamentseröffnung, so nahe lag, daß es leicht war, einen gewissen inneren Zusammenhang zwischen beiden Tagen zu argwöhnen. Mochte dies aber sein, wie es wollte, ja, mochte man selbst einen kleinen Hinterhalt gelegt haben, Zwang konnte ja auf keine Weise gegen einen Mann ausgeführt werden, der freier Herr seiner Entschließungen und überdies den Überredungskünsten oder gar der Verführung, auf welchem Wege man ihm nun beizukommen suchen wollte, vollkommen gewachsen war.
Von der Betrachtung dieses unerquicklichen Verhältnisses ging nun Bodo in seinem Nachsinnen zu dem unerwarteten Erscheinen der Besitzerin der Cluus über. Er mußte unwillkürlich lächeln, als er an den Empfang dachte, den sie den drei Familien hatte zu teil werden lassen, obwohl ihm, als er demselben persönlich beiwohnte, nicht behaglich zu Mute gewesen war. Hatte die alte Frau vielleicht eine Ahnung gehabt, daß sie mit ihrer Nichte und deren Familie auf Sellhausen zusammentreffen würde, oder war es ein Zufall gewesen, der sie herbeigeführt und nun den Zusammenstoß zu Wege gebracht? Bodo war sich hierüber nicht ganz klar; den Meier hatte er leider nicht mehr danach fragen können, obwohl es bei ihm nicht dem geringsten Zweifel unterlag, daß dieser von dem Besuche der Frau Birkenfeld gewußt habe.
Allein auch über das in diesem Vorfall liegende Rätsel dachte Bodo in dieser Abendstunde nicht allzu lange nach. Was konnte es ihm auch helfen, da der eigentliche Kern der Wahrheit doch unerreichbar blieb? Es gab vielmehr da noch etwas ganz anderes in seiner Seele, was einer Aufklärung, einer Enträtselung bedurfte, und das waren seine eigenen Empfindungen, die sich zu halb bewußten Gefühlen zu gestalten begannen, worüber er im ersten Augenblick zwar fast erschrak, die aber doch wieder, ihn in ein süß wonniges Behagen einzulullen, vollkommen geeignet waren.
Er hatte an diesem Tage einen Anblick gehabt, der ihm immer noch frisch und lebhaft vor Augen stand, und dieser Anblick hatte gleichsam mit unwiderstehlicher Gewalt an seinem bisher verschlossenen Innern gerüttelt, eine ganz neue Anschauung der Verhältnisse und Menschen in ihm wachgerufen und schließlich ein geheimes Fach seiner Seele eröffnet, zu dem er bisher selbst keinen Schlüssel gehabt und das also aller Welt verborgen geblieben war.
Jener seltsame Anblick nun – wir meinen den, als er die einfache, stille Gertrud vor der glänzenden und prunkvollen Tochter des stolzen Barons stehen sah – beschäftigte ihn auf eine unbegreiflich lebhafte Weise und zog sein ganzes Denken und Fühlen auf einen Punkt, der – ach! schon manchen ernsten gediegenen Mann wie mit einer Feuerzange gepackt, ihn um so fester gehalten und tiefer verwundet hat; je weiter entfernt er davon bisher in seinem Leben geblieben war und je weniger er seinem Kopfe gestattet, in den geheimnisvollen Zauberkreis zu treten, den nur die Empfindungen eines warm schlagenden Herzens beherrschen.
Von dieser nicht immer ganz gefahrlosen Feuerzange – man verzeihe die Wiederholung dieses nicht gerade poetischen Bildes – zwar nur erst von ferne und ganz leise gefaßt, und vor allen Dingen sich bemühend, in die ihn umgebenden Verhältnisse Ordnung und Klarheit zu bringen, wandelte Bodo nun auf der obersten Terrasse langsam hin und her. Seine Brust dehnte sich dabei weit aus, und er sog mit Entzücken die balsamische Nachtluft ein, der tausend Blüten ihren Duft und ihre berauschende Macht geliehen, und die der sternenbesäete blaue Himmel mit dem großen göttlichen Nachtauge, die einlullende Stille um ihn her und jene große geheimnisvoll leuchtende Wasserschlange so unendlich lieblich und genußreich machte.
Aber da zog ihn der klagende Ton einer verspäteten Nachtigall, die er schon seit mehreren Abenden im Lindensaal belauscht, seitwärts und langsam trat er auch jetzt in die vordere Tür des dunklen Blätterdomes, um sein Ohr zu erfreuen und dadurch vielleicht auch seinem hämmernden Herzen eine süße Labung zu bereiten. Der Lindensaal lag still und einsam wie immer da. Es herrschte fast vollständige Dunkelheit in seinem weiten Innern; nur auf die höchsten Spitzen der Baumwipfel ließ der Mond sein silbernes Licht fallen, so daß es auch an dem grünen Gewölbe da oben flimmerte und blitzte, nur stiller und schwächer, als in den höheren freien Regionen da draußen, in deren ungemessenen Räumen die glanzvollen Sterne selber ihre Wohnung haben.
Bodo trat in den friedlichen Raum ein und da die Nachtigall in diesem Augenblick schwieg, setzte er sich geduldig wartend auf die nächste Bank, bald wieder in die dämmernde Traumwelt versinkend, die ihn noch eben im Freien umgaukelt.
Allein er hatte noch nicht lange seinen Platz behauptet, so begann die Nachtigall wieder ihren köstlichen Gesang. Aber merkwürdig, sie schmetterte plötzlich ganz fröhlich, als hätte sie ihre Klage ausgeschüttet und wolle nun einmal ein Jubellied anstimmen. Bodo horchte entzückt auf und neigte sein Ohr aufmerksam den Tönen des kleinen Geschöpfes zu, welches an der entgegengesetzten Seite des Lindensaales ungefähr in der halben Höhe eines Baumes zu sitzen schien.
Bodo hatte schon einige Minuten zugehört, da wandelte ihn plötzlich die Neigung an, dem Vogel näher zu treten und sich seines Sitzes zu vergewissern, wie man oft auch bei Tage bei dergleichen Veranlassung tut, als habe man einen Genuß davon, das kleine unscheinbare Wesen auch mit den Augen zu erblicken, das unser Ohr so süß berauscht.
Langsam schritt er durch den langen Raum, ruhig seine Zigarre weiter rauchend, die rot glühte, und dadurch seine Anwesenheit sichtbar verriet, wenn man sie auch sonst nicht wahrgenommen hätte. Als er aber ungefähr die Mitte des Lindensaales erreicht und sein Auge sich bereits an die Dunkelheit darin gewöhnt hatte, so daß er schon seine nächste Umgebung unterschied, blieb er plötzlich stehen und ein jäher Schreck durchfuhr seine Glieder.
Er hatte in der entferntesten Ecke, der er eben zuzuschreiten im Begriffe stand, ein eigentümliches Rauschen vernommen und gleich darauf erhob sich eine menschliche Gestalt von der in der Ecke stehenden Bank, als wolle sie schnell aus dem zweiten Ausgange flüchten, der auf derselben Stelle lag, wo die Nachtigall geschlagen.
Bodo stand also still, strengte seine Augen, sobald er den ersten Schreck überwunden, möglichst an und suchte die vor ihm liegende Dunkelheit zu durchdringen. »Ist jemand hier?« brachte er endlich mit unsicherem Tone hervor, als gebe es eine Gewalt in der Welt, eine geheimnisvolle, aber zwingende Gewalt, die seine Sprache beherrschte und, seltsam genug, auch sein männliches Herz zu schnellerem Schlagen veranlaßte.
»Ja, Herr von Sellhausen, ich bin es, und ich bitte um Entschuldigung, daß ich Sie störte. Ich wußte nicht, daß Sie hierher kommen würden.«
Die Stimme, eine wohlbekannte, liebe, süße Stimme, hatte es gesprochen, und wie seltsam war die Wirkung, die sie auf den sie hörenden und sogleich stehen bleibenden Mann hervorbrachte! Die Feuerzange, von der wir vorher gesprochen, packte ihn aus näherer Ferne und fester, wie von einer allmächtigen höheren Hand in Bewegung gesetzt; dieselben unbestimmten, seltsam wonnigen Gefühle, der Mark und Bein durchdringende Schauer, die am Nachmittage dieses Tages ihn schon einmal durchzittert, machten sich in intensiver Kraft und Fülle bemerkbar und bewegten den starken Mann so sehr, daß er kaum imstande war, sogleich eine Antwort zu finden, noch weniger aber sie laut auszusprechen. Dabei sauste es vor seinen Ohren wie ein gewaltsam vorüberrauschender Windstoß. Die Blutwellen in seiner Brust jagten sich stürmisch aufeinander, er fühlte selbst, daß sein Kopf wirbelte und daß eine unsagbare, unwiderstehliche Gewalt sich seiner ganzen Empfindung, seines ganzen Wesens bemächtigte.
»Gertrud!« sagte er endlich mit möglichster Ruhe und Fassung, indem er seine kräftige Stimme zu sanfteren Tönen zwang – »Sie sind es! Ich erkenne Sie. O, verzeihen Sie mir selber, daß ich Sie gestört. Auch ich wußte nicht, daß der Platz besetzt war, sonst hätte ich meinen Weg wo anders hingelenkt.«
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so bereute er sie auch schon, wenigstens den Schluß derselben. Um ihn aber rasch wieder gut zu machen, trat er schnell dem jungen Mädchen nach, das aus dem hinteren Ausgange des Lindensaals geschlüpft und in einen breiten Weg getreten war, auf den der Vollmond seinen ganzen strahlenden Glanz niedergoß.
Wie es geschah, daß er dicht an ihre Seite gekommen, wußte er selber nicht, indessen war keine halbe Minute verstrichen, so wandelte er langsam neben der nach dem Hause Zurückkehrenden hin, ohne imstande zu sein, ein Wort weiter zu sprechen, um so weniger, da auch Gertrud in ein ungewöhnliches Schweigen versunken blieb. Als nun aber beide, immer noch schweigsam, die Stelle der Terrasse erreicht, wo die Gesellschaft am Nachmittag ihren Kaffee getrunken, blieb er plötzlich stehen, streckte seine Hand aus, als wollte er seine Gefährtin an den Ort fesseln, ohne sie jedoch zu berühren, und sagte:
»Es ist eigentlich närrisch, daß wir beide so ohne allen Grund wie vor einem uns bedrohenden Feinde davonlaufen und uns dadurch den schönsten Genuß an einem so schönen Abend verkümmern. Keiner von uns hat um Entschuldigung zu bitten, denn keiner tat dem andern irgend etwas zuleide. O bleiben Sie noch einen Augenblick – und sehen Sie dahin. Ist der golden blitzende und wie eine feurige Schlange fortzitternde Widerstrahl des Mondes im Wasser nicht schön? Lächelt der sternenklare Himmel nicht unendlich gütig und freudenvoll auf uns hernieder? Duften die Blumen nicht mit unendlicher Süße um uns her? – Wenn Sie einen Genuß an dem allen finden, o so möchte ich um keinen Preis derjenige sein, der Sie darin stört, und so wollen wir beide uns darin vertiefen, indem wir ihn teilen – meinen Sie nicht?«
Gertrud antwortete anfangs nicht, dann aber sagte sie mit etwas gedämpfter Stimme, als habe sie noch nicht ganz den ersten Eindruck ihrer Überraschung überwunden: »Gern, Herr Legationsrat, wir wollen ihn teilen – ja, Sie haben recht, es ist dies ein wonniglicher Anblick in so milder, schöner und friedvoller Nacht!«
»Und doppelt wonnig nach einem solchen Tage der Unruhe, der Selbstbezwingung, der großen Gewalt, die man sich antun mußte, um ein heiteres Gesicht zu zeigen, wo man lieber düster geblickt hätte.«
Gertrud schwieg wieder, obgleich sie bei den letzten Worten etwas lebhafter zu atmen begann, was ihr Gefährte jedoch nicht bemerkte und höchstens aus dem bewegten Tone ihrer Stimme schließen konnte, als sie endlich weiter sprach.
»Ich habe Sie noch einmal um Ihre Verzeihung anzusprechen,« fuhr Gertrud fort, »und bitte Sie, mir dieselbe angedeihen zu lassen, Herr Legationsrat.«
Bodo richtete sein leuchtendes Auge verwundert auf das hell vom Monde beschienene Gesicht der Redenden, die diesem Blick aber nicht mit ihrem Auge begegnete, sondern dasselbe niedergeschlagen hielt.
»Was wollen Sie sagen?« fragte er.
»Tante Treuhold hat mir gesagt, daß Sie unwillig waren, weil ich –«
»O, bitte, reden Sie nicht davon,« unterbrach er sie. »Unwillig war ich übrigens nicht, nur erstaunt, daß Sie – daß Sie – doch still, lassen Sie uns lieber darüber schweigen. Wenn mir jener unerwartete Vorfall, den Sie meinen, in einer Beziehung auch wehgetan hat – ja, das ist das rechte Wort – so hat er mir in anderer auch wieder unendlich wohlgetan.«
Gertrud hob das schöne Auge fragend zu ihm empor und Bodo glaubte sogar jetzt den warmen Strahl zu empfinden, den dieses sanfte blaue Auge zu werfen die Kraft und das Feuer besaß. »Jetzt verstehe ich Sie nicht!« sagte sie mit ihrer alten Offenheit.
Bodo bemerkte sogleich diesen Wechsel ihrer Stimmung und lächelte sanft. »Kommen Sie,« sagte er, »lassen Sie uns hier noch ein wenig herumspazieren, wir können ja unsere Unterhaltung dabei fortsetzen.«
Gertrud folgte ihm sogleich. Bodo aber fuhr im Sprechen fort. »Sie verstehen mich nicht,« sagte er, »und ich glaube Ihnen das wohl. Ich verstehe mich sogar selbst noch nicht ganz und es ist ein wundersam Ding, wenn man sich dann einem andern klar machen will. Darum lassen Sie uns hiervon abbrechen und sagen Sie mir lieber, wie der heutige Tag auf Sie gewirkt hat.«
»Auf mich?« fragte Gertrud erstaunt.
»Ja, auf Sie, denn er hat doch ganz gewiß auf uns alle eine bestimmte Wirkung hervorgebracht.«
»Ich habe darin kein bestimmtes Urteil. Ich bin ja auf Ihren Wunsch und später auf den der Tante Grete fern von der Gesellschaft geblieben. Aber ich dächte – ich dächte – auf Sie könnte diese Wirkung nicht ganz von der Art gewesen sein, daß Sie, wie Sie vorher sagten, hätten düster blicken mögen.«
Bodo stand wieder still und sah Gertrud von der Seite erstaunt an. »Wie,« sagte er, »wie meinen Sie das? Ah, sollte ich mich nicht täuschen? Sie deuten auf mein Verhältnis zu den Grotenburgs hin, wenn man meine Lage, Ihnen gegenüber, ein Verhältnis nennen kann.«
»O, gewiß ist das ein Verhältnis und ein sehr eng umgrenztes – so sollte ich wenigstens meinen.«
»Ja, ja,« sagte Bodo nachsinnend, »Sie haben eigentlich recht. Ein Verhältnis ist da und ein recht hübsches und zärtliches sogar!« Und er lachte still vor sich hin, worin sich unleugbar ein bitteres Gefühl aussprach. »Natürlich,« fuhr er fort, »wissen Sie von Ihrem Vater, um was es sich hier handelt, nicht wahr?«
»Jawohl, ich weiß es.«
»So. Nun, dann brauchen wir ja keine Geheimnisse vor einander zu haben. Das ist angenehm. Wie hat Ihnen denn Fräulein Klotilde gefallen?«
Gertrud sah ihn flüchtig mit einem raschen Blick von der Seite an. Sein Gesicht war ernst, fast streng auf sie gerichtet und aus seiner Stimme klang ein fremder Ton heraus, der etwas ungemein Kaltes hatte.
»Darüber lassen Sie mich schweigen,« sagte Gertrud entschieden. »Es würde sich für mich nicht ziemen, Ihnen meine Meinung über eine Dame zu sagen, der Sie, wie man sagt, einst so nahe treten sollen.«
»Sollen! Ja, das ist das Wort, aber es ist nicht richtig, paßt wenigstens auf mich nicht. Mich zwingt nichts auf der Welt, wenn ich mich nicht selbst zu etwas zwinge. Doch – weg mit der Wortspielerei – ich liebe die Maskeraden nicht und sehe gern jedem Menschen mit freiem Auge frei ins Herz. Sagen Sie mir also, wie Ihnen diese Dame gefallen hat. Ich bitte darum.«
In den letzten Worten lag wirklich eine Bitte, schon in dem Tone, womit sie gesprochen wurden. Dieser Ton übte stets eine große Wirkung aus, auf alle, die ihn hörten, auch auf Gertrud. »Sie ist hübsch,« sagte sie auch sogleich ohne Ziererei, »das ist keine Frage, aber sie macht sich weniger hübsch dadurch, daß sie noch hübscher erscheinen will, als sie ist. Das ist mein ganzes Urteil und mehr kann ich nicht sagen.«
»Sie haben auch genug gesagt. Ich danke Ihnen. Das ist ganz meine Meinung. O – Sie glauben nicht, wie froh ich bin, daß dieser Tag vorüber ist. Zum erstenmal seit langer Zeit habe ich mir wieder Gewalt antun müssen und das stimmt mich nicht froh. Jetzt aber ist es vorbei, die Stunde ist auch durch diesen rauhen Tag gerannt und wir haben einen ruhigen friedlichen, einen – glücklichen Abend.«
Gertrud bebte vor diesem stark betonten Worte zusammen. Ihr Busen hob sich, wie er sich bei der seltsamen Frage der alten Frau gehoben, und sie schaute zu Boden, als suche sie daselbst etwas.
Beide waren auf ihrem Gange unwillkürlich auf die zweite und dritte Terrasse niedergestiegen, anstatt nach dem Hause zu gehen, wohin Gertrud zurückkehren gewollt, und hier merkte sie plötzlich, daß sie von ihrem Wege abgewichen war.
»Es wird spät,« sagte sie mit einiger Befangenheit, »ich möchte lieber ins Haus geben.«
»So kommen Sie. Aber da haben wir den steilen Berg vor uns. Geben Sie mir Ihren Arm.«
Gertrud legte sanft ihren vollen runden Arm in den seinigen und nun bebte Bodo unwillkürlich zusammen. Die Berührung regte seinen Herzschlag wieder auf, der sich schon beruhigt hatte, der alte Schauer kam wieder und es war, als ob eine große mächtige Welle sich in ihm bewege und bis in seinen Kopf hinauf ihre dröhnende Wucht wälze. Er schwieg, denn er mußte schweigen, weil er nicht reden konnte. Auch Gertrud schwieg. Ihre Kleider aber streiften, wie es bei so nahem Zusammengehen natürlich war, an ihren Begleiter an und dieses Streifen befeuerte merkwürdigerweise seinen Pulsschlag nur noch mehr und die große innere Woge stieg immer höher empor. Er atmete laut. Auch Gertruds Atem wurde kürzer. Endlich aber waren sie oben und standen einen Augenblick still.
»Gertrud,« sagte da Bodo und nahm den Arm des Mädchens aus dem seinen, hielt aber wider Wissen ihre Hand fest, »ich habe heute einen sauren, einen bitteren, ja, einen schweren Tag verlebt. Aber diese halbe Stunde am Abend hat ihn aus meiner Erinnerung verwischt und ich bin wieder zufrieden, ja vielleicht noch zufriedener, als ich heute morgen war. Soviel für heute. Grüßen Sie Ihre Tante von mir. Ich mag heute nicht mehr mit ihr sprechen, denn ich habe noch viel mit mir selbst zu sprechen. Morgen aber, morgen in aller Frühe, wenn wir uns alle von unsrer Anstrengung ausgeruht, wollen wir plaudern über das, was heute geschehen, und ich hoffe, wir können es mit aller Ruhe tun. Gute Nacht und schlafen Sie recht wohl. Ihrem Vater aber bin ich doppelt dankbar, daß er gekommen ist und Frau Birkenfeld in Beschlag genommen hat. Ah, da bin ich schon wieder mit meinen Gedanken, wo ich nicht sein sollte – und darum – gute Nacht!«
Er ließ ihre Hand langsam los, sie verneigte sich und bald war sie im Innern des Hauses verschwunden, in das Bodo erst nach einer Stunde einsamen Umherwandelns und Nachdenkens zurückkehrte.
*
Der Menschen Gedanken und Wünsche im großen und ganzen erreichen im Leben sehr häufig ihr Ziel, aber doch bei weitem nicht immer, und oft sogar wird vor die Erfüllung der kleinsten und unbedeutendsten unvermutet ein Riegel geschoben. So sollte auch aus der Plauderei über den vergangenen Tag, wie Bodo gehofft und gesagt, am nächsten Morgen nichts werden, und zwar aus einer Ursache, die niemand hatte vorhersehen können.
Als der Legationsrat am nächsten Morgen etwas später als gewöhnlich aufstand, denn er wurde durch eine auffallende Abspannung in langem Schlafe festgehalten, fand er in seinem Zimmer, das, seitdem Frau Birkenfeld und Gertrud es verlassen, noch niemand wieder betreten hatte, in der Ecke des Sofas eine grüne Samttasche, fest verschlossen und auf allen Seiten dicht zusammengefügt, die nach dem äußeren Gefühl zu urteilen, Papiere enthielt. Der Finder glaubte, Fräulein Treuhold habe sie bei ihm liegen lassen, und so genoß er ruhig sein Frühstück, mit dem Vorsatz, die Tasche mit hinunter zu nehmen und sie der Eigentümerin einzuhändigen, wenn er zum zweiten Frühstück hinabginge, da das Wetter zu einem Morgenspaziergang im Garten nicht einladend genug war.
Es wehte ein feuchter mit Regen drohender Wind aus Westen, wonach die Natur schon lange schmachtete, denn die Hitze war anhaltend und mit einer großen Dürre verbunden gewesen.
Indessen fiel Bodo zur rechten Zeit ein, was er mit Gertrud am Abend zuvor verabredet, und da es ihn nicht länger im Zimmer dulden wollte, so ging er wohl eine Stunde vor der eigentlichen Frühstückszeit hinab und traf das alte Fräulein eben beim Ordnen des Tisches an.
Nachdem er sie begrüßt, reichte er ihr die Tasche hin und sagte: »Hier haben Sie Ihre Tasche. Sie haben sie gewiß auf meinem Zimmer liegen lassen, denn sie lag in der Sofaecke.«
»Um Verzeihung, Herr von Sellhausen,« lautete die unerwartete Antwort, »ich bin gestern gar nicht auf Ihrem Zimmer gewesen und kenne die Tasche auch nicht. Aber Frau Birkenfeld hat mit dem Meier und Gertrud lange darin gesessen, und am Ende hat sie sie oben liegen lassen.«
»Ist Ihre Nichte nicht da?« fragte Bodo einigermaßen betroffen, als er diese Mitteilung vernahm.
»Ich werde sie sogleich rufen; sie schreibt sehr emsig einen Brief,« sagte Fräulein Treuhold.
Nach wenigen Minuten trat Gertrud mit rosigem Gesicht herein, und als sie die Tasche sah, erklärte sie sogleich, daß sie Tante Grete gehöre, und daß diese über ihren Verlust sehr empfindlich sein werde, da dieselbe, soviel sie wisse, wichtige Dokumente enthalte und fast nie von ihrem Arme komme, wenn sie außer dem Hause sei.
»Dann muß sie sie so bald wie möglich wieder haben,« entgegnete Bodo, »und ich selbst werde sie sogleich nach der Cluus bringen.«
Gertrud antwortete nicht, schien aber etwas Wichtiges zu überlegen und warf dann ihrer Tante einen bedeutungsvollen Blick zu.
»Ich kann heute zu Wasser hinfahren,« fuhr Bodo fort, »das geht schneller, da wir guten Segelwind haben, ich will mir sogleich ein paar Ruderer bestellen. Lassen Sie uns bald frühstücken, Liebe, die Tasche hat Eile.«
»Ah,« sagte da Fräulein Treuhold plötzlich, während Gertrud ganz leise das Zimmer verließ, »das trifft sich herrlich, Herr von Sellhausen. Wenn Sie nach der Cluus fahren, bleiben Sie doch gewiß zu Mittag da?«
»Das könnte wohl geschehen. Warum fragen Sie so?«
»Weil ich die Absicht hatte, heute mit Gertrud, falls Sie nichts dagegen haben, nach der Stadt zu fahren.«
»Was soll ich dagegen haben – fahren Sie alle Tage hin. Aber was wollen Sie in der Stadt?«
Fräulein Treuhold machte sich irgend etwas im Zimmer zu schaffen, wobei sie das Gesicht abwenden konnte und sagte: »Wie Sie auch fragen! Hat denn ein junges Mädchen nicht manches Bedürfnis aus der Stadt zu beziehen? Sie will Einkäufe machen, und ich auch, und da können wir gleich beide unsern Geschäften nachgehen.«
»Gut, tun Sie das. Dann treffen wir uns also erst gegen Abend wieder?«
Mit diesen Worten trug er die Tasche auf sein Zimmer zurück, verschloß sie und ging dann in den Hof, um Herrn Hinz aufzusuchen, der die Leute zu bestimmen hatte, die den Nachen nach der Cluus rudern sollten.
Kaum aber war er aus der Treuhold Zimmer getreten und diese hatte ihn im Hofe beschäftigt gesehen, so öffnete sie die Tür nach Gertruds Stübchen, die eben einen schon adressierten Brief zusiegelte und rief:
»Trude, nun rasch, jetzt ist die rechte Zeit, wenn wir es vollbringen wollen. Er könnte am Ende nachher sein Zimmer zuschließen, wie er bisweilen aus Zerstreutheit tut.«
Gertrud stand schon bereit, der Brief war versiegelt und lag auf dem Tische. Sie sah ihre Tante mit geröteten Wangen an, atmete kürzer als gewöhnlich und sagte beklommen: »Ja, Tante, wenn es sein muß, wollen wir es tun. Aber ich zittere, wenn ich an eine Entdeckung denke.«
»Ich nicht, er ist nicht so schlimm, und deine Tante Grete, wie du sie nennst, muß alle Verantwortung tragen. Nun schnell, er könnte sonst zurückkommen. Du aber mußt dabei sein, denn ich verstehe mit dem Dinge nicht umzugehen.«
Die beiden Frauen warfen noch einen raschen Blick nach dem Hof, und da sie den Legationsrat mit dem Verwalter langsam nach den Feldern gehen sahen, huschten sie aus dem Zimmer, wie zwei flüchtige Schatten, sprangen hurtig die Treppe hinauf und betraten des Abwesenden Zimmer, wo sie sich einige Minuten zu schaffen machten, dann aber mit ängstlicher Miene, als hätten sie einen Diebstahl vollführt, in das untere Stockwerk zurückkehrten und den Tisch ordneten, um das Frühstück baldmöglichst auftragen zu lassen.
Nach einer halben Stunde stand es auch schon bereit, und da sich Bodo pünktlich dazu einfand, aß man rasch, weil alle drei einige Eile zu haben schienen, zumal die Frauen, die diesmal nicht schnell genug aus dem Bereiche der scharfen Augen des Legationsrats kommen zu können glaubten.
Da Herr Hinz an dem Frühstück teil nahm, sprach man wenig über den vergangenen Tag, auch schienen die beiden Frauen zu einer ernsten Unterhaltung kaum aufgelegt zu sein, was Bodo nicht entging, es jedoch auf die beabsichtigte Reise schob, da dergleichen Frauen immer in einigen Anspruch zu nehmen pflegt. Nachdem aber Herr Hinz sich entfernt, um, wie er sagte, nach dem Wagen zu sehen, der die Damen fortbringen sollte, wandte sich Bodo nach Gertrud um, deren Miene ihm doch zu befangen vorkam, als daß die Reise allein sie verschulden sollte, und sagte:
»Aus unserer Morgenplauderei ist nun nichts geworden, Fräulein Gertrud, aber dafür wollen wir am Abend nachholen, was wir jetzt versäumt. Wissen Sie aber, wie Sie aussehen?«
»Nun?« fragte Gertrud, wieder errötend und ihre Augen niederschlagend, was sonst nicht ihre Art war.
»Als ob Sie etwas auf dem Herzen hätten, was nicht darauf liegen soll.«
»Ihre Augen sind fast zu scharf,« bemerkte Gertrud, mit Mühe lächelnd, »und auch diesmal haben Sie richtig erraten, daß etwas auf meinem Herzen liegt. Ob es aber etwas ist, was nicht darauf liegen soll, mögen Sie gleich selbst entscheiden. Ich habe einfach eine Bitte auszusprechen, und nur der Gedanke, Sie möchten sie übeldeuten, setzt mich in einige Verlegenheit.«
»Ah, ist es das? So sprechen Sie.«
»Ich habe der Tante Grete einen Brief geschrieben – sie hat mich um Auskunft über mancherlei gebeten, was ich ihr gestern in der Hast nicht sagen konnte. Hätten Sie wohl die Güte, ihr diesen Brief mit meinem Gruß zu überbringen? Sie ist eine Freundin von sicheren Boten, und Sie sind gewiß der allersicherste.«
Bodo lächelte, als könne er die Verlegenheit, eine so kleine Bitte auszusprechen, nicht recht begreifen, und sagte nur: »Geben Sie gleich den Brief her, er soll sicher bestellt werden.«
Zwei Minuten später hatte er ihn in der Tasche und gleich darauf von den Damen Abschied genommen, die in ihren Wagen stiegen, während Bodo nach der Weser hinabschritt, wo ihn schon zwei Leute vom Hofe erwarteten, die mit Segeln und Rudern umzugehen verstanden.
Die Wasserfahrt ging schnell und günstig von statten, denn schon nach einer guten Stunde legte das Boot, trotzdem es gegen die Strömung gefahren, an dem Landeplatz der Fähre vor der Cluus an. Bodo gebot den Leuten, ihn zu erwarten, wenn er auch lange ausbliebe, und schritt nun, seine Tasche unter dem Paletot am Arm, und den Brief in der Rocktasche tragend, ruhig den grünen Abhang hinan, ohne wie das erste Mal Frau Birkenfeld am Fenster wahrgenommen zu haben. Die Erklärung davon sollte ihm jedoch bald zu teil und damit zugleich eine Überraschung bereitet werden, die er gewiß am wenigsten erwartet und gewünscht, als er den Weg hierher angetreten hatte.
Die Tür wurde ihm, nachdem er geschellt, von Dina geöffnet, die, ihn sogleich wiedererkennend, sichtbar erschrak, als sie ihn plötzlich vor sich sah. Das alte Mädchen wurde erst blaß und dann blutrot und bat den Herrn Legationsrat, in ein Zimmer zur linken Hand zu treten, da die Frau Birkenfeld eben Besuch habe und mit dem Herrn in ihrer Stube spreche.
Nachdem Dina Bodo eingeführt, entfernte sie sich rasch, um das Neueste sogleich Boas mitzuteilen und mit ihm eine Beratung zu halten, was unter diesen Umständen zu tun sei, da ihrer Gebieterin Unterhaltung mit einem Besucher niemals durch einen andern gestört werden durfte. Kaum aber hatte Boas erfahren, wer da sei, so kam er selbst zu dem Legationsrat ins Zimmer gestürzt und betrachtete den jungen Mann mit bebenden Lippen und sprühenden Augen, aber im ganzen mit einem so ehrfurchtsvollen Wesen, als ob er eine hohe Person vor sich habe.
»Ach Gott, Herr Legationsrat,« sagte er, »wie würde sich Frau Birkenfeld gefreut haben, wenn Sie heute zuerst gekommen wären! Aber da hat sie drüben einen Besuch, der ihr gewiß nicht halb so angenehm ist.«
»Wer ist es denn?« fragte Bodo, der dem guten Alten eine gewisse Angst und Beklommenheit anmerkte und doch von seiner Freude, ihn wiederzusehen, befriedigt wurde.
Boas näherte sich ihm mit geheimnisvoller Miene, riß die Augen weit auf und sagte mit halb flüsternder Stimme, als dürfe niemand seine Mitteilung vernehmen: »Es ist der Herr Baron von Grotenburg, Herr Legationsrat!«
»Wie,« rief Bodo voller Erstaunen aus, »Baron von Grotenburg? Ist's möglich! Und wie lange mag er wohl bleiben?«
»O, gewiß nicht länger, als nötig ist,« erwiderte Boas mit schlauem Lächeln, » der Herr wird stets kurz abgespeist. Er ist schon eine halbe Stunde da, und ich denke, er wird bald genug haben. Haha! Wollen Sie aber nicht so lange in den Garten treten?«
»Darf ich es denn, wenn Ihre Herrin nicht dabei ist?«
»Sie? Ei, warum nicht? Sie dürfen überall hin, das weiß ich gewiß.«
»So kommen Sie, wenn Sie die Verantwortung übernehmen wollen.«
Boas führte den Gast seiner Herrin nun selbst durch das Treibhaus und den Glassaal in den schönen Garten und zeigte ihm manches Neue und Seltene, wozu ein eifriger Gärtner ja immer reichliche Gelegenheit hat. Dabei aber blickte er mehr auf den Gast als auf seine Blumen hin, und wenn dieser ihn nicht gerade ansah, betrachtete er ihn mit einem Ausdruck von Zärtlichkeit, der mit herzlicher Rührung innig gepaart war.
Um aber den Leser von der Unterhaltung in Kenntnis zu setzen, die zwischen Frau Birkenfeld und Baron Grotenburg in diesem Augenblick stattfand, wollen wir zu der Ursache übergehen, welche den letzteren zu so ungewöhnlicher Zeit nach der Cluus führte, eine Ursache, die offenbar von Bedeutung sein mußte, da er nur selten hier erschien und nun sogar gekommen war, nachdem er erst am Tage vorher einen so üblen Empfang von seiten der alten Dame erfahren hatte.
*
Die Nachhausefahrt der drei Familien in der vergangenen Nacht war auf der einen Seite sehr laut, auf der andern dagegen sehr schweigsam von statten gegangen, je nachdem die Lebensgeister der einen durch den überreichen Weingenuß sehr erregt, die Gemüter der andern aber durch die verschiedenen Erlebnisse mehr oder weniger beunruhigt und niedergedrückt worden waren. In dem Wagen des Barons Kranenberg herrschte noch die meiste Ruhe vor, obwohl der Baron selbst sich sehr gern in Beifallsrufen ergangen hätte; allein er war daran gewöhnt, in Gegenwart der frommen Theodolinde und des heiligen Mannes seinen Mund zu halten, und so hielt er ihn auch diesmal. Baron Haas hingegen ward durch nichts in seiner guten Laune gehindert und er kehrte überglücklich in sein Haus zurück, wovon er schon unterwegs durch lautes Schreien und Singen die deutlichste Kunde gegeben. Er war so von der Überzeugung durchdrungen, daß alles prächtig gegangen, und in Zukunft das Beste zu erwarten sei, daß niemand auf der Welt imstande gewesen wäre, ihm eine Ahnung des Gegenteils beizubringen. Vorzüglich aber war er dadurch beglückt, daß seine Umsicht und Klugheit das Größte und Schwerste geleistet und daß man nur ihm für den günstigen Erfolg der Unternehmung verpflichtet sei. Er überschlug sich fast vor Übermut, hielt in seinem Sinn den Legationsrat für einen leicht lenkbaren Mann, wenn man ihn nur an der rechten Seite zu packen wisse, und vermaß sich hoch und teuer, aus und mit ihm alles zu machen, was nur aus einem Menschen zu machen sei, den man zum eigenen Besten auf einen bestimmten Weg des Handelns und Wirkens leiten wolle.
Mit ganz entgegengesetzten Empfindungen waren die Grotenburgschen Eheleute nach Hause zurückgekehrt und in ihrem Innern gab es eigentlich nichts, was, für den Augenblick wenigstens, eine bestimmte Aussicht auf den notwendigen Sieg erkennen ließ. Nachdem sie sich von der leichtfertigen Tochter rasch getrennt, die singend und tänzelnd ihr Zimmer suchte, und schon dadurch befriedigt war, daß man heute auf Sellhausen mit silbernen Messern und Gabeln gespeist, ließen sie sich in der Baronin stillem Zimmer nieder, um eine ernstliche Beratung miteinander zu halten, denn seltsamerweise war die gnädige Frau diesmal mit ihrem Gemahl über die Hauptpunkte des verlebten Tages einig, sie wie er hatten diesmal mit offenen Augen ihre Beobachtungen angestellt und sich weniger von ihren Wünschen und Hoffnungen betören lassen, als der liebe Schwager vom Kolkhof.
Was zunächst den Schwiegersohn » in spe« betraf, so waren sie mit der Aufnahme, die ihnen bei ihm zuteil geworden, ziemlich zufrieden, ja, sie hatten ihn sogar viel aufmerksamer, höflicher, selbst freundlicher gefunden, als sie ihn zu finden erwartet. Auf dieser Seite war also ihre Hoffnung auf einen günstigen Ausgang der wichtigsten Angelegenheit der Gegenwart nicht trübe zu nennen. Auch sein ganzer Besitz, Haus und Hof, Garten und Feld hatten ihnen wohlgefallen, und der Gedanke, dies alles in kürzester Zeit ihrer Tochter zufallen zu sehen, hatte etwas so Verführerisches für sie, daß sie alle Segel aufzuspannen beschlossen, um ihr Schiff in den richtigen Hafen zu steuern.
Allein ein ganz anderes Ding war es mit dem Besuche der Frau Birkenfeld auf Sellhausen an diesem Tage. Was hatte dieser seltsame Vorfall wohl zu bedeuten? Wie kam es, daß diese Frau, die Sellhausen so viele Jahre nicht betreten, die mit dem früheren Besitzer desselben in offener Fehde gelebt, wie alle Welt wußte, wie kam es, daß sie jetzt plötzlich das Gut besuchte und dem jungen Mann dadurch einen auffallenden Beweis ihrer Gewogenheit und Freundschaft lieferte? Dieses Ereignis – denn ein solches war es in ihren Augen – mußte etwas zu bedeuten haben, und den Grund desselben zu erforschen, mußte unternommen werden, koste es, was es wolle, selbst wenn damit große Mühe oder irgend eine andere Aufopferung verbunden war.
Jedenfalls war durch diesen unerklärlichen Besuch der alten Frau der Legationsrat selbst in ihren Augen gestiegen, eine wichtigere Person geworden, und man mußte unter allen Umständen vorsichtiger, zurückhaltender gegen ihn zu Werke gehen, als es ohne diesen leidigen Zwischenfall nötig gewesen wäre.
Daher beschlossen die würdigen Eheleute denn, ganz behutsam vorzuschreiten, nichts zu übereilen und insbesondere den vorlauten Haas von jedem ferneren gewaltsamen Eingriff abzuhalten, was, im voraus gesagt, eine ganz vergebliche Bemühung war, da dieser sich seine Bahn im Geiste schon fest vorgezeichnet hatte und, in seinem störrischen Sinne immer blindlings verfahrend, so leicht von nichts abzubringen war, was er sich einmal in den Kopf gesetzt.
Nach reiflicher Überlegung also kamen sie überein, sich gegen Bodo außerordentlich leutselig, freundlich und abwartend zu verhalten, sie wollten ihn zu sich einladen, ohne ihn im geringsten zu bedrängen, ihn mit einem Worte warm halten und sein Gefühl für die schöne Tochter anwachsen lassen, was ja nicht ausbleiben konnte, sobald er ihr nur öfter begegnen und ungestört ihre noblen Eigenschaften sich entwickeln sehen würde. Und in diesem Punkt glaubten beide schon einen bedeutenden Fortschritt in der Neigung des Legationsrats bemerken zu können. Hatte er zum Beispiel nicht oft und lange Klotilden von der Seite angeschaut, sie heimlich beobachtet und den vollen Reiz ihrer Persönlichkeit behaglich auf sich wirken lassen? Hatte er nicht wiederholt beiseite freundliche Worte an sie gerichtet, ihr Fragen gestellt, wie ihr dies und jenes gefalle, wo sie dies und jenes anders gesehen habe, und dergleichen mehr? In der Tat, das war nach der Meinung so scharfsichtiger Eltern schon etwas, nein, das war sogar schon sehr viel.
Ganz anders aber verhielt es sich mit der Tante Birkenfeld. Hier mußte durchaus etwas geschehen, um ihre durch frühere Mißgriffe und verschwenderische Lebensweise verscherzte Gunst wiederzugewinnen oder wenigstens ihre verwandtschaftliche Liebe von neuem anzufachen. Allein das gestanden sich beide: hier war guter Rat teuer, und deshalb dauerte ihre Beratung bis tief in die Nacht hinein. Das Resultat derselben, zu dem sie endlich gelangten, war aber folgendes. Diese alte Frau war kein gewöhnliches Wesen, welches durch vornehme Mienen, durch Prunk und Pomp, durch Glanz und Flitter zu bestechen und zu erobern war. Ihr mußte man mit dem Gefühl beizukommen suchen und, um in ihren Augen wenigstens etwas zu scheinen, was man nicht war, lieber eine Maske vornehmen. Und da hier so großes auf dem Spiel stand, konnte es auf ein Mehr oder Weniger in der Maskerade nicht ankommen, man mußte, mit einem Wort, energisch zu Werke gehen. So kam man denn überein, sich vor der Hand in das Gewand der Demut zu hüllen, eine Unterordnung an den Tag zu legen, die ihre Gunst erringen mußte, und dabei, wenn es durchaus nötig sei, selbst ihre Grobheiten zu ertragen, falls denselben nur endlich ein freundschaftliches und verwandtschaftliches Wohlwollen nachfolge.
Daß man sich zu dieser Nachgiebigkeit entschloß und die vornehme Miene ganz beiseite lassen wollte, hatte aber noch einen viel triftigeren Grund, der an diesem unseligen Abend zwischen den beiden Gatten zur Sprache kam, indem Baron Grotenburg schlau genug war, die weiche Stimmung seiner Gemahlin zu benutzen und sie einen Blick – nicht in sein volles Herz allein, sondern auch in seine leere Kasse tun zu lassen. Der Baron hatte nämlich den Mut, zu bekennen, daß seine Mittel vollständig und auf Jahre hinaus erschöpft seien, und daß sie auf irgend eine Weise möglichst bald ersetzt werden müßten, wenn man das Schiff des regellosen und prunkvollen Haushalts nicht völlig auf den Grund wollte laufen lassen. Daß man dies Geld nun am leichtesten von der reichen Tante der Baronin erlangen könne, wenn man es geschickt anfange, war ausgemacht, und so entschloß man sich nach langer Überlegung zu folgender Operation. Baron Grotenburg sollte den letzten Fechterstreich versuchen und sich auf Gnade oder Ungnade in den Bereich des schrecklichen Drachens, des grünen Pelzes, begeben. Der arme Mann zitterte zwar bei diesem tollkühnen Wagnis, aber die Handlung war nicht mehr zu umgehen, die eiserne Notwendigkeit drängte zu hart, zu schwer. Er wollte sich also untertänig und gehorsamst der Tante zu Füßen legen, ihr seine Not gestehen, an ihr Herz appellieren und, wenn es denn sein müsse, frühere Schwächen bekennen, um auf spätere Tugenden hoffen zu lassen. Um sein Gesuch eines Vorschusses von einigen tausend Talern aber um so sicherer zu begründen, sollten die bevorstehenden Ausstattungskosten Klotildens in den Vordergrund gestellt werden, und das war ja ein Punkt, der selbst auf ein Felsenherz nicht ohne Wirkung bleiben konnte.
»Deine Aufgabe ist schwer, Grotenburg,« sagte am Schlusse der langen Beratung die Baronin, »aber du bist ein Mann und wirst für deinen und unser aller Vorteil zu kämpfen verstehen. Zeig, was du kannst, und laß mich einmal wieder stolz auf dich werden, wie ich es früher gewesen bin. Solltest du aber wider Erwarten auch diesmal das steinerne Herz dieses alten Weibes, das sich schimpflicherweise meine Tante nennt, nicht erweichen, nun, dann sehe ich mich selbst genötigt, mich so weit zu erniedrigen, um ihre Gunst zu buhlen und sie um ein Darlehn anzuflehen, was eigentlich unter meiner Würde ist, wie du begreifen wirst. Indessen so weit wird es hoffentlich nicht kommen, und nun küß' mir die Hand und geh', ich bin todmüde und fast der Erschöpfung nahe. Mein Gott, mein Gott, was sind das für empörende Zeiten und wie kann die Vorsehung so ungerecht sein, dieser alten Person alles zu geben und uns alles zu versagen. Doch – das Klagen hilft zu nichts – schlaf wohl, Grotenburg!«
Auf diese Weise zärtlich und liebevoll befeuert, verließ der edle Gemahl seine noch edlere Gemahlin. Beide aber hatten eine schlaflose Nacht, denn an beider Herzen zehrte der Gram, daß es ihnen nicht vergönnt sei, den gordischen Knoten ihres Wehs durch einen kühnen Schlag zu lösen, eine herrliche Manier zum Zweck zu kommen, wenn man die eiserne Gewalt in Händen hat, und ein Beispiel, für das man dem großen mazedonischen König in gewissen Regionen nicht oft genug seinen Dank sagen kann.
Baron Grotenburg aber war schon am frühen Morgen gerüstet, den schweren Gang anzutreten, nachdem er während der Nacht in seinem diplomatischen Geiste die Art und Weise überlegt, wie er den ihm übertragenen Feldzug am besten und »mit Ehren« eröffnen wolle. Er stieg schon um acht Uhr in einen bescheidenen Wagen, ließ sich von einem einfach gekleideten Kutscher fahren und schlug denselben Weg nach der Cluus ein, auf dem wir schon Bodo von Sellhausen bei seinem ersten Besuche daselbst begleitet haben.
*
Frau Birkenfeld war an diesem Morgen etwas spät aufgestanden; die alte Frau fühlte sich wirklich von ihrer Reise am vorigen Tage und den damit verbundenen gemütvollen Aufregungen angegriffen und ermüdet. In der Regel war sie unter solchen Verhältnissen nicht gut gelaunt, aber heute war sie im ganzen ruhig gestimmt, denn was sie gesehen und erfahren, hatte sie mit Zufriedenheit erfüllt und über mancherlei war sie sogar entzückt, wie sie dem Meier auf dem Heimwege das offene Bekenntnis abgelegt.
So war sie im ganzen also nicht übel aufgelegt und selbst die Art und Weise, wie sie ihrem Herzen gegen die Grotenburger Sippschaft, wie sie sie nannte, Luft gemacht, bereitete ihr noch in der Erinnerung Vergnügen, da sie nur selten Gelegenheit fand, den Herrschaften ihre Meinung zu sagen, wozu doch so mancher triftige Grund vorlag. Als sie aber von ihrem Fenster aus, an dem sie schon seit zehn Uhr strickend saß, den Baron anlangen sah, ergriff sie ein ungewöhnliches Staunen, denn daß dieser Mann so bald nach der gestrigen Demütigung zu ihr kam, mußte in der Tat etwas zu bedeuten haben. Schnell genug jedoch faßte sie sich, und ihre Arbeit, die sie einen Augenblick hatte ruhen lassen, wieder aufnehmend, sagte sie sich: »Sieh dich vor, Grete, der kommt nicht umsonst. Es ist irgend etwas nicht ganz in Ordnung, sonst käme er gerade heute nicht. Ruhig, Alte, ruhig! Sei schlau und mache ihm Mut, damit er sich frei ausspricht, und erst wenn er fertig ist, zieh deine Rute und schlage ihn damit in die Flucht, denn soviel ist ausgemacht – fliehen muß er und das Schlachtfeld ist dein!«
Nachdem der Baron geschellt, ward er durch Boas gemeldet und angenommen. Er fand Frau Birkenfeld ruhig auf ihrem Platze am Fenster sitzen, und die großen Nadeln bewegten sich eifrig in ihren kleinen Händen, während ihr Auge durch die blaue Brille, die sie schnell aufgesetzt, möglichst gleichgültig auf den eintretenden Besuch blickte.
Der Baron trat ein, ein ganz anderer Mann als sonst bei irgend einer wichtigen Gelegenheit. Seiner Rolle getreu, kehrte er heute nicht den vornehmen Herrn, den Baron heraus, nein, durchaus nicht, er trat vielmehr ganz bescheiden und fast schlicht einher, zeigte eine freundliche, demütige Miene, wie ein Mann, der sich bewußt, daß er nichts ist, wenn die Großmut seiner teueren Verwandten ihn nicht hebt und trägt, und so verbeugte er sich mit einer so unterwürfigen Haltung, daß Frau Birkenfeld nur noch mehr erstaunte, aber auch um so wachsamer mit ihren Blicken und in ihrem ganzen Benehmen blieb.
»Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten Morgen, teuerste Frau Tante,« begann er und schien sich der alten Dame nähern zu wollen, um ihr die Hand zu reichen, allein da sie keine entgegenkommende Miene zeigte, blieb er vier Schritte von ihr entfernt stehen und schaute die fleißige Arbeiterin aufmerksam an.
»Guten Morgen, Herr Baron,« sagte diese gleichgültig. »Nehmen Sie sich einen Stuhl. Sie sind früh aufgestanden heute.«
»Ach Gott, liebe Frau Tante, ich bin die ganze Nacht nicht im Bett gewesen und habe sie kummervoll genug zugebracht.«
»So! Warum denn?«
»Mein ganzes Haus ist wie ein Lazarett; meine Frau und Tochter krank, elend, wie gebrochen, und beide haben mich in unendliche Sorge gestürzt.«
»Ei! Woran leiden sie denn und was hat sie so schnell krank gemacht? Sie waren doch gestern noch gesund und übermütig genug.«
» Gestern! Ach!« sagte der Baron und zuckte die Schultern wie ein Mann, dessen empfindlichste Stelle man mit einer glühenden Nadel berührt. »Gerade der gestrige Tag hat sie krank und elend gemacht, verehrte Frau Tante.«
»Das ist ihre eigene Schuld. Warum gehen sie halb nackt. Pfui, was ist das für eine schimpfliche Mode!«
»Das ist es nicht,« fuhr der Baron langsamer fort, der schon die erwarteten Schwierigkeiten sich vor seinen Augen gewaltig auftürmen sah, »erkältet haben sie sich nicht, sie sind ja an diese – diese alberne Tracht gewöhnt. Sie haben recht – meinen Beifall hat diese Mode auch nicht. Aber was soll man machen?«
»Was soll man machen?« fuhr die alte Frau heftiger auf. »Warum ist man Mann? Warum befiehlt man nicht Ordnung und Zucht, wenn sie nicht vorhanden ist? He? Doch – das ist nicht meine Sache. Sie sind einmal nicht zum Befehlen geschaffen, das hat Ihr ganzes Leben bewiesen. – Sprechen Sie weiter – woran leiden Ihre Damen? Haben sie sich etwa den feinen Magen an des Meiers gemeinen Forellen verdorben?«
»Ach Gott nein, auch das nicht, beste Frau Tante. Es ist etwas ganz anderes. Und um es Ihnen offen zu gestehen – sie fühlten sich beide verletzt, tief gekränkt, weil Sie – Sie selbst sie in Gegenwart Fremder so übel behandelt.«
»Verletzt? Tief gekränkt?« fuhr die alte Frau auf. »Wie meinen Sie das? Ist Ihre hochnäsige Frau noch durch Worte zu verletzen? Ei, nein, Mann, die hat eine zu harte Haut. Und übel behandelt habe ich sie? Nennt man das übel behandeln, wenn man jemanden die Wahrheit sagt?«
»Eben das ist es, was die jetzige Welt nicht vertragen kann – kein Mensch will die Wahrheit mehr hören, ich beklage es alle Tage.«
»Sie beklagen es? Also Sie können sie noch vertragen? Nun gut. Sie sollen sie heute noch hören, ich bin bereit dazu. Fahren Sie fort. Die Krankheit aber, an der Ihre Damen leiden, wird nicht lange dauern. Ich kenne das. Heute mittag oder abend werden sie herrlich da oder dort soupieren und dann sind sie wieder gesund – haha!«
»Ach nein, liebe Frau Tante. Wir leben jetzt sehr häuslich und finden auch unser ganzes Glück darin.«
Frau Birkenfeld richtete ihre Augen bei diesen Worten scharf auf den Baron. Sie hatte seine Maske längst durchschaut und wußte nun auch schon, um was es sich demnächst handeln würde. – »So,« sagte sie, »Sie leben also jetzt häuslich. Na, da muß es nahe vor Ihrem Untergange sein, sonst kann ich es mir nicht erklären.«
Der Baron schauerte zusammen, als er dies so kalt aussprechen hörte. »Ja, ja,« rief eine Stimme in ihm, »sie hat recht!« Und die trostlose Überzeugung von diesem Rechte gab ihm eine wahrhaft klägliche Miene.
»Nun weiter!« fuhr Frau Birkenfeld ohne Erbarmen fort. »Wollen Sie mich zur Rede stellen, daß ich Ihre Frau und Tochter krank gesprochen habe?«
»Ach nein, das will ich gewiß nicht. Ich komme vielmehr, um Ihnen mitzuteilen, daß meine Frau in ihrer tiefen Kümmernis endlich eingesehen hat, daß sie bisher nicht – nicht so gelebt, wie sie eigentlich hätte leben sollen. Und so ist sie zur Umkehr entschlossen –«
Ein lautes Lachen unterbrach ihn. Die alte Frau war von ihrem Stuhle heruntergesprungen und drehte sich, immer lachend, wie ein Kreisel im Zimmer umher, zum größten Erstaunen des Barons. Plötzlich stand sie still, hörte zu lachen auf, stemmte beide Hände in die Seiten, trat dicht an ihren Besuch heran und sagte bitter: »Um es kurz zu machen, ich kenne schon Ihren Plan. Ihrer Frau fehlt es an Geld und Ihnen auch. Darum die Krankheit – darum die Umkehr – darum Ihre Armesündermiene! Pfui, Mann, wie kann man sich zu einem solchen Puppenspiel gebrauchen lassen! Mit einem Wort: Sie sind von meiner lieben Nichte abgesandt, um zu pumpen. Das ist des Pudels Kern – und nun pumpen Sie – da haben Sie den Schwengel, aber ich glaube nicht, daß etwas anderes als Wasser aus mir herauskommen wird. Haha!«
Bei diesen Worten hielt sie ihm einen Arm hin, als wolle sie ihm den Schwengel in die Hand geben. Der Baron aber stand ganz verdutzt da. Er sah ein, daß Schauspielerkünste, wenn sie nicht von einem größeren Meister ausgeführt würden, als er war, hier nicht viel Wirkung übten. Dennoch aber faßte er sich bald wieder und sagte mit einem so ehrlichen Gesicht als möglich: »Allerdings habe ich ein gehorsamstes Gesuch an Sie zu richten, doch davon nachher. Zuvörderst aber will ich Sie bitten, sich selbst zu überzeugen, daß es bei uns gegenwärtig einfach genug hergeht, und ich komme deshalb, um Sie zu einem Besuche einzuladen, zumal Sie so lange nicht auf der Grotenburg gewesen sind.«
»Nun, da haben Sie recht, da bin ich lange nicht gewesen und – offen gesagt – denke auch nie wieder hin zu kommen. Also ich danke für Ihre Einladung – bei mir gefällt es mir besser und wenn ich eine einfache Haushaltung sehen will, brauche ich nur meine anzusehen – die ist noch einfacher als Ihre. – Doch zur Sache, ich habe keine Zeit zum langen Plaudern über unnütze Dinge. Kommen Sie jetzt zum Hauptpunkt. Sie sprachen von einem gehorsamen Gesuch – erklären Sie sich deutlicher.«
Der Baron raffte sich zusammen. Es galt. Ein Kampf stand bevor und noch hoffte er zu siegen, wenn er seine Haupttruppen ins Feld führte, unter denen er eine mächtige Hilfe zu haben glaubte. Nachdem er sich daher geräuspert und wieder gesetzt, da auch Frau Birkenfeld ihren Platz wieder eingenommen, sagte er:
»Ja, ich will es wagen und gestehe zugleich offen, daß ich mein ganzes Glück der Gegenwart, meine Hoffnung der Zukunft in Ihre Hände lege und zwar mit einem Vertrauen, daß Sie meine Empfindungen teilen werden, welches – ich spreche ganz unumwunden – unbegrenzt ist.«
Frau Birkenfeld nickte mit dem Kopfe, sah aber nicht von ihrer Arbeit auf.
»Ja,« wiederholte der Baron, »ich komme, um Sie um ein Darlehn zu bitten, und es soll das letzte Mal sein, daß ich Ihre Güte in Anspruch nehme. Ich brauche Geld, es ist leider wahr, aber diesmal zu einem unzweifelhaft guten Zweck.«
»Nennen Sie ihn kurz.«
»Ich will meine Tochter verheiraten!« stieß der Baron mit schwerem Atem hervor.
Frau Birkenfeld sank das Strickzeug aus der Hand. Auch sie fühlte jetzt, daß der Hauptkampf vor der Tür stand, und sie rüstete sich mit ihrer ganzen Geistesschärfe, den Mann zu durchdringen, der in höchster Qual vor ihr saß, was ihr nicht verborgen blieb.
»Mit wem?« fragte sie ruhig.
»Mit dem Legationsrat von Sellhausen!« lautete die Antwort, die etwas lange auf sich warten ließ.
»So. Ist das bestimmt? Hat er schon um die Hand Ihrer Tochter angehalten?« fragte die alte Frau mit hörbar schnellerem Atem.
»Nein, bis jetzt noch nicht, allein sein ganzes Benehmen läßt dasselbe demnächst vermuten. Auch ist es bestimmtes Abkommen zwischen seinem Vater und mir –«
Die Alte hob die Hand, wie um ihn zum Schweigen zu bewegen. »Ein Abkommen!« sagte sie verächtlich. »Wie kann ein Vater ein Abkommen von einer solchen Bedeutung über seinen an Alter und Verstand reifen Sohn treffen?«
»Er hat es aber doch getroffen, denn sein sehnlichster Wunsch bestand darin, seinen Sohn mit Klotilden, die er wie eine Tochter liebte, vermählt zu sehen. Außerdem aber, verehrteste Frau Tante, und das ist die Hauptsache, schließt die Erfüllung dieses Wunsches seines Vaters den größten Vorteil für den ganzen Mann ein, weil er, wenn er diesen letzten Willen seines Vaters nicht erfüllt, wahrscheinlich – ich sage wahrscheinlich – kraft eines hinterlegten Testaments einen Teil seines Erbes verliert –«
Der Baron stockte – es wurde ihm schwer, dieser Frau gegenüber von diesem letzten Willen zu sprechen, auch konnte er kaum den scharfen Blick ihres Auges ertragen, das ihn plötzlich ohne Brille anschaute, als wollte sie ihn ebenso ehrlich in ihr Herz schauen lassen, wie sie in das seine schaute.
»Ich habe von dieser merkwürdigen Sache schon reden hören,« sagte sie, mit einem Mal wunderbar ruhig werdend, »aber ich habe sie nicht glauben wollen. Sie bestätigen mir jetzt die Wahrheit, aber mein Unglaube wächst dennoch frisch hervor. – Was hat Ihnen der alte Sellhausen denn für einen Grund zu diesem seltsamen Tun angegeben?« fragte sie, fast atemlos und mit lebhaftester Spannung den Baron beobachtend.
»Was für einen Grund?« sagte dieser ganz ruhig, so daß die alte Frau sich sogleich auch beruhigte. »Keinen andern als seine innige Freundschaft zu mir und die Anhänglichkeit an und die Dankbarkeit gegen meine Familie.«
»So. Na, wenn er keine anderen Gründe gehabt hat, dann will, dann muß ich Ihnen sagen, daß der alte Sellhausen – als Vater – abscheulich, schlecht und unväterlich gegen seinen Sohn gehandelt hat, und ebenso, daß Sie, mein werter Herr Baron, an dieser Schlechtigkeit einen sehr regen Anteil genommen haben. Da haben Sie meine Meinung.«
»Das wüßte ich doch nicht!« bemerkte der Baron in seinem natürlichen hochtrabenden Ton, der ihn wider Willen und zu seinem Schaden bei dieser peinlichen Auseinandersetzung überkam.
»Es ist aber meine Meinung, und ich habe darin auch eine, so gut wie Sie, – um so mehr, weil Sie von mir Geld zur Ausstattung Ihrer Tochter zu dieser Verbindung verlangen und mich also auch zur Teilnehmerin Ihres Streiches anwerben wollen. Haha! Doch was quälen wir uns! Abgemacht! Zu einer solchen Ausstattung, die ja noch gar nicht 'mal in Aussicht steht, da der Legationsrat sich noch nicht erklärt hat, habe und gebe ich kein Geld. Sie müssen eine andere Notwendigkeit ausfindig machen – diese erste war – Wind!«
Diese mit herbem und schneidend sicherem Tone gesprochenen Worte donnerten den Baron fast nieder. Seine Hilfstruppen wichen, seine festeste Stütze wankte.
»Aber mein Gott,« stöhnte er endlich, »haben Sie denn gar kein Gefühl für Ihre Nichte, nehmen Sie keine verwandtschaftliche Rücksicht?«
»Nein, gar keine. Eine bloße zufällige Verwandtschaft des Blutes, wenn sie sich nicht auf innere Übereinstimmung, Einsicht, auf ein gemeinsames Gefühl, Liebe und Neigung, und was zur Verwandtschaft gehört, gründet, ebenso wenn meine Verwandten meine Liebe und Teilnahme nicht verdienen, Herr Baron, existiert für mich nicht, und ein braver, armer fremder Mann ist mir lieber und steht mir näher als hundert hochtrabende, schwelgerische, wertlose Verwandte, die nur dann sich erinnern, daß sie in irgend einem Verbande mit mir stehen, wenn sie mein Geld gebrauchen, sonst aber mich das alte geizige Weib, den giftigen Drachen, den grünen Pelz nennen. Da haben Sie es. Und Sie sind mit Ihrem Gelde von jeher ein Verschwender gewesen. Sie waren ein wohlhabender, ein reicher Mann. Sie haben aber alles zum Schornstein hinausgejagt, auf jede Weise verpraßt, mit vollen Fäusten auf die Straße geworfen. Und wie leben Sie denn etwa jetzt, da Sie selbst sich für bedürftig erklären? Sind Sie es denn? Nein, Sie sind es nicht. Denn wer mit kostbaren Pferden und Wagen, Vorreitern und Jägern fahren, sich sechs Bediente halten, seine hochmütige Frau und seine alberne Tochter in langen Schleppkleidern von Samt und Seide, mit Gold und Edelsteinen beladen, einhergehen lassen, wer große Feste geben und den Fürsten im Kleinen spielen kann, der ist nicht arm, nicht bedürftig und der muß sich nicht so weit erniedrigen – zum zehnten Mal schon um ein Darlehn zu bitten, was er niemals wieder bezahlen kann und niemals wieder zu bezahlen die Absicht hat. Nein, nein, Herr Baron, ich kann Ihnen diesmal nicht helfen, also helfen Sie sich selbst – arbeiten Sie, wie alle anderen ehrlichen Leute – das ist mein letzter Rat. Und um mit mir ganz fertig zu werden, nehmen Sie noch meine letzte Antwort für unterwegs mit: Mögen Sie und Ihre Frau mich bitten und quälen, so viel Sie wollen – Sie erhalten, so lange ich lebe, auch keinen Groschen mehr von mir. Die Tausende, die Ihnen früher mein Mann, der alte Sellhausen und ich selbst gegeben, sind alle in die Lüfte geflogen, ohne Ihnen auch nur das Geringste zu nützen. Sie haben sich nie eingeschränkt, nie nach Ihren Einkünften gelebt, nie wie ein kluger Mann gewirtschaftet, sondern wie ein Mensch, der keine Einsicht hat, welche wertvolle Gottesgabe das Geld ist. Sie und Ihre Frau, jedes auf seine Weise, haben sich von jeher unserer Unterstützung, unserer Hilfe unwürdig erwiesen, unwürdig, sage ich, und ich appelliere dabei an Ihr eigenes Gewissen, das hier vor mir deutlich auf Ihrem kreideweißen Gesicht zu lesen ist. Ja, ich lese es – machen Sie nur die Augen noch größer auf. Also noch einmal – damit Sie es behalten – so lange ich lebe, erhalten Sie nichts von mir, und was Ihrer Frau, meiner Nichte, einst nach meinem Tode zufallen wird, das weiß ich noch nicht, und damit muß sie sich, ob es viel oder wenig ist, begnügen. Jetzt haben Sie mich lange genug gestört, Herr Baron, und können zu Ihrer Frau Gemahlin zurückkehren und ihr meinen Gruß bringen. Geld habe ich, sagen Sie ihr, ja, das ist wahr, aber zu edlen Zwecken und für brave, arbeitsame Menschen. Daß Sie keine edlen Zwecke verfolgen und kein braver und arbeitsamer Mann sind, Herr Baron, das, wenn Sie es noch nicht wissen, sage ich Ihnen, denn sonst würden Sie den altersschwachen Narren, den Sellhausen, Ihren Freund und Schwager, der durch Sie geadelt, aber gewiß nicht veredelt ist, nicht so gemißbraucht haben. Sie würden nicht mit dem Glücke seines Sohnes gespielt und durch sein Unglück Ihre eigene Niederlage zu vergolden und in einen scheinbaren Sieg zu verwandeln getrachtet haben. Und nun bin ich fertig und Sie sind es auch, denn daß Sie mit Ihrem Latein zu Ende gekommen, sehe ich an Ihrer Miene, Ihrem Auge, das Sie nicht mehr zu mir zu erheben imstande sind. So machen Sie denn bald Kehrt und sagen Sie mir Lebewohl, wie ich es Ihnen sage.«
Der Baron stand vernichtet vor der alten, ihn mit ihren blitzenden Augen durchbohrenden Frau. Ihre Geradheit hatte seine Diplomatie geschlagen und ihre Schwäche seine Kraft gelähmt. Er griff zitternd nach seinem Hut, aber im Begriff, zu gehen, wandte er sich noch einmal um und sagte, in flehendem Tone:
»Und das ist Ihr letztes Wort?«
»Mein allerletztes. Mit Männern, wie Sie und Ihre Sippschaft es sind, muß man verständlich reden, denn Sie sehen und hören nicht wie andere gemeine Leute, mit den von Gott geschaffenen Augen und Ohren die Welt an, wie sie ist und wie sie spricht, sondern Sie betrachten alles um sich her durch die künstliche Brille, die Ihre in Stahl und Eisen gepanzerten Vorfahren für Sie geschliffen und geputzt und Ihnen unabreißbar auf die Nase gebunden haben – aber die Welt ist anders geworden, seitdem es keine Raubritter mehr gibt, und wenn Sie diese Welt nicht begreifen, so sind Sie selbst, aber nicht die Welt daran schuld, die sich durch nichts aus ihrem Geleise bringen läßt, selbst wenn Tausend und Millionen Barone ihre Schultern gegen ihre Achse stemmen, um sie aus den Fugen zu heben. Leben Sie wohl, Sie einer von diesen Tausend und – behalten Sie mich in gutem Andenken. Ich grüße Sie!«
Sie machte ihm eine tiefe ironische Verbeugung und verließ, stolz von ihm fortschreitend, indem sie in das benachbarte Zimmer ging, den gedemütigten Mann, der noch eine Weile wie vernichtet auf der Stelle stand, die er bisher eingenommen, dann aber, von tausend Ängsten gequält, mit röchelndem Atem das Zimmer verließ und selbst nicht wußte, wie er zum Hause hinaus, den Berg hinunter, über das Wasser kam, wie er in seinen Wagen kletterte und halb zerschmettert seiner stolzen Burg zufuhr, um seine ganze Niederlage, seine Verzweiflung, seinen Jammer der edlen Amalie zu verkünden, die von den diplomatischen Künsten ihres Gemahls, auf den sie wieder stolz werden wollte, einen ganz anderen Umschwung der Dinge erwartet hatte.
![]()