
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
An Bord D. S. »König Wilhelm II.«.
11. III. 08.
Untergebracht. Die Koffer verstaut, ausgepackt, ein home aus der Kabine gemacht. Gegessen, geschlafen, überall herumgekrochen. Die grosse Freude der ersten Tage: dass so viele Leute seekrank sind. Denen, die's nicht sind, nehme ich das fast übel. Alle sollten es doch sein – nur ich nicht, natürlich. Ich zähle beim Frühstück – 150 Passagiere fehlen. Prächtig! Eigentlich war meine Hoffnung gering: ein so stetiges Schiff, so schönes Wetter. Und doch sind sie seekrank? Das ist lieb von ihnen.
18. III. 08.
Coruña, Vigo, Lissabon und Cintra, Madeira. Ein Journalist, der mit an Bord ist, hat schon vier Artikel für sein Blatt geschrieben. Es kommt sicher viel vom blauen Himmel, von Palmen und unendlichem Meere darin vor. Er findet das alles wunderbar schön – und das ist es auch, ganz gewiss. Aber er will nicht einsehen, dass es, eben deshalb, so grässlich langweilig ist.
20. III. 08.
Ich habe die Passagierliste durchstudiert und mir von meinem Tischnachbar kommentieren lassen. Der heisst Don Ernesto, ist Chilene und hat einige Goldminen und Latifundien. Ausserdem weiss er alles von allen an Bord. Demnach sind vorhanden, befinden sich auf Lager:
3 Handlungsreisende in Kanonen, 2 dito in Diamanten, 1 in Hasenhaaren, 1 in Tauen, 2 in Konfektion, 1 in alten Schiffen, 2 in Schminke, Seife und Puder, 1 in Stiefelwichse, 2 in Artikeln der Notre Dame de Lourdes, 1 Commère einer Pariser Revue, 1 Barfusstänzerin, 1 reisende Diplomatenwitwe, 1 kinderlose Pastorenfrau, 4 Bierbrauer und einige Ingenieure.
Dann sind noch sehr viele Argentiner und Chilenen da, mit noch mehr Kindern. Von den deutschen Handlungsreisenden sind sieben Generäle und einer Leutnant, die Bierbrauer sind auch Leutnants in erster Linie, wenn auch nur der Reserve. Endlich gibt es noch einen Menschen, der einen Kasten voll lebender Fische hat, die er in den Bergwassern der Cordilleren aussetzen will. So sagt Don Ernesto – aber das glaub ich ihm nicht.
23. III. 08.
Im Zwischendeck habe ich zwei jüdische Schauspielerinnen gefunden. Sie reisen ihrer Truppe nach, die nächstens in Buenos Aires auftritt. Sie sind aus London und sprechen englisch, aber eigentlich sind sie aus Warschau. Sie werden mit Schalom Aschs »Gott der Rache« eröffnen, dann »Othello« und »Die Räuber« spielen. In Jiddisch. Im ganzen hat die Truppe nur sieben Mitglieder, aber das genügt; kleinere Rollen: Spiegelberg, Herrmann, Roller, Schweizer e tutti quanti werden gestrichen. Die Damen haben mir erzählt, dass sie sehr talentvoll sind; ich bringe ihnen dafür Cakes, Obst und Zigaretten hinunter.
25. III. 08.
Die Generäle sind nicht alle richtige Generäle, Don Ernesto hat das missverstanden. Einer ist Generaldirektor und macht in Zucker, zwei sind General-Merchants, die machen in allem. Noch zwei sind Generalkonsuln, der eine für Persien in Ecuador und der andere für San Marino in Paraguay. Aber der siebente ist richtiger Generalleutnant und Exzellenz dazu, er reist in Kanonen und ist »junger Mann« bei Ehrhard. Der Leutnant ist sein Sohn und Sekretär. Der andere Kanonenreisende ist junger Mann bei Krupp, er ist Geheimrat und hat einen beneidenswerten Appetit.
Die Diplomatenwitwe hat eine Zofe. Die heisst Martha und ist sehr hässlich. Trotzdem ist sie bei den bierbrauenden Leutnants ausserordentlich beliebt. Sie tanzen mit ihr, abends, wenn die Musik auf Deck spielt. Martha ist selig, sie hat vier Kavaliere im Smoking, die ihr Kupferberg-Gold spendieren. Aber die reisende Frau Baronin ist ausser sich, sie findet das vulgär. Sie hat nur einen Leutnant, aber den richtigen, der sein Monokel wundervoll tragen kann. Er schält ihr Orangen und liest ihr vor, bis sie einschläft. Sie ist mit der ganzen deutschen Diplomatie verwandt und hat es wohl gelernt, wie man einen blutjungen Gardeleutnant hübsch artig erzieht. Das hat sie oft getan, in Teheran, in Caracas, in Konstantinopel und in Rio. Jetzt gehen sie nach Lima zu einer anderen Kusine. Kein Mensch mag sie leiden an Bord, sie und ihren Pagen, aber ich mag sie beide sehr gern leiden. Sie haben sich meine Bücher aus der Bibliothek geben lassen; sie meinten, das wären sie mir schon schuldig. Aber – wenn sie ehrlich sein wollten – so wären sie doch nicht ganz befriedigt. Sie sind beide so höflich: sie finden sie nämlich ganz scheusslich. Da wäre ihnen Jörn Uhl und Götz Krafft denn doch lieber. Und erst die Kahlenberg!
26. III. 08.
Der Generaldirektor (Zucker) ist ein grosser Lebemensch. Er ist jährlich sechs Monate in Argentinien und verdient da 500 000 Mark. Dann geht er nach Berlin. Da hat er zwei Geliebte. Eine hat er in Breslau, eine in Hamburg und eine in Buenos Aires. Ausserdem kennt er alle Damen vom Moulin Rouge, vom Riche und von der Union-Bar. Er jeut dann jede Nacht und lacht nur, wenn er Tausende verspielt. Und trinken kann er – unter vier Flaschen Ayala geht er überhaupt nicht schlafen. – Nur an Bord ist er merkwürdigerweise Abstinenzler.
Auch der junge Mann von Ehrhard (Kanonen) ist Abstinenzler. Jeden Morgen zum ersten Frühstück hält er dem Leutnant, seinem Sohne, eine lange Rede. Nachher muss der sie dann niederschreiben und dazu hat er Zeit, denn seine Dame kommt nie vor zwölf Uhr auf Deck. So sitzt er also um acht Uhr schon im Salon und schreibt:
»Reden eines preussischen Generals an seinen Sohn«.
Das wird dann ein Buch werden und erscheinen, wenn man zurückkommt. (Es ist grässlich, überall lauert die Konkurrenz!) Der General spricht über die Degeneration unserer Zeit, über die Notwendigkeit einer strammeren Zucht im Offizierskorps, über die Schäden des Alkoholismus, über die Enthaltsamkeit ab Baccho et Venere. Dann geht er hinauf auf Sonnendeck, sucht sich ein stilles Plätzchen, streckt sich bequem in seinen Long-Chair und studiert in illustrierten Blättern: »Nackte Schönheit«, »Pariser Album« usw.
Die kinderlose Pastorenfrau, die nach Uruguay zu dem harrenden Gatten fährt, ist glücklich daran. Sie bekommt jeden Tag einen Brief und Sonntags zwei. Der schreibfrohe Pastor hat nämlich gleich dreissig Briefe auf einmal geschrieben und sie der Hamburger Agentur gesandt, die hat sie dem Obersteward gegeben und der liefert jeden Abend der hübschen jungen Frau einen aus. Don Ernesto, der alles weiss, hat herausbekommen, dass die Briefe folgendermassen lauten:
»Im Herrn geliebte Martha! Für den heutigen Tag bitte ich dich, folgende Sprüche zu beherzigen. Einmal: – –«
Dann folgen ein halbes Dutzend frommer Verslein, aus Bibel, Katechismus und Gesangbuch. Und dabei ist die kleine Frau noch immer munter und vergnügt. Nicht einmal seekrank ist sie geworden, trotz aller Bemühungen ihres würdigen Eheherrn.
28. III. 08.
Aequatorfest, Taufe, Gymkhamaspiele. Beinahe hätte ich etwas darüber geschrieben. Der Journalist hätte es gewiss getan, aber er stieg aus in Madeira. Aber der Leutnant schreibt schon, für irgendein Militärblatt. Und einer der Bierbrauer auch, für eine ganz richtige Zeitung, das Buxtehuder Tageblatt. Er ist nämlich aus Buxtehude und hoch angesehen da. Und deshalb hat der Verleger es für sehr vorteilhaft gehalten, sich seine Feder zu sichern. Eigentlich schreibt er zwar an seine Buxtehuder Braut, nie unter zwanzig Seiten. Diese Briefe gibt dann die Braut an die Redaktion und die macht sich Artikel daraus. Der Bierbrauer hat einen richtigen Kontrakt und hat 1000 Mark für sechs solche Briefe bekommen – pränumerando! Herrgott, ich wollte, ich wäre auch ein hochangesehener bierbrauender Mann in Buxtehude!
Der Bierleutnant und der Kanonenleutnant haben mir beide ihre Berichte gezeigt, ob sie gut wären. Ich habe gesagt, sie wären gut. Und es ist wirklich wahr, sie haben alles so erzählt, wie es wirklich war. – Ich hätte ganz gewiss hinzugelogen.
Nur haben sie beide etwas ausgelassen; das will ich nachholen, denn ich brauche nicht bescheiden zu sein, wie sie. Nämlich die Gymkhamaspiele und das grosse Tauziehen dabei, Europa gegen Amerika. Das ist ein Ereignis an Bord und man ist ehrgeizig genug, da zu gewinnen. Zwei Mannschaften auf jeder Seite, die gegeneinander antreten. Die erste europäische Mannschaft war mit Geschick zusammengestellt, drei dicke Vlamen, dann baumlange Hamburger und sehnige Engländer; ihr Gegner war durchs Los die viel schwächere argentinische Mannschaft. Die zog Handschuhe an, schmierte die Schuhe mit Kolophonium, redete, schrie zu den Germanen hinüber, die sie verächtlich ansahen und ruhig dastanden. Der Unparteiische pfiff und die Argentiner zogen, ruck, unter dem Freudengeheule ihrer Frauen und Kinder, die Herrn Europäer über Deck. Die machten dumme Gesichter: sie hatten gar nicht einmal Miene gemacht, das Tau anzuziehen, hatten sich glatt übertölpeln lassen. Dann die zweiten Mannschaften: die stärkere der Argentiner und eine schwache von Deutschen. Vorne stand mein Kanonenleutnant und hinter ihm der vom Bier: es war ein Vergnügen, die Jungen anzusehen. Ihre Wangen glühten und sie zogen, zogen, als stände ihr Leben auf dem Spiel. Sie waren viel schwächer wie ihre Gegner, aber sie wollten gewinnen und darum gewannen sie. Sie bekamen jeder einen Knallbonbon zur Belohnung – stolzer hätten sie auf keinen Orden sein können.
29. III. 08.
Ich überanstrenge mich. Gestern habe ich mehr als zwanzig Zeilen geschrieben; heute darf ich also Ferien machen. Ich liege im Long-Chair und träume aufs Meer hinaus. Und das blinzelnde Auge fängt ganze Scharen fliegender Fische, dann spielende Trupps lustiger Delphine. Manchmal auch die dreieckige Rückenflosse eines streichenden Hais und ganz hinten am Horizont die steigende Fontaine des nasenspritzenden Potwals.
30. III. 08.
Don Ernesto war falsch unterrichtet. Der Generaldirektor (Zucker) ist gar kein Lebemensch. Er hat auch keine Geliebte, weder in Hamburg, noch in Berlin, noch sonstwo. Dafür hat er eine richtige Frau und zwei Kinder und hat ihre Photos über seinem Bett aufgehängt. Und er trinkt auch gar nicht und jeut erst recht nicht. Bloss Geld verdienen tut er,
Auch bezüglich der kinderlosen Pastorenfrau hat mir der chilenische Goldminen- und Latifundienbesitzer nicht ganz richtig berichtet. Ich glaube, das kommt daher, dass Don Ernesto so wenig die deutsche Sprache versteht. Das mit den Briefen stimmt freilich, aber es sind nette, einfache Liebesbriefe, und fromme Sprüche kommen schon gar nicht darin vor. Der Obersteward – er sieht aus wie ein Admiral und ich habe einen ungeheuren Respekt vor ihm – macht jedesmal eine tiefe Verbeugung, wenn er als Postillon d'Amour kommt und der kleinen Frau ihren täglichen Brief bringt. Dann wird sie rot und steht auf und läuft in ihre Kabine, um zu lesen.
31. III. 08.
Wir liegen vor Montevideo. Die Dampflaunch kommt, um die Passagiere von Bord zu bringen. Ganz vorne steht ein Wesen, das schreit, heult, schlenkert mit den Armen in der Luft herum und führt Indianertänze auf. »Das ist mein Mann,« sagt die hübsche kleine Pastorenfrau, die neben mir steht. Und nun springt er die Gangway hinauf und fasst sie in die Arme und schwingt sie herum, hoch durch die Luft. Es ist ein Prachtkerl, der Pastor, und ich werfe Don Ernesto einen strafenden Blick zu. Aber der stösst sich nicht daran, wie kann sich auch ein chilenischer Goldgrubenbesitzer in die Tiefen eines deutschen Pastorengemütes hineinträumen! –
Ich traf den Mann mit den Fischen auf Achterdeck. »Wo gehen Sie hin?« fragte ich. Er meinte, er wolle hinunter, nach seinen Fischen sehen.
»Sie haben wirklich Fische?« fragte ich. »Warum nicht? Wollen Sie sie sehen?« Er führte mich hinunter und zeigte mir seine Fischbehälter mit unglaublich komplizierten Kühlvorrichtungen. Er erklärte mir alles genau, ich nickte immer, verstand aber nicht ein Wort davon. 2000 Forellchen hatte er und Kärpfchen und Schleichen und Bärschchen und furchtbar viele Eier von allen Sorten. Er war sehr selig, dass ihm nicht ein Tier eingegangen war auf der Reise. Und er jubelte in dem Gedanken, wie er sie alle aussetzen wollte in den Bergwässern der Cordilleren und wie interessant es dann sein würde, im Laufe der Jahre zu beobachten – –
1. IV. 08.
Der Reisende in Hasenhaaren spuckte über die Reeling in die schmutzigen Fluten des La Plata. »Pfui Teufel,« brummte er, »da vorne liegt das Dreckloch – Buenos Aires. Mir wird jedesmal seekrank, wenn ich diese jammervollste aller Städte wiedersehe.«
»Aber Don Ernesto sagte mir doch – –« warf ich ein.
»Was für ein Don Ernesto?« unterbrach er mich.
»Nun, der chilenische Goldgruben- und Latifundienbesitzer.«
Da feixte der Hasenhaarmensch. »Goldminen? Er verkauft Salpeter. Und ausserdem ist er ein waschechter Berliner und seine Latifundien liegen da unten im La Plata!«
»Er verkauft Salpeter – in Chile?« rief ich entrüstet. »Soviel ich weiss, kommt gerade daher der Salpeter!«
»Freilich, und deshalb importiert er ihn und wird reich dabei. Es gibt nicht Besseres als eine Ware in ein Land zu importieren, das übervoll davon ist. Ich verkaufe Hasenhaare – Sie wissen doch, dass Filzhüte daraus fabriziert werden – in Argentinien, trotzdem dort mehr Hasen herumlaufen, als Kaninchen in Australien. In Brasilien, wo es keinen halben Hasen gibt, kann ich auch kein Hasenhaar verkaufen. Aber weil es das grösste Kaffee-Exportland der Welt ist, importiere ich dorthin Kaffee – in Dosen, gleich fertiggemacht mit Milch, englische Erfindung, schmeckt wie Knüppel auf den Kopf! – und ich sage Ihnen, es geht glänzend. Das ist eben das Geheimnis des Geschäftes von heute; bei uns ist's ebenso!«
– »Bei uns – in Deutschland – –?«
»Aber sicher!« sagte er bestimmt. »Was fabriziert Deutschland hauptsächlich?«
»Alles mögliche –« sagte ich.
»Also was? Nennen Sie irgend etwas Bestimmtes!«
Ich wusste im Moment nicht, womit ich beginnen sollte. »Deutschland ist das Land der Dichter und Denker,« sagte ich ausweichend.
»Allright!« rief der Hasenhaarmensch. »Ich kenne den Artikel gerade nicht besonders. Ist da bei uns Ueberproduktion?«
Ich seufzte. »Ueberproduktion? Jeder Mensch schreibt ja. Generäle und Bierbrauer und – –«
»Schon gut; ich habe auch schon daran gedacht, meine Erlebnisse in Tagebuchform niederzulegen. – Also weiter: wird der Artikel auch stark importiert?«
Ich liess die Augen sinken. »Furchtbar wird er importiert. Von Skandinavien und Russland, von Frankreich, England, Italien – – kein Land und keine Sprache schickt uns nicht ihre Produkte!«
»Sehen Sie, sehen Sie!« rief er triumphierend. »So ist's überall! Hasenhaare muss man nach Argentinien bringen, Salpeter nach Chile, Kaffee nach Brasilien und Bücher nach Deutschland! Ich habe es mir schon überlegt,« fuhr er nachdenklich fort, »ich werde argentinisches Quilmes-Bier nach München importieren!«
An Bord des grossen Hapagdampfers war ein gutes Hundert Argentiner und Argentinerinnen. Und wen man nur fragte nach Buenos Aires, der strahlte. Nur Paris steht ihm gleich, sagten sie, nur Paris. Ich liebe Paris wie keine andere Stadt und ich ersehnte den Tag, da der »König Wilhelm II.« uns zu dem Paris der neuen Welt bringen sollte, der zweiten Millionenstadt der romanischen Völker.
Von Montevideo kreuzte der gewaltige Dampfer langsam über den La Plata. In ungeheurer Breite wälzten sich die schmutzigen Fluten träge dem Meere zu, braunen Schlamm rissen die mächtigen Schrauben vom Grunde und zeichneten einen breiten, dunklen Streif in den trüben Wassern. Auf Sonnendeck stand ein Passagier und biss sich in den blonden Schnurrbart. Es war der Reisende in Hasenhaaren, er war der lustigste von allen an Bord gewesen, die ganze Fahrt über; so einer, der von früh bis in die Nacht hinein die ganze Gesellschaft unterhält. Heute abend war er melancholisch, fast tiefsinnig.
»Da schauen Sie,« sagte er, »den Dreck nennen die Herren Argentiner; ›La Plata‹, den Silberstrom! Und so nennen sie Buenos Aires – Paris!«
»Gefällt's Ihnen nicht?« fragte ich.
»Mir?« rief er. »Ich sagte Ihnen doch schon, mir wird jedesmal ganz seekrank, wenn ich wieder einmal in dieses Jammerloch muss.«
Hundert Argentiner – Generäle, Obersten, Minister, Grosskaufleute – Gutsbesitzer, die Stücke Landes ihr eigen nannten, grösser wie Sachsen – schöne Frauen, deren Ohren und Nacken, Haare und Finger strahlten von grossen Brillanten – – und auf der anderen
Seite ein Reisender in Hasenhaaren? Nun – er war ein Deutscher. Ein Deutscher kann schlecht lügen, kaum unsere Dichter können das.
Weiss Gott, der Reisende in Hasenhaaren hat recht gehabt. Paris? In einem Pflasterstein des Boulevard Haussmann steckt mehr Kultur als in ganz Buenos Aires. Es ist die trostloseste Grosstadt dieser Erde und nur zu einem armseligen Zwecke zu gebrauchen: zum Geldverdienen.
Mühsam kroch der »König Wilhelm II.« durch die schmale Fahrrinne des unendlich breiten aber völlig verschlammten Stromes, mühselig holte ihn der Dampfleichter in den völlig unzureichenden Hafen. Da lag die Stadt der »guten Lüfte« – sie heisst wahrscheinlich so, weil man nirgends einen Mund voll frischer Luft bekommt. Es ist gar nicht zu sagen, was für uralte Stinkkästen die lieben Franzosen dieser Stadt als Automobile anhängen, die meisten scheinen lange vor ihrer Erfindung schon in die Welt gesetzt worden zu sein: eigentümliche Embryonen, die ein Museum gewiss interessieren möchte. Da lag die Riesenstadt, die mehr Raum einnimmt, als das achtmal stärker bevölkerte London, aber man sah nur die ersten Strassen in der ungeheuren flachen Ebene, die kein kleinster Hügel unterbricht. Da lag sie – und sie hatte so gar keine Aehnlichkeit mit Paris.
Unendlich lang ziehen sich, die Strassen hin. alle hundert Meter in rechtem Winkel von einer Querstrasse unterbrochen. Aber sie wirken noch viel länger, da hier nicht die Häuser numeriert sind, sondern die Meter; so hat jeder Häuserblock rechteckig hundert Meter im Geviert. Und alle diese Blocks und Strassen sind sich gleich, eine wie die andere, eng, schmutzig, voll von schreienden, unappetitlichen Menschen. Ein langweiligeres Städtebild lässt sich kaum denken. Natürlich sind auch öffentliche Gebäude da, Kirchen und Bibliotheken, Theater, Schulen, Staats- und Gerichtsgebäude. Auch Plätze und Denkmäler, aber von allen ist nicht eines der Mühe wert, dass man einen kleinen Augenblick davor stehen bleibt. Nichts, aber auch gar nichts ist da, das man nicht in jeder grossen europäischen Stadt viel schöner und besser sähe. Und was schlimmer ist: es ist nichts da, das charakteristisch ist für diese Stadt, nichts, das sie allein voraus hätte vor allen anderen.
Nun wird mir ein Argentiner entrüstet sagen: Palermo! O ja, Palermo, das ist der Bois de Boulogne dieser Stadt, aber nur so, wie eben Buenos Aires ein Paris ist.
Palermo ist ein schöner Park, wirklich, er ist recht schön. Und hier ist der Korso der feinen Welt, jeden Nachmittag von vier Uhr an. Equipage drängt sich an Equipage, dazwischen stinken vorsintflutliche Automobile. Ganz langsam, Rad um Rad, schieben sich die Wagen weiter, viele Hunderte, in sechs Reihen nebeneinander, auf den breiten Alleen. Die Herren, nun, sie sind, wie sie immer sind; höchstens, dass sie einmal ihre Beine auf den Vordersitz flegeln. Aber die Damen!
Riesige, gewaltige Hüte in allen Farben und Federn, kein Vogel der Welt fehlt in diesem traurigen Museum. Und die Toiletten! Bunt meistens, moosgrün und ein unleidliches Rosa sind bevorzugt dieses Jahr. Und alles aus Paris natürlich. Ich verstehe mich nicht gerade gut auf Toilettenpreise, aber so viel habe ich von meinem Freunde Spitzer (von »Maison« Spitzer) doch gelernt, um beurteilen zu können, dass hier keine Robe ist, die nicht tausend Franken gekostet hätte. Geschmackvoll ist herzlich wenig dabei; die Pariser Schneider haben ein eigentümliches Lächeln, wenn sie von ihrer argentinischen Kundschaft – schweigen. (Denn nie spricht ein Gentleman-Schneider von seiner Kundschaft.) Und dann die Brillanten! Ich glaube wirklich, hier hat der »Porteño« Porteño – der Bewohner der Hafenstadt. So nennt sich stolz der Buenarense zum Unterschied von den Leuten vom Lande, über die er sich hoch erhaben dünkt. einen Rekord, soviel Brillanten werden nicht einmal im Bois zur Schau getragen. Kann man noch mehr verlangen von seinen Frauen? Der Argentiner gewiss nicht. Nur wir dummen Europäer sind so anspruchsvoll, uns auch noch die Gesichter anzusehen. Und da – ja, sind das denn Damen, die hier herumkutschieren? Ich schwöre darauf, dass es nur Dirnen sind. Nicht von der Strasse freilich, aber vom Moulin Rouge oder von der Arcadia. Da ist nicht eine, die nicht gemalt wäre, die Lippen, die Ohren, die Wangen, die Augen. Und wie sind sie geschminkt! Bei aller Freude über einen so ungeheuren Verbrauch seiner Fabrikate würde der Herr Kommerzienrat Leichner doch einen gelinden Ohnmachtsanfall bekommen, wenn er sehen würde, in welch talentloser Weise hier Puderquaste und Schminktopf gehandhabt wird: nur auf die Quantität des Verbrauchs scheint es anzukommen.
Der junge Deutsche, in dessen Wagen ich fahre, grüsst rechts und links.
»Na,« sage ich, »Sie scheinen mir auch kein schlechter Lebemensch zu sein.«
»Lebemensch?« fragte er. »Wieso?«
»Sie kennen ja alle Kokotten der ganzen Stadt.«
»Aber hier ist nicht eine einzige! Das sind alles Damen, ohne jede Ausnahme. Sehen Sie, dort die Gattin des Ministers U – –, dort die drei Töchter des Generals J – – –!! Dahinter kommt Frau Z – –, die Gattin des reichsten Estanciero im Lande, hier sehen Sie – – –«
Ich unterbrach ihn: »Und alle sehen aus wie – wie – – –«
»Wie – Argentinerinnen!« lachte er. »Je ekelhafter sie aussehen, um so besser gefallen sie sich. Und erst den Herren!«
Wirklich, nirgends kommt einem die Tatsache, dass man in einem Affenlande ist, so sehr zum Bewusstsein, als in »Palermo«, von dem jeder Argentiner nur mit ehrfürchtigem Stolze spricht.
Es macht nicht viel Freude, Schlechtes über jemanden zu sagen; da ist es viel besser, still zu sein. Oder zu suchen, ob nicht irgendwo doch ein Standpunkt zu gewinnen ist, von dem aus man Gutes entdecken kann. An Buenos Aires kann ich das als Künstler gewiss nicht. Meine zwei Augen, die nun einmal in manchen Jahren gelernt haben, die Welt zu sehen, wie sie ist, und die sich so leicht nichts vormachen lassen, können nur Hässliches, Widerwärtiges entdecken. Grosse Theater mit jammervollen Schauspielen. Ein gewaltiges Opernhaus, das zur Saison zu unerhörten Preisen alle grössten Stars zeigt, und – trotz der besten Kräfte – eine schmachvolle Aufführung vor einem brillantenbehangenen, unglaublich unintelligenten Publikum. Ich würde erzählen müssen von Korruption und Schwindel an allen Ecken, von Elend und Prostitution – – – wozu? Mir macht es so wenig Freude wie meinen Lesern. Nein, der Künstler kann in dieser kulturlosesten Stadt auf keine Insel flüchten, auf der es Rettung gibt.
Der Kaufmann kann es. Denn er kann hier viel Geld verdienen. Mehr, besser und schneller vielleicht als irgendwo anders. (Vorausgesetzt, dass er kein Esel ist, wie ich; der verdient nirgendwo Geld.) Der ungeheure Reichtum des Landes bedingt starke Einfuhr und Ausfuhr, der Handel des Landes blüht – trotz aller schwindelhaften Bankerotte – ausserordentlich. Und ganz allmählich brechen sich solidere Anschauungen Bahn, so zwar, dass Argentinien heute schon den anderen südamerikanischen Republiken ein gut Stück voraus ist. Das alles zeigt sich natürlich am ersten in der grossen Haupt- und Hafenstadt des Landes.
Es gibt einige Krankheiten, die man selbst gehabt haben muss, um sie ganz begreifen zu können. Seekrankheit gehört dazu, Jähhunger, Heimweh, Bergfieber und Tropenanämie. Ich bin von diesen Genüssen immer verschont geblieben, aber ich habe sie oft genug bei anderen gesehen und gründlich beobachtet. Und trotzdem habe ich sie in ihren letzten Konsequenzen nie verstehen können. Was geht in dem Hirne der armen Dame vor, die tagelang bei herrlichstem Wetter unten in ihrer Kabine liegt, die längst nicht mehr Neptun opfern kann, da nichts mehr zum Opfern da ist und die nur ein Stossgebet nach dem anderen zum Himmel schickt, er möge doch das Schiff untergehen lassen? Was denkt der Herr, den die »Puna«, das Bergfieber, fasst, wenn er das Seil durchschneiden, sich von seinen Gefährten losreissen und mit Gewalt den Abhang hinunterspringen will? Was bildet sich wohl der arme Kerl ein, der an Tropenanämie leidet und immer nur schlafen, schlafen will, der den Tod sehnsüchtig herbeiwünscht, weil er sich da endlich einmal gründlich ausschlafen kann?
Alle diese Krankheiten sind im allerstärksten Masse ansteckend, keine aber greift in so verblüffendem Masse um sich, wie der Landhunger. Diese amerikanische Krankheit ist im allgemeinen schmerzlos, sie greift nur den Geldbeutel und die Nerven an. Eine Heilung an Ort und Stelle gibt es nicht, nur eine Rettung: schleunige Flucht nach Europa, dessen Klima den merkwürdigen Einfluss hat, alles das lächerlich und absurd zu machen, was man drüben als höchst selbstverständlich und natürlich hinnimmt.
Wenn man frisch hineinschneit nach Buenos Aires, lacht man nicht wenig über diese närrische Krankheit, die einem überall in die Augen springt. Immer wieder trifft man Bureaus von Landgesellschaften, die ihre Hausfronten zu grossen Schildern machen, auf denen das beste und billigste Land der Erde angeboten wird. Sandwichmänner laufen in starken Trupps durch die Strassen, auf ihren Tafeln zeigen sie die nächste grosse Landauktion in Chubut oder in Santa Fé an. Ueberall hängen Plakate mit Landangeboten, alle Zeitungen, Kursbücher, Adressen- und Telephonverzeichnisse sind voll von solchen Annoncen. So wird das Auge verführt, aber das Ohr wird nicht weniger belagert. Den Phonographen, die aus den Fenstern ihre Landofferten hinausschreien, kann man ja weglaufen, den Bekannten aber, die man in Gesellschaften, im Theater, im Restaurant, auf der Strasse oder im Kaffeehause trifft, kann man mit dem besten Willen nicht entgehen. Man kann sprechen über was man will, – in fünf Minuten handelt man doch mit Land. Und es nutzt nichts, dass man entrüstet aufsteht und andere Leute aufsucht, – da geht es genau ebenso zu. Ob man nun mit Katholiken, Protestanten oder Juden, mit Deutschen, Franzosen, Yankees, Skandinaviern, Italienern, Spaniern, Criollos oder Basken spricht, – in irgendeiner Sprache handelt man doch ganz gewiss mit Grundstücken. Mit den Deutschen ist es gewöhnlich so. Zuerst wollen sie einem zeigen, dass sie auch da drüben ihre geistigen Interessen bewahrt haben und durchaus auf der Höhe sind. Deshalb erzählen sie einem den neuesten Witz aus dem »Simplizissimus« oder sie kommentieren einen Aufsatz der »Zukunft« – auf diese Blätter sind sie nämlich abonniert. Damit aber glauben sie aller Höflichkeit durchaus Genüge getan zu haben; nun beginnt die Debatte, ob die englische Gesellschaft die gewünschte Konzession für die zweite Andenbahn erhalten wird, ob die Schiffbarmachung des mittleren Laufes des Pilcomayo in der Tat möglich sein wird, ob die bolivianische Regierung sich für das französische Bahnprojekt durch Matto Grosso oder für das englische durch Paraguay einsetzen wird.
Zu Anfang begreift man nichts von alledem. Aber es ist überraschend, wie schnell man Fortschritte macht; nach einer Woche schon redet man über Terrainspekulationen, als habe man sein ganzes Leben lang sich mit nichts anderem beschäftigt. Es ist fabelhaft, wie man es schon versteht, die Preise anzusetzen, wie herrliche Kalkulationen man machen kann, in welch verblüffenden Wahrscheinlichkeitsrechnungen man exzelliert. Nach einem Monat schon besitzt man ein paar Dutzend Landkarten und macht kreuz und quer Striche hinein – die bedeuten die Eisenbahnen, die man bauen will.
Denn da drüben geschieht alles umgekehrt wie bei uns. Wir bauen eine Eisenbahn, wenn »das Bedürfnis da ist« und das »Bedürfnis« ist nach Ansicht der Regierung dann da, wenn sich die Linie unter allen Umständen glänzend rentieren muss. Die Gegend ist längst dicht bewohnt, das Publikum, alle Behörden, alle Blätter schreien nach einer neuen Bahnverbindung – dann erst, fängt die Regierung an, langsam zu »erwägen«. Sie erwägt jahrelang und sammelt eine ungeheure Menge von Material, das natürlich kein Mensch liest. Und dann, ganz allmählich, entschliesst man sich, hält ein paar Reden, weht mit ein paar Fahnen und tut den ersten Spatenstich. Da drüben ist's anders. Kein Mensch denkt an ein Bedürfnis – denn das ist nie da. Es soll erst geschaffen werden, eben durch die neue Linie. Ist erst eine Eisenbahn da, sagt man sich, dann kommen schon die Leute, dann wird aus Urwald Ackerland, dann wächst der Weizen da, wo Sumpfgras wucherte. Die Verbindung ist die Hauptsache, alles andere kommt schon von selbst. Es kommt auch schliesslich – aber bis dahin würden gewiss zehn kapitalkräftige Gesellschaften an der trotz enormer Preise unrentablen Bahn zugrunde gehen, wenn nicht die Herren Erbauer mit einem Faktor rechnen würden: dem Landhunger.
Im Grunde ist diese Krankheit ja nur eine andere Form unserer Spielwut. Wir spielen in allen möglichen Lotterien, spielen in Monte Carlo, an der Börse, im Skat und im Poker. Das tut man in Argentinien natürlich auch, und gewiss noch viel gründlicher als bei uns. Nur der Börse hält sich der Einheimische wenigstens ziemlich fern, da ja der gesamte Handel fast ausschliesslich in den Händen von Fremden liegt. Seine Domäne ist aber das Land, da wird er reich; kein Wunder, dass er längst alle Fremden, die ja auch nur reich werden wollen in diesem Lande, gründlich mit seinem Landhunger angesteckt hat. Das Geschäft entwickelt sich nun so, dass irgendein Konsortium irgendwo gewaltige Strecken Landes kauft, eben längs der von ihm projektierten Eisenbahn, für die nun die Konzession nachgesucht wird. Natürlich finden die Ankäufe möglichst geheim statt; wird dann die Konzession erteilt – wobei natürlich Minister, Senatoren, Deputierte auch viele Tausende verdienen –, so steigt der Preis des Grund und Bodens im Augenblick aufs Zehn-, ja aufs Hundertfache und das Geschäft ist von vornherein gesichert, mag die Bahn selbst noch so unrentabel sein. Der Witz des Einzelnen ist nun, alle die Vorgänge zu erfahren, die hinter den Kulissen spielen, herauszufinden, wer irgendwo bauen will und welche Aussichten dann die nachgesuchte Konzession hat. Sie hat immer gute Aussichten, wenn bar geschmiert wird; aber die Herren Abgeordneten und Beamten verstehen ihr Geschäft auch. Die, die nichts bekommen, spielen die Patrioten und entrüsten sich, dass man wieder den Fremden eine neue wertvolle Konzession »schenke«; so müssen häufig so viele Mäuler gestopft werden, dass der ganze Verdienst zum Teufel geht.
Land soll und muss jeder Mensch haben in Buenos Aires; jeder Zeitungsjunge und jeder Stiefelputzer spekuliert in Land. Man kann schon für einen Taler Land kaufen und das tut man auch. Zu sehen bekommt man sein Land freilich nie, hat kaum eine Ahnung, wo es so ungefähr liegen mag, aber das ist ja auch vollkommen unnötig, auf ein paar Tagereisen weit kommt es dem Menschen, der sie doch nicht reist, nicht an. Man hat Land »oben in Paraguay« oder »unten in Patagonien« oder sonst irgendwo. Je weiter es wegliegt von Buenos Aires, um so mehr hat man natürlich. Jeder weiss, dass sein Land »augenblicklich« keinen Heller wert ist, aber jeder hofft, dass es in zehn Jahren Hunderttausende wert sei. Denn, glauben Sie, die Eisenbahn – –
Herr Walter Bebe lud uns in sein Privatkontor. Wir kamen alle: Herr Ingenieur Baier, Herr Generaldirektor Schliemann, Herr Erich Cohnberg und ich; dazu noch ein paar andere Herren. Alle waren Kapitalisten, oder wenigstens angehende Kapitalisten, ich selbst rechnete seit vorgestern mich zu den letzteren, nachdem ich mir für zehn Taler einen Anteil in der totsicheren Neuquen-Landgesellschaft erstanden hatte. Herr Walter Bebe liess alle Sachen von seinem Tisch abräumen, dann breitete er eine sehr grosse und sehr schmutzige Pergamentkarte darüber aus. Wir waren alle Kenner und wir sagten alle: »Ah«, denn wir erkannten sogleich den ungeheuren Wert dieser Karte. Wir erfuhren nicht, woher er sie hatte – Herr Bebe hütete wohl sein Geheimnis – aber wir verstanden, dass sie uns alle im Augenblick zu Millionären machte. Es war die Handkarte (oder eine Kopie davon) eines englischen Ingenieurs, der im Auftrage eines Konsortiums die Möglichkeit einer Eisenbahntrace von Boliviens Hauptstadt durch Matto Grosso bis zum Atlantic untersucht und dabei natürlich ein Hauptaugenmerk auf die Brauchbarkeit des Geländes gelegt hatte. Hübsch grün war allerbester Boden eingezeichnet und alles Land gehörte noch den verschiedenen Regierungen. Das heisst, eigentlich gehört ja der Grund nie den Regierungen, er gehört seinen Eigentümern, den wilden Indianern, aber die kommen ebensowenig in Betracht, wie die Tiger und Gürteltiere: man ignoriert einfach ihre Existenz. Man ist sehr anständig und lässt sie einstweilen wohnen, wo es ihnen beliebt; sollte man, nach Jahrzehnten vielleicht, das Land wirklich einmal brauchen, so jagt man sie eben weg.
Der Ingenieur war von seiner Forschungsreise erst vor kurzem nach London zurückgekehrt; abgeschlossen und vergeben war also noch nichts, aber es war sehr wahrscheinlich, dass das Konsortium diese Route wählen und dann auch gewiss die Konzession bekommen würde, da man von vornherein so klug gewesen war, den bolivianischen Präsidenten und den Gouverneur des Staates Matto Grosso mit sehr erheblichen Gewinnanteilen in das Konsortium hereinzunehmen. Aus eben diesem Grunde aber waren die englischen Herren gezwungen, ihre Arbeiten sehr zu beschleunigen, denn wer konnte wissen, ob die beiden heute allmächtigen Herren im nächsten Jahre noch auf ihren Posten waren?
Das alles erzählte uns Herr Walter Bebe; er war auch über die Preise des Bodens sehr gut informiert. Sie betrugen eigentlich nur den Stempel, den die Regierungen – bezw. ihre Beamten – verdienen wollten, ein paar Taler für so und so viel Quadratkilometer.
Es war alles in Ordnung und wir konnten uns gleich konstituieren: »Terraingesellschaft Germano-Boliviana« nannten wir uns, da wir in Bolivien kaufen wollten.
Herr Walter Bebe wurde zum Vorsitzenden ernannt, Herr Cohnberg sollte als bevollmächtigter Vertreter gleich am nächsten Tage nach Bolivien reisen, um das gewünschte Land zu kaufen. Es war ja kein sehr grosses Stück Land, kaum so gross wie Bayern, und wir waren zu zehn Herren, die sich alle zu gleichen Teilen beteiligten; so habe ich schliesslich nicht viel mehr Land auf mein Teil bekommen als etwa die Rheinpfalz. Aber es ist doch immerhin etwas, und es gibt ja arme Leute in Deutschland, die in der Tat noch weniger Land haben. Uebrigens konnte ich bei weitem mein Geld nicht voll einzahlen, nur zwanzig Taler hatte ich noch flüssig. Aber die Gesellschaft bezahlte für mich, indem sie meine brauchbaren Eigenschaften als Schriftsteller voll und ganz einzuschätzen wusste. Ich bekam dafür die Verpflichtung auferlegt, in Deutschland in allen Blättern für das Land der »Terraingesellschaft Germano-Boliviana« eine weitgehende Reklame zu machen; denn wir wollen unser Land durchaus nicht allein behalten, sondern möglichst bald möglichst viel davon wieder möglichst teuer verkaufen. Ich nehme meinen Auftrag sehr ernst und gerade deshalb habe ich diesen Aufsatz geschrieben, den ich meiner Gesellschaft sofort nach Druck einsenden werde, damit sie sich von meiner Tätigkeit selbst überzeugen kann. Denn ich wünsche meiner Gesellschaft das allerbeste Weiterkommen, wohlverstanden der Gesellschaft, nicht etwa ihren Mitgliedern. Denen muss ich leider, so sympathisch sie mir auch sonst sind, nur wünschen, dass sie allesamt morgen früh das Zeitliche segnen! Warum? Nun, im Paragraphen 3 unserer Statuten haben wir festgesetzt, dass während des ersten Jahrzehntes der, der stirbt, von seinen Genossen beerbt werden soll. Wenn sie nun alle sterben, so beerbe ich sie, und das ist ein sehr gutes Geschäft. Ich hoffe dabei auf ihre eigene Mithilfe, es wäre ja reizend, wenn sie sich gegenseitig ein bisschen umbringen möchten – es liegt doch in ihrem eigenen Interesse! Und wenn ich einem von ihnen einen Brief schreibe über meine glorreiche Propagandatätigkeit für die »T. G. B.«, so vergesse ich nie, ein wenig zu hetzen. Ich weiss wohl, dass meine Wünsche nicht sehr moralisch sind, aber ich bin in dieser Beziehung zu entschuldigen; es ist krankhaft bei mir, pathologisch – ich habe den Landhunger.
Uebrigens bin ich auch bei der »A. T. O.« (Aberdeen Territorial Organisation), bei der »H. A. M.« (Hollandsch-Argentinsche Maatschapij), bei »U. C. I. P.« (Unione Cooperativa Italiano-Paraguaya) und bei sieben anderen Landgesellschaften beteiligt. Ich habe Anteile an Grundstücken in Minas Geraes, Petroleumfelder in Chubut, Boraxstrecken in den chilenischen Anden, Quebrachowaldungen im Chaco – alles in Gegenden, wo, glauben Sie mir, demnächst eine Eisenbahn hinkommt. Ich bin auf dem kürzesten Wege, Trillionär zu werden, ich bin jetzt schon in der grässlichsten Unruhe, wie ich es anfangen soll, nur meine Zinsen aufzubrauchen. Ich werde wahrscheinlich Berlin mit Goldstücken pflastern lassen müssen, anders ist es mit dem besten Willen nicht möglich.
In Punta Arenas, Amerikas südlichster Stadt, kann man nichts tun, als Felle kaufen, in Droschken fahren und Ansichtspostkarten schreiben. Felle kauft man, weil die Stadt ein Freihafen ist und man nirgends so gut und billig Sealskin, Seeotter und Vicuña erhandeln kann – – wenn man etwas davon versteht. Wenn man nichts davon versteht, macht man's wie ich: man kauft teurer ein, als in Berlin. Droschke fahren muss man, weil man sonst weggepustet wird von den Strassen. So rettet man sich vor dem ewigen Sandwinde in eine der beiden vorsintflutlichen Droschken, die die Stadt durcheilen. Ansichtspostkarten aber schreibt man, weil man doch nicht immer Felle kaufen und Droschke fahren kann. Droschkenkutscher gibt es nur zwei in Punta Arenas, aber zweihundert Fellhändler und zweitausend Dalmatiner, die alle mit Ansichtskarten handeln – – wenn ich nur wüsste, an wen sie ihre Karten verkaufen könnten, denn Fremde gibt es gewiss mehr in der Sahara als hier.
Uebrigens tut man doch noch etwas anderes in Punta Arenas. Man fährt von dort zum Feuerlande hinüber – weil es so romantisch ist, wenn man erzählen kann, dass man sogar im Feuerlande gewesen sei und dort nach Gold gesucht habe.
Porvenir heisst der kleine Ort, er besteht aus einem Dutzend Häusern, die alle Gasthöfe sind. Porvenir bildet den Treffpunkt und das Versorgungsheim der Goldwäscher aus aller Herren Ländern. Uebrigens ist es, glaube ich, vorzuziehen, auf der Friedrichstrasse in Berlin nach Gold zu suchen statt im Feuerlande. Wir sahen zwar ein paar Lagunen mit Goldbaggern, aber kein Gold; und die Gesellen, die nach diesem erstrebenswerten Metall wuschen, sahen nicht so aus, als ob sie jemals etwas gefunden hätten. Feuerland hat mich sehr enttäuscht und nur durch seine Pinguine sich wieder einigermassen bei mir rehabilitiert.
Es gibt viele komische Geschöpfe auf dieser Welt, aber der Pinguin ist wohl der komischste. Direktor Heck im Zoologischen Garten zu Berlin hat eine Familie in Pension, und ich versäume nie, sie zu besuchen, so oft ich an die Spree komme. Ihr Wasserbassin ist so eingerichtet, dass man, in einen kleinen unterirdischen Gang eintretend, durch grosse Scheiben in das Wasser sehen kann. Dort muss man sich hinstellen, wenn der Wärter den Pinguinen Fische in das Wasser wirft. Die auf dem Lande so ungelenken Vögel springen ins Wasser, tauchen, schwimmen unter Wasser und jagen flink der Beute nach. Die kurzen zum Fluge untauglichen Flügelstummel werden zu prächtigen Flossen; wie der behendeste Fisch schnellt der Vogel durch die Fluten. Das weiche ölige Gefieder hält die Luft fest, die sich im Wasser in Silberperlen ablöst und nach oben steigt. So erscheint das dahinschiessende Tier in einen wundervollen, silbern perlenden Schaum getaucht, ein Anblick, an dem man sich nicht sattsehen kann.
Aber ich wollte vom Feuerlande erzählen und nicht vom Berliner Zoologischen Garten.
Im Wasser freilich kann man hier die Pinguine nicht so beobachten wie dort, um so besser aber auf dem Lande. Die grossen Kerle sitzen hoch aufgerichtet auf ihren Felsen und regen sich nicht. Plötzlich kommt einer auf den Gedanken, man müsse etwas spielen. Und dann spielen sie »Börse«; es ist das köstlichste Spiel, das man sich denken kann. Sie schreien alle durcheinander, reden mit den kurzen Flügeln und den Füssen. Endlich scheinen sie sich über die Kurse geeinigt zu haben, sehr gravitätisch und ausserordentlich eingenommen von ihrer Wichtigkeit marschieren sie, immer hoch aufgerichtet, dem Meere zu. Ein mächtiger Kopfsprung vom Felsen hinunter und sie sind verschwunden.
Wie Punta Arenas drei Dinge hat, um seinen Kulturwert zu erweisen: Droschken, Felle und Ansichtskarten, so hat auch das Feuerland drei Dinge: Goldwäscher, Pinguine und – – Schiffsvisitenkartenschalen. Das sind merkwürdige Sammlungen, die ich sonst nirgends in der Welt gefunden habe. Ueberall in der Magelhaenstrasse trafen wir schwimmende Wracks von Segelschiffen, manchmal auch Trümmer aufgelaufener Dampfschiffe. In dieser Einsamkeit zu scheitern und wochenlang in jämmerlichster Entbehrung warten zu müssen, bis zufällig ein anderes Schiff als Retter naht, schrecklicher Gedanke! Kein Wunder, dass die Seeleute diese Gegend nicht aus dem Gedächtnis verlieren und auch wünschen, dass ihre Namen hier erhalten bleiben als Bescheinigung ihres Wagnisses. Auf diesen verständlichen Wunsch lässt sich wohl die seltsame Einrichtung der vielen »Schiffsvisitenkartenschalen« zurückführen.
Die grösste dieser eigentümlichen Sammlungen befindet sich freilich in Field-Harbour. Zwischen den engen Kanälen öffnet sich in der herrlichen Fjord- und Alpenlandschaft plötzlich weit ein See, der einen wunderbar geschützten, natürlichen Hafen hat: Field-Harbour. Auf einem kleinen Inselchen, am Fusse eines sich ins Meer ziehenden Gletschers, sieht man überall grosse Bretter, teils an den Felsen, teils an Bäumen festgenagelt. Sie tragen in grossen unbeholfenen Lettern die Namen von Schiffen; Deutsche und Franzosen, Engländer, Dänen, Schweden, Holländer, Norweger, Spanier, Portugiesen, Italiener und Argentinier – alle haben hier auf diese Weise ihre Visitenkarten abgegeben. Wenn die erzählen könnten!
Aber die Pinguine, glaube ich, kennen alle die Geschichten. – Mit einem alten, ganz dicken habe ich Freundschaft geschlossen; ich weiss nicht recht, wie er heisst, aber ich nenne ihn immer Herrn Baron Schlesinger de Buda, und ich bin ganz sicher, dass er ein feuerländischer Kommerzienrat ist. Die Goldwäscher wissen nicht, wo das Gold ist, aber die Pinguine wissen es ganz gewiss, nur sagen sie es nicht. Sie handeln selber damit, und lachen über die dummen Menschen. Nur von den Schicksalen all der gescheiterten Schiffe hat mir Herr Schlesinger Geschichten erzählt – – weil er ein Kommerzienrat ist und sich freut, wenn er einen armen deutschen Dichter protegieren kann!
Man nimmt keinen »Führer« irgendeines Landes in die Hand, ohne nicht wenigstens drei Plätze zu finden, die Alexander von Humboldt »den schönsten Fleck der Erde« oder das »achte Wunder der Welt« oder das »Paradies hienieden« genannt hat. Er verteilt diese drei Phrasen wie Baedeckersche Sterne mit einer gewissen Unparteilichkeit, kein Land kommt da zu kurz. Nun weiss ich freilich nicht, ob er Madeira oder Godesberg, Capri und Granada und hundert andere Erdfleckchen wirklich so preisgekrönt hat, oder ob die Reiseführer nur mit seinem grossen Namen krebsen gehen; das aber ist gewiss: Humboldts Autorität fehlt nirgends, wo es einen einigermassen schönen Blick gibt. Natürlich hat auch Rio einen solchen Humboldtorden: nun, diese ehrende Anerkennung ist weiss Gott verdient.
Tausend Jahre mag man alt werden und immer herum reisen – und man kennt die dünne Kruste des winzigen Sternleins, das wir Erde nennen, noch immer nicht. Ich reise kaum seit zwölf Jahren und ich kann nicht sagen, ob Rio de Janeiro wirklich der schönste Fleck dieser Erde ist. Aber das weiss ich gewiss, dass Rio schön ist, noch schöner vielleicht als Neapel mit seinem Golf, seinen Inseln und seinem Feuerberge. Ja, Rio ist schön! So schön, dass es einem Dichter wohl erlaubt sein mag, den trockenen Ton zu lassen und wie ein Trunkener in Farben und Tönen zu schwelgen. Wer will, mag in irgendeinem Reiseführer Namen und Einzelheiten nachlesen – die er doch wieder vergisst – ich will hier nur den wirren Eindruck niederlegen, den ein fahrender Träumer in sonnenfrohen Wochen dort hatte.
Wenn die Sonne aufgeht, dann fahr' hinein in die Bai! Noch sind die Linien nicht deutlich, noch verwischen sich Gelb und Rot, Wolken und Berge. Noch zieht ein blauer Nebel über die Inseln. Ganz langsam gleitet dein Schiff, als habe es Scheu: als sei das alles nur ein Truggebilde schwindelnder Nebelschichten; als habe es Angst, mit dem Schrei der Dampfpfeife die Fata morgana zu zerreissen. Geh nicht an Deck, noch nicht. Bleibe in deiner Kabine, schau hinaus durch den runden Rahmen deines Kajütfensters. Ein Bild, und ein anderes, und noch eins und wieder ein neues. Nun ein roter Berg, steil im Meere; du hast nie seinen Namen gehört, aber du weisst, dass er »Zuckerhut« heisst. Eine kleine Insel, rings zum Wasser mit leuchtenden Gebäuden bedeckt, dazwischen aufragend, herausschauend aus weissen Steinen ein paar Palmen. Und wieder Berge und Buchten in allen Farben und Formen, immer wechselnd; immer neue Ausschnitte, schöner wie die anderen.
Geh hinauf nun an Deck – die Sonne ist herauf. Da ist es, das ganze grosse herrliche Bild, die strahlende gewaltige Stadt mit ihren Bergen und Wäldern, ihren Buchten und Inseln: Rio de Janeiro. Wenn überhaupt glücklich sein kannst, vielleicht bist du es jetzt. Und bist du ein ganz ungenügsamer Gesell, so wirst du mit dem Schöpfer hadern: dass er dir nur zwei Augen gemacht hat, da vorne im Kopfe, und nicht ringsherum welche, auf allen Seiten. – So musst du dich drehen, viele Male – – –
Wenn ich in Neapel nachtmahlte, oben auf Bertolinis Terrasse, war ich wohl der glücklichsten einer. Ischia und Procida zur Rechten, und hinten, wo die Sonne sank, des Tiberius träumerische Insel. Und die rote Fackel des Vesuv mit weissen Nebeln und die Lande am Golf, dicht besät mit leuchtenden Städten. Und mir zu Füssen mein grausam schönes Neapel, das ich so liebte. Nirgendwo, glaubte ich, kann es schöner sein. Nun aber sitze ich oben auf den Bergen von Rio, auf meinem Balkon im Hotel International – – der Name ist scheusslich und passt so gar nicht zu all dieser Schönheit. Aber nur dieser Name – –
Du fährst mit der elektrischen Tram hinauf – Bond nennt man sie hier. Durch die Stadt – nein, über die Stadt. Denn die Tram läuft über den gewaltigen steinernen Aquädukt, den die Jesuiten vor ein paar hundert Jahren auf steilen Rundbogen bauten. Ganz schmal ist das Ding und rechts und links blickst du tief hinab auf die höchsten Häuser und Palmen. Wie in Brunnen schaust du in Höfe und Gassen hinein, wie kleine Käfer siehst du dort unten die Menschen krabbeln. Und weiter hinauf zwischen Gärten und Villen, immer neue Blicke trinkend aus dieser Fülle ewig wechselnder Gesichte. Da ragen, wie bei einer Feste, mitten im Walde gewaltige Quadermauern auf, hier steigst du aus, hier sollst du bleiben.
Natürlich ist der Wirt ein Deutscher. Ueberall da drüben, wenn du etwas triffst, ganz gut, ganz schön, magst du sicher sein, dass es einem Deutschen gehört. Du bist verwöhnt von der Kost deines Hapagdampfers? Beruhige dich, hier isst du gewiss nicht schlechter, und du hast allen Komfort, den du nur verlangen kannst in einem ersten Hause Berlins oder Londons. – Nur: du hast viel mehr! Geh auf die Terrasse, geh an dein Fenster und blicke hinaus! Oder geh durch den grossen Garten mit seinen Teichen, in denen du schwimmen magst, geh durch den Berg durch, den der Wirt durchstechen liess, seinen »Simplontunnel«, vorbei an den grossen Stallungen mit ihren Pferden und Maultieren, ihren Ochsen, Ziegen, Hunden und Katzen, ihren Gänsen, Truthühnern, Enten und Hühnern, durch die Bambusbüsche und Bananenhaine – zwei Schritte, und du bist mitten im Urwald. Wirklich eine Sensation, die kaum ein anderer Hotelwirt seinen Gästen bieten kann!
Mitten im Urwald! Kannst du dir vorstellen, was das sagen will? Ich habe so manchen Urwald gesehen, und immer wieder berauscht mich sein Zauber. Wenn du Schritt über Schritt staunst über neue, phantastische Phänomene, dann bist du im Urwald. Wenn du in dem undurchdringlichen Gewirre von gewaltigen Stämmen, von armdicken Schlingpflanzen, von haushohen Farren und Palmen nicht mehr weisst, was nun Luftwurzel, was Zweig, was Liane ist, so bist du im Urwald. Wenn du irgendwo, fünf Meter über dir einen mächtigen Felsblock siehst, eingeklemmt zwischen Stamm und Aesten, den der Baum losgerissen hat von dem Abhang, auf dem er steht, und mit hochgenommen hat in jahrzehntelangem Wachsen – glaube mir, dann bist du im Urwald. Wenn du wagerecht in der Luft mit Kronen und Wurzeln einen Baum schweben siehst, länger als der höchste Schiffsmast, irgendwie entwurzelt im Sturm, hinaufgeschleudert und nun festgehalten von taustarken Lianen, über und über bewachsen von blühenden Orchideen – dann bist du im Urwald. Wenn dir Scharen von Affen Steinchen und Stöckchen an den Kopf werfen, wenn blauschillernde Falter, grösser wie dein Strohhut, um dich spielen, wenn bunte Kolibris mit spitzen Schnäbeln aus Blumen trinken und armlange Eidechsen über deine Füsse laufen – wenn du immer wieder neue abenteuerlich geformte Früchte an den Bäumen findest, deren Namen die Nigger, die dir begegnen, nicht einmal kennen – wenn du Ameisenhügel triffst, grösser als du selbst bist – wenn – wenn – – – Glaub mir, ich könnte lange so fortfahren, dir vom Urwald zu erzählen. Aber die Glocke tönt im Hotel, ich eile zurück, den Smoking anzuziehen. Und nach wenigen Minuten esse ich Malossolkaviar und Aguacates – – die bekommst du auch nicht in Berlin!
In Rio de Janeiro lebt ein Poet. Die Leute sagen zwar, er sei ein grässlicher Gauner und Spitzbube, der Jahre hindurch die Eisenbahngesellschaften des Landes betrogen und die Einnahmen in seine eigene Tasche gesteckt hätte. Vielleicht will er dafür jetzt büssen. Das ist aber ganz gleichgültig, ob er büssen will oder nicht, jedenfalls ist er ein Dichter. Er baut mit ungeheuren Kosten elektrische Tramlinien rings um Rio, Berge hinauf, Berge hinab, durch Schluchten und über Abhänge, tief, tief durch den Urwald. Setze dich in einen solchen Bond, du bist sicher ganz allein mit dem Führer. Und er fährt dich um wenige Groschen stundenlang durch den Urwald, immer weiter, immer tiefer hinein. Wenn du willst, hält er; und du musst ihn manchmal halten lassen. Wenn die Sonne sinkt, lass ihn warten, steig aus und blick hinunter, nie hast du eine herrlichere Illumination gesehen. Viele tausende von kleinen Lichtchen, hunderttausende, ein helles Meer glitzernder Sterne. Oben glühen sie am tiefblauen Himmel, unten, viel schöner noch, in der weiten Stadt, um dich herum fliegen sie, auf und nieder, grosse Marienkäfer mit funkelnden Laternchen.
Oder du fährst zur Stadt hinunter. Nimm dir ein Auto, sie stehen an jeder Strassenecke. Fahre herum um die gewaltige Bai über den herrlichen Kai und durch lange Strassen, mit riesigen Palmen besetzt wie mit Mastbäumen. Immer kommst du an einen Berg – da ist es zu Ende? Aber du fährst herum, bist wieder in einem anderen Teile der Stadt, wieder an einer anderen schöneren Bucht –
Fahre den Corcovado hinauf, den Berg, der das Wahrzeichen Rios ist. Eine brave prustende Maschine zieht dich; sie heisst Carmencita, ist aber eine alte gute Schwäbin, die schon fünfunddreissig Jahre da hinauf- und hinabschnauft. Die Wolken jagen unter dir her, legen sich auf die Berge und Wälder und tief auf die Stadt, da musst du schon warten, bis die Schleier zerreissen. Aber warte nur, warte, dann wirst du ein Bild sehen, das du nie in deinem ganzen Leben wieder vergessen wirst. Da oben streben, weit nach Petropolis hin, die schlanken Orgelberge zum Himmel, wie eine steile Burg ragt hinter dir der Tafelberg auf. Unten, mitten in die gewaltige Bai hinein schiebt sich mit breiten Tatzen und hocherhobenem Haupte eine unermessliche Sphinx: der »Zuckerhut«, mit seinen nachgelagerten Höhen. Und du wirst gestehen, dass Humboldt diesmal recht hatte mit seinem »achten Wunder der Welt« – – –
Ich habe ein dickes englisches Buch vor mir liegen, über Brasilien, wohl tausend Seiten stark. Viel sehr viel steht darin über Rio. Auch dass es schön sei, sagt der Engländer: »Rio is a very nice place indeed.« Sonst kein Wort. Aber lange Seiten über elektrische Anlagen und Kaffee-Export, unendliche Statistiken und Vergleiche, alles Sachen, die heute wahr sind und morgen schon wieder grundfalsch. Und das eine, das immer noch bleibt, die ewige prachtvolle Schönheit dieser Stadt, hat er so ganz und gar nicht gesehen. Freilich aus des Engländers Buch werden manche klugen Kaufleute etwas profitiert, aus irgendeinem guten Wink einen Gewinn herausgeschlagen haben. Aus meinem Artikel kann das kein Mensch. Aber was soll ich tun? Ich kann nun einmal nicht so schreiben: »Rio de Janeiro ist die Hauptstadt Brasiliens. Sie hat 823 526 Einwohner, darunter – – –«
Gerade ein halbes Dutzend deutscher Maler traf ich in Südamerika. Zwei in Buenos Aires, einen in Rio, einen mitten im Chaco und einen in der Pampa. Den letzten aber, Don Gustavo, traf ich überall, er abenteuert durch ganz Amerika, von Halifax bis Punta Arenas hinunter.
Der erste war Don Martin. Kaum einen Tag war ich in der Metropole am La Plata, als er zu mir ins Hotel kam; er hatte von meiner Ankunft in den Blättern gelesen und war froh, einmal wieder mit einem Menschen zu sprechen, den er von Berlin her kannte. Don Martin lebte der festen Ueberzeugung, dass er in die schlimmste Räuberhöhle der Welt gefallen sei. Er hat im Berliner Westen ein hübsches Heim, eine liebe Frau, einen reizenden Jungen, hat eine Villa an der Ostsee und genug Bestellungen, um bequem leben zu können. Freilich reich war er gerade nicht; und reich konnte man im Handumdrehen im Silberlande werden, so hatte ihm ein deutscher Schulmeister erzählt, der seinen Urlaub in der Heimat verbrachte.
Martin liess also Weib und Kind und Wohnung und Villa, setzte sich auf den nächsten Hapagdampfer und fuhr nach Argentinien. Er hatte sich einen feinen Plan ausgeheckt, wie er die Herzen der Criollos im Sturme erobern wollte. Ausser seinen Porträts malte er nämlich zuweilen auch grosse Sensationsbilder, nie unter vier Meter im Geviert; eine solche Leinwand hatte er mitgebracht. Sie stellte das Kasino in Monte Carlo dar, im Vordergrunde selbstmordete sich gerade ein eben ruiniertes Hochzeitspärchen. Martin, der inzwischen zu einem Don Martin avanciert war, lief mit zwei Dienstleuten durch die Gassen, suchte das grösste Schaufenster und fand es bei einer deutschen Buchhandlung in der Strasse Bartolomé Mitre. Nach einer halben Stunde schon prangte das Riesenbild am Fenster. Befriedigt zog Don Martin weiter, mietete in irgendeiner Vorstadt ein Zimmer, das man mit einigem guten Willen als Atelier ansprechen konnte, und wartete da des grossen Erfolges. Der Erfolg kam auch, aber er war leider – – viel zu gross. Denn von Stund an stockte jeder Verkehr in der Bartolomé Mitre, der verkehrsreichsten Strasse der Stadt, dicht gedrängt standen Männer und Weiber vor dem Mordfenster, hoben die Kinder auf die Arme und wichen und wankten nicht. Und als dann der beglückte Buchhändler sich entschloss, die Bogenlampen vor seinem Fenster die ganze Nacht über brennen zu lassen, blieben die kunstbegeisterten Leute bis zum Morgen stehen und tief in den Tag hinein. Niemand konnte sich rühren, keiner nach Hause, keiner in sein Geschäft gehen. Die Banken, die alle in dieser Strasse liegen, mussten schliessen, die Trambahnen, die nicht vorwärts und nicht zurück konnten, wurden von Glücklichen erobert, die nun von ihrem Dache aus sehen konnten. Italienische Zeitungsbuben krochen auf die Häuser, liessen in Körben die Blätter hinunter und zogen ihr Geld hinauf; alle Zeitungen fanden reissenden Absatz, sie brachten die Reproduktion des »Selbstmordes von Monte Carlo«. Eine Hungersnot drohte unter der aufgestauten Menschenmasse auszubrechen; Bäcker und Fruchthändler folgten dem Beispiele der Camelots, stiegen auf die Dächer und versorgten die Leute mit Nahrung. Dann machte die Polizei einen Räumungsversuch, der aber ebenso vergeblich war, wie ein anderer des Militärs; man hätte Bergleute holen müssen, um den Schacht leer zu hauen – aber es gibt in Argentinien keine Bergleute. Inzwischen stieg der Wirrwarr. Frauen versahen sich, gebaren Kinder, die einen runden blutroten Flecken auf der Brust hatten, oder aber eine merkwürdige Zeichnung auf dem Rücken trugen, die wie das Kasino von Monte Carlo aussah. Endlich sandte der Präsident der Republik die Feuerwehr; die kroch auf die Dächer und setzte von dort aus die Strasse unter Wasser. Das Wasser floss natürlich in die Nebenstrassen und mit ihm flossen und schwammen die Menschen ab: so wurde Buenos Aires gerettet.
Buenos Aires – aber nicht Don Martin. Ihm und dem Buchhändler wurde wegen Anstiftung zur Revolution der Prozess gemacht, wegen groben Unfugs und Verkehrsstockungen, wegen Erregung öffentlicher Aergernisse durch Herbeiführung von Geburten auf öffentlicher Strasse. Zur Deckung der Geldstrafen und der Kosten wurde der »Selbstmord von Monte Carlo« beschlagnahmt und versteigert: ein patagonischer Estanciero erstand ihn für eine halbe Million. Aber Don Martin bekam davon nichts; nur eine Menge Porträtaufträge erhielt er und arbeitete also tapfer darauf los. Da er jedoch kein Wort spanisch verstand und jeden Menschen, der ein Bild bestellte, als einen ausgemachten Gentleman ansah, auch einen Vorschuss für einen eines Künstlers unwürdige Geschäftspraktik hielt, so war die Folge, dass er in einem Jahre zwar über hundert Bilder gemalt, aber kaum hundert Goldstücke dafür eingenommen hatte. Das Gericht aber scheute er wie die Pest. Lieber hungern, meinte er, und das tat er auch. Ich riet ihm, einen Impresario zu nehmen; aber er hatte schon zwei gehabt und die hatten ihn erst recht hineingelegt. Jetzt war seine einzige Hoffnung, nur einmal jemanden zu finden, der sein Bild bezahlte. Er genierte sich, nach Hause um Geld zu schreiben – wenigstens das Rückreisegeld wollte er sich erwerben. Täglich ging er in die Agentur der Hamburg-Amerika-Linie – – ach, wenn er nur endlich aus dieser Räuberstadt heraus wäre.
Aber Don Nicolàs seinerseits nannte Buenos Aires die entzückendste Stadt der Welt. Er war ein Hamburger Zeichenlehrer und hatte sich aus einem biederen Klaus spanisch weiterentwickelt. Hier hatte er in der Berlitzschule angefangen und dabei seinen Schülern erzählt, dass er eigentlich kein armseliger Sprachlehrer sei, sondern ein grosser Künstler. Zur Bestätigung hatte er ihnen Zeichnungen geschenkt, die er durchgepaust hatte. Er bekam den Neffen eines Deputierten zum Schüler und dann den Sohn eines Senators; da war sein Weg bald gemacht. Jetzt ist er Professor für Kunstgeschichte, Malerei und Bildhauerei an der Universität, aber es ist gewiss, dass sehr bald für ihn eine Akademie geschaffen wird, und dann wird er Direktor. Keine Stadt der Erde, sagt er, hat soviel Interesse für Kunst, soviel Verständnis und soviel edle Begeisterung. Von hier aus wird einst ein neuer Kunstfrühling in die Welt – – –
Mitten in der Pampa traf ich Don Zeppelino. – In Düsseldorf hatten wir einmal, als noch keiner von uns zwanzig Jahre alt war, einen Künstlerklub; da war der das grösste Talent, der am meisten trinken konnte. Jeder hatte einen geistreichen Trinknamen und ihn nannten wir »Zeppes«; mag der Himmel wissen, warum. Er wurde Pferdemaler aus dem einfachen Grunde, weil sein Vater auch Pferdemaler war. Später habe ich ihn oft wieder gesehen, in Karlshorst und in Auteuil; es lässt sich nicht leugnen, dass er eine unerhörte Pferdekenntnis von allen Pferdestammbäumen hatte. Wenn einer »Flying Fox« sagte, fügte er gleich hinzu: »Vom ›Petit Farceur‹ aus der ›Festa‹.« Und dann kamen weitere sechzehn Ahnen nach beiden Seiten hin. In Derby hatte er einen argentinischen Estanciero getroffen, der dort für eine runde Million einen »Matchbox«-Sohn als Beschäler kaufte. Der hatte ihn mit hinübergenommen. Hier wirkte er sehr für das Deutschtum, sprach nur Deutsch – sonst hätte er schweigen müssen – und liess sich Don Zeppelino nennen, was allein seine Bilder um das Dreifache an Wert steigen machte. Er ritt von einer Estancia zur anderen, erklärte jedem Estanciero, dass sein Lieblingsgaul vom »Bucephalus« oder vom »Rozinante« abstamme und unbedingt im Bilde der Nachwelt erhalten werden müsste. Das sahen die Herren ein, und da Zeppelino das Vorschusssystem virtuos beherrscht, wird er bald als reicher Mann zurückkehren.
Don Esteban fand ich in Rio; in München hatte er einst Steffi geheissen. Er malte noch immer Kreidebilder nach Photographien, aber wirklich jetzt mehr aus Liebhaberei. Nötig hatte er's nicht mehr. Denn er hatte in eine ausgezeichnete Pfandleihe hineingeheiratet, ein Geschäft, das überall einträglich, in Brasiliens Hauptstadt aber eine Quelle nie versiegender Reichtümer ist. Früher in München spielte Steffi jeden Abend Tarock und verdiente in wenigen Stunden bis zu zwei Mark. Heute spielt Don Esteban allabendlich Poker und verliert mit tödlicher Sicherheit einige hundert Milreis – – – aber das macht ihm gar nichts, er kann es sich ja leisten. Ja, wenn man eine Pfandklappe hat!
Max Renner aus Wien hat mir eine bittere Enttäuschung bereitet: er ist der einzige deutsche Maler, der da drüben nicht zum »Don« geworden ist. Drei Jahre treibt er sich nun schon da herum und macht nicht den leisesten Versuch, reich zu werden. Wenn er noch selbst reich wäre – aber keine Spur: er hat seine kleine Rente von ein paar tausend Gulden und die verbraucht er. Ich war mit ihm im Chaco, da malte er Indianermännlein und -weiblein, dann Tiger und Krokodile und Tapire und Ameisenbären. Für ihn ist seine Fahrt nur eine grosse Studienreise; er ist also gar kein richtiger Amerikamaler.
Aber ein ganz richtiger, vielmehr der allerrichtigste, den es gibt, das ist Don Gustavo. Er ist ein Düsseldorfer und wenn er Spanisch oder Englisch, Französisch, Italienisch oder Portugiesisch spricht – – – es klingt doch immer genau wie Düsseldorfisch. Das Gymnasium erklomm er bis zur Quarta, dann rückte er aus, wurde Seiltänzer und ging nach den Staaten. Da zog er mit einer Truppe durchs ganze Land und wurde der Reihe nach Parterregymnastiker, Zirkusreiter, Ringkämpfer und Konzertmaler. Diesen letzten Beruf ergriff er in Kanada, als der Herr der Truppe, der bisher in dieser Kunst exzellierte, plötzlich starb. Gustav trat an seine Stelle und malte, wenn die Ringkampfnummer zu Ende war. Das ist eigentlich das bequemste im Artistendasein, Konzertmaler zu spielen: man taucht nur seinen Pinsel in Wasser und wischt damit das dünne Seidenpapier ab, das über der längst fertigen Farbenzeichnung liegt. Gustav aber entwickelte diese Kunst zur Vollendung, er malte mit und ohne Musik, malte mit dem rechten und dem linken Fuss, malte im Trapez an den Füssen hängend oder auf dem Kopfe stehend. Schliesslich stellte er sich mit den Händen auf das trabende Pferd, malte mit dem linken Fuss, schwang mit dem rechten eine amerikanische und eine deutsche Fahne und sang dazu das Yankee-Doodle.
Auf diese Weise verdiente er eine Menge Geld. Dann kehrte er nach Düsseldorf zurück. Inzwischen waren alle seine früheren Schulkameraden längst Maler geworden, und es war daher das allereinfachste, dass er auch Maler wurde. Er mietete sich ein Atelier, richtete es schön ein und war Maler. Aber lange hielt es ihn nicht mehr zu Hause, er musste wieder Kunstreisen machen; jetzt freilich nicht mehr als Artist, sondern als Maler. Südafrika, Australien, die beiden Amerika, Sibirien und Indien hat er mit Porträts beglückt, ja sogar die Japaner verstand er davon zu überzeugen, dass deutsche Bildnisse denn doch eine höhere Kunst repräsentieren als Makimomos, Kakemomos und Oribons. Dazwischen kehrte er immer wieder nach Düsseldorf zurück, von hier aus machte der abenteuernde Wiking seine Beutezüge. Mit der Zeit fand er dann heraus, dass das lateinische Amerika das eigentliche Feld seiner Tätigkeit sei, diese gelobten Staaten, in denen auch in der Kunst das Faustrecht mitspricht. Und das hat Don Gustavo gründlich ausgebildet, ihm ist noch keiner mit der Zahlung durchgegangen, wie so viele dem armen Don Martin. Don Gustavo ist wirklich ein echter Raubritter; er ist der einzige Mensch, den ich je gesehen habe, der ein Panzerhemd trägt. Und ein paar hübsche Kugelbeulen auf der Brust beweisen, dass er es schon nötig gehabt hat.
Einmal traf ich ihn in einer kleinen Stadt im nördlichen Mexiko, da hatte er einen grossen Krach mit einem italienischen Minenbesitzer, der ein paar bestellte Bilder nicht abnehmen wollte. Don Gustavo prozessierte und gewann seinen Prozess trotz der ungeheuerlichsten Quertreibereien. Sein schwerreicher Gegner gab mit vollen Händen allen Richtern und Advokaten. Don Gustavo tat das natürlich auch, aber er erklärte ausserdem noch in aller Freundschaft jedem einzelnen, dass er ihn totschlagen würde, wenn er die Klage verlöre. Natürlich gewann er also. Aus Rache liess der Italiener aus San Franzisko einen Preisboxer kommen, der mit dem Maler in einer Kneipe Händel anfing. Don Gustavo bearbeitete ihn so gründlich mit den Fäusten, dass der arme Preisboxer sechs Monate lang das Hospital hüten musste, während Gustavo selbst ins Gefängnis gesteckt wurde. Dorthin liess er sich von ein paar Freunden seine Pistolen bringen und veranstaltete zu seinem Privatvergnügen ein so sicheres Scheibenschiessen, dass der Polizeihauptmann um seine Nachtruhe fürchtete und ihn höflichst ersuchte, doch nur ja bald das Lokal zu verlassen.
Solcher Stückchen kenne ich ein gutes Dutzend von Don Gustavo. Wie ein Drache fällt er in eine Gegend ein und wehe dem, der sich nicht malen lässt. »Die Kunst über alles« ist sein Wahlspruch, und als Pionier deutscher Kunst erobert er unerschrocken Gebiete, die nie einen Pinsel gesehen haben und eine Palette nicht einmal dem Worte nach kennen. Seine Düsseldorfer Mitmaler ärgern sich über ihn und schimpfen, aber das ist sehr unrecht von ihnen; denn Don Gustavo ist wirklich ein anständiger Kerl, der nicht nur an sich allein denkt, sondern auch alle anderen gern leben lässt.
Einmal traf ich ihn in Westindien; mein Reisegefährte war ein Berliner Marinemaler. Kaum hörte Don Gustavo, dass ein »Kollege« mit mir sei, als er sofort sich anheischig machte, ein Bild von diesem zu verkaufen. Mein Freund hatte nur kleine Stücke Leinwand mit, zu Studienzwecken; Don Gustavo aber brachte augenblicklich einen mächtigen Keilrahmen, überspannte ihn und setzte meinen Freund davor. »Was soll ich denn malen?« fragte dieser. »Einerlei, die Leinwand voll!« war die Antwort. Jede Stunde kam er ins Hotel nachzusehen; endlich – nach drei Tagen – war »die Leinwand voll«. – Kaum eine Viertelstunde später kam Don Gustavo mit dem Käufer, den er völlig erstickte mit einer ungeheuren Lobpreisung des herrlichen Bildes. Der arme Mann konnte nur starren, staunen – und seinen Beutel ziehen.
So ist Don Gustavo; er hat Ellbogen und er weiss sie zu gebrauchen. Vor ein paar hundert Jahren wäre er mit Pizarro nach Peru gezogen und hätte die Goldschätze des Sonnentempels zum Rheine geschleppt. Heute führt er den Pinsel statt des Raufdegens, und die Pistole steckt nur zur besseren Unterstützung in der Hosentasche. »Werde Christ oder ich verbrenne dich!« sagten die Konquistadoren. »Lass dich malen oder ich schiesse dich tot!« sagte Don Gustavo. So erobert er Amerika. Ich mag ihn sehr gut leiden, weil er ein prächtiger Kerl ist und in sieben Sprachen Düsseldorfisch spricht.
Europas Geschichte ist voll von Frauen. Da ist kein grosses Drama, in dem nicht Frauen ihre Rollen, und tragende Rollen, gehabt hätten. In der Geschichte der beiden Amerika dagegen stossen wir nur auf Männer, kaum ist irgendeine kleine Charge einmal von einem weiblichen Mitgliede des grossen Welttheaters besetzt.
Im lateinischen Amerika vollends finden wir nur eine einzige Frau, die mit ihren schönen Händen in das Geschick der Völker hineingriff und vier Länder in den gewaltigsten Krieg trieb, den der Kontinent erlebte. Das war die Engländerin Elisa Lynch.
Man kennt ihren Namen in Europa kaum und doch verdient diese merkwürdige Frau in der Weltgeschichte ihren Platz dicht neben Nelsons Freundin, ihrer Landsmännin Lady Hamilton, zu deren Lebensgang der ihre eine seltsame Parallele bildet. Emma Lyonna Harte, die spätere Lady Hamilton, erwarb kümmerlich ihren und ihrer Mutter Unterhalt auf dem Pflaster Londons, bis eines Tages ein Wunderdoktor die Strassendirne aufgriff und sie in seinen Räumen als Hygieia, die Göttin der Gesundheit, einem erstaunten Publico ausstellte. Dort sah der berühmte Romney ihren herrlichen Körper; über zwei Dutzend prächtiger Meisterwerke verdankt die Welt seinem Pinsel und der reinen Schönheit der Dirne. Emma Lyonna war im Augenblick berühmt und die Dandies rissen sich um sie. Sie ging aus einer Hand in die andere, um schliesslich den englischen Gesandten am napolitanischen Hofe, Lord Hamilton, zu heiraten. Dort spielte sie bald eine ausserordentlich politische Rolle, nicht so sehr durch ihre intime Freundschaft mit Marie Antoniettes Schwester, der Königin Karoline, als besonders auch durch die glühende Liebe Lord Nelsons, des Königs der Meere. Ihr Einfluss ging weit über Italien hinaus, sie spann ihre Ränke sowohl in Wien und Hamburg, wie in dem heimischen London, und Frankreich hatte mit dieser Frau nicht weniger zu rechnen wie mit dem König von Preussen. Nach Nelsons Tode verblich dann schnell ihr Stern, selbst die Tochter, die sie von Englands Nationalhelden hatte, vermochte nicht ihr Alter vor den englischen Heuchlern zu schützen und ihren vollständigen Ruin aufzuhalten. Sie starb in bitterster Armut, elend und verlassen.
Ein halbes Jahrhundert später machte die Londonerin Elisa Lynch eine ähnliche und gewiss nicht weniger abenteuerliche Karriere. Als sechzehnjähriges Mädchen heiratete sie einen vermögenden Engländer, der aber kurz darauf starb. Sie ging dann mit ihrer Mutter nach Paris und heiratete bald zum zweiten Male und zwar einen Pariser Arzt, der heute noch als Direktor eines grossen botanischen Gartens lebt. Aber wohl schon vor dieser Ehe hatte die Engländerin die Reize des Pariser Nachtlebens kennen und lieben gelernt; so liess sich ihr Mann bald von ihr scheiden. Elisa Lynch legte sich nun keine Rücksichten mehr auf, sondern wurde, was ihre Natur ihr gebot: eine »grande cocotte«. Sie besuchte regelmässig die öffentlichen Ballokale und namentlich war es der Garten Mabille, berühmt durch Heinrich Heines herrlichen Zyklus von der »Königin Pomare«, den sie mit ihrem Erscheinen beehrte. Dort lernte sie Francisco Solano Lopez kennen, den Sohn des Diktators von Paraguay.
– Merkwürdig genug ist die Geschichte dieses Landes. Die spanischen Eroberer zogen gleich nach ihrem Einbruch ins Land vom Süden her den La Plata hinauf; Assuncion, die heutige Hauptstadt des Landes, ist eine ihrer ersten Gründungen. Die fast wehrlosen Chacoindianer dieser Gebiete liessen sich bald ansiedeln, im Gegensatz zu den wilden Pampasindianern des Südens. Hier harmlose Waldmenschen, fast Kinder oder Affen, wie man will, – dort die Spanier, starke Eroberernaturen, roh und rücksichtlos: da war die Folge natürlich, dass die »Ansiedelungen« sehr bald zu Sklaveninstituten wurden, in denen die Indianer in Scharen zugrunde gingen. Dann kamen, von der spanischen Krone mit den weitgehendsten Privilegien versehen, zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Jesuiten; neben den »Laienansiedelungen« entstanden sehr bald die »geistlichen«, die, wachsend von Jahr zu Jahr, bald zu einem mächtigen Reiche sich entwickelten, der »Republica Christiana«, wie die Padres sie nannten, die sich zur Zeit ihres höchsten Glanzes von der Küste Rio Grandes bis weit nach Bolivien hineinstreckte. Ein theokratischer, kommunistischer Staat, in dem die Herrschenden eine Handvoll Padres waren, während die beherrschten Indianer in solchem Gehorsam und solcher Abhängigkeit lebten, dass sie schon vom fünften Lebensjahre ab auch nicht die kleinste Handlung aus eigenem Antriebe heraus mehr tun durften. So sehr war in diesem geordnetsten Staate der Weltgeschichte, in dem die Behandlung der Indianer durch ihre Herren, die Jesuiten, übrigens eine recht gute, ja mustergültige war, alles vorgeschrieben und reglementiert, dass sogar die Liebe geregelt war, wie in Gestüten. Nach einem 150-jährigen Bestehen zerfiel der Jesuitenstaat; der Neid des Laienelements und der Franziskaner, sowie ein grosser Indianeraufstand, der den Jesuiten in die Schuhe geschoben wurde, verursachten ihre Austreibung. Die Indianer des Jesuitenreiches, treu ihren Padres, widersetzten sich aufs äusserste, in Jahren blutiger Kämpfe mit Spaniern und Portugiesen wurden sie vernichtet; was übrig blieb, flüchtete tief in die Wälder Paraguays und nahm die Gewohnheiten der Wilden wieder an. Alle 36 Jesuitenstädte wurden zerstört, heute hat längst wieder der Urwald das einst blühend kultivierte Land zurückerobert.
Als dann 1810 die südamerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit von der spanischen Krone erfochten, führte einer der neuen Staaten sofort wieder die schrankenloseste Sklaverei ein: Paraguay. Die Jesuiten hatten aus den hundert Indianerstämmen eine Art Volk zusammengeschweisst – die Guarani. Nur Guarani durfte in ihrem Lande gesprochen werden, kein Wort Spanisch. Diese Guaranimasse gab den Hauptstamm der neuen Nation ab, daneben befand sich die kleine Oberschicht der spanischen Kolonisten.
Aus dieser trat ein seltsamer Mann an die Spitze des Landes, ein Mann, der in Wahrheit mit viel mehr Recht als der XIV. Ludwig von sich sagen konnte: » L'Etat c'est moi.« Das war Dr. Francia. Er war ein glühender Feind der Geistlichen, trieb alle aus und duldete so wenig eine Religion in seinem Lande, dass er sogar jede Eheschliessung untersagte. Trotzdem aber adoptierte er das ausgezeichnete Regierungssystem der Jesuiten in allen Stücken, seine Verwaltung des Landes war gerade so vorzüglich und gerade so drakonisch streng, wie die der Padres. Er war der einzige Herr, ja der Gott des Landes. In einem Punkte übertraf seine Verwaltung noch die der Jesuiten: während diese allen Gewinst aus dem Lande heraus nach Europa trugen, verwandte Dr. Francia alles für das Land selbst. Jedermann war Sklave des Staates, keiner hatte ein Eigentum – – aber auch Dr. Francia nicht: er starb als blutarmer Mann. Nach aussen war das Land streng abgeschlossen, niemand konnte hinein noch heraus. Siebenundzwanzig Jahre herrschte der eiserne Diktator; als er starb, wusste kein Mensch, was geschehen sollte, gab es doch weder eine Regierung noch Regierungsorgane. Aber es fand sich ein trefflicher Nachfolger, der Diktator Lopez, der nicht weniger eisern regierte. Freilich hob er das kommunistische System zum Teil wieder auf, rief die Priester wieder ins Land und tat einiges für den Unterricht, aber im grossen und ganzen blieben auch während seiner zwanzigjährigen Herrschaft die Guarani genau so Sklaven, wie sie es unter den Jesuiten und unter Dr. Francia gewesen waren. Und wie sehr sie das waren, wie sehr sie ihren Herrn, der sie wie Vieh behandelte, als Gott verehrten, das zeigten sie in dem Vernichtungskampfe unter seinem Sohne, Francisco Solano Lopez.
Lopez, der Vater, hatte Dr. Francias System, dass jeder Untertan Soldat sei, noch viel kräftiger ausgebaut; seine ganze Regierungszeit war im Grunde ein stetiges Rüsten. Sein junger Sohn war sein Kriegsminister; als solchen sandte er ihn 1854 nach Paris; dort lernte er im Garten Mabille die kankanierende Elisa Lynch kennen. Ihre Beziehungen wurden bald nähere und als der junge Paraguay einige Jahre später in seine Heimat zurückkehrte, nahm er die Geliebte mit sich. Geheiratet hat er sie nie, obwohl sie zwei Söhne von ihm hatte; nichtsdestoweniger war Elisa bald die eigentliche Herrscherin des Landes.
1862 starb der alte Lopez, ihm folgte, zum lebenslänglichen Diktator von seinem Vater ernannt, sein Sohn. Schon den alten Lopez wollte der Kongress zum erblichen »Kaiser« proklamieren, der Sohn aber – oder vielmehr Elisa Lynch – wollte mehr: das Kaisertum des lateinischen Amerika. Nie wird man freilich ganz feststellen können, inwieweit die Handlungen Lopez' seiner Initiative oder der Elisas entsprangen; ich glaube, man wird wohltun, soviel wie möglich das letztere anzunehmen. Denn in der Folge verleugnete der »Supremo« seine eigenste Natur so sehr, dass man die meisten seiner Taten kaum mehr auf sein eigenes Konto setzen kann.
Den Krieg mit den drei viel mächtigeren Nachbarstaaten, Brasilien, Uruguay und Argentinien, brach er völlig grundlos vom Zaun; dass er ihn durch sieben lange Jahre gegen zwanzigfache Uebermacht bis zur völligen Aufreibung seines Volkes fortsetzen konnte, ist nur der ungeheuren Energie der schönen Madama Doña Elisa Lynch zuzuschreiben. Man stelle sich diesen Feldherrn vor, so feige, dass er sich in den tiefsten Keller versteckte, sobald Schüsse knallten, dazu ein Heer aus den harmlosesten friedliebendsten Menschen zusammengesetzt, denen in jahrhundertelanger Sklaverei der Begriff »Vaterland« – in der ersten Waldesfreiheit hatten sie ihn natürlich auch nicht gekannt – vollständig inhaltlos geblieben war, die auch nicht den geringsten Grund hatten, sich, für irgend etwa zu schlagen. Dazu eine Frau, die nur ein Interesse über alles setzte: Geld zu verdienen. Die zwischen Toten und Verwundeten nach der Schlacht herumlief, um den Soldaten die erbeuteten fremden Goldmünzen abzuhandeln. Aber sie verstand es, den Marschallpräsidenten zu entflammen, und der wieder vermochte sein Volk durch seine glühenden, inhaltlich ganz albernen Reden so in Feuer zu setzen, dass es für ihn in die Hölle gegangen wäre. So sehr war der Gehorsam diesem Sklavenvolke eingewachsen, dass Schwerverwundete, die gefangen wurden, baten, man solle sie doch niederschiessen: der »Supremo« habe verboten, dass sie Pardon nähmen. Je mehr der Krieg zu seinen Ungunsten sich wandte, um so grausamer wurde der Tyrann, zu Hunderten liess er seine treuen Paraguays niederschiessen oder totpeitschen. Freilich, man konnte sich loskaufen – – bei Madame Lynch!
Als der Krieg 1870 zu Ende, der Diktator erschossen war, da war die männliche Bevölkerung des Landes fast völlig ausgerottet. Nur ein paar tausend Krüppel waren noch im Lande, und einige hunderttausend Weiber mussten sich mit dem brasilianischen, orientalischen und argentinischen Gesindel trösten, das die Kriegswoge ins Land geschwemmt und zurückgelassen hatte. Das seltsame Volk war tot, dies Volk, das einen der heroischsten und dümmsten Kriege geführt hat, die die Weltgeschichte kennt, das sich »um der Freiheit« willen fast bis zum letzten Mann abschlachten liess – für die grausamste Tyrannei. Ein Volk, das nicht einmal wusste, was ein Vaterland sei und doch dafür starb, das »Independencia ò Muerte« brüllte, aber die rücksichtsloseste Sklaverei gewohnt war und nicht von ihr lassen wollte. Das feige war wie kein anderes Volk und doch die unglaublichsten Heldentaten verrichtete. Das einen Führer hatte, der ohnmächtig und seekrank wurde, wenn die Büchsen krachten, und doch die blutigsten Schlachten führte, die der amerikanische Kontinent kennt. Fürwahr eine Fülle seltsamer Rätsel, deren Schlüssel nicht minder merkwürdig ist: eine engländische Dirne aus einem Pariser Ballhaus, deren Ehrgeiz weit flog, die aber doch einem Gedanken vor allem Raum gab, dem – möglichst viel Geld zu verdienen! Und die – mit diesem banalen Motor – eine ungeheure Maschine in Bewegung setzte, zusammengeschweisst aus Hunderttausenden von Menschenleibern, die alle schmählich zugrunde gingen.
Bis zum letzten Schuss hielt Elisa Lynch bei dem Diktator aus, ihre erstaunliche Energie liess keinen Augenblick die Hoffnung fahren, ihr unerhörter Mut rettete oft genug das Leben des Geliebten. Die verbündeten Regierungen entliessen sie mit ihren Söhnen nach Europa; sie hatte es schon während des Krieges verstanden, dorthin grosse Reichtümer hinüberzuschaffen. Ihr letztes Schicksal ist dann wieder ähnlich dem der Lady Hamilton, ein langsamer Zusammenbruch, ewige Prozesse und der Tod – – irgendwo in der Welt. Kein Mensch bekümmerte sich um sie bei uns in Europa, aber da drüben wird man ihren Namen in Jahrhunderten nicht vergessen.
Man fährt von Buenos Aires aus ein paar Tage lang bis nach Villa Concepcion, setzt dort über den Strom und reitet einige achtzig Kilometer ins Land hinein. Dann kommt man nach San Nicolas, das einmal eine Stadt war, eine der sechsunddreissig Städte des grossen Jesuitenreichs, das anderthalb Jahrhunderte Südamerika beherrschte und nun seit weiteren anderthalbhundert Jahren weggewischt ist mit all seinen merkwürdigen Erinnerungen. Urwald wächst wieder da, wo blühende Felder lagen.
An einem heissen Sommertage ritt ich in die Ruinen. Die Mauern sind überwuchert von alten Lianen, die Häuser zerfallen, erstickt von dem siegenden Grün, das überall vordringt. Orangenbäume, die aus Decken herauswachsen, mächtige Quebrachos, die den Stumpf einer Säule, ein Kapitäl mit hinaufgenommen haben und nun hoch in den Aesten tragen. Keine Strassen mehr – mit der Machete muss man sich den Weg durch den Wald bahnen. Die Kirche kämpft am längsten den hartnäckigen Kampf, die grosse Kirche, die 3500 Menschen fasste. Durch die Fenster wachsen mächtige Platanen heraus, Bananen strecken ihre breiten Blätter da, wo einst der Altar stand. Aber noch hält ein Teil des Daches, noch tragen hohe Säulen das grosse Schiff. Eine ist geborsten, ein starkes Philodendron schlägt die Wurzeln durch den Stein.
Und Schweigen, Schweigen des Urwaldes. Um diese glühende Mittagstunde ruhen alle Tiere, nicht einmal die rastlose Chacogrille lässt ihren Singsang ertönen. Nur grosse blaue Falter wiegen sich in der Sonne, still, langsam, leicht schwebend in der ungeheuren Ruhe.
Das ist die Stille, in der man Sonette dichtet – nein, man dichtet sie nicht. Irgend etwas dichtet sie; man sitzt nur da, ein kleines Stück des unendlichen Friedens, lauscht auf wogende Töne, die keinen Klang haben, schreibt nieder, was ein grösseres diktiert. Und es sind nicht Worte: es ist eine seltsame Musik, die man niederschreibt.
Meine Blicke fallen auf einen verwitterten Stein, irgendeine alte Stufe, von Wasserefeu zerbrochen. Ich lese E. C. C. ... und vervollständige – Ecclesia. (Kirche.) Auf dem Fusse einer Säule sehe ich die Buchstaben L. D. O. M. – Laus Deo Optimo Maximo. (Ruhm dem besten, dem grössten Gotte.) Ich gehe durch den Klosterhof, nur auf einem einzigen Grabstein vermag ich noch eine Inschrift zu erkennen: P. Gonz – l – e Santa Cr – –. Und ich lese: Pater Gonzalez de Santa Cruz. Das ist der Name des Baumeisters der Jesuitenstädte, die alle bis auf den Zentimeter gleich gebaut wurden, wie aus Baukästen aufgestellt. Muster tödlicher Langeweile. Heute ist ein besserer Baumeister gekommen: der siegende Urwald hat aus den Ruinen seltsame Stätten romantischer Melancholie geschaffen. Unter dem Namen des alten Jesuitenarchitekten entziffere ich mit einiger Mühe die Buchstaben: S. S. A. S. X. M. J. Auch das ist nicht zu schwer zu lesen, sind es doch dieselben Lettern, die Christoph Kolumbus stets seinem Namen folgen liess; sie bedeuten: Supplex Servus Altissimi Salvatoris Christi, Mariae, Jesophi. (Demütiger Diener des höchsten Heilandes Christus, der Maria, des Joseph.) Ich schlage mir durch grossblätterige Talquabüsche einen Weg in die Kirche; an einer Seite finde ich noch eine zerschlagene Figur aus Zedernholz, Guaraniarbeit, primitiv, aber doch nicht ohne ein gewisses Verständnis geschaffen.
Hinten, wo die Bananen die Stelle des Altars überwuchern, fand ich eine Tür. Sie war neu, aus Brettern roh zusammengeschlagen und führte zur Sakristei. Ich stiess sie auf, der Raum war augenscheinlich bewohnt, allerlei Geräte, Bettzeuge, Kannen, zerschlagene Schüsseln standen in einem unglaublichen Schmutz durcheinander. Ein menschliches Wesen war nicht zu sehen, wohl aber hörte ich nun hinter mir in der Kirche hastige Schritte. Ein altes Weib kam atemlos auf mich zu, augenscheinlich hatte sie einen diebischen Indianer in mir vermutet. Doch verwandelte sich ihr Schrecken im Augenblick in grosse Freude, als sie einen Fremden in weissem Reitanzug sah; mit unverhohlenem Jubel begrüsste sie mich. Dann machte sie gleich wieder kehrt, rief mir aber in einem ungeheuerlichen Spanisch zu, ich möge nur ja warten, sie würde gleich zurückkommen. Freilich kam sie nicht gleich, erst am Abende stellte sie sich wieder ein. Ich hatte mich inzwischen in einem noch nicht zugewachsenen Teile des Säulenganges im Klosterhofe häuslich niedergelassen; meine Peone Knechte, meist Indianer. waren gerade damit beschäftigt, mir ein leckeres Gürteltier in seiner eigenen Schale zu rösten.
Jentel Tartakower hiess das alte Weib; die beiden, die sie mitbrachte, waren ihr Mann Schalom und ihr Sohn Jaikef. Ich unterhielt mich mit ihnen in reinem Jiddisch, das mich heimatlich an mein Berliner Kaffeehaus erinnerte. Was die Herrschaften aus Kischinew im Urwalde machten, erfuhr ich bald genug; sie verkauften an Fremde ausgegrabene Altertümer aus der Jesuitenzeit, ein Geschäft, das bei einem Maximalbesuch von kaum einem Dutzend Köpfen im Jahre nicht gerade glänzend gewesen wäre, wenn nicht der grössere Teil der Familie, fünf weitere Söhne, überall im Lande als Hausierer herumzogen. Die Tartakowers waren nicht unvermögend, den Grundstock zu ihrem Wohlstande hatten sie in den Baron-Hirschschen Kolonien erworben. Sie waren von Russland ohne einen Heller gekommen und in Moisesville angesiedelt worden; hatten von der »Ica« (Jewish-Colonial-Association, das heisst der Baron-Hirsch-Stiftung) Haus, Land, Arbeitstiere, Werkzeuge, bar Geld, Einrichtung, kurz alles bekommen, was das Herz begehrt. Und sie waren denselben Weg gewandelt, den so viele ihrer Glaubensgenossen in den fünf jüdischen Kolonien gingen, sie hatten so lange die Gesellschaft angebettelt, bis diese endlich die Taschen zuknöpfte. Als dann Tartakowers und manche andere – es wäre unrecht, wenn ich hier nicht bemerken wollte, dass auch eine gute Anzahl ihrer Brüder sich in der Tat zu tüchtigen Ackerbauern herangebildet hat – sahen, dass die Icaverwaltung in Buenos Aires nichts mehr gab, verkauften sie Haus und Land und alles, was sie hatten, und begannen wieder das alte traute Gewerbe, das sie von der Heimat gewohnt waren: sie kehrten zum Hausierhandel zurück. Irgendein Zufall brachte sie auf den Handel mit Funden aus der Jesuitenzeit, für den sie jedenfalls in Argentinien ein Monopol haben.
Natürlich wurde mir eine Menge Zeug zum Kauf angeboten. Ich will meine Sachkenntnis in alten Jesuitenstücken nicht über Gebühr loben; wenn ich den Tartakowers auf den Kopf zusagte, dass auch nicht ein kleines Stückchen von ihrem Kram echt sei, so geschah es lediglich deshalb, weil ich genau wusste, wie bei der Zerstörung des Jesuitenreichs von Indianern und »Mamelucken« – den holländisch-portugiesischen Freischärlern aus dem Staate Rio Grande do Sul – gehaust worden war und wie ausserordentlich wenig echte Stücke selbst in den Museen von La Plata und Buenos Aires zu finden sind. Die Tartakowers schwuren zwar viele heilige Eide für die Echtheit, gerieten aber in ein stillvergnügtes Wanken, als ich ihre Ware für »Tineff« erklärte. Ich wollte gerne ihre Fabrik in Jesuitenartikeln kennen lernen; dass sie mir schliesslich ihr Geheimnis verrieten, habe ich jedoch weniger meinem Anerbieten, ihnen die übrigens sehr geschickt gearbeiteten falschen Sachen zu den geforderten Preisen abzunehmen, als vielmehr meinem »Jiddisch« zu verdanken, das mir im Sturme die Tartakowerschen Herzen gewann. Sie führten mich also am anderen Morgen zu der Werkstatt ihrer Kunst, die an dem viereckigen, noch ziemlich gut erhaltenen Badeteich der Jesuiten gelegen war. Ich fand dort ein paar Hütten, vor denen einige Männer und Frauen arbeiteten. Der Vorsteher und künstlerische Beirat des Betriebes war ein Napolitaner, früher Bronzegiesser in einem der Löcher auf San Martino, also ein Mann, der das Nachmachen alter Kunstgegenstände gründlich verstand; seine Hilfskräfte waren Guarani-Indianer. Die Vorlagen bestanden aus Zeichnungen, die er in den Museen gefertigt hatte, daneben aber variierte er auf eigene Faust und schuf sehr ergötzliche Mischaltertümer, die den Jesuitenstil mit dem ihm eingeimpften pompejanischen sehr lustig verbanden. Dabei war seine Erklärung, dass die guten Padres, wenn sie nicht ausgetrieben worden wären, wohl später so hätten arbeiten lassen, durchaus nicht dumm.
Als ich mich von der Kunsthütte endlich entfernte, lief mir der alte Vorarbeiter, ein schmutziger Guarani, nach und überfiel mich mit einem langen Wortschwall in einer Mischung von Spanisch, Jiddisch, Napolitanisch und Guarani. Mit einiger Mühe brachte ich heraus, was er wollte: er wusste eine Stelle, wo ein grosser Schatz vergraben war und wollte mir seine Weisheit verkaufen. Ein solches Anerbieten ist nicht ganz so von der Hand zu weisen, wie die Briefe, mit denen die bekannten spanischen Schatzgräberbanden immer wieder neue Dumme finden. Es ist ganz gewiss, dass die Jesuiten nicht alle Reichtümer ihrer Kirchen bei dem Untergang ihres Reiches die Flüsse hinunter wegschaffen konnten, und dass sie das einzige taten, was sie in ihrem Falle tun konnten: die Schätze in Erwartung besserer Zeiten vergraben. Auch trifft der andere Einwand, warum denn ein Indianer, der eine Schatzstelle findet, den Schatz nicht selbst hebe, hier nicht zu: die Guarani würden sich lieber die Hände abhacken lassen, als etwas nehmen, das den Geistern des Waldes gehört. Und dass der Alte seinem russischen Brotherrn das Geheimnis nicht erzählen mochte, war auch zu verstehen, von ihm hätte er gewiss keine Belohnung bekommen. Andere Leute sah er aber nicht; die Tartakowers hüteten sich wohl, ihre Kunstwerkstätte profanen Blicken auszusetzen.
So hatte ich also die Hoffnung, binnen kurzem ein reicher Mann zu werden. Ich machte mit dem Alten aus, dass er nur dann hundert Taler bekommen sollte, wenn wir wirklich etwas finden würden und verabschiedete mich von der Familie Tartakower. In Villa Concepcion kaufte ich Schaufeln und Hacken und für den Alten ein Pferd, dann ritten wir unter seiner Führung nach Norden, quer durch den Staat Missiones. Bei San Ignacio setzten wir über den Alta Parana und ritten noch eine gute Tagereise ins paraguaysche Gebiet hinein. Mitten im Wald trafen wir wieder eine alte Jesuitenstadt, die der Alte Hualaguaychu nannte, die aber gewiss einmal, wie alle anderen, den Namen irgendeines christlichen Heiligen getragen hatte. Hier hatte der Urwald das Werk der Vernichtung noch viel gründlicher besorgt als in San Nicolàs; kaum vermochte man aus den überwucherten Trümmern Häuser und Strassenruinen zu erkennen. Auch die Kirche war völlig zerfallen; nur die Mauern des Klosterhofes hatten ein wenig widerstanden. Und hier, bei einem alten Stein, der die rätselhaften Buchstaben »V. L. Q.« trug, sollte der Schatz liegen.
Wir waren nachmittags angekommen, ich beschloss aber, mit der Arbeit bis zur Nacht zu warten. Wenn man schon einmal schatzgraben will, soll man es auch nach allen Regeln der Kunst tun, sagte ich mir und streckte mich ins Gras. Um elf Uhr liess ich meine Peone rings um den Grabstein das Gras wegnehmen und einen Kreis schaffen, den ich vorsichtig mit verbrannten Holzstücken auslegte. Um halb zwölf setzte ich auf den Stein eine dicke alte Kröte; um viertel vor zwölf bereitete ich mir ein Gemisch von Schneckenfett, angebranntem Horn, Holzkohle, Oelsardinenöl, verwelkten Blättern und Dreck und malte mir damit Dreiecke auf die Stirn und die Handflächen; punkt 12 Uhr trat ich in den Kreis. Ich sagte dreimal Abacadabra, rief den Astaroth und den Otiphar an und behauptete, dass die Geister mir gehorchen müssten und mir den Schatz nicht länger vorenthalten dürften. Dann gab ich Befehl, zu graben. Meine Beschwörung hatte auf meine Peone einen sehr tiefen Eindruck gemacht, sie hatten eine Mordsangst und wären am liebsten in die Nacht hinausgelaufen; der alte Guarani hatte sich längst aus dem Staube gemacht und erwartete zähneklappernd irgendwo im Walde die Erfolge dieser grässlichen Tollkühnheit. Der Grabstein war bald weggehoben, immer grösser und tiefer wurde das Loch, immer höher schichtete sich zur Seite der Haufen schwarzer Erde. Zwischen der Erde fanden wir eine kurze, dicke Sorte Engerlinge und eine absonderliche Art von sehr langen, dünnen, fleischfarbigen Regenwürmern. Immer hoffte ich den Spaten an etwas Hartes anstossen zu hören, aber es erklang nichts, gar nichts. Wir arbeiteten bis in den Morgen hinein; entrüstet zeigte ich dem alten Guarani das leere Loch. Er gab zwar seine Sache noch nicht verloren, sondern suchte uns zu neuer Tätigkeit anzuspornen. Ich brachte ihn aber nach San Nicolas zu Tartakowers zurück, gab ihm ein paar Taler und nahm ihm das Versprechen ab, den nächsten Fremden hinzuführen, der würde gewiss mehr Glück haben wie ich. Hoffentlich tut er das und findet bald einen, der die Sache besser versteht: wahrscheinlich war meine Beschwörung nicht ganz richtig.
In diesem Jahre habe ich richtig Ostern gefeiert. Mit Hasen und Eiern und In-die-Kirche-gehen. Das war sehr nett von mir und ich hoffe, es wird mir dereinst vergolten werden. Wie es war, das will ich hier aufschreiben; dann kann ich das Blatt dem Petrus mitbringen, und er muss es schon glauben. Sonst lässt er mich doch vielleicht nicht hinein in den Himmel.
Wenn man so vier Tage lang auf einem kleinen Dampfer den Parana hinaufgefahren ist, immer dieselben schmutzigen Fluten gesehen hat und immer dieselben Ufer – flache Ufer, mit Weidenbäumen, aber sie sehen aus wie englisch geschnittene Anlagen, so dicht sind sie mit grünem Schlingzeug umwuchert – dann weiss man, was Langeweile ist. Wenn man den ersten Alligator sieht, freut man sich und knipst ihn. Beim zweiten holt man die Büchse und schiesst und beim dritten auch. Und dann knipst man und schiesst man abwechselnd. Aber wenn schliesslich alle drei Schritt am Ufer so lange, schlaffaule Kerle sich rekeln, mehr und immer mehr, dann lässt man schliesslich das Knipsen und Schiessen und gähnt genau so wie die alten schmutzigen Krokodile.
Auf dem Fahrplane standen ein halbes Dutzend kleiner Plätze, die wir anlaufen sollten. Wir liefen auch an – aber immer bei Nacht. Und so kamen wir nicht von dem Dampfer herunter, gähnten bei Tag um die Wette mit den Reptilien und kämpften zur Nacht mit den Moskiten, die zweifellos sehr viel gefährlichere Tiere sind. –
Da waren zwei deutsche Familien an Bord, die hinauffuhren nach Paraguay zu ihren Kampen. Sie hatten zusammen elf kleine Kinder, von denen jedes wenigstens dreihundert dicke Mückenbissbeulen hatte. Sie kratzten sich natürlich fortwährend, konnten nicht schlafen, und heulten grässlich, manchmal abwechselnd, aber meistens alle zusammen. Wir erfanden die unglaublichsten Spiele und Scherze, um sie wenigstens für halbe Stunden zu zerstreuen. Und da Ostern kam, so erzählte die eine Mama immerfort von dem wunderbaren Osterhasen, zeigte ihn auch am Ufer, wenn in irgendeiner Lichtung so ein gelbbrauner Pampalampe herumsprang.
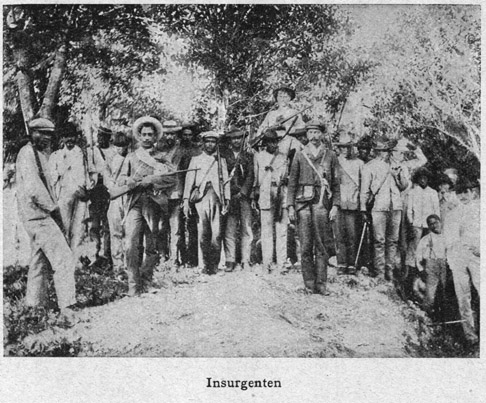
So waren wir festgelegt, wir mussten Ostern feiern, wenn wir nicht an dem Tage die Musik aufs doppelte verstärken wollten. Ich selbst habe mich daran aktiv beteiligt und ich kann Müttern, die ähnliches vorhaben, wertvolle Winke geben. Zuerst mögen sie zum Färben nur gekochte Eier nehmen, nicht rohe, wie ich erst tat. Mein weisser Tropenanzug war gelb im Augenblick; ich zog mich um und liess mir derweil die Eier kochen. Zum Färben nahm ich Karottensaft, der mich den zweiten, Worcestersauce und Tinte, die mich den dritten und vierten Anzug kosteten. Ich ging deshalb zu Rotstift und Blaustift über, die sich ganz ausgezeichnet bewährten, besonders, da es mir mit einiger Mühe gelang, Zeichnungen auf den Eiern anzubringen, von denen ich kühn behauptete, dass es Darstellungen von Krokodilen, Schiffen und Schlangen seien. (Schlangen sind am leichtesten.)
Der eine Vater versteckte die Eier, und zwar so gut, dass die Kinder kaum ein Drittel fanden. Und auch das hatten sie nur ihrem teckelhaften Instinkt zu verdanken, der sie in die schmutzigsten Schlupfwinkel zwischen Taue, Radkästen und Kambüsen hineinführte. Zwei waren in den Maschinenraum gedrungen, der Maschinist rettete ihr Leben nur durch einige kräftige Maulschellen. Natürlich waren die weissen Osterkleidchen bald so schmutzig und zerrissen wie die Wischlappen der Deckjungen, und die Mamas waren ausser sich über die kleinen Schweinderln und heulten mit ihnen um die Wette. Nun sollten die Papas einschreiten, aber die sassen im Rauchzimmer, tranken Cocktails und hielten sich die Ohren zu. – Da tutete die Dampfpfeife, Gott sei Dank, wir hielten.
Drei Stunden hatten wir Aufenthalt in der kleinen Pampastadt; ich bin nie so schnell von Bord gekommen. Im Boot gab uns der Agent die neuesten Zeitungen, übervoll mit Nachrichten über die neueste Revolution; hier war sie ausgebrochen, gestern war der Gouverneur erschossen und das Regierungsgebäude gestürmt worden. So ein bisschen Revolution ist immer nett, wenn man nur zuschaut; ich freute mich schon und schwelgte in Erinnerungen an Haiti und Venezuela.
Ob es gefährlich sei, fragte der eine Papa. Er sei Familienvater – – Der Agent zuckte mitleidig die Achseln. – Gefährlich, eine Revolution in Südamerika gefährlich! Das fehlte noch gerade. Und als ob der Familienvater noch nie eine erlebt hätte – in Paraguay!
Ich ging durch die stillen Gassen. Kein Mensch war zu sehen, nur hier und da bratete ein räudiger Hund in der Sonne. An der grossen Kirche vorbei, die die Stadt heute leerfrass, Frauen und Kinder verschluckte, Regierungsleute und Rebellen, alle in ihrem ungeheuren Bauch vergrub. Irgendein verschlagener Orgelton drang durch die geschlossenen Tore, vielleicht konnte er gleich abbrechen, die Kuppel hinaufflüchten vor dem harten Knatterschreien der Coolepistolen und Browningrevolver. Quer über den Marktplatz, an dessen Bäumen ein gutes Hundert gesattelter Gäule angehalftert stand – kleine unansehnliche Tiere ohne Eisen, die ihre braunen Herren zum Festtage oder zum Aufruhr in die Stadt getragen hatten. Alle waren wohl in der Kirche, nur vor der kleinen Kneipe lungerten ein paar der Gauchos herum, lagen im Schatten auf der Bank und schlürften Mate durch Blechröhrchen. Hässliches Mischblut mit Pferdehaaren und sehnigen Beinen, den braunen Poncho eng um den Hals geworfen.
Und weiter über die palmenbesetzte Placa. In der Mitte ein Reiterstandbild, irgendein General, der in irgendeiner Schlacht das Glück hatte, dass die Gegner früher davonliefen, wie er selbst. Mit grüner Farbe angestrichen und mit faustdicken Ruhmesphrasen auf der schmutzigen Marmortafel. Drei verlauste Indianerbengel spielten Karten auf dem Sockel: Siebeneinhalb um Nickelstücke.
Da, vor dem Denkmal, eine andere Kirche mit zwei runden Ziegelkuppeln. Ein wenig zerfallen, aber gross und mächtig; gierig trank das weit offene Tor die wallende Mittagssonne, sog sie ein, schlürfte wie ein nimmersatter Maelstrom immer neue Wogen flutenden Lichts. Und die tausend Strahlen buntglitzernder Stäubchen zogen jubelnd hinein in die weite Halle und erloschen, immer mehr, immer neue, in ihren tiefen Schatten. Aber es gab kein Ende; wo sie starben, drangen andere vor, lange funkelnde Streifen des reifen Tages. Und als ob dieser geheime Wirbel auch mich in seinem Banne trüge, schoben sich meine Schritte, einer um den anderen, langsam weiter, der toten Kirche zu.
Im Augenblick schlugen die Schatten über mir zusammen, die Augen, das weissstrahlende Licht des Tages gewohnt, tappten unbewusst im dunkeln. Aber gleich richteten sich die Pupillen, klar genug sah ich in der nun überhellen Kirche, die mir eben noch ein dunkles Grabgewölbe schien. Sie war fast leer, leichte Weihrauchwolken glitten zwischen den zerbrochenen, weissgestrichenen Säulen. Nur ganz vorne am Altar fächelten sich ein paar braune Frauen, seltsam kauernd auf niedrigen Hockern. Ein paar falsche kreischende Terzen – – da oben auf der Galerie schlug jemand auf ein verstimmtes Klavier. – Ein Walzer – – das ist – aber ganz gewiss – das ist doch: »Jetzt geh ich zu Maxim!« Nun: der »dumme Reitersmann« und jetzt der grässliche Kram von der »Vilja«. Wirklich, man spielt ein Potpourri aus der » Lustigen Witwe«!
Ich las einmal als Sekundaner »Raskolnikow« unter der Schulbank und hatte längst vergessen, dass an der Tafel der binomische Lehrsatz demonstriert wurde. Erst eine schallende Ohrfeige brachte mir diese Tatsache wieder ins Gedächtnis. Ich hätte den Professor erwürgen mögen – und möchte es heute noch gerne tun, wenn ich an die Ohrfeige denke. Aber sie war nicht schlimmer, wie die, die mir der Klavierspieler versetzte; wenn man schon aus Träumen herausgerissen wird, dann lieber durch handliche Ohrfeigen, als durch die »Lustige Witwe«.
Die frommen Frauen teilten meine Ansicht nicht. Sie beteten und fächelten sich ruhig weiter, in ihrer Andacht gewiss noch bestärkt durch die weihevolle Musik. Ich ging hin zu ihnen, sie starrten hinauf zu – – ja, das musste doch wohl die Madonna sein? Sie trug einen Strahlenkranz und hatte ein nacktes Jesukindlein im Arme, genau so, wie es die Mütter Gottes zu tun pflegen. Aber – sie hatte sich zum Festtage in eine moderne Argentinerin verwandelt. Ein schwarzes Spitzenkleid hatte man ihr angezogen, Lackschuhe und gelbseidene Handschuhe. Einen Fächer trug sie in der Rechten und schien das Jesuknäblein zu fächeln. Auf dem Kopfe türmte sich unter dem Strahlenkranz ein riesiger Hut in Rosa und Moosgrün, mit langen violetten Federn, ein Unikum von einem Hut, der in allen Himmeln Aufsehen erregt hätte. Aber ihre Eleganz war noch echter, noch wirkungsvoller: diese moderne Pampamadonna trug ein Korsett. Nicht irgendein gewöhnliches Mieder, so ein Provinzkorsett, nein, einen prachtvollen Schnürleib, ein wirkliches »Corset de Paris«, Busen heraus, Hüften zurück und den Bauch ganz eingedrückt.
Arme, gute Madonna, wie viel du dir doch gefallen lassen musst! Aber warte nur, bald sind die Festtage vorbei, da zieht man dich wieder aus und du kannst wieder frei atmen unter dem dünnen weissen Hemdchen und dem mottenzerfressenen Tuchkleide.
Ich ging weiter, da stand der heilige Joseph, höchst unglücklich in einem verbrauchten Frackanzug. Die lange Kerze, die er in der Hand trug, war ihm halb heruntergeknickt, die schwarzen Hosen, die einst in besseren Tagen eines Kellners Beine zierten, schlotterten weit über seine dünnen Holzschenkel. – Und neben ihm, an der anderen Seite, St. Johannes; der trug sein Festtagskleid mit feiner Ruhe: selbst in seinem Smoking schien er noch zu lächeln. Er nieste nicht einmal, obwohl ein grosser Weihrauchkessel gerade zu seinen Füssen stand. Aber mir war, als ob er mir ganz leicht mit den Augen zuwinkte. Ich habe ihn immer gern leiden mögen, den Johannes, diesen grossen »fumiste«, der die Offenbarung schrieb. Und auch im Smoking gefällt er mir, ich finde, das steht ihm ganz gut. Ich nickte ihm zu und eh' ich ging, gab ich einen Taler in seine Büchse.
Das Geldstück klapperte. Da hörte die Musik auf da oben. Ein gelber Kaplan bog sich über die Galerie, um zu sehen, in welche Büchse ich mein Scherflein geworfen; dann setzte er sich wieder, seine breiten Pfoten patschten auf die Tasten. Er spielte die »Tonkinoise«.
Es sollte einmal ein Psychologe ein Buch schreiben über die Zusammenhänge zwischen dem und jenem Beruf und den Leuten, die ihn ausüben. Jeder Beruf färbt auf seine Angehörigen stark ab, bringt Typen hervor, die – auf den ersten Blick fast – diesen oder jenen Stand leicht erkennen lassen. Nicht nur der Offizier in Zivil fällt uns auf Reisen an der Table d'hote auf, auch den Juristen, den Arzt, den Apotheker, den Schullehrer kann ein Menschenkenner leicht erraten, ohne nur ein Wort aus seinem Munde gehört zu haben. Ganz besonders aber scheinen mir alle Menschen, die sich viel mit Tieren abgeben, im Laufe der Jahre auch äusserlich wie ein Spiegel dieser Beschäftigung zu wirken. Dabei ist nun freilich nichts Sonderbares, wenn ein kalabrischer Ziegenhirt genau so riecht wie seine Böcke, oder wenn man einem Jockei und auch manchen Kavalleristen die Stallmanieren auf Schritt und Tritt anmerkt. Aber ich kannte einen berühmten Tiermaler, der sah genau so aus, wie die Säue, die er malte. Ich fand einmal eine Photographie von ihm, die ihn als jungen Mann darstellte, da schaute er wirklich noch aus wie ein Mensch; später aber sah er gar nicht mehr aus wie ein Mensch, da hatte er einen richtigen Schweinekopf. Einen Entenmaler kannte ich, der sah zwar nicht aus wie diese Tiere, aber wenn er sprach, dann schnatterte er tak, tak, tak, als ob eine ganze Schar von Enten über den Hof watschelte. Meine alte Tante, die in ihrem Wohnzimmer vier grosse Kästen mit zusammen 27 weissen Mäusen hat, sieht gerade so aus wie eines ihrer schneeweissen kleinen Tanzmäuschen. Deshalb nenne ich sie auch immer nur »Tänzchen Molli« und nie »Täntchen Molli«, wie sie eigentlich heisst. Sie ist ganz klein geworden und hat ein schneeweisses Näschen, so spitz wie ein Nadelknopf. Sie läuft und huscht in ihren Zimmern herum und gibt keinen Augenblick Ruhe, obwohl sie 85 Jahre alt ist. Ich denke immer, sie muss auch einen langen dünnen Mauseschwanz haben, aber das kann man nicht sehen, weil sie immer ein langes, schwarzes Kaschmirkleid trägt.
Ich glaube, alle Leute, die viel mit Tieren umgehen, werden etwas komisch, am meisten aber die Vogelhändler. Das sind die komischsten Leutchen von der Welt. Einer wohnt nicht weit von mir, und ich gehe oft hin, ihn zu besuchen; dann sitze ich still in der Ecke und höre zu, wie er sich mit seinen Pfleglingen unterhält. Ich verstehe es nicht, aber er kennt sechs oder sieben Vogelsprachen und redet mit allen roten und gelben und grünen Federträgern. Ein Blutfink ist da, den kann ich auch schon etwas verstehen. So wie der Alte hineinkommt, pfeift er: »Mach mir auf, ich will raus.« Dann öffnet er ihm die Käfigtür. Der Fink fliegt ihm auf die Schulter und ruft ihm ins Ohr: »So, und nun mach den Käfig hübsch rein.« Da macht der Alte: »Pips! pips! pips!« Das bedeutet: »Jawohl, mein Herr, Sie werden gleich bedient werden.«
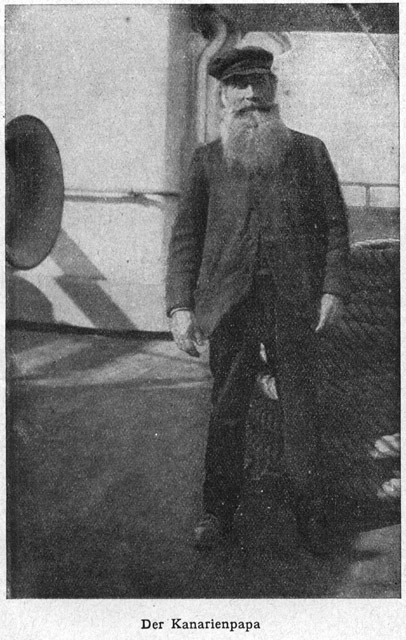
Einmal fuhr ich auf dem »Prinzen Eitel Friedrich«, da war im Zwischendeck ein uralter Mann, der hiess Elias Huster. Er hustete auch wirklich immer ein bisschen, aber es war kein richtiges Husten und ich glaube, er tat es nur so aus alter Gewohnheit, und weil er doch nun einmal Huster hiess. Alle kannten ihn, vom Kapitän bis zum letzten Deckjungen. Denn Elias fuhr schon zum 35. Male mit der Hamburg-Amerika-Linie hinüber nach Bahia. Immer mit derselben Fracht: 2000 Kanarienvögel hatte er bei sich. Der Alte bat nie jemanden um Hilfe, obwohl er allein kaum den vierten Teil der Arbeit hätte leisten können, den die Tierchen machten. Wer aber von der Mannschaft Freiwache hatte, der war gewiß bei Elias und half ihm. Wenn der Kapitän früh morgens die Runde machte, so war sein erstes, sich nach dem Befinden der gelben Spatzen zu erkundigen; selbst der Arzt holte sich aus der Schiffsbilbliothek ein ornithologisches Werk, um Ratschläge erteilen zu können, die Elias dankbar anhörte – aber gewiss nicht befolgte, denn da kannte er sich doch besser aus. Seine Tierchen waren gute Harzer Roller, die in Brasilien nicht weniger beliebt und berühmt sind wie überall in der Welt. In den ersten Tagen waren die Tierchen scheu und verängstigt, aber nach Lissabon schon begannen sie ihre Konzerte. Und der Alte pfiff mit ihnen den ganzen Tag über, wenn er einen nach dem anderen die langen niedrigen Käfige reinigte und den Tierchen Wasser und Körner gab. Er verstand sich ganz ausgezeichnet auf die Pflege; er sagte immer, es gäbe nur ein Mittel und das sei: die Vögel bei guter Laune zu erhalten. Wie ein moderner Gelehrter arbeitete er mit der Suggestion; die Tierchen sollten gar nicht merken, dass die dreiwöchige Seereise irgendwie etwas Gefährliches und Unangenehmes sei. Und so blühte sein Kanarienexport; bei einigermassen normalem Wetter brachte er fast 90 Prozent glücklich hinüber.
Elias Huster, der Kanarienpapa, war ein Patriarch. Er hatte lange weisse Locken und einen langen weissen Bart. Wenn er nicht gerade pfiff, erzählte er von seinen Urenkelkindern; die gingen in Deutschland zur Schule. Und dafür sorgte der Uralte ganz allein; sie sollten nicht so wild und roh aufwachsen, wie seine Söhne und Enkel, die im Staate Rio Grande do Sul mit starken Fäusten dem Urwalde Kulturboden abrangen. Die lachten ihn aus, als er ihnen sagte, die Kleinen sollten in Deutschland zur Schule gehen; wenn er das wolle, so möge er nur selber dafür sorgen! »Nun gut,« sagte der Alte, »so sorge ich selber dafür.« Und er nahm die Kinder hinüber nach Deutschland, gleich vierzehn auf einmal. Nun fährt er hinüber und herüber, von Hamburg nach Bahia, von Bahia nach Hamburg. Zärtlich pfeift er seinen gelben Kanarienvögeln und spricht mit ihnen; aber ich bin gewiss: eigentlich meint er seine Urenkelkinder.
* * *
Ein ganz anderer Mann als der greise Kanarienpapa war Friedrich Wilhelm Kleebinder aus Magdeburg, der Papageienmann. Ich traf ihn zuerst im paraguayschen Chaco. Er redete da in einer höchst merkwürdigen Sprache mit ein paar Guaraniindianern; er hielt sein Idiom wohl für indianisch und die Guarani waren davon überzeugt, dass es spanisch sei. Sie verstanden gegenseitig nicht ein Wort, aber durch irgendein seltsames Phänomen begriffen die Leute doch, dass sie für Kleebinder Papageien fangen sollten, worauf er wieder begriff, dass er dafür Vorschuss zahlen müsse. Vorschuss ist in Paraguay alles; es gibt keine, selbst nicht die kleinste Arbeit, die man nicht Monate zuvor bezahlen muss. Herr Kleebinder sah aus wie ein Indianer, aber so wie ein Sonntagsindianer in einer Jahrmarktsbude. Er hatte sich mit Rot und Blau überall bemalt, trug einen prachtvollen Kopfschmuck aus Hahnenfedern und hatte einen Tomahawk im Gürtel stecken. Dafür aber hatten die Guarani lange Hosen an, blaue Hemden und Jacken, und trugen Strohhüte auf den widerspenstigen Haarsträhnen.
Ein paar Monate später traf ich Herrn Kleebinder in Asuncion, er stieg mit mir an Bord des Mihanowitschdampfer »Paris«, um nach Buenos Aires hinunterzufahren. Seine wilden Vögel hatte er in Riesenkäfigen auf Deck stehen, daneben liefen einige Carpinchos, Iguane und Gürteltiere herum, die er dem zoologischen Garten in Buenos Aires verkaufen wollte. Seine Hauptarbeit bestand darin, die anderen Zwischendecker und namentlich die Kinder von seinen Tieren fern zu halten. Bald darauf redete er mich in Buenos Aires auf der Strasse an; diesmal war er als Kavalier gekleidet, leider auch als Sonntagsnachmittagsjahrmarktskavalier. Er hatte einen speckglänzenden Gehrock an und trug dazu einen stolzen Zylinder. »Aus dem Jahre 1879,« sagte er, »von der Feier meiner ersten und einzigen Hochzeit.« Er sah aus wie ein innerer Missionar und machte auch genau solch ein Gesicht. »Mein harter Beruf zwingt mich, mich in die Stätten des Lasters zu begeben,« sagte er mit tränenerfüllter Stimme. Das schien mir nicht ganz unverständlich, da er sich ein halbes Jahr lang einsam in Chaco herumgetrieben hatte. »Ach,« lachte ich, »und deshalb haben Sie sich so fein gemacht? Wohin wollen Sie denn?« Er weinte beinahe, als er mir antwortete: »Wohin? Ich muss in alle Stätten des Lasters!« Das deuchte mich ganz erstaunlich, alldieweil es in dieser biederen Stadt viele Hundert solcher Lasterstätten gibt. »Friedrich Wilhelm, denken Sie an ihre treue, alte Frau! Sie wandeln auf dem Pfade der Sünde und Ihr Fuss ist dem Straucheln nahe!« Da aber hob sich seine Mannesbrust: »Hochgeehrter Herr,« schluchzte er, »was denken Sie eigentlich von mir? Glauben Sie, dass Kleebinder einen Fuss in die Höhlen des Lasters setzt, zu einem anderen Zweck, als um Vögel zu kaufen?« Dann erfuhr ich, dass aus diesen Lasterpfuhlen die Aristokratie des Papageiengeschlechts hervorgeht. Die Mädchen, die Herr Kleebinder nur den »Auswurf« nannte, sind die besten Professoren, weil sie Zeit, Geduld und Liebe zu den Tieren haben. Dazu kommt, dass in diesen Papageienuniversitäten Professoren aller Länder weilen; so lernen die Vögel deutsch, englisch, spanisch und französisch, ganz besonders aber »jiddisch« sprechen, was namentlich für Berlin das Tier sehr im Werte steigen lässt. Ich besuchte mit Herrn Kleebinder einige Pfuhle des Lasters; er brachte dem »Auswurf«, den er hier freilich nur »Hochverehrtes Fräulein« oder »Muy linda Señorita« nannte, wilde Vögel, zahlte ein ziemlich hohes Aufgeld und tauschte die angelernten Vögel ein. Es war übrigens rührend zu sehen, wie sich der »Auswurf« von den ihm lieb gewordenen Vögeln trennte. Mehr als einmal passierte es, dass irgendein Mädchen uns nachlief auf die Strasse, ihren schon verkauften Vogel wiedernahm und das Geld zurückgab, ja noch draufzahlte, nur um ihr Tier wieder zu bekommen. Das deuchte dann Herrn Kleebinder jedesmal der Gipfel aller Verworfenheit zu sein. »Da kommt nun ein Familienvater,« sagte er, »und bietet diesem Auswurf eine schöne Gelegenheit, einmal auf anständige Weise Geld zu verdienen. Was tut der Auswurf? Er wirft es einem vor die Füsse!« Er war sehr moralisch, der Herr Kleebinder, das ist wirklich wahr. Aber einmal habe ich ihn doch auf eine harte Probe gestellt. »Wissen Sie das neueste«, sagte ich, »die Regierung hat beschlossen, vom nächsten Jahre ab die Stätten des Lasters polizeilich schliessen zu lassen.« Ich log natürlich, die Regierung dachte gar nicht daran. Aber Herrn Kleebinder gab es doch einen mächtigen Stoss. »Was,« schrie er, »was? Und wer soll dann die Papageien abrichten?«
Als ich in Rio de Janeiro mich auf dem »König August Wilhelm« einschiffte, schrie jemand laut meinen Namen. Es war Herr Kleebinder, der sich mit 1000 Papageien im Zwischendeck einquartiert hatte. Er wusste schon, dass ich an Bord kommen sollte und nahm gleich meine Protektion in Anspruch. Ich müsse mit dem Kapitän sprechen, mit dem ersten Offizier, mit dem Zahlmeister; er könne nirgends hin mit seinen Vögeln und über 200 seien ihm schon eingegangen. Nun kann man es gewiss keinem Kapitän übelnehmen, wenn er alle Tierhändler mit etwas scheelen Augen ansieht; mein Papageienmann machte sicherlich mehr Mühe und Arbeit als hundert andere Zwischendecker zusammen, namentlich in den ersten Tagen der Reise, wo alles noch ein wenig durcheinander geht da unten. Nun, Herr Kleebinder hat sich über diese Fahrt nicht zu beklagen brauchen und seine Vögel auch nicht: sie bekamen im Handumdrehen eine Voliere, die jedem Zoo Ehre gemacht hätte. Diesmal zog Friedrich Wilhelm mit seinen Vögeln wieder nach Deutschland; die letzten Jahre aber war er nach Südwestafrika gegangen. »Das war ein gutes Geschäft,« erzählte er. »Da war keiner der Soldaten, der nicht einen Vogel von mir gekauft und mit nach Hause genommen hätte!«
Andenken an Afrika! Ach, wenn die guten Soldatenmütter, Bräute und Schwestern ahnten, woher die Grünfräcke ihre Sprachkenntnisse hatten! Nein, bei den Hottentotten lernt auch der intelligenteste Papagei gewiss nichts: da muss er schon – die Universität in Buenos Aires besuchen!