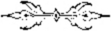|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der arme Paulus saß vor der Thür des Senators auf einer steinernen Bank und fror, denn je näher der Morgen rückte, desto kühler wurde die Nachtluft, und er war so gewohnt an sein wärmendes Schaffell, das er nun Hermas geschenkt hatte.
In seiner Hand hielt er den Kirchenschlüssel, den er dem Pförtner bei Petrus abzugeben versprochen hatte; aber es war Alles so still in dem Hause des Senators, und er scheute sich, die Schläfer zu wecken.
»Was das für eine seltsame Nacht ist!« murmelte er vor sich hin und zog sein kurzes, zerrissenes Röcklein fester zusammen. »Wäre es auch wärmer, und steckt' ich auch statt in diesem fadenscheinigen Läppchen in einem Sack voll flockiger Wolle, es würde mich doch kalt überlaufen, wenn mir die Höllengeister, die hier umgehen, noch einmal begegnen würden. Nun hab' ich's mit eigenen Augen gesehen. Aus der Oase jagen die Dämonen in Weibsgestalt auf den Berg, um uns im Schlaf zu ängstigen und zu verlocken. Was der große Spuk im weißen Gewande mit dem fliegenden Haar wohl im Arm hielt? Vielleicht den Stein, mit dem er, wenn der Alp uns drückt, unsere Brust belastet. Der Andere schien zu fliegen, aber die Schwingen hab' ich doch nicht gesehen. In diesem Seitengebäude muß wohl der Gallier mit seinem ruchlosen Weibe wohnen, das den armen Hermas bestrickt hat. Ob sie wirklich so schön ist? Aber was weiß der Junge, der unter lauter Felsen heranwuchs, von der Anmuth der Weiber. Die Erste, die ihn freundlich ansah, mußte er wohl für die Reizendste halten. Dazu ist sie blond und also ein seltener Vogel unter all den braungebrannten, zweibeinigen Wüstengewächsen. Der Centurio fand das Schaffell gewiß noch nicht, sonst wäre es hier weniger still. Einmal hat, seitdem ich hier warte, ein Esel geschrieen, einmal ein Kameel gebrüllt, und da kräht schon der erste Hahn, aber einen Laut aus dem Mund eines Menschen hab' ich nicht vernommen, nicht einmal das Schnarchen des großen Senators und seiner behäbigen Frau Dorothea, und es wäre doch ein Wunder, wenn diese Beiden nicht schnarchten.«
Er erhob sich und trat an das Fenster der Wohnung des Phöbicius und lauschte durch die halb geöffneten Laden, aber es war Alles still bei den Galliern.
Vor einer Stunde hatte Mirjam in Sirona's Wohnung hineingelauscht.
Sie war, nachdem sie den Verrath begangen, Phöbicius von fern gefolgt und durch die Ställe auf den Hof des Senators geschlüpft.
Sie mußte wissen, was da drinnen vorgefallen, welches Schicksal der wüthende Gallier über Hermas und Sirona verhängt habe.
Sie war auf Alles gefaßt, und der Gedanke, daß der Centurio gegen Beide das Schwert gebraucht haben könnte, erfüllte sie mit bittersüßem Behagen.
Jetzt sah sie Licht in der Oeffnung, welche die beiden nur leicht zusammengelegten Laden trennte, breitete die hölzernen Flügel leicht auseinander und zog sich an ihnen, indem sie den nackten Fuß an die Wand stemmte, elastisch empor.
Da sah sie Sirona auf ihrem Lager in aufgerichteter Stellung und ihr gegenüber den Gallier mit verzerrtem Gesicht. Vor seinen Füßen lag das Schaffell des Hermas. In der Rechten hielt der blasse Mann die brennende Lampe. Ihr Licht fiel auf den Estrich vor dem Lager Sirona's und spiegelte sich in einer großen, rothen dunklen Lache.
»Das ist Blut,« dachte sie, schauderte zusammen und schloß die Augen.
Als sie wieder aufblickte, sah sie, wie die Gallierin mit glühenden Wangen das Antlitz ihrem Gatten zuwandte. Sie war unverletzt; aber Hermas?
»Das ist sein Blut,« klagte und schrie es in ihrem gemarterten Herzen; »und ich, Mörderin, hab' es vergossen!«
Ihre Hände lösten sich von dem Laden, ihre Füße berührten wieder das Pflaster des Hofes, und in furchtbarer Seelenangst eilte sie auf dem Weg, den sie gekommen, in's Freie und dem Berg entgegen.
Sie fühlte, daß sie eher den reißenden Panthern, dem Nachtfroste, dem Durst und Hunger trotzen, als Frau Dorothea, dem Senator und Marthana mit dieser Schuld auf dem Herzen wiederum unter die Augen treten könne. Die fliehende Mirjam war die eine unter den Spukgestalten, deren Anblick Paulus erschreckt hatte.
Der geduldige Anachoret saß wieder auf der Steinbank und dachte: »Der Frost thut doch weh. Es ist gar ein schönes Ding um solch' ein wolliges Schaffell; aber der Heiland hat ganz andere Schmerzen ertragen als diese, und wozu hab' ich die Welt verlassen, als um ihm nachzufolgen und durch Leiden hier mich durchbilden zu den Freuden des Jenseits?
»Da wo die Engel schweben, wird man keine armselige Bockshaut brauchen, und dießmal ist die Selbstsucht mir fremd geblieben, denn ich leide wahrhaftig für Andere, ich friere für Hermas und um dem Alten Schmerz zu ersparen.
»Ich wollte, es wäre noch kälter, ja ich werde, gewiß ich werde nie, niemals wieder einen Pelz um die Schultern legen!«
Paulus bewegte das Haupt, als wolle er sich selbst Beifall zunicken, aber bald schaute er ernster drein, denn er meinte wieder auf einem falschen Weg zu wandeln.
»Da bringt man eine Handvoll Gutes zu Stande,« dachte er, »und gleich füllt sich das Herz mit einer Kameelsladung Stolz. Ob mir die Zähne auch klappern, ich bin doch nur ein elender Wicht! Wie hat's mich bei allen Bedenken und Skrupeln doch gekitzelt, als Die von Raïthu kamen und mir die Würde ihres Aeltesten anboten. Als ich zum ersten Mal mit dem Viergespann siegte, hab' ich lauter gejubelt; aber aufgeblasener war ich doch kaum als neulich! Wie Viele denken dem Heiland nachzufolgen, und es verlangt sie doch nur nach seiner Erhöhung; der Erniedrigung gehen sie fein aus dem Weg. Du, Höchster, bist ja mein Zeuge, ich suche sie ernstlich, aber sobald die Dornen mich ritzen, gleich werden aus meinen Blutstropfen Rosen, und streif' ich sie ab, so kommen die Anderen und werfen mir Kränze in den Weg. Ich glaube, es ist eben so schwer auf Erden, Leid ohne Lust, als Lust ohne Leiden zu finden.«
Also dachte er, während ihm vor Frost die Zähne klapperten; aber sein Sinnen ward unterbrochen, denn die Hunde erhoben ein lautes Gebell.
Phöbicius klopfte jetzt an die Thür des Senators.
Sogleich richtete Paulus sich auf und näherte sich dem Thor des Petrus.
Kein Wort, das auf dem Hof gesprochen wurde, entging ihm.
Die tiefe Stimme war die des Senators, die scharfe und hohe mußte die des Centurio sein.
Der Letztere verlangte von dem Ersteren sein Weib zurück, das er in seinem Hause verborgen halte, während Petrus bestimmt versicherte, Sirona habe seit dem Morgen des vergangenen Tages seine Schwelle nicht betreten.
Trotz des heftigen und gereizten Tones, in dem sein Miethsmann zu ihm sprach, blieb der Senator völlig gelassen und entfernte sich bald, um seine Gattin zu fragen, ob sie etwa, während er geschlafen, der Entflohenen das Haus geöffnet habe.
Paulus hörte die Schritte des im Hof auf und nieder schreitenden Soldaten, die schnell zum Stillstand gelangten, als Frau Dorothea nun mit ihrem Gatten vor die Thür trat und auch ihrerseits mit Entschiedenheit erklärte, nichts von Sirona zu wissen.
»Um so besser,« unterbrach sie Phöbicius, »wird euer Sohn Polykarp über ihr Verbleiben unterrichtet sein.«
»Mein Sohn befindet sich seit gestern in Geschäften zu Raïthu,« entgegnete Petrus fest und abweisend. »Wir erwarteten ihn erst heute Morgen zurück.«
»Er scheint sich beeilt zu haben und schon früher heimgekehrt zu sein,« sagte Phöbicius. »Unsere Vorbereitungen zur Opferfeier auf dem Berg waren kein Geheimniß, und des Hausherrn Abwesenheit reizt die Diebe zum Einbruch, vor Allem die verliebten, die Rosen in das Fenster ihrer Schönen werfen. Ihr Christen rühmt euch, die Ehe heilig zu halten; doch will es mir scheinen, als bezögt ihr dieß nur auf eure Glaubensgenossen. Bei dem Weib des Heiden mögen eure Söhne ihr Glück versuchen; es kommt nur darauf an, ob auch der heidnische Gatte mit sich spielen läßt oder nicht. Was mich nun anbetrifft, so bin ich zu Allem mehr geneigt, als zum Spaß und erkläre Dir, daß ich das Kleid des Kaisers, das ich trage, nicht beschimpfen lasse und gewillt bin, Dein Haus zu untersuchen, und wenn ich das pflichtvergessene Weib und Deinen Sohn bei euch finde, ihn und Dich vor den Richter zu ziehen und mit dem Verführer nach meinem Recht zu verfahren.«
»Du würdest vergeblich suchen,« entgegnete Petrus, indem er sich mühsam beherrschte. »Mein Wort ist ›ja‹ oder ›nein‹, und ich wiederhole es hier. Nein, wir beherbergen nicht sie und nicht ihn. Weder Dorothea noch ich sind geneigt, uns in Deine Angelegenheiten zu mischen, aber wir dulden es auch nicht, daß sich ein Anderer unterstehe, er sei, wer er wolle, sich in unsere Angelegenheiten zu mengen. Diese Schwelle wird nur von Dem, dem ich's gestatte, oder von dem Richter des Kaisers, dem ich weichen muß, übertreten. Dir verbiete ich's und wiederhole nochmals: Sirona ist nicht bei uns, und Du würdest besser thun, sie anderwärts zu suchen, als hier Deine Zeit zu vergeuden.«
»Ich brauche nicht Deinen Rath,« rief der Centurio heftig.
»Und ich,« entgegnete Petrus, »fühle mich wenig berufen, die Händel Deiner Ehe zu schlichten. Auch ohne unsere Hülfe wirst Du Sirona zurückerlangen, denn es ist immerhin schwerer, sein Weib an das Haus zu fesseln, als es einzufangen, wenn es entlaufen.«
»Du wirst mich kennen lernen,« drohte der Centurio und warf einen Blick auf die Sklaven, die sich in dem Hof versammelt hatten und zu denen auch Antonius, des Senators ältester Sohn, getreten war. »Ich rufe unverzüglich meine Leute zusammen, und solltet ihr den Verführer verbergen, so werden wir ihm den Ausgang verlegen.«
»Warte noch eine Stunde,« nahm nun Dorothea das Wort, indem sie die Hand ihres Mannes, welcher seiner selbst kaum mehr mächtig war, mit der ihren berührte, »und Du wirst Polykarp auf dem Hengste seines Vaters heimkehren sehen. Deine Frau weiß so freundlich mit seinen Geschwistern zu spielen! Haben Dich nur die Rosen, die mein Sohn ihr in's Fenster legte, auf den Gedanken gebracht, er sei ihr Verführer, oder sind es noch andere Gründe, die Dich bewegen, ihn und uns mit einer so schweren Beschuldigung zu verletzen?«
Oft, wenn zornige Männer wie düstere Gewitterwolken auf einander zu stoßen drohen, hält sie und drängt sie gleich dem Wehen eines freundlichen Windes ein Wort aus dem Munde eines verständigen Weibes zurück.
Phöbicius war nicht gewillt, der Mutter Polykarp's Rede zu stehen, aber ihre Frage veranlaßte ihn zum ersten Mal zu einem schnellen Rückblick auf das Geschehene, und er konnte sich nicht verhehlen, daß sein Verdacht auf schwachen Füßen stehe. Zu gleicher Zeit sagte er sich nun, daß wenn Sirona statt in das Haus des Senators in's Weite geflohen sei, er hier seine Zeit vergeude und den Vorsprung, den sie ihm ohnehin abgewonnen, in verhängnißvoller Weise anwachsen lasse.
Wenige Sekunden waren zu diesen Erwägungen erforderlich, und gewohnt, sich, wo es noth that, zu beherrschen, sagte er ausweichend: »Wir wollen ja sehen, es wird sich ja finden,« und wandte sich langsam, ohne seine Wirthe zu grüßen, seiner Wohnung zu.
Aber noch hatte er die Thür derselben nicht erreicht, als sich Hufschlag auf der Straße hören ließ, und Petrus ihm nachrief:
»Verziehe noch wenige Augenblicke, denn da kommt Polykarp und wird sich in eigener Person vor Dir rechtfertigen können.«
Der Centurio hemmte den Fuß, der Senator winkte dem alten Jethro, und dieser öffnete das Thor; man hörte einen Reiter aus dem Sattel springen und nicht Polykarp, sondern ein amalekitischer Mann trat in den Hof.
»Was bringst Du?« fragte der Senator, indem er sich halb an den Boten, halb an den Centurio wandte.
»Der Herr Polykarp, Dein Sohn,« entgegnete der Gefragte, ein tief gebräunter Mann in reifen Jahren, mit gelenkigen Gliedern und rascher Zunge, »entbietet Dir und Deiner Hausfrau seinen Gruß und läßt Dir sagen, er werde vor der Mittagszeit mit acht Leuten, die er in Raïthu geworben, hier eintreffen. Frau Dorothea möge für Alle Unterkommen und eine Mahlzeit rüsten.«
»Wann hast Du meinen Sohn verlassen?« fragte Petrus.
»Zwei Stunden vor Untergang der Sonne.«
Petrus athmete auf, denn erst jetzt war er völlig von der Schuldlosigkeit seines Sohnes überzeugt; aber weit entfernt, nun zu triumphiren und Phöbicius das Unrecht, welches er ihm angethan, fühlen zu lassen, sagte er freundlich, denn Theilnahme mit dem Mißgeschick des Galliers war in ihm wach geworden: »Ich wollte, der Bote wüßte auch Auskunft über den Aufenthalt Deines Weibes zu ertheilen. Sie konnte sich schwer an das stille Leben hier in der Oase gewöhnen. Vielleicht ist sie nur entwichen, um eine Stadt aufzusuchen, die einem so jungen und schönen Wesen mehr Abwechslung bietet, als dieser stille Ort in der Wüste.«
Phöbicius schwenkte mit einer Bewegung der Verneinung und des Besserwissens die Hand und sagte: »Ich werde Dir zeigen, was der saubere Nachtvogel in meinem Nest gelassen. Es kann sein, daß ihr zu sagen wißt, wem es gehört.«
Während er sich raschen Schrittes in seine Wohnung begab, war Paulus durch das nunmehr geöffnete Thor in den Hof getreten, begrüßte den Senator und die Seinen und überreichte Petrus den Kirchenschlüssel.
Die Sonne war inzwischen aufgegangen und Frau Dorothea's Gegenwart veranlaßt den Alexandriner, erröthend auf das kurze, durchlöcherte Unterkleid zu schauen, das den immer noch athletischen Wuchs seiner Glieder recht ungenügend verhüllte.
Petrus hatte nur Gutes von Paulus vernommen, aber er maß ihn jetzt mit wenig freundlichen Blicken, denn Alles, was der Uebertreibung gleichsah, widersprach seinem auf Maß und Ordnung gerichteten Sinn.
Paulus fühlte nach, was in dem Senator vorging, als er ihm, ohne ihn eines Wortes zu würdigen, den Schlüssel abnahm. Es war ihm nicht gleichgültig, was dieser Mann von ihm denke, und mit einiger Verlegenheit sagte er: »Wir gehen sonst nicht ohne das Schaffell unter die Leute, aber meines ging nur verloren.«
Noch hatte er nicht ausgesprochen, als Phöbicius mit dem Widderpelze des Hermas in der Hand den Hof betrat und dem Senator zurief: »Das fand ich bei meiner Heimkehr in unserem Gemach.«
»Und wann hast Du gesehen, daß Polykarp sich solchen Mantels bediente?« fragte Frau Dorothea.
»Wenn die Götter die Töchter der Menschen besuchen,« entgegnete der Centurio, »so wählten sie von jeher fremde Gestalten. Warum sollte ein gesalbtes alexandrinisches Herrlein sich nicht einmal in einen der rauhen Narren vom Berge verwandeln? Auch der alte Homer schläft zuweilen, und ich gestehe, daß ich mich in Bezug auf euren Sohn im Irrthum befand. Nichts für ungut, Senator! Du bist hier länger zu Hause als ich; wer mag mir dieses Fell, das noch leidlich neu zu sein scheint, mitsammt den Hörnern zum Geschenk gemacht haben?«
Petrus betrachtete und befühlte den Pelz und sagte dann: »Das ist ein Anachoretenmantel. Die Büßer auf dem Berge pflegen sämmtlich solche zu tragen.«
»So hat also einer von den Müßiggängern den Weg in mein Haus gefunden!« rief der Centurio. »Ich bin der Diener des Kaisers, und alles Gesindel, das hier in der Wüste die Oasenbewohner und die Wanderer beunruhigt, soll ich unschädlich machen. So lautet der Befehl, den ich aus Rom mit hiehernahm. Ich will die schnöden Gesellen alle zusammentreiben wie Wild bei der Hetzjagd, denn Schurken und Einbrecher sind sie, und werde sie zu ängstigen wissen, bis ich unter ihnen den Rechten gefunden!«
»Das wird der Kaiser Dir übel lohnen,« entgegnete Petrus. »Sie sind fromme Christen, und Du weißt, daß Konstantin selbst . . .«
»Konstantin?« fragte der Centurio höhnisch. »Vielleicht läßt er sich auch noch taufen, weil das Wasser nichts schadet, und er die Masse, die dem gekreuzigten Wundertäter nachläuft, nicht ausrotten kann wie der große Diokletian, ohne das Reich zu entvölkern. Aber sieh' diese Münzen. Hier steht das Bildniß des Kaisers, und was steht hier auf der andern Seite? Ist das euer Nazarener, oder ist es der alte Gott, die nie untergehende, unbezwingliche Sonne? Ist Der der Euern einer, der im neuen Konstantinopel die Tyche ehrt und die Dioskuren Kastor und Pollux? Das Wasser, mit dem er sich morgen benetzen läßt, übermorgen wischt er es ab, und die alten Götter werden ihm helfen, wenn er sie in ruhigeren Zeiten gegen euren Aberglauben in's Feld führt!«
»Bis dahin aber,« entgegnete Petrus gelassen, »hat es gute Weile, und heute wenigstens ist Konstantin der Schutzherr der Christen. Ich rathe Dir, übergib Deine Sache dem Bischof Agapitus.«
»Damit er mir eure Lehre auftischt, die selbst für Weiber zu schlecht ist,« lachte der Centurio, »meinen Feinden die Füße zu küssen? Einbrecherisches Gesindel sind die da oben, ich wiederhole es, und als solches werden die bösen Narren behandelt, bis ich meinen Mann gefunden. Heute noch beginn' ich die Hetze.«
»Und heute magst Du sie einstellen, denn dieß Fell ist das meine.«
Paulus war es, der diese Worte laut und entschieden aussprach.
Aller Augen richteten sich auf ihn und den Centurio.
Petrus und die Sklaven hatten den Anachoreten häufig gesehen, aber niemals ohne ein Schaffell, das demjenigen gleich sah, welches Phöbicius in der Hand hielt.
Unerhört und kaum faßbar mußte Denen, die Paulus und Sirona kannten, die Selbstanklage des Erstern erscheinen, und dennoch ward sie von Niemand, selbst nicht von dem Senator bezweifelt.
Nur Frau Dorothea bewegte ungläubig das Haupt, und wenn sie auch keine Erklärung fand für das, was hier vorging, so mußte sie sich doch sagen, daß dieser Mann nicht aussehe wie ein Verführer, und daß die Gallierin um seinetwillen schwerlich ihre Pflicht vergessen haben würde. Es wollte ihr überhaupt nicht gelingen, an die Schuld Sirona's zu glauben, denn sie war ihr herzlich wohlgesinnt und – recht war das gewiß nicht, – aber ihre mütterliche Eitelkeit befahl ihr zu glauben, daß wenn die schöne Frau hätte sündigen wollen, sie doch wahrlich ihren stattlichen Polykarp, dessen Rosen und feurige Blicke sie ja so aufrichtig wie möglich verdammte, diesem struppigen, verwahrlosten Graubart vorgezogen haben würde.
Ganz anders der Centurio.
Er glaubte gern an das Geständniß des Anachoreten, denn um eines je unwürdigern Verführers willen Sirona ihre Pflicht vergessen hatte, je größer war ihre Schuld, je unverzeihlicher ihr Leichtsinn, und seiner männlichen Eitelkeit schien es namentlich solchen Zeugen wie Petrus und Dorothea gegenüber leichter erträglich, daß sein Weib um jeden Preis, auch um den der Hingabe an einen zerlumpten Bettler, Abwechslung und Lust gesucht hatte, als wenn sie einem jüngern, schönern, würdigern Manne als ihm selber ihre Neigung geschenkt haben würde.
Vielfältig hatte er gegen sie gefehlt, aber das lag jetzt Alles wie Federn auf seiner Schale der Wage, während das, was sie begangen, die ihre wie mit schwerem Bleigewichte belastete. Dazu begann er das Gefühl des im Sumpfe Watenden, der mit einem Fuße festen Boden gewinnt, zu empfinden, und dieß Alles zusammen gab ihm die Kraft, dem Anachoreten mit jener Selbstbeherrschung entgegenzutreten, über die er sonst nur im Dienste des Kaisers an der Spitze seiner Soldaten verfügte.
Mit gemachter Würde und einer Haltung, welche bewies, daß er in den Theatern der großen Städte des Reiches auch der Vorstellung von Tragödien beigewohnt hatte, schritt er auf den Alexandriner zu, der seinerseits keinen Schritt zurückwich und ihm mit einem Lächeln, das Petrus und die anderen Zuschauer erschreckte, entgegensah.
Das Gesetz gab den Anachoreten völlig in die Hand des beleidigten Gatten; dieser Letztere aber schien nicht gewillt, sich seines Rechtes zu bedienen, denn nichts als Verachtung und Ekel sprach aus seinen Worten, wie er nun ausrief:
»Wer einen räudigen Hund anfaßt, um ihn zu strafen, der besudelt sich nur die Hände. Das Weib, das mich um Deinetwillen betrog, und Du, schmutziger Bettler, seit einander werth. Wie eine Mücke, die man mit der Hand zerschlägt, könnt' ich Dich hier zermalmen, wenn ich nur wollte; aber mein Schwert gehört dem Kaiser und darf mit so schmutzigem Blut wie Deinem nicht besudelt werden. Immerhin sollst Du Vieh Dein Fell nicht umsonst abgelegt haben. Es ist dicht, und Du wolltest mir doch nur die Mühe ersparen, es Dir abzureißen, bevor ich Dir gebe, was Dir gebührt. An Hieben wird Dir's nicht fehlen. Gestehst Du, wohin sich Dein Liebchen geflüchtet, so werden es wenig, zögerst Du mit der Antwort, so wächst ihre Menge. Leih' mir das Ding da, Bursche!«
Mit diesen Worten nahm er einem Kameeltreiber die Geißel von Nilpferdhaut aus der Hand, trat dicht an den Alexandriner heran und fragte: »Wo ist Sirona?«
»Schlage nur zu,« bat Paulus und zeigte mit der Hand auf seinen Rücken; »so scharf mich Deine Geißel auch trifft, so wird sie mich doch nicht schwer genug für all' meine Sünden bestrafen; aber wo Dein Weib sich verbirgt, das weiß ich wahrhaftig nicht zu sagen, und wenn Du mir auch, statt mich mit diesem armseligen Dinge zu streicheln, die Glieder mit Zangen zerreißest.«
Es lag etwas so unverfälscht Treuherziges in dem Ton der Stimme des Paulus, daß der Centurio ihm zu glauben geneigt war, aber eine angedrohte Strafe unvollzogen zu lassen, war nicht seine Art, und daß seine Hand, wo sie schmerzlich treffen wollte, nicht streichelte, das sollte der wunderliche Bettler erfahren.
Und Paulus erfuhr es, ohne einen Klagelaut zu erheben, und ohne sich von der Stelle zu rühren.
Als Phöbicius endlich den ermatteten Arm ruhen ließ und röchelnd seine Frage wiederholte, antwortete der Gemißhandelte: »Ich sagte es Dir ja: ich weiß es nicht, und kann es darum nicht verrathen.«
Bis hieher hatte Petrus, so sehr es ihn drängte, seinem gemißhandelten Glaubensgenossen beizuspringen, den beleidigten Gatten gewähren lassen, denn der Letztere schien mit ungewöhnlicher Milde zu verfahren und der Alexandriner jeder Strafe werth zu sein; aber es würde Dorothea's Zuspruch nicht bedurft haben, um ihn nun zu veranlassen, sich in's Mittel zu legen.
Er näherte sich dem Centurio und sagte ihm leise: »Du hast dem Uebelthäter gegeben, was ihm gebührt. Wenn Du willst, daß er einer schärfern Strafe verfällt, als Du über ihn verhängen kannst, so überlaß Deine Sache, ich wiederhole es, dem Bischof; Du wirst hier nichts ausrichten. Glaube mir; ich kenne den Mann dort und seinesgleichen. Er weiß thatsächlich nicht, wo Dein Weib sich aufhält, und Du vergeudest hier nur die Zeit und Kraft, die Du zu Rathe halten solltest, um Sirona wiederzufinden. Ich denke, sie wird versucht haben, an das Meer, nach Aegypten, wo möglich nach Alexandria zu entkommen, und dort, – nun, Du kennst ja die Griechenstadt – dort geht sie völlig zu Grunde.«
»Und dabei findet sie,« lachte der Gallier, »was sie sucht, Abwechslung und jedes Vergnügen. Es gibt für solch' junges Geschöpf, das die Freuden liebt, kein dankbareres Geschäft als das Laster. Aber ich will ihr das Spiel verderben. Du hast Recht; es ist nicht gut, ihr einen weitern Vorsprung zu lassen. Hat sie den Weg zum Meere gefunden, so könnte sie jetzt schon . . . Heda, Talib!« und er winkte dem amalekitischen Boten Polykarp's. »Du kommst aus Raïthu; bist Du unterwegs einem fliehenden Weibe begegnet mit gelben Haaren und weißem Gesicht?«
Der Angeredete, ein im Hause des Senators und auch von Phöbicius als zuverlässig und besonnen hochgeschätzter freier Mann mit klugen Augen, hatte diese Frage erwartet und gab nun eifrig zurück:
»Zwei Stadien etwa vor el Heswe ist mir die große Karawane aus Petra begegnet, die gestern hier in der Oase gerastet hat. Da lief auch ein Weib mit, wie Du es beschreibst. Als ich hörte, was hier vorgegangen, wollte ich schon reden, aber wer hört, wenn es donnert, das Heimchen?«
»War ein lahmes Windspiel mit ihr?« fragte Phöbicius erwartungsvoll.
»Sie trug etwas in den Armen,« erwiderte der Amalekiter. »Ich hielt es im Mondschein für einen Säugling. Mein Bruder, der die Karawane begleitet, sagte mir, die Frau sei wohl auf der Flucht, denn sie habe das Schutzgeld nicht mit klingender Münze, sondern mit einem goldenen Siegelringe bezahlt.«
Der Gallier erinnerte sich nun an einen goldenen Reifen mit einem schön geschnittenen Onyx, den er vor langen Jahren Glycera, die noch einen gleichen besaß, von dem Finger gezogen und Sirona am Tage der Hochzeit geschenkt hatte.
»Seltsam,« dachte er, »was wir den Frauen schenken, um sie an uns zu fesseln, das brauchen sie als Waffe gegen uns, sei es, um anderen Männern als uns zu gefallen, sei es, um sich den Weg zu ebnen, der sie von uns entfernt. Mit einem Armband Glycera's bezahlte ich damals den Schiffsherrn, der uns nach Alexandria führte. Aber der weichherzige Narr, dessen Täubchen mir nachflog, und ich sind von verschiedenem Schlage. Ich folge dem entwichenen Vogel und fange ihn ein.«
Die letzten Worte hatte er laut gesprochen und trug nun einem Sklaven des Petrus auf, sein Maulthier tüchtig zu füttern und zu tränken, denn sein eigener Pferdeknecht und auch der älteste Decurio, der ihn in seiner Abwesenheit zu vertreten hatte, gehörten zu den Mithrasverehrern und waren noch nicht von dem Berge zurückgekehrt.
Phöbicius bezweifelte nicht, daß das Weib, welches sich der Karawane, die er selbst am gestrigen Tage gesehen, angeschlossen hatte, seine entflohene Gattin sei, und wußte, daß seine Säumniß seinen heißen Wunsch, sie einzuholen und zu strafen, in weite Ferne rücken könnte; aber er war ein römischer Soldat und würde eher die Hand an sich selbst gelegt, als seinen Posten ohne Stellvertretung verlassen haben.
Als seine Glaubensgenossen endlich von dem Opfer und ihrer Begrüßung der aufgehenden Sonne zurückkehrten, waren seine Vorbereitungen zu einer längern Reise beendet.
Sorgfältig schärfte Phöbicius seinem Decurio ein, was er während seiner Abwesenheit zu thun, und wie er sich zu verhalten habe. Dann übergab er Petrus den Schlüssel seines Hauses, sowie die schwarze Sklavin, die über die Flucht ihrer Herrin laut und leidenschaftlich weinte und klagte, und ersuchte den Senator, den Bischof von der That des Anachoreten in Kenntniß zu setzen. Endlich trabte er rasch der Karawane nach, um womöglich vor ihrer Einschiffung das Meer zu erreichen. Der Amalekiter Talib ritt ihm voran und wies ihm den Weg.
Als sich der Hufschlag des Maulthiers weiter und weiter entfernte, verließ auch Paulus den Hof des Senators; Frau Dorothea aber sagte ihrem Gatten, indem sie auf den dem Berge zuschreitenden Anachoreten wies: »Wahrlich, Mann, das war ein seltsamer Morgen; Alles, was hier geschehen ist, scheint ja sonnenklar zu sein, und doch vermag ich es nicht zu begreifen. Das Herz schnürt sich mir zu, wenn ich mir vorstelle, was der armen Sirona geschehen wird, wenn ihr wüthender Gatte sie einholt. Es ist doch, als gäb' es zweierlei Ehen. Die einen stiftet der freundlichste Engel, ja der Allgütige selbst, die anderen aber . . . Nicht auszudenken ist es! – Wie werden die Beiden künftig zusammen wohnen? Und das unter unserem Dache! Wie zerstört und abgebrannt erscheint mir ihr verschlossenes Haus, und wir haben die Brennnesseln schon aufschießen sehen, die überall unter den Trümmern von vernichteten Menschenwohnungen wuchern.« . . .