
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der russische kommandierende General im Abschnitt Urga hat die Herren seines Stabes um sich versammelt.
Das Generalkommando liegt in dem neuen großen Gebäude der mongolischen Reichsbank, deren Panzergewölbe erwünschte Deckung gegen die zu erwartenden, aber merkwürdigerweise bisher noch nicht erfolgten Bombenangriffe des Gegners bieten.
Der General, Träger eines berühmten Namens europäischer Kriegsgeschichte, mit seinem Stabschef, einem ehemaligen Werkzeugschlosser, einem untersetzten, intelligent aussehenden Manne, steht über die Karten gebeugt am Ende des langen Tisches am Fenster. Um ihn die Führer der hier eingesetzten Truppenteile. Neben großen Gestalten, die ihre bäuerliche Ahnenreihe nicht verleugnen können, stehen kleine bewegliche Offiziere dunkleren Typus, Weißrussen und Ukrainer, schlanke Kaukasier und Männer polnischer Abstammung.
Ein sehniger blonder Offizier mit einer scharfen Adlernase im hageren kühnen Antlitz, die unvermeidliche Zigarette zwischen den schmalen Lippen, der berühmte Führer der Luftgeschwader, General Bars, fällt besonders auf. Er ist von Haus aus Deutscher, aber seinen deutschen Namen kennen die wenigsten; seine Leute nennen ihn »Bars«, das heißt der Panther, und so nennt ihn die ganze Armee.
Die Ausführungen des kommandierenden Generals gipfeln in der klaren Kennzeichnung der Lage, daß ein allgemeiner Angriff gegen die Stadt aus Südwesten her zu erwarten sei; selbst offensiv zu werden, sei leider von der Heeresleitung in diesem Abschnitt nicht vorgesehen. Die noch durchaus ungeklärte Lage des bei Mandschuria kämpfenden linken Armeeflügels, die außerordentlich große Ausdehnung der Kampffront in der Mongolei und nicht zuletzt das Fehlen der immer wieder angeforderten Tankträgerformationen – hier macht der General mit einem leicht boshaften Zug um die Mundwinkel eine kleine Verbeugung zu Bars hin – lasse aber die Maßnahme der Heeresleitung verständlich erscheinen.
»Meine Herren, wir stehen hier auf exponiertem Posten; Rußland, ganz Europa erwartet von uns, daß wir unsere Pflicht tun.
Zeigen Sie, daß wir des Vertrauens der zivilisierten Welt würdig sind!«
*
An den Hängen des Bogdo-Ola, des heiligen Berges von Urga, dessen Bäume nicht gefällt und dessen Wild nicht gejagt werden darf, zwischen Birken in frühem Herbstgold und schlanken Lärchen arbeiten russische Soldaten am Bau von Batteriestellungen und Unterständen für die Flugabwehrgeschütze, die noch ungedeckt in Gruppen von je vier Kanonen zusammenstehen. Die großen Horchgeräte und Entfernungsmesser, Bereitschaftsmunition und die Wagen der Radioanlage sind behelfsmäßig mit Zweigen und Asten getarnt. Mit den handlichen Elektrosägen werden Bäume reihenweise gefällt, mit Preßluftbohrern und Fräsern der steinige Boden aufgerissen – die Maschinen stammen vom Bahnbau Kjachta-Urga, der vorläufig eingestellt ist.
Zum Vergnügen der Soldaten klettern ein paar rotgekleidete Lamas jammernd zwischen den Stämmen herum und beschwören die Heiligtumsschänder, von ihrem unseligen Tun abzulassen. Unablässig ihre Gebetsmühlen drehend oder Rosenkränze zwischen den Fingern weiterbewegend, reden sie wild auf die Arbeitenden ein. Da aber die Soldaten kein Mongolisch verstehen, dieser Berg für sie zudem ohne jede heilige Bedeutung ist, aber eine möglichst rasche Fertigstellung der Deckungsbauten unter den obwaltenden Verhältnissen sehr erwünscht erscheint, haben die lamentierenden Mönche keinerlei Erfolg. Die Soldaten lachen und verhöhnen die Lamas, die mit komisch erhobenen Gewändern über die gefällten Bäume steigen, wobei man ihre nackten Beine sieht, deren braune Farbe durchaus nicht nur das natürliche Kolorit ihrer Rasse, sondern vorwiegend ganz gewöhnlicher Dreck ist.
Einer von den Soldaten, der wohl die Ursache des Lamentos erkannt hat, ruft den Mönchen zu:
»He, ihr da, ihr, wenn ihr nicht bald verschwindet und uns in Ruhe laßt, werden wir den ganzen Berg so kahl machen wie eure dreckigen Schädel sind.« Unter allgemeinem Gelächter verschwinden mit schwirrenden Gebetsmühlen die roten Kahlköpfe.
Nur einer der Holzfäller ist ernst geblieben:
»Es ist nicht gut, Ilja Fomitsch, wenn man zerstört, was anderen heilig ist, wirst sehen, daß es kein gutes Ende nimmt.«
»Ach,« lacht der Angeredete, »bist du so einer, der an heiligen Unsinn glaubt? Für dich gibt's wohl noch einen ›lieben Gott‹ du he, du Reaktionär!«
»Es mag ja sein, Towarisj, daß es bei euch in der Stadt keinen Gott mehr gibt …« »Werdet ihn wohl schon lange wegorganisiert haben, ihr …«
»Ach was aber, das ist unser Gott,« schreit der andere und schlägt auf sein Gewehr.
»Und das da« – er faßt den Preßluftbohrer an, »und der Geist des Fortschritts und …«
»Laß gut sein, Bruder. Du glaubst an die Maschine – sieh, die Gelben da drüben haben sie auch, aber sie haben noch einen unsichtbaren Gott, der darübersteht –. Und wenn es in unseren Augen auch nur ein scheußlicher Götze ist – aber vielleicht ist es der richtige Gott für dieses Land –. Und wie kannst du an die Maschine glauben, wenn wir sie doch selber gemacht haben?
Nein, Ilja Fomitsch, man muß noch einen andern Gott haben –.«
Ein paar andere Soldaten hören zu, beteiligen sich am Gespräch, – schon ist die schönste Diskussion im Gange.
Während in den ausgedehnten Feldstellungen rund um Urga alles für den bevorstehenden Angriff bereitgestellt wird, erfolgt unerwartet im Tal der Tola und gleichzeitig hart nördlich der Stadt ein tollkühner Handstreich feindlicher Luftgeschwader.
Im ersten Morgengrauen registrieren die großen Horchgeräte am Bogdo-Ola Motorengeräusch vieler Maschinen aus östlicher und südlicher Richtung. Mit Hilfe der Feineinstellung gelingt es ziemlich genau die Höhe und Geschwindigkeit der feindlichen Flugzeuge festzustellen. Bequeme Tabellen ermöglichen den Meßtrupps zu berechnen, in welcher Zeit die Staffeln in den Bereich der Abwehrgeschütze gelangen werden. Automatisch werden durch Radio die Meldungen an alle Dienststellen weitergegeben.
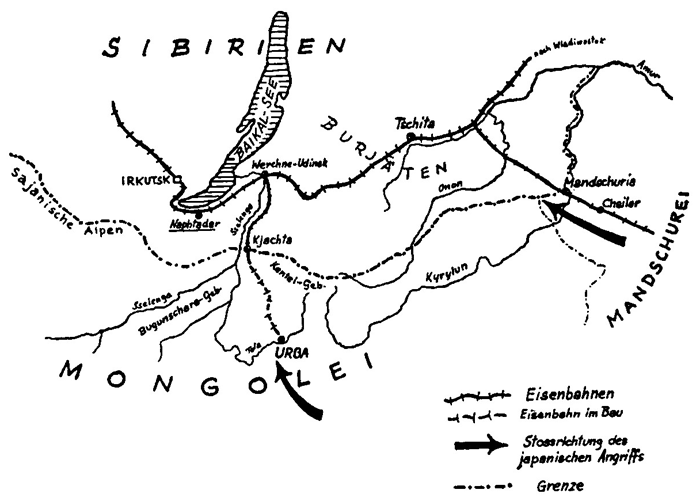
General Bars startet sofort mit den Jagdgeschwadern 5, 7, 8.
Trotz des dichten Hochnebels, der wie ein milchiger Brei über den Tälern und Steppen lagert und nun beginnt, auch die Berggipfel zu umschleiern. Sehr zum Ärger der dortliegenden Artilleriebeobachter, die nichts mehr sehen können. Die Armee verfügt noch nicht über »Nebelaugen«, Apparate, die auf dem Prinzip der Infrarot-Photographie aufgebaut sind. Vorläufig hat solche nur die Marine.
Im Augenblick sind die außerordentlich schnell steigenden Maschinen – an der Spitze der schneeweiße Einsitzer des Generals – im Nebel verschwunden. Das Geräusch ihrer Motoren ist für menschliche Ohren bald nicht mehr wahrnehmbar.
Die Geschwaderführer melden durch Radio: Über der Nebeldecke klare Sicht bis 6500 Meter, darüber Wolkenbänke, in denen sie die feindlichen Flugzeuge vermuten.
Vom Jagdgeschwader 5, das zuerst gestartet ist, kommen merkwürdigerweise keine Nachrichten mehr. Vergebens sendet die Flugplatzstation ihre Anrufe in den Raum.
Keine Antwort.
Und nun auf einmal wird auch die Verbindung mit den andern Geschwadern unterbrochen – noch ein paar abgerissene Worte kommen an, dann nichts mehr.
Jetzt werden eine Anzahl Fesselballons hochgelassen.
Aus ihren Meldungen und denen der Horchgeräte ist zu erkennen, daß die Maschinen in rund 7100 Meter in südöstlicher Richtung auf Teile des dort festgestellten Gegners gestoßen sind. Ein anderer Teil der feindlichen Maschinen hat sich vom Gros gelöst und nähert sich jetzt rasch der Stadt.
An den Geschützen der Flakbatterien am Bogdo-Ola und neben dem Flugplatz stehen fiebernd die Artilleristen.
Fast unerträglich ist die Spannung.
Obwohl sie nichts sehen können, wissen sie doch, daß der Feind jetzt gleich über ihnen sein wird.
Wenn sie schießen wollen, müssen sie blind schießen, das heißt ungezielt in einen Raum über dem Nebel, in dem die Flugzeuge erhorcht sind.
Von den Ballonbeobachtern kommt keine Nachricht, obwohl sie mit den Batterien telefonisch verbunden sind.
Entweder müssen die Ballons abgeschossen oder die Leitungen unterbrochen sein – Telefontrupps mit Motorrädern sind bereits unterwegs, um eine eventuelle Störung in der Leitung zu flicken. Aber bis die Leute in dem gebirgigen Gelände an Ort und Stelle sind, wird es zu spät sein. Dann sind die Flieger längst da.
Endlich kommen die erlösenden Kommandos, kurz und klar:
»Sperre 7200 minus …«
Zahlen und Buchstaben schwirren in den Kopfhörern der Geschützbedienungen, und schon donnern die Kanonen, und aus den langen Doppelrohren fauchen die Geschosse in den Nebel.
Mit kurzen Zwischenräumen feuern die Batterien Brand- und Sprenggranaten, die in einer Höhe von 7200 bis 6800 einen dichten Feuerraum legen, der die feindlichen Flugzeuge zu Richtungs- und Höhenänderung zwingen soll.
Ein genaues Zielen ist immer noch nicht möglich, da die Verbindung zu den Ballonbeobachtern noch immer nicht wieder hergestellt ist. Und die inzwischen aufgelassenen kleinen Ersatzballons auf dem Bogdo-Ola, kommen nicht hoch genug, um die Hochnebeldecke zu durchstoßen. –
In jeder Feuerpause neue Messungen der Horchgeräte (die einzig übrig gebliebenen Instrumente, mit denen man den Feind »beobachten« kann) und neue Kommandos.
Unerbittlich folgt die Feuerwand dort in der Höhe dem unsichtbaren Gegner. Schweißtriefend arbeiten die Leute an den Geschützen.
Granate auf Granate fliegt aus den heißen Rohren –.
Doch niemand hier unten erfährt zunächst mit welchem Erfolg.
Plötzlich wird das Feuer eingestellt.
Eine nervenzerrende Stille entsteht.
Jetzt sind wohl die eigenen Geschwader so nah, daß nicht mehr geschossen werden darf, will man nicht die eigenen Maschinen gefährden.
Noch ist nichts zu sehen, noch liegt unverrückt die Nebeldecke und verhüllt das Drama, das sich da oben jetzt abspielt.
Die Ballonbeobachter sind ausgefallen.
Und die Horchgeräte können nicht sehen.
Minuten vergehen, ohne daß die Russen erkennen, was sich jetzt vorbereitet.
Dieser verfluchte Nebel!
Wie blinde Maulwürfe liegen die Soldaten da, unfähig sich gegen einen Feind wehren zu können, den man doch ganz in der Nähe weiß, der jetzt angreifen wird … aber woher, wie? …
Keinerlei Meldungen kommen aus den Höhen jenseits des Nebels. Bleischwer liegt die Luft im Tal.
Totenstille ringsum.
Da – – auf einmal, von Osten her, zerreißt rasendes Donnern und Knattern die unerträgliche Stille, zwanzig, vierzig, fünfzig Maschinen haben in steilem Sturzflug den Nebel durchstoßen und rasen jetzt mit aufbrüllenden Motoren dicht über den Boden hin!
Tausendschüssige, doppelläufige Maschinengewehre, vier oder sechs auf jeder Maschine, überschütten das ganze Gelände um den Flugplatz mit dem alles niedermähenden Hagel ihrer Stahlgeschosse.
Ganze Serien von Bomben wühlen sich krachend in den Grund.
In breiter Front, dicht nebeneinanderfliegend, in zwei Linien übereinander gestaffelt, wobei die oberen Maschinen über der Lücke zwischen den unteren stehen, fauchen sie als todspeiende Wolke daher, ein blitzesprühender Gewitterorkan, der alles niedermäht, was im Weg steht.
Von diesem plötzlichen Überfall vollkommen überrascht und überrannt erliegen schon beim ersten Angriff Hunderte der Russen, ohne daß sie auch nur das Geringste zu ihrer Verteidigung hätten unternehmen können.
Der furchtbare Kamm der Geschoßgarben durchpflügt fast lückenlos den Boden, rast über die Hallen, Batteriestellungen und Unterstände, zerfetzt, zersplittert im Nu die freistehenden Meßgeräte, legt Mannschaften reihenweise um, zersiebt die nur gegen Sicht schützenden Deckungen der Bereitschaftsmunition, der Nebelapparate, vernichtet beim ersten Anlauf sofort die gesamte Bedienungsmannschaft der Flakgruppen 1 und 2, vernichtet die meisten Maschinen des Bombengeschwaders, die frei auf dem Platz standen, vernichtet restlos den Pferdebestand zweier Eskadronen, die nicht rechtzeitig genug ihre Tiere in die Deckungen hatten ziehen können.
Nach wenigen Sekunden gleicht das ganze betroffene Gelände einem Leichen- und Trümmerfeld.
Schreie der Verwundeten gellen über den Platz, Detonationen von Kartusch- und Munitionsstapeln mischen sich in das Brüllen der Motoren und das Krachen der Bomben des angreifenden Geschwaders, das jetzt in steiler, exakt ausgeführter Kurve wendet, um erneut anzugreifen.
In diesem Moment, wie von Geisterhand emporgehoben, wallen die Nebel auseinander – – und aus dem aufreißenden Himmel stürzt beinahe senkrecht das russische Jagdgeschwader herab.
Wirft sich maschinengewehrhämmernd auf den Feind!
Zu spät, um zu verhindern, daß die Japaner jetzt ihre schlanken Gastorpedos losmachen, die mit dumpfem Knall bei den Batterien und Unterständen, bei den Hallen und Lagern aufschlagen, um nun ihren giftigen Atem rundum zu verbreiten – – aber zeitig genug, um noch Rache zu nehmen für den heimtückischen Überfall.
Ehe die japanischen Jagdmaschinen des mit andern Russen in der Höhe noch kämpfenden Geschwaders herab sind, müssen viele ihrer Kameraden, die den Angriff geflogen haben, zu Boden.
Brandwolken, Explosionen und unentwirrbare Trümmerhaufen zeigen die Stellen an, wo ein Gegner in die Erde rannte.
Nun sind auch einzelne Batterien wieder schußbereit. Ohne Befehl, aber den Feind dicht vor Augen, feuern die Kanoniere Schuß auf Schuß in die steil wegziehenden, von einigen Staffeln hart bedrängten Maschinen, die von einer glänzend gelegten Brandgranatensperre der auf dem Bogdo-Ola stehenden Flakbatterien plötzlich empfangen werden.
Brennend werden die großen Maschinen heruntergeholt.
Daß auch einige russische Jagdflugzeuge dabei in den feurigen Regen geraten, ist nicht zu vermeiden.
Zu dicht sind Freund und Feind ineinander verwickelt.
In geschicktester Abwehrtaktik entziehen sich jetzt die japanischen Jagdgeschwader ihren Feinden.
Bald sind sie in großen Höhen entschwunden.
Mit ihnen verschwindet auch der russische Fliegerführer, Bars der Panther. Mit einer Staffel ausgesuchter Kampfflieger. Er läßt nicht locker; solange er noch einen Tropfen Benzin und einen Streifen Munition hat, bleibt er dem Feind auf den Fersen. Koste es was es wolle!
Auf die Anrufe von der Erde aus hört er längst nicht mehr. Die ganze Radioapparatur hat er über Bord geworfen. Er braucht dieses Gängelband nicht mehr, auch seine Leute nicht, die um ihn sind, die fühlen, was ihr Führer vorhat und brauchen keine Befehle. Auch sie haben die Maschine des japanischen Geschwaderführers erkannt, dem ihr General jetzt nachjagt.
Doch heute kommt es nicht mehr zu dem ersehnten Zweikampf.
Die Japaner ziehen in solch enorme Höhen hinauf, in denen kein Kampf mehr möglich ist.
Eine weitere Verfolgung ist zwecklos.
Ergrimmt wendet der Panther und kehrt nach Urga zurück.
*
Während der Kämpfe um den Flugplatz bei Urga, die den Russen fast unersetzliche Verluste, aber doch das Gefühl eines, wenn auch zu teuer erkauften Sieges brachten, spielen sich im Tale der Tola Ereignisse ab, die von einschneidender Bedeutung sein werden.
Unter Ausnützung der Hochnebeldecke, die auch die höheren Berggipfel mit verhüllt, und damit rechnend, daß der Angriff auf den Flugplatz die Aufmerksamkeit der Russen von dem zweiten gleichzeitigen Unternehmen ablenken würde, wendet sich ein aus Jagdstaffeln, Bombenflugzeugen und einer ganzen Meute von Tankträgern gebildetes Geschwader dem Tal der Tola zu.
Da diese Tankträger – es sind windmühlenartige Maschinen, die fünf bis zehn Tonnen große, mit drei bis fünf Leuten bemannte Tanks tragen, – langsamer sind als die andern Maschinen, zudem nur verhältnismäßig geringe Höhen erreichen können, werden sie von den Jagdstaffeln ständig umkreist, die sie ringsum schützend umgeben.
Dort im Tal der Tola, da wo der Fluß eine scharfe Biegung nach Norden macht, liegt der am weitesten vorgeschobene Posten des Verteidigungsgürtels um Urga. Er wird von einem Regiment Infanterie, einigen Schwadronen Kavallerie, motorisierten leichten Batterien und schnellen Panzerwagen gebildet. Eine Aufklärungsstaffel ist ihnen beigegeben.
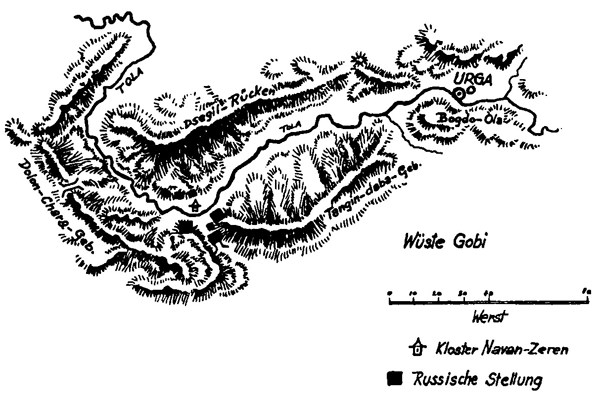
Obwohl in ständiger drahtloser Telefonverbindung mit dem Generalkommando in Urga und mit dem nächsten Talquerriegel verbunden, ist dieser Posten in dem einsamen kahlen Gebirge, ständig durch tollkühne Angriffe kleinerer Abteilungen der mongolischen Armee in Atem gehalten, eine außerordentlich exponierte Stellung.
Das wissen die Japaner genau.
Von mongolischen Agenten dauernd vorzüglich über die russischen Anlagen, ihre Stärke und Bewaffnung unterrichtet, haben sie für ihre heutige Unternehmung diese empfindliche Stelle ausgesucht.
Sie wissen, daß hier nur kleinere Horchgeräte stehen, die durch entsprechende Gegenmaßnahmen wertlos gemacht werden können. Sie wissen, daß der Posten über keine Fesselballons verfügt.
Die großen Kampfmaschinen, die erste Welle des Geschwaders, fliegen sehr hoch. Genaue Peilungen – nach einem Verfahren, das unabhängig von Bodensicht, ähnlich etwa dem Echolot früherer Zeiten, durch eine Art Abtasten des Erdbodens ein Heranfühlen an das Ziel möglich macht – führen das Geschwader sicher über seinen Bestimmungsort. Dort angekommen werden sich die Maschinen mit gedrosselten Motoren fast lautlos auf ihre Beute niedersenken können, um überraschend anzugreifen.
Um die Radioverbindung mit Urga unwirksam zu machen, trägt einer der großen Bomber eine Störungsstation, die imstande ist, den Funkverkehr der russischen Truppen ganz empfindlich zu stören. Eine solche Station war es auch, die bei Urga das unverständliche Abbrechen der Meldungen verursacht hatte.
Einen langen Zug ausgebreiteter Wolkenschichten geschickt als Deckung benutzend, löst sich dieses Geschwader unbemerkt von dem bei Urga operierenden und nähert sich jetzt seinem Ziel.
Gleichzeitig kommen über die menschenleere Gobi hinweg die von Jagdstaffeln begleiteten Tankträger.
Bei dem russischen vorgeschobenen Posten liegen zwei Schwadronen alarmbereit in guter Deckung in einer Felsschlucht. Darüber, unterhalb eines flachen Bergsattels stehen die Motorbatterien und einige Flakgeschütze. Rechts und links den Kamm hinauf sind schwere Maschinengewehrnester verteilt und Flammenwerfer untergebracht. In den Boden eingegrabene, mit Felstrümmern gedeckte Unterstände sind überall angelegt.
Am unteren Ende der Felsschlucht, noch etwas über dem Tal, stehen andere Batterien, die weites Schußfeld sowohl talabwärts, dem nach Norden abbiegenden Strom entlang, als auch talaufwärts haben. Weiter zurück, im Tal selbst, liegen zwei weitere Schwadronen mit Geschützen, Maschinengewehren und leichten Panzerwagen.
Auf der andern Seite des Flusses, in einer flachen Senke stehen gut getarnte weitere Tanks, die Aufklärungsstaffel und die motorisierte fünfte Schwadron.
Das 36. Infanterieregiment mit Motorbegleitbatterien ist seit vorgestern zu einem Unternehmen in Richtung auf Burun unterwegs. Die Rückkehr wird erst in den nächsten Tagen erwartet.
Die Radiomeldungen über die Annäherung eines großen feindlichen Geschwaders gegen Urga werden auch hier gehört. Doch fühlt sich der Kommandant des Postens nicht unmittelbar bedroht.
Er unterläßt einen allgemeinen Alarm.
Nur die Aufklärungsstaffel wird startbereit gehalten, und die Schwadronen, die noch Pferde haben, werden in künstliche Deckungen gegen Sicht gezogen.
Aus dem in der Nähe liegenden großen lamaistischen Kloster Navan-Zeren, das bei einem der früheren Kämpfe zerstört wurde und ausgebrannt ist, hat man alles Holz und sonstiges Brauchbare, wie Teppiche und Stoffe, herausgeholt und damit unter anderem auch diese Deckungen gebaut. Hier gibt es ringsum kein Holz – die Gegend ist völlig kahl – da waren die Reste von Brettern und Balken hoch willkommen.
Halb belustigt und halb beunruhigt von der Meldung einer Kavalleriepatrouille, die heute nacht von einem Paß des im Westen vorgelagerten Dolon-Chara-Gebirges aus einen breiten Feuerschein aus der Steppe gesehen haben will, in dem sie silhouettenhaft gegen den erhellten Horizont sich bewegende riesige Reiterhorden zu erkennen geglaubt habe, streckt sich der Kommandant wieder auf das Lager seines Unterstandes aus, der mit Teppichen, Fahnen und Kissen aus dem Kloster phantastisch ausgeschmückt und wohnlich gemacht ist.
Er verträgt die Höhenluft nicht. Man ist hier in 1800 Meter Meereshöhe – die Berge ringsum gehen hoch über 2000 hinauf – raucht eine Zigarette nach der andern und verflucht das Schicksal, das ihn auf diesen verdammten Posten in dieser noch verdammteren Gegend gestellt hat.
Daß ihn noch etwas anderes drückt, will er sich selbst nicht eingestehen. In der vergangenen Nacht ist das ganze Benzindepot, das in einer Art Höhle untergebracht war, ausgelaufen.
Kein Mensch weiß, wer die schweren eisernen Fässer hat anbohren können. Jedes Faß weist ein fingerdickes Loch auf, das zweifellos von einem Bohrer stammt. Die Posten wollen niemand gesehen haben.
Der Fall ist völlig rätselhaft.
»Nitschewo,« morgen läßt man neues Benzin kommen, in Urga liegen ja große Mengen. In eineinhalb Tagen kann es hier sein.
So beruhigt sich der Kommandant.
Jetzt aber fällt ihm die Unterlassungssünde ein, nicht sofort für Ersatz gesorgt zu haben.
Dunkel ahnt er, daß die Tankführer ihre Behälter nicht ordentlich aufgefüllt haben könnten, ja, daß manche sogar wohl nur die paar Reserveliter in ihren Maschinen haben.
Wenn er die Wagen einsetzen soll – und sie blieben nach einer halben Stunde einfach stehen?!
Erregt springt der Kommandant auf, eilt zu seinem Gefechtsstand, um sich Meldungen über die vorhandenen Betriebsstoffmengen geben zu lassen. Der Funker am Antennenwagen tritt ihm völlig verstört entgegen:
»Genosse Kommandir, eine unerklärliche Störung, seit fünfzehn Minuten bekommen wir keinerlei Verbindungen mehr! Unsere Anlage ist vollkommen in Ordnung, ich habe alles genau durchgesehen …«
Der Kommandant zischt einen meterlangen Fluch durch die Zähne. Ihm wird auf einmal schwarz vor den Augen. Ist das die Höhenkrankheit oder der dreimal verfluchte Nebel oder das ekelhaft aufdringliche Gefühl, daß hier etwas nicht stimmt, sogar ganz erheblich nicht stimmt? –
Ein leises Surren, von dem man anfangs noch gar nicht weiß, woher es eigentlich kommt, dann ein hohles Fauchen und Rauschen – dann mit einemmal ein donnerndes Aufbrausen in der Luft zieht aller Augen magnetisch nach der Nebeldecke hinauf.
Wie gebannt starrt der Kommandant, starren die Leute um ihn herum auf die dunklen huschenden Schatten, die sich jetzt aus den milchigen Schwaden herauslösen und sich nun aufbrüllend als große fünfmotorige japanische Flugzeuge herausstellen!
Drüben, auf der andern Seite des Flusses, vielleicht acht Werst vom Kommandostand entfernt, sind die Maschinen durch den Nebel gestoßen. Im Nu sind sie orientiert und auch schon formiert und greifen mit Maschinengewehren, Sprengbomben und Gastorpedos an.
Ihr erstes Opfer ist die Aufklärungsstaffel. Die Flieger wissen sofort, was das leise Surren zu bedeuten hat; mit einem Satz sind die Piloten in den Maschinen, werfen die Motoren an – doch noch im Anrollen werden sie vom Feuersturm erfaßt und vernichtet.
Über ihre Trümmer hinweg, das Tal querend, kommen nun die Japaner geschlossen auf die Stellungen am Südufer zu. In das Donnern der Motoren mischt sich das rasende Knattern ihrer Maschinengewehre, das harte Krachen der ersten Bomben.
Alles zerfetzend, rast die breite Fläche der Geschoßbahnen heran, fährt in die nun nutzlosen Deckungen der Pferde, übersprüht die Batterien, erreicht auch die Schlucht und den Kommandostand; spritzend und klatschend mit zwitschernden Querschlägern fahren die Geschosse in den Boden, in die Fahrzeuge und in die Menschenleiber. Ganze Serien von Bomben, untermischt mit Gastorpedos erfüllen die Schlucht mit zerreißendem Krachen. Den Hang hinauf, von dem ein rasendes Schnellfeuer der tapferen Kanoniere da oben die Maschinen empfängt, jagt der Todeshagel. Mit unheimlicher Präzision finden die Japaner ihr Ziel; kaum eine Batterie, kaum ein Maschinengewehrnest, kaum ein Unterstand entgeht diesem blitzschnellen Angriff.
Aber auch die Batterien haben nicht umsonst geschossen, fünf der furchtbaren Vögel müssen herunter, krachend und im Nu in Brandfackeln verwandelt, schlagen sie zwischen ihren Opfern auf.
Die Geschütze der Tanks und der motorisierten Schwadronen auf dem anderen Flußufer – vom ersten Angriff der Japaner nur eben gestreift – feuern, was aus den Rohren geht.
Ihnen gilt jetzt der zweite Angriff. Unbekümmert um den Eisenhagel, der ihnen vernichtend entgegenschlägt, schleudern die großen Maschinen Bombe auf Bombe, jagen schmetternd ihre Geschoßgarben hinunter. Was tut es, daß noch einige von ihnen flammend niederstürzen, ihre Aufgabe ist erfüllt, die Kampfkraft des Gegners gelähmt, wenn nicht gebrochen.
Ihnen folgen die Tankträgerstaffeln, die ihre gepanzerte Last weiter zurück in der Talebene niedersetzen.
Inzwischen haben sich auch hier die Nebel gehoben und den Verteidigern den ganzen Ernst ihrer Lage enthüllt. Wenn diese geglaubt hatten, es nur mit einem Bombenangriff zu tun zu haben, so erkennen sie jetzt, daß das Schwerste noch bevorsteht. Denn über ihnen in der klaren Luft schwirren flinke Jagdstaffeln und senken sich die unheimlichen Tankträger herab. Wo sich noch Widerstand regt – es sind hauptsächlich die Schnellfeuergeschütze der Kavallerie und die Maschinengewehre auf dem Paß, die unentwegt feuern – wird er von den immer wieder niederstoßenden Jagdstaffeln unterdrückt. Prasselnd fahren die dichten Geschoßgarben in die Geschützstände und Bedienungen. Wer nicht fällt oder verwundet wird, birgt sich hinter Felsbrocken oder in den Deckungen.
Da nur ein kleiner Teil der Panzerwagen auf einen erfolgreichen Kampf mit Flugzeugen eingerichtet ist, und da für die anderen Geschütze bei dem blitzartig wechselnden Ziel ein wirkungsvolles Schießen nicht möglich ist, gelingt es den Jagdstaffeln, das Abwehrfeuer der Verteidiger so stark zu vermindern, daß die Tankträger einigermaßen ungestört zu Boden kommen können. Sie setzen in vorbildlichem Manöver zuerst die schnellsten Wagen ab, die sofort in weit auseinandergezogener Keilform auffahren, dessen Spitze gegen die Stellungen der Russen gerichtet ist.
Drei werden noch in der Luft getroffen. Wie große graugrüne Steine fallen sie senkrecht in das Tal und explodieren mit unheimlichem Krachen. In dicken Wolken quillt schwarzer Qualm aus den geborstenen Panzern. Weiter zurück, das Tal aufwärts, landen die größeren Tanks. Von ihrer Last befreit heben sich die Träger – Windmühlenflugzeuge – schnell empor und verschwinden, von den großen Bombenmaschinen und einem Teil der Jagdstaffeln in die Mitte genommen nach Süden. Und jetzt beginnt der Endkampf, das endgültige Niederringen des Gegners. Nachdem die blitzschnellen feuerspeienden Vögel, gegen die man hier im freien, fast deckungslosen Gelände beinahe wehrlos ist, von ihren Opfern abgelassen haben, zeigt es sich, daß doch noch nicht alles Leben und alle Kampfkraft erstorben ist. Wohl sind die Schwadronen in der Talschlucht durch das Gas vollständig vernichtet. In Haufen übereinander liegen die verendeten Pferde, weit hängt den armen Tieren die Zunge zum schaumbedeckten Maul heraus, von ihren aufgedunsenen Leibern starren steif die Beine empor. Dazwischen und in den Unterständen liegen und hocken, teilweise entsetzlich verkrümmt die Mannschaften. Viele ohne Gasmasken, von den Bomben zerrissen, von den Maschinengewehren niedergemäht oder von dem schnellwirkenden Gas betäubt, bevor sie die Masken anlegen konnten. In grünlich-weißen Schwaden wabert das Gas gespenstisch auf und ab.
Hier herrscht nur noch der Tod.
Weiter oben in den Batteriestellungen war die Wirkung der Maschinengewehre und der Sprengbomben stärker als die der Gastorpedos. Drei Batterien sind restlos erledigt. Wie sie gerade an den Geschützen standen, sind die Bedienungen gefallen. Am Eingang eines Munitionsstollens lehnt ein Soldat wie ein Steinbild aufrecht stehend, eine Granate im Arm. Irgendein vorspringender Stein hat sein Zusammensinken aufgefangen. So steht er nun da mit der nutzlosen Granate im Arm und starrt mit weitaufgerissenen Augen in die Ferne. Andere Batterien sind bis auf wenige Mann dezimiert. Verwundete hat es nur sehr wenige gegeben. Wo die massierten Geschoßgarben trafen, die hochbrisanten Bomben krepierten, haben sie ganze Arbeit gemacht.
Die Kampfkraft der auf dem flachen Sattel liegenden Truppen ist noch am besten erhalten. Doch die Flammenwerfer sind, soweit sie nicht in den Deckungen waren, zerstört, schwarz qualmende glühende Eisenreste sind alles, was übrig blieb. Das Gas hat nur wenig gewirkt hier oben. Der Wind trug wohl die giftigen Schwaden hinab, bevor sie ihre würgende Bestimmung erfüllen konnten.
Von den Batterien unten dicht über dem Tal, sind nur noch fünf Geschütze verwendungsfähig. Hier haben die Sprengbomben verheerend gewütet. In viele Geschützstände sind sie unmittelbar eingeschlagen, haben die Bedienungen zerrissen, die Kanonen umgeworfen und die Munition entzündet. Der tapfere und umsichtige Adjutant des Artillerieführers, obwohl selbst verwundet, übernimmt an Stelle seines gefallenen Kommandeurs das Kommando über die übrig gebliebenen Batterien. Er stellt aus den Resten der Mannschaft Bedienungen für die noch erhaltenen Geschütze zusammen, läßt Munition herbeitragen und beginnt die im Tal gelandeten Tanks unter Feuer zu nehmen.
Der Hauptkommandostand, die Radioanlage, die Horchapparate und alles, was hier zusammenlag, ist erledigt. Der Kommandant ist gefallen. Lang ausgestreckt liegt er inmitten der Trümmer und Toten. Diese Zentralbefehlstelle befindet sich an einer nach drei Seiten abfallenden vorspringenden Nase eines vom Paß herunterstreichenden schmalen Höhenrückens. Stollenähnliche Unterstände, deren Eingänge auf der Talseite liegen, beherbergen die empfindlichen Apparate der Radioanlage, die unvermeidliche Schreibstube, das Quartier des Kommandanten, Artilleriebeobachtungsstellen, die Entgasungstrupps mit ihren Geräten und anderes mehr. Im Freien, auf einer Art Kanzel, die von aufgehäuften Steinen wie von einem mittelalterlichen Burgwall umgeben ist, hat sich der Kommandant eine Befehlsstelle eingerichtet, von der aus er das Tal und die umliegenden Höhen weit übersehen kann. Hier stehen auch die Horchgeräte. Ein Stollen, der von hier zu den Unterständen führt, ist im Bau und zur Zeit des Angriffs noch nicht verwendbar.
Von der Anlage und den Eigentümlichkeiten dieses Kommandostandes müssen die Japaner genaue Kenntnis gehabt haben. Während die Bombengeschwader die russischen Stellungen unter ihr vernichtendes Feuer nahmen, wählte sich eine Sonderstaffel den Kommandostand zum alleinigen Ziel. Durch ihre Taktik, im steilen Herabstoßen die Bomben zu schleudern, gelang es ihnen, in die Eingänge der Stollen und Unterstände zu treffen. Je ein Gastorpedo genügt, die Belegschaft solcher unterirdischer Räume außer Gefecht zu setzen. Wer nicht durch die Sprengwirkung der Bomben oder durch die einstürzenden Wände der Stollen getötet oder verwundet wird, der erliegt in kurzer Zeit dem konzentrierten Gas, gegen das auf die Dauer keine Maske schützt. Einer einheitlichen Führung beraubt, ist der Widerstand der Überlebenden trotz aller Tapferkeit einzelner nur ein verzweifeltes Sichwehren gegen einen Feind, den man gerade vor sich hat. Wobei wertvolle Kräfte unnötig verzettelt werden, und in der Verteidigung Lücken entstehen, die verhängnisvoll werden.
Was von der Kavallerie übrig geblieben ist, verteidigt mit Gewehr und Maschinengewehr, mit kleinen Tankgeschützen und Handgranaten die vorbereiteten Stellungen an den Berghängen. Die schnellen Tanks auf dem Südufer des Flusses, dem Kernpunkt des Postens, sind bis auf einige durch Bomben beschädigte Wagen voll verwendungsfähig. Doch sind es zu wenig, um den Japanern ernstlich gefährlich werden zu können. Zudem verfügen sie nur über eine kleinkalibrige Bestückung.
Von diesem eigentlichen Kampfgebiet getrennt, stehen auf der andern Seite des Tals die Reste der motorisierten Schwadronen mit ihren kleinen Zwei-Mann-Tanks und den Geschützwagen. Der Fluß ist hier fünfzig Meter breit, nicht tief, aber reißend und voller Felstrümmer. Der von den Russen gebaute Steg ist für die schweren Wagen nicht benützbar. Ein Eingreifen in den Kampf am Südufer wird ohne großen Erfolg sein, da eigentlich nur die wenigen Geschützwagen dafür in Frage kommen. Das Maschinengewehrfeuer der kleinen Tanks über den Fluß und die Breite des Tals hinüber wird gegen die japanischen Tanks ohne Wirkung sein.
Die Japaner haben ihre beiden Tankformationen geordnet und rücken weit auseinandergezogen heran. Mit einer kleinen, in der Höhe zurückgebliebenen Flugzeugstaffel des abgezogenen Angriffsgeschwaders stehen sie in Verbindung. Von diesen Beobachtern über die Bewegungen der Russen unterrichtet, stoßen sie vor. Von den überall im Tal herumliegenden Felstrümmern und großen Steinen sind sie kaum zu unterscheiden. Da der Wind von Westen her steht, sind sie auch nicht zu hören. In den Bodenwellen immer wieder für Augenblicke verschwindend, in Zickzackkursen fahrend, nähern sie sich schnell, ohne durch die zwischen ihnen aufschlagenden russischen Granaten ernstlich behindert zu werden. Sie selbst feuern noch nicht.
Der Führer der russischen Tanks hat den Deckel des oberen Mannlochs aufgeklappt, mit halbem Leib aus dem Wagen herausragend, beobachtet er kaltblütig den lautlos ankommenden Feind.
Er hat seine wenigen Wagen hinter Bodenwellen, Felsstücken und Einschnitten so im Gelände verteilt, daß sie von den Japanern nicht gesehen werden können. Nur der Führerwagen steht frei mit weiter Rundsicht da.
Der kleine schlanke Offizier, ein »Ehemaliger«, das heißt aus baltischer Adelsfamilie stammend, meint trocken zu dem unter ihm hockenden Mann am Geschütz:
»Wie wenn Ratten herumlaufen, sieht das aus – sind ja auch Ratten dort, die Gelben, nur daß sie keine Schwänze haben.« – Und dann, nach einer Pause:
»Verdammt miserabel schießen unsere Geschütze da oben. Keinen mehr haben sie getroffen! – Entfernung?«
»Achtundzwanzighundert,« kommt es dumpf aus dem Innern.
»Wenn sie doch nur ein paar von den großen Kasten da hinten kleinkriegen wollten!«
Nun sind die Angreifer wieder hinter einer Geländewelle verschwunden, aus der sie merkwürdigerweise nicht wieder auftauchen.
Wie vom Erdboden verschluckt sind alle Wagen.
Erstaunt und beunruhigt sucht der Offizier mit dem Glas das Tal ab. Die russischen Granateinschläge ziehen sich jetzt nach rechts hinüber. Hinter einem Höhenrücken, der vom Gebirge herunterzieht, steigen die Wolken auf. »Aha, die Kerle wollen uns überklettern!«
Um sich Gewißheit zu verschaffen, läßt er seinen Wagen anlaufen und fährt einige hundert Meter nach rechts den Hang hinauf. Von hier aus ist das Tal bester einzusehen. – Die Tanks sind weg!
Da er keine Radioverbindung mit den Batterien bekommt, läßt er mit der Blinklampe anfragen, ob man dort die Bewegungen des Gegners beobachten könne.
Die Batterien feuern noch, also müssen sie doch ein Ziel haben.
Nervös trommelt er mit den Fingern auf den Stahlpanzer:
»Herrgott, schlafen denn die Kerle da oben?«
Der Blinkanruf bleibt ohne Antwort.
»Verdammte Schweinerei!«
Kurz entschlossen beordert er seine Wagen herauf.
In einer Reihe hintereinander zieht er die Tanks hinter den Batterien herum höher hinauf. Während die Wagen mit hohem, singendem Ton ihrer Motoren über das Geröll, trockene Bachrinnen, Felsbrocken und sandige Stellen herum mühelos emporklettern, bricht plötzlich vorn und auf dem Sattel ein toller Feuerwirbel los. Hartes Krachen von Granaten, das dumpfe Hämmern von Tankabwehrkanonen, prasselndes Maschinengewehrfeuer bricht sich tausendfach an den Hängen und Schluchten der Berge.
Jetzt ist die Hölle losgelassen!
Die kleineren japanischen Panzerwagen stürzen sich feuersprühend auf die vordere Verteidigungslinie, während die großen mit den 10 cm-Kanonen die russischen Batterien unter Feuer halten. Unheimlich wendig, geschickt das Terrain ausnützend, wirklich wie Ratten hin- und herrennend, kommen sie in kurzen Stößen feuernd rasch näher. Ein Teil von ihnen, geführt von einem Wagen bisher unbekannter Art, hat die Höhe des Bergsattels gewonnen und greift die Stellungen der Maschinengewehre und Flammenwerfer an.
Endlich wird bei den russischen Batterien besser geschossen. Treffer hauen in das Getriebe zweier der großen Tanks, die jetzt lahmgelegt, mit ein paar weiteren Granaten erledigt werden. Auch da und dort werden kleine getroffen, mit hoher Stichflamme explodieren die Wagen.
Aber es nützt nicht viel, die dünne Linie der Kavallerie ist überrannt, von den Motorbatterien feuert nur noch ein Geschütz.
Auf der Höhe haben die Japaner den geringen Widerstand fast ohne eigene Verluste gebrochen. Ein Wagen ist im Strahl eines Flammenwerfers in die Luft geflogen, ein anderer über eine Felskante abgestürzt.
Der Kampflärm dort oben ist verstummt!
Nun wenden die Tanks und bedrohen die Russen in der Flanke und von rückwärts.
Der Führer der russischen Kampfwagen übersieht mit einem Blick die Lage. Sie ist hoffnungslos.
Von zwei Seiten angegriffen, ohne stärkere Bestückung, ohne Artillerieunterstützung sieht er sich einem weit überlegenen Feind gegenüber, der ihn in kurzer Zeit überrannt haben wird. Seine Wagen, weit auseinandergezogen, feuern wohl wie die Teufel, aber der Erfolg ist gering. Von Treffern manövrierunfähig gemacht, sind drei schon erledigt. Andere melden Betriebsstoffmangel oder haben sich fast verschossen. Sein eigener Wagen hat nur noch einen geringen Vorrat Benzin.
Der Führer denkt nicht daran, sich hier einfach abschlachten zu lassen, sich zu ergeben noch weniger.
Schon sind die feindlichen Wagen so nahe heran, daß ein Ausweichmanöver nicht mehr möglich ist. Kurz entschlossen gibt er seine Befehle, seine letzten.
In Dreckwolken gehüllt, von Geschoß- und Gesteinssplittern überschüttet, umdröhnt von den Detonationen der Granaten laufen die Tanks an. Mit höchster Fahrt rast diese stählerne Kavallerie nach vorn.
Wie einst in früheren Kriegen die Kürassiere ihre todesmutigen Attacken ritten, so stürzen sich hier die Panzerwagen auf den gepanzerten Feind! Es sind nicht mehr Maschinen, ist nicht die Technik eines raffinierten Jahrhunderts, nicht von Gehirnen beherrschter Stahl, was da über die kahlen Berge eines fernen Asien braust – der uralte Kampfgeist der Helden, die Mann gegen Mann um die Entscheidung ringen, ist es selbst, der da dem übermächtigen Feind an die Gurgel springt!
In jedem der Tanks lebt dieser Geist – jeder sucht sich einen Gegner aus der grauen Meute heraus.
Die letzte Phase des ungleichen Kampfes hat begonnen.
Die Japaner stutzen zuerst, das hatten sie nicht erwartet; nun schieben sie die größeren Wagen vor, die andern ziehen sich dahinter zusammen. So soll ein Keil gebildet werden, an dem die anlaufenden Russen zerschellen müssen. Doch noch ehe dieses Manöver beendet ist, sind diese heran.
Der Wagen des Führers ist der erste, der mit seinem japanischen Gegner zusammenprallt.
Er hat ihn regelrecht gerammt!
Im selben Augenblick verhüllt eine riesige Explosionswolke beide Wagen. Der Russe hat sich und den Gegner gesprengt!
Von den vierzehn russischen Tanks vernichten dreizehn auf dieselbe Weise dreizehn japanische Tanks. Nur einer findet vorher allein sein Ende.
So fanden die letzten Verteidiger der Stellungen bei Navan-Zeren ihren ruhmvollen Untergang.
*
Die auf der andern Seite des Flusses liegenden Teile der Russen haben sich während der Kämpfe das Tal hinauf zurückgezogen. Die Japaner sind Herr der Lage.
Die erste Bresche in den Verteidigungsgürtel von Urga ist gelegt.
Am Nachmittag erscheinen auf den Pässen des Dolon-Chara-Gebirges, das im Westen das Tal abriegelt und den Fluß zu dem scharfen Abbiegen nach Norden zwingt, mongolische Reiter und Artillerie.
Wie ein Bild aus der Zeit Dschin-Gis-Chans kommen die Söhne des Landes auf ihren kleinen zottigen Pferden, die mit Menschenblut beschriebenen Fahnen schwingend, in dichten Haufen die Hänge herabgebraust. Trotz ihrer modernen Bewaffnung – kurze Karabiner, mächtige Maschinenpistolen und leichte Maschinengewehre – machen die Reiter in ihrer malerischen Kleidung nicht den Eindruck von regulären Soldaten. In kurzen Jacken, deren Ärmel weit über die Hände hinausreichen, über bunte seidene Gürtel Patronengurte und die Ledertaschen für die Pistolenmagazine geschnallt, den mit roten und gelben seidenen Tüchern geschmückten Karabiner mit der Mündung nach unten über dem Rücken, in langen weiten Röcken, mit halbhohen Stiefeln, deren Spitzen nach oben gebogen sind, die Fellmütze schief auf dem pechschwarzen, strähnigen Haar, jagen sie daher.
Die Geschütze kommen in demselben halsbrecherischen Tempo den Berg herunter. Im Nu wimmelt das Tal von farbenfreudigen, neugierigen Mongolen. Die zerschossenen und explodierten Tanks, die russischen Stellungen und die großen japanischen Panzerwagen, die toten Pferde und Soldaten, alles wird unter lautem Geschnatter besichtigt. Die neben den gutgewachsenen Mongolen besonders klein wirkenden japanischen Soldaten lassen sich nicht im geringsten in ihrer Arbeit stören. Still und flink räumen sie die Gefallenen weg und bringen die Verwundeten mit Hilfe der wenigen noch gänzlich verstörten Gefangenen zu dem Verbandplatz, auf dem ein japanischer Arzt mit seinem russischen Kollegen, der mit einem Teil seines Personals der allgemeinen Vernichtung entgangen ist, alle Hände voll zu tun hat. Entgasungstrupps arbeiten in der Schlucht und in den Unterständen. Da, wo im freien Gelände noch Gasschwaden liegen – manche Talsenken sind noch weithin davon erfüllt – sind vorerst durch rote Flaggen die Gefahrzonen abgesteckt.
Die Offiziere stehen über Karten gebeugt auf der Kanzel des Kommandostandes, den sie nun für sich einrichten lassen. Niemand kümmert sich zunächst um die Bundesgenossen, die ängstlich die noch gasverdächtigen Niederungen vermeidend, sich jetzt an den Hängen lagern, wo sie ihre Pferde im spärlichen Gras weiden lassen.
Der Himmel hat sich bezogen, tiefhängende Wolkenzüge jagen über die Pässe, gleiten das Tal hinauf. Es sieht nach Regen aus.
Gegen Abend tauchen auf dem Paß im Westen die Silhouetten schaukelnder Kamelkarawanen auf; der Troß der mongolischen Truppen.
In langen Reihen, ein Tier hinter dem andern, die Doppelhöcker hoch bepackt, schwanken die zottigen Kamele, von Reitern umschwärmt, von den Führern am Halfter geleitet, glockenklingelnd hinunter ins Tal. An der Spitze, auf einem prachtvollen Rappen, in farbenprächtige Seide gekleidet, den Zobelhut mit der goldenen Spitze auf dem Kopf, die Pistole an einer goldenen Schnur um den Hals, reitet ein Chan, rechts und links von zwei bis an die Zähne bewaffneten jungen Fürsten begleitet. Ihnen folgen hohe buddhistische Würdenträger und eine kleine Eskorte bewaffneter Reiter.
Ein seltsamer Gegensatz.
Hier das alte malerische, ewige Asien – dort die internationale Technik des 20. Jahrhunderts.
Im Schutze der Nacht, auf Spezialschnellastwagen aus den Weiten der Gobi herangebracht, rücken japanische Infanterieregimenter mit schwerer Artillerie heran. Während ein stiebender Regen über Tal und Berge fegt, rumpeln wie vorsintflutliche Ungeheuer mit glotzenden Scheinwerferaugen die Wagen über den flachen Paß und entladen Kompanie um Kompanie, Geschütz um Geschütz.
Geräuschlos verschwinden die Regimenter im Dunkel.
Pioniere gehen daran, eine starke Brücke über die Tola zu bauen. Das eiskalte Wasser nicht achtend, stehen die Leute bis zur Brust im reißenden Fluß. Wenn einer hinweggespült wird, tritt mit ruhiger Selbstverständlichkeit ein anderer an seine Stelle.
Schon stehen, in den Grund gerammt oder an Felsblöcken verankert, die niedrigen Pfeiler, schon werden die vorbereiteten Träger hinübergeschoben. In wenigen Stunden wird die Arbeit beendet sein.
Ein ununterbrochener Strom von Munitions-, Lebensmittel- und Materialkolonnen ergießt sich über die Pässe in das Tal.
Um Navan-Zeren bildet sich in dieser Nacht eine bewegliche Festung, die Urga von Westen her aufs schwerste bedroht.
Durch die Störung der Radioverbindung (ein Drahttelefon besteht nicht) wird der ungleiche Kampf im Tal der Tola erst in den späten Abendstunden im Hauptquartier bekannt. Die Nachricht löst allgemeine Bestürzung aus. Es werden sofort Vorbereitungen zu einem Gegenstoß getroffen und Maßnahmen eingeleitet, die eine Wiederholung derartiger Fälle ausschließen sollen. Dem Chef des Nachrichtenwesens wird vom General in nicht mißzuverstehender Weise nahegelegt, seinen Posten mit dem eines Schusters zu vertauschen, für welchen Beruf er sich vielleicht besser eigne.
Im Generalkommando herrscht Gewitterstimmung.
Bars ist rasend vor Wut. Sein japanischer Gegner ist ihm heute morgen entkommen; für die Vernichtung des Postens bei Navan-Zeren durch den unerhörten Überfall des Tankträgergeschwaders darf er nicht sofort Vergeltung üben; der General, in kluger Beurteilung seiner beschränkten Machtmittel, zügelt das hitzige Temperament des Fliegers. Zudem ist es jetzt Nacht, aus tiefhängenden Wolken rinnt trostloser Regen.
Ruhelos geht Bars in seinem Quartier auf und ab. Ein großer Teil seines Bombengeschwaders ist heute morgen vernichtet worden. Es kann Wochen dauern, bis genügend Ersatz herankommt. Jetzt rächt sich die kurzsichtige Maßnahme des Kriegsministeriums, die Masse der Bombengeschwader an der Front in Turkestan und am Amur einzusetzen. Jetzt sitzt er da ohne die nötigen schweren Maschinen und ohne die immer noch nicht eingetroffenen Tankträger.
Eine unglaubliche Schweinerei, daß sie immer noch nicht hier sind! Was soll er mit seinen paar Jagdgeschwadern machen und den wenigen Großkampfmaschinen, die ihm übrig geblieben sind, wenn der Feind über Schwärme von Luftriesen verfügt?
So ist die Front hier nicht zu halten!
In den nächsten Tagen regnet und schneit es ununterbrochen. Es ist Ende September, der Winter steht vor der Tür. Damit wachsen die Schwierigkeiten dieses ohnehin schon schwierigen Geländes beträchtlich. Einen Krieg bei Bodentemperaturen von oft bis -40 Grad zu führen, ist trotz der raffiniertesten Technik keine Kleinigkeit. Von der Welteiskälte, die dann die Flieger in großen Höhen antreffen, gar nicht zu reden.
Alle Militärsachverständigen der Welt haben für die Dauer eines Zukunftskrieges ganz kurze Zeiten vorausgesagt. Bei der großen Zahl von Luftgeschwadern, hieß es, über die alle Länder verfügen, und bei dem immer mehr sich steigernden Aktionsradius der großen Bombenträger, überhaupt bei diesem kaum mehr zu überbietenden Stand der Luftangriffswaffe müsse man annehmen, daß schon am ersten Kriegstage alle wichtigen Industriezentren, alle Großstädte, alle lebenswichtigen Gebiete des angegriffenen Landes in wenigen Stunden zerstört sein würden; daß ferner die riesigen Tankgeschwader, die Technisierung und Motorisierung der auf der Erde kämpfenden Truppen gleich in den ersten Tagen zu Entscheidungsschlachten führen müssen, die entweder die völlige Vernichtung der einen oder vielleicht sogar beider Armeen bedeute.
Wie alle Voraussagen immer graue Theorie bleiben, so am meisten die, welche berauscht von Zahlen und den Wunderwerken menschlichen Erfindungsgeistes den Menschen selbst darüber vergessen.
Noch immer ist es im Letzten der Mensch, der über den Menschen entscheidet, und nicht eine noch so hoch gezüchtete Technik.
Bei diesem großen Kampf Rußlands gegen das erwachende Asien zeigt es sich nun, daß die Theoretiker wieder einmal falsch prophezeit hatten. Der Krieg dauert nun schon Wochen mit dem Einsatz der modernsten Waffen, und doch ist noch nirgends eine Entscheidung gefallen, die einen der Gegner zum Aufgeben gezwungen hätte. Wohl spielt er sich in der Hauptsache in Ländern ab, die mit europäischen Maßstäben nicht zu messen sind, aber die Heere, die an den Brennpunkten dieser unerhörten Front einander gegenüberstehen, sind mit allen Kampfmitteln des Jahrhunderts ausgerüstet.
Doch Rußland kämpft nicht nur gegen Flugzeug- und Tankgeschwader, gegen Motore, Stahl und Gas, es kämpft gegen Ideen und kämpft gegen Menschen, die diese Ideen verkörpern.
*
Es schneit. Ununterbrochen rieselt feinkörniges Weiß herab, es ist merkwürdig still.
Der Fluß hat sich mit Eisplatten bedeckt, unter denen es geheimnisvoll gurgelt und gluckst. Die Berge sehen in ihren weißen Mänteln wie Möbel aus, die man vor Antritt einer großen Reise mit Überzügen versehen hat.
An der Front ist Ruhe. Vom Feind ist nichts zu sehen. Die weiße rieselnde Schneewand verbirgt ihn und sein Vorhaben.
Der russische Gegenstoß, durch den der verlorengegangene Posten bei Navan-Zeren wieder zurückgewonnen werden soll, ursprünglich auf heute angesetzt, muß verschoben werden. Ohne die Mitwirkung der Luftgeschwader, auf die man bei diesem Wetter verzichten müßte, will der General das Unternehmen nicht wagen.
Bars ist bei den Flugzeughallen gewesen, die ausgebessert und um eine ganze Reihe neuer vermehrt sind, in denen imposante dreimotorige, zum Teil gepanzerte Bomben- und Kampfmaschinen stehen. In strömendem Regen sind sie gestern ganz unerwartet eingetroffen. Die energischen Vorstellungen des Generals, die an Deutlichkeit – man kann ruhig sagen Grobheit – nichts zu wünschen übrig gelassen hatten, haben also doch Erfolg gehabt. Bars ist zufrieden. Es hat lange gedauert, bis er den serienmäßigen Bau dieser Typen durchsetzen konnte. Als ausgesprochener Gegner der ganz großen, fünf- und mehrmotorigen »Dreadnoughts der Luft« – der Stolz vieler Armeen – legt er den größten Wert auf kleinere, aber schnelle und wendige, mit nur wenigen Leuten bemannte Maschinen, mit denen auch die größten Höhen zu erreichen sind.
»Mit den Möbelwagen voll Maschinengewehren und womöglich noch Geschützen,« pflegt er zu sagen, »kann ich nichts anfangen. Man hängt keine Festungen in die Luft!«
Die großen Bomben- und Tankträger sind ihm ein notwendiges Übel. Am liebsten hätte er gar nichts mit ihnen zu tun. Sie sind für ihn keine Luftwaffe mehr (trotzdem ist es ihm unangenehm, daß die angeforderten Tankträger noch nicht eingetroffen sind. Daß sie zuweilen nützlich sind, hat er ja neulich bemerkt). Einen Herrn vom Kriegsministerium, der ihm von immer neuen Möglichkeiten dieser Waffe vorschwärmte, setzte er in nicht geringes Erstaunen mit seiner trockenen Bemerkung:
»Demnächst werden sie noch Schienen in die Luft legen und mit Panzerzügen drauf herumfahren. Nein, danke, dann nehme ich meinen Abschied und werde Pastetenbäcker oder Damenschneider!«
Der hohe Herr vom Ministerium ist seitdem kein großer Freund mehr dieses temperamentvollen Fliegers.
Um so mehr lieben ihn seine Leute. Mann für Mann gingen sie durchs Feuer für ihren Panther.
Bars betritt unbemerkt eine der Wohnbaracken seiner Flieger. Durch den rotseidenen Vorhang, der als Windfang dient, sieht er in den mit allerhand aus der Chinesenstadt Zusammengetragenem malerisch ausstaffierten, von Zigarettenrauch erfüllten und völlig überheizten Raum. Gerade unter einem prachtvollen, seidengestickten Wandbild, auf dem in Wolken schwebend, von allerhand Getier umgeben, irgend so ein vielarmiger Götze sein Wesen treibt, sitzt auf einem der schweren, geschnitzten chinesischen Ebenholzstühle der junge, tollkühne Staffelführer Grigorij Morosoff und singt. Er hat eines der eigentümlichen chinesischen Musikinstrumente, die an eine Laute oder große Mandoline erinnern, für seine Zwecke umgestimmt und begleitet nun damit die schwermütigen oder schalkhaften Volkslieder seiner Heimat. Seine Kameraden summen die Melodie mit.
Es sind nicht die in den Anfangsjahren der Revolution entstandenen blutrünstigen oder kindisch überheblichen Strophen der proletarischen Welt, es sind die ewig jungen Lieder des Volkes, die hier im fernen kriegerfüllten Asien wieder auftauchen aus der verschüttet gewesenen Tiefe des Gemüts. Morosoff singt:
»Wie ein Seidenfädchen an der Mauer klebt,
So hat Iwan die Avdotja sich ans Herz gedrückt,
Sage mir Avdotja, sage mir Michailowna,
Wer ist dir, mein Leben, jetzt am meisten lieb?« …
Mit einem verträumten Lächeln, das niemand an ihm kennt, wendet sich der Panther wieder zur Tür und geht.
Draußen bestellt er seinen Wagen. Er will in die Stadt fahren.
Man müßte sich jetzt in irgendeiner stillen Ecke einsam betrinken, das dumme, zu einem Soldaten und Flieger ganz und gar nicht passende weiche Gefühl da irgendwo ganz innen drin zu ersäufen.
Am Rand der oberen Stadt angelangt, schickt er den Wagen voraus, er will zu Fuß gehen. An dem großen modernen Gebäude der Goldminengesellschaft Mongolor, dem Betonklotz des Asneft, des russischen Öltrusts, dem Hause der Elektrizitätsgesellschaft und der anderen neuen Bauten, die sich um den weitläufigen Komplex des russischen Generalkonsulats drängen, geht er ohne aufzusehen vorbei. Als häßliche Fremdkörper stehen sie auf der Höhe und überragen an Meterzahl und Nüchternheit den »Gando«, die ausgedehnte Anlage der buddhistischen Universität mit ihren Klöstern und dem neuen »Maidari«, dem Hauptheiligtum der MongoIen.
Die sonst von drängendem Leben erfüllte Stadt ist wie ausgestorben. Da die Truppen zum größten Teil außerhalb untergebracht sind, sieht man auch wenig Soldaten. Ab und zu saust ein Kraftwagen vorbei, daß der vom Schnee aufgeweichte Dreck weithin spritzt. Wer von den Einwohnern nicht geflohen ist – und das ist die ganze ärmere Bevölkerung in der unteren Stadt –, läßt sich nicht sehen. Nur die zottigen scheußlichen Köter, die Totengräber der Mongolen, streifen hungrig durch die schmutzigen Straßen oder balgen sich um einen Leichnam hinter einer der vielen Palisadenwände.
Der Mongole beerdigt seine Toten nicht, er läßt sie von den Hunden auffressen.
So war es immer hier und so ist es auch heute noch. Trotz scharfer Verordnung von seiten der russischen Besatzung. Bars feuert mit seiner Pistole in solch einen Haufen schwarzer Biester, die ihm im Wege sind. Verrücktes Land, denkt er, die Chinesen machen eine Riesengeschichte um ihre Toten mit ihrem Ahnenkult, aber diese Menschen hier, doch ganz nah verwandt mit ihnen, schmeißen sie einfach auf die Straße. Kopfschüttelnd geht er weiter in dem fallenden Schnee, der wenigstens den allerärgsten Schmutz und Unrat – und die Gebeine der Toten mit seinem gnädigen weißen Tuch bedeckt. Denn Bars ist unversehens auf das Gräberfeld von Urga geraten, das heißt also in die Gegend hinter der Universität, wo die Toten den Hunden zum Fraß ausgesetzt werden. Sofern man sich die Mühe nimmt, sie hierher zu bringen. Was durchaus nicht immer der Fall ist.
Weiter an braunroten Palisadenwänden vorbei gelangt er zu den phantastischen, farbenprächtigen Triumphbogen, Tempeln und Toren, die das alte Maidari mit seiner patinierten Messinghaube umgeben. Vor einer im chinesischen Stil gehaltenen Kapelle mit buntem Dach, an deren vier Ecken mächtige vergoldete Gebetsmühlen angebracht sind, bleibt er stehen. Vom Wind gedreht, leiern diese mechanischen Beter ihr ewiges: » om mani padme hum« für ihre Stifter. Aus einem anderen, mit Gold- und Silberstatuen, Bildern, Fahnen und all den ihm unverständlichen buddhistischen Ritualgegenständen angefüllten, mit bunten Gläsern und Ziegeln und Porzellanungeheuern geschmückten Tempel kommen gedämpfte Gongschläge und dumpfes Trommeln. Von einem hohen Gerüst herab blasen ein paar einsame Lamas auf ihren langen Muscheltrompeten. Weithin zittern die klagenden Töne durch den rinnenden Schnee. Tief in Gedanken versunken steht lange der Panther im Bann dieser andern Welt.
Auf dem Rückweg trifft er zwei Kameraden seines Geschwaders, die auf der Straße mit einem Mongolen verhandeln. Dieser Kerl steckt in einem schmierigen Pelz und den üblichen Stiefeln mit den aufgebogenen Spitzen, aber auf dem Kopf trägt er eine hohe gelbe Seidenmütze mit vielen Bändern. Er ist anscheinend kein Lama, aber auch kein »Schwarzer«, also kein gewöhnlicher Mongole, denn er trägt kein langes Haar. Der eine der Flieger, der mongolisch versteht, – er stammt aus Baikalien – redet eindringlich auf den Mann ein. Er sucht ihn wohl zu etwas zu überreden.
Bars tritt hinzu, erkundigt sich. »Einen Augenblick noch,« wird ihm zur Antwort. Gleich könne er, wenn ihm daran gelegen sei, die Prophezeiungen eines Wahrsagers hören, der sich hier unter der einfachen Bevölkerung eines großen Rufes erfreue.
Ob ich mich jetzt betrinke, oder ob ich mir den Humbug anhöre, ist schließlich egal, denkt der Panther. Betrinken können wir uns dann immer noch.
»Gut, wo soll der Zauber vor sich gehen, doch nicht etwa hier auf der Straße?«
Der Wahrsager, der bisher noch kein Wort gesprochen hat, dreht sich plötzlich um, sieht den Frager aus seinen kleinen geröteten Augen an – Bars hat das Gefühl, als ob der Mongole durch ihn hindurch sähe – wendet sich dann mit einer einladenden Gebärde um und setzt sich in Marsch. Die drei Flieger folgen ihm schweigend.
Wieder an langen Palisadenwänden entlang über Hügel von Schmutz und Abfällen, hinter einem Tempel mit chinesisch geschweiftem Dach vorbei, gelangen sie zu einem freien Platz, auf dem ein paar armselige Jurten stehen. Vor der einen macht der Wahrsager Halt, schlägt den Eingangsteppich auf das Dach hinauf und läßt die Herren eintreten.
In der Mitte des runden Filzzeltes glimmt ein kleines Feuer, unendlich schmierige Kisten und Fellhaufen liegen umher, weiter rückwärts im Halbdunkel ist das mongolische Bett zu erkennen. An der scherengitter ähnlichen Versteifung der Wände hängen allerlei seltsame Gerätschaften; dem Bett gegenüber steht eine hölzerne geschnitzte und bemalte hohe Truhe mit Heiligenfiguren, Gebetsfahnen, Tellern, silberbeschlagenen Holzgefäßen und verschiedenen anderen Gegenständen. Trotz des anfänglichen Ekels vor den schmutzstarrenden Sitzgelegenheiten und dem Gestank nehmen die drei doch Platz und harren neugierig der Dinge, die da kommen sollen. Der Mongole kramt in einer Ecke, unaufhörlich Unverständliches vor sich hinmurmelnd. Nachdem er mehrere Male das Feuer im Kreis umschritten hat, kauert er sich, das Gesicht der Truhe zugewendet, dicht vor der Glut nieder. Aus seinem langen Ärmel zieht er einen Schafschulterknochen hervor und berührt damit seine Stirn. Lange hockt er so mit geschlossenen Augen, seine wulstigen Lippen formen irgendwelche Gebete.
Bars, der sich allmählich an das Dämmerlicht gewöhnt hat, beobachtet den Mann scharf.
Da er überzeugt ist, daß alles, was jetzt folgen soll, Schwindel ist, versucht er hinter die Schliche des Zauberers zu kommen. Er glaubt hier Ähnliches vorgesetzt zu bekommen, wie es die indischen Fakire den europäischen Reisenden vorgaukeln.
Jetzt legt der Wundermann den Knochen in die warme Asche, deckt mit einer Feuerzange zuerst Asche und dann Glut darauf. Dann verbirgt er seine Hände in den langen Ärmeln und verharrt wieder, Zaubersprüche oder Gebete leiernd, unbeweglich.
Jetzt nimmt er mit der Zange den Knochen heraus, bläst sorgfältig die Asche herunter und läßt ihn erkalten. Dann betrachtet er eingehend die Risse und Sprünge, die sich wie ein feines Netz über den ganzen Knochen hinziehen. – Nun erhebt er sich. Die Sitzung scheint beendet.
Bars ist sehr enttäuscht; das war also alles? Sein mongolischsprechender Kamerad dagegen, der die ganze Zeremonie mit steigendem Interesse, ja beinahe mit Unruhe verfolgt hat, spricht jetzt lebhaft auf den Mongolen ein, er scheint nach dem Resultat zu fragen.
Langsam, die drei einzeln mit seinem unheimlichen Blick ansehend, gibt dieser Antwort. Bars versteht kein Wort, bemerkt aber, daß sein Kamerad plötzlich sehr blaß wird. Oder täuscht ihn das kalte Tageslicht, das vom Eingang her, dessen Teppich der Wahrsager jetzt wieder aufhebt, auf sein Gesicht fällt? Der Mann bekommt eine Belohnung in die Hand gedrückt, und nun stehen die drei wieder draußen im Schneetreiben. Auf dem Heimweg fragt der Panther:
»Na, was hat nun der Kerl aus dem alten Knochen herausgelesen? Auf dich scheint ja sein Orakel einigen Eindruck gemacht zu haben.«
Mit verbissenem Gesicht auf den Boden starrend, gibt der Gefragte zunächst keine Antwort. Bars ist erstaunt. Auf sein Drängen hin übersetzt er schließlich stockend, was der Mongole gesagt hat:
»Morgen in der Stunde des Drachen (das ist 8-10 Uhr vormittags) werden viele große Vögel von Osten kommen, werden weit hinter den Bergen ein großes Feuer entzünden. Ihr werdet auf euren brummenden Vögeln mit ihnen kämpfen. In der Stunde der Schlange (das ist 10-12 Uhr) werden viele tote Vögel auf den Bergen liegen. Du, der du unsere Sprache verstehst, wirst unter ihnen sein. Aber der mit dem gelben Haar, den ihr den Panther nennt, wird unter die Erde hinabsteigen, aus der er als ein anderer wieder kommen wird.«
*
Als nachher alle drei in ihrer hellen Wohnbaracke im Kreis von unbeschwerten und von keiner düsteren Prophezeiung belasteten Kameraden sitzen, schwindet allmählich der Schatten der dunkeln Weissagung und macht dem kühl betrachtenden Verstande Platz.
Die Wettermeldung sagt, daß mit einem Aufklaren in den nächsten vierundzwanzig Stunden nicht zu rechnen sei.
Ein Blick zum Fenster hinaus: es schneit ununterbrochen.
Das ganze Theater bei dem Mongolen ist also ein lächerlicher Hokuspokus. Wer sich davon einschüchtern läßt, ist ein hysterisches Frauenzimmer, aber kein ausgewachsenes Mannsbild unseres aufgeklärten Jahrhunderts. Daß es in den nächsten Tagen, sobald es einigermaßen Wetter danach ist, Luftkämpfe geben wird, daß – und nur so ist doch das Wort von dem »großen Feuer« zu verstehen – der Gegner Bombenangriffe unternehmen wird; um das vorauszusagen, braucht man schließlich keinen alten Knochen. Wer bei diesen Kämpfen bleiben wird, nun, das wird sich dann schon Herausstellen. Eine Lebensversicherung ist das Fliegen nicht. Und Krieg ist Krieg.
»Auf deine Gesundheit!«
Bars stößt lachend mit dem Kameraden an:
»Und jetzt Schluß mit dem Thema!«
Das Anstoßen wird an diesem Abend mehrfach exerziert, was zur Folge hat, daß der Vorsatz des Panthers, sich heute zu betrinken, nun zu einer ziemlich allgemeinen Besäufnis führt.
Beim Aufbruch in die Quartiere schneit es in der gleichen Weise wie bisher. Doch Bars, einer Eingebung folgend, gibt der Wache den Befehl, ihm sofort Meldung zu machen, wenn sich in der Nacht etwa das Wetter ändern sollte. Zur Vorsicht stellt er den Lautsprecher über seinem Bett auf Stärke ›eins‹.