
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
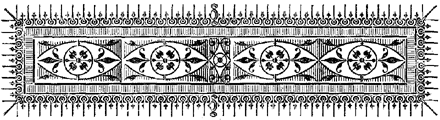
Der Kuß, welchen Saccard auf den Nacken seiner Frau gedrückt, gab ihm zu denken. Schon seit langer Zeit machte er seine Gattenrechte nicht geltend; der Bruch hatte sich ganz natürlich eingestellt, keines von Beiden kehrte sich an ein Band, welches ihnen gleicherweise gleichgiltig war. Wenn er daran dachte, sich in das Zimmer Renée's zu begeben, so mußte er zum Schluß seiner Gattenzärtlichkeiten ein vorteilhaftes Geschäft ankündigen können.
Das Unternehmen in Charonne machte gute Fortschritte, erfüllte ihn aber mit einiger Unruhe in Bezug auf den Ausgang der Sache. Larsonneau mit seiner blendend weißen Wäsche, lächelte in einer Weise, die ihm mißfiel. Larsonneau war blos ein Vermittler, ein Strohmann, dessen Zuvorkommenheit er mit zehn Perzent von den zukünftigen Erträgnissen bezahlte. Und trotzdem der Expropriationsagent keinen Sou in dem Unternehmen stecken und Saccard, nachdem er die erforderlichen Mittel zur Erbauung des Café-Concert vorgestreckt, alle erforderlichen Vorsichtsmaßregeln getroffen hatte, als Wiederkäufe, Briefe mit freigelassener Stelle für das Datum, im Vorhinein gegebene Bestätigungen und so weiter, konnte sich Letzterer einer dumpfen Angst, des Vorgefühls irgend eines sich vorbereitenden Verraths nicht erwehren. Er witterte bei seinem Genossen die Absicht, ihm mit Hilfe des falschen Inventars, welches Jener sorgfältig aufbewahrte und welchem er seine Betheiligung an dem Unternehmen zu danken hatte, irgend einen bösen Streich zu spielen.
Eben deshalb drückten sich die beiden Ehrenmänner kräftig die Hand und Larsonneau nannte Saccard »theurer Meister«. In Wahrheit hegte er eine aufrichtige Bewunderung für diesen Seiltänzer, dessen Kunststücke auf dem gespannten Seil der Spekulation er als Dilettant verfolgte. Der Gedanke, diesen Mann zu betrügen, erfüllte ihn mit der Freude eines seltenen und pikanten Genusses. Er arbeitete an einem noch nicht endgiltig festgestellten Plane und wußte noch nicht recht, wie er sich der Waffe bedienen sollte, die er besaß und mit welcher er sich selbst zu verwunden fürchtete. Zudem fühlte er sich noch abhängig von seinem ehemaligen Kollegen. Die Grundstücke und Baulichkeiten, welche laut den sachverständig aufgestellten Inventarien bereits einen Werth von beinahe zwei Millionen repräsentirten, die aber in Wahrheit nicht den vierten Theil dieser Summe werth waren, mußten von dem finsteren Abgrund eines kolossalen Bankerotts verschlungen werden, wenn die Fee der Expropriation sie nicht mit ihrem goldenen Zauberstabe berührte. Nach den ursprünglichen Plänen, die ihnen zugänglich gewesen, sollte der neue Boulevard, der eröffnet wurde, um den Artillerie-Park zu Vincennes mit der Kaserne des Prinzen Eugen zu verbinden und diesen Park mit Umgehung des Saint-Antoine-Viertels in die Mitte von Paris zu versetzen, einen Theil dieser Grundstücke beanspruchen; doch stand zu befürchten, daß dieselben kaum gestreift werden und die geistreiche Spekulation des Café-Concert an ihrer eigenen Kühnheit zu Grunde gehen würde. In diesem Falle bliebe Larsonneau in einer schönen Patsche. Dessenungeachtet hinderte ihn diese Gefahr, trotz der sekundären Rolle, die er gezwungenermaßen spielte, nicht, auf's Tiefste betrübt zu sein, wenn er an die mageren zehn Perzent dachte, die ihm bei einem solch kolossalen Millionendiebstahl zufallen sollten. Und so vermochte er dem Kitzel nicht zu widerstehen, ebenfalls die Hand auszustrecken, um seinen Antheil einzuheimsen.
Saccard hatte nicht einmal wollen, daß er seiner Frau Geld borge, da er sich an dieser großen Komödie ergötzte, bei welcher seine Vorliebe für verwickelte Geschäfte so reichlich ihre Rechnung fand.
»Nein, nein, mein Lieber,« sagte er mit seinem provençalischen Accent, den er noch verschärfte, wenn er einem Scherz eine größere Würze verleihen wollte; »wir wollen unsere Rechnung nicht verwickeln. Sie sind der einzige Mensch in Paris, dem ich niemals etwas schuldig sein zu wollen geschworen habe.«
Larsonneau begnügte sich mit der Bemerkung, daß seine Frau ein bodenloser Abgrund sei. Er rieth ihm, ihr keinen Sou mehr zu geben, um sie zu zwingen, ihm ihren Antheil an den Grundstücken sofort abzutreten. Er würde es vorziehen, wenn er mit ihm allein zu thun hätte. Zuweilen streckte er Fühlhörner aus und trieb es mitunter so weit, daß er mit seiner lässigen, gleichartigen Miene des Lebemannes sagte:
»Ich müßte endlich doch etwas Ordnung in meine Papiere bringen ... Ihre Frau, mein Lieber, flößt mir Schrecken ein und ich will nicht, daß bei mir gewisse Papiere versiegelt werden.«
Saccard war nicht der Mann dazu, um derartige Anspielungen ruhig hinzunehmen, insbesondere da er wußte, welch' peinliche Ordnung in den Bureaux dieses Menschen herrschte. Seine ganze kleine Person, die so voll List und Thatkraft war, bäumte sich gegen die Furcht, welche ihm dieser große, elegante Wucherer mit den gelben Handschuhen einzuflößen suchte. Das Schlimmste an der Sache war aber, daß er von einem Schauer erfaßt wurde, wenn er an die Möglichkeit eines Skandals dachte und schon sah er sich von seinem Bruder unbarmherzig nach Belgien verbannt, wo er irgend ein unsauberes Gewerbe betreiben mußte, um sein Leben zu fristen. Und eines Tages ward er so zornig, daß er sich so weit vergaß, Larsonneau zu duzen.
»Höre, mein Kleiner,« sagte er zu ihm; »Du bist ein ganz netter Junge, wirst aber wohl daran thun, mir das bewußte Papier zurückzugeben. Du wirst sehen, daß uns dieses Stück Papier noch entzweien wird.«
Der Andere schien im höchsten Grade erstaunt, drückte die Hände seines »theuren Meisters« und versicherte ihn seiner Ergebenheit, so daß Saccard seine momentane Aufwallung bereits bereute. Zu dieser Zeit war es, daß er ernstlich daran dachte, sich seiner Frau wieder zu nähern; er konnte ihrer gegen seinen Komplizen bedürfen und er sagte sich, daß sich die Angelegenheiten im Bette am besten erledigen ließen. Der Kuß auf den Nacken bildete denn sozusagen die Einleitung zu einer ganz neuen Taktik.
Im Uebrigen hatte er es nicht eilig und ging er nur sparsam mit seinen Mitteln vor. Der Winter diente ihm dazu, seinen Plan zu zeitigen, welchen zahllose andere Angelegenheiten, die überaus verwickelt waren, in die Länge zogen. Es war das ein schrecklicher Winter für ihn, reich an den größten Erschütterungen, ein an's Wunderbare grenzender Feldzug, während dessen er täglich dem Bankerott entgegentreten mußte. Weit entfernt, seinen Haushalt einzuschränken, veranstaltete er eine Festlichkeit nach der anderen. Doch wenn es ihm auch gelang, Allem die Spitze zu bieten, so mußte er doch Renée vernachlässigen, die er sich für seinen Hauptstreich vorbehielt, sobald die Charonner Operation reif geworden. Er begnügte sich damit, die Lösung vorzubereiten, indem er fortfuhr, ihr nur durch Larsonneau's Vermittelung Geld zu geben. Wenn er über etliche tausend Francs verfügen konnte und sie sich in Geldnöthen befand, gab er ihr das Geld, indem er sagte, daß die Leute Larsonneau's einen Wechsel über das Doppelte des betreffenden Betrages verlangten. Diese Komödie bereitete ihm ungeheuren Spaß; die Geschichte mit den Wechseln gefiel ihm, weil sie dem trockenen Geschäft einen romantischen Beigeschmack verliehen. Selbst zur Zeit, da er das Gold in ungezählten Massen einheimste, hatte er die Bezüge seiner Frau sehr unregelmäßig ausgefolgt, indem er ihr fürstliche Geschenke machte, sie mit Gold geradezu überhäufte und sie dann einer Kleinigkeit wegen wochenlang in Verlegenheit ließ. Gegenwärtig, da seine Lage thatsächlich eine bedrängte war, sprach er von den Lasten des Haushaltes, behandelte er sie wie einen Gläubiger, dem man nicht gestehen will, daß man zu Grunde gerichtet ist und den man durch allerlei Geschichten hinzuhalten sucht. Sie aber hörte ihm kaum zu, unterschrieb Alles, was er wollte und beklagte sich nur, daß sie nicht noch mehr unterschreiben könne.
Indessen besaß er schon von ihr Wechsel über zweihunderttausend Francs, die ihm kaum hundertzehntausend Francs gekostet hatten. Nachdem er dieselben an Larsonneau hatte indossiren lassen, brachte er die Papiere vorsichtig in Verkehr, um sich derselben später als entscheidender Waffen zu bedienen. Er hätte diesen entsetzlichen Winter nicht zu überstehen, seiner Frau nicht auf Wucherzinsen Darlehen zu beschaffen und die Kosten seines Haushaltes nicht zu bestreiten vermocht, wenn er seinen Baugrund auf dem Boulevard Malesherbes nicht verkauft hätte, welchen ihm die Herren Mignon und Charrier baar bezahlten, doch nicht ohne sich hierfür einen beträchtlichen Betrag in Abzug zu bringen.
Dieser Winter bildete für Renée eine einzige Kette der Freude und des Genusses; nur hatte sie fortwährend mit Geldverlegenheiten zu kämpfen. Maxime kam ihr sehr theuer zu stehen; er behandelte sie immer noch als Stiefmama und ließ sie überall bezahlen. Diese heimliche Geldnoth bildete für sie eine Wonne mehr. Sie sann über Mittel nach, zerbrach sich den Kopf, nur damit ihr »geliebtes Kind« nichts entbehre und wenn sie von ihrem Gatten einige tausend Francs zu erhalten vermochte, so vergeudete sie dieselben mit ihrem Liebhaber in kostspieligen Thorheiten, gleich zwei Schülern, die den ersten tollen Streich anstellen. Waren sie aller Mittel entblößt, so blieben sie hübsch zu Hause und erfreuten sich an diesem großen Gebäude, an seiner neuen, glänzenden Einrichtung. Der Vater war niemals zugegen. Häufiger denn je verweilten die Liebenden am Kaminfeuer; es war Renée endlich gelungen, die eisige Leere dieser vergoldeten Zimmerdecken mit warmem Leben zu erfüllen. Dieses Haus, welches den weltlichen Vergnügungen geweiht war, hatte sich in eine Kapelle verwandelt, allwo sie im Geheimen einer neuen Religion huldigte. Maxime brachte nicht allein den grellen Ton in ihr Leben, welcher mit ihren unsinnigen Toiletten im Einklang stand; sondern er war auch der Geliebte, wie ihn dieses Haus erforderte, welches Glasscheiben in der Größe von Schaufenstern hatte und vom Speicher bis zu den Kellern mit Schnitzereien und Bildwerken bedeckt war. Er belebte diese Gipsmassen, von den beiden pausbäckigen Amoren, die im Hofe aus ihrer Muschel einen dünnen Wasserstrahl entsendeten, bis zu den großen, nackten Frauen, die mit ihren Köpfen die Erker stützten und dabei mit Aepfeln und Getreideähren spielten. Er bildete die verkörperte Erklärung des überladenen Vestibüls, des zu engen Gartens, der strahlenden Räume, in denen man zu viele Fauteuils und keinen einzigen Kunstgegenstand sah. Die junge Frau, die sich hier tödtlich gelangweilt hatte, fand mit einem Male lebhaftes Vergnügen an diesen Dingen und bediente sich derselben wie einer Sache, deren Bestimmung ihr bis dahin unbekannt gewesen. Und sie genoß ihre Liebe nicht allein in ihren Gemächern, in dem kleinen Salon mit den goldenen Knospen und im Treibhause, sondern im ganzen Hause. Schließlich gefiel es ihr sogar auf dem Divan des Rauchzimmers; sie vergaß sich daselbst und sagte, daß in diesem Raume ein unbestimmter, doch sehr angenehmer Geruch von Tabak zu verspüren sei.
Statt eines Empfangstages hatte sie jetzt deren zwei in der Woche. Am Donnerstag erschien eine ganze Menge von Leuten, der Montag dagegen gehörte den vertrauten Freundinen. Männer wurden nicht zugelassen und nur Maxime durfte bei den im kleinen Salon stattfindenden köstlichen Unterhaltungen zugegen sein. Eines Abends hatte Renée die absonderliche Idee, ihn als Frau zu kleiden und als eine ihrer Basen vorzustellen. Adeline, Susanne, die Baronin von Meinhold und die anderen Freundinen, die zugegen waren, erhoben sich und grüßten, nicht wenig verwundert über dieses Gesicht, welches sie zu erkennen glaubten. Als sie hernach aufgeklärt wurden, lachten sie herzlich und wollten durchaus nicht zugeben, daß sich der junge Mann umkleide. Sie behielten ihn mit sammt seinen Röcken bei sich, neckten ihn und ergingen sich in allerlei zweideutigen Bemerkungen. Wenn er die Damen zur großen Thür hinausbegleitet hatte, machte er die Runde durch den Park und kehrte durch das Treibhaus zurück. Die guten Freundinen hatten niemals den leisesten Verdacht. Die Liebenden konnten gar nicht mehr vertrauter mit einander werden, als sie es bereits waren, da sie sich gegenseitig für gute Kameraden ausgaben. Und traf es sich mitunter, daß ein Bedienter dazu kam, wenn sie sich gerade umarmt hielten, so hatte das auch nichts zu bedeuten, da man daran gewöhnt war, daß Madame und der Sohn des Herrn vom Hause mit einander scherzten.
Diese unbeschränkte Freiheit und Straflosigkeit machten sie noch kühner. Des Nachts schoben sie wohl die Riegel vor, dagegen umarmten sie sich Tags über in allen Räumen des Hotels. Wenn es regnete, so erfanden sie tausenderlei kleine Belustigungen. Das Hauptvergnügen Renée's bestand aber stets darin, im Kamin ein mächtigs Feuer anzünden zu lassen und vor demselben einzuschlummern. Sie hatte sich diesen Winter herrliche Leibwäsche anfertigen lassen. Sie trug Hemden und Morgenröcke um fabelhafte Preise; der feine Battist schien sich wie ein leichter Hauch an ihre Glieder zu schmiegen. Und in der rothen Beleuchtung der Gluth schien sie ganz nackt zu sein; die Spitzen und ihre Schultern waren gleichförmig rosig, durch das dünne Gewebe hindurch versengte die Hitze fast ihren Leib. Zu ihren Füßen kauernd, küßte ihr Maxime die Kniee, ohne gar das feine Linnen zu spüren, das die Wärme und die Farbe dieses herrlichen Körpers hatte. Der Tag neigte sich bereits seinem Ende zu, die Dämmerung verbreitete sich immer mehr in dem grauen Zimmer, während Céleste hinter ihnen ruhigen Schrittes kam und ging. Sie war ganz natürlich die Verbündete der Liebenden geworden. Als dieselben eines Morgens zu lange im Bette geblieben waren, fand sie sie dort und behielt ihr ganzes Phlegma, ihre Kaltblütigkeit bei. Die Liebenden thaten sich vor ihr keinerlei Zwang an; sie kam und ging zu jeder Zeit, ohne daß sie bei dem Geräusch der gewechselten Küsse den Kopf gewendet hätte. Sie rechneten auf sie, um im Nothfall durch sie gewarnt zu werden, ohne darum ihr Stillschweigen zu erkaufen. Céleste war ein sehr sparsames, sehr ehrbares Mädchen, welchem man keinerlei Liebschaft nachsagen konnte.
Dessenungeachtet führte Renée keine zurückgezogene Lebensweise. Sie verkehrte in Gesellschaften, fand hieran sogar ein größeres Vergnügen als früher und nahm Maxime gleich einem blonden Pagen in schwarzem Anzuge mit sich. Die Saison bildete für sie einen einzigen großen Triumph. Niemals noch hatte sie in ihren Toiletten und Haartrachten größere Phantasie entwickelt. Größtes Aufsehen erregte sie mit einem strauchgrünen Seidenkleide, auf welchem eine ganze Hirschjagd in kunstvoller Stickerei ausgeführt war mit allen entsprechenden Attributen, als Pulverhörnern, Jagdhörnern und Hirschfängern. Sie brachte die antike Haartracht in die Mode, welche Maxime in dem kürzlich eröffneten Campana-Museum für sie kopiren mußte. Sie schien förmlich verjüngt und stand in der Blüthe ihrer aufregenden Schönheit. Die Blutschande erfüllte sie mit einer Gluth, welche in der Tiefe ihrer Augen flackerte und ihr Lachen erhitzte. Ihre Lorgnette nahm sich keck und unternehmend aus, wenn sie sie auf die Spitze ihrer Nase setzte und die anderen Frauen, ihre guten Freundinen betrachtete, die irgend einem Laster fröhnten. Ihre an einen prahlerischen Jüngling gemahnende Miene, ihr spöttisches Lächeln schien zu besagen: »Auch ich habe mein Verbrechen«.
Maxime dagegen fand die Gesellschaften tödtlich langweilig. Er behauptete, sich nur um des guten Tones willen zu langweilen; in Wahrheit aber amüsirte er sich nirgends. In den Tuilerien, bei den Empfängen der Minister verschwand er hinter den Röcken Renée's, handelte es sich aber um irgend einen tollen Streich, so ward er wieder zum Herrn und Lehrmeister. Renée wollte das bewußte Kabinet im Café Riche wiedersehen und der breite Divan entlockte ihr ein Lächeln. Allmälig führte er sie überall hin: zu den Mädchen, auf den Opernball, hinter die Koulissen der kleinen Theater, an alle zweideutigen Orte, wo sie mit dem Laster in Berührung kommen und dabei ihr Inkognito wahren konnten. Langten sie erschöpft und ermüdet zu Hause an, so schliefen sie einander umschlungen haltend ein, mit den Schlußworten irgend eines unzüchtigen Liedes auf den Lippen, welches sie an einem jener Orte vernommen, an welchen das unfläthige Paris so reich ist. Am nächsten Tage ahmte Maxime den Schauspielern nach und auf dem Piano des kleinen Salons suchte Renée die rauhe Stimme und die Hüftenbewegungen Blanche Müllers in der »Schönen Helena« nachzuahmen. Der Musikunterricht, welchen sie im Kloster genossen, diente ihr nur dazu, die neuesten Gassenhauer zu klimpern; vor ernsteren Musikstücken empfand sie eine Art heiliger Scheu. Gleich ihr verhöhnte Maxime die deutsche Musik und er glaubte »aus Ueberzeugung« den »Tannhäuser« auspfeifen zu müssen, nur um die gepfefferten Refrains seiner Stiefmama zu vertheidigen.
Großes Vergnügen bereitete ihnen das Schlittschuhlaufen, welches gerade sehr in der Mode war, denn der Kaiser war einer der Ersten gewesen, die das Eis des Teiches im Boulogner Wäldchen erprobt hatten. Renée bestellte bei Worms ein kompletes Polenkostüm aus Sammt und Pelzwerk; auf ihren Wunsch hatte Maxime weiche Stiefel an den Füßen und eine Mütze aus Fuchsfell auf dem Kopfe. Als sie im Bois anlangten, herrschte eine grimmige Kälte, daß ihnen Nase und Lippen prickelten, als würde ihnen der Wind feinen Sand ins Gesicht wehen. Es bereitete ihnen ein Vergnügen, daß sie froren. Im Bois war alles grau, Alles mit einer feinen Schneehülle bedeckt; die von Reif bedeckten Baumzweige glichen feinen Spitzen. Und unter dem bleichen Himmel, auf dem festen, glänzenden Eise ragten blos die Tannen der Inseln gleich Theaterdekorationen, die gleichfalls mit feinen, durchsichtigen Spitzen besetzt waren, in die Höhe. Flüchtig gleich den über dem Boden dahinschießenden Schwalben glitten sie auf der blanken Fläche dahin, eine Faust auf dem Rücken und mit der freien Hand sich gegenseitig bei der Schulter fassend. Vom Ufer schauten die Neugierigen zu. Zuweilen wärmten sie sich an den am Rande des Teiches angezündeten Feuern, worauf sie wieder davoneilten. Sie holten zu weitem Fluge aus, während ihre Augen vor Kälte und innerlichem Vergnügen thränten.
Wenn der Frühling kam, ward Renée wieder von einer elegischen Stimmung überwältigt. Sie wünschte mit Maxime des Nachts, bei hellem Mondschein, im Monceau-Park zu schwärmen. Sie besuchten die Grotte, ließen sich im Grase nieder und blickten zu den Sternen empor. Als die junge Frau aber den Wunsch äußerte, eine Spazierfahrt auf dem kleinen Teich zu unternehmen, bemerkten sie, daß die Barke, die man auch aus den Fenstern des Hauses sah und die am Rande einer Allee angelegt war, keine Ruder hatte. Offenbar wurden dieselben des Abends entfernt. Dies war eine Enttäuschung; außerdem wurden die Liebenden durch die ausgedehnten Schatten des Parkes beunruhigt. Sie hätten am liebsten daselbst ein venetianisches Fest mit rothen Lampions und Musik veranstaltet. Bei Tage gefiel ihnen der Park doch besser und mitunter setzten sie sich an ein Fenster, um die durch die große Allee vorüberrollenden Equipagen zu sehen. Sie fanden großes Gefallen an diesem reizenden Winkel des neuen Paris, an dieser reinlichen, liebenswürdigen Natur, an diesen Sammtstücken vergleichbaren Rasenflächen, an den wohlgehegten Hecken und Blumenbeeten. Die Wagen verkehrten hier ebenso zahlreich wie auf einem Boulevard und die Damen zogen ihre Kleider ebenso anmuthig hinter sich her, als hätten sie noch den Teppich ihres Salons unter den Füßen. Und durch das Laubwerk hindurch kritisirten sie die Toiletten, zeigten sie einander Wagen und Pferde und freuten sich herzlich über die zarten Farbenabstufungen dieses großen Gartens. Zwischen zwei Bäumen sah man ein Stück des vergoldeten Gitters glänzen, eine Schaar von Enten schwamm über den Teich, die kleine Brücke glänzte freundlich hell zwischen dem frischen Grün, während auf beiden Seiten der großen Allee gelbe Stühle standen, welche von Müttern und Kindeswärterinen besetzt waren, die in eifrigem Geplauder vertieft, an die kleinen Knaben und Mädchen ganz vergaßen, die munter und sorglos mit einander spielten.
Die Liebenden fanden Gefallen an dem neuen Paris. Häufig fuhren sie durch die Stadt und machten sogar Umwege, nur damit sie gewisse Boulevards, an die sie eine Art persönlicher Zuneigung knüpfte, sehen könnten. Die hohen Häuser mit den großen, geschnitzten Thoren und zahlreichen Balkonen, auf welchen in goldener Ausführung Namen, Aushängschilder, Firmentafeln glänzten, erfüllten sie mit Entzücken. Während der Wagen dahinrollte, folgten sie mit liebevollem Blick der endlosen grauen Linie der breiten Trottoirs mit ihren Bänken, buntscheckigen Säulen und mageren Bäumchen. Die helle Oeffnung des Horizonts, diese ununterbrochene Doppelreihe der großen Verkaufsläden, in welchen die dienstbereiten Angestellten den Käufern entgegeneilten, diese wogende, summende Menschenmasse, – all' dies erfüllte sie allmälig mit einer vollen, absoluten Befriedigung, mit einem Gefühl des Glückes. Sie liebten dieses Straßenleben bis zu den Wasserstrahlen der Spritzschläuche, die gleich einem weißen Dampf von den Pferden aufstiegen und in seinem Regen unter die Wagenräder dringend, den Boden überflutheten und eine schwache Staubwolke emporwirbelten. Immer weiter fuhren sie und es schien ihnen, als rollte der Wagen über einen Teppich, längs dieses schnurgeraden, schier endlosen Weges, den man blos angelegt hatte, damit sie nicht durch enge, dunkle Straßen zu fahren genöthigt seien. Jeder Boulevard wurde für sie ein Korridor ihres Hauses. Lachend lagen die wärmenden Sonnenstrahlen auf den neuen Façaden, die Schaufenster blinkten und leise hoben und senkten sich die Leinwanddächer der fliegenden Verkaufsstände und der Kaffeehäuser, während sich das Asphalt unter den Füßen der geschäftigen Menge zu erwärmen schien. Und wenn sie ein wenig betäubt durch das glänzende Wirrsal des Gesehenen nach Hause kamen, so erholten sie sich an dem Anblick des friedlich daliegenden Monceau-Parkes, als bildete derselbe den natürlichen Ruhepunkt dieses neuen Paris, welches seine Pracht bei den ersten Strahlen der Frühlingssonne entfaltete.
Wenn die Mode sie zwang, Paris zu verlassen, begaben sie sich in ein Seebad, voll Bedauern einen Vergleich zwischen dem Gestade des Meeres und den Trottoirs des Boulevards ziehend. Selbst ihre Liebe langweilte sich dort. Diese war eine Treibhausblüthe, welche des großen Bettes in Grau und Rosa nicht entbehren konnte, ebensowenig wie des fleischfarbenen Zeltes und der goldenen Morgenröthe des kleinen Salons. Seitdem sie sich des Abends allein am Meeresufer befanden, hatten sie einander nichts zu sagen. Sie versuchte die übermüthigen Lieder aus dem Variétés-Theater auf einem alten, wackeligen Pianino zu spielen, welches in ihrem Hôtelzimmer schlummerte; das von der feuchten Seeluft gänzlich ruinirte Instrument aber gab nur klägliche Töne von sich, so daß die Couplets aus der »Schönen Helena« sich wie Trauermärsche anhörten. Um sich selbst zu trösten, setzte die junge Frau durch ihre phantastischen Kostüme das ganze Gestade in Erstaunen. Sämmtliche Damen, die hier anwesend waren, gähnten, langweilten sich, sehnten den Winter herbei und suchten mit verzweiflungsvoller Hast nach einem Badekostüm, welches sie nicht zu sehr verunstaltete. Niemals vermochte Renée Maxime dazu zu bewegen, daß er ein Bad nehme. Er fürchtete sich geradezu entsetzlich vor dem Wasser, wurde ganz bleich, wenn dasselbe seinen Fuß benetzte und hätte sich um nichts in der Welt dem Ufer genähert. Er machte weite Umwege, um einem Tümpel, einer etwas steilen Uferstelle auszuweichen.
Saccard fand sich zwei- oder dreimal ein, um nach »den Kindern« zu sehen. Er sagte, daß ihn die Sorgen zu Boden drückten. Erst Ende Oktober, als alle Drei nach Paris zurückgekehrt waren, dachte er ernstlich daran, sich seiner Frau zu nähern. Die Charonner Angelegenheit wurde immer reifer. Sein Plan war ebenso einfach als brutal. Er rechnete darauf, daß er sich Renée's auf dieselbe Weise wie einer Dirne bemächtigen werde. Ihre Geldverlegenheiten wurden immer drückendere und aus Stolz wendete sie sich an ihren Gatten nur, wenn die Noth zum Höchsten gestiegen war. Saccard nahm sich nun vor, ihr nächstes Anliegen sich zu Nutze zu machen, um galant zu sein und in der Freude über eine bedeutende Schuld, die er bezahlen wollte, die längst gelockerten ehelichen Bande wieder fester zu knüpfen.
Die ärgsten Verlegenheiten harrten Renée's und Maxime's in Paris. Mehrere der Wechsel, welche man Larsonneau gegeben, waren fällig geworden; da Saccard dieselben aber friedlich bei dem Gerichtsvollzieher ruhen ließ, so ward die junge Frau nur wenig davon beunruhigt. Viel mehr erschreckte sie ihre Schuld bei Worms, die sich gegenwärtig auf beiläufig zweihunderttausend Francs belief. Der Schneider forderte eine größere Abschlagszahlung, widrigenfalls er jeden weiteren Credit zu verweigern drohte. Sie erschauerte, wenn sie an den Skandal eines Prozesses und insbesondere an die Möglichkeit eines Bruches mit dem berühmten Kleiderkünstler dachte. Außerdem bedurfte sie Taschengeldes. Sie und Maxime kamen fast um vor Langeweile, wenn sie nicht täglich ein paar Louis zu verausgaben hatten. Das geliebte Kind befand sich auf dem Trockenen, seitdem es die Schubfächer seines Vaters vergebens durchsuchte. Seine Treue, seine musterhafte Aufführung während sieben oder acht Monate hatte ihren eigentlichen Grund in der absoluten Leere seiner Börse. Er verfügte nicht immer über die zwanzig Francs, deren er bedurfte, um ein gelegentlich getroffenes Dämchen zum Souper zu laden und so kam er denn zumeist hübsch solid nach Hause. Bei jedem Ausfluge, den sie mit einander unternahmen, übergab ihm die junge Frau ihre Börse, damit er in den Restaurants, auf den Bällen, in den kleinen Theatern die beiderseitigen Kosten bezahle. Sie behandelte ihn nach wie vor gewissermaßen mütterlich und sie bezahlte sogar bei dem Konditor, zu dem sie sich jeden Nachmittag begaben, um kleine Austernpasteten zu verzehren. Häufig fand er des Morgens in seiner Westentasche einige Louisd'ors, von deren Vorhandensein er keine Kenntniß gehabt und die sie dorthin praktizirt hatte, gleichwie eine Mutter die Börse eines Schulknaben füllt. Und nun sollte diese schöne Zeit der Imbiße, befriedigten Launen und leichten Vergnügungen mit einem Male ein Ende nehmen! Hierzu gesellte sich noch eine größere Angst. Der Juwelenhändler Sylvia's, dem er zehntausend Francs schuldig war, verlor die Geduld und sprach davon, eine Klage anzustrengen, ihn in Schuldhaft setzen zu lassen. Die seit langer Zeit protestirten Wechsel, die er in Händen hatte, waren derart mit Spesen überladen, daß die Schuld um drei- oder viertausend Francs zugenommen hatte. Saccard erklärte rundheraus, daß er nichts thun könne. Wenn sein Sohn in den Schuldthurm käme, so würde dies allgemeines Aufsehen erregen und wenn er ihn aus demselben befreien würde, so müßte diese väterliche Freigebigkeit ihm nur zum Ruhme gereichen. Renée war in Verzweiflung; sie sah ihr geliebtes Kind bereits im Gefängniß, in einem wirklichen Kerker, wo er auf feuchtem Stroh liegen mußte. Eines Abends machte sie ihm in allem Ernste den Vorschlag, er möge sie nie mehr verlassen und nur bei ihr leben, ohne daß Jemand wisse, wohin er gerathen. Dann wieder schwor sie, daß sie das Geld auftreiben werde. Niemals erwähnte sie den Ursprung dieser Schuld, sprach niemals von dieser Sylvia, die ihre Liebesgeheimnisse den Spiegeln in den Restaurantskabineten anvertraute. Sie mußte fünfzigtausend Francs auftreiben: fünfzehntausend für Maxime, dreißigtausend für Worms und fünftausend Francs Taschengeld. Hiedurch würden ihnen wieder volle vierzehn glückliche Tage gesichert werden. Und sie bot Alles auf, um das Geld herbeizuschaffen.
Ihr erster Gedanke war, dasselbe von ihrem Gatten zu verlangen und nur widerstrebend vermochte sie sich hierzu zu verstehen. Bei den letzten Anlässen, die ihn in ihr Zimmer geführt hatten, um ihr Geld zu bringen, hatte er sie neuerdings auf den Nacken geküßt, ihre Hände ergriffen und von seiner Liebe gesprochen. Die Frauen haben eine feine Witterung und so war sie denn auf eine Forderung, auf einen stillschweigend abgeschlossenen Handel vorbereitet. Thatsächlich zeigte er sich sehr erschrocken, als sie die fünfzigtausend Francs von ihm verlangte; er sagte, daß Larsonneau einen solchen Betrag niemals vorstrecken werde und er selbst denselben auch nicht auftreiben könne. Dann aber schlug er einen anderen Ton an, als wäre er besiegt und von einer plötzlichen Rührung erfaßt worden.
»Man vermag Ihnen nichts zu verweigern,« murmelte er. »Ich will Alles aufbieten, das Unmögliche durchsetzen ... Ich will Sie, geliebte Freundin, zufriedenstellen.«
Und sich zu ihrem Ohre neigend, küßte er ihr Haar und flüsterte mit zitternder Stimme:
»Ich bringe Dir das Geld morgen Abend in Dein Zimmer ... und ohne Wechsel ...«
Sie aber erwiderte lebhaft, daß sie es nicht eilig habe, daß sie ihm diesbezüglich keine Ungelegenheiten bereiten wolle. Und er, der die gefährlichen Worte »ohne Wechsel« mit scheinbarer Inbrunst gesprochen und schier wieder bereute, daß ihm dieselben entschlüpft waren, schien die unangenehme Abweisung gar nicht zu empfinden. Er erhob sich und sagte:
»Nun, wie Sie wollen ... Ich werde Ihnen das Geld beschaffen, sobald es erforderlich sein wird. Larsonneau, wohlverstanden, wird gar nichts damit zu thun haben. Ich will Ihnen damit ein Geschenk machen.«
Dabei lächelte er gutmüthig, sie aber blieb die Beute einer unaussprechlichen Angst. Sie fühlte instinktiv, daß sie das bischen Gleichgewicht, welches ihr geblieben, einbüßen würde, wenn sie sich ihrem Gatten hingeben müßte. Ihr letzter Stolz bestand darin, daß sie den Vater geheirathet habe, doch nur die Gattin des Sohnes sei. Häufig, wenn Maxime kalt schien, versuchte sie ihm diese Situation durch sehr deutliche Anspielungen zu erklären; der junge Mann aber, den sie nach einer derartigen Auseinandersetzung zu ihren Füßen sinken zu sehen hoffte, blieb völlig gleichmüthig, da er sicherlich meinte, sie wolle ihn nur bezüglich der Möglichkeit eines Zusammentreffens mit seinem Vater in dem grauen Zimmer beruhigen.
Als Saccard von ihr gegangen war, kleidete sie sich eilig an und ließ anspannen. Während ihr Wagen sie nach der Insel Saint-Louis brachte, legte sie sich die Art und Weise zurecht, wie sie die fünfzigtausend Francs von ihrem Vater verlangen werde. Sie klammerte sich an diesen Gedanken, ohne denselben näher zu prüfen, denn im Grunde genommen fühlte sie, daß sie sehr feige sei und vor einem derartigen Schritt eine unüberwindliche Furcht habe. Als sie anlangte, ward sie bei dem Anblick des eiskalten Hofes des Hôtels Béraud mit seinen kahlen, düsteren Mauern von einem frostigen Gefühl erfaßt und während sie die breite steinerne Treppe emporstieg, auf welcher die hohen Absätze ihrer kleinen Schuhe ein schreckliches Echo erweckten, wäre sie am liebsten wieder entflohen. In ihrer Eile war sie so unvorsichtig gewesen, ein laubfarbenes Seidenkleid mit langen Spitzenvolants anzulegen; um die Hüften hatte sie eine weiße Spitzenschärpe geschlungen. Die Toilette, welche ein kleines Hütchen mit einem großen weißen Schleier vervollständigte, nahm sich in dem düsteren Treppenhause so merkwürdig aus, daß sie sich selbst bewußt war, welch' absonderliche Gestalt sie daselbst abgab. Sie zitterte, als sie die kahle Flucht der öden Gemächer durchschritt, wo die undeutlich hervortretenden Figuren der Wandbekleidung über diese das Halbdunkel ihrer Einsamkeit unterbrechenden rauschenden Frauenröcke höchlich erstaunt schienen.
Sie fand ihren Vater in einem nach dem Hofe gehenden Salon, wo er sich gewöhnlich aufhielt. Er las in einem großen Buche, welches auf einem an dem Arm seines Fauteuils angebrachten Pulte lag. Vor einem Fenster saß Tante Elisabeth und strickte mit langen, hölzernen Nadeln und außer dem einförmigen trockenen Geklapper dieser Nadeln störte nichts die Ruhe des Raumes.
Befangen ließ sich Renée nieder; sie konnte keine Bewegung machen, ohne durch das Rauschen der eleganten Stoffe die ernste Stille des Gemaches zu stören. Gegen das tiefe Schwarz der Tapeten und alten Möbel nahmen sich ihre Spitzen erschreckend weiß aus. Die Hände auf sein Pult gestützt, blickte Herr Béraud du Châtel sie an, während Tante Elisabeth von der bevorstehenden Vermählung Christinens sprach, die den Sohn eines sehr reichen Notars heirathen sollte und in Begleitung einer alten Magd des Hauses ausgegangen war, um verschiedene Einkäufe zu besorgen. Die gute Tante plauderte ganz allein, mit ihrer ruhigen Stimme, ohne ihre Strickerei für einen Moment zu unterbrechen; sie sprach über hauswirthschaftliche Angelegenheiten und warf über ihre Brille hinweg lächelnde Blicke auf Renée.
Die junge Frau aber gerieth immer mehr in Verlegenheit. Das ganze düstere Schweigen des Hôtels lastete auf ihren Schultern und sie hätte Vieles darum gegeben, wenn die Spitzen ihres Kleides schwarz gewesen waren. Der beharrliche Blick ihres Vaters machte sie so befangen, daß sie Worms für lächerlich erklärte, weil er so mächtige Volants erfunden.
»Wie schön Du bist, mein Kind!« sagte Tante Elisabeth, die die weißen Spitzen ihrer Nichte noch gar nicht wahrgenommen, plötzlich. Sie hielt ihre Nadeln an und rückte ihre Brille zurecht, während Herr Béraud du Châtel leise lächelte.
»Die Toilette scheint etwas zu weiß,« sagte er. »Für eine Frau mag dies auf der Straße recht hinderlich sein.«
»Man geht ja nicht zu Fuße aus, Vater!« rief Renée aus, bereute aber sofort, daß sie dies gesagt.
Der Greis schien etwas erwidern zu wollen, dann aber stand er auf, richtete sich zu seiner vollen Höhe empor und begann langsam auf- und niederzuschreiten, ohne seine Tochter mehr anzublicken. Diese war ganz bleich vor Erregung. So oft sie sich aufraffte und einen Uebergang suchte, um ihr Anliegen vorzubringen, entsank ihr der Muth.
»Man bekommt Sie gar nicht mehr zu sehen, Vater,« murmelte sie.
»Oh!« erwiderte die Tante, ohne ihrem Bruder Zeit zu lassen, die Lippen zu öffnen, »Dein Vater verläßt das Haus nur sehr selten und auch dann geht er blos in den Thiergarten. Und ihn dazu zu bewegen, muß ich ihn erst tüchtig auszanken. Er behauptet, daß er sich in Paris verirrt, daß die Stadt nicht mehr für ihn tauge.«
»Mein Gatte wäre sehr erfreut, wenn Sie an unseren Donnerstagen zuweilen bei uns vorsprechen wollten,« sagte Renée.
Herr Béraud du Châtel machte einige Schritte und sprach dann ruhigen Tones:
»Danke Deinem Gatten in meinem Namen. Er ist wie es scheint, ein sehr rühriger Mann und in Deinem Interesse wünsche ich, er möge seine Angelegenheiten rechtschaffen zu Ende führen. Wir haben aber ganz verschiedene Anschauungen und ich fühle mich sehr unbehaglich in Eurem schönen Hause im Monceau-Park.«
Tante Elisabeth schien diese Antwort zu betrüben. »Wie schlimm doch die Männer sind, wo es sich um ihre Politik handelt!« sagte sie. »Willst Du die Wahrheit wissen? Dein Vater ist nicht gut auf Euch zu sprechen, weil Ihr die Tuilerien besucht.«
Der Greis aber zuckte mit den Schultern, wie um anzudeuten, daß seine Unzufriedenheit auf viel ernsteren Ursachen beruhe und darauf begann er wieder langsam und nachdenklich im Zimmer auf- und abzuschreiten. Renée schwieg einen Augenblick und schon öffnete sie den Mund, um ihre Bitte wegen der fünfzigtausend Francs vorzubringen, als mit einem Male eine noch größere Mutlosigkeit sie befiel; sie küßte rasch ihren Vater und entfernte sich.
Tante Elisabeth wollte sie bis zur Treppe begleiten und während sie durch die hohen, düsteren Gemächer schritten, fuhr sie fort, mit ihrer feinen Stimme zu plaudern:
»Du bist glücklich, mein theures Kind. Es freut mich, Dich so schön und wohlauf zu sehen, denn wenn Deine Ehe eine unglückliche gewesen wäre, so hätte ich mich dafür verantwortlich gemacht! ... Dein Gatte liebt Dich, Du hast Alles, was Du benöthigst, nicht wahr?«
»Gewiß, gewiß,« erwiderte Renée und zwang sich zu lächeln, obschon ihr sehr bitter zu Muthe war.
Ueber das Geländer der Treppe geneigt, fuhr die Tante zu sprechen fort:
»Siehst Du, ich habe nur die eine Befürchtung, Du könntest durch Dein Glück unvorsichtig gemacht werden. Sei klug und verkaufe nichts ... Wenn Du einmal ein Kind haben solltest, so wirst Du für dasselbe ein kleines Vermögen bereit finden.«
Als Renée wieder in ihrem Coupé saß, stieß sie einen Seufzer der Erleichterung aus. Kalte Schweißtropfen standen ihr auf den Schläfen und als sie dieselben abtrocknete, dachte sie an die eisige Feuchtigkeit des Hôtels Béraud. Dann aber rollte der Wagen über das sonnenbeschienene Asphalt des Quai Saint-Paul, sie erinnerte sich der fünfzigtausend Francs und ihr Schmerz erwachte lebhafter denn je. Man hielt sie für muthig und doch war sie vorhin so feige gewesen! Und es handelte sich doch um Maxime, um seine Freiheit, um ihre beiderseitigen Freuden! Inmitten der bitteren Vorwürfe, die sie sich machte, schoß ihr ein Gedanke durch den Kopf, welcher ihre Verzweiflung noch vermehrte; sie hätte über diese fünfzigtausend Francs mit Tante Elisabeth auf der Treppe sprechen müssen. Wo hatte sie denn nur ihren Verstand? Die gute Frau hätte ihr diese Summe vielleicht vorgestreckt, oder wäre ihr wenigstens rathend zur Seite gestanden. Schon neigte sie sich vor, um ihrem Kutscher zu sagen, er möge nach der Rue Saint-Lous-en-l'ile zurückkehren, als sie die Gestalt ihres Vaters vor sich zu sehen meinte, wie er langsam durch das feierliche Halbdunkel des großen Salons schritt. Nein, sie besaß den Muth nicht, sofort wieder in dieses Gemach zu treten. Was sollte sie auch sagen, um ihren abermaligen Besuch zu erklären? Und ehrlich gesprochen, fühlte sie sogar, daß sie jetzt nicht mehr wagen würde, mit Tante Elisabeth über die Sache zu reden. Sie befahl ihrem Kutscher, nach der Rue du Fauburg-Poissonnière zu fahren.
Frau Sidonie stieß einen Freudenschrei aus, als sie die dicht verhängte Thür des Ladens sich öffnen sah. Sie war nur zufällig zu Hause und wollte soeben ausgehen, um sich zum Friedensrichter zu begeben, wo sie mit einer Klientin zu thun hatte. Nun würde sie dies aber für den nächsten Tag verschieben, denn sie war zu erfreut darüber, daß ihre Schwägerin so liebenswürdig war, ihr einen kleinen Besuch abzustatten, Renée lächelte ein wenig verlegen. Frau Sidonie wollte durchaus nicht zugeben, daß sie unten bleibe; sie führte sie über die kleine Treppe in ihr Zimmer hinauf, nachdem sie den Messingknopf des Ladens weggenommen hatte. Diesen durch einen einfachen Nagel festgehaltenen Knopf zog sie wohl zwanzig Mal im Tage ab, um ihn eben so oft wieder anzubringen.
»So, meine Schöne,« sagte sie, nachdem sie ihr auf einer Chaiselongue einen Platz angewiesen; »hier wollen wir gemüthlich mit einander plaudern ... Denken Sie nur, Sie kommen mir wie gerufen, denn ich wollte heute Abend zu Ihnen gehen.«
Renée, die dieses Zimmer kannte, ward daselbst von einem gewissen Unbehagen erfaßt, wie es etwa ein Spaziergänger empfindet, der die Wahrnehmung macht, daß an einer ihm besonders liebwerthen bewaldeten Stelle die Bäume ausgehauen worden.
»Ah!« sagte sie endlich; »Sie haben dem Bette einen anderen Platz gegeben?«
»Ja,« erwiderte die Spitzenhändlerin ruhig. »Eine meiner Klientin findet, es sei dem Kamin gegenüber besser am Platze. Sie hat mir auch den Rath gegeben, rothe Vorhänge anzubringen.«
»Ich wollte auch eben die Bemerkung machen, daß die Vorhänge nicht mehr die früheren seien ... Roth ist übrigens recht gewöhnlich, meiner Ansicht nach.«
Und ihre Lorgnette hervornehmend, blickte sie in dem Gemach umher, welches mit dem Luxus eingerichtet war, wie man ihn in größeren Hotels Garnis antrifft. Auf der Kaminplatte erblickte sie lange Haarnadeln aus Schildpatt, die sicherlich nicht zu dem mageren Chignon der Frau Sidonie gehörten. Auf der Stelle, wo sich das Bett früher befunden, war die Tapete ganz abgewetzt, beschmutzt und durch die Matratzen farblos geworden. Die Hausfrau hatte diese Stelle allerdings durch den Rücken zweier Fauteuils verdecken wollen; doch waren dieselben ein wenig zu niedrig und Renée's Blick blieb an diesem schwärzlichen Streifen haften. »Sie haben mir etwas zu sagen?« fragte sie endlich.
»Ach ja; das ist aber eine ganze Geschichte,« erwiderte Frau Sidonie und faltete die Hände mit der Miene einer Feinschmeckerin, die sich zu erzählen anschickt, was sie zum Diner gespeist. »Denken Sie nur, Herr von Saffré ist zum Sterben in die schöne Frau Saccard verliebt ... Ja, in Sie, mein Herz ...«
Sie machte nicht einmal eine kokette Bewegung, als sie entgegnete:
»Sie sagten doch, er sei in Frau Michelin verliebt!«
»Ach, das ist zu Ende, ganz aus ... Ich kann es Ihnen beweisen, wenn Sie wollen ... Sie wissen also nicht, daß die kleine Michelin den Gefallen des Barons Gouraud erregt hat? Die Sache ist mir ganz unbegreiflich und Jedermann, der den Baron kennt, ist auf's Höchste erstaunt darob ... Und wissen Sie, daß sie ihrem Gatten sehr bald das rothe Bändchen der Ehrenlegion errungen haben wird? ... Ach, die kleine Frau ist ein Schelm; sie findet ihren Weg allein und braucht Niemanden, der ihr Schifflein führen hilft.«
Die letzten Worte sprach sie mit einigem Bedauern, welchem sich eine gewisse Bewunderung zugesellte.
»Kommen wir aber auf Herrn von Saffré zurück ... Er will Sie auf einem Ball getroffen haben, den eine Schauspielerin gab; er behauptet, Sie wären in schwarzem Domino gewesen und er hätte Sie – was er jetzt bedauert – ein wenig zudringlich aufgefordert, mit ihm zu soupiren ... Ist das wahr?«
Die junge Frau war auf's Höchste überrascht.
»Vollkommen!« murmelte sie. »Doch wer konnte ihm gesagt haben ...«
»Warten Sie ... Er behauptet, Sie erst später erkannt zu haben, als Sie nicht mehr im Salon waren und er erinnerte sich, daß Sie am Arme Maxime's hinausgegangen seien ... Seit jener Zeit ist er rasend verliebt in Sie und er hat sich die Sache ungeheuer zu Herzen genommen. ... Nun hat er mich aufgesucht, um mich zu bitten, Ihnen seine Entschuldigungen vorzubringen ...«
»Sagen Sie ihm meinethalben, daß ich ihm verzeihe,« fiel ihr Renée nachlässig ins Wort und mit einem Male wieder ängstlich und zaghaft werdend, fügte sie hinzu:
»Ach, meine gute Sidonie, ich befinde mich in einer so peinlichen Lage! Bis morgen Früh muß ich unbedingt fünfzigtausend Francs haben und ich bin nur gekommen, um hierüber mit Ihnen zu sprechen. Sie kennen Leute, sagten Sie mir, die Geld leihen?«
Aergerlich über die wenig rücksichtsvolle Weise, in welcher ihre Schwägerin sie in ihrer Erzählung unterbrochen, zögerte die Maklerin eine Weile mit ihrer Antwort.
»Gewiß kenne ich welche; doch rathe ich Ihnen, es vorerst bei Ihren Freunden zu versuchen ... Ich an Ihrer Stelle wüßte, was ich zu thun hätte ... Ich würde mich ganz einfach an Herrn von Saffré wenden.«
Renée lächelte gezwungen, als sie zur Antwort gab:
»Dies wäre nicht sehr schicklich, da er, wie Sie behaupten, in mich so sehr verliebt ist.«
Die Alte blickte sie fest an, dann verzog sich ihr farbloses Gesicht langsam zu einem mitleidsvollen Lächeln.
»Armes Kind,« murmelte sie. »Sie haben geweint; leugnen Sie nicht, Ihre Augen verrathen es. Seien Sie also stark, nehmen Sie das Leben so wie es ist ... Ueberlassen Sie es mir, ich werde die Sache in Ordnung bringen.«
Renée erhob sich, wobei sie ihre Finger so krampfhaft in einander schlang, daß ihre Handschuhe schier platzten. Und sie blieb aufrecht stehen, während sich in ihrem Inneren ein schwerer Kampf vollzog. Schon öffnete sie die Lippen, vielleicht um einzuwilligen, als in dem anstoßenden Gemach der Ton einer Klingel vernehmbar wurde. Frau Sidonie schritt eilig hinaus, wobei sie eine Thür halb offen stehen ließ, durch die eine Doppelreihe von Klavieren sichtbar wurde. Darauf vernahm die junge Frau Männerschritte und das gedämpfte Geräusch einer mit leiser Stimme geführten Unterhaltung. Mechanisch trat sie näher, um den gelblichen Streifen anzusehen, welchen die Matratzen an der Mauer zurückgelassen. Dieser Streifen beunruhigte sie, war ihr lästig. Sie vergaß Alles: Maxime, die fünfzigtausend Francs, Herrn von Saffré, und trat sinnend vor das Bett hin. Dasselbe stand hier unbedingt besser als an der Stelle, wo es sich früher befunden. Es gab in der That Frauen, die keinen Geschmack hatten; wenn man im Bette lag, mußte man sich doch dem Licht gegenüber befinden. Und unbestimmt tauchte in ihrer Erinnerung das Bild des Unbekannten vom Quai Saint-Paul auf, ihr Roman, der aus zwei Begegnungen bestanden, diese Zufalls-Liebe, welche sie dort, an jener anderen Stelle genossen. Nichts als dieser abgefärbte Fleck an der Mauer war von derselben zurückgeblieben. Und nun ward sie von demselben Unbehagen erfaßt, welches sie schon beim Eintritt in dieses Zimmer empfunden und das Gemurmel der Stimmen im anstoßenden Gemach regte sie ungemein auf.
Als Frau Sidonie zurückkam, wobei sie die Thür vorsichtig öffnete und hinter sich schloß, machte sie eine hastige Bewegung mit dem Zeigefinger, wie um ihr zu bedeuten, sie möge leise sprechen. Sodann neigte sie sich zu ihr und flüsterte ihr ins Ohr:
»Das trifft sich ja herrlich; Herr von Saffré ist hier.«
»Sie haben ihm doch nicht gesagt, daß ich hier bin?« fragte die junge Frau unruhig.
Die Vermittlerin schien ganz überrascht und erwiderte naiven Tones:
»Oh doch ... Er wartet nur hereingerufen zu werden. Von den fünfzigtausend Francs habe ich ihm natürlich nichts gesagt.«
Tief erbleichend richtete sich die junge Frau wie von einer Feder geschnellt in die Höhe. Ein unendlicher Stolz regte sich in ihr und der Schall der Männerschritte im anstoßenden Gemach erbitterte sie.
»Ich gehe,« sprach sie kurzen Tones. »Oeffnen Sie mir die Thür.«
Frau Sidonie versuchte zu lächeln.
»Seien Sie nicht kindisch ... Was soll ich denn jetzt mit dem jungen Mann anfangen, nachdem ich ihm gesagt, daß Sie hier seien ... Sie kompromittiren mich wahrhaftig.«
Die junge Frau aber war die kleine Treppe bereits hinabgeschritten und wiederholte, vor der verschlossenen Thür des Ladens angelangt:
»Oeffnen Sie! öffnen Sie mir sofort!«
Wenn die Maklerin den Messingknopf abzog, pflegte sie ihn gewöhnlich in die Tasche zu stecken. Noch wollte sie einen Versuch machen und parlamentiren; schließlich aber gerieth sie selbst in Zorn und indem ihre grauen Augen all' die Bosheit und Habsucht ihrer Natur verriethen, rief sie aus:
»Was soll ich dem Manne aber eigentlich sagen?«
»Daß ich nicht käuflich bin!« erwiderte Renée, die mit einem Fuß bereits auf der Straße stand.
Und während Frau Sidonie die Thür heftig ins Schloß warf, glaubte sie dieselbe murmeln zu hören: »Gehe nur, dumme Gans; Du sollst mir Das noch entgelten.«
»Meiner Treu!« sprach sie halblaut vor sich hin, als sie bereits im Wagen saß; »da ziehe ich ja noch meinen Gatten vor.«
Sie kehrte geradewegs nach Hause zurück. Am Abend sagte sie Maxime, er möge nicht kommen, denn sie sei leidend und bedürfe der Ruhe. Und als sie ihm am nächsten Tage die fünfzehntausend Francs für den Juwelier Sylvia's übergab, hatte sie für seine überraschten Fragen blos ein verlegenes Lächeln. Ihr Gatte, sagte sie, habe ein vortheilhaftes Geschäft abgeschlossen. Doch von diesem Tage an war sie launenhaft, änderte sie häufig die Stunden der Rendezvous, welche sie mit dem jungen Manne vereinbarte und häufig erwartete sie ihn sogar im Treibhause, um ihn fortzuschicken. Er beachtete diese wechselnden Stimmungen kaum, denn er gefiel sich darin, ein fügsames Werkzeug in den Händen der Frauen zu sein. Unangenehmer war es ihm, daß ihre Zusammenkünfte, die durch die Liebe herbeigeführt wurden, mitunter eine moralische Wendung nahmen. Renée war ganz traurig geworden und zuweilen hatte sie Thränen in den Augen. Sie sang nicht mehr die übermüthigen Weisen aus der »Schönen Helena«, spielte nur die Gesänge, die sie im Pensionat gelernt und fragte ihren Geliebten, ob er daran glaube, daß das Böse früher oder später bestraft werde.
»Sie wird alt, daran ist nicht zu zweifeln,« dachte der junge Mann im Stillen. »In ein oder höchstens zwei Jahren wird sie Niemandem mehr ein Vergnügen bereiten können.«
Die Wahrheit aber bestand darin, daß sie fürchterlich litt. Nun hätte sie Maxime lieber mit Herrn von Saffré betrogen. Bei Frau Sidonie hatte sie ihrer Entrüstung Ausdruck verliehen, hatte sie aus Abscheu über den schmählichen Handel einem instinktiven Stolz Gehör geschenkt. An den folgenden Tagen aber, da sie die Qualen des Ehebruches erduldete, ward sie von düsterem Schrecken erfaßt und sie selbst kam sich so verächtlich vor, daß sie sich dem erstbesten Manne hingeworfen hätte, der die Thür des mit den Klavieren angefüllten Zimmers geöffnet hätte. Wenn bisher der Gedanke an ihren Gatten gleich einem Gegenstand wollüstigen Schreckens in der Blutschande, der sie sich hingab, aufgetaucht war, so trat fortan an Stelle dieses Gedankens der Gatte, der Mann selbst und dies mit einer Brutalität, welche ihre zartesten Empfindungen in unerträgliche Leiden verwandelte. Sie, die sich dem vollen Genusse ihres Fehltrittes hingeben wollte und gerne von einem übermenschlichen Paradies träumte, allwo die Götter unter sich ihrer Liebe fröhnen, fiel zwischen zwei Männern getheilt, der niedrigsten Ausschweifung anheim. Vergebens versuchte sie sich an dieser Infamie zu erfreuen. Noch waren ihre Lippen warm von den Küssen Saccard's, als sie dieselben den Küssen Maxime's darbot. Ihre Lüsternheit vertiefte sich gänzlich in diese fluchwürdige Wollust und es kam so weit, daß sie die Zärtlichkeitsbeweise dieser beiden Wesen mit einander zu vereinen und in den Umarmungen des Vaters den Sohn zu finden suchte. Doch erfüllte sie dieses Erforschen des Bösen, dieses heiße Dunkel, in welchem sie ihre beiden Geliebten mit einander verwechselte, mit noch größerem Abscheu und Schrecken, mit einem Entsetzen, welches ihre Freuden zu Höllenqualen gestaltete.
Doch verschloß sie dieses Drama in ihrem Inneren und verdoppelte ihr Leid noch durch die Bilder ihrer Phantasie. Lieber wäre sie gestorben, als daß sie Maxime die Wahrheit gestanden hätte. Es entsprang dies einer dumpfen Befürchtung, daß der junge Mann sich erzürnen, sie verlassen könnte; aber auch ihrem unerschütterlichen Glauben an die entsetzliche Schuld und ewige Verdammniß, so daß sie eher nackt durch den Monceau-Park gegangen wäre, als ihre Schmach gebeichtet hätte. Im Uebrigen blieb sie die leichtfertige Verschwenderin, die Paris durch ihren Aufwand in Erstaunen setzte. Sie trug eine geräuschvolle Heiterkeit zur Schau und gefiel sich in den tollsten Streichen, über welche die Zeitungen Berichte brachten, in welchen ihr Name durch die Anfangsbuchstaben bezeichnet wurde. In diese Epoche viel es, daß sie sich in allem Ernste mit der Herzogin von Sternich auf Pistolen duelliren wollte, weil dieselbe ein Glas Punsch über ihr Kleid ausgegossen hatte, – mit Absicht, wie Renée behauptete, und ihr Schwager, der Minister mußte sich unter Androhung seines Zornes ins Mittel legen, damit die Sache unterbliebe. Ein anderes Mal wettete sie mit Frau von Lauwerens, daß sie die Runde um die Rennbahn zu Longchamps in weniger denn zehn Minuten machen werde und die Tollheit gelangte nur nicht zur Ausführung, weil sie nicht wußte, welche Kleidung sie zu diesem Bravourstück anlegen sollte. Maxime selbst begann sich vor dieser Frau zu fürchten, die nicht ganz zurechnungsfähig zu sein schien und an deren Busen er des Nachts das Tosen einer in rauschenden Vergnügungen schwelgenden Stadt zu vernehmen meinte.
Eines Abends begaben sie sich ins Theatre-Italien. Sie hatten nicht einmal nachgesehen, welches Stück zur Aufführung gelangen würde und wollten nur die große italienische Tragödin Ristori sehen, die damals ganz Paris in Entzücken versetzte und den Anforderungen der Mode entsprechend bewundert werden mußte. Man gab »Phädra«. Er kannte sein klassisches Repertoir genügend und Renée verstand hinlänglich italienisch, um der Darstellung folgen zu können. Und selbst dieses Drama bereitete ihnen eine eigenthümliche Erregung, trotz des ihnen fremden Idioms, dessen heller Klang ihnen mitunter blos die Begleitung zu dem Mienenspiel der Darsteller zu sein schien. Hippolyte war ein großer, bleicher, junger Mann, ein sehr mittelmäßiger Schauspieler, der seine Rolle in weinerlichem Tone vortrug.
»Welch' ein Tölpel!« murmelte Maxime.
Die Ristori aber mit ihren breiten Schultern, die infolge des Schluchzens bebten, mit ihrer tragischen Physiognomie und ihren mächtigen Armen, erschütterte Renée. Phädra war aus dem Blute der Pasiphaë und sie fragte sich, welches Blut denn in ihr rollen könne, in ihr, der Blutschänderin der Neuzeit. Von dem ganzen Stücke sah sie nichts weiter als diese große Frauengestalt, die das antike Verbrechen auf die Bühne brachte. Im ersten Akt, als Phädra Oenone ihre verbrecherische Liebe enthüllt; im zweiten, da sie sich in lodernder Leidenschaft Hippolyte offenbart und dann im vierten, da die Rückkehr Theseus' sie zu Boden schmettert und sie in einem Anfall düsterster Verzweiflung sich selbst flucht, – da gellte ein solcher Schrei wilder Leidenschaft, des Verlangens nach übermenschlicher Wollust durch das Haus, daß die junge Frau sich von einem Schauer ihrer Begierden und Gewissensbisse erfaßt fühlte.
»Warte 'mal,« murmelte Maxime neben ihr; »nun sollst Du die Erzählung Theramens hören. Der Alte sieht vielversprechend aus.«
Und Jener sprach mit grabestiefer Stimme:
»Kaum waren wir aus den Thoren von Trözen,
Als sein Siegeswagen – – –«
Doch Renée sah und hörte nichts mehr, als der Alte zu sprechen begonnen. Die flimmernde Beleuchtung blendete sie, eine glühende Hitze schien von all' diesen der Bühne zugewendeten bleichen Gesichtern auszugehen und sie zu versengen. Der Monolog aber wollte kein Ende nehmen und sie sah sich im Treibhause, unter dem dichten Blätterwerk, während ihr Gatte eintrat und sie in den Armen seines Sohnes überraschte. Sie litt unsäglich, verlor fast das Bewußtsein und erst beim letzten Röcheln Phädra's, die erst im Sterben bereute und sich selbst durch Gift richtete, schlug sie wieder die Augen auf. Der Vorhang fiel. Wird sie den Muth haben, sich eines Tages zu vergiften? Wie lächerlich und schmählich ihr Drama neben dieser antiken Epopöe erschien! Und während Maxime sie in ihren Theatermantel hüllte, tönte ihr noch immer die herbe Stimme der Ristori im Ohr, welcher das beistimmende Murmeln Oenone's antwortete.
Im Wagen plauderte der junge Mann allein. Im Ganzen genommen fand er die Tragödie »tödtlich langweilig« und zog er derselben entschieden die ergötzlichen Schwänke der kleinen Theater vor. Phädra aber war »stark« und er hatte Interesse für das Stück, weil ... Und er drückte Renée die Hand, um seinen Gedanken zu vervollständigen. Dann aber kam ihm eine kurzweilige Idee und er konnte dem Reiz, ein Scherzwort anzubringen, nicht widerstehen.
»Ich hatte ganz Recht,« sagte er halblaut, »als ich in Trouville dem Meere nicht nahekommen wollte.«
In ihren schmerzlichen Gedanken versunken, gab Renée keine Antwort und Maxime war gezwungen, seine Worte zu wiederholen.
»Nun, weil das Ungeheuer ...«
Dabei lachte er leise, sein Scherz aber berührte die junge Frau peinlich. Alles drehte sich wirr in ihrem Kopf. Die Ristori war ein großer Hampelmatz, der sein Peplum emporschürzte und dem Publikum die Zunge zeigte, wie Blanche Müller im dritten Akt der »Schönen Helena«; Theramen tanzte Cancan und Hippolyte aß Knackmandeln, wobei er mit dem Finger in der Nase bohrte.
Wenn Renée von zu heftigen Gewissensbissen geplagt wurde, empfand sie etwas wie stolze Empörung. Worin besteht denn ihr Verbrechen und weshalb wäre sie erröthet? Sah sie nicht täglich schlimmere Niedrigkeiten begehen? Begegnete sie nicht überall, bei den Ministern sowohl, als auch in den Tuilerien Elenden gleich ihr, die Werthe von Millionen an ihrem Leibe trugen und auf den Knieen liegend angebetet wurden? Und sie gedachte der schmählichen Freundschaft, welche zwischen Adeline d'Espanet und Susanne Haffner bestand und über die man mitunter sogar bei den Montagsempfängen der Kaiserin lächelte. Sie erinnerte sich an die Geschäfte der Frau von Lauwerens, die von den Ehemännern ihrer tadellosen Lebensweise, ihres Ordnungssinnes und der Pünktlichkeit wegen gepriesen wurde, mit welcher sie ihre Lieferanten bezahlte. Sie führte Frau Daste, Frau Teissière, die Baronin von Meinhold und die übrigen Geschöpfe an, die ihren Luxus von ihren Liebhabern bezahlen ließen und die in den Herrenkreisen gleich den Werthpapieren an der Börse ihren Kurs hatten. Frau von Guende war so dumm und so herrlich gebaut, daß sie zu gleicher Zeit drei höhere Offiziere zu Geliebten hatte, die sie an ihren Uniformen nicht zu unterscheiden vermochte, so daß sie, wie die boshafte Luise behauptete, gezwungen war, dieselben bis auf's Hemd entkleiden zu lassen, damit sie wisse, mit welchem von den Dreien sie sprach. Die Comtesse Vanska hingegen hatte eine lange Reihe von öffentlichen Lokalen hinter sich, in denen sie gesungen hatte und die Zeit war gar nicht so fern, da sie in schlechte Zitzstoffe gekleidet, gleich einer auf Beute ausziehenden Wölfin über die Boulevards strich. Jede dieser Frauen hatte ihre Schmach, ihre offene Wunde, mit welcher sie sozusagen triumphirte. Und über Alle emporragend sah man die häßliche, alte abgelebte Herzogin von Sternich mit dem Glorienschein, welchen ihr eine im Bette des Kaisers verbrachte Nacht verlieh. Dies war das offizielle Laster, welches selbst die Ausschweifung mit einer gewissen Hoheit umgab und ihr eine Art Ueberlegenheit über diese Schaar auserlesener Buhlerinen verlieh.
Die Blutschänderin gewöhnte sich denn an ihre Schuld wie an ein Galakleid, dessen Steifheit ihr anfänglich lästig gewesen. Sie folgte der Mode ihrer Zeit, kleidete und entkleidete sich nach dem Beispiele der Anderen. Schließlich gelangte sie zu der Ansicht, daß sie inmitten einer Welt lebe, die über die gewöhnliche Moral erhaben sei, in welcher sich die Sinne verfeinerten und entwickelten und es gestattet war, sich zur Freude des ganzen Olymp's auch nackt sehen zu lassen. Das Schlechte wurde ein Luxus, eine Blume, die man ins Haar steckte, ein Diamant in der Mitte der Stirne. Und gleich einer Rechtfertigung und Erlösung sah sie im Geiste wieder den Kaiser vor sich, wie er am Arme des Generals durch die Doppelreihe der demüthig geneigten Schultern schritt.
Nur ein einziger Mann: Baptiste, der Kammerdiener ihres Gatten, beunruhigte sie noch immer. Seitdem Saccard wieder galant geworden, schien sich dieser bleiche, würdige Lakai mit der Feierlichkeit eines stummen Vorwurfes um sie zu bewegen. Er schaute sie gar nicht an, sein kalter Blick glitt über sie, über ihren Chignon mit der Züchtigkeit eines Kirchendieners hinweg, der seine Augen nicht durch den Anblick der Haare einer Sünderin besudeln will. Sie bildete sich ein, daß er Alles wisse und hätte sie es gewagt, so würde sie sein Schweigen zu erkaufen versucht haben. Ein Unbehagen erfaßte sie und eine Art unfreiwilliger Hochachtung überkam sie, wenn sie Baptiste begegnete, denn sie sagte sich, daß die ganze Rechtschaffenheit ihrer Umgebung unter dem schwarzen Gewande dieses Lakaien Zuflucht genommen habe.
Eines Tages richtete sie die Frage an Céleste:
»Pflegt Baptiste im Gesindezimmer Scherze zu machen? Hat er keinerlei Abenteuer ober Maitressen?«
»Mir ist nichts bekannt,« begnügte sich die Dienerin zur Antwort zu geben.
»Er wird Ihnen aber doch den Hof gemacht haben?«
»Ah, er würdigt die Frauen keines Blickes und wir bekommen ihn kaum zu Gesicht ... Er ist immer beim Herrn oder in den Ställen. Er sagt, daß er ein großer Freund der Pferde sei.«
Gereizt durch diese Rechtschaffenheit forschte Renée weiter; sie wollte etwas in Erfahrung bringen, um ihre Leute verachten zu können und obgleich sie für Céleste eine gewisse Zuneigung empfand, wäre sie doch erfreut gewesen, wenn sie gewußt hätte, daß das Mädchen Liebhaber besaß. »Aber Sie, Céleste, finden Sie nicht, daß Baptiste ein hübscher Junge sei?«
»Ich, Madame?« rief die Dienerin mit der überraschten Miene einer Person aus, die etwas Unglaubliches vernommen. »Oh! ich habe ganz andere Gedanken und von einem Manne will ich nichts wissen. Ich habe meinen Plan, wie Sie sehen werden, wenn der richtige Augenblick gekommen sein wird. Ich bin nicht dumm ...«
Weiter vermochte Renée nichts aus ihr herauszubekommen. Im Uebrigen wurden ihre Sorgen mit jedem Tage größer. Ihre geräuschvolle Lebensweise, ihre tollen Launen, denen sie zu genügen suchte, stießen auf zahlreiche Hindernisse, welche sie zu überwinden gezwungen war und an denen zuweilen ihr Wille scheiterte. So richtete sich eines Tages Luise de Mareuil zwischen ihr und Maxime empor. Sie war nicht eifersüchtig auf »die Buckelige«, wie sie sie verächtlich nannte; sie wußte, daß dieselbe von den Aerzten aufgegeben sei und konnte nicht glauben, daß sich Maxime jemals dazu verstehen würde, solch ein häßliches Wesen, selbst um den Preis einer Million zu heirathen. Trotzdem sie so tief gesunken war, hatte sie sich eine gewisse spießbürgerliche Naivität bewahrt, wo es sich um Personen handelte, die sie liebte und wenn sie sich selbst auch verachtete, so hielt sie jene dennoch gerne für überlegene und durchaus ehrenwerthe Menschen. Indem sie aber den Gedanken an eine Heirath, die ihr eine häßliche Ausschweifung und ein Diebstahl zugleich dünkte, energisch von sich wies, litt sie durch den vertraulichen, kameradschaftlichen Verkehr der jungen Leute. Wenn sie mit Maxime über Luise sprach, so lachte er behaglich, erzählte ihre neuesten Scherze und sagte:
»Weißt Du, die Schelmin nennt mich ihren kleinen Mann.«
Und dabei bekundete er eine solche Unbefangenheit, daß sie ihn nicht darauf aufmerksam zu machen wagte, daß diese »kleine Schelmin« siebzehn Jahre alt sei und daß ihre Spielereien mit den Händen, ihre Eile, mit welcher sie in den Salons die dunkelsten Ecken aufsuchten, um sich daselbst über die Gesellschaft lustig zu machen, hinreichend waren, um sie zu kränken und ihr die schönsten Abende zu verderben.
Hierzu gesellte sich ein Vorfall, der der ganzen Situation einen absonderlichen Anstrich verlieh. Renée empfand häufig das Bedürfniß einer Prahlerei, die Laune brutaler Kühnheit. Sie zog Maxime hinter einen Vorhang, hinter eine Thür und küßte ihn auf die Gefahr hin, gesehen zu werden. An einem Donnerstag Abend, da der kleine, goldene Salon voll mit Leuten war, gerieth sie auf den schönen Einfall, den jungen Mann, der gerade mit Luise plauderte, zu sich zu rufen. Sie schritt ihm aus dem Hintergrunde des Treibhauses, wo sie sich befand, entgegen und küßte ihn zwischen zwei Baumgruppen, wo sie vor allen Blicken sicher zu sein glaubte, heftig auf den Mund. Luise aber war Maxime nachgegangen und als die Liebenden die Köpfe emporhoben, erblickten sie kaum einige Schritte von ihnen entfernt die junge Dame, die sie mit einem eigenthümlichen Lächeln anblickte, ohne daß sie irgend welches Erstaunen oder Verlegenheit verrathen hätte. Sie hatte ganz die ruhig-freundschaftliche Miene eines Sündengenossen, der sehr wohl im Stande ist, einen solchen Kuß zu verstehen und zu würdigen.
Maxime war in Wahrheit erschrocken, während Renée ganz gleichgiltig, ja sogar heiter zu sein schien. Ihre Befürchtungen waren verstummt, nun es unmöglich geworden, daß die Buckelige sie ihres Geliebten beraubte.
»Ich hätte Das schon längst eigens thun müssen,« sagte sie sich im Stillen. »Sie weiß nunmehr, daß ›ihr kleiner Mann‹ mein ist.«
Allmälig beruhigte sich Maxime, als ihm Luise ebenso heiter und witzig entgegentrat wie bisher. Er nannte sie im Stillen »sehr stark, ein sehr gutes Mädchen« und das war Alles.
Renée's Befürchtungen waren begründet. Seit einiger Zeit schon dachte Saccard daran, seinen Sohn mit Fräulein von Mareuil zu verheirathen. Es war da eine Million zu holen, die er sich nicht entgehen lassen wollte, wenn er sich des Geldes auch erst später zu bemächtigen gedachte. Da Luise zu Beginn des Winters drei Wochen hindurch an's Bett gefesselt gewesen, ward er von Furcht erfaßt, sie könnte noch vor dem Zustandekommen der geplanten Verbindung sterben und darum beschloß er, die Kinder sofort zu verheirathen. Dieselben waren zwar noch sehr jung, doch befürchteten die Aerzte, daß der Monat März der Brustleidenden verhängnißvoll werden könnte. Herr von Mareuil befand sich seinerseits in einer sehr schwierigen Lage. Bei der letzten Wahl war es ihm gelungen, seine Erwählung zum Abgeordneten durchzusetzen. Die gesetzgebende Körperschaft erklärte diese Wahl aber für ungiltig. Die Prüfung seines Mandats war der »Schandfleck« des ganzen Verifikations-Verfahrens. Die ganze Wahl überhaupt war ein tragikomisches Heldengedicht, an welchem die Zeitungen einen ganzen Monat zehrten. Herr Hupel de la Noue, der Präfekt des betreffenden Departements, hatte eine solche Energie entwickelt, daß die übrigen Kandidaten weder ihre Programme aufstellen, noch ihre Wahlreden halten konnten. Auf seinen Rath bestritt Herr von Mareuil während einer vollen Woche die Kosten, welche die Versammlungen der Bauern verursachten, die nach Herzenslust aßen und tranken. Er versprach ihnen außerdem eine Eisenbahn, die Erbauung einer Brücke und dreier Kirchen und beschenkte die einflußreichen Wähler am Vorabend der Wahl mit den Bildnissen des Kaisers und der Kaiserin in goldenem Rahmen. Diese Geschenke erzielten einen ungeheuren Erfolg, die Majorität war eine erdrückende. Als die Kammer aber unter dem lauten Gelächter des ganzen Landes Herrn von Mareuil zu seinen Wählern heimzuschicken gezwungen war, gerieth der Minister in einen fürchterlichen Zorn gegen den Präfekten und den unglücklichen Kandidaten, die thatsächlich zu scharf ins Zeug gegangen waren. Er sprach sogar davon, einen andern offiziellen Kandidaten aufzustellen. Herr von Mareuil erschrack. Er hatte sich die Sache dreihunderttausend Francs kosten lassen, besaß in dem Departement bedeutende Güter, auf denen er sich langweilte und die er mit Verlust verkaufen mußte. Er suchte daher seinen lieben Kollegen auf, damit dieser seinen Bruder begütige, indem er ihm für das nächste Mal eine vollkommen tadellose Wahl zusichere. Unter diesen Umständen brachte Saccard die Heirath der Kinder neuerdings zur Sprache und die beiden Väter einigten sich nunmehr endgiltig über dieselbe.
Als Maxime über die Sache ausgeholt wurde, empfand er eine gewisse Verlegenheit. Er fand Luise kurzweilig, die in Aussicht gestellte Mitgift verlockte ihn noch mehr. Er sagte Ja und acceptirte Alles, wie es Saccard wünschte, nur um sich in keine Erörterung einlassen zu müssen. Insgeheim war er sich aber klar darüber, daß sich die Dinge nicht in dieser schönen Ordnung weiter entwickeln würden. Renée würde niemals einwilligen, sie wird weinen, ihm Scenen machen und war sehr wohl im Stande, irgend einen großen Skandal heraufzubeschwören, der ganz Paris in Erstaunen setzen würde. Dies war höchst unangenehm und sie flößte ihm bereits Furcht ein. Sie hatte so beunruhigende Augen und beherrschte ihn so despotisch, daß er ihre Krallen sich in seine Schultern versenken zu fühlen glaubte, wenn sie ihre weiße Hand auf dieselbe legte. Ihre geräuschvolle Heiterkeit erschien ihm gezwungen und ihr Lachen klang mitunter, als risse eine Saite in ihrem Inneren. Er befürchtete thatsächlich, daß sie eines Nachts in seinen Armen wahnsinnig werden würde. Bei ihr gelangten die Gewissensbisse, die Furcht ertappt zu werden, die grausamen Freuden des Ehebruches nicht wie bei anderen Frauen durch Thränen und Traurigkeit zum Ausdruck, sondern durch eine noch schlimmere Ausgelassenheit, durch ein noch unwiderstehlicheres Bedürfniß nach Geräusch und Betäubung. Und inmitten ihrer zunehmenden Bestürzung begann man ein Röcheln, das Knacken dieses aus einander gehenden herrlichen, bewunderungswürdigen Mechanismus zu vernehmen.
Unthätig erwartete Maxime eine Gelegenheit, welche ihn von dieser lästigen Maitresse befreien würde. Wiederholt sagte er, daß sie eine Dummheit gemacht hatten. Wenn ihre Vertraulichkeit ihrer Liebe einen Reiz mehr verliehen hatte, so hinderte ihn dieselbe heute, das Verhältniß abzubrechen, wie er es unbedingt bei einer anderen Frau gethan hätte. Er wäre ganz einfach nicht wiedergekommen, denn dies war seine Art, seine Liebschaften zu lösen, um allen Anstrengungen und Streitigkeiten aus dem Wege zu gehen. Hier aber fühlte er sich unfähig, einen Bruch herbeizuführen, zumal er sich die Zärtlichkeitsbezeugungen Renée's noch immer gerne gefallen ließ; sie war so mütterlich gut zu ihm, bezahlte für ihn und wird ihn sicherlich stets aus der Verlegenheit befreien, wenn ein Gläubiger zudringlich werden sollte. Da kam ihm wieder der Gedanke an Luise, an die Mitgift im Betrage von einer Million und er sagte sich, selbst während er in den Armen der jungen Frau lag, daß dies Alles recht schön und gut, doch nicht ernst sei und daß dem ein Ende gemacht werden müsse.
Eines Nachts befand sich Maxime bei einer Dame, bei der oft bis zum Morgen gespielt wurde, so hartnäckig im Verluste, daß er alsbald seinen letzten Franc verspielt hatte und den dumpfen Zorn des Spielers empfand, dessen Taschen leer sind. Er hätte eine Welt darum gegeben, wenn er noch einige Louis auf den Tisch zu werfen vermocht hätte. Er nahm seinen Hut und begab sich mit dem mechanischen Schritte eines Menschen, den ein ausschließlicher Gedanke beherrscht, nach dem Monceau-Park, wo er die kleine Pforte öffnete und alsbald befand er sich im Treibhause. Mitternacht war vorüber. Renée hatte ihm gesagt, er möge sich diesen Abend nicht einfinden. Sie suchte jetzt gar nicht mehr nach einer Erklärung, nach einem Vorwande, wenn sie ihm ihre Thür versagte und er dachte blos daran, seinen Urlaub auszunützen. Er erinnerte sich des Verbotes der jungen Frau erst vor der verschlossenen Glasthür des kleinen Salons. Gewöhnlich wenn er kommen durfte, öffnete Renée diese Thür schon im Vorhinein.
»Bah!« sagte er sich bei dem Anblicke des beleuchteten Fensters des Ankleidezimmers. »Ich werde pfeifen und sie wird herunterkommen. Ich werde sie nicht stören und wenn sie mir ein Paar Louis geben kann, so gehe ich gleich fort.«
Damit stieß er einen leisen Pfiff aus. Auf diese Weise pflegte er ihr häufig seine Anwesenheit anzukündigen; heute aber mußte er wiederholt pfeifen, was ihn ärgerlich machte und so pfiff er immer lauter, da er den Gedanken an eine sofortige Anleihe nicht aufgeben wollte. Endlich sah er, wie die Glasthür mit größter Vorsicht geöffnet wurde, ohne daß er vorher irgendwelche Schritte vernommen hätte. In dem Halbdunkel des Treibhauses erblickte er jetzt Renée mit aufgelöstem Haar, kaum bekleidet und barfuß, als hätte sie sich gerade zu Bett begeben wollen. Sie drängte ihn in eine der Lauben und stieg dabei die Stufen hinab, schritt über den Sand der Allee, ohne dem Anscheine nach die Kälte oder die Rauhheit des Bodens zu empfinden.
»Weshalb pfeifst Du so stark?« fragte sie mit unterdrücktem Zorn. »Ich sagte Dir doch, Du solltest nicht kommen. Was willst Du von mir?«
»So gehen wir doch hinauf,« sagte Maxime überrascht durch diesen Empfang. »Oben will ich Dir Alles sagen. Du wirst Dich erkälten.«
Da er aber bei diesen Worten eine Bewegung machte, als wollte er der Thür zuschreiten, hielt sie ihn zurück und da gewahrte er erst, daß sie entsetzlich bleich sei. Ein stummes Entsetzen schien sie zu beherrschen. Die letzten wenigen Gewänder, die sie am Leibe hatte, die Spitzen des Hemdes hingen wie tragische Fetzen um ihre erschauernden Schultern.
Er betrachtete sie mit wachsendem Staunen.
»Was ist Dir denn? Bist Du krank?«
Und instinktiv hob er die Augen empor, blickte er durch die Glasscheiben des Treibhauses zu dem Fenster des Ankleidezimmers hinüber, wo er vorhin Licht wahrgenommen.
»Ein Mann ist ja bei Dir!« sagte er mit einem Male.
»Nein, nein, es ist nicht wahr,« stammelte sie flehend und es schien ihr, als schwänden ihr die Sinne.
»Aber ich sehe ja seinen Schatten, mein Schatz!«
So verharrten sie einen Augenblick schweigend, blickten sich an und wußten nicht, was sie sagen sollten. Renée's Zähne schlugen vor Angst klappernd auf einander und es schien ihr, als göße man Ströme eiskalten Wassers über ihre nackten Füße aus. Maxime empfand größeren Zorn als er gemeint hätte; dessenungeachtet behielt er noch genügend Besonnenheit, um zu überlegen und sich zu sagen, daß die Gelegenheit für einen endgiltigen Bruch sehr günstig sei.
»Du wirst mir doch nicht weiß machen wollen, daß Céleste einen Paletot trägt,« fuhr er fort, »Wären die Glasscheiben des Treibhauses nicht so dick, so würde ich den Herrn vielleicht erkennen.«
Sie drängte ihn noch tiefer in die Dunkelheit, wobei sie mit gefalteten Händen, von wachsendem Entsetzen erfaßt, sagte:
»Ich bitte Dich, Maxime ...«
Bei diesen Worten erwachte aber die ganze Bosheit des jungen Mannes, eine wilde Bosheit, die nach Rache verlangte. Er war zu schwächlich, als daß er sich durch einen Zornesausbruch Erleichterung zu verschaffen vermocht hätte. Der Verdruß ließ ihn die Lippen zusammenpressen und statt sie zu prügeln, wie er im ersten Moment gewollt, nahm er höhnischen Tones von Neuem auf:
»Du hättest es mir sagen sollen und dann wäre ich nicht gekommen, hätte Euch nicht gestört ... Es ist ja klar wie die Sonne, daß alle Liebe verschwunden ist. Mir begann es auch bereits zu viel zu werden . .. Werde nicht ungeduldig; ich lasse Dich ja gleich wieder hinaufgehen, nur mußt Du mir den Namen dieses Herrn nennen ...«
»Nie, nie!« murmelte die junge Frau, ihr Schluchzen gewaltsam unterdrückend.
»Ich will ihn nicht fordern, nur wissen will ich ... Den Namen also, sage mir schnell den Namen und dann gehe ich.«
Er hatte sie bei den Handknöcheln erfaßt und blickte sie mit seinem boshaften Lachen an. Sie wehrte sich verzweifelt und wollte die Lippen gar nicht mehr öffnen, damit ihr der Name, den er zu erfahren wünschte, nicht unversehens entschlüpfe.
»Wird es besser sein, wenn wir Lärm machen? Und weshalb fürchtest Du Dich denn? Sind wir nicht gute Freunde? ... Ich will wissen, wer an meine Stelle getreten ist, das ist doch nur billig ... Warte, ich will Dir zu Hilfe kommen. Es ist wohl Herr von Mussy, dessen Schmerz Dein Mitleid erregte?«
Sie gab keine Antwort, sondern ließ blos den Kopf bei diesem Verhör sinken.
»Herr von Mussy ist's nicht? ... Also der Herzog von Rozan? auch nicht? ... Vielleicht der Graf von Chibray? Der ebenfalls nicht?«
Er hielt inne und schien nachzudenken.
»Teufel, ich weiß sonst Niemanden ... Nach Alledem, was Du mir gesagt hast, ist es mein Vater auch nicht ...«
Renée zuckte zusammen wie von einer Schlange gebissen und erwiderte dumpfen Tones:
»Nein, nein, Du weißt ja, daß er nicht mehr kommt. Ich hätte auch gar nicht eingewilligt, da dies schlecht wäre.«
»Wer ist es also?«
Und dabei preßte er ihre Handgelenke noch fester. Die arme Frau versuchte noch einige Sekunden Widerstand zu leisten.
»Oh, Maxime, wenn Du wüßtest! ... Ich kann Dir ja nicht sagen ...
Dann fügte sie gleichsam überwältigt und wie von Sinnen, wobei sie voll Entsetzen auf das beleuchtete Fenster blickte, leisen, gebrochenen Tones hinzu:
»Es ist Herr von Saffré.«
Maxime, der Vergnügen an seinem grausamen Spiel fand, erbleichte tödtlich bei diesem Geständnisse, welches er mit solcher Beharrlichkeit zu erpressen bemüht gewesen. Der unerwartete Schmerz, welchen ihm dieser Name eines Mannes bereitete, machte ihn wüthend. Er schleuderte die Hände Renée's heftig von sich, trat dann ganz dicht zu ihr und sein Gesicht dem ihrigen nähernd, sprach er mit auf einander gepreßten Zähnen:
»Weißt Du, Du bist eine ...«
Er sprach das Wort aus und verließ sie. Sie aber eilte ihm nach, schloß ihn schluchzend in ihre Arme, murmelte die zärtlichsten Worte, flehte ihn um seine Verzeihung an, schwor, daß sie noch immer nur ihn anbete und versprach ihm, am nächsten Tage Alles erklären zu wollen. Er befreite sich aber aus ihren Armen und warf grimmig die Thür des Treibhauses hinter sich ins Schloß, wobei er sagte:
»Alle Wetter, nein! Ich habe die Sache nun völlig satt!«
Wie niedergeschmettert blieb sie zurück und sah ihn durch den Garten davonschreiten. Dabei schien es, als führten die Bäume des Treibhauses einen wilden Tanz um sie her aus. Langsam schleppte sie sich dann mit den nackten Füßen über den Kiessand der Allee und stieg fast starr vor Frost die Stufen empor, ein Bild des Jammers in ihrer nachlässigen Gewandung. Auf die Fragen ihres Gatten erwiderte sie, daß sie sich plötzlich an eine Stelle im Treibhause erinnert habe, wo sich möglicherweise ein kleines Notizbuch befand, welches sie seit dem Morgen vermißte. Und als sie im Bette lag, ward sie mit einem Male von grenzenloser Verzweiflung erfaßt, da sie sich erinnerte, daß sie Maxime hätte sagen können, sein Vater, der mit ihr gleichzeitig nach Hause gekommen, sei ihr in ihr Zimmer gefolgt, um eine Geldangelegenheit mit ihr zu besprechen.
Am nächsten Tage beschloß Saccard, die Entwicklung des Charonner Geschäftsunternehmens zu beschleunigen. Seine Frau gehörte ihm; hatte sie doch erst vergangene Nacht sanft und hingebungsvoll in seinen Armen geruht, als wollte sie sich ihm rückhaltslos zu eigen geben. Andererseits sollte die Richtung des Boulevards des Prinzen Eugen endgiltig entschieden werden und es galt, Renée ihres Eigenthums zu berauben, bevor die bevorstehende Expropriation bekannt wurde. Saccard widmete sich dieser Angelegenheit mit der ganzen Liebe des Künstlers; andächtig sah er es mit an, wie seine Pläne reiften und seine Fallen legte er mit der Schlauheit eines Jägers, der einen Ruhm darein setzt, das Wild mit Eleganz zu fangen. Es war dies bei ihm die bloße Befriedigung des gewandten Spielers, des Mannes, den der geraubte Gewinn mit einer besonderen Wollust erfüllt. Er wollte die Grundstücke für einen Pappenstiel haben und war im Hochgefühle seines Triumphes bereit, seiner Frau für 100 000 Francs Geschenke zu machen. Die einfachsten Operationen wurden komplizirt, verwandelten sich in düstere Dramen, sobald er sich mit denselben beschäftigte; dieselben regten ihn auf und er hätte sich für ein Hundertsousstück an seinem Vater vergriffen, – dann aber streute er das Gold mit königlicher Freigebigkeit aus.
Bevor er aber von Renée die Verzichtleistung auf den ihr zufallenden Besitzantheil erwirkte, gebrauchte er die Vorsicht, bei Larsonneau in Bezug auf die Erpressungsabsichten, die er bei ihm vermuthete, die Fühlhörner auszustrecken. Sein Instinkt sollte ihn bei dieser Gelegenheit retten. Der Expropriationsagent seinerseits war der Ansicht gewesen, daß die Frucht reif sei und er sie pflücken könne; denn als Saccard in das prächtige Arbeitszimmer in der Rue de Rivoli trat, fand er seinen Genossen ganz verstört, eine Beute der größten Verzweiflung.
»Ach, mein Freund!« sprach er kläglichen Tones und erfaßte seine beiden Hände; »wir sind verloren ... Soeben wollte ich zu Ihnen eilen, um mit Ihnen zu berathen, was zu thun sei, um uns aus dieser schrecklichen Lage zu befreien ...«
Während er die Hände rang und zu schluchzen versuchte, bemerkte Saccard, daß Jener bei seinem Kommen gerade mit dem Unterschreiben von Briefen beschäftigt gewesen und daß die Unterschriften von tadelloser Reinheit waren. Er blickte ihn daher ruhig an und fragte:
»Bah! was ist denn geschehen?«
Der Andere aber antwortete nicht sofort. Er hatte sich vor seinem Schreibtisch in einen Fauteuil gleiten lassen und die Ellenbogen auf seine Schreibmappe gestützt, den Kopf zwischen beide Hände gedrückt, raufte er sich das Haar. Mit erstickter Stimme erwiderte er endlich:
»Man hat mir das Register gestohlen ... das bewußte Register ...«
Und nun begann er eine lange Geschichte zu erzählen; einer seiner Angestellten, ein Hallunke, der ins Zuchthaus kommen müßte, habe ihm eine Menge Papiere gestohlen, unter welchen sich auch das famose Register befand. Das Schlimmste an der Sache war aber, daß sich der Dieb des Vortheils bewußt ist, welchen er aus diesem Schriftstück ziehen könne und daß er dasselbe nur gegen eine Entlohnung von hunderttausend Francs herausgeben wolle.
Saccard dachte nach. Das Märchen däuchte ihm zu durchsichtig, doch focht es Larsonneau offenbar nicht an, wenn er auch durchblickt wurde. Ihm war es blos um einen einfachen Vorwand zu thun, um seinen Genossen wissen zu lassen, daß er von dem Charonner Unternehmen hunderttausend Francs haben wolle und gegen diese Summe sogar die kompromittirenden Schriftstücke zurückgeben werde, die er in Händen hatte. Der Preis dünkte Saccard zu hoch gegriffen, trotzdem er seinem ehemaligen Genossen gerne einen kleinen Gewinn hätte zukommen lassen wollen. Dieser Hinterhalt, diese Aussicht, für überrumpelt zu gelten, ärgerten ihn aber. Im Uebrigen war er ziemlich beunruhigt, denn er kannte seinen Mann und wußte, daß er sehr wohl im Stande sei, die Papiere seinem Bruder, dem Minister, zu übergeben, der zweifellos zahlen würde, nur um jeden Skandal zu unterdrücken.
»Wetter!« machte er und setzte sich gleichfalls nieder; »das ist eine vertrackte Geschichte ... Und könnte man mit dem in Rede stehenden Hallunken sprechen?«
»Ich werde ihn holen lassen,« erwiderte Larsonneau. »Er wohnt ganz in der Nähe, in der Rue Jean Lantier.«
Noch waren keine zehn Minuten vergangen, als ein kleiner, schielender junger Mann mit farblosem Haar und sommersproßigem Gesichte sachte eintrat, wobei er sorgfältig darauf achtete, daß die Thür kein Geräusch mache. Er trug einen schlechten schwarzen Rock, der ihm zu groß und schändlich abgetragen war. Er blieb in achtungsvoller Entfernung aufrecht stehen und blickte Saccard ruhig aus einem Augenwinkel an. Larsonneau, der ihn Baptistin nannte, unterzog ihn einem Verhör, welches er stets nur mit einsilbigen Worten beantwortete, ohne daß er dabei irgend welche Unruhe gezeigt hätte; ja er nahm sogar völlig gleichmüthig die verschiedenen schmeichelhaften Beinamen, als Dieb, Schurke, Galgenstrick hin, mit welchen sein Patron jede Frage glaubte begleiten zu müssen.
Saccard bewunderte die Kaltblütigkeit dieses Unglücklichen. Bei einer seiner Fragen schnellte der Expropriationsagent von seinem Fauteil empor, wie um Jenen zu schlagen und Der begnügte sich, einen Schritt zurückzutreten, wobei er noch demüthiger schielte wie bisher.
»Gut, gut, lassen Sie ihn,« sagte der Finanzmann. »Sie verlangen also hunderttausend Francs für die Rückgabe der Papiere, mein Herr?«
»Ja, hunderttausend Francs,« erwiderte der junge Mann. Und damit ging er, wahrend sich Larsonneau nicht beruhigen zu können schien.
»Hah! welch' eine Niedertracht!« sprudelte er endlich hervor, »Haben Sie die falschen Blicke des Burschen gesehen? ... Diese Hallunken haben das Aussehen einer Taube und bringen für zwanzig Francs einen Menschen um,
Saccard aber fiel ihm ohne Weiteres ins Wort, indem er sagte:
»Bah, der Mann ist nicht so schrecklich und man wird sich noch mit ihm verständigen können ... Ich bin einer viel bedenklicheren Angelegenheit wegen gekommen ... Sie hatten ganz Recht, als Sie sagten, ich möge meiner Frau nicht trauen. Stellen Sie sich nur vor, sie verkauft ihren Besitzantheil an Herrn Haffner, denn sie braucht Geld, wie sie sagt. Sicherlich hat ihre Freundin Susanne ihr diesen Rath gegeben.«
Larsonneau legte seine Verzweiflungsmiene sofort ab und seinen steifen Kragen, den er in seinem Grimm ein wenig verschoben hatte, zurechtrückend, hörte er ein wenig erbleichend zu.
»Dieser Verkauf kommt dem Ruin unserer Hoffnungen gleich. Wenn Haffner Ihr Mitbetheiligter wird, ist nicht nur unser ganzer Profit in Frage gestellt, sondern ich befürchte sogar, daß wir diesem kleinlichen Menschen gegenüber, der die Rechnungen wird prüfen wollen, in eine unangenehme Lage gerathen.«
Der Agent begann erregt in dem Gemach auf- und niederzuschreiten, wobei seine lackierten Schuhe auf dem Teppich knarrten.
»Sehen Sie, in welche Lage man geräth, wenn man den Leuten gefällig sein will!« sagte er dabei. »Ich an Ihrer Stelle, mein lieber Freund, würde meine Frau um jeden Preis verhindern, eine solche Thorheit zu begehen. Lieber möchte ich sie prügeln.«
»Ach, mein Guter,« erwiderte der Andere mit einem feinen Lächeln; »ich kann meiner Frau so wenig Vorschriften machen, wie Sie dem Anscheine nach diesem nichtswürdigen Baptistin.«
Larsonneau blieb dicht vor Saccard stehen, der noch immer lächelte und blickte ihn nachdenklich an. Dann nahm er seinen Gang durch das Zimmer von Neuem auf, doch war sein Schritt nunmehr langsam und regelmäßig. Er näherte sich einem Spiegel, zog die Schleife seiner Halsbinde zurecht und nachdem er seine ganze Eleganz wiedergewonnen, machte er neuerdings einige Schritte. Darauf rief er mit einem Male lauten Tones:
»Baptistin!«
Der kleine, schieläugige junge Mann trat wieder ein, doch durch eine andere Thür. Er hatte nicht mehr seinen Hut in der Hand, sondern eine Feder zwischen den Fingern.
»Hole das Register,« befahl ihm Larsonneau.
Und nachdem Jener gegangen, begann er über die Summe zu feilschen, die man ihm geben sollte.
»Thun Sie es mir zu Liebe,« platzte er endlich heraus.
Und nun sicherte ihm Saccard einen Antheil von dreißigtausend Francs von dem künftigen Gewinn an dem Charonner Unternehmen zu. Er hoffte noch mit einem blauen Auge von dem feinbehandschuhten Wucherer loszukommen. Letzterer ließ sich dieses Versprechen auf seinen Namen ausstellen und um die Komödie bis zu Ende durchzuführen, sagte er, daß er dem jungen Manne die dreißigtausend Francs verrechnen werde. Mit einem Lachen der Erleichterung verbrannte Saccard das Register Blatt für Blatt in dem Kaminfeuer und nachdem er diese Operation beendet, schüttelte er Larsonneau kräftig die Hand. Als er ihn verließ, sagte er noch:
»Sie gehen doch heute Abend zu Laura, nicht wahr? ... Erwarten Sie mich dort. Ich werde inzwischen Alles mit meiner Frau ordnen und dann unsere letzten Verfügungen treffen.«
Laura d'Aurigny, die ihre Wohnung häufig wechselte, hatte dazumal eine Wohnung am Boulevard Haußmann, der Bußkapelle gegenüber inne. Sie hatte ihren Empfangstag gleich den Damen aus den besten Kreisen. Auf diese Weise versammelte sie die Männer, die sie im Laufe der Woche einzeln bei sich empfing, auch auf einmal um sich. Die Dienstagsabende waren für Aristide Saccard stets ein Triumph. Er war der offizielle Liebhaber und er wendete sich mit einem ausdruckslosen Lächeln ab, wenn die Hausfrau ihn zwischen zwei Thüren hinterging, indem sie mit einem der Herren eine Zusammenkunft noch für denselben Abend vereinbarte. Wenn sich dann Alle entfernt hatten, zündete er noch eine Zigarre an, plauderte über Geschäfte, scherzte einen Augenblick über den Herrn, der auf der Straße vor Ungeduld vergehend, wartete, bis er das Haus verlassen; dann, nachdem er Laura sein »liebes Kind« genannt und ihr einen kleinen Klaps auf die Wange gegeben, entfernte er sich ruhig durch eine Thür, während der Herr durch eine andere hereinkam. Das geheime Einvernehmen, welches Saccard's Kredit gefestigt und der Aurigny in einem Monat zwei Wohnungseinrichtungen eingetragen hatte, bereitete ihnen großes Vergnügen. Laura aber wollte für die Komödie einen Abschluß finden. Dieser im Vorhinein vereinbarte Abschluß sollte in einem öffentlichen Bruch bestehen, zu Gunsten irgend eines Einfaltspinsels, der das Vorrecht, der offizielle und von ganz Paris gekannte Liebhaber Laura's zu sein, theuer bezahlen sollte. Dieser Einfaltspinsel war gefunden worden. Der Herzog von Rozan, der es satt hatte, die Frauen aus seinen Kreisen zwecklos zu Tode zu langweilen, wollte Alles aufbieten, um sich einen Ruf als Lebemann zu erwerben, der seiner abgeschmackten Figur ein gewisses Ansehen verleihen sollte. Er war ein ständiger Gast an den Dienstagen Laura's, die er durch seine absolute Naivität erobert hatte. Leider war er im Alter von fünfunddreißig Jahren noch immer von seiner Mutter abhängig, so daß er nie über mehr als zehn Louisd'ors zu verfügen vermochte. An den Abenden, da sich Laura klagend herbeiließ, seine zehn Louis anzunehmen und dabei seufzend der hunderttausend Francs gedachte, deren sie bedurfte, versprach er ihr diese Summe für den Tag, da er der alleinige Herr hier sein würde. Dies regte in ihr den Gedanken an, ihn mit Larsonneau, einem Freunde des Hauses bekannt zu machen. Die beiden Männer nahmen bei Tortoni ein Dejeuner ein und beim Dessert erwähnte Larsonneau, der sich seiner Liebschaft mit einer köstlichen Spanierin rühmte, daß er Leute kenne, welche Darlehen bewilligen; doch rathe er Rozan eindringlich, sich niemals mit denselben einzulassen. Diese vertraulichen Mittheilungen eiferten den Herzog derart an, daß er nicht eher abließ, als bis ihm sein guter Freund das Versprechen gegeben, sich mit »seiner kleinen Angelegenheit« zu beschäftigen. Und er beschäftigte sich so eingehend mit derselben, daß er ihm das Geld an demselben Abend übergeben sollte, da Saccard ein Rendezvous bei Laura mit ihm verabredet hatte.
Als Larsonneau anlangte, waren in dem in Weiß und Gold gehaltenen großen Salon der Aurigny erst fünf oder sechs Frauen anwesend, die sich seiner Hände bemächtigten, ihm um den Hals fielen, – Alles mit einer närrischen Zärtlichkeit. Sie nannten ihn »den großen Lar«, – ein Kosename im Diminutiv, welchen Laura erfunden. Und er wehrte mit süßlicher Stimme ab:
»Langsam, langsam, meine Kätzchen! Ihr werdet meinen Hut zerdrücken!«
Sie beruhigten sich und setzten sich dicht neben ihn auf einem runden Sopha, während er ihnen erzählte, daß Sylvia, mit der er gestern soupirte, heute an einer Indigestion leide. Sodann zog er eine Bonbonsdüte aus der Tasche seines Rockes und bot ihnen vom Inhalte derselben an. Jetzt kam aber Laura aus ihrem Schlafzimmer und als einige Herren anlangten, zog sie Larsonneau in ein Boudoir, welches am Ende des Salons lag und von diesem durch eine doppelte Portière getrennt war.
»Hast Du das Geld?« fragte sie, als sie mit ihm allein war.
Sie duzte ihn bei besonderen Anlässen. Larsonneau verbeugte sich ohne zu antworten, mit feierlicher Miene und pochte auf die Brusttasche seines Rockes.
»Oh! der große Lar!« murmelte die junge Frau entzückt und damit umschlang sie ihn mit beiden Armen und küßte ihn. »Warte,« sprach sie dann; »ich will die Bilderchen gleich haben ... Rozan ist in meinem Zimmer, ich werde ihn holen.«
Er aber hielt sie noch zurück und sie auf die Schulter küssend, fragte er:
»Du weißt doch, welchen Lohn ich mir von Dir bedungen habe?«
»Ei gewiß, Du großer Thor und es bleibt dabei.«
Gleich darauf kehrte sie mit Rozan zurück. Larsonneau war geschmackvoller gekleidet als der Herzog; er trug feinere Handschuhe, elegantere Halsbinden. Sie reichten einander nachlässig die Hände und plauderten über das vorgestrige Wettrennen, bei welchem das Pferd eines ihrer Freunde geschlagen worden. Laura verging fast vor Ungeduld.
»Ach, laß' doch Das, mein Freund,« sagte sie zu Rozan. »Der große Lar hat das bewußte Geld bei sich und die Sache sollte endlich zum Abschluß kommen.«
Larsonneau schien sich zu erinnern.
»Ach ja,« sagte er; »ich habe die gewünschte Summe bei mir ... Sie hätten aber klüger daran gethan, meinen Rath zu befolgen, mein Bester, denn die Räuber haben nicht weniger als fünfzig Perzent gefordert ... Ich willigte schließlich ein, da Sie mir ja sagten, daß dies nichts zu bedeuten habe ...«
Laura d'Aurigny hatte sich im Laufe des Tages gestempeltes Papier verschafft; als es sich aber um Tinte und Feder handelte, blickte sie die beiden Männer mit bestürzter Miene an, da sie daran zweifelte, diese Gegenstände in ihrem Hause zu finden. Sie wollte in der Küche nachsehen, als Larsonneau aus derselben Tasche, in welcher sich die Bonbonsdüte befunden, zwei reizend gearbeitete Gegenstände hervorholte: eine silberne Feder, die mittelst eines Schiebers zu verlängern war und ein Tintenfaß aus Stahl und Ebenholz, welches eher einem Schmuckkästchen glich. Als sich Rozan zum Schreiben niedersetzte, sagte Larsonneau:
»Stellen Sie die Wechsel auf meinen Namen aus; Sie werden es begreiflich finden, daß ich Sie nicht ins Gerede bringen wollte. Wir werden uns unter einander verständigen. Sechs Stück zu fünfundzwanzigtausend Francs, nicht wahr?«
Auf einer Ecke des Tisches zählte Laura die »Bilderchen«; Rozan selbst sah dieselben gar nicht und als er unterschrieben hatte und den Kopf emporhob, waren sie bereits in den Taschen der jungen Frau verschwunden. Diese trat jetzt auf ihn zu und küßte ihn auf beide Wangen, was ihn im höchsten Grade zu entzücken schien. Larsonneau beobachtete sie mit philosophischer Ruhe, während er die kostbaren Wechsel zusammenfaltete und sammt Feder und Tintenfaß in seine Tasche barg.
Die junge Frau hing noch am Arme des Herzogs, als Aristide Saccard die Portière zurückschlug und beim Anblick des Liebespärchens lachend sagte:
»Ach, ich bitte sich keinen Zwang anzuthun.«
Der Herzog erröthete, Laura aber schüttelte die Hand des Spekulanten, wobei sie verständnißvoll mit den Augen zwinkerte. Ihr Gesicht strahlte vor Freude.
»Es ist geschehen, mein Lieber,« sprach sie dabei. »Ich hatte Sie ja gewarnt. Zürnen Sie mir nicht zu sehr?«
Saccard zuckte mit gutmüthiger Miene die Achseln. Er schlug die Portière zurück und zur Seite tretend, um Laura und dem Herzog den Weg freizugeben, rief er mit der schallenden Stimme eines Thürstehers:
»Herzog von Rozan sammt Gemahlin!«
Der Scherz hatte einen riesigen Erfolg. Am nächsten Tage verzeichneten die Morgenblätter denselben, wobei sie Laura d'Aurigny unverblümt beim Namen nannten und die beiden Männer mit sehr durchsichtigen Anfangsbuchstaben bezeichneten. Der Bruch zwischen Aristide Saccard und der dicken Laura erregte noch größeres Aufsehen, als ihre vermeintliche Liebschaft.
Nach seinem Scherz, welcher im Salon einen ungeheuren Heiterkeitserfolg erzielte, lies Saccard die Portiere hinter dem Pärchen fallen und sich zu Larsonneau wendend, sagte er:
»Gelt, ein gutes Mädchen? Eine wahre Künstlerin! ... Und Sie Duckmäuser, Sie genießen wohl den eigentlichen Vortheil? Was kriegen Sie für Ihre Vermittelung?«
Jener aber wehrte lächelnd ab und zog dabei an seinen Manschetten, bis dieselben unter dem Rockärmel hervorlugten. Darauf ließ er sich in der Nähe der Thür auf ein Sopha nieder, auf welchem bereits Saccard saß, der gutmüthigen Tones fortfuhr:
»Setzen Sie sich hierher ... es fällt mir nicht ein Sie zu verhören ... Wir wollen lieber über ernstere Dinge sprechen. Ich hatte heute Abend eine lange Verhandlung mit meiner Frau ... Alles ist in Ordnung.«
»Sie willigt ein, ihren Antheil abzutreten?« fragte Larsonneau.
»Ja; doch hat das schwere Mühe gekostet ... Die Frauen sind von einer unglaublichen Hartnäckigkeit! Sie wissen ja, die meinige hatte einer alten Tante das Versprechen gegeben, daß sie nichts verkaufen werde und so gab es da zahllose Skrupel zu zerstreuen ... Glücklicherweise hatte ich mir eine unwiderstehliche Geschichte zurechtgelegt.«
Er erhob sich bei diesen Worten, um eine Zigarre an dem Kandelaber anzuzünden, welchen Laura auf den Tisch gestellt hatte; und sich darauf behaglich auf dem Sopha zurücklehnend, fuhr er fort:
»Ich sagte meiner Frau, daß Sie zu Grunde gerichtet seien ... Sie haben an der Börse gespielt, Ihr Geld mit leichtfertigen Dämchen durchgeschlagen, sich in schlechte Spekulationen eingelassen und sind endlich auf dem Punkte angelangt, einen scheußlichen Bankerott zu machen ... Ich ließ sogar durchblicken, daß ich nicht an eine zweifellose Rechtlichkeit Ihrerseits glaube... Darauf setzte ich ihr auseinander, daß das Unternehmen in Charonne durch Ihren Untergang gleichfalls zu Grunde gehen müsse und daß es am besten wäre, den Vorschlag anzunehmen, welchen Sie mir gemacht, nämlich meine Frau dadurch zu entlasten, daß Sie ihren Antheil – allerdings für einen Pappenstiel – übernehmen.
»Das ist nicht sehr schlau erfunden,« meinte der Expropriationsagent. »Und Sie denken, daß Ihre Frau solchen Unsinn glauben wird?«
Saccard lächelte. Er befand sich heute in mittheilsamer Stimmung.
»Sie sind zumindest naiv zu nennen, mein Guter,« erwiderte er. »Die eigentliche Geschichte hat im Grunde genommen nichts zu bedeuten; die Details, der Vortrag, Gesten und Ausdrucksweise geben den Ausschlag. Holen Sie mir Rozan her und ich wette mit Ihnen, daß er sich überzeugen läßt, daß wir jetzt Mittag haben. Und bei meiner Frau ist nicht mehr Witz vorhanden, als bei Rozan ... Ich zeigte ihr die Abgründe, an deren Rand wir stehen. Von der bevorstehenden Expropriation hat sie keine Ahnung. Und als sie darüber staunte, daß Sie dicht vor einer Katastrophe stehend, noch daran denken konnten, eine vermehrte Last zu übernehmen, sagte ich ihr, daß Sie Ihren Gläubigern jedenfalls einen boshaften Streich zu spielen gesonnen seien und sie Ihnen dabei zweifellos hinderlich wäre ... Und zum Schluß rieth ich ihr, den Vorschlag anzunehmen, da ich denselben für das einzige Mittel ansehe, sie vor endlosen Plackereien zu bewahren und noch einiges Geld aus den Grundstücken herauszuschlagen.«
Larsonneau fand die Geschichte noch immer ein wenig brutal. Er war ein Freund der wenig dramatischen Methode; jede seiner Operationen wurde mit der Eleganz einer Salonkomödie angelegt und zur Lösung gebracht.
»Ich hätte etwas Anderes erfunden,« behauptete er. »Schließlich aber hat Jedermann sein System ... Wir haben also nichts weiter zu thun als zu zahlen.«
»Hierüber möchte ich mich noch mit Ihnen verständigen,« gab Saccard zur Antwort. »Morgen lege ich meiner Frau die Abtrittserklärung behufs Unterschrift vor und sie wird Ihnen dieselbe blos einhändigen lassen müssen, um den vereinbarten Preis zu beheben ... Ich ziehe es nämlich vor, keinerlei Zusammenkunft zwischen Ihnen und meiner Frau zu bewerkstelligen.«
Thatsächlich hatte er es so einzurichten verstanden, daß Larsonneau in seinem Hause niemals festen Fuß fassen konnte. Er lud ihn niemals ein und begleitete ihn stets zu Renée, wenn eine Unterredung der beiden Geschaftstheilhaber unvermeidlich geworden, was höchstens dreimal der Fall gewesen. Er arbeitete beinahe ausschließlich als Bevollmächtigter seiner Frau, da er der Ansicht war, daß sie seine Geschäftsangelegenheiten nicht allzu genau kennen dürfe.
Er öffnete seine Brieftasche und fügte hinzu:
»Hier haben Sie die von meiner Frau unterschriebenen Wechsel über 200 000 Francs, welche Sie ihr an Zahlungsstatt übergeben und dann weitere 100 000 Francs hinzufügen werden, welche ich Ihnen morgen früh einhändigen werde. Ich verblute mich, mein Freund. Diese Geschichte kostet mir ein heidenmäßiges Geld.«
Dies ergibt aber blos eine Summe von 300 000 Francs,« bemerkte der Expropriationsagent. »Wird die Quittung über diese Summe lauten?«
»Eine Quittung über 300 000 Francs?« lachte Saccard. »Sehr gut! Das gäbe eine schöne Geschichte! Im Sinne unserer Inventarien muß die Besitzung heute einen Werth von 2 500 000 Francs repräsentiren und somit wird die Quittung über die Hälfte dieses Betrages lauten.«
»Ihre Frau wird dieselbe niemals unterschreiben.«
»Doch! Ich sage Ihnen ja, daß Alles bereits geordnet ist ... Ich sagte ihr, daß dies Ihre erste Bedingung sei. Sie setzen uns mit Ihrem Bankerott die Pistole auf die Brust, verstehen Sie denn nicht? Und hierbei schien ich an Ihrer Rechtlichkeit zu zweifeln und beschuldigte ich Sie, daß Sie Ihre Gläubiger hintergehen wollten ... Versteht denn meine Frau von all' diesen Dingen etwas?«
Larsonneau wiegte den Kopf und erwiderte:
»Gleichviel; Sie hätten etwas Einfacheres vorbringen müssen.«
»Aber meine Geschichte ist ja die Einfachheit selbst!« sagte Saccard auf's Höchste erstaunt. »Wo sehen Sie etwas Verwickeltes in derselben?«
Er war sich der unglaublichen Menge von Fäden gar nicht bewußt, welche er an die gewöhnlichste, an die einfachste Sache knüpfte. Er freute sich mit einer wahren Wonne über die lächerliche Geschichte, die er Renée aufgebunden hatte und was ihn am meisten entzückte, war die Frechheit der Lüge, die Anhäufung der Unmöglichkeiten, die erstaunliche Komplikation der Intrigue selbst. Schon seit langer Zeit wäre dieser Bodenbesitz in seine Hände übergegangen, wenn er nicht dieses ganze Drama aufgebaut hätte; doch würde er weit weniger Vergnügen empfunden haben, wenn er sich desselben auf leichte Weise zu bemächtigen vermocht hätte. Im Uebrigen betrieb er es mit der größten Naivetät, aus der Charonner Spekulation ein finanzielles Melodrama zu gestalten.
Er stand auf, zog den Arm seines Genossen unter den seinigen und dem Salon zuschreitend, fragte er:
»Sie haben mich doch verstanden, wie? Beschränken Sie sich darauf, meinen Weisungen zu folgen und Sie werden mir nachher Ihren Beifall nicht versagen ... Sehen Sie, mein Lieber, es ist nicht gut, daß Sie gelbe Handschuhe tragen, denn die behindern Sie in der freien Bewegung der Hand.«
Der Andere aber begnügte sich mit der lächelnd gegebenen Erwiderung:
»Oh, die Handschuhe, theurer Meister, haben auch ihr Gutes, denn man kann an Alles rühren, ohne sich zu beschmutzen.«
Als sie in den Salon traten, fand Saccard zu seiner Ueberraschung und theilweisen Beunruhigung seinen Sohn Maxime jenseits der Portiére. Der junge Mann saß auf einem Sopha neben einer blonden Dame, die ihm mit eintöniger Stimme eine lange Geschichte, sicherlich die ihrige, erzählte. Er hatte das Gespräch zwischen seinem Vater und Larsonneau vernommen; die beiden Genossen bildeten seiner Ansicht nach ein sauberes Paar. Noch aufgebracht über den Verrath Renée's, bereitete es ihm eine feige Freude, als er erfuhr, welchem Raub sie zum Opfer fallen sollte. Dies rächte ihn ein wenig. Sein Vater trat auf ihn zu und drückte ihm mit argwöhnischer Miene die Hand; Maxime aber flüsterte ihm auf die blonde Dame deutend, ins Ohr:
»Sie ist nicht übel, wie? Ich gedenke den heutigen Abend mit ihr zu verbringen.«
Nun wurde Saccard heiter und gesprächig. Laura d'Aurigny schloß sich ihnen auch einen Augenblick an, wobei sie sich beklagte, daß Maxime sich kaum bei ihr blicken lasse. Er sagte aber, er sei sehr beschäftigt gewesen, worüber Jedermann herzlich lachte. Dann fügte er hinzu, daß man ihn fortan sehr häufig sehen werde.
»Ich habe eine Tragödie geschrieben,« sagte er; »und den fünften Akt erst gestern gefunden ... Ich gedenke bei allen schönen Frauen von Paris Erholung zu suchen.«
Er lachte und freute sich selbst über seine Anspielungen, die nur er allein verstehen konnte. Im Salon waren nur mehr Rozan und Larsonneau zugegen, die am Kamin lehnten. Die beiden Saccard, Vater und Sohn erhoben sich, ebenso die blonde Dame, die im Hause wohnte. Nun begann die Aurigny leise mit dem Herzog zu sprechen, der überrascht und ärgerlich schien. Als sie sah, daß er sich noch immer nicht entschließen konnte, seinen Fauteuil zu verlassen, sagte sie halblaut:
»Nein, heute Abend wirklich nicht ... Ich kann nicht, denn ich habe Migraine ... Doch morgen, ich verspreche es Ihnen.«
Rozan mußte gehorchen. Laura wartete, bis er die Treppe erreicht, worauf sie Larsonneau lebhaft zuraunte:
»Gelt, großer Lar, ich kann Wort halten ... Expediere ihn doch in seinen Wagen.«
Als sich die blonde Dame von den Herren verabschiedete, um sich in ihre ein Stockwerk höher liegende Wohnung zu begeben, gewahrte Saccard zu seinem Erstaunen, daß ihr Maxime nicht folge.
»Nun?« fragte er ihn.
»Ach nein,« erwiderte der junge Mann; »ich hab' es mir überlegt.«
Dann meinte er einen drolligen Einfall zu haben, denn er fügte hinzu:
»Ich überlasse Dir meinen Platz, wenn Du willst. Beeile Dich, sie hat ihre Thür noch nicht geschlossen.«
Der Vater aber zuckte leicht mit den Achseln und erwiderte:
»Danke, mein Kleiner; ich habe jetzt etwas Besseres.«
Die vier Männer stiegen die Treppe hinab. Unten wollte der Herzog um jeden Preis, Larsonneau solle zu ihm in den Wagen steigen; seine Mutter wohnte im Marais und er wollte den Agenten vor seinem Hause in der Rue de Rivoli absetzen. Dieser aber lehnte ab, schloß die Thür und befahl dem Kutscher nach Hause zu fahren, worauf er mit den beiden Anderen auf dem Trottoir weiterplauderte, ohne Miene zu machen, sich zu entfernen.
»Ach, der arme Rozan!« sagte Saccard, dem mit einem Male Alles klar wurde.
Larsonneau schwor, daß er sich täusche; er sei ein nüchtern denkender Mann, dem an derlei Dingen nichts gelegen sei. Da die beiden Anderen aber nicht aufhörten zu witzeln und die Kälte sehr empfindlich war, rief er endlich aus:
»Meine Treu, umso schlimmer, ich läute an ... Sie sind indiscret, meine Herren.«
»Gute Nacht!« rief ihm Maxime nach, als sich das Hausthor hinter ihm geschlossen hatte.
Und den Arm seines Vaters ergreifend, schritt er mit ihm den Boulevard hinan. Die Nacht war hell und kalt und es ging sich so angenehm in der eisigen Luft, auf dem hart gefrorenen Boden dahin. Saccard sagte, Larsonneau handle thöricht; er müßte sich begnügen, blos der Kamerad der Aurigny zu sein. Dies bildete für ihn den Ausgangspunkt, um zu erklären, daß die Liebeleien all' dieser Dämchen in Wahrheit schlimm und gefährlich seien. Er war moralisch gestimmt und was er sprach, überfloß vor Weisheit und Enthaltsamkeit.
»Siehst Du,« sprach er zu seinem Sohne; »dies taugt nur für eine kurze Zeit, mein Kleiner... Man büßt dabei seine Gesundheit ein, ohne des wahren Glückes theilhaftig zu werden. Du weißt, daß ich kein Spießbürger bin und dennoch hab' ich die Sache satt.«
Maxime lachte, hielt seinen Vater an und ihn beim Scheine des Mondes betrachtend, erklärte er, daß er eine ergötzliche Figur mache. Saccard aber wurde nur noch ernster. »Scherze so viel Du willst. Ich sage Dir, daß man nur durch die Ehe konservirt und glücklich gemacht wird.«
Darauf begann er von Luise zu sprechen. Er schritt dabei langsamer, um, wie er sagte, die Sache zu erledigen, da man schon von derselben spreche. Die Angelegenheit war bereits vollkommen geordnet. Er theilte ihm auch mit, daß er mit Herrn von Mareuil die Unterzeichnung des Kontraktes für den auf Mittfastendonnerstag folgenden ersten Sonntag festgesetzt habe. Am Donnerstag sollte im Hôtel am Monceau-Parke eine große Festlichkeit abgehalten werden und hiebei würde er die Verlobung öffentlich bekannt machen. Maxime war mit Allem einverstanden. Er hatte sich Renée's entledigt, Hindernisse waren nicht mehr vorhanden und er würde sich durch seinen Vater leiten lassen, wie er sich durch seine Stiefmutter hatte leiten lassen.
»Einverstanden,« sagte er; »nur erwähne Renée gegenüber nichts von der Sache. Ihre Freundinen würden mich necken, mich verspotten und es wäre mir lieb, wenn sie die Sache gleichzeitig mit den Anderen erfahren würden.«
Saccard versprach ihm zu schweigen. In der Nähe des Boulevard Malesherbes angelangt, ertheilte er ihm neuerdings eine Menge der vortrefflichsten Rathschläge; er unterwies ihn vor Allem, auf welche Weise er sich zu benehmen habe, um aus seinem ehelichen Leben ein Paradies zu gestalten.
»Vor Allem darfst Du niemals mit Deiner Frau brechen. Dies ist eine große Thorheit. Eine Frau, mit welcher man nicht mehr verkehrt, verursacht die ungeheuerlichsten Geldausgaben ... Man muß eine Person aushalten, nicht wahr? Die Ausgaben im Haushalte sind auch bedeutend größere: die Toiletten, die Vergnügungen der Frau Gemahlin, dann die guten Freundinen und sofort, was drum und dran hängt.«
Er befand sich in einer ungeheuer tugendhaften Stimmmung. Der Erfolg, den er mit seiner Charonner Spekulation erzielt hatte, stimmte ihn idyllisch zärtlich.
»Ich,« fuhr er fort; »ich bin geboren, um mit meiner Familie glücklich und sorglos in irgend einem Provinzstädtchen dahinzuleben ... Man kennt mich eben nicht, mein Kleiner ... Und man hält mich für Einen, der in der Welt herumlaufen will ... Nun denn, man täuscht sich eben; denn am liebsten möchte ich nur für meine Frau leben, den Geschäften den Rücken wenden und mich mit einer bescheidenen Rente nach Plassans zurückziehen ... Du wirst reich sein, gründe Dir mit Luisen ein Heim, in welchem Ihr wie die Turteltauben leben werdet. Das ist ja so gut! Ich werde Euch besuchen und das wird mir so wohl thun.«
Seine Stimme klang wie von Thränen verschleiert. Sie waren vor dem Hôtel angelangt und plauderten am Rande des Trottoirs stehend. Hier blies ein ziemlich scharfer Wind, doch sonst war kein Laut inmitten der eisigen Nacht zu vernehmen. Ueberrascht durch die ungewohnte rührselige Stimmung seines Vaters vermochte Maxime eine Frage nicht zu unterdrücken, die ihm seit einer Weile auf den Lippen lag.
»Aber Du selbst? Es scheint mir doch ...«
»Was denn?«
»Mit Deiner Frau ...«
Saccard zuckte die Achseln, als er zur Antwort gab:
»Ja, allerdings ... Ich war eben thöricht und darum kann ich aus eigener Erfahrung sprechen ... Doch haben wir uns mit einander ausgesöhnt; vollkommen sogar. Es mögen an sechs Wochen her sein. Wenn ich des Abends nicht zu spät nach Hause komme, so gehe ich zu ihr. Heute freilich wird sich der arme Schelm ohne mich bescheiden müssen, denn ich habe während der ganzen Nacht zu arbeiten. Sie ist allerliebst geformt ...« Maxime reichte ihm die Hand. Saccard behielt dieselbe in der seinigen und fügte leiser, vertraulichen Tones hinzu:
»Du kennst doch die Taille der Blanche Müller? Nun, die ihrige ist zehnmal schöner. Und die Hüften erst! die sind von einer Zartheit, einer Rundung ...«
Und als sich der junge Mann bereits entfernte, schloß er etwas lauter:
»Du bist wie ich, Du hast ein Herz ... Deine Frau wird glücklich sein ... Auf Wiedersehen, mein Kleiner!«
Als sich Maxime endlich seines Vaters entledigt hatte, schritt er rasch durch den Park. Was er da vernommen, überraschte ihn in solchem Maße, daß er das unwiderstehliche Bedürfniß empfand, Renée zu sehen. Er wollte sie für seine Brutalität um Verzeihung bitten, in Erfahrung bringen, weshalb sie gelogen, als sie ihm Herrn von Saffré genannt, die der Zärtlichkeit ihres Gatten zu Grunde liegenden Motive kennen lernen. All' Dies wirbelte aber toll durch seinen Kopf und er war sich nur des einen Wunsches klar bewußt, daß er bei ihr eine Zigarre rauchen und ihre frühere Kameradschaft erneuern wollte. Wenn sie sich in der richtigen Stimmung befand, so wollte er ihr sogar seine bevorstehende Vermählung ankündigen, um ihr begreiflich zu machen, daß ihre Liebesbeziehungen todt und begraben bleiben müßten. Als er die kleine Thür öffnete, deren Schlüssel er glücklicherweise behalten hatte, sagte er sich, daß nach den Mittheilungen seines Vaters sein Besuch ebenso nothwendig als schicklich sei.
Im Treibhause pfiff er wie Abends bevor, brauchte aber nicht zu warten. Renée öffnete sofort die Glasthür des kleinen Salons und stieg ihm die Treppe voran hinauf, ohne ein Wort zu sprechen. Sie war soeben von einem Balle heimgekehrt, der im Stadthause abgehalten worden und trug noch ihre Robe aus weißem wallendem Tüll, über welchen seidene Schleifen ausgestreut waren, während die Einfassung des Leibchens eine breite Spitze aus weißen Schmelzperlen bildete, welche in dem Lichte der Kandelaber ins Blaue und Rosafarbene spielten. Als Maxime sie anblickte, ward er gerührt durch ihre Blässe, durch die tiefe Bewegung, die ihre Stimme erstickte. Sie konnte ihn nicht erwartet haben und bebte am ganzen Leibe, als sie ihn wie sonst anlangen sah, ruhig, mit seiner schmeichelnden Miene. Céleste kehrte aus der Garderobe zurück, von wo sie ein Nachthemd geholt hatte, und die Liebenden schwiegen noch immer, da sie darauf warteten, daß sich die Dienerin entferne. Gewöhnlich thaten sie sich vor ihr keinen Zwang an; die Dinge aber, die sie einander zu sagen hatten, erweckten ihr Schamgefühl. Renée wollte sich von Céleste im Schlafzimmer entkleiden lassen, da dort ein helles Feuer brannte. Die Zofe entfernte die Nadeln, nestelte die Röcke los, einen nach dem andern, ohne sich zu beeilen und Maxime griff gelangweilt, scheinbar unbewußt nach dem Hemde, welches neben ihm auf einem Stuhl lag und begann es mit ausgebreiteten Armen, vornübergebeugt am Feuer zu wärmen. Diese kleinen Dienstleistungen hatte er Renée schon früher, in ihren glücklichen Tagen erwiesen. Sie ward von Rührung erfaßt, als sie ihn das Hemd behutsam an's Feuer halten sah. Und da Céleste noch immer nicht fertig werden wollte, fragte er:
»Hast Du Dich auf dem Ball gut unterhalten?«
»Ach nein; Du weißt ja, es ist immer dieselbe Geschichte,« gab sie ihm zur Antwort. »Es waren viel zu viel Leute da; eine förmliche Völkerwanderung.«
Er wendete jetzt das Hemd, welches auf einer Seite bereits erwärmt war.
»Was für Toilette hatte Adeline?«
»Eine herzlich geschmacklose malvenfarbene Robe ... Sie ist klein und hat eine sinnlose Vorliebe für breite Volants.«
Dann sprachen sie über andere Frauen und Maxime verbrannte sich fast die Finger mit dem Hemd. »Du wirst es noch versengen,« sagte Renée mit mütterlich kosender Stimme.
Céleste nahm das Hemd aus den Händen des jungen Mannes. Dieser richtete sich empor, betrachtete das große, grau-rosafarbene Bett und vertiefte sich in die Besichtigung des Tapetenmusters, um den Kopf abgewendet zu halten, damit er die nackten Brüste Renée's nicht sehe. Er that dies ganz instinktiv, denn da er sich nicht mehr für ihren Geliebten hielt, so hatte er auch kein Recht mehr, zu sehen. Darauf nahm er eine Zigarre hervor und zündete sie an; Renée hatte ihm die Erlaubniß gegeben, bei ihr zu rauchen. Endlich zog sich Céleste zurück, nachdem sich die junge Frau in ihrem schneeweißen Nachtgewande vor dem Feuer niedergelassen hatte.
Schweigend schritt Maxime einige Minuten auf und nieder, wobei er verstohlen Renée beobachtete, die von einem abermaligen Schauer erfaßt zu sein schien. Dann stellte er sich vor sie hin und die Zigarre zwischen den Zähnen haltend, fragte er harten Tones:
»Weshalb hast Du mir nicht gesagt, daß es mein Vater gewesen, der gestern bei Dir war?«
Sie hob den Kopf empor und ihre weit geöffneten Augen hatten einen Ausdruck höchster Angst. Dann schoß ihr eine Blutwelle ins Gesicht und fast vergehend vor Scham, schlug sie beide Hände vor die Augen, während sie stammelte:
»Du weißt das? Du weißt es?«
Sie sammelte all' ihren Muth und versuchte zu leugnen:
»Das ist nicht wahr ... Wer hat es Dir gesagt?«
Maxime zuckte die Achseln.
»Wer? mein Vater selbst, der Dich allerliebst geformt findet und mit mir über Deine Hüften sprach.«
Er hatte einigen Verdruß durchblicken lassen. Nun begann er aber wieder auf- und abzuschreiten und fuhr mit freundschaftlich scheltender Stimme zu sprechen fort, wobei er von Zeit zu Zeit einen Zug aus seiner Zigarre that:
»Wahrhaftig, ich verstehe Dich nicht; Du bist eine eigenthümliche Frau. Es ist Deine Schuld, wenn ich gestern grob war. Wenn Du mir gesagt hättest, daß es mein Vater sei, so wäre ich ruhig fortgegangen, denn ich habe doch keine Rechte. Du aber sagtest mir, es sei Herr von Saffré!«
Die Hände vor das Gesicht gedrückt, schluchzte sie. Er näherte sich ihr, kniete vor ihr nieder und entfernte mit sanfter Gewalt ihre Hände.
»Laß hören, sprich, weshalb hast Du Herrn von Saffré genannt?«
Sie wendete den Kopf noch mehr ab und erwiderte mit vor Thränen erstickter Stimme leise:
»Ich dachte, Du würdest mich verlassen, wenn Du wüßtest, daß Dein Vater ...«
Er stand auf, ergriff seine Zigarre, die er auf eine Ecke des Kamins gelegt hatte und begnügte sich zu sagen:
»Du bist aber doch recht komisch ...«
Sie weinte nicht mehr. Die Flammen des Kamins und das Feuer ihrer Wangen hatte ihre Thränen getrocknet. Ihr Staunen ob der Ruhe Maxime's angesichts einer Enthüllung, welche ihn, wie sie gemeint, zu Boden schmettern würde, ließ sie ihre Beschämung vergessen. Wie in einem Traume sah sie ihn auf- und abgehen, hörte sie ihn sprechen. Ohne die Zigarre aus dem Munde zu nehmen, wiederholte er ihr, daß sie nicht recht gescheidt sei, daß er es ganz natürlich finde, wenn sie Beziehungen zu ihrem Gatten unterhalte und daß er doch gar nicht daran denken könne, ihr dies übelzunehmen. Dagegen könne er es nicht fassen, daß sie sich auf einen Liebhaber ausrede, ohne daß sie einen solchen habe! Und immer wieder kehrte er zu diesem Gegenstande zurück, welchen er nicht begreifen konnte und der ihm wahrhaftig ungeheuerlich erschien; dann machte er einige Bemerkungen über die »tollen Phantastereien« der Frauen.
»Du bist ein wenig rappelig, meine Theure; da muß Abhilfe getroffen werden.«
Schließlich fragte er neugierig:
»Aber weshalb gerade Saffré und kein Anderer?«
»Weil er mir den Hof macht,« erwiderte Renée.
Maxime unterdrückte eine impertinente Bemerkung; er wollte sagen, sie habe sich wahrscheinlich um einen Monat älter gehalten, als sie Herrn von Saffré für ihren Liebhaber ausgab. Indessen kam blos das Lächeln über diese Bosheit zum Vorschein und indem er seine Zigarre ins Feuer warf, ließ er sich auf der anderen Ecke des Kamins nieder, worauf er Moral zu predigen begann und Renée zu verstehen gab, daß sie weiter gute Freunde bleiben müßten. Der beharrliche Blick der jungen Frau setzte ihn indessen einigermaßen in Verlegenheit, so daß er von der projektirten Heirath nicht zu sprechen wagte. Lange betrachtete sie ihn, während noch Thränen an ihren Wimpern hingen. Sie fand, daß er unbedeutend, verächtlich, beschränkten Geistes sei und dessenungeachtet liebte sie ihn, wie sie etwa ihre Spitzen liebte. Er erschien ihr so hübsch in dem Lichte des Kandelabers, der neben ihm am Rande des Kamins stand und als er den Kopf zurücklehnte, vergoldete der sanfte Kerzenschimmer seine Haare, glitt über sein Gesicht und färbte die leicht beflaumte Wange mit zarten Schatten.
»Nun muß ich doch aber gehen,« sagte er zu wiederholten Malen.
Er war entschlossen nicht zu bleiben; auch hätte ihn Renée nicht mögen. Beide dachten und sagten es sich: sie waren nur mehr zwei Freunde. Und als Maxime endlich die Hand der jungen Frau gedrückt und im Begriffe war, das Zimmer zu verlassen, hielt sie ihn noch einen Augenblick zurück. Sie sprach von seinem Vater, dem sie hohes Lob spendete.
»Siehst Du, ich hatte schwere Gewissensbisse und bin beinahe froh, daß es so gekommen ... Du kennst Deinen Vater nicht und auch ich war ganz erstaunt, als ich erfuhr, wie gut, wie uneigennützig er ist. Und dabei hat der arme Mann gegenwärtig so große Sorgen!«
Maxime betrachtete schweigend, mit verlegener Miene die Spitzen seiner Stiefel, während sie zu sprechen fortfuhr:
»So lange er nicht in dieses Zimmer kam, war er mir gleichgiltig. Hernach aber ... Als ich ihn hier sah, wie er in liebevoller Sorge mir Gelder herbeischaffte, die er vielleicht nur mit schwerer Mühe aufbringen konnte, wie er sich zu Grunde richtete, ohne mit einem Worte zu klagen, – da wurde ich ordentlich krank ... Wenn Du wüßtest, mit welcher Sorgfalt er meine Interessen wahrgenommen!«
Langsam kehrte der junge Mann zu dem Kamin zurück und lehnte sich an denselben. Seine Miene war noch immer ein wenig verlegen und den Kopf hielt er mit einem leisen Lächeln gesenkt, welches immer deutlicher hervortrat. Dann meinte er:
»Ach ja, mein Vater ist sehr gewandt, wo es sich darum handelt, die Interessen anderer Leute zu wahren.«
Der Ton, in welchem Dies gesagt worden, überraschte Renée. Sie blickte ihn an, während er, wie um sich zu entschuldigen, hinzusetzte:
»Oh, ich weiß gar nichts ... Ich sage nur, daß mein Vater ein gewandter Mann ist.«
»Du thätest Unrecht, wenn Du ihm Uebles nachsagen wolltest,« nahm sie von Neuem auf. »Du beurtheilst ihn wohl ein wenig oberflächlich ... Wenn ich Dir von all' seinen Verlegenheiten Mittheilung machen und Dir wiederholen wollte, was er mir erst heute Abend anvertraute, so würdest Du einsehen, wie sehr man sich täuscht, wenn man meint, daß ihm etwas am Geld gelegen sei ...«
Maxime konnte ein Zucken der Schultern nicht unterdrücken; dann fiel er seiner Stiefmutter mit einem ironischen Lachen ins Wort.
»Ach laß doch, ich kenne ihn, kenne ihn besser als Du ... Er mag Dir ja recht erbauliche Dinge gesagt haben. Erzähle es mir doch einmal.«
Der spöttische Ton verletzte sie und sie verstieg sich noch höher in ihren Lobeserhebungen. Sie erklärte, ihr Gatte sei ein großer Mann, sprach von dem Charonner Unternehmen, von dem ganzen Schwindel, von dem sie kein Wort verstanden, wie von einer Katastrophe, in welcher ihr die hohe Güte und Intelligenz Saccard's offenbar geworden. Sie fügte hinzu, daß sie am nächsten Tage die Verzichtsurkunden unterschreiben werde und wenn dies thatsächlich ein Unglück sei, so nehme sie es hin als eine Strafe für ihre Fehltritte. Maxime ließ sie sprechen; nur von Zeit zu Zeit lachte er auf und sagte mit halblauter Stimme:
»Es stimmt, das ist es ...«
Und lauter fügte er hinzu, indem er die Hand auf Renée's Schulter legte:
»Ich danke Dir, meine Liebe; ich kannte die Geschichte aber schon ... Du bist die gutmüthige Thörin, nicht er der Thor.«
Und wieder schickte er sich zum Gehen an. Er empfand einen grimmigen Drang, ihr Alles zu erzählen. Sie hatte ihn durch die ihrem Gatten gespendeten Lobsprüche erzürnt und er vergaß ganz, daß er sich selbst Schweigen gelobt, um allen Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen.
»Wie? was willst Du damit sagen?« fragte sie.
»Ei, alle Wetter, daß Dich mein Vater auf die niedlichste Art von der Welt am Gängelbands führt ... Du thust mir wirklich leid; Du bist zu ungeschickt!«
Und damit begann er ihr zu erzählen, was er bei Laura gehört; er erzählte es feige, hinterlistig und freute sich insgeheim darüber, daß er in diesen Infamien wühlen konnte. Es schien ihm dabei, als rächte er sich damit für eine geheime Beleidigung, die man ihm angethan. Sein weibisches Temperament erlabte sich in thierischer Wollust an dieser Denunziation, an diesem grausamen Geschwätz, welches er hinter einer Thür erlauscht. Er ersparte Renée nichts, – weder das Geld, welches ihr Gatte ihr auf Wucherzinsen vorgestreckt, noch jenes andere, welches er ihr durch lächerliche Geschichten, die für ein Ammenmärchen zu schlecht waren, entlocken wollte. Leichenblaß hörte ihm die junge Frau zu, ihre Lippen waren dabei fest über einander gepreßt. Vor dem Kamin stehend, blickte sie gesenkten Hauptes in das Feuer; dabei hatte sich ihr Nachtgewand, das Hemd, welches Maxime gewärmt hatte, ein wenig verschoben und ließ die regungslosen Formen einer Marmorstatue sehen.
»Ich sage Dir das Alles,« schloß der junge Mann, »damit Du nicht blindlings in die Falle gehst ... Meinem Vater aber brauchst Du darum nicht zu zürnen, denn er ist so böse nicht. Er hat nur seine Fehler, wie jeder Mensch ... Auf Wiedersehen also!«
Damit schritt er der Thür zu, Renée aber hielt ihn durch eine Geberde zurück.
»Bleibe!« rief sie dabei gebieterischen Tones.
Und ihn an sich ziehend, drückte sie ihn vor dem Feuer beinahe auf ihre Kniee nieder, küßte ihn auf den Mund und sagte:
»Das wäre doch zu lächerlich, wenn wir uns jetzt noch irgendwelchen Zwang anthun wollten ... Du weißt wohl nicht, daß ich seit gestern, seitdem Du mit mir brechen wolltest, nicht mehr recht bei Sinnen war? Ich bin wie verrückt. Heute Abend hatte ich einen Schwindelanfall auf dem Ball. Ich habe Dich nöthig, um leben zu können. Wenn Du von mir gehst, werde ich vernichtet sein ... Lache nicht; ich sage Dir blos, was ich empfinde.«
Sie blickte ihn mit unendlicher Zärtlichkeit an, als hätte sie ihn schon lange nicht gesehen.
»Du hast das richtige Wort gefunden, ich war ungeschickt und Dein Vater hätte mir Alles, was er wollte, weismachen können. Konnte ich denn eine Ahnung haben? Während er mir seine Geschichte vortrug, vernahm ich nur ein dumpfes Brausen in den Ohren und ich war derart jedes freien Willens bar, daß ich seine Papiere selbst auf den Knieen liegend unterschrieben hätte, wenn er es verlangt hätte. Und ich bildete mir ein, daß ich Gewissensbisse hatte! ... Es war doch zu lächerlich ...«
Sie lachte laut auf und der Ausdruck des Wahnsinns erschien in ihren Augen. Sie preßte den Geliebten noch inniger an sich und fuhr fort:
»Verüben wir denn das Schlechte? Wir lieben und amüsiren uns, wie es uns gefällt; und dies thut die ganze Welt, nicht wahr? ... Sieh, Dein Vater thut sich auch keinerlei Zwang an. Er liebt das Geld und nimmt es, wo er es findet. Er hat vollkommen Recht und ich werde mich darnach zu richten wissen ... Vor Allem werde ich nichts unterschreiben und Du wirst Dich wie früher jeden Abend hier einfinden. Ich fürchtete, Du würdest nicht mehr wollen, weil... Du weißt ja, was ich Dir gesagt ... Da Dich Das aber nicht anficht ... Und dann werde ich ihm die Thür verschließen, wie Du begreifen wirst...«
Sie stand auf und zündete die Nachtlampe an. Maxime zögerte; er war völlig verzweifelt. Nun ward er sich über den Fehler klar, den er begangen und machte sich bittere Vorwürfe darüber, daß er gesprochen. Wie sollte er jetzt seine bevorstehende Vermählung ankündigen? Die Schuld konnte er nur sich allein zuschreiben, denn der Bruch hatte stattgefunden und er es nicht nöthig gehabt, sich neuerdings in diesem Zimmer einzufinden, oder der jungen Frau zu beweisen, daß ihr Gatte sie schmählich hintergehe. Er wußte gar nicht mehr, welchen Regungen er nachgegeben, was seinen Zorn gegen sich selbst nur noch vermehrte. Doch wenn er auch einen Augenblick den Gedanken hatte, ein zweites Mal brutal zu sein, sich ohne Weiteres zu entfernen, so erfüllte ihn der Anblick Renée's, die ihre Pantoffel abstreifte, mit einer unbesiegbaren Feigheit. Er ward von Furcht erfaßt und blieb.
Als sich Saccard am nächsten Tage bei seiner Frau einfand, um ihr die Verzichtsurkunde zur Unterschrift vorzulegen, theilte sie ihm ruhig mit, daß sie sich die Sache überlegt habe und nichts zu unterschreiben gedenke. Sie machte nicht die leiseste Anspielung, denn sie hatte sich selbst Schweigen gelobt, um sich keine Unannehmlichkeiten zuzuziehen und ihre wiedergefundene Liebe in Ruhe genießen zu können. Aus dem Charonner Geschäfte mochte werden was da wollte; die Verweigerung ihrer Unterschrift war blos eine Rache und alles Uebrige focht sie nicht an. Saccard war nahe daran, sich von seinem Zorne hinreißen zu lassen. Alle seine Träume gingen in Trümmer, denn was er an sonstigen Unternehmungen hatte, mißglückte ebenfalls. Er war am Ende seiner Hilfsmittel und es mußte ein Wunder genannt werden, daß er sich noch aufrecht erhielt; am Morgen desselben Tages hatte er nicht einmal die Rechnung seines Bäckers bezahlen können. Dies hinderte ihn aber nicht, für Mittfastendonnerstag ein glänzendes Fest vorzubereiten. Angesichts der Weigerung Renée's empfand er den ohnmächtigen Zorn eines kraftstrotzenden Mannes, der durch die Laune eines Kindes in seinem Werke aufgehalten wird. Mit der Verzichtsurkunde in der Tasche hatte er sich Geld beschaffen zu können gehofft, bis ihm die städtische Entschädigung zugefallen wäre. Als er sich ein wenig beruhigt hatte und klar zu denken vermochte, staunte er über die plötzliche Aenderung des Entschlusses seiner Frau; sicherlich war sie von Jemandem berathen worden. Sein Verdacht richtete sich naturgemäß auf einen Liebhaber. Diese Vermuthung gewann derart die Oberhand in ihm, daß er zu seiner Schwester eilte, um sie zu fragen, ob ihr von Renée's Geheimnissen nichts bekannt sei. Sidonie gab sehr scharfe Antworten, denn sie vermochte ihrer Schwägerin nicht zu verzeihen, daß sie sie durch ihre Weigerung, Herrn von Saffré zu sehen, in eine arge Verlegenheit gebracht hatte. Als sie daher aus den Fragen ihres Bruders ersah, daß er seine Frau im Verdacht habe, sie unterhielte geheime Liebesverhältnisse, stimmte sie eifrig bei und sagte, daß sie dessen sicher sei. Sie machte sich anheischig, die »Turteltäubchen« abzufassen. Diese Zierpuppe sollte nicht glauben, daß ihr Alles gestattet sei. Saccard liebte es sonst nicht, unangenehmen Wahrheiten nachzuspüren; hier aber zwang ihn sein Interesse, die Augen zu öffnen, die er klüglich geschlossen gehalten und so nahm er das Anerbieten seiner Schwester an, die mitfühlenden Tones zu ihm sagte:
»Sei unbesorgt, ich werde Alles in Erfahrung bringen. Ach! mein armer Bruder, Angéle hätte Dich gewiß niemals verrathen! Einen so guten, so großmüthigen Gatten! Diese Pariser Puppen haben ja kein Herz ... Und ich habe doch niemals aufgehört, ihr die besten Rathschläge zu ertheilen!«