
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
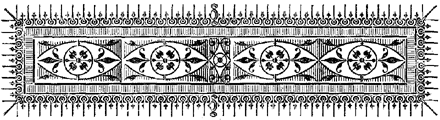
Bis zu den Sommerferien des Jahres 1854 blieb Maxime im Colleg zu Plassans. Er war dreizehn Jahre und etliche Monate alt und hatte sein fünftes Schuljahr absolviert. Zu dieser Zeit entschloß sich sein Vater, ihn nach Paris kommen zu lassen. Er sagte sich, daß ein Sohn in diesem Alter sich ganz gut ausnehmen und dazu dienen würde, ihn in seiner Rolle als reichen und ernsten Witwer, der eine zweite Ehe eingegangen, zu unterstützen. Als er mit seiner Gattin, der gegenüber er sich einer großen Zuvorkommenheit befleißigte, über dieses Projekt sprach, erwiderte sie nachlässig:
»Mir ist's recht, lassen Sie den Jungen kommen... Er wird uns ein wenig zerstreuen. Am Vormittag ist es bei uns ohnedies zum Sterben langweilig.«
Acht Tage später langte der Junge an. Es war das ein schmächtiger, hochaufgeschossener Schlingel mit dem Gesicht eines Mädchens, zarter, kecker Miene und ganz blondem Haar. Doch wie lächerlich sah der Knabe aus! Sein Kopf war ganz geschoren, das Haar so kurz, daß der Schädel kaum beschattet war; dazu trug er Beinkleider, die ihm zu kurz waren und eine Bluse, die zu weit geraten, ganz fadenscheinig war und ihm den Anschein gab, als hätte er einen Höcker. In diesem Aufzuge und überrascht von den neuen Dingen, die er hier sah, blickte er um sich, allerdings ohne Furcht, mit der wilden und schlauen Miene eines frühreifen Kindes, welches sich nicht auf den ersten Hieb ergibt.
Ein Diener hatte ihn vom Bahnhofe abgeholt und er befand sich in dem großen Salon, dessen vergoldete Decke und Einrichtung ihn entzückten, während ihn der Gedanke an all' die Pracht, in welcher er fortan leben sollte, ganz glücklich machte, als Renée, die von ihrem Schneider heimkehrte, wie ein Wirbelwind hereinstürmte. Sie warf ihren Hut auf den weißen Burnus, den sie zum Schutze gegen die bereits empfindliche Kälte angelegt hatte, ab und erschien dem vor Bewunderung ganz bestürzten Maxime in dem vollen Glanz ihrer herrlichen Toilette.
Der Knabe meinte, sie sei verkleidet. Sie trug einen herrlichen Rock aus blauer Fayeseide mit großen Falbeln, darüber eine Art Rock der garde française aus zart grauer Seide. Die Rockschöße, mit blauer Seide gefüttert, waren galant zurückgeschlagen und durch Bänder festgehalten; die Verzierungen der Ärmel, sowie die breiten Überschläge des Leibchens waren aus demselben Zeug. Und gleichsam als Krone des Ganzen zogen sich große Knöpfe in der Farbe des Saphirs, in azurblaue Rosetten gefaßt, in zwei Reihen von den Hüften bis zum Saum hinab. Es war häßlich und anbetungswürdig zugleich.
Als Renée ihren Stiefsohn bemerkte, war sie erstaunt zu sehen, daß er beinahe ebenso groß war wie sie und wendete sich mit der Frage zu dem Diener:
»Das ist wohl der Kleine, nicht wahr?«
Das Kind verschlang sie förmlich mit den Blicken. Diese Dame mit der weißen Haut, deren Busen aus dem Spalt der gefältelten Brustkrause hervorlugte, diese plötzliche reizende Erscheinung mit der hohen Haartracht, den fein beschuhten Händen und den kleinen Männerstiefletten, deren spitzige Absätze sich in den Teppich versenkten, entzückte ihn und erschien ihm als die gute Fee dieses warmen goldschimmernden Raumes. Er begann zu lächeln und benahm sich gerade linkisch genug, um seine knabenhafte Anmut beizubehalten.
»Ach! wie drollig er ist!« rief Renée aus, »Doch wie schrecklich! man hat ihm den Kopf beinahe rasirt!... Höre mich an, mein kleiner Freund, Dein Vater wird offenbar vor dem Diner nicht nach Hause kommen und ich werde gezwungen sein, Dich unterzubringen... Ich bin Ihre Stiefmutter, mein Herr... Willst Du mir einen Kuß geben?«
»Gewiß will ich,« erwiderte Maxime rundheraus.
Und damit küßte er die junge Frau auf beide Wangen, indem er sie bei den Schultern faßte, wodurch der graue Seidenüberwurf ein wenig verschoben wurde. Lachend machte sie sich los, indem sie sagte:
»Mein Gott, wie drollig der kleine Schlingel ist!« Und etwas ernster fügte sie hinzu: »Wir werden Freunde sein, nicht wahr?... Ich will Ihnen eine Mutter sein. Ich dachte hierüber nach, während ich bei meinem Schneider wartete, der mit anderen Damen beschäftigt war und ich sagte mir, daß ich zu Ihnen sehr gut sein und Sie tadellos erziehen müsse... Das wird hübsch sein!«
Noch immer blickte Maxime sie mit seinen blauen Augen an – diesen Augen eines kühnen Mädchens – und mit einem Male fragte er:
»Wie alt sind Sie?«
»So etwas fragt man niemals!« rief sie die Hände zusammenschlagend aus. »Er weiß das aber nicht, der kleine Unglückliche! Ich werde ihn erst Alles lehren müssen... Glücklicherweise brauche ich mein Alter noch nicht zu leugnen. Ich bin einundzwanzig Jahre alt.«
»Und ich werde bald vierzehn Jahre alt sein... Sie könnten meine Schwester sein.«
Er sagte nichts weiter, doch verriet sein Blick deutlich, daß er der Meinung gewesen, die zweite Frau seines Vaters müßte bedeutend älter sein. Er stand dicht bei ihr und betrachtete ihren Hals mit solcher Beharrlichkeit, daß sie schließlich errötete. Ihr unsteter Geist wandte sich indessen alsbald einem anderen Gegenstande zu, da sie sich nicht lange mit einer Sache beschäftigen konnte, und indem sie auf- und abzuschreiten begann, sprach sie von ihrem Schneider, ohne zu beachten, daß sie ein Kind vor sich habe.
»Ich wäre bei Deiner Ankunft gerne hier gewesen; doch bedenke, daß mir Worms diese Toilette heute morgens gebracht hat... Ich probiere sie und finde sie ziemlich gelungen. Sie ist recht nett, nicht wahr?«
Damit war sie vor einen Spiegel getreten, während Maxime hinter ihr bald einige Schritte vorwärts machte, bald ein wenig zurückwich, um sie von allen Seiten betrachten zu können.
»Als ich aber das Kleid anlegte,« fuhr sie fort, »bemerkte ich, daß es hier, auf der linken Schulter eine große Falte machte; Du siehst ja selbst... Diese Falte ist sehr häßlich und gibt mir den Anschein, als hätte ich eine Schulter höher als die andere.«
Er war näher gekommen, legte den Finger auf die bezeichnete Falte, wie um dieselbe niederzudrücken und die Hand dieses dem Laster nicht mehr fremden Schülers schien mit einem gewissen Wohlbehagen auf dieser Stelle zu verweilen.
»Meiner Treu,« plauderte sie weiter; »das konnte doch nicht so bleiben. Ich ließ daher anspannen und fuhr zu Worms, dem ich seine unverzeihliche Nachlässigkeit vorhielt... Er versprach mir, daß er die Sache ändern werde.«
Dabei stand sie immer noch vor dem Spiegel, in dem sie sich sinnend betrachtete und endlich legte sie den Finger mit einer Miene ungeduldigen Nachdenkens auf den Mund, worauf sie leisen Tones, als spräche sie zu sich selbst, sagte:
»Etwas fehlt ... ja, ja, etwas fehlt hier...«
Und mit einer plötzlichen Bewegung drehte sie sich um, stellte sich vor Maxime hin und fragte wichtig:
»Ist's wirklich gut?... Findest Du nicht, daß etwas fehlt, irgend etwas, eine Kleinigkeit, ein Band, eine Schleife?«
Beruhigt durch den freundschaftlichen Ton der jungen Frau, hatte der Schuljunge die ganze Sicherheit seiner kecken Natur wiedergewonnen. Er trat zurück, trat wieder näher und die Augen zusammenkneifend, murmelte er:
»Nein, nein, es fehlt nichts,... es ist sehr hübsch, sehr hübsch... Meiner Ansicht nach ist sogar etwas zuviel vorhanden.«
Er errötete ein wenig, trotz seiner Kühnheit, trat noch näher und mit der Spitze seines Fingers einen Strich über Renée's Busen ziehend, fügte er hinzu:
»Sehen Sie, ich würde diese Spitze hier rund ausschneiden und ein Halsband mit einem großen Kreuz anlegen.«
Entzückt klatschte sie in die Hände.
»Ja, ja, das ist's,« rief sie aus. »Das Wort lag mir auf der Zungenspitze.«
Damit schlug sie die Busenkrause zurück, verschwand für zwei Minuten und kehrte mit dem Halsband und dem Kreuze zurück. Darauf stellte sie sich wieder vor den Spiegel hin und murmelte mit triumphirender Miene:
»So ist's richtig, vollkommen richtig!... Er ist ganz und gar nicht dumm, der kleine Kahlkopf! Du bist wohl den Frauen in Deiner Provinz beim Ankleiden behilflich gewesen?... Kein Zweifel, wir werden gute Freunde sein. Doch mußt Du hübsch folgsam sein. Vor Allem, junger Herr, werden Sie sich die Haare wachsen lassen und diese abscheulichen Gewänder nicht mehr tragen; ferner werden Sie meine Ratschläge über Anstand und Benehmen getreulich befolgen. Ich will einen jungen Mann aus Ihnen machen.«
»Gewiß,« erwiderte das Kind naiv; »denn Papa ist nunmehr reich und Sie sind seine Frau.«
Sie lächelte und sagte dann mit ihrer gewohnten Lebhaftigkeit:
»Vor Allem müssen wir uns duzen; ich sage bald Du, bald Sie, das ist zu dumm... Du wirst mich also sehr lieb haben?«
»Ich werde Dich von ganzem Herzen lieben,« erwiderte der Knabe mit der Glut eines jungen Burschen, der eine Liebschaft gefunden.
Dies war die erste Begegnung zwischen Maxime und Renée. Der Knabe kam erst einen Monat später in die Schule. In den ersten Tagen spielte seine Stiefmutter mit ihm wie mit einer Puppe; sie entkleidete ihn seiner Provinzgewohnheiten und es muß zugegeben werden, daß er hierbei viel guten Willen bekundete. Als er durch den Schneider seines Vaters vom Kopf bis zu den Füßen neu gekleidet vor ihr erschien, stieß sie einen Ruf freudiger Überraschung aus; er sei herzallerliebst, erklärte sie. Nur seine Haare wuchsen mit einer Langsamkeit, die geradezu zum Verzweifeln war. Die junge Frau behauptete immer, daß das Haar dem Gesicht Ausdruck verleihe und sorgfältig pflegte sie ihr eigenes. Lange Zeit war sie untröstlich über die Farbe desselben, die in ihrer Unbestimmtheit am ehesten an feine Butter erinnerte. Doch als gelbe Haare modern wurden, war sie hoch erfreut und um den Glauben zu erwecken, daß sie die Mode nicht einfältigerweise nachahme, schwor sie, daß sie ihr Haar jeden Monat färbe.
Seiner dreizehn Jahre ungeachtet war Maxime schon sehr erfahren. Er war eine jener zarten, frühreifen Naturen, bei welchen die Sinne vorzeitig zur Geltung gelangen. Das Laster erwachte in ihm noch vor der Begierde. Zweimal war er nahe daran gewesen, aus der Schule verwiesen zu werden. Renée, deren Augen an die provinziale Anmuth gewöhnt waren, hätte sehen können, daß der kleine Kahlkopf, wie sie ihn nannte, so unschön er auch gekleidet war, den Hals auf anmuthige Weise wendete, die Arme mit einer gewissen weichen Bewegung gebrauchte und mit dem mädchenhaften Ausdruck der Schülerinen lächelte. Seinen Händen, die zart und lang waren, wendete er besondere Pflege zu, und wenn seine Haare auf Anordnung des Schulvorstehers, eines ehemaligen Stabsoffiziers, auch kurz geschnitten sein mußten, so besaß er dafür einen kleinen Spiegel, den er während des Vortrages aus der Tasche zog, zwischen die Blätter seines Buches legte und in welchem er sich stundenlang betrachtete, seine Augen untersuchte, sein Mienenspiel beobachtete und allerlei kokette Künste einstudierte. Seine Kameraden hängten sich an seine Blouse wie an einen Weiberrock und dabei preßte er sich derart zusammen, daß er schlank erschien und sich gleich einer voll entwickelten Frau in den Hüften wiegen konnte. In Wahrheit aber erhielt er ebensoviel Prügel wie Schmeicheleien. Die Schule zu Plassans, eine Höhle kleiner Banditen gleich der Mehrzahl der Provinzschulen, wurde auf diese Weise ein Ort der Besudelung, wo dieses neutrale Temperament, dieses Kind, welches das Laster als Erbschaft überkommen zu haben schien, eine seltsame Entwickelung nahm. Vielleicht sollten es die Jahre bessern; doch die Spuren seiner kindlichen Verirrungen, dieser Verweichlichung seines ganzen Wesens, dieser Stunde, in welcher er sich für ein Mädchen halten konnte, sollten in ihm zurückbleiben und seine Männlichkeit für alle Zeiten beeinträchtigen.
Renée nannte ihn »mein Fräulein«, ohne zu wissen, daß sie noch vor sechs Monaten das Richtige getroffen hätte, Sie sah, daß er sehr gehorsam, sehr liebevoll sei; ja mitunter fühlte sie sich durch seine Liebkosungen geradezu verwirrt. Er hatte eine Art, sie zu küssen, die ihr einen heißen Schauer verursachte. Was sie aber am meisten entzückte, war seine Schelmerei; er war unsagbar drollig, kühn und sprach bereits lächelnd über die Frauen, hielt sogar den Freundinen Renée's Stand: der theuren Adeline, die Herrn von Espanet geheirathet hatte und der dicken Susanne, die ganz kürzlich die Gattin des Großindustriellen Haffner geworden. Mit vierzehn Jahren war er bis über die Ohren in letztere verliebt. Er hatte seine Stiefmutter zu seiner Vertrauten gemacht und bereitete dadurch dieser viel Vergnügen.
»Ich hätte Adeline vorgezogen, denn diese ist hübscher,« pflegte sie zu sagen.
»Mag sein,« erwiderte der Schlingel; »doch ist Susanne bedeutend dicker... Ich liebe die schönen Frauen... Und wenn Du gut wärest, so würdest Du für mich ein Wort bei ihr einlegen.«
Renée lachte. Ihre Puppe, dieser große Junge mit dem Mädchengesicht däuchte ihr unbezahlbar, seitdem er verliebt war. Es trat sogar ein Augenblick ein, da sich Frau Haffner ernstlich vertheidigen mußte. Im Uebrigen ermunterten die Damen Maxime durch ihr ersticktes Lachen, durch die hingeworfenen zweideutigen Worte und die koketten Geberden und Mienen, die sie vor diesem frühreifen Kinde zeigten. Ein Zug stark aristokratischer Lüsternheit war da mit im Spiel. Alle Drei, in ihrem von der Leidenschaft durchglühten, geräuschvollen Leben, machten Halt bei der reizenden Verderbtheit dieses halbwüchsigen Jungen, als wäre dieselbe ein seltenes und gefahrloses Gewürz, welches ihren Gaumen reizt. Sie ließen ihn gewähren, wenn er ihre Kleider berührte, mit den Fingern über ihre Schultern strich, sobald er ihnen in's Vorzimmer folgte, um ihnen beim Anlegen ihrer Ueberwürfe behilflich zu sein. Sie gaben ihn von Hand zu Hand und lachten wie toll, wenn er ihnen das Handgelenk an der Innenseite küßte, wo die Haut sich so zart und warm anfühlt; dann wieder gaben sie sich ein mütterliches Ansehen und lehrten ihn die Kunst, ein schöner Mann zu sein und den Damen zu gefallen. Er bildete ihr Spielzeug; er war ihnen ein Männchen mit sinnreichem Mechanismus, das küssen und den Hof machen konnte, das die liebenswürdigsten Laster hatte, das trotz alledem ein Spielzeug, ein Hampelmännchen blieb, vor dem man sich nicht zu sehr, nur gerade so weit ängstigte, daß man bei der Berührung seiner kindlichen Hand einen sehr angenehmen Schauder verspürte.
Als Maxime neuerdings zur Schule gehen sollte, kam er auf das Bonaparte-Lyceum, Dies war das Lyceum der eleganten Welt, welches Saccard für seinen Sohn wählen mußte. Trotz seiner Weichlichkeit und Leichtfertigkeit war der Knabe hochintelligent; doch verwendete er seine Intelligenz auf ganz andere Dinge als auf klassische Studien. Dessen ungeachtet war er ein korrekter Schüler, der niemals zu den nichtsnutzigen Faulenzern herabsank, sondern sich an die gutgekleideten, kleinen Herren hielt, von denen man nichts Schlimmes sagte. Seine Jugend äußerte sich bei ihm blos in einer wahren Verehrung für die Toilette. Paris öffnete ihm die Augen und machte einen schönen jungen Mann aus ihm, dem die stets nach der neuesten Mode geschnittenen Kleider wie angegossen am Leibe saßen. Er war der Musterstutzer seiner Klasse, in welcher er sich wie in einem Salon einfand, mit eleganten Schuhen und tadellosen Handschuhen, herrlichen Kravaten und Hüten. Solcher junger Herrchen gab es in seiner Klasse etwa zwanzig, die gleichsam einen aristokratischen Verband bildeten, sich beim Verlassen des Schulgebäudes Havannazigarren aus Zigarrentaschen mit goldenen Schließen anboten und sich ihre Bücher durch einen livrirten Diener nachtragen ließen. Maxime hatte seinen Vater bewogen, ihm einen Tilbury und einen kleinen kräftigen Rappen zu kaufen, der die Bewunderung und das Entzücken seiner Kameraden bildete. Er führte selbst das Gespann; auf dem Rücksitz hinter ihm saß ein Lakai mit untergeschlagenen Armen und der an ein Ministerportefeuille erinnernden Schultasche aus kastanienbraunem Leder auf den Knieen. Und man mußte sehen, mit welcher Leichtigkeit, Uebung und Anmuth er in zehn Minuten aus der Rue de Rivoli nach der Rue du Havre kam, sein Pferd hart vor dem Thor des Lyceums anhielt und dem Diener mit den Worten: »Jacques, um halb fünf Uhr!« die Zügel hinwarf. Die Ladeninhaber in den umliegenden Häusern waren entzückt von der köstlichen Anmuth dieses Blondkopfes, den sie regelmäßig jeden Tag zweimal mit seinem Wägelchen anlangen und abfahren sahen. Bei der Heimfahrt nahm er zuweilen einen Freund mit sich, den er vor dessen Thür absetzte. Dann rauchten die beiden Kinder Zigarren, betrachteten die Frauen und bespritzten die Passanten mit Koth, als kämen sie vom Wettrennen zurück. Es war das eine wunderliche kleine Welt von Stutzern und Gecken, die man täglich in der Rue du Havre anlangen sah, wo sie in ihren geckenhaften Anzügen den reichen, blasirten Mann spielten, während die »Hefe« der Anstalt, die wirklichen Schüler, schreiend und lachend daherkamen, sich gegenseitig stießen, mit den schweren Schuhen das Pflaster stampften und ihre Bücher an langen Riemen über den Rücken herunterhängen hatten.
Renée, die ihre Rolle als Mutter und Erzieherin ernst nehmen wollte, war entzückt von ihrem Schüler. Sie vernachlässigte thatsächlich nichts, um seine Erziehung zu vervollkommnen. Gerade zu jener Zeit hatte sie schweren Kummer und vergoß sie manche Thräne; – ein Liebhaber hatte sie verlassen, um seine Verehrung der Herzogin von Sternich zu Füßen zu legen und die Sache hatte ungeheures Aufsehen erregt. Sie träumte davon, daß Maxime ihr Trost sein werde; sie wurde alt, bemühte sich, recht mütterlich zu sein und wurde zum absonderlichsten Mentor der Welt. Häufig blieb der Tilbury Maxime's daheim, denn Renée holte den Stiefsohn mit ihrer großen Karosse ab. Die braune Büchertasche wurde unter den Sitz geschoben und dann fuhr man in's Bois, wo sie ihm einen Vortrag über das kaiserliche Paris hielt, welches noch ganz glücklich und in heller Begeisterung über diesen Schlag mit dem Zauberstabe war, welcher aus den Hungerleidern und Handlangern von gestern große Herren und Millionäre gemacht hatte, die prahlerisch auf ihren Geldsäcken saßen. Der Knabe aber fragte fast immer nur nach den Frauen und da sie sich ihm gegenüber sehr frei aussprach, so lieferte sie ihm eingehende Details: Frau von Guende war dünn, aber vorzüglich gebaut; die sehr reiche Gräfin Vanska war eine Straßensängerin gewesen, bevor sie sich von einem Polen heirathen ließ, der sie mit Schlägen traktierte, wie man behauptete; und was die Marquise d'Espanet und Susanne Haffner betraf, so waren die Beiden unzertrennlich und obgleich sie ihre vertrauten Freundinen waren, so fügte Renée mit zusammengekniffenen Lippen, als wollte sie nicht mehr sagen, hinzu, daß man sich über Beide recht unsaubere Dinge erzähle. Auch die schöne Frau von Lauwerens war sehr kompromittirend, hatte aber so schöne Augen, und Jedermann wußte, daß soweit es sich um ihre Person handle, man keinen Tadel vorbringen könne, obgleich sie sich zuviel mit den Händeln der armen kleinen Frauen abgibt, mit denen sie verkehrt: Frau Daste, Frau Teissière, die Baronin von Meinhold. Maxime wünschte die Porträts dieser Damen zu besitzen; er füllte mit denselben ein Album, welches im Salon auf einem Tischchen lag. Um seine Stiefmutter mit der lasterhaften Schlauheit, die den Grundzug seines Charakters bildete, in Verlegenheit zu bringen, verlangte er von ihr Aufschlüsse über Dirnen, wobei er sich den Anschein gab, als sähe er sie für vornehme Damen an. Moralisirend und ernst erwiderte ihm Renée, daß dies verabscheuungswürdige Geschöpfe seien, denen er sorgfältig ausweichen müsse: dann aber vergaß sie sich und sprach von denselben wie über Personen, die sie genau kannte. Einen besonderen Genuß bereitete es dem Knaben, wenn er die Sprache auf die Herzogin von Sternich bringen konnte. So oft der Wagen derselben im Bois an dem ihrigen vorüberfuhr, begann er von der Herzogin zu sprechen, und zwar mit einer boshaften Schadenfreude und einem Seitenblick auf seine Stiefmutter, welcher zur Genüge bewies, daß er das letzte Abenteuer derselben kannte. In trockenem Tone fiel dann Renée über ihre Rivalin her und zerpflückte dieselbe erbarmungslos; wie alt die arme Frau wurde! Sie schminkte sich, hatte Liebhaber in jedem ihrer Kleiderschränke verborgen, und habe sich einem Kammerherrn hingegeben, um in das kaiserliche Bett zu gelangen. So ging es in einem Zuge erbarmungslos fort, während Maxime, um sie zu ärgern, die Herzogin für eine entzückende Frau erklärte. Derartige Lektionen erhöhten die Intelligenz des Knaben ganz ungemein, umsomehr, als die junge Erzieherin dieselben überall wiederholte, im Salon, im Bois, im Theater. Der Schüler machte bedeutende Fortschritte.
Maxime hatte für sein Leben gern mit Frauengewändern, für den weiblichen Leib bestimmten Toilettesachen zu schaffen. Immer blieb etwas vom Mädchen an ihm haften, dank seinen zarten länglichen Händen, seinem bartlosen Gesichte, seinem weißen, vollen Halse. Renée besprach sich ganz ernsthaft über ihre Toiletten mit ihm. Er kannte die guten Schneider der Hauptstadt, urtheilte sachverständig über dieselben und sprach über die Symmetrie eines Hutes, über die Logik einer Toilette wie irgend eine Frau. Als er siebzehn Jahre alt geworden, gab es keine Modistin, die er nicht ergründet, keinen Schuhmacher, den er nicht bis in's Innerste studiert hätte. Dieser merkwürdig frühreife Junge, der während der englischen Stunde die Prospekte durchlas, welche ihm sein Parfumlieferant jeden Freitag zugehen ließ, hätte eine brillante Abhandlung über das ganze elegante Paris, Klienten und Lieferanten mitinbegriffen, zu schreiben verstanden, in einem Alter, da die Provinzschulknaben noch keine Magd anzusehen wagen. Häufig brachte er vom Lyceum heimkehrend, in seinem Tilbury einen Hut, eine Seifenschachtel, irgend ein Geschmeide mit, welches seine Stiefmutter Tags vorher bestellt hatte. In seinen Taschen war stets ein Endchen parfumirter Spitzen zu finden.
Sein Höchstes war aber, wenn er Renée zu dem berühmten Worms, dem genialem Schneider begleiten durfte, vor welchem die Mode-Königinen des zweiten Kaiserreiches auf den Knieen lagen. Der Salon des großen Mannes war geräumig, elegant eingerichtet und mit breiten Divans versehen. Mit einer gewissen religiösen Erregung setzte er den Fuß in denselben. Die weiblichen Toiletten besitzen unleugbar ihren eigenen Duft; Seide, Satin, Sammt und Spitzen vermengen ihren zarten Hauch mit dem der Haare und bernsteinartig angehauchten Schultern und die Atmosphäre dieses Salons hatte jene duftige Wärm;, jenen Weihrauch des Reichthums und lebenden Fleisches, welches den Raum zu einer dem Dienste irgend einer geheimen Gottheit geweihten Kapelle machte. Häufig mußten Renée und Maxime Stunden lang warten; stets waren etwa zwei Dutzend Damen noch zugegen, die darauf warteten, daß die Reihe an sie komme und inzwischen Biscuits in kleine Gläschen Madeira tauchten, die nebst anderen kleineren Delikatessen auf dem großen Tische in der Mitte bereitstanden. Die Damen fühlten sich hier ganz zu Hause, plauderten unbefangen mit einander und wenn sie sich in dem weiten Gemach niederließen, hätte man sie für eine Schaar Lesbierinen halten können, die sich in einem Pariser Salon versammelten. Maxime, den sie um seines mädchenhaften Aussehens willen liebten und in ihrer Nähe duldeten, war das einzige männliche Wesen, welches Zutritt in das Heiligthum hatte. Er schwelgte daselbst in göttlichen Genüssen; er glitt schlangengleich über die Divans hin und stets konnte man ihn unter einem Rock, hinter einem Mieder, zwischen zwei Kleidern antreffen, wo er sich ganz klein zusammenkauerte, vollkommen ruhig verhielt und mit der Miene eines Chorknaben, der den Leib des Herrn empfängt, die duftende Wärme seiner Nachbarinen einathmete.
»Er schmuggelt sich überall ein, der Kleine da,« sagte die Baronin von Meinhold und streichelte ihm die Wangen.
Er war so zart, daß ihn die Damen kaum für vierzehnjährig hielten; sie fanden ein Vergnügen daran, ihn mit dem Madeira des berühmten Worms zu berauschen. Er sprach die überraschendesten Dinge zu ihnen und sie lachten darüber, daß ihnen die Thränen über die Wangen flossen. Indessen war es die Marquise d'Espanet, die das charakteristische Wort der Situation fand; denn als man Maxime eines Tages in einer Divanecke zusammengekauert hinter ihrem Rücken entdeckte, wo er so rosig und erröthend, so ganz durchdrungen von dem Wohlbehagen, welches er in ihrer unmittelbaren Nähe empfand, dreinblickte, murmelte sie:
»Dieser Knabe hätte als Mädchen geboren werden sollen.«
Wenn dann der große Worms Renée endlich vorließ, trat Maxime mit ihr zugleich in das Kabinet. Er hatte sich erlaubt, zwei oder drei Mal einige Worte zu sprechen, während sich der Meister in den Anblick seiner Klienten vertiefte, gleichwie ein Künstler sein Modell betrachtet und der Meister hatte über die Triftigkeit seiner Bemerkungen zu lächeln geruht. Er ließ Renée sich vor einen vom Fußboden bis zur Decke reichenden Spiegel stellen und schien, indem er die Brauen runzelte, innerlich mit sich zu Rathe zu gehen, während die aufgeregte junge Frau den Athem anhielt, um gewiß keine störende Bewegung zu machen. Und wie von Begeisterung ergriffen, begann der Künstler nach wenigen Minuten in großen Zügen das Meisterwerk zu skizziren, welches er vor seinem geistigen Auge entstehen sah, indem er in kurzen Sätzen hervorstieß:
»Robe Montespan aus aschfarbener Fayeseide ... Schleppe halbkurz, vorne runder Ausschnitt ... große Schleifen aus grauem Satin zum Festhalten an den Hüften ... Vordertheil aus gefütterter perlgrauer Seide ...«
Er dachte von Neuem nach, wobei er bis in die tiefste Tiefe seines Genies hinabzutauchen schien und mit der triumphirenden Grimasse einer auf ihrem Dreifuße sitzenden Wahrsagerin fuhr er fort:
»In den Haaren, auf diesem leuchtenden Haupte werden wir den träumerischen Schmetterling der Psyche mit den azurblauen Flügeln anbringen.«
Bei einer anderen Gelegenheit aber wollte die Eingebung nicht kommen. Vergebens rief der berühmte Worms sie herbei; er strengte sich ganz nutzlos an. Dann runzelte er die Brauen, wurde bleich, nahm seinen armen Kopf zwischen beide Hände, drückte ihn verzweiflungsvoll und warf sich schließlich entmuthigt in einen Fauteuil.
»Nein,« murmelte er dabei schmerzlichen Tones; »nein, heute nicht ... heute ist es nicht möglich ... Die Damen sind so erbarmungslos ... Die Quelle ist versiegt.«
Damit setzte er Renée vor die Thür und fügte gleichsam begütigend hinzu:
»Nicht möglich, nicht möglich, verehrte Frau; bitte, sprechen Sie nächster Tage wieder vor ... Heute bin ich nicht in der richtigen Stimmung.«
Nicht lange währte es, so hatte die schöne Erziehung, welche Maxime zutheil wurde, ihre ersten Früchte getragen. Mit siebzehn Jahren verführte der Schlingel das Kammermädchen seiner Stiefmutter. Das Aergste an der Sache war, daß die Person schwanger wurde. Man mußte sie sammt ihrem Balg auf's Land schicken und ihr eine kleine Rente aussetzen. Renée war im höchsten Grade aufgebracht über das Abenteuer, während sich Saccard nur soweit darum kümmerte, als es die materielle Seite der Frage erforderte. Die junge Frau zürnte ihrem Zögling ernstlich. Er, aus dem sie einen vornehmen Mann machen wollte, kompromittirte sich mit einer solchen Person! Welch' lächerlicher, schmählicher Anfang, welch' unbesonnener Streich! Wenn er sich noch mit einer der Damen eingelassen hätte!
»Meiner Treu!« erwiderte er ruhig; »wenn Deine gute Freundin Susanne gewollt hätte, so wäre sie auf's Land geschickt worden.«
»Oh, über den Schlingel!« murmelte sie wehrlos gemacht. Die Vorstellung, Susanne mit einer Rente von zwölfhundert Francs auf dem Lande zurückgezogen zu sehen, stimmte sie heiter.
Dann aber kam ihr ein kurzweiliger Gedanke und ganz vergessend, daß sie die zürnende Mutter darzustellen habe, begann sie zu lachen und ihn aus den Augenwinkeln ansehend, murmelte sie, während sie ihr Lachen hinter der vorgehaltenen Hand zu ersticken suchte:
»Höre 'mal, Adeline wäre in diesem Falle sehr ungehalten über Dich gewesen und sie hätte Susannen heftige Vorwürfe gemacht...«
Weiter sprach sie nicht, denn Maxime begann ebenfalls zu lachen. Derart kam Renée's Sittenstrenge in diesem. Abenteuer zu Falle.
Aristide Saccard kümmerte sich nicht im Geringsten um die beiden Kinder, wie er seinen Sohn und seine zweite Frau nannte. Er lies ihnen eine unbeschränkte Freiheit, froh darüber, daß sie so gute Freunde waren, wodurch sich sein Haus mit geräuschvoller Heiterkeit füllte. Es war das übrigens ein gar merkwürdiges Haus. Die Thüren desselben gingen während des ganzen Tages auf und zu; die Dienerschaft unterhielt sich mit lauter Stimme; inmitten der funkelnagelneuen Pracht erschienen fortwährend ungeheure flatternde Damenröcke, ganze Züge von Lieferanten, die lärmende Schaar von Renée's Freundinen, die Kameraden Maxime's und die Besucher Saccard's. Letzterer empfing von neun bis elf Uhr die merkwürdigsten und verschiedensten Personen der Welt: Senatoren und Gerichtsvollzieher, Herzoginen und Modewaarenhändler, den ganzen Gischt, welchen die Pariser Stürme vor seine Thüre fegten; Seidenkleider, schmutzige Röcke, Blousen und schwarze Fräcke, die er mit dem stets gleichen geschäftigen Ton, denselben ungeduldigen und nervösen Bewegungen empfing. Er erledigte wichtige Geschäfte in zwei Worten, löste zwanzig Schwierigkeiten auf einen Hieb und fand Lösungen im Handumdrehen. Man hätte meinen sollen, daß dieser bewegliche kleine Mann, der eine sehr starke Stimme hatte, in seinem Kabinet mit den Leuten und Möbeln stritt und zankte, mit dem Kopfe gegen die Decke stieß, um demselben Gedanken zu erpressen und immer wieder siegreich auf seine Füße zurückfiel. Um eilf Uhr verließ er das Haus, wo man ihn während des ganzen Tages nicht wiedersah; er dejeunirte außerhalb des Hauses und oft nahm er auch das Diner auswärts ein. Dann gehörte das Haus Renée und Maxime. Sie nahmen das Arbeitszimmer des Vaters ein, öffneten dort die Sendungen der Lieferanten und allerlei Tand und werthloses Zeug breitete sich auf den wichtigsten Geschäftspapieren aus. Mitunter mußten ernste Persönlichkeiten Stunden lang vor der Thür des Arbeitszimmers warten, während der Schuljunge und die junge Frau auf dem Arbeitstische Saccard's sitzend, über ein neues Band beratschlagten. Renée ließ zehnmal während eines Tages anspannen. Nur selten speiste man zusammen; von den drei Personen der Familie streiften sicherlich immer zwei außerhalb des Hauses umher und kehrten gewöhnlich erst um Mitternacht heim. Es war das ein geräuschvolles Haus, den Geschäften und Zerstreuungen gewidmet, in welches das moderne Leben mit seinem Goldklange und seidenen Gewändern seinen rauschenden Einzug gehalten.
Endlich befand sich Aristide Saccard in seinem Element. Er hatte gefunden, daß er zum großen Spekulanten geboren worden, der Millionen aus der Erde hervorstampfen müsse. Nach dem Meisterstreich in der Rue de la Pepinère stürzte er sich kühn in den Kampf, welcher Paris mit schmählichen Trümmern und glänzenden Triumphen zu füllen begann. Er wiederholte das alte Spiel, nunmehr mit aller Sicherheit, kaufte die Häuser an, die er der Spitzhaue verfallen wußte und benützte seine Freunde dazu, bedeutende Entschädigungssummen zu erwirken. Es traten Epochen ein, da er fünf oder sechs Häuser sein eigen nannte, – all' jene Häuser, die er ehedem auf so eigenthümliche Weise betrachtet hatte, als hätten dieselben bereits ihm gehört, als er nichts weiter als ein armer Wegekommissär gewesen. Dies bedeutete aber erst das Anfangsstadium der Kunst; so lange er die Miethskontrakte ausgenützt, mit den Inwohnern paktirt und Staat und Privatleute ausgebeutet, hatte es keiner besonderen Schlauheit bedurft und er war der Ansicht, daß es sich so gar nicht lohne. Und es währte nicht lange, so erprobte er sein Genie an schwierigeren Aufgaben.
Vorerst erfand Saccard die Spiegelfechterei des Ankaufs von Immobilien unter dem Vorwande, daß dies für Rechnung der Stadt geschehe. Eine Entschließung des Staatsrathes hatte die letztere in eine schwierige Situation gebracht. Auf dem Wege gütlicher Uebereinkunft hatte die Stadt eine große Anzahl von Häusern in der Hoffnung angekauft, sie werde die Miethskontrakte ausnützen, den Miethern ohne Entschädigung aufkündigen können. Doch wurden diese Käufe für thatsächliche Expropriationen angesehen und sie mußte zahlen. Zu dieser Zeit machte sich Saccard anheischig, als Strohmann für die Stadt zu operiren; er kaufte, nützte die Kontrakte aus und lieferte das betreffende Haus gegen eine kleine Abfertigung zum festgesetzten Termin ab. Schließlich spielte er sogar ein doppeltes Spiel: er kaufte für die Stadt und den Präfekten zu gleicher Zeit. War ein Kauf gar zu verführerisch, so behielt er das Haus für sich und der Staat bezahlte. Man belohnte seine Dienstwilligkeit, indem man ihm einzelne Straßenabschnitte, projektirte Straßen-Kreuzungen überließ, welche er wieder verkaufte, noch bevor der Bau der neuen Straße gar in Angriff genommen worden. Es war ein wildes Spielen; man spielte auf die zu erbauenden Stadtviertel, wie man auf Rentenpapiere spielt. Gewisse Damen, schöne Mädchen, vertraute Freundinen hoher Funktionäre, waren mit von der Partie; eine derselben, die von ihren herrlichen Zähnen her berühmt ist, hat zu wiederholten Malen ganze Straßen aufgeknabbert. Saccard fühlte sein Verlangen, seinen Durst nach Reichthum immer höher steigen, als er sah, wie das Gold durch seine Hände strömte. Es schien ihm, als breitete sich rings um ihn ein Meer von Zwanzigfrancsstücken aus; die Fluth wurde zum Ozean und erfüllte den unabsehbaren Horizont mit einem unbestimmten Wogen und Rauschen, einer metallischen Melodie, die sein Herz umschmeichelte und immer weiter wagte er sich als kühner Schwimmer, der seine Unerschrockenheit mit jedem Tage zunehmen fühlte, in die Fluth hinaus, untertauchend, dann wieder zum Vorschein kommend und bald auf dem Rücken, bald auf dem Bauche liegend, durchschnitt er die unabsehbare Wasserfläche bei heiterem und bei stürmischem Wetter, voll Vertrauen zu seiner Kraft und seiner Geschicklichkeit, die ihn nicht untergehen lassen würde.
Zu jener Zeit war Paris in eine Wolke von Gipsstaub gehüllt. Die Epoche, welche Saccard in dem Restaurant auf dem Montmartre vorausgesagt, war gekommen. Die Stadt wurde unerbittlich zerstückelt und Aristide war bei jedem Einschnitt dabei. An allen vier Enden der Stadt besaß er Trümmerhaufen. Selbstverständlich war er in der Rue de Rome auch in die erstaunliche Geschichte jenes Loches verwickelt, welches eine Gesellschaft ausheben ließ, um fünf- oder sechstausend Kubikmeter Erde fortführen zu lassen und den Glauben an gigantische Arbeiten zu erwecken und welches wieder verschüttet werden mußte, wozu die erforderliche Erdmenge aus Saint-Ouen herbeigeschafft wurde, als die Gesellschaft fallit wurde. Aristide zog sich mit reinem Gewissen und vollen Taschen aus der Geschichte, dank seinem Bruder Eugen, der Vermittelnd eingriff. In Chaillot war er bei der Abtragung des Hügels behilflich, der in eine Niederung geschafft wurde, um für den Boulevard Raum zu gewinnen, der sich vom Arc-de-Triomphe bis zur Alma-Brücke erstreckt. In der Nähe von Passy regte er den Gedanken an, die Trümmer des Trokadero auf das Plateau schaffen zu lassen, so daß sich die fruchtbare Erde heute zwei Meter tief befindet und nicht einmal das Gras auf diesem Schutt gedeihen will. Man konnte ihn an zwanzig Punkten zu gleicher Zeit antreffen, an allen Orten, wo es irgend ein unüberwindliches Hinderniß gab: Trümmer, mit denen man nichts anzufangen wußte, Aufschüttungen, die man nicht auszuführen vermochte, ein Haufen Erde und Gips, der der fieberhaften Eile der Ingenieure im Wege war, den er mit seinen Fingern durchwühlte und welchen er dann stets auf irgend eine Weise zu verwerthen verstand. An einem und demselben Tage besichtigte er die Arbeiten am Arc-de-Triomphe und auf dem Boulevard Saint-Michel, die Demolirungen am Boulevard Malesherbes, sowie die Erdarbeiten zu Chaillot, stets gefolgt von einer Armee von Arbeitern, Gerichtsvollziehern, Aktionären, Bethörten und Gaunern.
Seinen größten Triumph feierte er aber mit dem Crédit Viticole, den er mit Toutin-Laroche gründete. Dieser war der offizielle Direktor der Gesellschaft, während er selbst nur als Mitglied des Aufsichtsrathes figurirte. Auch bei dieser Gelegenheit hatte Eugen seinen Bruder nach Thunlichkeit unterstützt. Dank seiner Vermittlung begünstigte die Regierung die Gesellschaft und behandelte dieselbe mit großem Wohlwollen. Als anläßlich einer kitzlichen Unternehmung dieser Gesellschaft ein übelwollendes Blatt sich herausnahm, an dieser Operation Kritik zu üben, ging der amtliche »Moniteur« so weit, eine Note zu veröffentlichen, in welcher jede Diskussion über ein solch' ehrenwerthes Unternehmen, welches der Staat selbst seiner Gunst würdigte, untersagt wurde. Der Crédit Viticole beruhte auf einem vorzüglichen Finanzsystem: er streckte den Weingartenbesitzern die Hälfte des Betrages vor, auf welchen deren Eigenthum geschätzt wurde, sicherte das Darlehen durch eine Hypothek und behob von den Parteien die Zinsen des Kapitals, sowie eine Anzahlung auf die Tilgung der Schuld. Noch nie hatte es einen besseren, weiseren Mechanismus gegeben. Mit einem feinen Lächeln hatte Eugen seinem Bruder erklärt, daß man in den Tuilerien den Wunsch habe, es möge Alles ehrbar zugehen. Herr Toutin-Laroche deutete diesen Wunsch in der Weise, daß er die Darlehen an die Weingartenbesitzer nach wie vor bewilligte und nebstbei ein Bankhaus errichtete, welches die großen Kapitalien an sich zog und sich mit fieberhafter Spielwuth in allerlei Abenteuer stürzte. Dank dem vom Direktor ausgehenden kräftigen Antrieb hatte sich der Crédit Viticole in kurzer Zeit den Ruf einer blühenden und über jeden Zweifel erhabenen Institution erworben. Um an der Börse zu Beginn der Operationen mit einem Schlage eine ganze Masse neuer Aktien, die eben erst die Presse verlassen hatten, auf den Markt zu werfen und den Papieren ein Aussehen zu geben, als befänden sie sich schon seit Langem im Umlauf, verfiel Saccard auf den ingeniösen Gedanken, sie während einer ganzen Nacht von den Dienern mit Birkenbesen bearbeiten zu lassen. Man hätte die Anstalt für eine Filiale der Bank von Frankreich ansehen können. Das Haus, in welchem sich die Bureaux befanden, schien mit seinem von Equipagen wimmelnden Hofe, seinem massiven Eisengitter, dem breiten Perron und der monumentalen Treppe, mit seiner Flucht glänzend eingerichteter Kabinete, seinen zahllosen Beamten und livrirten Dienern ein ernster, würdevoller Tempel des Geldes zu sein und die Leute, die mit ihren Angelegenheiten hierher kamen, wurden von einem andächtigen Schauer erfaßt, wenn sie das Heiligthum, die Kasse erblickten, zu welchem ein vollkommen kahler Korridor führte und in welchem man die eiserne Kasse sehen konnte, die an die Wand geschmiedet, mit ihren drei Schlössern und mächtigen Seitentheilen das Aussehen einer grimmigen Gottheit hatte.
Saccard vermittelte damals ein bedeutendes Geschäft für die Stadt. Nachdem die Stadt durch den Wirbeltanz der Millionen, welchen sie selbst entfesselt hatte, um dem Kaiser gefällig zu sein und gewisser Leute Taschen zu füllen, fortgerissen und in Schulden gestürzt worden, war sie genöthigt, ihre Zuflucht zu versteckten Anlehen zu nehmen, um nicht zu verrathen, daß auch sie von der Spekulationswuth angesteckt worden. Sie hatte gerade ihre sogenannten Delegationsbons, welche eigentlich unverfälschte Wechsel auf lange Zeit waren, in's Leben gerufen, um die Unternehmer sofort am Tage des Kontraktabschlusses zu bezahlen und diesen durch Veräußerung dieser Bons die Möglichkeit zur Beschaffung neuer Mittel zu bieten. Der Crèdit Viticole hatte dieses Papier entgegenkommend von seinen Klienten angenommen und an dem Tage, da es der Stadt an Geld mangelte, trat Saccard an sie heran. Sie erhielt eine bedeutende Summe ausbezahlt, auch eine neue Emission von Delegationsbons, welche Herr Toutin-Laroche von Konzessionen besitzenden Gesellschaften bekommen zu haben vorgab und welche er durch alle Pfützen der Spekulation zog. Fortan war der Crèdit Viticole unantastbar; er hielt ja Paris an der Kehle gefaßt. Der Director sprach nur mehr mit einem Lächeln von der famosen Marokkaner Hafengesellschaft; indeß lebte diese noch immer und die Zeitungen fuhren fort, die großen Handelsstationen zu preisen. Eines Tages redete Herr Toutin-Laroche Saccard zu, er möge Aktien dieser Gesellschaft kaufen; Jener lachte ihm aber in's Gesicht und fragte ihn, ob er ihn denn wirklich für so dumm ansehe, daß er sein Geld in Papieren der »Gesellschaft von Tausendundeiner Nacht« anlegen werde.
Bislang hatte Saccard mit Glück gespielt, hatte betrogen, sich selbst verkauft und aus jeder Operation Nutzen gezogen. Doch bald genügte ihm diese Thätigkeit nicht mehr; es widerstrebte ihm, sozusagen die Nachlese zu halten und das Gold zusammenzuraffen, welches Toutin-Laroche, Baron Gouraud und ihresgleichen hinter sich niederfallen ließen. Er fuhr mit beiden Armen bis an die Schulter in den Sack. Er verbündete sich mit den Herren Mignon, Charrier und Comp., diesen famosen Unternehmern, die damals noch am Beginn ihrer Thätigkeit standen und ein ungeheures Vermögen erwerben sollten. Die Stadt war bereits zu dem Entschluß gelangt, die Arbeiten nicht in eigener Regie auszuführen, sondern die Boulevards auf Akkord zu vergeben. Die im Besitze der Konzession befindlichen Gesellschaften verpflichteten sich, ihr gegen eine vereinbarte Entschädigung die fertige Straße sammt Bäumen, Bänken und Gaslaternen zu übergeben. Mitunter berechneten sie für die Straße selbst gar nichts, da sie durch die längs derselben gelegenen Baugründe, die sie für sich behielten und dann zu fetten Preisen veräußerten, reichlich entschädigt waren. Die fieberhafte Spekulation mit Baugründen, die unerhörte Preissteigerung der Häuser und sonstiger Immobilien datirt aus jener Zeit. Dank seinen Verbindungen erhielt Saccard die Konzession für drei Boulevard-Abschnitte. Er wurde die rastlose und ein wenig übereifrige Seele der ganzen Gesellschaft. Die Herren Mignon und Charrier, die ihm zu Beginn blind ergeben, waren schlaue, rohe Patrone, Maurermeister, die den Werth des Geldes kannten. Sie lachten insgeheim über die Equipagen Saccard's behielten ihre Blousen und zögerten auch nicht, bei einer Arbeit mit Hand anzulegen; mit Staub und Mörtel bedeckt kehrten sie des Abends heim. Beide stammten aus Langres, von wo sie ihren ruhigen, wenig intelligenten Geist nach dem unbefriedigten, heißen Paris brachten; doch wenn ihr Geist auch ein wenig beschränkt war, so verstanden sie es dennoch trefflich, jede Gelegenheit zu ergreifen, um ihre Taschen anzufüllen. Wenn Saccard die Geschäfte hastig betreiben wollte, es an Drängen und Aneifern nicht fehlen, sich durch seinen Heißhunger fortreißen ließ, so verhinderten die Herren Mignon und Charrier durch ihr schrittweises Vordringen, durch ihre gewandte, sichere Verwaltung sehr oft, daß er, verführt durch glänzende Aussichten, sich in Schwierigkeiten stürze. Sie willigten niemals ein, die eleganten Bureaux, das Hotel zu besitzen, welches er erbauen wollte, um Paris in Erstaunen zu setzen. Ebenso weigerten sie sich, die Spekulationen zweiten Ranges auszuführen, die jeden Tag in seinem Gehirn entstanden: Errichtung von Konzertsälen, großartigen Badeanstalten auf den freien Bauplätzen; er wollte Eisenbahnen erbauen, die längs der neuen Boulevards angelegt werden sollten, mit Glas gedeckten Galerien, die den Werth der Verkaufsläden verzehnfachen und bei schlechtem Wetter die Spaziergänger vor dem Naßwerden schützen würden. Um all' diesen Projekten, die sie mit Schrecken erfüllten, ein Ende zu bereiten, beschlossen die Unternehmer, die freien Baustellen unter die drei Genossen zu vertheilen und dann sollte Jeder nach Gutdünken mit seinem Antheil verfahren. Während sie fortfuhren, ihre Parzellen zu guten Preisen zu verkaufen, ließ Aristide bauen. In ihm arbeitete es wild, sein Gehirn befand sich in unablässiger fieberhafter Thätigkeit und er hätte in allem Ernste den Vorschlag gemacht, Paris unter eine ungeheure Glocke zu setzen, um es in ein Treibhaus zu verwandeln und Ananas und Zuckerrohr daselbst zu züchten.
Dank den bedeutenden Kapitalien, die er besaß, nannte er alsbald acht Häuser auf den neuen Boulevards sein eigen. Vier derselben: zwei in der Rue de Marignan und zwei auf dem Boulevard Haußmann, waren vollkommen fertig; die anderen vier, die auf dem Boulevard Malesherbes lagen, waren unvollendet, ja eines derselben, welches blos einen weiten von Brettern umgebenen Raum darstellte, auf welchem sich ein moderner Prachtbau hätte erheben sollen, war blos bis zum Fußboden des ersten Stockes gediehen. Zu dieser Zeit hatten sich seine Angelegenheiten derart komplizirt, hatte er so viele Fäden um jeden seiner Finger gerollt, so viele Interessen zu wahren und Marionetten in Bewegung zu setzen, daß er des Nachts kaum drei Stunden schlief und seine Korrespondenz in seinem Wagen las. Das Merkwürdigste war, daß seine Kasse unerschöpflich schien. Er war an allen Aktienunternehmungen betheiligt, baute mit einer wahren Wuth, beschäftigte sich mit Allem, womit Handel getrieben werden konnte und drohte, Paris gleich dem steigenden Meere zu überfluthen, ohne daß man jemals gesehen hätte, daß er einen bedeutenden Gewinn erzielte, oder höhere Geldbeträge einforderte. Dieser goldene Fluß, welcher, ohne daß man seine Quellen gekannt hätte, in eiligem Drängen aus seinem Arbeitszimmer hervorkam, erregte das Staunen und die Bewunderung der Müßiggänger und machte ihn für einen Moment zu dem von aller Welt gekannten Manne, welchem die Zeitungen jedes neue Börsenwitzwort in den Mund legten.
Die ehelichen Bande, welche Renée mit diesem Gatten vereinten, waren denn auch die denkbar lockersten. Es vergingen mitunter ganze Wochen, ohne daß sie ihn zu Gesichte bekam. Im Uebrigen konnte sie nicht über ihn klagen, denn seine Kasse stand ihr gänzlich zur Verfügung und sie liebte ihn im Grunde genommen, wie man einen zuvorkommenden Bankier liebt. Wenn sie sich in's Hotel Béraud begab, so rühmte sie seine vortrefflichen Eigenschaften ihrem Vater gegenüber, den der Reichthum seines Schwiegersohnes kalt und unberührt ließ. Ihre Verachtung war geschwunden; dieser Mensch – Aristide Saccard – schien so durchdrungen von der Ueberzeugung, daß das Leben nichts als ein Geschäft sei, er war so augenscheinlich dazu geboren, aus Allem Geld zu machen, was ihm unter die Hände kam: Kinder, Frauen, Pflastersteine, Gipssäcke, Gewissen, – daß sie ihm aus seiner mit größter Berechnung durchgeführten Heirath leinen Vorwurf machen konnte. Seit diesem Handelsgeschäfte betrachtete er sie gewissermaßen mit denselben Blicken, wie eines dieser schönen Häuser, die ihm zur Ehre gereichten und aus welchen er noch bedeutenden Nutzen zu ziehen hoffte. Er wollte, sie solle elegant gekleidet, bei allen Vergnügungen zugegen sein und ganz Paris den Kopf verdrehen. Dies gereichte ihm zum Vortheil und ließ sein Vermögen doppelt so groß erscheinen. Er war schön, jung, verliebt, unbesonnen durch seine Frau. Sie war seine Verbündete, seine Mitschuldige, ohne es zu wissen. Ein neues Paar Pferde, eine Toilette für zweitausend Thaler, ein liebenswürdiges Benehmen irgend einem Liebhaber gegenüber erleichterte, ja entschied mitunter sogar seine einträglichsten Geschäfte. Häufig schickte er sie auch unter dem Vorwande, sich vollkommen erschöpft zu fühlen, zu einem Minister, zu einem Funktionär, um eine Konzession zu erwirken oder einen Bescheid zu erhalten. Bei solchen Gelegenheiten sagte er ihr: »Sei vernünftig!« und das in einem zugleich spöttischen und schmeichelndem Tone, den nur er eigen hatte. Und wenn sie zurückkehrte und den gewünschten Erfolg erzielt hatte, so rieb er sich die Hände, indem er sein famoses: »Warst Du auch vernünftig?« wiederholte. Renée lachte. Er war zu thätig, um sich eine Frau Michelin zu wünschen; nur liebte er es, einen derben Scherz zu machen, schlüpfrige Hypothesen aufzustellen. Wenn Renée übrigens »nicht vernünftig gewesen wäre«, so hätte er keinen anderen Verdruß als den empfunden, die Gefälligkeit des Ministers oder des Funktionärs thatsächlich bezahlt haben zu müssen. Die Leute bethören, ihnen weniger geben, als sie für ihr Geld beanspruchen konnten, war sein Prinzip. Häufig konnte man ihn sagen hören: »Wenn ich eine Frau wäre, würde ich mich vielleicht verkaufen, die Waare aber niemals liefern; das wäre ja zu dumm!«
Die tolle, unberechenbare Renée, die eines Nachts am Pariser Himmel erschienen war, gleich der excentrischen Fee der weltlichen Genüsse, war eine sich jeglicher Analyse entziehende Frau. Wäre sie im Elternhause erzogen worden, so hätte sie gewiß durch die Religion oder irgend eine andere Beruhigung der Nerven den Stachel der Begierden abgestumpft. Ihr Kopf war gut spießbürgerlich veranlagt; sie besaß eine absolute Ehrbarkeit, eine Vorliebe für logische Dinge, eine tiefsitzende Furcht vor dem Himmel und der Hölle, eine Menge Vorurtheile; sie war ihrem Vater nachgerathen, dieser ruhigen, vorsichtigen Race, welche alle häuslichen Tugenden besaß. Und dessenungeachtet keimten und gediehen in dieser Natur die erstaunlichsten Phantasiegebilde, die unablässig neu erstehenden Begierden und Wünsche, die sie sich selbst nicht zu gestehen wagte. Bei den Damen in dem Kloster zur Heimsuchung Mariä war ihr Geist unter den mystischen Freuden der Kapelle und den sinnlichen Neigungen ihrer kleinen Freundinen umhergeirrt und so hatte sie sich selbst da eine phantastische Erziehung gegeben, das Laster kennen gelernt, hierbei ihrer ungeberdigen Natur keinerlei Zwang angethan und ihr junges Gehirn derart aus dem Geleise gebracht, daß sie eines Tages ihren Beichtvater nicht wenig in Verlegenheit brachte, indem sie ihm beichtete, daß sie während der Messe ein unbezwingliches Verlangen empfunden hatte, sich von ihrem Platz zu erheben und ihn zu küssen. Dann aber schlug sie sich die Brust und erbleichte bei dem Gedanken an den Teufel und seine Pechpfannen. Der Fehltritt, welcher späterhin ihre Verbindung mit Saccard nach sich zog, diese Vergewaltigung, welche sie mit einer Art erschrockener Erwartung über sich hatte ergehen lassen, erfüllte sie nachher mit einer gewissen Selbstverachtung, die bedeutsam zu dem Sichgehenlassen ihres ferneren Lebens beitrug. Sie dachte, es nütze doch nichts, gegen das Böse anzukämpfen, welches in ihr war und daß die Logik sie ermächtige, die Wissenschaft des Schlechten gänzlich auszukosten. Sie empfand eher Neugierde als wirkliches Verlangen. Inmitten des Wirbels des zweiten Kaiserreiches stehend, ihrer eigenen Phantasie anheimgegeben, überreichlich mit Geld versehen, ermuthigt, in den geräuschvollsten Vergnügungen fortzufahren, gab sie sich widerstandslos hin, bereute es darauf und schließlich gelang es ihr, ihre verstummende Ehrbarkeit gänzlich zu unterdrücken, zumal sie durch ihr unersättliches Verlangen, zu wissen und zu fühlen, unaufhaltsam vorwärts getrieben wurde.
Im Uebrigen segelte sie im gewöhnlichen Fahrwasser. Sie plauderte gerne halblaut und mit vielsagendem Lachen über das seltene Vorkommniß einer zärtlichen Freundschaft, wie sie zwischen Susanne Haffner und Adeline d'Espanet bestand; über das heikle Gewerbe der Frau von Lauwerens und die zu festgesetzten Preisen erhältlichen Küsse der Gräfin Vanska; doch betrachtete sie all' diese Dinge nur von Weitem, mit der unbestimmten Idee, dieselben selbst einmal zu verkosten und dieses unentschiedene Verlangen, welches sie in ihren bösen Stunden heimsuchte, vermehrte noch die sinnverwirrende Angst, dieses erschrockene Suchen nach einem einzigen, köstlichen Genuß, welcher nur ihr zu eigen bliebe. Ihre ersten Liebhaber hatten sie nicht verwöhnt; diesmal hatte sie gemeint, von einer großen Leidenschaft erfaßt worden zu sein, – die Liebe platzte in ihrem Kopfe gleich einer Petarde, deren Funken aber in ihrem Herzen nicht zündeten. Während eines Monats war sie wie toll, ließ sie sich überall mit ihrem Angebeteten sehen und eines schönen Morgens empfand sie an Stelle der gestrigen Zärtlichkeit eine niederschmetternde Gleichgiltigkeit, eine unendliche Leere, Der Erste, der junge Herzog von Rozan erfreute sich seiner Eroberung am wenigsten lange; Renée, der seine Ruhe und vortreffliche Haltung gefallen, fand, daß er im Tête-à-tête eine Null und im höchsten Grade langweilig sei. Herr Simpson, Attaché der amerikanischen Gesandtschaft, der nach ihm kam, behandelte sie fast roh und kam daher länger als ein Jahr aus mit ihr. Nach dieser Zeit wendete sie ihre Gunst dem Grafen von Chibray, Flügeladjutanten des Kaisers zu, ein schöner, eingebildeter Mann, der ihr merkwürdig lästig zu werden begann, als es der Herzogin von Sternich einfiel, sich in ihn zu verlieben und ihn an sich zu reißen. Nun beweinte sie ihn mit heißen Thränen und ihren Freundinen gegenüber äußerte sie sich, daß ihr Herz gebrochen sei und sie nicht mehr lieben werde. So kam endlich Herr von Mussy an die Reihe, der unbedeutendste Mensch von der Welt, der es nur seiner Gewandtheit beim Arrangiren von Rundtänzen zu danken hatte, daß er im diplomatischen Dienste vorwärts kam. Sie hätte niemals zu sagen vermocht, wie es eigentlich gekommen, daß sie sich ihm hingegeben und dennoch hielt sie es lange mit ihm, denn sie war bereits müde geworden und wollte sich nicht die Mühe geben, mit neuen Gestalten anzuknüpfen, bis sich ihr das Außerordentliche, Ungewöhnliche geboten, worauf sie wartete. Mit achtundzwanzig Jahren war sie bereits übersättigt. Die Langeweile aber däuchte ihr umso unerträglicher, da ihre spießbürgerlichen Tugenden die Stunden, in welchen sie sich langweilte, benützten, um sich zu beklagen und sie zu beunruhigen. Sie verschloß die Thür und hatte fürchterliche Migraine. Oeffnete sich ihre Thüre wieder, so kam zu derselben ein in Seide und Spitzen gehülltes Geschöpf herausgerauscht, welches keine Sorge und kein Erröthen kannte.
Inmitten ihres alltäglichen, vergnügungssüchtigen Lebens durchkostete sie aber einen Roman. Eines Tages war sie zu Fuße ausgegangen, um ihren Vater zu besuchen, der das Stampfen der Pferde vor seinem Hause nicht leiden mochte, als sie bei hereinbrechender Abenddämmerung heimkehrend, auf dem Quai Saint-Paul die Entdeckung machte, daß ihr ein junger Mann folge. Es war warm gewesen und der Tag neigte sich seinem Ende zu, eine gewisse liebesdurstige Atmosphäre zurücklassend. Bisher war man ihr immer nur zu Pferde durch die Alleen des Bois gefolgt und sie fand, daß dieses Abenteuer pikant sei; dasselbe schmeichelte ihr als eine Art neuer Huldigung und gerade die Brutalität, die Derbheit derselben übte einen prickelnden Reiz auf sie. Anstatt nach Hause zu gehen, schlug sie die Rue du Temple ein, wodurch sie ihren Galan über die Boulevards entlang führte. Der Mann aber wurde kühner und allmälig so zudringlich, daß Renée ein wenig erschrack, den Kopf verlor und durch die Rue de Faubourg-Poissonniere eilend, sich in den Laden der Schwester ihres Gatten flüchtete. Der junge Mann trat hinter ihr ein. Frau Sidonie lächelte, schien zu verstehen und ließ sie allein. Doch als ihr Renée folgen wollte, hielt der Unbekannte sie zurück, begann höflich, doch erregt zu sprechen und erlangte ihre Verzeihung. Der Mann war in irgend einem Amte angestellt, nannte sich Georg und sie fragte ihn niemals nach seinem Familiennamen. Zweimal fand sie sich ein, um mit ihm zusammenzukommen, wobei sie durch den Laden, er durch die Rue Papillon eintrat. Diese zufällige Liebe, die sich auf der Straße angeboten und ebendort angenommen worden, bereitete ihr ein lebhaftes Vergnügen. Sie erinnerte sich stets mit einiger Scham, aber auch mit einem Lächeln des Bedauerns an dasselbe. Frau Sidonie aber zog den Nutzen aus dem Abenteuer, daß sie endlich die Mitschuldige der Frau ihres Bruders wurde, eine Rolle, nach der sie sich seit dem Tage der Vermählung gesehnt.
Die arme Frau Sidonie hatte sich gewissermaßen verrechnet. Indem sie an dem Zustandekommen dieser Verbindung arbeitete, hatte sie gehofft, sozusagen auch für ihre Person Renée zu heirathen, an dieser eine Klientin zu bekommen und eine Menge kleiner Vortheile aus ihr zu ziehen. Sie beurtheilte die Frau auf den ersten Blick, gleichwie ein Kenner ein Pferd beurtheilt. Ihre Bestürzung war daher keine geringe, als sie, nachdem sie den jungen Eheleuten einen Monat gegönnt, um sich ein wenig einzurichten, sich sagen mußte, daß sie zu spät gekommen, denn als sie wieder vorsprach, sah sie im Salon Frau von Lauwerens thronen. Diese, eine schöne Frau von sechsundzwanzig Jahren, hatte den Beruf, Neulinge in die Geheimnisse des gesellschaftlichen Lebens einzuführen. Sie gehörte einer sehr alten Familie an und war mit einem hochgestellten Finanzmanne verheirathet, der die Thorheit beging, die Bezahlung der Schneider- und Putzmacherrechnungen zu verweigern. Die Dame, die ebenso intelligent wie liebenswürdig war, sorgte nun selbst für sich. Sie verabscheute die Männer, wie sie Jedem versicherte, der es hören wollte; dagegen verschaffte sie all' ihren Freundinen welche, und stets fand sich eine vollständige Auswahl in den Gemächern, welche sie in der Rue de Provence, oberhalb der Bureaux ihres Gatten innehatte. Man nahm daselbst kleine schmackhafte Imbiße ein und kam auf ebenso unerwartete als reizende Weise zusammen. Es hatte gar nichts Anstößiges an sich, wenn ein junges Mädchen ihre liebe Frau von Lauwerens besuchte und es war sicherlich nur der reine Zufall, wenn auch Herren zugegen waren, die sich im Uebrigen eines tadellosen Benehmens befleißigten und den besten Kreisen angehörten. Die Hausfrau selbst nahm sich reizend aus in ihren großen weißen Spitzenkleidern, so daß ihr so mancher Besucher den Vorzug vor ihrer Sammlung blonder und brünetter Schönheiten gegeben hätte. Doch die Chronik versichert, daß sie von absoluter Enthaltsamkeit war. Hierin lag das ganze Geheimniß des Geschäftes. Sie behauptete ihre hohe Stellung in der Gesellschaft, hatte alle Männer zu ihren Freunden, bewahrte ihren Stolz als ehrbare Frau und erfreute sich insgeheim daran, die anderen Frauen zu Falle zu bringen und hieraus sogar Nutzen zu ziehen. Als sich Frau Sidonie über den Mechanismus der neuen Erfindung klar geworden, war sie niedergeschmettert. Die Frau in dem alten schwarzen Kleide, die die Liebesbriefe in ihrem Körbchen beförderte, vertrat die alte, die klassische Schule, die sich jetzt der modernen Schule gegenübergestellt sah, dieser großen Dame, die ihre Freundinen in ihrem Boudoir bei einer Tasse Thee verkauft. Und die moderne Schule triumphirte. Frau von Lauwerens hatte nur einen kalten Blick für die zerknitterte Toilette der Frau Sidonie, in der sie eine Rivalin witterte. Thatsächlich war es ihre Hand, aus welcher Renée ihren ersten Liebhaber, den jungen Herzog von Rozan empfing, welchen die schöne Vermittlerin nur sehr schwer unterzubringen vermochte. Erst später gewann die klassische Schule wieder die Oberhand, als Frau Sidonie ihr Halbgeschoß der flüchtigen Neigung ihrer Schwägerin für den Unbekannten vom Quai Saint-Paul zur Verfügung stellte. Und von da an blieb sie auch ihre Vertraute.
Einer der Getreuen der Frau Sidonie war Maxime. Noch nicht fünfzehn Jahre alt trieb er sich bereits bei seiner Tante umher, um an den Handschuhen zu riechen, die er in den Fauteuils, auf den Möbeln fand. Sidonie, die jeder klaren Situation mit Abscheu aus dem Wege ging und ihre Gefälligkeiten niemals eingestand, überließ ihm schließlich die Schlüssel zu ihrer Wohnung, indem sie ihm sagte, sie müsse auf's Land gehen, wo sie bis zum nächsten Tage zu bleiben gedenke. Maxime sprach von Freunden, die er nicht im Hause seines Vaters empfangen dürfe und die er gerne hierher führen möchte. Und so verbrachte er denn in dem Halbgeschoß der Rue du Faubourg-Poissonnière mehrere Nächte mit dem armen Mädchen, welches man nachher auf's Land schicken mußte. Frau Sidonie streckte ihrem Neffen Geld vor und verhätschelte den »lieben Kleinen, der noch ganz bartlos war und rosig wie ein Amor«.
Maxime war aber herangewachsen und nunmehr ein schlanker, hübscher, junger Mann, der die rosigen Wangen und blauen Augen des Kindes sich bewahrt hatte. Sein lockiges Haar trug noch dazu bei, ihm das »mädchenhafte Aussehen« zu verleihen, welches die Damen so sehr entzückte. Er sah der armen Angèle ähnlich und besaß auch ihren sanften Blick, ihre Blässe und blonden Haare, Aber er taugte nicht einmal so viel, als diese gleichmüthige, unbedeutende Frau. In ihm verfeinerte sich die Race der Rougons, wurde zarter und lasterhafter. Von einer Mutter stammend, die zu jung gewesen, als sie ihn geboren, brachte er ein merkwürdiges Gemisch des Heißhungers seines Vaters, der Hingebung und Weichheit seiner Mutter mit sich; er war ein mangelhaftes Produkt, in welchem die Fehler der Eltern sich ergänzten und noch verschlimmert erschienen. Diese Familie lebte zu rasch und erstarb bereits in diesem gebrechlichen Körper, bei welchem selbst das Geschlecht gezögert haben mußte und welcher nicht mehr den eisernen Willen, Reichthum und Genüsse anzusammeln gleich Saccard, sondern eine weichliche, kraftlose Natur darstellte, welche die angesammelten Reichthümer verzehrte; ein absonderlicher Hermaphrodit, rechtzeitig erschienen inmitten einer Gesellschaft, die in Fäulniß überzugehen begann. Wenn sich Maxime mit seinen Hüften, um die ihn eine Frau hätte beneiden können, auf seinem hübschen Pferde, in dessen Sattel er sich leicht wiegte, im Bois einfand, so repräsentirte er mit seinem frauenhaften Wuchse, seinen schlanken, weißen Händen, seiner kränklichen, verschmitzten Miene, seiner korrekten Eleganz und seinem Theater-Kauderwälsch die Gottheit dieser Epoche. Mit zwanzig Jahren war er über alle Ueberraschungen und jeden Ekel erhaben. Sicherlich hatte er von den ungewöhnlichsten Ausschweifungen geträumt. Das Laster war bei ihm kein Abgrund, wie bei gewissen Greisen, sondern eine natürliche und rein äußerliche Blüthe und saß in seinen blonden Haaren, lächelte mit seinen Lippen und stack in seinen Kleidern. Am meisten charakterisirten ihn aber seine Augen, diese zwei blauen Löcher, die hell und lächelnd an den Spiegel einer Kokette erinnerten und hinter welchen man die ganze Leere des Gehirns gewahrte. Diese Augen einer feilen Dirne senkten sich niemals zu Boden; sie suchten stets nach neuen Vergnügungen.
Der ewige Luftzug, welcher in dem Hause der Rue de Rivoli herschte und die Thüren desselben in fortwährender Bewegung erhielt, wurde immer stärker, je mehr Maxime heranwuchs, je weiter Saccard seine Operationen ausdehnte und je fieberhafter Renée nach einem unbekannten Genusse suchte. Diese drei Menschen führten in dem geräumigen Hause schließlich ein Leben, welches ebensosehr durch seine Freiheit, wie durch seine Thorheit in Erstaunen setzte. Es war die reife und merkwürdige Frucht einer ganzen Epoche. Die Straße schien in die Wohnung hinaufzusteigen, mit ihrem Wagengerassel, ihrem Getümmel von Unbekannten, ihrer Ungebundenheit der Rede. Vater, Stiefmutter und Stiefsohn thaten, sprachen und benahmen sich, als hätte sich Jeder allein befunden und ein Junggesellenleben geführt. Drei Kameraden, drei Studenten, die ein möblirtes Zimmer gemeinschaftlich bewohnen, hätten über dieses Zimmer nicht mit mehr Unbefangenheit verfügen können, um daselbst ihren Lastern, ihren geräuschvollen Vergnügungen zu fröhnen. Sie reichten sich zum Empfang die Hände, schienen die Beweggründe gar nicht zu ahnen, welche sie unter demselben Dache vereint hielten, behandelten sich gegenseitig mit heiterer Ritterlichkeit und wahrten sich dergestalt eine absolute Unabhängigkeit. Den Begriff des Familienlebens schien bei ihnen eine Art Gesellschaftshandlung zu vertreten, in welcher die Einkünfte zu gleichen Theilen vertheilt werden; - Jeder nahm seinen Antheil an Vergnügungen und Geldvorrat entgegen und man war stillschweigend darin übereingekommen, daß Jeder seinen Antheil nach seinem Belieben verzehren werde. Es kam so weit, daß die drei Personen sich gegenseitig ganz rückhaltslos über ihre Abenteuer und Zerstreuungen berichteten, ohne beim Andern mehr als etwas Neid oder Neugierde zu erregen.
Jetzt unterrichtete bereits Maxime seine Stiefmutter. Wenn er sich mit ihr in's Bois begab, erzählte er ihr von den Kokotten allerlei Geschichten, die Beide sehr erheiterten. Kein neues Gesicht konnte zum Vorschein kommen, ohne daß er darnach getrachtet hätte, den Namen des Liebhabers der Betreffenden zu erfahren; er mußte wissen, welchen Monatgehalt sie von demselben bezog und wie sie ihr Leben einrichtete. Er kannte diese Damen genau, wußte intime Details zu erzählen; er war ein lebender Katalog, in welchem alle Dirnen von Paris angeführt und mit ausführlichen orientirenden Daten versehen waren. Diese Art Skandalzeitung bereitete Renée einen hohen Genuß, Wenn sie in Longchamp bei den Renée erschien, hörte sie, während sie mit der stolzen, unnahbaren Miene der vornehmen Frau in den seidenen Kissen ihres Wagens lag, mit einer wahren Gier ihrem Stiefsohne zu, der ihr erzählte, wie Blanche Müller ihren Gesandschaftsattaché mit ihrem Friseur hintergehe, oder wie der kleine Baron den Grafen in Unterhosen in dem Alkoven einer mageren Berühmtheit angetroffen habe, die man ihrer rothen Haare wegen den »gesottenen Krebs« nannte. Jeden Tag gab es etwas Neues und wenn die Geschichte zu arg war, so dämpfte Maxime die Stimme, erzählte aber getreulich bis zu Ende. Renée machte große Augen, wie ein Kind, dem man eine ergötzliche Fabel erzählt, unterdrückte ihr Lachen und verbarg es dann hinter dem spitzenbesetzten Taschentuch, welches sie anmuthig an ihre Lippen hielt,
Maxime brachte auch die Photographieen dieser Damen mit sich. In jeder Tasche, ja sogar in seinem Zigarrenetui hatte er Bilder von Schauspielerinen. Zuweilen, wenn er sich derselben entledigen wollte, steckte er die Bilder in die Albums, die im Salon auf den Tischen umherlagen und bereits die Porträts der Freundinen Renèe's enthielten. In den Albums befanden sich auch Photographieen von Männern; die der Herren von Rozan, Simpson, von Chibray, von Mussy, gleichwie von Schauspielern, Schriftstellern, Abgeordneten, die auf räthselhafte Weise hinzugekommen waren, um die Sammlung zu vergrößern. Eine merkwürdig gemischte Welt, ein Abbild des Wirrsals von Ideen und Personen, die das Leben Renée's und Maxime's bewegten. Wenn es regnete, wenn man Langeweile hatte, bot dieses Album reichlichen Stoff zur Unterhaltung und immer wieder gerieth es Einem unter die Hände. Gähnend öffnete die junge Frau dasselbe, zum hundertsten Male vielleicht. Dann wurde die Neugierde rege und der junge Mann trat hinter sie, um über ihre Schultern hinweg gleichfalls in das Album zu blicken. Dann wurden eifrige Debatten geführt, die bald den Haaren des »gesottenen Krebses«, dem doppelten Kinn der Frau von Meinhold, den Augen der Frau von Lauwerens, bald dem Busen der Blanche Müller, der etwas schiefen Nase der Marquise oder dem Munde der kleinen Sylvia galten, der von seinen starken Lippen her berühmt war. Sie verglichen all' diese Frauen unter und mit einander.
»Wenn ich ein Mann wäre,« sagte Renée, »so würde ich Adeline wählen.«
»Weil Du Sylvia nicht kennst,« erwiderte Maxime »Sie ist zu drollig! ... Mir ist Sylvia lieber.«
Damit wurde weiter geblättert und wenn dann die Bildnisse des Herzogs von Rozan, des Herrn Simpson oder des Grafen von Chibray zum Vorschein kamen, so fügte der junge Mann spöttisch hinzu:
»Uebrigens ist es eine ausgemachte Sache, daß Du einen schlechten Geschmack hast... Kann man sich etwas Dümmeres vorstellen, als die Gesichter dieser Herren? Rozan und Chibray sehen meinem Friseur Gustave ähnlich.«
Renée zuckte mit den Achseln, gleichsam um anzudeuten, daß diese Ironie sie unberührt lasse. Sie fuhr fort, die verschiedenen, bald lächelnden, bald unfreundlichen Gesichter zu betrachten, welche das Album enthielt; besonders lange hielt sie sich bei den Bildern der Mädchen auf, um neugierig die geringsten Details der Photographieen, die Falten und Härchen zu besichtigen. Eines Tages ließ sie sich sogar ein starkes Vergrößerungsglas holen, weil sie auf der Nase des »Krebses« ein Haar glaubte wahrgenommen zu haben. Und thatsächlich zeigte ihr die Lupe ein goldenes Härchen, welches von den Augenbrauen herrühren mochte. Dieses Härchen bot ihnen lange Zeit Stoff zum Lachen. Während einer ganzen Woche mußten die Damen, die zu Besuch kamen, sich durch den Augenschein von dem Vorhandensein dieses Härchens überzeugen. Von da an diente die Lupe dazu, die Gesichter der Damen auf das Sorgfältigste zu untersuchen. Hierbei machte Renée überraschende Entdeckungen; sie fand unbekannte Runzeln, rauhe Haut und Lücken in derselben, welche das Reispulver nur ungenügend verbarg. Schließlich ließ Maxime die Lupe verschwinden, indem er erklärte, er wollte das weibliche Gesicht nicht auf solche Weise verunglimpfen lassen, in Wahrheit aber, weil Renée die dicken Lippen Sylvia's, für die er eine besondere Vorliebe empfand, einer zu strengen Kritik unterzog. Dafür wurde ein neues Spiel ersonnen. Sie stellten die Frage auf: »Mit wem möchte ich am liebsten eine Nacht verbringen?« und schlugen das Album auf, welches ihnen die Antwort brachte. Dieses Spiel führte die ergötzlichsten Verwickelungen herbei. Während einiger Abende nahmen die Freundinen gleichfalls Theil daran. So wurde Renée nacheinander mit dem Erzbischof von Paris, mit dem Baron Gouraud und dem Grafen Chibray vermählt, was allgemeines Gelächter erregte, mitunter auch mit ihrem Gatten, was sie ganz zornig machte. Was Maxime betraf, so fiel ihm – entweder aus Zufall oder aus Renée's Bosheit – stets die Marquise zu. Doch wurde nie so herzlich gelacht, als wenn der Zufall zwei Männer oder zwei Frauen zusammenführte. Die Kameradschaft zwischen Renée und Maxime ging so weit, daß sie ihm sogar das Leid ihres Herzens klagte. Er tröstete sie und ertheilte ihr Rathschläge. Sein Vater schien gar nicht zu existiren. Dann theilten sie sich Begebenheiten aus ihrer Jugendzeit mit. Insbesondere wurden sie auf ihren Fahrten durch das Bois von einer unbestimmten Sehnsucht erfaßt, sich gegenseitig Dinge zu erzählen, die man nur schwer oder gar nicht sagen kann. Jene Freude, welche Kinder empfinden, wenn sie ganz leise über verbotene Dinge sprechen können, jener Reiz, der für einen jungen Mann und eine junge Frau darin liegt, mit einander in das Laster hinabsteigen zu können, wenn auch nur mit Worten, brachte sie unablässig auf anstößige Dinge zu sprechen. Sie genossen hiedurch eine Wollust, über welche sie sich keinen Vorwurf zu machen hatten, an welcher sie sich erfreuten, während sie gemächlich in den beiden Ecken des Wagens lagen, gleich zwei Schulfreunden, die über ihre ersten muthwilligen Streiche plaudern. Schließlich prahlten sie sogar mit ihrer Unsittlichkeit. Renée gestand, daß die kleinen Mädchen im Pensionat sehr schlau und durchtrieben seien. Maxime that erstaunt und wagte es, ihr einige der skandalösen Geschichten zu erzählen, die sich im Colleg zu Plassans zugetragen.
»Ach! ich kann es gar nicht sagen ...« murmelte Renée.
Darauf neigte sie sich an sein Ohr, als hätte schon der Ton ihrer Stimme genügt, um sie erröthen zu machen und flüsterte ihm eine jener Klostergeschichten zu, wie sie in unfläthigen Gassenhauern besungen werden. Er besaß zu diesen Dingen eine zu reiche Auswahl, als daß er ihr etwas schuldig geblieben wäre. Dicht an ihr Ohr geneigt, sang er leisen Tones irgend ein gemeines Couplet. So geriethen sie allmälig in einen Zustand absonderlicher Mattigkeit, umschmeichelt von all' diesen sinnlichen Gedanken, die sie hegten, angenehm gekitzelt von den sich leise regenden Wünschen, die sich nicht in Worte kleiden ließen. Sanft rollte der Wagen dahin und wenn sie heimkehrten, empfanden sie eine köstliche Mattigkeit, eine größere Erschöpfung als am Morgen einer Liebesnacht. Sie hatten Schlechtes gethan, gleich zwei schulschwänzenden Knaben, die, weil sie keine Mädchen finden, sich mit ihren gegenseitigen Erinnerungen begnügen.
Eine noch größere Vertraulichkeit herrschte aber zwischen Vater und Sohn. Saccard war sich darüber klar geworden, daß ein großer Finanzmann die Frauen lieben und einige Thorheiten für dieselben begehen müsse. Seine Liebe war brutal, denn er zog das Gold vor; doch sein Programm erheischte es, daß er sich in den Alkoven herumtrieb, einige Banknoten aus gewissen Kaminplatten zurückließ und von Zeit zu Zeit irgend eine hervorragende Vertreterin der Halbwelt als Aushängeschild seiner Spekulationen benützte. Als Maxime die Schulen hinter sich hatte, trafen sie nicht selten bei denselben Damen zusammen und darüber lachten sie nur. Sie wurden sogar in gewissem Sinne Rivalen. Wenn der junge Mann mit irgend einer lustigen Schaar im Maison d'Or speiste, vernahm er im angrenzenden Zimmer mitunter die Stimme Saccard's.
»Ach! Papa ist auch da!« rief er dann mit einer Grimasse aus, die er irgend einem bekannten Schauspieler abgelernt zu haben schien. Und ohne sich irgend einen Zwang anzuthun, pochte er an die Thür des Zimmers, um die Schöne seines Vaters zu sehen.
»Ah! Du bist es!« sprach dieser heiter. »Komm doch herein. Ihr macht da nebenan einen Lärm, daß man seinen eigenen Bissen nicht hört. Wen habt Ihr denn mit Euch?«
»Laura d'Aurigny, Sylvia, den Krebs und noch zwei Andere, glaube ich. Die Damen sind erstaunlich; sie stecken die Finger in die Schüsseln und werfen uns Salatblätter an die Köpfe. Meine Kleider sind schon ganz ölfleckig.«
Der Vater lachte, da ihm dies sehr drollig dünken mochte.
»Ja, Jugend hat nicht Tugend,« murmelte er. »Bei uns geht es anders zu, nicht wahr, mein Schatz? Wir haben hübsch gemächlich gegessen und jetzt werden wir ein wenig schlafen.« Damit faßte er seine Dame am Kinn und girrte mit seinem provençalischen, näselnden Tone, was eine seltsame Liebesmusik gab.
»Ach! der alte Narr!« rief die Frau aus. »Guten Tag, Maxime. Ich muß Sie wohl sehr lieb haben, wie, wenn ich mich entschließe, mit Ihrem Hallunken von Vater zu soupiren? ... Man kriegt Sie ja gar nicht mehr zu sehen ... Kommen Sie übermorgen Früh zu mir ... Nein, nein, ich habe Ihnen etwas zu sagen.«
Saccard, der sich gemächlich eine Pfirsich schälte, küßte die Frau auf die Schulter und sagte zuvorkommend:
»Ihr wißt, meine Lieben, wenn ich Euch hinderlich bin, ... ich räume Euch gerne das Feld ... Und wenn man wiederkommen darf, werdet Ihr läuten.«
Zuweilen nahm er die Dame mit sich oder er schloß sich mit ihr der Gesellschaft im anstoßenden Salon an. Maxime und er erfreuten sich an den gleichen Schultern; ihre Arme schlangen sich um dieselben Hüften. Sie erzählten sich gegenseitig mit lauter Stimme, was ihnen die Frauen, anvertraut hatten. Und sie trieben die Vertraulichkeit so weit, daß sie mit einander darüber beriethen, wie man die Blonde oder die Braune, die einem von ihnen ganz besonders gefiel, aus der Gesellschaft entführen könnte.
Im Mabille-Garten waren sie wohlbekannt. Sie fanden sich daselbst Arm im Arm, nach irgend einem seinen Diner ein, machten einen Spaziergang durch den Garten, grüßten die Frauen und wechselten im Vorübergehen einige Worte mit denselben. Sie lachten laut, ohne von einander zu gehen und unterstützten sich gegenseitig, wenn die Unterhaltung eine zu lebhafte wurde. Der nach dieser Richtung hin sehr sattelfeste Vater vertheidigte die Liebschaften seines Sohnes. Zuweilen ließen sie sich an einem Tische nieder und pokulirten mit den Damen; dann setzten sie sich wieder an einen anderen Tisch oder setzten ihre Promenade fort. Und bis Mitternacht konnte man sie freundschaftlich Arm in Arm die leichtgeschürzten Dämchen durch die mit gelbem Kies bestreuten Alleen verfolgen sehen.
Wenn sie heimkehrten, haftete ihren Gewändern etwas von den Mädchen an, die sie soeben verlassen. Ihre ungezwungenen Bewegungen, die Ueberreste gewisser gewagter Worte und gewisser frecher Geberden erfüllten das Haus in der Rue de Rivoli mit dem Geruche verdächtiger Schlafgemächer. Die weiche, lässige Art, in welcher der Vater dem Sohne die Hand reichte, besagte schon zur Genüge, woher sie kämen. An dieser Atmosphäre holte sich Renée ihre Kaprizen, ihre sinnlichen Beklemmungen; sie ließ es auch an spöttischen Bemerkungen nicht fehlen.
»Woher kommt Ihr denn?« fragte sie. »Ihr riecht nach Pfeifentabak und Muskat. – Ich bekomme sicher meine Migraine – –«
Thatsächlich verursachte ihr der fremde Geruch großes Unbehagen; dies war der charakteristische Duft dieser absonderlichen Häuslichkeit.
Maxime aber wurde von wirklicher Leidenschaft für die kleine Sylvia erfaßt. Mehrere Monate hindurch langweilte er seine Stiefmutter mit dieser Person und Renée kannte dieselbe alsbald ganz genau, vom Scheitel bis zur Fußspitze. An einer Hüfte hatte sie ein bläuliches Mal; nichts war so reizend wie ihre Kniee und ihre Schultern waren insoferne merkwürdig, als sich nur auf der linken ein kleines Grübchen befand. Maxime setzte einen gewissen Werth darein, auf ihren gemeinschaftlichen Ausfahrten nur über die Vorzüge seiner Geliebten zu sprechen. Als man eines Abends aus dem Bois zurückkehrte, mußten die Wagen Renée's und Sylvia's, die in ein Gedränge gerathen waren, dicht neben einander anhalten. Die beiden Frauen musterten sich mit lebhafter Neugierde, während Maxime auf's höchste von dieser kritischen Situation ergötzt, das Lachen kaum zu unterdrücken vermochte. Als sich der Wagen neuerdings in Bewegung setzte und seine Stiefmutter in düsterem Schweigen verharrte, glaubte er, sie sei ihm böse. Er bereitete sich daher auf eine jener mütterlichen Scenen vor, in denen sie sich mitunter in ihren Mußestunden noch gefiel.
»Kennst Du den Juwelier dieser Dame?« fragte sie ihn plötzlich, gerade als der Wagen auf der Place de la Concorde anlangte.
»Ach ja!« erwiderte er mit einem Lächeln. »Ich bin ihm zehntausend Francs schuldig ... Weshalb fragst Du aber?«
»Es hat keinen besonderen Grund.«
Und nach einer abermaligen Pause hub sie neuerdings an:
»An der linken Hand hatte sie ein sehr niedliches Armband ... Ich hätte es gerne in der Nähe gesehen.«
Man langte daheim an, ohne daß sie weiter etwas gesprochen hätte. Erst am nächsten Tag, gerade als Maxime mit seinem Vater das Haus verlassen wollte, zog sie den jungen Mann auf die Seite und sprach leisen Tones, mit verlegener Miene und einem hübschen Lächeln zu ihm, welches bereits um Verzeihung bat. Er schien überrascht zu sein und entfernte sich dann, wobei sein gewohntes hämisches Lächeln zur Geltung kam. Am Abend brachte er Sylvia's Armband mit sich, um es seiner Stiefmutter zu zeigen, die ihn darum gebeten.
»Da ist das Ding,« sagte er. »Man wird Deinethalben noch zum Dieb, Stiefmama.«
»Sie hat nicht gesehen, als Du es an Dich nahmst?« fragte Renée, das Schmuckstück gierig betrachtend.
»Ich glaube nicht ... Sie hatte es gestern angelegt und wird es heute sicherlich nicht anlegen wollen.« Inzwischen war die junge Frau an das Fenster getreten und hatte das Armband dabei angelegt. Jetzt hob sie den Arm ein wenig empor, um den Schmuck im Sonnenlicht funkeln zu lassen, wobei sie entzückt wiederholte:
»Sehr hübsch! sehr niedlich ... Nur die Smaragde wollen mir nicht sonderlich gefallen.«
In diesem Augenblick trat Saccard ein und da sie den Arm noch immer erhoben hielt, rief er erstaunt aus:
»Das ist ja Sylvia's Armband!«
»Sie kennen es?« fragte sie verlegener noch als er, nicht wissend, was sie mit ihrem Arm anfangen solle.
Er aber hatte sich bereits gefaßt und seinem Sohn mit dem Finger drohend, murmelte er:
»Dieser Schlingel hat immer verbotene Früchte, in der Tasche! ... Eines schönen Tages wird er uns den ganzen Arm der Dame sammt dem Armband nach Hause bringen.«
»Ach! ich bin unschuldig an der Sache,« erwiderte Maxime feige und hinterlistig. »Renée hatte es sehen wollen.«
»Ah!« begnügte sich der Gatte zu sagen und indem er das Schmuckstück gleichfalls betrachtete, wiederholte er gleich seiner Frau:
»Sehr hübsch! sehr niedlich!«
Damit verließ er das Zimmer mit gelassener Miene und Renée schalt Maxime aus, weil er sie derart verrathen. Er aber versicherte ihr, daß sich sein Vater durchaus nicht an derartige Dinge kehre. Darauf gab sie ihm das Armband zurück und sagte:
»Bestelle mir bei dem Juwelier ein ganz gleiches; blos an Stelle der Smaragde sollen Saphire kommen.«
Saccard konnte nicht lange einen Gegenstand oder eine Person in seiner Nähe haben, ohne dieselbe verwerthen oder sonst welchen Vortheil aus ihr ziehen zu wollen. Sein Sohn war noch keine zwanzig Jahre alt, als er bereits daran dachte, ihn irgendwie zu verwerthen. Ein hübscher Junge, der Neffe eines Ministers, der Sohn eines großen Finanzmannes mußte seinen Weg machen. Wohl war er noch etwas jung; immerhin aber konnte man ihm eine Frau und eine Mitgift suchen und die Vermählung je nach den Geldverlegenheiten des Hauses beschleunigen oder in die Länge ziehen. Auch hierin hatte er eine glückliche Hand. In einem Aufsichtsrathe, dem auch er als Mitglied angehörte, machte er die Bekanntschaft eines schönen, großen Mannes, eines Herrn von Mareuil, den er nach zwei Tagen in der Tasche hatte. Vordem war er Zuckerfabrikant in Havre gewesen und hatte Bonnet geheißen. Nachdem er sich ein bedeutendes Vermögen erworben, hatte er ein vornehmes junges Mädchen geheirathet, welches ebenfalls sehr reich war und einen Einfaltspinsel als Gatten benöthigte. Bonnet setzte es durch, daß er den Namen seiner Frau annehmen durfte, was für ihn eine Befriedigung seiner Eitelkeit bedeutete. Seine Heirath aber hatte ihn mit einem tollen Ehrgeiz erfüllt und er träumte davon, als Gegenleistung für Helenens Adel sich eine hohe politische Stellung zu erwerben. Von diesem Augenblick an fütterte er die neuen Journale mit seinem Gelde, erwarb bedeutende Grundbesitzungen und bereitete sich mit allen bekannten Mitteln eine Kandidatur in die gesetzgebende Körperschaft vor. Bisher war es ihm nicht gelungen, über die Vorbereitungen hinauszukommen, ohne daß er darum etwas von seiner Würde eingebüßt hätte. Einen größeren Hohlkopf mochte es schwerlich jemals gegeben haben. Er hatte einen herrlich modellirten Kopf, das bleiche, nachdenkliche Gesicht eines großen Staatsmannes und da er es vortrefflich verstand, mit durchdringenden Blicken und einer majestätischen Ruhe des Gesichtes zuzuhören, so konnte man glauben, daß sich in seinem Inneren eine gewaltige Gedankenarbeit vollziehe und er Schlüsse und Vergleiche zu ziehen bemüht sei. In Wirklichkeit ober dachte er an gar nichts. Dagegen gelang es ihm, die Leute in Verlegenheit zu bringen, da man nicht mehr wußte, ob man es mit einem überlegenen Geiste oder einem Einfaltspinsel zu thun habe. Herr von Mareuil klammerte sich an Saccard wie an einen Rettungsanker. Er wußte, daß in dem Departement, in welchem seine Besitzungen gelegen waren, eine Neuwahl erforderlich sei und wünschte nichts sehnlicher, als daß ihn der Minister für dieselbe in Vorschlag bringe; dies war seine letzte Hoffnung. Darum auch lieferte er sich dem Bruder des Ministers auf Gnade und Ungnade aus. Saccard, der hier ein vortheilhaftes Geschäft witterte, legte ihm den Gedanken an eine Heirath zwischen seiner Tochter Luise und Maxime nahe. Der Andere erging sich in Dankesbetheuerungen, meinte dieses Heirathsprojekt schon längst im Stillen gehegt zu haben und schätzte sich glücklich, in die Familie eines Ministers gelangen und Luise mit einem jungen Manne verheirathen zu können, der zu den schönsten Hoffnungen berechtigte.
Luise sollte laut Angabe ihres Vaters eine Mitgift von einer runden Million erhalten. Mißgestaltet, häßlich und anbetungswürdig war sie verurtheilt, jung zu sterben; ein Brustleiden nagte heimtückisch an ihr und verlieh ihr eine nervöse Heiterkeit, eine schmeichelnde Anmuth. Kranke junge Mädchen altern schnell, werden vorzeitig zu Frauen. Sie besaß eine sinnliche Naivetät und schien mit fünfzehn Jahren vollkommen mannbar zur Welt gekommen zu sein. Wenn ihr Vater, dieser gesunde, baumstarke Riese sie anblickte, konnte er gar nicht glauben, daß sie seine Tochter sei. Ihre Mutter war bei Lebzeiten gleichfalls groß und stark gewesen; doch waren über sie Gerüchte im Umlauf, welche die Verkrüppelung dieses Kindes, sein zigeunerhaftes Betragen, seine lasterhafte, reizende Häßlichkeit erklärlich machten. Man behauptete, Helene von Mareuil sei infolge der schändlichsten Ausschweifungen gestorben. Die Vergnügungen hatten sie zerfressen und unterhöhlt gleich einem giftigen Geschwür, ohne daß der Gatte den augenscheinlichen Wahnsinn seiner Frau, um dessenwillen er sie in eine Irrenanstalt hätte bringen müssen, wahrgenommen hätte. Aus diesem kranken Mutterleibe hervorgegangen, war Luise schon bei ihrer Geburt blutarm, ihre Gliedmaßen mißgestaltet, das Gehirn angegriffen und die Erinnerung bereits von einem lasterhaften Leben erfüllt. Zuweilen glaubte sie sich undeutlich an eine andere Existenz zu erinnern und von wallenden Nebeln beschattet sah sie bizarre Scenen sich abspielen, Männer und Frauen, die sich umschlungen hielten, – ein ganzes Drama der Sinnlichkeit, an welchem sich ihre kindliche Neugierde ergötzte. Ihre Mutter sprach in ihr. Heranwachsend fühlte sie diese Erinnerungen nicht schwächer werden. Nichts setzte sie in Erstaunen; sie erinnerte sich an Alles, besser gesagt, sie wußte Alles und berührte verbotene Dinge mit einer Sicherheit, die sie einer Person ähnlich machte, die nach langer Abwesenheit endlich heimkehrt und blos den Arm auszustrecken braucht, um es sich behaglich zu machen und sich an ihrer Häuslichkeit zu erfreuen. Dieses merkwürdige Mädchen, dessen schlechte Instinkte denen Maxime's schmeichelten, welches aber eine kecke Unschuld, ein prickelndes Gemisch von Kindlichkeit und Kühnheit in diesem zweiten Leben besaß, das sie als Jungfrau mit dem Bewußtsein und Schamgefühl der reifen Frau nochmals durchlebte, mußte dem jungen Mann schließlich gefallen und ihm bedeutend drolliger dünken als Sylvia, die als Tochter eines ehrsamen Papierhändlers bei aller Schlauheit im Grunde genommen eine sehr spießbürgerliche Natur war.
Lachend wurde die Heirath vereinbart und man beschloß zu warten, bis »die Kinder« herangewachsen wären. Die beiden Familien verkehrten häufig mit einander. Herr von Mareuil betrieb seine Kandidatur, Saccard lauerte auf seine Beute. Man einigte sich dahin, daß Maxime seine Ernennung zum Auditor im Staatsrathe in den Hochzeitskorb legen werde.
Indessen schien das Glück der Saccard seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Dasselbe erhellte ganz Paris gleich einem kolossalen Freudenfeuer. Es war die Stunde, da die heiße Jagd einen Theil des Waldes mit dem Geläute der Hunde, dem Knallen der Peitschen und den Flammen der Fackeln erfüllte. Der entfesselte Heißhunger sättigte sich endlich in der Schamlosigkeit des Triumphes bei dem Geräusch, welches die niedergerissenen Stadtviertel und die binnen sechs Monaten gesammelten Reichthümer erregten. Die ganze Stadt war nichts weiter als ein großes Gelage der Millionen und der Frauen. Das von oben herab kommende Laster floß durch die Straßenkanäle, drang in die Tiefe und stieg mit den Wasserstrahlen der Springbrunnen der Gärten wieder in die Höhe, um als feiner, durchdringender Regen auf die Dächer zurückzufallen. Und wenn man des Nachts über die Brücken schritt, so schien es, als wälzten die Fluthen der Seine allen Unrath der Stadt, die von den Tischen gefallenen Brocken, die auf den Sophas gelassenen Spitzen, die in den Fiakern vergessenen Haarlocken, die in's Mieder geschobenen Banknoten, – all' das, was die Brutalität des Verlangens und die augenblickliche Befriedigung des Instinktes auf die Straße wirft, nachdem es mißbraucht und besudelt worden, mitten durch die schlafende Stadt. Wenn Paris in fieberhaftem Schlummer lag, konnte man noch mehr als während des athemlosen Jagens des Tages die geistige Zerrüttung, den vergoldeten wollüstigen Alpdruck einer Stadt beurtheilen, die toll war ob des eigenen Fleisches, des eigenen Goldes. Bis Mitternacht vernahm man das Singen der Geigen; dann wurden die Fenster dunkel und die Schatten senkten sich über die Stadt, Es war, als befände man sich in einem ungeheuren Alkoven, wo die letzte Kerze ausgelöscht, das letzte Schamgefühl abgestreift worden. Inmitten der herrschenden Dunkelheit war nichts weiter zu vernehmen, als ein mächtiges Keuchen der tollen und müden Liebe, während die am Ufer des Flusses gelegenen Tuilerien ihre Arme wie zu einer riesenhaften Umarmung in die Finsterniß hinausstreckten.
Saccard hatte den Bau seines Hôtels am Monceau-Parke auf einem der Stadt gestohlenen Grundstücke beendet. Er hatte sich im ersten Stockwerke desselben ein prächtiges, in Gold und Palissander gehaltenes Arbeitszimmer eingerichtet, mit hohen Bibliothekschränken, in welchen man lauter Aktenbündel, doch kein einziges Buch sah. Die in die Mauer eingefügte eiserne Kasse wölbte sich daselbst gleich einem stählernen Alkoven, groß genug, um in ihrem Inneren die Liebesergüsse einer Milliarde zu beherbergen. Sein Vermögen breitete sich schamlos in derselben aus. Alles schien ihm zu gelingen. Als er die Rue de Rivoli verließ, seinen Haushalt vergrößerte und seine Ausgaben verdoppelte, sprach er vor seinen vertrauten Freunden von bedeutenden Gewinnsten, die er letzthin wieder erzielt. Seiner Angabe nach warf ihm seine Verbindung mit den Herren Mignon und Charrier ungeheure Summen ab; seine Spekulationen mit Häusern und Baugründen schlugen besser ein als je und was gar den Crédit Viticole betraf, so war das eine Kuh, deren Milch niemals erschöpft werden konnte. Er hatte eine Art, seine Reichthümer herzuzählen, welche seine Zuhörer betäubte und sie am klaren Sehen hinderte. Er näselte mehr denn je, entzündete mit seinen kurzen Sätzen und nervösen Bewegungen ein wahres Feuerwerk, welches die Millionen in leuchtenden Garben emporsandte und die ungläubigsten Gemüther blendete. Dieser lebhaften Mimik des reichen Mannes verdankte er zum größten Theil seinen Ruf eines glücklichen Spielers. In Wirklichkeit hatte Niemand Kenntniß davon, ob er ein solides und sicheres Kapital besitze. Seine verschiedenen Geschäftsfreunde, deren jeder seine Situation kannte, so wie dieselbe ihm gegenüber beschaffen war, erklärten sich sein ungeheures Vermögen in der Weise, daß sie meinten, er habe ein niemals versagendes Glück in den anderen, ihnen nicht bekannten Spekulationen. Er gab eine unsinnige Menge Geld aus; seine Kasse wurde nicht müde, bedeutende Summen herzugeben, ohne daß es gelungen wäre, die Quellen dieses goldenen Flußes zu entdecken. Es war der reine Wahnsinn, eine Geldmanie; die Goldstücke flogen haufenweise zum Fenster hinaus, die Kaffe wurde jeden Abend bis zum letzten Sou geleert, füllte sich aber des Nachts immer wieder, ohne daß man gewußt hätte wieso, und lieferte niemals so bedeutende Beträge, als wenn Saccard behauptete, die Schlüssel derselben verloren zu haben.
In diesem Reichthum, welcher rauschend und tosend gleich einem Wildbach über seine Ufer trat, wurde Renée's Mitgift mitgerissen, ertränkt. Die junge Frau, die in den ersten Tagen mißtrauisch gewesen und ihr Vermögen selbst verwalten wollte, wurde alsbald müde, sich mit Geschäften zu befassen; sodann auch kam sie sich neben ihrem Gatten arm vor und als sie sich in Schulden stürzte, mußte sie ihre Zuflucht dennoch zu ihm nehmen, ihn um Geld angehen. Bei jeder neuen Rechnung, die er mit dem Lächeln eines Mannes bezahlte, der Nachsicht mit den menschlichen Schwächen hat, lieferte sie sich ihm immer mehr aus, übergab sie ihm eine Anzahl Rententitres und betraute ihn damit, Dies oder Jenes zu verkaufen. Als sie das Hotel am Monceau-Parke bezogen, war sie fast aller Mittel bereits entblößt. Er trat an die Stelle des Staates und bezahlte ihr die Zinsen für die 100 000 Francs, die noch von dem Hause in der Rue de la Pepinière herrührten; andererseits hatte er sie überredet, ihre Besitzung in der Sologue zu verkaufen, um den Erlös für dieselbe in einem großen Unternehmen anzulegen, welches wie er behauptete, mit größter Sicherheit glänzenden Erfolg verhieß. Auf diese Weise war ihr nichts weiter in Händen geblieben, als der Grundbesitz in Charonne, welchen sie unter keinen Umständen veräußern wollte, um die treffliche Tante Elisabeth nicht zu betrüben. Und selbst hierbei plante er einen Geniestreich, bei welchem ihm sein alter Sündengenosse Larsonneau behilflich sein sollte. Bei Alledem blieb sie ihm verpflichtet, denn wenn er sich auch ihres Vermögens bemächtigt hatte, so bezahlte er ihr doch fünf- oder sechsfach das Erträgniß desselben. Die Zinsen der hunderttausend Francs und des für den Verkauf der Grundstücke erzielten Betrages beliefen sich kaum auf neun- oder zehntausend Francs, was gerade hinreichte, um die Rechnungen ihres Wäsche- und Schuhlieferanten zu begleichen. Er gab ihr das Fünfzehn- und Zwanzigfache dieses Bettels. Er hätte acht Tage lang gearbeitet, um ihr hundert Francs zu stehlen und ihre Ausgaben bestritt er mit königlicher Freigebigkeit. Und so hegte denn auch sie gleich Jedermann die höchste Achtung für diese großartige Kasse ihres Gatten, ohne dem Urquell dieses goldenen Flusses nachzuspüren, den sie vor Augen hatte und in den sie sich jeden Morgen von Neuem stürzte.
In dem Hôtel am Park Monceau trat die wahnsinnige Krise, der leuchtende Triumph ein. Die Saccards verdoppelten die Zahl ihrer Wagen und Pferde; sie hatten eine Armee von Dienstleuten, welche sie eine dunkelblaue Livrée mit mastixfarbenen Beinkleidern und schwarz und gelb gestreiften Westen tragen ließen, welche sich ein wenig streng ausnahm, welche der Finanzmann aber gewählt hatte, um ernst zu erscheinen, was einer seiner liebsten Träume war. Schon die Außenseite ihres Hauses verrieth den Luxus, welchen sie entfalteten und an den Tagen, da die großen Diners gehalten wurden, gelangte die volle Pracht des Haushaltes zur Geltung. Der ewige Luftzug des zeitgenössischen Lebens, welcher die Thüren im ersten Stockwerk der Rue de Rivoli in fortwährender Bewegung erhalten, war im Monceau-Park zu einem wahren Orkan geworden, der die Wände umzuwerfen drohte. Inmitten dieser fürstlichen Gemächer, längs der vergoldeten Treppenbrüstung, auf den schweren Smyrnateppichen, in diesem feenhaften Palais des Emporkömmlings verspürte man den Geruch des Mabille-Gartens, schleppten sich die nachlässigen Tanzschritte der modernen Quadrille dahin, fanden sich die Vertreter dieser Epoche mit ihrem blöden Lachen, ihrem ewigen Hunger und Durst ein. Es war das verrufene Haus der weltlichen Vergnügungen, frechen Zerstreuungen, dessen Fenster nur so breit schienen, um die Vorübergehenden in die Geheimnisse der Schlafgemächer einzuweihen. Mann und Frau führten einen ungezwungenen Lebenswandel vor den Augen ihrer Dienstleute. Sie hatten das Haus unter sich getheilt und bewohnten dasselbe in einer Weise, als befänden sie sich gar nicht daheim, als wären sie nach einer tollen, betäubenden Reise in ein königlich eingerichtetes Hotel gerathen, wo sie sich knapp die Zeit nahmen, ihre Effekten auszupacken, um ja so rasch als möglich den Vergnügungen dieser neuen Stadt entgegenzueilen. Sie hielten sich daselbst nur des Nachts und an den Tagen der großen Diners auf, da eine Menge Geschäfte sie fortwährend durch die Stadt zu wandern nöthigte und sie zuweilen nur für eine Stunde heimkehrten, wie man etwa zwischen zwei Geschäften schnell sein Hotelzimmer aufsucht. Renée fühlte sich daselbst unruhiger, nervöser; ihre seidenen Röcke glitten mit schlangengleichem Zischen über die dicken Teppiche, an den seidenen Causeusen vorüber; sie fühlte sich gereizt durch diese läppischen Vergoldungen, die sie umgaben, durch diese hohen, leeren Deckengewölbe, in welchen nach den stattgehabten Festlichkeiten nichts als das Lachen der jungen Dummköpfe und die Phrasen der alten Hallunken zurückblieben. Um diese Pracht zu genießen, um sich an dieser glänzenden Umgebung zu erfreuen, hätte sie sich ein höchstes Vergnügen gewünscht, welches ihre gierigen Blicke vergebens in allen Ecken des Hotels, in dem kleinen sonnenhellen Salon, in dem in üppiger Vegetation strotzenden Wintergarten suchten. Was hingegen Saccard betraf, so begann sein Traum in Erfüllung zu gehen; er empfing die Mitglieder der hohen Finanzkreise bei sich, Herrn Toutin-Laroche, Herrn von Lauwerens, ebenso große Politiker, den Baron Gouraud, den Deputirten Haffner und sogar sein Bruder, der Minister, hatte sich zwei oder drei Mal bei ihm eingefunden, um durch seine Anwesenheit zur Festigung der Stellung des großen Spekulanten beizutragen. Aber auch dieser ward gleich seiner Frau von nervösen Befürchtungen ergriffen, von einer Unruhe, die seinem Lachen einen absonderlichen Klang wie von zerbrochenen Fensterscheiben verlieh. Er wurde so erregt, so geräuschvoll in seinem ganzen Gebühren, daß seine Bekannten von ihm sagten: »Dieser verteufelte Saccard! er verdient zu viel Geld und wird noch verrückt werden!« Im Jahre 1860 erhielt er seine Auszeichnung; offenbar als Belohnung für einen geheimnißvollen Dienst, welchen er dem Präfekten erwies, indem er bei dem Verkauf eines größeren Grundbesitzes einer Dame den Strohmann abgab.
Es war ungefähr zur Zeit ihrer Uebersiedelung nach dem Park Monceau, als es für Renée ein Ereigniß gab, welches einen unverwischbaren Eindruck in ihr zurückließ. Bis lang hatte der Minister den Bitten seiner Schwägerin Widerstand geleistet, die zehn Jahre ihres Lebens darum gegeben hätte, wenn sie zu den Hofbällen geladen worden wäre. Jetzt endlich gab er nach, da er das Glück seines Bruders für endgiltig gesichert ansah. Während eines ganzen Monats vermochte Renée nicht zu schlafen. Endlich war der große Abend herangekommen, und am ganzen Leibe zitternd saß sie in dem Wagen, der sie nach den Tuilerien brachte.
Sie trug eine Toilette, die ein Wunder an Anmuth und Originalität war, eine wahre Offenbarung, die ihr während einer schlaflosen Nacht geworden und welche drei Arbeiter Worms' bei ihr, vor ihren Augen ausführen mußten. Es war das eine einfache Robe aus weißer Gaze, bedeckt von einer Menge kleiner ausgezackter und mit schmalen schwarzen Sammtbändern benähter Falten. Der Ueberwurf aus schwarzem Sammt hatte einen tiefen, viereckigen Ausschnitt, den eine kaum fingerbreite Spitze einsäumte. Keine Blume, kein Band, blos an den Handgelenken ganz glatte Goldreifen und im Haar ein schmales, goldenes Diadem, ein glänzender Reif, der sie wie eine Aureole zu umgeben schien.
Als sie in den Salons angelangt war und ihr Gatte sie verließ, um den Baron Gouraud aufzusuchen, empfand sie eine vorübergehende Verlegenheit. Doch die Spiegel, aus welchen ihr entzückendes Bild ihr entgegenblickte, beruhigten sie alsbald und sie gewöhnte sich an die warme Luft, an das Gemurmel der Stimmen, an dieses Gemisch schwarzer Fräcke und weißer Schultern, als der Kaiser erschien. Langsam schritt er am Arme eines untersetzten dicken Generals, der in einer Weise schnaufte, als litte er an einer beschwerlichen Verdauung, durch den Saal. Die Schultern rangirten sich zu beiden Seiten, während die schwarzen Fräcke instinktiv, bescheiden einen Schritt zurückwichen. Renée sah sich an das Ende der Schulternreihe, in die Nähe der zweiten Thür gedrängt, welcher der Kaiser schwerfälligen, wankenden Schrittes zustrebte.
Er war im Frack und trug die rothe Schärpe des Großkordons. Von neuerlicher Erregung erfaßt, sah Renée die Dinge nur wie durch einen Nebel und es schien ihr, als bedecke dieser rothe Streifen die ganze Brust des Monarchen. Sie fand, daß er klein sei, zu kurze Beine und schlotterige Hüften habe; doch war sie entzückt, denn sie sah ihn ganz deutlich mit seinem bleichen Gesicht, seinen schweren, bleiernen Lidern, die sich über sein lebloses Auge legten. Unter seinem Schnurrbarte öffneten sich die Lippen in weicher Biegung, während aus dem ganzen verfallenen Gesichte blos die Nase knochig hervorragte.
Der Kaiser und der alte General fuhren fort, langsam weiterzuschreiten, wobei sie sich leise lächelnd gegenseitig zu stützen schienen. Sie blickten die sich verneigenden Damen an und ihre nach rechts und links schweifenden Augen versenkten sich in die Mieder. Jetzt neigte sich der General ein wenig und flüsterte seinem hohen Herrn etwas zu, wobei er ihm mit der heiteren Miene eines guten Kameraden den Arm drückte. Und matt und schlaff, düsterer noch als gewöhnlich, kam der Kaiser schleppenden Ganges immer näher.
Sie waren in der Mitte des Salons angelangt, als Renée ihre Blicke auf sich gerichtet fühlte. Der General blickte sie ganz offen und unbefangen an, während in dem grauen, verschwommenen Auge des Kaisers eine wilde Flamme aufzuckte, als er die Lider halb emporhob. Außer Fassung gebracht, senkte Renée den Kopf und verbeugte sich, wobei sie nichts weiter, als die Rosen des Teppichs sah. Doch verfolgte sie ihre beiden Schatten, ja sie wußte sogar, daß sie einige Sekunden vor ihr stehen geblieben waren. Und sie glaubte zu hören, wie der Kaiser, dieser zweideutige Träumer, während er sie in ihrem mit schwarzen Sammtstreifen durchzogenen weißen Gazekleide betrachtete, seinem Begleiter zuflüsterte:
»Sehen Sie doch, General, da gäbe es eine Blume zu pflücken, eine geheimnißvolle Nelke mit weißen und schwarzen Streifen.«
Worauf der General brutal erwiderte:
»Sire, diese Nelke würde sich in unseren Knopflöchern verteufelt gut ausnehmen!«
Renée hob den Kopf empor. Doch die Erscheinung war verschwunden und eine Menge Menschen drängte sich um jene Thür. Seit diesem Abend kam sie oft nach den Tuilerien und ward ihr sogar die Ehre zu Theil, von Seiner Majestät ein Kompliment über ihre Schönheit zu erhalten und ein wenig seine Freundin zu werden; doch erinnerte sie sich immer wieder an den langsamen, schwerfälligen Gang des Monarchen durch den Salon, zwischen den zwei Reihen nackter Schultern und wenn ihr das steigende Glück ihres Gatten irgend eine neue Freude bereitete, erblickte sie immer wieder den Kaiser, der achtlos an den schönen Frauen vorüberschreitend, auf sie zukam und sie mit einer Nelke verglich, welche ihm der alte General in sein Knopfloch zu stecken rieth. Das Wort gellte ihr zeitlebens in den Ohren.
