
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
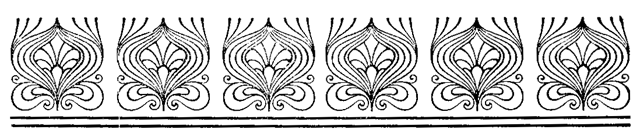
 Florida war im Jahre 1819 den Vereinigten Staaten von Amerika angegliedert worden und wurde ein paar Jahre später ein eigener Staat. Durch diese Angliederung wuchs das Territorium der Republik um 67 000 Quadratmeilen. Aber das Gestirn Florida strahlt nur als Stern zweiter Klasse in der Reihe der 37 Sterne auf der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika.
Florida war im Jahre 1819 den Vereinigten Staaten von Amerika angegliedert worden und wurde ein paar Jahre später ein eigener Staat. Durch diese Angliederung wuchs das Territorium der Republik um 67 000 Quadratmeilen. Aber das Gestirn Florida strahlt nur als Stern zweiter Klasse in der Reihe der 37 Sterne auf der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika.
Es ist nur eine schmale, flache Landzunge, dieses Florida. Infolge seiner geringen Breite können die Flüsse, die es bewässern, mit Ausnahme des St. John, keine bedeutende Ausdehnung annehmen. Auf einem so eben verlaufenden Gelände haben die Wasserläufe ein zu geringes Gefälle, um reißend zu strömen. Kaum finden sich hier ein paar jener »Bluffs« oder Hügel, wie sie in den Mittel- und Nordgebieten der Union so zahlreich sind. Die Gestalt dieser Halbinsel könnte man mit einem Biberschwanz vergleichen, der zwischen dem Atlantischen Ozean im Osten und dem Golf von Mexiko im Westen im Meere hängt.
Florida hat daher keine Grenznachbarn, wenn man von Georgia absieht, das gegen Norden daran stößt. Diese Grenze bildet den Isthmus, durch den die Halbinsel mit dem Kontinent zusammenhängt.
Im Grunde erscheint Florida als ein Land für sich, als ein sogar recht eigentümliches Gebiet, mit seinen halb spanischen, halb amerikanischen Einwohnern und seinen Indianern vom Stamme der Seminolen, die von ihren Stammesbrüdern des Wilden Westens sehr verschieden sind. Obwohl trocken, sandig und fast ganz von Dünen eingefaßt, die der Atlantische Ozean am Südufer nach und nach angeschwemmt hat, erfreut es sich doch in seinen nördlichen Ebenen einer wundervollen Fruchtbarkeit. Es trägt seinen Namen mit Recht. Die Flora ist herrlich, gewaltig, von überreicher Mannigfaltigkeit. Das rührt ohne Frage daher, weil dieser Teil des Gebietes vom Saint-John bewässert wird. Dieser Fluß strömt von Süden nach Norden in einem Lauf von 250 Meilen breit dahin, von denen 107 Englische Meilen (250 = ca. 400 km, 107 = ca. 170 km. bis zum George-See bequem schiffbar sind. Die Länge, die den quer das Land durchströmenden Flüssen fehlt, mangelt ihm Dank seiner Stromrichtung nicht. Zahlreiche Rios ergießen sich bei den zahlreichen Ausbuchtungen seiner beiden Ufer in ihn. Der Saint-John ist der Hauptfluß des Landes. Er belebt es mit seinem Wasser – jenem Blute, das in den Adern der Erde rollt.
Am 7. Februar 1862 fuhr der Dampfer »Shannon« den Saint-John stromab. Um vier Uhr nachmittags sollte er an dem kleinen Flecken Picolata anlegen, nachdem er an den obern Stationen des Flusses und den verschiedenen Forts der Counties Saint-Jean und Putnam Halt gemacht hatte. Ein paar Meilen weiter sollte er dann in das County Duval einlaufen, das bis zum County Nassau reicht, welches wiederum von dem Flusse gleiches Namens begrenzt wird.
Picolata selber ist nicht sehr bedeutend, aber die Umgebung ist reich an Indigo und Reispflanzungen, an Baumwoll- und Zuckerrohrfeldern und an riesigen Zypressenwäldern. Hier wohnt in ziemlich weitem Umkreis auch eine zahlreiche Bevölkerung. Ferner herrscht infolge der Lage ein ziemlich reger Personen- und Waren-Verkehr. Es ist der Einschiffungspunkt nach St. Augustine, einer der Hauptstädte des östlichen Florida, die, etwa zwölf Meilen von Picolata entfernt, an jenem Teil der Meeresküste liegt, der von der langen Insel Anastasia geschützt wird. Ein schnurgerader Weg führt von dem Flecken nach der Stadt.
An diesem Tage hätte man an den Anlegestegen von Picolata eine größere Anzahl von Reisenden zählen können als sonst. Ein paar schnell verkehrende Postkutschen, sogenannte »Stages«, eine Art Wagen mit acht Plätzen und mit vier bis sechs Mauleseln bespannt, die wie wahnsinnig auf dieser Strecke über das Sumpfland hingaloppieren, hatten sie nach St. Augustine gebracht. Die Anlegezeit des Dampfers durfte nicht verpaßt werden, wenn man nicht eine Verspätung von wenigstens 48 Stunden erleiden wollte, ehe man mit den stromabwärts gelegenen Städten, Flecken, Forts und Dörfern wieder Verbindung hätte erhalten können.
Der »Shannon« fuhr nämlich nur einmal am Tage von beiden Ufern des St. John ab und versah zur Zeit ganz allein den Beförderungsdienst. Man mußte daher pünktlich zu der Zeit, wo er in Picolata anlegte, dort sein. Vor einer Stunde hatten die »Stages« ihre Fahrgäste ausgesetzt.
In diesem Augenblicke standen ihrer etwa fünfzig auf der Landungsbrücke von Picolata. In lebhaftem Geplauder begriffen, warteten sie. Es war zu bemerken, daß sie sich in zwei Gruppen schieden, die anscheinend wenig Neigung hatten, miteinander in Berührung zu treten. Hatte ein wichtiges Geschäftsinteresse oder eine politische Angelegenheit diese Leute nach St. Augustine geführt? Jedenfalls stand fest, daß eine Einigung zwischen den beiden Gruppen sich nicht vollzogen hatte. Wenn sie als Feinde gekommen waren, so kehrten sie nun auch als Feinde zurück. Das war nur zu deutlich an den erbosten Blicken zu merken, die sie austauschten, an der auffälligen Sonderung in zwei Abteilungen, an ein paar mißtönenden Worten, deren herausfordernde Bedeutung alle herauszuhören schienen.
Inzwischen erschallten flußaufwärts langgezogene Pfiffe. Bald erschien um ein Knie zur Rechten herum, eine halbe Meile oberhalb von Picolata, der »Shannon«. Dicke Dampferwolken, aus seinen beiden Essen entströmend, zogen über die hohen Bäume hin, die am andern Ufer im Meereswinde rauschten. Das stattliche Schiff wuchs im Näherkommen. Die Flut war im Fallen begriffen. Ihre Strömung hatte in den letzten drei Stunden die Fahrt behindert und verlangsamt, förderte sie nun aber, indem sie das Wasser des St. John nach seiner Mündung zurückströmen ließ.
Endlich ertönte die Glocke. Die Räder, die den Wasserspiegel schlugen, brachten den »Shannon« zum Halten, der nun dicht an die Landungsbrücke anlegte, von den Schiffstauen gehalten.
Sofort begaben sich die Leute in Eile auf Deck. Eine der zwei Gruppen ging zuerst an Bord, ohne daß die andere ihr zuvorzukommen versucht hätte. Das kam ohne Frage daher, weil letztere noch ein paar verspätete Reisende erwartete, welche in Gefahr waren, das Boot zu verpassen; denn ein paar Männer lösten sich aus dieser Gruppe und eilten nach dem Quai von Picolata bis zu der Stelle hin, wo die Straße von St. Augustine mündet. Von dort aus spähten sie nach Osten, in sichtlicher Unruhe.
Nicht ohne Grund, denn der auf der Kommandobrücke stehende Kapitän des »Shannon« rief:
»Einsteigen! Einsteigen!«
»Noch ein paar Minuten,« sagte einer der Leute, der auf der Brücke geblieben war.
»Ich kann nicht warten, meine Herren!«
»Ein paar Minuten bloß!«
»Nein! Nicht eine Minute!«
»Nur einen Augenblick!«
»Unmöglich! Die Flut fällt, und ich laufe Gefahr, am Strande von Jacksonville nicht genug Wasser zu finden.«
»Uebrigens,« sagte einer der Reisenden, »liegt kein Grund vor, weshalb wir uns nach den Launen von Nachzüglern richten sollten.«
Der diese Worte gesprochen hatte, gehörte zu der ersten Gruppe, die sich schon nach hinten begeben hatte.
»So denke ich auch, Herr Burbank,« versetzte der Kapitän. »Der Dienst geht vor! Schnell, meine Herren, einsteigen! ich gebe jetzt den Befehl, die Taue zu lösen.«
Schon schickten die Matrosen sich an, das Dampfboot von dem Stege abzustoßen, während aus der Dampfpfeife tiefes Brausen klang. Ein Schrei gebot jedoch Einhalt.
»Da ist Texar! – da ist Texar!«
Ein Wagen kam im schärfsten Galopp auf den Quai von Picolata gefahren. Die vier Maulesel, die das Gespann bildeten, machten vor der Brücke Halt. Ein Mann stieg aus. Diejenigen seiner Gefährten, die bis an die Straße gegangen waren, eilten auf ihn zu. Dann gingen sie allesamt an Deck.
»Einen Augenblick später, Texar, und du wärst nicht mitgekommen! Das wäre doch unangenehm gewesen!« sagte einer von ihnen.
»Ja, dann hättest du erst in zwei Tagen zurück sein können in – wo denn? Das werden wir hören, wenn dir's zu sagen beliebt!« setzte ein anderer hinzu.
»Und wenn der Kapitän auf diesen unverschämten James Burbank gehört hätte,« sagte ein dritter, »dann wäre der »Shannon« jetzt schon eine gute Viertelmeile von Picolata weg.«
Texar hatte sich auf das Vorderdeck begeben, seine Freunde folgten ihm. Er warf James Burbank, von dem er nur durch die Kommandobrücke getrennt war, einen flüchtigen Blick zu. Wenn er auch kein Wort sprach, so gab doch dieser Blick zur Genüge zu verstehen, daß zwischen den beiden Männern ein unversöhnlicher Haß bestand.
James Burbank sah Texar voll ins Gesicht, drehte ihm dann den Rücken zu und setzte sich auf das Hinterdeck zu den Seinen, die dort schon alle Platz genommen hatten.
»Fuchsteufelswild, der Burbank!« sagte einer der Gefährten Texars. »Das läßt sich denken. Das hat er nun von seinen Schwindeleien und der Gerichtsherr hat seine falschen Aussagen zurückgewiesen, wie sie es verdienten –«
»Aber ihn selber aufs höflichste behandelt,« antwortete Texar, »und auf diese Gerechtigkeit pfeife ich.«
Inzwischen hatte der »Shannon« die Taue gelöst. Mit langen Stangen abgestoßen, kam das Boot in die Strömung. Dann trieben es die mächtigen Ruder hinweg, denen die zurückweichende Flut noch zu Hilfe kam, und es glitt geschwind zwischen den Ufern des St. John dahin.
Die Bauart der zum Dienst auf den amerikanischen Flüssen bestimmten Dampfer ist bekannt. Es sind wahre Häuser von mehreren Stockwerken mit breiten Terrassen. Die Dampfessen ragen hoch empor, und die Flaggenmasten tragen das Tauwerk der Zeltüberdachung. Die auf dem Hudson und dem Mississippi verkehrenden Dampfboote, wahre Seepaläste, können die Bevölkerung einer ganzen Ortschaft in sich aufnehmen. So groß waren die Ansprüche hier auf dem St. John und für die Städte Floridas natürlich nicht. Der »Shannon« war nur ein schwimmendes Hotel, doch glich er im Innern wie im Aeußern völlig jenen größern Fahrzeugen.
Das Wetter war herrlich. Der tiefblaue Himmel war von ein paar kleinen Dampfwölkchen befleckt, die am Horizont verstreut waren. Hier unter dem 30. Breitengrade ist in der neuen Welt der Februar ebenso heiß, wie in der alten an der Grenze der Wüste Sahara.
Immerhin milderte eine frische Seebrise das Unerträgliche der Temperatur. Daher waren die Fahrgäste des »Shannon« zum größten Teile auf Deck geblieben, um den starken Duft einzuatmen, den der Wind aus den Wäldern zu beiden Ufern herüber trug. Unter dem Zeltdach, das bei der Schnelligkeit des Dampfers wie indische Punkas hin und her schwankte, waren sie vor den schrägen Strahlen der Sonne geschützt.
Texar und die fünf bis sechs Gefährten, die mit ihm eingestiegen waren, hatten es für gut erachtet, in eine der Abteilungen des Speisesaals hinunterzugehen. Als Trinker, deren Gaumen an die starken Liköre der amerikanischen Bars gewöhnt war, leerten sie hier ganze Gläser von Gin, Bitter und Bourbon-Whisky. Es waren größtenteils hagebuchene Kerle; in ihrem Wesen keine Spur von »comme il faut« – in ihren Reden grobkörnig – mehr in Leder als in Tuch gekleidet – mehr gewöhnt, in den dichten Wäldern zu leben, als in den Städten Floridas.
Texar schien zwischen ihnen eine Machtvollkommenheit zu haben, die zweifelsohne weniger auf einer bedeutenderen Stellung oder einem größern Vermögen als vielmehr auf der Energie seines Charakters beruhte. Da Texar nicht redete, verhielten sich daher auch seine Gefährten schweigsam und benutzten die Zeit, die sie nicht zum Sprechen brauchten, zum Trinken.
Nachdem Texar eins der Blätter durchflogen hatte, die auf den Tischen des Speisesaals herum lagen, legte er es beiseite und sagte:
»Das ist schon alt!«
»Glaub's wohl!« antwortete einer seiner Gefährten. »Die Nummer ist schon drei Tage alt!«
»Und in drei Tagen passiert vieles, seit jetzt an unsern Toren der Krieg tobt!« setzte ein anderer hinzu.
»Wie steht's mit dem Krieg?« fragte Texar.
»Soweit es uns im besonderen angeht, Texar, steht es so: Die Bundesregierung befaßt sich, wie es heißt, mit den Vorbereitungen zu einem Zuge gegen Florida. Man muß daher in Kürze auf einen Einfall der Nördlichen gefaßt sein.«
»Ist das gewiß?«
»Das weiß ich nicht; aber ich habe es in Savannah gehört, und in St. Augustine ist das Gerücht bestätigt worden.«
»Eh! so mögen sie kommen, wenn sie sich's zutrauen, uns zu unterwerfen!« rief Texar, seine Drohung mit einem Faustschlag, unter dem Gläser und Flaschen auf dem Tische tanzten, nachdrücklich verstärkend. »Ja! Sie sollen nur kommen! Wir werden ja sehen, ob die Sklavenbesitzer von Florida sich von diesen Räubern von Abolitionisten ausplündern lassen.«
Diese Antwort Texars hätte jeden, der über die damals in Amerika vorgehenden Ereignisse nicht auf dem Laufenden war, über zweierlei unterrichtet: erstens, daß der Sezessionskrieg, der durch den am 11. April 1861 gegen das Fort Sumter abgefeuerten Kanonenschuß erklärt worden war, damals bereits in seine schärfste Phase getreten war, denn er erstreckte sich schon bis an die äußersten Grenzen der Südstaaten; ferner daß Texar als Parteigänger der Sklavenhalterei gemeinsame Sache mit der großen Mehrheit der Sklavenstaaten machte.
An Bord des »Shannon« befanden sich eben jetzt mehrere Repräsentanten beider Parteien: einerseits – um die verschiedenen Bezeichnungen zu gebrauchen, die ihnen während dieses langen Kampfes gegeben wurden – Nördliche, Antisklaverei-Leute, Abolitionisten oder Föderierte; andererseits: Südliche, Sklavenhalter, Sezessionisten oder Konföderierte.
Eine Stunde später erhoben sich Texar und die Seinen, mehr als hinreichend gestärkt, um sich wieder auf Deck des »Shannon« zu begeben. Am rechten Ufer war man schon an der Trentbucht und der Sechsmeilenkrampe vorbei; die eine zieht sich bis an einen dichten Zypressenwald hin, die andere bis zu den weiten Zwölfmeilen-Sümpfen, deren Name ihre Ausdehnung bezeichnet.
Das Dampfboot fuhr jetzt zwischen zwei Säumen prachtvoller Bäume dahin: hier standen Tulpenbäume, Magnolien, Fichten, Zypressen, immergrüne Eichen, Yukkas und viele andere von stolzem Wuchse, deren Stämme unter dem unentwirrbaren Gestrüpp der Azaleen und Schlingpflanzen verschwanden. Bisweilen, wenn man an den Krampen vorbeikam, die den sumpfigen Ebenen der Counties St. Jean und Duval Wasser zuführen, war die Luft von starkem Moschusduft durchtränkt.
Dieser Geruch kam nicht von jenen Gewächsen, deren Ausdünstungen unter diesem Klima so penetrant sind, sondern vielmehr von den Alligatoren, die sich vor dem Geräusch, das der »Shannon« im Vorbeifahren machte, in das hohe Kraut flüchteten.
Da waren ferner Vögel aller Arten: Spechte, Reiher, Goldvögel, Rohrdommeln, Weißkopf-Tauben, Orpheen, Spottdrosseln und hundert andere von mannigfachster Gestalt und verschiedenstem Gefieder, während der Katzenvogel mit seiner Bauchrednerstimme jedes Geräusch der Außenwelt wiedergab – sogar jenen Schrei des Krausenhahnes, der hell wie ein Trompetenstoß klingt und dessen Ton man vier bis fünf Meilen weit hören kann.
In dem Augenblick, als Texar den Fuß auf die letzte Treppenstufe setzte, ehe er wieder auf Deck trat, wollte eben eine Frau in den Speisesaal hinuntersteigen. Als sie sich diesem Manne gegenüber sah, wich sie zurück. Es war eine Mestizin, die bei der Familie Burbank in Dienst stand. Ihre erste Regung war unüberwindlicher Abscheu, als sie so unvermutet diesem erklärten Feinde ihres Herrn begegnete. Ohne vor dem bösen Blick, den Texar ihr zuwarf, stehen zu bleiben, trat sie rasch zur Seite. Er aber zuckte die Achseln und wandte sich an seine Gefährten.
»Ja, das ist Zermah,« rief er, »eine Sklavin jenes James Burbank, der sich das Air gibt, kein Parteigänger der Sklavenhalter zu sein!«
Zermah antwortete nichts. Als die Treppe frei war, ging sie in den großen Salon des »Shannon« hinunter, ohne, wie es schien, sich irgendwie um diese Worte zu kümmern.
Texar schritt nach dem Vorderteil des Dampfbootes. Dort zündete er sich eine Zigarre an, befaßte sich nicht weiter mit seinen Kameraden, die ihm gefolgt waren, und schien mit großer Aufmerksamkeit das linke Ufer des St. John zu betrachten, das hier die Grenze des County Putnam bildete.
Währenddes wurde auf dem Hinterdeck des »Shannon« ebenfalls der Stand des Krieges erörtert. Nachdem Zermah gegangen war, befand sich James Burbank mit den zwei Freunden, die ihn nach St. Augustine begleitet hatten, allein. Der eine war sein Schwager, Mr. Edward Carrol, der andere ein Floridier, der in Jacksonville wohnte, namens Walter Stannard.
Auch sie sprachen mit Erregung über den blutigen Kampf, dessen Ausgang für die Vereinigten Staaten eine Frage auf Leben und Tod war. Aber James Burbank betrachtete, wie man sehen wird, die Dinge von anderem Gesichtspunkte aus als Texar.
»Ich habe Eile,« sagte er, »nach Camdleß-Bai zurückzukommen. Wir sind zwei Tage weg. Vielleicht sind Kriegsnachrichten eingetroffen. Vielleicht sind Dupont und Sherman bereits Herren von Port-Royal und den Inseln von Süd-Karolina.«
»Jedenfalls kann das nicht mehr lange dauern,« antwortete Edward Carrol, »und es sollte mich wundern, wenn Präsident Lincoln nicht daran dächte, den Krieg bis nach Florida auszudehnen.«
»Das könnte nicht früh genug geschehen!« entgegnete James Burbank. »Ja! Es ist hohe Zeit, die Bestimmungen der Union all diesen Südlichen in Georgia und Florida aufzulegen, die denken, sie sind weit genug vom Schusse und können nicht belangt werden. Man sieht ja, wie weit solche herrenlose Kerle wie dieser Texar die Unverschämtheit treiben! Er fühlt sich unterstützt von den Sklavenhaltern dieses Landes, er hetzt sie gegen uns Leute vom Norden, und unsere Lage wird immer schwieriger, und alle Rückschläge des Krieges fallen auf uns!«
»Du hast recht, James,« erwiderte Edward Carrol. »Es ist nötig, daß Florida sobald wie möglich wieder unter die Autorität der Regierungen von Washington kommt. Ja! Auch ich wünsche sehnsüchtig, daß das Bundesheer hier wieder die gesetzlichen Zustände herstellt, sonst werden wir schließlich unsere Pflanzungen verlassen müssen.«
»Das kann nur noch eine Frage von Tagen sein, mein lieber Burbank,« sagte Walter Stannard. »Als ich vorgestern Jacksonville verließ, waren die Gemüter schon lebhaft beunruhigt, weil man davon sprach, daß der Kommodore Dupont die Einfahrt in den St. John erzwingen wollte. Und das hat einen Vorwand gegeben, diejenigen zu bedrohen, die nicht wie die Anhänger der Sklaverei denken. Ich fürchte, daß in Kürze ein Straßentumult die städtische Behörde stürzen wird und daß Kerle von der schlimmsten Sorte ans Ruder kommen werden.«
»Das wundert mich nicht,« antwortete James Burbank. »Wir können uns auch, wenn erst das Bundesheer anrückt, auf böse Tage gefaßt machen. Aber es ist unmöglich, dem vorzubeugen.«
»Was sollten wir auch tun?« entgegnete Walter Stannard. »Wenn auch in Jacksonville und an andern Orten Floridas sich einige wackere Kolonisten befinden, die über die Sklavenfrage ebenso denken wie wir, so sind sie doch nicht zahlreich genug, um den Uebergriffen der Sezessionisten Widerstand bieten zu können. Wir können nicht eher uns in Sicherheit glauben, als bis die Armee der Föderierten eingetroffen ist, und obendrein wäre, wenn ihr Einmarsch wirklich schon beschlossen sein sollte, zu wünschen, daß er unverzüglich bewerkstelligt würde.«
»Ja! Möchten sie nur kommen,« rief James Burbank, »und uns von diesen Bösewichten befreien!«
Es wird sich bald zeigen, ob die Nördlichen, die infolge von Familien- oder Vermögens-Interessen gezwungen waren, sich den Gebräuchen des Landes, wo sie inmitten einer Bevölkerung von Sklavenhaltern lebten, anzupassen – berechtigt waren, solche Sprache zu führen, und nicht vielmehr Ursache hatten, auf alles gefaßt zu sein.
Was James Burbank und seine Freunde vom Kriege dachten, traf zu. Die Bundesregierung bereitete eine Expedition vor, die den Zweck hatte, Florida zu unterwerfen. Es handelte sich weniger darum, sich des Staates zu bemächtigen, oder ihn militärisch zu besetzen, als vielmehr darum, jeder Konterbande den Zugang abzuschließen. Deswegen getraute sich auch der »Shannon« nicht mehr, die Südküste von Georgia zu befahren, die schon in der Gewalt der Generale der Nördlichen war. Aus Vorsicht blieb er an der Grenze und fuhr nur ein Stückchen über die Mündung des St. John hinaus gegen den Norden der Amelia-Insel bis zu dem Hafen Fernandina, von wo die Eisenbahnlinie von Cedar-Keys ausgeht, die die floridische Halbinsel schräg durchschneidet und am Golf von Mexiko endet. Jenseits der Amelia-Insel und des Rio St. Mary hätte der »Shannon« Gefahr gelaufen, von den Schiffen der Föderierten gekapert zu werden, die unausgesetzt diesen Teil der Küste überwachten.
Hieraus folgt, daß die Fahrgäste des Dampfers alles solche Floridier waren, die nicht aus Rücksicht auf ihre Verhältnisse gezwungen waren, sich über die Grenzen Floridas hinauszubegeben. Alles wohnte in den Städten, Flecken oder Weilern, die an den Ufern des St. John oder seiner Zuflüsse liegen, und größtenteils in St. Augustine oder in Jacksonville. An diesen verschiedenen Oertlichkeiten konnten sie an den Landungsbrücken aussteigen oder an den sogenannten »Piers«, hölzernen Anlegestegen, die, nach englischer Mode erbaut, besondere Ausladeboote überflüssig machten.
Einer der Fahrgäste mußte jedoch das Dampfboot auf dem freien Flusse verlassen. Er beabsichtigte auszusteigen, ohne abzuwarten, bis der »Shannon« an einer Haltestelle angelegt hatte – und zwar an einem Punkt des Ufers, wo weder ein Dorf noch ein einzelnes Haus, ja nicht einmal eine Jäger- oder Fischerhütte zu sehen war.
Dieser Fahrgast war Texar.
Gegen sechs Uhr abends stieß der »Shannon« drei scharfe Dampfpfiffe aus. Seine Räder stoppten gleichzeitig, und er ließ sich von der Strömung treiben, die hier sehr schwach ist. Er befand sich jetzt vor der Schwarzen Krampe.
Diese Bucht ist ein tiefer Einschnitt des linken Ufers, an dessen Ende ein kleiner namenloser Rio mündet, welcher am Fuße des Fort Heilman vorbeifließt, fast genau auf der Grenze zwischen den Counties Putnam und Duval. Ihre enge Oeffnung verschwindet fast unter einer Wölbung dichter Zweige, deren Blätterwerk wie ein dichtes Gewebe in einander greift. Diese düstre Lagune ist fast unbekannt. Noch nie hat jemand versucht, hier hineinzudringen, und niemand wußte, daß sie diesem Texar zur Wohnung diente. Das Ufer des St. John scheint nämlich an der Mündung der Schwarzen Krampe für das Auge an keinem Punkte durch irgend welchen Einschnitt unterbrochen zu sein. Bei der rasch hereinbrechenden Nacht hätte man daher jetzt diese in tiefen Schatten versunkene Krampe sehr genau kennen müssen, wenn man mit einem Kahn die Einfahrt hätte finden wollen.
Auf die ersten Pfiffe des »Shannon« hatte sogleich ein Schrei dreimal Antwort gegeben. Ein Feuerschein, der zwischen dem hohen Gras des Ufers leuchtete, hatte sich in Bewegung gesetzt. Das war das Zeichen, daß ein Kanoe herankam, um an dem Dampfer anzulegen.
Es war ein bloßes Skiff, ein Rindenboot, das mit einer Pagaie gelenkt und getrieben wurde. Bald war dieses Skiff nur noch eine halbe Kabellänge vom »Shannon« entfernt.
Texar ging jetzt an die Bordöffnung des Vorderdecks und legte die Hände an den Mund.
»Aoh!« rief er.
»Aoh!« tönte es zurück.
»Bist du's, Squambo?«
»Ja, Herr!«
»Leg an!«
Das Skiff legte an. Beim Schein der in der Spitze befestigten Fackel konnte man den Mann sehen, der es steuerte. Es war ein Indianer mit schwarzem Haar, nackt bis zum Gürtel – nach dem im Lichte erkennbaren Oberkörper zu schließen, ein kräftiger Bursche.
In diesem Augenblick wandte Texar sich an seine Gefährten, drückte ihnen die Hand und rief ihnen ein vielsagendes Lebewohl zu. Nachdem er einen drohenden Blick nach Herrn Burbank hin geworfen hatte, stieg er die Treppe hinunter, die am Radmantel der Backbordschaufel angebracht war, und stieg zu dem Indianer Squambo ins Boot. i
Mit wenigen Raddrehungen hatte sich der Dampfer von dem Skiff entfernt, und niemand an Bord konnte auf den Gedanken kommen, daß das leichte Fahrzeug sich unter dem finstern Laubwerk des Flußarmes verlieren würde.
»Ein Schuft weniger an Bord!« sagte Edward Carrol, der sich nicht daran kehrte, ob die Gefährten Texars ihn hören konnten.
»Ja,« antwortete James Burbank, »und das ist obendrein ein gefährlicher Verbrecher. Ich meinesteils hege in diesem Punkte keinerlei Zweifel, obgleich dieser Elende sich durch seine wirklich unerklärlichen Alibi-Beweise immer aus der Schlinge zu ziehen wußte.«
»Wenn jedenfalls,« sagte Herr Stannard, »in dieser Nacht in der Gegend von Jacksonville ein Verbrechen begangen worden ist, so kann man ihn dessen nicht verdächtigen, da er ja den »Shannon« verlassen hat.«
»Ich bin mir nicht klar,« entgegnete James Burbank. »Wenn man mir sagte, man hätte ihn in eben dem Augenblick, wo wir miteinander sprechen, fünfzig Meilen weiter im Norden von Florida stehlen und morden sehen, so würde mich das gar nicht wundern! Wenn es ihm dann allerdings gelänge, zu beweisen, daß er nicht das Verbrechen begangen habe, so würde das mich ebenso wenig wundern, nach dem, was ich erlebt habe. Aber es ist schon an sich eine Schmach, sich mit diesem Menschen überhaupt zu befassen. Gehen Sie wieder nach Jacksonville, Stannard?«
»Heute abend noch.«
»Erwartet Sie Ihre Tochter?«
»Ja, und es eilt mir, zu ihr zu kommen.«
»Das begreife ich,« antwortete James Burbank, »und wann dürfen wir auf Ihren Besuch in Camdleß-Bai bestimmt rechnen?«
»In ein paar Tagen.«
»Kommen Sie nur, sobald Sie irgend können, mein lieber Stannard. Sie wissen, wir stehen am Vorabend ernster Ereignisse, die bei der Annäherung der Bundesarmee sich nur noch ernster gestalten werden. Es ist daher die Frage, ob Sie mit Ihrer Tochter Alice bei uns in Castle-House nicht besser in Sicherheit sind, als mitten in dieser Stadt, wo die Südlichen zu allen möglichen Exzessen fähig sind.«
»Nun, bin ich nicht selber ein Mann des Südens, lieber Burbank?«
»Gewiß, Stannard, aber Sie denken und handeln wie einer vom Norden.«
Eine Stunde später fuhr der »Shannon«, hinweggeführt von der allmählich reißender gewordenen Ebbe, an dem kleinen Ort Mandarin vorbei, der auf einem grünen Hügel liegt.
Hier war ein Quai angelegt, an dem die Schiffe anlegen konnten, um Ladung aufzunehmen. Ein Stück stromauf lag ein elegantes »Pier«, ein leichter Holzsteg, der von zwei eisernen Ketten gehalten wurde. Das war die Anlegestelle von Camdleß-Bai.
Am Ende des »Pier« warteten zwei Schwarze, die Fackeln trugen; denn es war schon finstre Nacht.
James Burbank verabschiedete sich von Herrn Stannard und betrat mit Edward Carrol den Landungssteg.
Hinter ihm schritt die Mestizin Zermah, die schon von weitem einer Kinderstimme antwortete:
»Da bin ich, Dy! – Da bin ich!«
»Und Vater?«
»Vater auch!«
Die Fackeln entfernten sich, und der »Shannon« setzte seine Fahrt fort, schräg nach dem linken Ufer hinüber steuernd. Drei Meilen über Camdleß-Bai hinaus machte er an der andern Seite des Flusses an der Landungsbrücke von Jacksonville Halt, um den größten Teil seiner Fahrgäste abzusetzen.
Hier stieg Walter Stannard aus und mit ihm drei bis vier der Leute, von denen sich Texar vor anderthalb Stunden verabschiedet hatte, als der Indianer ihn mit dem Skiff abgeholt hatte.
Nun waren nur noch etwa ein halbes Dutzend Fahrgäste an Bord, die einen nach Pablo bestimmt, einem kleinen Flecken in der Nähe des Leuchtturms, der an den Mündungen des St. John erbaut worden ist; die andern nach der Talbot-Insel bestimmt, die an der See vor der Mündung des gleichnamigen Wasserlaufes liegt, die letzten endlich nach dem Hafen Fernandina bestimmt.
Der »Shannon« setzte seine Fahrt auf dem Flusse fort, und eine Stunde später war er um die Biegung der Trout-Krampe verschwunden, wo der St. John seine schon hohl gehenden Wogen mit der Brandung des Ozeans vermischt.