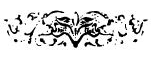|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
oder:
ein Gedächtniß dessen, was sich mit mir, Leonora Christina, im Blawen Thurm zugetragen hat von
Anno 1663 den 8.
Augusti bis
Anno 1685 den 19.
Maj.
 Elten wird man sich vergangener Zeiten ohn Betrübniß erinnern, denn entweder sind sie besser oder schlimmer gewesen als die gegenwärtigen. Waren sie freudiger, glücklicher und ehrenvoller, so betrübt billigerweise ihr Angedencken, und dieses um so mehr, als die gegenwärtigen sorgenvoll, unglücklich und erniedrigend seyn mögen. Waren die früheren Zeiten betrübender, elender und beklagenswerther als die gegenwärtigen, so ist deren Erinnerung in gleicher Weise trawrig, denn man findet und fühlt auff einmal alle vergangenen Mißgeschicke und Widerwärtigkeiten, so man im Lauffe der Zeit ausgestanden hat. Aber alle Dinge haben gleichsamb zween Henckel, an welchen man sie auffhebt, wie
Epictetus sagt: der eine Henckel, sagt er, ist verläßlich, der andere unverläßlich, und steht es in unserem Willen, welchen Henckel wir ergreiffen, den verläßlichen oder den unverläßlichen; erfassen wir den verläßlichen, so können wir alles Vorübergehende, wie schmertzlich und betrübend es auch gewesen seyn mag, ebenso gut ja eher mit Freude als mit Trawer in unser Gedächtniß zurückrufen; darumb will ich den verläßlichen Henckel ergreiffen und in
Jesu Namen meine Erinnerung durchfliegen, all des Jammers und Elendts, und all der Betrübniß, des Spottes und Leidens, der Verhöhnung und Widerwärtigkeit gedencken, die mich an diesem Ort betroffen haben und die ich mit Gottes Hülffe überwandt, will mich auch keineswegs darüber grämen, sondern im Gegentheil an jeder Stelle mich der Güte Gottes erinnern und dem Allerhöchsten dancken, der stets mit seiner kräfftigen Hülffe und mit seinem Trost bey mir gewesen ist, der mein Hertz regieret hat, damit es nicht von Gott abwiche, der meinen Sinn und Verstand bewahret hat, daß sie sich nicht verwirrten, der meinen Gliedern Kraft und natürliche Stärcke gab, ja, der mir Ruhe des Gemüthes und Freudigkeit vergönnte und noch vergönnt. Du, unbegreifflicher Gott, seyest gelobt und gepriesen ewiglich!
Elten wird man sich vergangener Zeiten ohn Betrübniß erinnern, denn entweder sind sie besser oder schlimmer gewesen als die gegenwärtigen. Waren sie freudiger, glücklicher und ehrenvoller, so betrübt billigerweise ihr Angedencken, und dieses um so mehr, als die gegenwärtigen sorgenvoll, unglücklich und erniedrigend seyn mögen. Waren die früheren Zeiten betrübender, elender und beklagenswerther als die gegenwärtigen, so ist deren Erinnerung in gleicher Weise trawrig, denn man findet und fühlt auff einmal alle vergangenen Mißgeschicke und Widerwärtigkeiten, so man im Lauffe der Zeit ausgestanden hat. Aber alle Dinge haben gleichsamb zween Henckel, an welchen man sie auffhebt, wie
Epictetus sagt: der eine Henckel, sagt er, ist verläßlich, der andere unverläßlich, und steht es in unserem Willen, welchen Henckel wir ergreiffen, den verläßlichen oder den unverläßlichen; erfassen wir den verläßlichen, so können wir alles Vorübergehende, wie schmertzlich und betrübend es auch gewesen seyn mag, ebenso gut ja eher mit Freude als mit Trawer in unser Gedächtniß zurückrufen; darumb will ich den verläßlichen Henckel ergreiffen und in
Jesu Namen meine Erinnerung durchfliegen, all des Jammers und Elendts, und all der Betrübniß, des Spottes und Leidens, der Verhöhnung und Widerwärtigkeit gedencken, die mich an diesem Ort betroffen haben und die ich mit Gottes Hülffe überwandt, will mich auch keineswegs darüber grämen, sondern im Gegentheil an jeder Stelle mich der Güte Gottes erinnern und dem Allerhöchsten dancken, der stets mit seiner kräfftigen Hülffe und mit seinem Trost bey mir gewesen ist, der mein Hertz regieret hat, damit es nicht von Gott abwiche, der meinen Sinn und Verstand bewahret hat, daß sie sich nicht verwirrten, der meinen Gliedern Kraft und natürliche Stärcke gab, ja, der mir Ruhe des Gemüthes und Freudigkeit vergönnte und noch vergönnt. Du, unbegreifflicher Gott, seyest gelobt und gepriesen ewiglich!
Umb zu meinem Vorsatz zu schreiten: Ich halt es vor nothwendig, meine Leidens-Geschichte mit dem Anfang des Tages zu beginnen, auff den der fatale Abend meiner Gefangenschafft folgte, und etzliches darüber zu melden, was sich mit mir auff dem Schiffe zutrug. Nachdem der Schiffer am 8. Augusti Anno 1663 umb 9 Uhr Vormittags etwas außerhalb der St. Anna Brücke seinen Ancker geworffen hatte, sendete Peter Dreyer (der von Petcon, damals Sr. königl. Majt. von Dänemarck Recident in Engeland, committiret war, mich fortzuführen) den Schiffer mit Brieffen an Landt. Ich kleidete mich an und setzte mich in eine der Kojen der Bootsleute auff dem Verdeck mit einer festen Resolution, freymüthig alles das entgegenzunehmen, so mir vorgelegt würde. Doch erwartete ich keineswegs das, was kam; denn obwol ich ein gutes Gewissen hatte und mir nichts Böses vorzuwerffen wußte, hatte ich unterschiedliche Male vorbem. Peter Dreyer umb die Ursach gefragt, weßhalb ich so von dannen geführt worden sey. Da gab er mir immer die Antwort, welche der Verräther Braten mir in Dovers gab (wenn ich ihn umb die Ursach meines Arrestes fragte), nämlich daß man mich vielleicht beschuldige, an General Major Fuxsis Tod schuld zu seyn, und daß man glaube, ich habe meinen Sohn zu diesem Todtschlag persuadiret; sagte, sich keine andere Ursach dencken zu können. Um 12 Uhr kam Nels Rosenkrantz, damals Oberster Lütenant, und Statz Major Steen Anderson Bilde mit einigen Musquettieren an Bord. Oberster Lütenant Rosenkrantz grüßte mich gar nicht. Der Statz Major spatzirte hin und wieder und kam mir flux nahe, so daß ich ihn en passant fragte, was da los sey. Er antwortete nichts anderes als: › Bonne mine, mauvois ieu;‹ darvon war ich ebenso klug wie zuvor. Ohngefähr umb 1 Uhr kam Capitain Bendix Alfeldt mit mehren Musquettieren an Bord, und nachdem er eine Weile mit Peder Dreyer gesprochen hatte, kam Dreyer zu mir und sagte: ›Es ist befohlen, daß Ihr in die Cajütte gehen sollt.‹ Ich sagte: ›Gerne,‹ und ging strax. Bald darauff kam Capitain Alfeldt zu mir herein und sagte, er habe Ordre Ich hatte einen Ring mit einem Tafel-Stein zu 200 Rdlr.; ich biß den Stein ab, warff das Gold auf den Strand und behielt den Stein im Mund. An meiner Sprache konnte man nicht merken, daß etwas im Munde war., meine Brieffe, mein Gold, Silber, Geldt und mein Messer von mir zu fodern. Ich antwortete: ›Gerne,‹ nahm meine Armbänder und Ringe ab, sammelte auff einen Haufen alles Gold, Silber und Geldt, und gab es ihm. Geschriebenes hatte ich nichts anderes als Copien von denen Brieffen, so ich an den König von Engeland geschrieben hatte, Annotationen über das eine oder das andere, was meine Reise anging, und einige englische Vocabeln; die überliefferte ich ihm auch. Das vorbemeldte legte Alfeldt in einen silbernen Bett-Topff, den ich mit mir hatte, versiegelte ihn in meiner Gegenwart; fuhr darmit von Bord. Eine Stunde oder etwas mehr darnach kam General Major Fridrich von Anfeldt, Commandant in Copenhagen, ließ begehren, daß ich zu ihm vor die Cajütte kommen möchte. Ich parirte strax. Er grüßte mich, gab mir die Hand und brauchte viele Complimente, redete immer französch. Er freute sich über meine Gesundheit, er fürchtete, daß die See mich incommodiret hätte; ich solle mir nicht die Zeit lang werden lassen, baldt würde ich anders accommodiret werden. Ich hielt mich an die letzten Worte und sagte lächelnd: ›Monsieur sagt anders, aber nicht besser.‹ ›Ja gewiß‹ replicirte er, ›Ihr sollt gut accommodirt werden, die fürnehmsten des Reiches werden Euch besuchen.‹ Ich verstand wol, was er darmit meinte, aber antwortete: ›Ich bin gewohnt mit fürnehmen Leuten umbzugehen, daher wird mir das nicht fremd vorkommen.‹ Darauff rieff er einem Diener, von welchem er vorbemeldten silbernen Bett-Topff (den Cap. Alfeldt mit sich genommen hatte) forderte. Das Papir, so Cap. Alf. darüber gesiegelt hatte, war abgerissen. Der General Major wendete sich zu mir und sagte: ›Hier habet Ihr Euere Juèèlen, Euer Gold, Silber und Geldt zurück; Cap. Alf. hatte unrecht verstanden, es waren nur Brieffe, die zu verlangen er beordert war, und nur diese sind heraus genommen und auff dem Schlosse geblieben; über das andere könnet Ihr disponiren wie Ihr selber wollt.‹ ›In Gottes Namen‹ (antwortete ich); ›da ist es mir also frey gestellt, meine Armbänder und Ringe wieder auffzustecken?‹ ›O Jesus‹ (sagte er), ›sie sind ja Euer, Ihr habt darüber zu disponiren.‹ Ich setzte Armbänder und Ringe auff, das übrige gab ich meiner Jungfer. Seine Freude zeigte sich nicht allein auff seinem Angesicht, auch sein Mund war voll von Gelächter und lieff über vor Lustigkeit. Unter Anderem sagte er, daß er die Ehre gehabt habe, zween meiner Söhne zu kennen, mit denen er in Holland umbgegangen sey, lobte sie auff das beste. Ich complimentirte ihn, als ob ich darauff hörete, that, als dächte ich, er redete aus einem guten Hertzen. Er überließ sich allerhand Späßen, besonders mit meiner Jungfer, meinte, daß sie hüpsch sey, wunderte sich, daß ich so hüpsche Mädchen halten dürffe; wenn die holsteinschen Frauen hüpsche Mädchen hielten, so sey es nur, umb den Mann in Humeur zu versetzen; hieltt einen langen discours darüber, wie sie sich darbey hätten, mit anderem ungezogenen Tratsch, den er zu meiner Jungfer führte. Ich antwortete nichts anderes, als daß er wol aus Erfahrung sprechen müsse. Er redete allerhand dummes Zeug zu meinem Mädchen, doch sie antwortete nicht ein Wort. Später sagte mir der Schloßvoigt, daß er, v. Anfeldt, anfangs den König glauben gemacht habe, mein Mädchen wäre meine Tochter, und daß der König lange in der Meynung geblieben sey. Endlich nach langem discours nahm der Gen. Major von mir Abscheidt mit dem Compliment, daß ich mir die Zeit nicht möge lang werden lassen, daß er baldt wieder kommen werde; fragte, was er Seiner königl. Majt. sagen solle. Ich bat, er möge mich auff die beste Weise Seiner Majts. Gnade recommandiren, ich wußte nicht viel sagen zu lassen oder worumb ich bitten sollte, indem ich nicht wußte, was sie mit mir im Sinne hatten. Als die Uhr gegen drey war, kam Gen. Maj. von Anfeldt wieder, war voll Gelächter und fröhlich, bat mich umb Entschuldigung daß er so lange fort gewesen sey. Ich solle mir nicht die Zeit lang werden lassen, baldt würde ich zur Ruhe kommen; er wüßte wol, daß die Leute (darmit wies er auff die Musquettiere, so längs beiden Seiten des Schiffes standen) ungestümb seyen und mich incommodirten, daß die Ruhe mir am besten wäre. Ich antwortete, die Leute incommodirten mich gar nicht, doch daß Ruhe mir wol dienen könne, sintemal ich 13 Tag bei ziemblich schwerem Wetter die See gehalten habe. Er fuhr mit seinen Complimenten fort und sagte, wenn ich in die Stadt komme, so würde seine Fraw sich die Ehre geben, mir auffzuwarten, ›und da mir scheint‹ (sagte er), ›daß Ihr nicht viel Bagage mit Euch habet, und vielleicht nicht die nothwendigen Kleider, so wird sie Euch verschaffen, wessen Ihr bedürffet.‹ Ich danckte ihm und sagte, daß die Ehre auff meiner Seite sey, wenn seine Fraw mich besuchte, aber meine Bagage sey so groß, wie ich sie zur Zeit bedürffe; würde ich in der Zukunfft etwas brauchen, so wolle ich hoffen, daß sie vor dieser Sorge bewahrt bleibe; ich hätte nicht die Ehre, sie zu kennen, bat ihn doch, ihr meine Dienste zu vermelden. Er fand allerley discours, über Birgitte Speckhans AdÜ Birgitte Speckhans war die Frau des Ceremonienmeisters Franz Eberhard v. Speckhan. Sie hatte früher bei Leonora Christina in Diensten gestanden und war der Ulfeldtschen Familie sehr ergeben. In ihrem Hause stiegen Corfitz Ulfeldt und Leonora Christina ab nach ihrer Flucht von Malmö. (Sophus Birket Smith' dän. Ausgabe von Leonora Christenens Jammersminde)., über verschiedene Lappalia, umb die Zeit damit zu vertreiben, doch ist es nicht der Mühe werth, ihrer zu gedenken, noch weniger sie auffzuschreiben. Endlich kam Botschafft, daß er mich vom Schiff wegführen, solle, weßhalben er mit Höfflichkeit sagte: ›Gefällt es Euch, Madame, in dieses Boot zu steigen, so hier zur Seite des Schiffes liegt?‹ Ich antwortete: ›Mir gefällt alles das, was ich muß und mir von Sr. königl. Majt. befohlen wird.‹ Der Gen. Major stieg zuerst in das Boot hinab und reichte mir die Hand; Oberster Lütenant Rosenkrantz, Capitain Alfeldt, Peter Dreyer und mein Mädchen gingen mit in das Boot. Und da unzähliges Volk sich versammelt hatte, das Spetackel anzusehen, ja ein großer Theil sich in Boote begeben hatte, umb mich zur Genüge zu beschawen, ließ er sein Auge nicht von mir, und da er sah, daß ich mich baldt auff die eine, baldt auff die andere Seite wendete, umb jenen ihr Vergnügen zu gönnen, sagte er: ›Das Volk frewet sch.‹ Ich sah wol keinen, der Zeichen der Freude gab, ihn ausgenommen, weßhalb ich antwortete: ›Der sich heute frewet, kann nicht wissen, ob er nicht morgen weine; doch ich sehe, daß, sey es nun zur Freude oder zur Trawer, das Volk gleich dicht zusammen läufft, und viele wundern sich über einen Menschen.‹ Als wir etwas besser vorwärts kamen, sahe ich die bekannte un-tugendsame Birgitte Vlfeldt AdÜ Die bekannte un-tugendsame Birgitte Vlfeldt – Corfitz Ulfeldt's jüngere Schwester Birgitte oder Berte (vgl. das Bild des Familienmahls und das Verzeichniß der Jacob Ulfeldt'schen Kinder weiter unten, war verheirathet mit Otto Krasse zu Egholm, dem sie zweimal davonlief. Sie soll ein ganz niederträchtiges Frauenzimmer gewesen sein. Corfitz Ulfeldt bezeichnet sie in einem Brief an Dr. Otto Sperling als seine und Leonora Christinens tödtlichste Feindin. Er nennt sie eine Schlange und ein verdammtes Weib, das ihn und seine Frau der Regierung verrathen habe und nur nach Hamburg (wo sie sich aufhielt, als der Brief geschrieben ward) gekommen sei, um seine Angelegenheiten auszuspioniren. Er sagt, sie sei voll von Lügen, und verbietet Sperling, sie in sein Haus kommen und seinen Sohn Leon Ulfeldt, den Sperling erzog, sehen zu lassen. (Soph. Birket Smith' dän. Ausg.), welche sich frewete. Sie hatte sich auff einen Postwagen begeben; hinter ihr saß ein Kerl, dem Anscheine nach ein Studenter. Sie fuhr den Strand entlang. Als ich mich nach dieser Seite wendete, stand sie im Wagen auff und lachte aus vollem Hals, daß es gellte. Ich sah lange zu ihr hin, schämte mich ihrer Un-verschämtheit und über den Spott, den sie sich selber anthat, im Uebrigen kümmerte mich dieses nicht mehr als der Hunde ihr Gebell, denn ich achtete beydes gleich viel. Mich hätte eher die Wehmuth der guten Leute zur Kleinmüthigkeit gebracht; denn verschiedene, sowol Männer wie Frawen vergossen Thränen, selbst die, welche ich nicht kannte. Der Gen. Major blieb beständig bei seinem Geplauder und ließ mich nie aus dem Auge, denn er fürchtete sich (wie er später sagte), daß ich mich in's Wasser stürtzen würde. AdÜHiernach befand sich folgende aus dem Manuscript gestrichene Parenthese: ( Er beurtheilte mich nach sich selber; er konnte des Glückes Wechsel nicht ertragen, wie sein Ende auch zeigte, denn es war nur von wegen eines Ehren-Tittels, den ein anderer statt seiner erhielt, daß er von Sinn und Verstand kam. Er wußte nicht, daß ich von einem anderen Geist regiert ward als er, der mir Muth und Stärke gab, wogegen der Geist, dem er diente, ihn in Verzweiflung von dannen führte.) Vgl. die Aufzählung am Schluß der Vorrede, Nr. 5. Als das Boot an der kleinen Brücke bei der Renterey anlangte, stieg Capitain Alfeldt aus und reichte mir die Hand, geleittete mich die Schloß-Brücke hinauff. Auff dem Schloß-Platz hielten Regimenter zu Pferd und zu Fuß, und Musquettiere fanden zu beyden Seiten, wo ich vorwärts schritt. Auff der Schloß-Brücke stand Jockum Walburger AdÜ Jockum Walburger, Schloßvoigt. Vgl. Einleitung., Schloßvoigt, der ging mir voran, und da das Volk auff beyden Seiten sich bis zur Königs-Treppe im Kreis auffgestellt hatte, that der Schloßvoigt so, als ob er dahin gehen wollte, wendete sich aber knapp umb und sagte zu Alfeldt: ›Hier her,‹ und ging dann nach der Thür des Blawen Thurmes, stand dort eine geraume Zeit und machte sich mit dem Schlüssel zu thun, that als ob er nicht auffschließen könne, umb mich recht lange zum Spetackel des Volkes seyn zu lassen. Und da mein Hertz zu Gott gerichtet war und ich mein Vertrauen in den Allerhöchsten gesetzt hatte, erhob ich indessen meine Augen gen Himmel, suchte dort Stärcke, Krafft und Rettung, so mir auch gnädig gewähret ward. (Einen Umbstand will ich nicht un-vermeldt lassen, nämlich, als ich meine Augen zum Himmel auffschlug, flog ein schreiender Rabe über den Thurm, und ihm folgte ein Flock Tauben, die auch in der selbigen Richtung flogen.) Endlich nach langem Zögern machte der Schloßvoigt die Thurmthür auff, und ward ich vom vorbem. Cap. Alfeldt in den Thurm geführt. Meiner Jungfer, welche sich anbot zu folgen, rieff Gen. Maj. von Anfeldt zu, sie solle zurück bleiben. Der Schloßvoigt ging die Treppe hinauff und zeigte Alfeldt den Weg in ein Missethäter-Gefängniß, welchem man den Namen Dunckle Kirche gegeben hat. Dort quittirte Alfeldt mich mit einem Seufzer und einer kleinen Reverentz. Ich kann ihm wol nachsagen, daß sein Antlitz Mitleid zeigte und daß er dem Befehl ungern nachkam. Die Uhr schlug halb sechs, als Jockum die Thür meines Gefängnisses schloß. Ich fand vor mir einen kleinen niedrigen Tisch, auff welchem ein Messing-Leuchter mit einem brennenden Licht stand, einen hohen Stuhl, zween kleine Stühle, ein föhrenes Bett ohne Vorhänge mit altem harten Bettzeug, einen Nacht-Stuhl und Bett-Topff. Auff allen Seiten, wo ich mich wendete, traf ich Stanck; war kein Wunder, denn drey Bawern, so hier gefangen gesessen hatten und den nämlichen Tag heraus geholt und anderswo hingesetzt worden waren, hatten ihre Notdurfft längs den Wänden gemacht. Bald darauff, nachdem die Thür geschlossen war, wurde sie wieder geöffnet, und kamen zu mir herein Graf Christian Rantzow, Premier Ministre, Peter Retz, Canzeler, Christoffer von Gabel, damals Rentmeister, und Erick Krag, damals Secreterer, welche mir alle mit Civilité die Hand gaben. Canzeler nahm das Wort und sagte: ›Seine königliche Majestät, mein allergnädigster Herr und Erb-König AdÜDiese Bezeichnung Erb-König, die man durchgehends finden wird, hat ihren Grund darin, daß Dänemark früher ein Wahlreich gewesen war und dem königlichen Hause damals erst vor Kurzem die Erbfolge war verliehen worden; man betonte daher das Wort Erb-König ausdrücklich. Vgl. Einleitung., lassen Euch, Madame, sagen, daß Se. Majt. hohe Ursach hat zu dem, was er wider Euch thut, die Ihr auch zu wissen kriegen sollt.‹ Ich antwortete: ›Es ist für mich sehr zu bedawern, wenn man Ursachen finden sollte; will doch vermuthen, sie werden nicht von der Art seyn, daß Sr. kön. Majts. Ungnade lange dawern werde, wenn ich die Ursach wissen und mich vertheidigen darff«. Graf Rantzow antwortete: ›Ihr werdet schon Erlaubniß bekommen, Euch zu vertheidigen;‹ flüsterte dem Canzeler etwas zu, worauff Canzeler einige Fragen stellte, zuerst: Ob ich itzt auff meiner letzten Reise mit meinem Mann in Franckreich gewesen sey? Ich antwortete ja darauff. Zum andern: Was mein Mann dort machte? Darauff antwortete ich, daß er Medici wegen seiner Schwachheit consultirte, ob es ihm dienlich sey, die warmen Bäder dort im Lande zu gebrauchen, was keiner ihm rathen wollte, ihm sey auch von einem Medico in Holland mit Namen Burri AdÜGiovanni Francesco Borri, ein berüchtigter Alchemist, Wunderdoctor und Betrüger, geboren zu Mailand 1625, ward in Rom zum Jesuiten erzogen. Er soll bedeutende Kenntnisse in der Arzneiwissenschaft besessen haben. Da er jedoch in Rom ein Reich Gottes auf Erden gründen wollte, mußte er von dort fliehen und schlug in Straßburg, später in Amsterdam seinen Sitz auf, wo vornehme Kranke und fürstliche Goldmacher, namentlich von Paris aus, ihn aufsuchten. Er beutete sie aus und lebte in großer Pracht, bis er entlarvt wurde und nach Hamburg entfloh. Nachdem er der Königin Christine von Schweden und Friedrich III. von Dänemark durch Goldmacherei fabelhafte Summen entlockt hatte, wollte er nach Constantinopel fliehen, ward aber in Oesterreich gefangen genommen und nach Rom ausgeliefert, wo er seine Ketzereien abschwur. Er ward 1672 auf die Engelsburg gebracht, wo er 1695 starb. abgerathen worden, als er ihm umb seine Meynung fragte. Zum 3.: Was ich in Engeland beabsichtiget habe? Zu diesem antwortete ich, daß meine Absicht gewesen sey, eine Summe Geldes einzufordern, welche der König von Engeland uns schuldig war, und wir ihm zur Zeit seiner Noth vorgestreckt hatten. Zum 4.: Wer mit mir in Engeland gewesen sey? Ich nannte die, so mit mir in Engeland waren, nämlich einen Edelmann mit Namen Cassetta AdÜJan Marcus Cassetta, ein vlämischer Edelmann, war Ulfeldt und Leonora Christinen sehr ergeben und heirathete später deren älteste Tochter Catharina., meine Jungfer, die mit mir herkam, einen Lacquei, der in Engeland blieb, mit Namen Frantz, und des Edelmanns Diener. Zum 5.: Wer meinen Mann zu Brügge besuchte? Ich konnte dieses nicht eigentlich sagen, da mein Herr in einer Kammer à part Besuche in Empfang nahm, wo ich nicht hin kam. Gf. Rantzow sagte: ›Ihr wisset wol, wer am meisten zu ihm kam.‹ Ich antwortete, von denen, so ich kannte, kamen am meisten zwey Brüder von den Arander AdÜDie Patrizierfamilie d'Aranda in Brügge war mit Ulfeldt befreundet., vorbem. Cassetta und ein Edelmann, welcher Ognati hieß. Zum 6. fragte Canzeler: Mit wem ich hier zu Lande correspondiret habe? Worauff ich antwortete, daß ich an H. Hendrick Bielcke AdÜHenrik Bjelke, dänischer Reichsadmiral, war verheirathet mit Edel Ulfeldt, einer Schwester von Corfitz Ulfeldt's Schwager Ebbe Ulfeldt. geschrieben habe, an Olluf Brockenhuuß AdÜVgl. das Verzeichniß der Jacob Ulfeldt'schen Kinder weiter unten und das Bild des Familienmahles., Frau Elße Paßberg und Frau Marie Vlfeldt; ich erinnerte mich nicht mehrer. Gf. Rantzow fragte: Ob ich mehre Brieffe hätte als die, so ich abgelieffert hatte? Worauff ich nein antwortete, ich hätte keine mehr. Er fragte ferner: Ob ich mehr Juëlen mit mir hätte, als die er gesehen habe? Ich antwortete, ich hätte zween Reihen kleiner runder Perlen umb meinen Hut und einen Ring mit einem Demant gehabt, welchen ich einem Lutenant in Dovers mit Namen Braten (der mich später verrieth) gegeben hätte. Gf. Rantzow fragte: Wie viel die Perlen wol werth gewesen seyn könnten? Das konnte ich nicht eigentlich sagen. Er meinte, ohngefähr wüßte ich das wol. Ich sagte, 200 Rdlr. oder etwas mehr waren sie wol werth. Darauff schwiegen sie alle ein wenig still. Ich beschwerte mich über die harte Gefangenschafft, daß ich so übel behandelt werde. Gf. Rantzow antwortete: ›Ja, Madame, Seine königl. Majestät hat hohe Ursach darzu, wollet Ihr die Wahrheit bekennen und das bey Zeiten, so ist vielleicht Gnade zu erwartten. Hätte Marichal de Birron AdÜCharles de Gontaut, Herzog von Biron, Marschall und Pair von Frankreich, Statthalter von Burgund, geboren 1562, ein ausgezeichneter Feldherr und tapferer Soldat, Günstling Heinrich's IV., gegen welchen er mit dem Herzog von Savoyen und der spanischen Regierung eine Verschwörung anzettelte. Der gute König verzieh ihm, doch ward ihm diese Großmuth von Biron übel gelohnt, welcher sich mit dem Herzog von Bouillon und dem Grafen von Auvergne zu neuem Verrath gegen den König verband. Allein auch dieser Anschlag ward entdeckt. Heinrich IV. suchte nun seinen Günstling zum Geständniß zu bewegen, indem er ihm Verzeihung zusicherte. Doch Biron wollte trotz allen Zuredens nicht gestehen und ward am 31. Juli 1602 in der Bastille enthauptet. die Sache bekannt, umb welche man ihn auff Befehl des Königes befragte und ihm Königl. Gnade anbot, sofern er die Wahrheit sagen wollte, wäre es ihm nicht ergangen wie es ging. Ich habe mir für Wahrheit sagen lassen, daß der König von Franckreich ihm sein Vergehen hätte verziehen, falls er es bey Zeiten bekannt haben würde; deßhalb bedencket Euch, Madame!‹ Ich antwortete: ›Wessen ich auff Sr. königl. Mts. Befehl gefragt werde und was mir wissentlich ist, das werde ich in Unterthänigkeit gerne sagen.‹ Darauff bot Gf. Rantzow mir die Hand, und ich erinnerte ihn mit wenigen Worten an die Härte meiner Gefangenschafft. Gf. Rantzow versprach, dieses Sr. kön. Mt. anzutragen. Darnach gaben die anderen mir die Hand und gingen fort. Und es wurde zugeschlossen. Mein Gefängniß war ein weniges geschlossen, weßhalb ich die Gelegenheit wahrnahm, und steckte hie und da in Löcher und zwischen Schutt ein güldenes Schlag-Werck, eine silberne Feder, so Tinte von sich gibt und mit Tinte gefüllet war, und ein aus Schildpatt und Silber gearbeitetes Scheerenfutteral. Dies war kaum verrichtet, als die Thür wieder auffgeschlossen wurde, und herein kamen der Königinn Hofmeisterinn, ihre Kammer-Frau und die Gattinn des Proviant-Schreibers, Abel Catharina. Die letzte kannte ich. Sie und die Kammer-Frau der Königinn trugen Kleider über den Arm; die bestanden aus einem langen mit Seide gesteppten Schlaff-Rock, überzogen mit leibfarbenem Schiller-Taffet und mit weißseidenem Unter-Futter, einem leinenen Unter-Rock, rund umbher in schwartzem Spitzen-Muster bedruckt, einem Paar seidenen Strümpfen, einem Paar Pantoffeln, einem Hemd, einem Fürtuch, einem Nacht-Mantel und zween Kämmen. Sie grüßten mich nicht. Abel Cath. nahm das Wort und sagte: ›Es ist Ihrer Majt. der Königinn Befehl, daß wir Euch Eure Kleider nehmen und Euch diese davor geben sollen.‹ Ich antwortete: ›In Gottes Namen!‹ Darauff löseten sie mir von dem Kopff meinen Wulst, in welchem ich Ringe und viele lose Demanter eingenäht hatte. Abel Cath. fühlte überall auff meinem Kopff, ob etwas in das Haar gesteckt sey; sagte zu den anderen: ›Dar ist nichts, wir haben die Kämme nicht vonnöthen.‹ Abel Cath. begehrte die Armbänder und Ringe, welche mir zum zweyten Mal genommen wurden. Ich nahm sie ab und gab sie ihnen, bis auff einen kleinen Ring, der mir auff das äußerste Glied meines kleinen Fingers ging, konnte etwas mehr als einen Rdlr. werth seyn; den bat ich behalten zu dürffen. ›Nein‹ (sagte die Hofmeisterin) ›Ihr sollt nichts behalten.‹ Abel Cathr. sagte: ›Es ist uns strenge verbothen, Euch das allergeringste zu lassen; ich habe der Königinn bei meiner Seel und Seligkeit schwören müssen, daß ich fleißig suchen und Euch nicht das allergeringste lassen wolle, aber darumb sollet Ihr es nicht missen; das soll alles zusammen versiegelt und zu Eurem besten verwahrt werden, das hat, bey Gott, die Königinn gesagt.‹ ›Gut, gut, in Gottes Namen!‹ antwortete ich. Sie zog mir alle meine Kleider ab. In meinem Unter-Rock hatte ich unter den breiten Gold-Spitzen Ducaten versteckt, in meiner seidenen Camisolle einen kleinen Demant-Schmuck, im Fuß meiner Strümpffe Jacobusse und Saphire in meinen Schuhen. Als sie mir das Hemd ausziehen wollten, bat ich es an behalten zu dürffen. Nein, schwur sie bei ihrer Seele, sie dürffe nicht. Sie entblößte mich gantz, und die Hofmeisterinn gab Abel Cathr. einen Winck, welchen sie nicht gleich verstand, weßhalb die Hoffm. sagte: ›Wisset Ihr wol, was Euch befohlen ist?‹ Darauff suchte Abel Cathr. mit ihrer Hand an einer heimblichen Stelle und sagte zu der Hoffm.: ›Neen, bi Gott! dar ist nichts.‹ Ich sagte: ›Ihr handelt un-christlich und un-geziemend gegen mich.‹ Abel Cathr. antwortete: ›Wir sind nur Dienerinnen, wir haben zu thun, was uns befohlen ist; wir sollen nach Brieffen suchen und nicht nach anderem, alles andere werdet Ihr zurück erhalten, es wird wol verwahret werden.‹ Nachdem sie mich so spoliret und mir die mitgebrachten Kleider angezogen hatten, kam der Hoffmeisterinn Bursch herein und suchte überall mit Abel Cathr., fanden auch alles, was ich versteckt hatte. Gott verblendete ihre Augen, so daß sie meiner Ohrringe nicht gewahr wurden, in welchen je ein großer Rosenstein sitzet und von welchen ich itzt die Steine abgebogen habe. Das Gold, so schlangenartig gemacht ist, sitzet noch in den Ohren. Sie wurden auch nicht gewahr, daß etwas umb mein Knie eingenähet war.
Die Hoffmeisterinn war sehr hart; sie konnten ihr nicht fleißig genung suchen. Sie lachte mich mehre Male aus und konnte auch nicht leiden, daß ich saß, fragte ob ich nicht stehen könne, ob mir etwas fehle. Ich antwortete: ›Mir fehlet nur allzu viel, übrigens kann ich wol stehen, wenn es vonnöthen ist.‹ (Es war kein Wunder, daß die Hoffmeisterinn die Plünderungs- Ordre so gut exequiren konnte, sie hatte ihren sel. Mann, Obr. Schaffshaußen, offt in den Krieg begleittet.) Als sie nu alle Stellen mit Fleiß untersuchet hatten, nahmen sie alle meine Kleider, außer einer Taffet-Kappe für den Kopff, mit sich und gingen fort. Und kam der Schloßvoigt gleich herein mit seinem Hut auff und sagte: › Leonora, warumb habet Ihr Eure Sachen versteckt?‹ Ich antwortete ihm nicht ein Wort, denn ich hatte die Resolution gefaßt, ihm nicht zu antworten, was er auch sagen mochte; seine Qvaliteten waren mir bekannt, ich wußte, daß er meisterhafft eine Rede verbessern und die Worte auff die Weise drehen konnte, wie er glaubte, daß die gerne hörten, so auff Schaden sinnen. Er fragte abermals mit den selbigen Worten, indem er noch hinzu fügte: ›Hört Ihr nicht?‹ Ich sah ihn über die Schulter an und ließ seine Verachtung mich nicht beirren. Darauff wurde der Tisch gedeckt, und 4 Gerichte Speise hereingetragen, aber bey mir war kein Apetit, obwol ich den Tag wenig oder gar nichts genossen hatte. Eine Stunde später, nachdem die Speisen herausgetragen waren, kam ein Mädchen herein mit Namen Maren Blocks, welche sagte, sie hätte von der Königinn Befehl, die Nacht über bey mir zu bleiben. Der Schloßvoigt schertzte viel mit vorbemeldter Maren und war sehr fröhlich, fandt auch allerhand losen Schnickschnack. Endlich, als die Uhr auff 10 ging, sagte er Gute Nacht und schloß zwey Thüren vor dem Gefängniß, von denen die eine mit Kupfer beschlagen ist. Als Maren sich mit mir allein sah, beklagte sie meinen Zustand, berichtete mir auch, daß viele, welche sie mit Namen nannte (wovon ein Theil mir wol bekannt war) mit Wehmuth und Thränen meine Freymüthigheit angesehen hatten, besonders H. Hendrick Bielckes Frau, welche vor Weinen ohnmächtig hingesuncken sey. Ich sagte: ›Die guten Leute haben mich im Wolstand gesehen; ist kein Wunder, daß sie des Glückes Un-beständigkeit beweinen;‹ wünschte, daß Gott jeden besonders vor Unglück bewahren wolle, die sich mein Unglück zu Hertzen nähmen. Ich tröstete mich mit Gott und einem guten Gewissen, sey mir nichts böses bewußt, fragte wer sie sey, und wem sie diene. Sie sagte, sie diene in der kleinen Küche der Königinn und habe das Silber in Verwahrung (ich entnahm daraus, daß sie ohne Zweiffel das Silber zu reinigen hatte, was auch so war). Sie sagte, daß die Königinn keine kriegen könne, die bey mir allein seyn wolle, denn ich würde für böse gehalten; man sage auch, ich sey sehr weise, ich wüßte zukünfftige Dinge. Ich antwortete: ›Wenn ich diese Weisheit besäße, glaube ich kaum, daß ich hier herein gekommen wäre, denn dann hätte ich mich davor hüthen können.‹ Maren meinte, man könne das wol wissen und gleichwol sich nicht davor hüthen. Sie sagte des weiteren, daß die Königinn selber mit ihr gesprochen und so gesagt habe: ›Du sollst diese Nacht bey Leonora seyn, du sollst dich nicht fürchten, sie kann nu nichts böses thun. All kann sie häcksen, so ist sie nu gefangen und hat nichts bey sich, und wo sie dich schlägt, so gebe ich dir Urlaub, ihr dicht wieder zu schlagen, daß sie bluten kann.‹ Maren sagte ferner: ›Die Königinn weiß wol, daß ich in einer hitzigen Kranckheit verwirrt worden bin, dahero wollte sie, ich solle bey Euch seyn;‹ flog mir umb den Hals, wie ich saß, und caressirte mich in ihrer Weise und sagte: ›Schlag mich mein Hertz, schlag mich! Ich werde,‹ schwur sie, ›nicht wieder schlagen.‹ Ich entsetzte mich ein wenig, fürchtete, daß die Tollheit kommen möchte. Sie sagte weiter, daß, als sie mich die Brücke herauff habe kommen sehen, so war es, als ob ihr Hertz in Stücke springen wollte, bedeutete mir mit vielen Worten, wie lieb sie mich hätte, und wie Jungfer Carisius AdÜVermuthlich Anna Cathrine Charisius, eine Tochter des dänischen Gesandten im Haag, Peder Charisius. Sie verheirathete sich 1667 mit Morton Skinkel zu Söholm. (Soph. Birk. Smith' dän. Ausgabe.), die bey ihr im Fenster stand, mich lobte und wünschte, zu meiner Rettung etwas beitragen zu können, mit mehr solchen Worten und Reden. Ich nahm die ungewöhnliche Caresse gut entgegen, sintemal die Umbstände es nicht anders wollten, und sagte, es würde gegen alle Billigkeit seyn, den jenigen Schläge zu biethen, die so große Affection sehen ließen, wie sie gethan habe, in Sonderlichkeit, wenn sie von ihrem Geschlechte wären; ich könne nicht wissen, wie die Königinn auff den Gedancken gekommen sey, daß ich schlüge, da ich doch niemals einem meiner Kammer-Mädchen eine Ohrfeigen gegeben hätte; ich danckte ihr vor ihre gute Gesinnung; ich hoffte, daß alles gut werden würde, wie sawer es auch aussehe; ich wolle fest zu Gott halten, der meine Un-schuld kenne, daß ich nichts un-verantwortliches gethan habe; ihm wolle ich meine Sache befehlen, er würde mich wol retten, daran zweiffle ich nicht, wenn auch nicht gleich, so geschehe es doch, dessen sey ich gewiß. Maren begann, über verschiedenes zu sprechen, unter anderem über meine Schwester Elisabeth Augusta AdÜVgl. das Verzeichniß der Kinder Christian's IV. und Frau Kirsten Munk's weiter unten., wie sie in ihrem Ercker gesessen habe, als man mich gefangen vorüber führte, und habe gesagt, wenn ich schuldig sey, so wäre nichts dargegen zu sagen, sey ich aber unschuldig, so geschehe mir zu viel. Ich sagte nichts darzu, antwortete auch nichts auff vielen anderen Schnickschnack, den sie führte. Sie begann von ihrer eigenen Verfolgung zu sprechen, was sie flux weitläufftig machte, indem sie andere Historien dar hinein flickte, so daß mir der discours (in dem damaligen Zustand) sehr lästig war; ich war außerdem sehr müde und von Sorge matt, sagte, ich wolle versuchen, ob ich schlaffen könne, both ihr Gute Nacht. Meine Gedancken verhinderten mich am schlaffen. Ich bedachte meinen dermaligen Zustand, konnte mich keineswegs darein finden oder die Ursach eines so großen Un-glücks erkennen. Leicht war zu bemercken, daß mir etwas anderes als Fuxis Tod beygelegt wurde, sintemalen man mich so spöttlich behandelte. Als ich lange der Wand zugekehrt gelegen hatte, wendete ich mich umb und wurd gewahr, daß Maren heimblich vor sich hin weinte, weßhalb ich sie nach der Ursach ihres weinens fragte. Sie leugnete zuerst, daß sie weine, später bekannte sie, daß sie über dieses Ereigniß in tieffe Gedancken gefallen sey. Es wäre ihr in den Sinn gekommen, daß sie so viel über Fräwlein Leonora und deren Herrlichkeit etc. habe rede hören, wie sehr der König sie geliebt habe und wie alle sie lobten et., und itzt solle sie in diesem verfluchten Diebes-Gefängniß sitzen, wo weder Sonne noch Mond herein scheine, und wo solch ein Stanck sey, umb Menschen darmit zu vergifften, die nur hinein und gleich wieder hinaus gingen, geschweige die, so darinnen bleiben müßten. Ich meinte, Ursach ihres Weinens sey, daß sie bey mir in dem schlimmen Gefängniß eingeschlossen bleiben solle, weswegen ich sie tröstete und sagte, daß sie nicht länger bei mir bleibe, als bis eine andere darzu ordiniret würde, sintemal sie in einem anderen Dienste stände; doch ich für meine Persohn dächte anjetzo nicht an frühere Zeiten, die gegenwärtigen gäben mir genung wahrzunehmen; wollte ich mich vergangener Zeiten erinnern, so würde ich mich auch der Unglücksfälle großer Herren, Keyser, Könige, Fürsten und anderer Standes-Persohnen erinnern, deren Herrlichkeit und Wolstand den meiningen weit überstieg, und deren Unglück doch viel größer gewesen als meines; denn sie seyen in der Tyrannen Hände gefallen, so sie un-menschlich tractirten, aber dieser König sey ein christlicher König und ein gewissenhaffter Herr, er werde wol auff bessere Gedanken kommen, wenn er Zeit kriegen werde, sich recht zu besinnen, meine Widersacher ließen ihm itzt nicht Muße darzu. Als ich dieses sagte, weinete sie noch mehr als zuvor, sagte aber nichts, sondern dachte bey sich (wie sie mir einige Tage darnach zu erkennen gab), daß ich nicht wüßte, welch ein schändliches Urtheil über meinen sel. Herrn AdÜAls Leonora Christina dies niederschrieb, war ihr Gemal allerdings schon längst gestorben, doch lebte er noch zu der Zeit, als die geschilderten Begebenheiten sich zutrugen. gefällt worden sey, und weinete umb so mehr, als ich dem Könige so fest vertraute. Die Nacht redeten wir so fort.
Den 9. Augusti des Morgens, als die Uhr 6 war, kam der Schloßvoigt herein, both Guten Morgen und fragte, ob wir Branntwein haben wollten. Ich antwortete nichts. Er fragte Maren, ob ich schlieffe. Sie antwortete, das wüßte sie nicht, ging zum Bett und stellte mir die selbige Frage. Ich danckte: das sey eine Sorte Getränck, so ich nie geschmeckt hätte. Der Schloßvoigt schwatzete mit Maren, war sehr vergnügt so früh am Tage, erzählte seine Träume, so er ohne Zweifel fingirte, umb nur etwas zu reden. Er sagte ihr heimblich, daß sie zur Königinn kommen solle, und befahl ihr, laut zu sagen, daß sie ein wenig hinaus zu gehen begehre. Er sagte, so lange wolle er bey mir bleiben, bis sie wieder komme, was er auch that, sprach einigemale zu mir und fragte: Ob ich etwas begehrte? Ob ich geschlaffen? Ob Maren gut gewacht hätte? Aber er bekam keine Antwort, weshalb die Zeit ihm flux lang wurde. Er ging nach der Treppe hinaus und kam wieder herein, sang einen Morgen-Psalm, schrie baldt nach einem, baldt nach dem andern, von denen er doch wußte, daß sie nicht da waren. Zu der Zeit war dort einer mit Namen Jon, der Raßmus Thurmwächter die Speisen herauff tragen halff, den rieff er über 40 Mal und das in einem Gesang, nahm den Ton hoch und tieff, schrie zuweylen, so laut er konnte, antwortete sich selber und sagte: ›Vatter, he is dar nicht, he is, bi Gott, dar nicht;‹ lachte über sich selbst, daß es gellte, fing wieder an zu rufen, entweder nach Jon oder nach Raßmus, so daß mir schien, er hatte Branntwein geschmeckt. Gegen 8 Uhr kam Maren zurück und sagte, daß umb Mittag gewiß zween Frawenzimmer kommen würden, sie abzulösen. Nach einiger Unterredung, die der Schloßv. mit Maren hatte, ging er hinaus und schloß die Thüren. Maren erzählte mir, wie die Königinn sie habe vor sich fordern lassen und gefragt habe, was ich thäte, und daß sie antwortete, daß ich stille vor mich hin läge und nichts redete. Die Königinn hatte gefragt, ob ich viel weinete. Maren antwortete: ›Ja gewiß, sie weinet heimlich für sich.‹ ›Denn‹ (sagte Maren) ›hätte ich gesagt, daß Ihr nicht weinet, so hätt die Königinn sich gedacht, daß ihr noch nicht genung habt, darob zu weinen.‹ Maren warnte mich, daß eine von den zween Frawenzimmern, die mir auffwarten sollten, das Weyb von des Königs Schuster sey, eine teutsche und sehr wol gelitten bey der Königinn. Ihre Majt. hätte sie gebraucht, Vldrich Christian Gyldenlöwe AdÜEin natürlicher Sohn Christian's IV. und Wibeke Kruse's, Frau Kirsten Munk's Kammerjungfer. (Vgl. Einleitung.) Geboren zu Jägersborg am 7. April 1630, starb während der Belagerung Copenhagens am 11. December 1658. in seiner rasenden und verzweiffelten Kranckheit, an der er starb, zu bedienen, und galt selbigen Weybes Wort sehr viel bey der Königinn. Von der anderen Frawens-Person wußte Maren nicht wer sie seyn könnte; vorbem. hatte mit der Königinn in Marens Gegenwart gesprochen und gesagt, sie traue sich nicht, mit mir allein zu seyn. Die Frawenzimmer kamen nicht vor Nachmittag gegen 4 Uhren. Der Schloßv. geleittete sie und schloß vor sie auff. Die erste war das Schuster-Weyb mit Namen Anna, welche gemeiniglich immer das Wort führen wollte. Die andere war das Weyb von des Königs Sattel Knecht mit Namen Catharina, auch eine teutsche. Nach dem Gruß sagte Anna, daß ihnen von Ihrer Majt. der Königinn befohlen sey, einen Tag oder zwey bey mir zu seyn und mir auffzuwarten. ›In Gottes Namen!‹ antwortete ich. Anna, die sehr geschäfftig war, fragte mich und sagte: ›Wil de Frue ock wat hebben? Se kan het man seggen, so wil ick bii de Königinne darumb anholden.‹ Ich danckete ihr und sagte, daß ich wol einige von meinen Kleidern haben möchte, als: zween Nachtwämser, eines mit seyden Bändern und ein anderes von weiß-geflocktem Zeug, mein Brusttuch, etwas für meinen Kopff und vor allem meine beinerne Balsam-Büchse, deren ich sehr bedurffte. Sie sagte, dies gleich verrichten zu wollen, was sie auch that, ging auff der Stelle und brachte es vor. Vorbemeldtes wurde mir alles durch den Schloßv., als die Uhr 6 war, zugestellt, bis auff meine Balsam-Büchse, welche fortgekommen seyn sollte, an deren Stelle man mir ein blecherne Dose mit einem ganz übeln Schlag Balsam gab. Als die Abend-Mahlzeit gehalten werden sollte, deckte Catharina auff einem Stuhl vor meinem Bett, doch mich gelüstete nicht, zu essen, begehrte eine Citron mit Zucker, was ich auch bekam. Der Schloßv. setzte sich mit den beyden Frawens-Persohnen zu Tisch und diente ihnen als Spaßmacher, so daß man nicht hätte sagen können, daß sie in einem Trawer-Haus, wol aber in einem Fest-Haus wären. Ich bat Gott innerlich umb der Seelen Krafft und Geduldigkeit, daß ich mich nicht vergessen möge. Gott erhörte mich, sein Namen sey gepriesen! Als der Schloßv. des Geschladders und Gelachters müde war, both er Gute Nacht nach 10 Uhr, sagte zu denen Weybern, wenn sie etwas wollten, sollten sie klopffen, der Thurm-Wächter sey gerade dar unter. Nachdem er beyde Thüren zugeschlossen hatte, stand ich auff, und machte Catharina mir das Bett. Anna hatte ein Gebet-Buch mit gebracht, daraus las sie das Abend-Gebet; ich legte mich auch und both ihnen Gute Nacht. Sie legten sich auff eine Bett-Banck, so ihnen hergerichtet war. Ich schlieff dann und wann, hatte doch keinen rechten Schlaff.
Den 10. Aug. umb 6 Uhr Morgens machte der Schloßvoigt auff, worüber die Weyber sich freueten, da sie sich inniglich nach ihm sehnten, in Sonderlichkeit Catharina, so eine feiste Frawenspersohn war; sie konnte die beklommene Luft nicht aushalten, war fast die ganze Nacht krank. Als der Schloßv. nach dem Gruß sie gefragt hatte, wie es ihnen ginge, ob sie noch lebten, both er ihnen Branntwein, den sie mit beyden Händen annahmen. Als die Uhr 7 war, begehrten sie heim zu gehen, was auch geschah; doch machten sie der Königinn erst eine Relation darüber, was den halben Tag und die Nacht über geschehen sey. Der Schloßv. blieb drinnen bey mir. Als die Uhr gegen 9 war, setzte er einen Stuhl herein, ohn etwas zu sagen. Ich merckte daraus, es werde Besuch kommen, und es geschah auch, daß gleich darauff zu mir herein kamen Graf Rantzow, Premier Ministre, Canzeler H. Peter Retz, Rentemeister Christoffer Gabel und Secreterer Erick Krag, welche mir die Hand gaben und sich vor mein Bett setzten. Krag, so Papir, Feder und Black mit sich hatte, setzte sich an den Tisch. Gf. Rantzow flüsterte dem Canzeler etwas zu. Canzeler begann darauff seine Rede so wie voriges Mal, daß Se. königl. Majt. große Ursach habe zu dem, so er wider mich thäte. ›Seine Majt. hat‹ (sagte er ferner) › susspition zu Eurer Persohn, und das nicht ohn Ursach.‹ Ich fragte, worin die susspition bestände. Canzeler sagte: ›Euer Mann hat einem fremden Herrn das Reich Dänemarck angebothen. AdÜVgl. Einleitung.‹ Ich fragte, ob das Reich Dänemarck meinem Mann zugehöre, daß er es ausbiethen könne, und als keiner antwortete, fuhr ich weiter fort und sagte: ›Ihr guten Herren kennet alle meinen Herrn; Ihr wisset, daß er als Mann von Verstand aestimiret worden ist, und ich kann Euch versichern, daß, als ich von ihm schied, er noch seine volle Vernunfft hatte. Nu ist leicht zu dencken, daß kein verständiger Mann das ausbiethen wird, so nicht in seiner Macht steht und worüber er nicht verfügen kann. Er ist ja in keiner Charge, hat weder Macht noch Mündigkeit, wie sollte er so thöricht seyn, solch Anerbiethen zu machen, und was vor ein Herr würde es annehmen?‹ Gf. Rantzov sagte: ›Es ist doch so, Madame; er hat Dänemarck einem fremden Potentaten angebothen, Ihr wisset es wol.‹ Ich antwortete: ›Es ist gewiß, daß mein Mann mir nichts verbarg was uns beyde anging. Das, so sein Ambt in früheren Tagen betraf, kümmerte mich nicht; aber das, so uns beide berührte, verbarg er nicht vor mir, so daß ich versichert bin, daß er, wenn er etwas dessengleichen vor gehabt hätte, es nicht vor mir verschwiegen hätte. Und ich kann mit Wahrheit sagen, daß mir nicht das geringste darüber bewußt ist.‹ Gf. Rantzov sagte: › Madame, bekennet es während der König Euch noch bittet!‹ Ich antwortete: ›Wüßte ich es, so würde ich es gerne sagen, aber so wahr Gott lebet, weiß ich es nicht, und so wahrhafftig kann ich auch nicht glauben, daß mein Mann so thöricht gewesen seyn sollte, denn er ist ein krancker Mann. Er nöthigte mich, nach Engeland zu ziehen, umb die ausgeliehenen Gelder einzufordern; ich habe diese Reise ungern unternommen, zum großen Theil aus der Ursach weil er so sehr schwach war. Er konnte nicht einmal die Treppe einige Stufen hinauff gehen, ohne auszurasten und Athem zu schöpffen; wie sollte er da ein Werck der Travaille vornehmen? Ich kann mit Wahrheit sagen, daß er nicht 8 Tage lang ohne Anfall ist, bald hat er einen, bald einen andern.‹ Gf. Rantzow flüsterte wieder mit dem Canzeler, und sagte der Canzeler ferner: ›Madame, saget in gutem, wie es zusammenhängt, und wer Mitwisser in dieser Sache ist, saget es zur Frist, da man Euch darumb bittet! Se. königl. Majt. ist ein absoluter Herr AdÜDie absolute Gewalt war damals erst vor Kurzem dem Könige übertragen worden; Leonora Christina betont ausdrücklich: er ist ein absoluter Herr, denn als ihr Gemal noch am Ruder stand, war der König kein absoluter Herr. Vgl. Einleitung., er ist nicht an das Gesetz gebunden, er kann thun was er will; saget es!‹ Ich antwortete: ›Ich weiß wol, daß Se. königl. Majt. ein absoluter Herr ist, ich weiß auch, daß er ein christlicher und ein gewissenhaffter Herr ist, deshalb thut Se. königl. Majt. nichts anderes als was er vor Gott im Himmel verantworten kann. Sehet, hier bin ich! Ihr könnet mit mir thun, was Ihr wollt; das, so ich nicht weiß, kann ich nicht sagen.‹ Gf. Rantzow begann wieder den Marichal de Birron herfür zu holen und machte eine lange dicente daraus. Worauff ich endlich antwortete, daß Marichal de Birron mich gar nichts anginge, daß ich nichts darauff zu antworten hätte, und mir schien, die Sache habe hiermit nichts zu thun. Gf. Rantzow fragte mich, weßhalb ich, als ich gefragt ward, mit wem ich hier im Reiche correspondiret hätte, nicht gesagt habe, daß ich auch ihm und Rentmeister Gabel schrieb. Darauff antwortete ich, daß ich meinte, diejenigen, so mich darumb fragten, wüßten es wol, so daß ich nicht vonnöthen hatte, es zu erwähnen; hätte nur das gesagt, wovon sie vielleicht nicht wußten. Gf. Rantzow flüsterte dem Canzeler abermals zu, und sagte Canzeler: ›Ihr habet in einem Brieff an F. Elße Paßburg über einen andern Zustand in Dänemarck geschrieben‹ (während dem sah er Gf. Rantzow an und fragte, ob es nicht so sey, oder wie es gewesen sey), ›was meintet Ihr damit, Madame?‹ Ich antwortete, ich könne mich nicht erinnern, welchen Anlaß ihr Brieff mir darzu gegeben habe, so zu antworten; ›was davor stehet oder darnach folgt, wird sonder Zweiffel meine Meinung wol ausdrücken; darff ich meine Schrifft zu sehen kriegen, so wird sie schon ausweisen, daß ich nichts geschrieben habe, was ich nicht verantworten kann.‹ Es wurde nichts mehr darüber gesprochen. Gf. Rantzow fragte mich, wer von fremden Ministri bey meinem Herrn in Brügge gewesen wäre. ›Keiner‹ (antwortete ich), ›daß mir wissentlich ist.‹ Er fragte ferner, ob kein holsteinscher Edelmann bey ihm gewesen sey. Resp. ›Mir nicht bewußt.‹ Darnach rechnete er alle Fürsten in Teutschland auff, vom Keyser bis zu dem Fürsten von Holstein, fragte besonders über jeden, ob nicht einer von deren Ministri bey meinem Mann gewesen sey. Ich gab dieselbige Antwort wie früher zu einer jeden Frage à part, mir sey nicht wissentlich, daß einer von ihnen bey ihm gewesen. Darnach sagte er: ›Nun, Madame, bekennet! ich bitte Euch; dencket an Marichal de Birron! Ihr werdet nicht mehr gebeten!‹ Ich war etwas überdrüssig, Birron erwähnen zu hören, weshalb ich ziemblich hastig antwortete: ›Ey, ich kümmere mich gar nicht umb Mar. de Bir.; ich kann das nicht sagen, wozu ich keinen vernünfftigen Grundt weiß.‹ Secreterer Krag hatte etwas hastig geschrieben, wie es schien, denn als er auff mein Begehr vorlesen sollte, was er geschrieben hatte, reimten sich die Antworten nicht zu den Fragen; ein Theil war vielleicht in der Eile versehen worden, und ein Theil wol aus Malice, denn er war meinem sel. Herrn nicht gut. Ich protestirte dargegen, als er das Protocoll vorlaß. Canzeler stimmte mir in allen Posten bey, so daß Krag es umbschreiben mußte. Darnach standen sie auff und nahmen Abscheidt. Ich ersuchte sie, Se. königl. Majt. zu bitten, daß Se. Majt. mir ein gnädiger Herr seyn und nicht glauben möge, was ihm über meinen Mann berichtet worden; ich wolle nicht vermuthen, man würde befinden, daß er jemals von seiner Pflicht abgewichen sey.‹ ›Ja,‹ antwortete Gf. Rantzow, ›wollet Ihr bekennen, Madame, und uns sagen, was an der Sache ist, und wie sie zusammen hänget, so werdet Ihr vielleicht einen gnädigen Herrn und König haben.‹ Ich schwur bey dem lebendigen Gott, daß ich es nicht wüßte; ich wüßte von nichts dergleichen, noch viel weniger von Mitwissern. Darmit gingen sie fort, nachdem sie fast drey Stunden bey mir zugebracht hatten, und kam der Schloßv. mit denen Weybern herein. Sie deckten und trugen Speise herbey, aber ich nahm nichts als einen Trunck Bier. Der Schloßv. setzte sich mit denen Weybern zu Tisch. War er vorher lustig, so war er es itzt noch mehr, erzählte einen schmutzigen Schnack nach dem andern. Als sie des Schmausens und Schwatzens genung hatten, ging er fort und schloß zu; kam wie gewöhnlich umb 4 Uhren des Nachmittags wieder und ließ die Weyber hinaus, blieb so lang bey mir, bis sie wieder kamen, was gemeiniglich zwey Stunden währte. Wenn die Weyber allein bey mir waren, ward über nichts anderes gesprochen, als daß Anna der Catharina von ihrer Trawer über ihren ersten Mann erzählte. Ich that dann, als ob ich schlieff, desgleichen that ich, wenn der Schloßv. allein bey mir war, dann vertrieb er sich die Zeit mit singen und sumsen. Die Abend-Mahlzeit war auch gantz lustig vor die Weyber, denn der Schloßv. machte ihnen großen Zeitvertreib, erzählte von seiner zweyten Ehe, wie er freyete ohn zu wissen umb wen, wußte es auch nicht eher, als er das Ja-Wort holen sollte. Die Erzählung war eben so putzierlich wie weitläufftig, ich observirte, daß sie 5 Viertelstunden dawerte. Als er gute Nacht gesagt hatte, setzte Anna sich an mein Bett, begann mit Catharina zu reden, und sagte: ›War es nicht eine greuliche Geschichte AdÜDamals gingen über Ulfeldt's vermeintliche Anschläge vielfache Gerüchte, die durch ihre Uebertreibung höchst lächerlich waren, im Volke um. (Soph. Birk. Smith' dän. Ausg.). mit der Verrätherey, den König, die Königinn und das gantze königliche Haus zu morden?‹ Catharina antwortete: ›Gott sey Dank, der König, die Königinn und die gantze Herrschafft leben noch!‹ ›Ja‹, sagte Anna, ›es war nicht das Verdienst der Verräther, daß es nicht geschah; es wurde zu schnell offenbar, der König wußte es drey Monate vorher, ehe er es der Königinn offenbaren wollte. Er ging melancolisch herumb und grübelte alleweyle, konnte es nicht recht glauben; später, als er dessen ganz gewiß war, sagte er es der Königinn; dann wurde die Leib-Wache verdoppelt, wie Ihr wisset.‹ Catharina fragte, wie sie es zu wissen gekriegt hätten. Anna antwortete: ›Das mag Gott wissen; es wird so heimblich gehalten, daß keiner auch nur zu fragen sich trawet, von wem es gekommen seyn mag.‹ Ich konnte nicht lassen, ein Wort darzu zu legen, und schien es mir beklagenswerth genung, daß man den Angeber nicht zu wissen kriegte, und war merckwürdig, daß keiner sich zu der Angeberey zu bekennen wagte. Cathr. sagte: ›Sollte es auch wol wahr seyn?‹ ›Was saget Ihr da?‹ antwortete Anna; ›sollte der König thun, was er thut, ohne sicher zu wissen, daß es wahr ist? Wie könnt Ihr so schwatzen?‹ Ich hielt dieses Gespräch für angelegt, umb einige Worte aus mir heraus zu holen, weßhalb ich nicht viel darauff antwortete, nichts anderes als daß ich bis jetzo nichts gesehen habe, so dieses Gerücht glaubwürdig mache, deshalb meinte ich, daß mir frey stünde, selbiges nicht zu glauben, bis ich gewisse Zeichen sehe. Anna blieb bey ihrem Propos, wunderte sich, daß es so verdammte Menschen geben könne, die den guten König morden wollten, machte es gantz weitläufftig. Sie konnte umb Materia nicht verlegen seyn, denn sie fing immer wieder von vorne an; aber endlich hatte sie doch genung, sintemal sie allein redete und weder von Cathr. noch von mir interrompirt wurde. Ich stand auff und begehrte, mein Bett gemacht zu haben, was Cathr. stets verrichtete. Anna gab Acht auff das Licht während der Nacht, denn sie war wachsamer als Cathr. Ich las ihnen aus Annas Buch vor, befahl mich Gott und legte mich schlaffen; aber der Schlaff war gantz leise, der Ratzen ihr Spatziergang konnte mich wecken, deren Mannigfaltigkeit war groß. Hunger machte sie dreist, sie fraßen von dem Licht, wie es da stand und brannte. Cathr. war es auch in selbiger Nacht gantz schlimm zu Muthe, so daß sie auch meinen Schlaff verhinderte. Am 11. Augusti des Morgens früh kam der Schloßv. wie gewöhnlich mit seinen Branntewein- Complimenten, obwol sie eine gantze Flasche voll bey sich darinnen hatten. Cathr. beklagte sich sehr, sagte in der beklommenen Luft könne sie nicht aushalten; wenn sie zur Thür herein käme, wäre es gleich als ob sie ersticken sollte; sollte sie 8 Tage darinnen bleiben, so wäre sie gewiß, daß man sie todt hinaus tragen müßte. Schloßv. hatte sein Gelächter darüber. Die Weyber gingen fort, und er blieb bey mir. Er grüßte mich von Gen. Major von Anfeldt, so mich bitten ließ, ich sollte ›gutes Muths seyn, es würde nu bald gut.‹ Ich antwortete nichts. Er fragte, wie es stehe, ob ich etwas geschlaffen hätte; antwortete sich selbst: ›Ich dencke, nicht viel.‹ Fragte, ob ich etwas haben wollte. Antwortete sich selbst: ›Nein, ich glaube nicht, daß Ihr etwas begehret.‹ Darauff ging er auff und ab und summte vor sich hin, kam darnach zum Bett und sagte: ›O, der liebe König, es ist doch ein frommer Herr! Gebet Euch zu Frieden, er ist ein gnädiger Herr und hat allezeit viel von Euch gehalten. Ihr seyd ein Frawens-Mensch, ein schwaches Werkzeug. Die arme Weybes-Bilder seind bald verführet. Man thut ihnen auch nicht gerne was, wann sie die Wahrheit bekennen. Die liebe Königinne, es ist doch eine liebe Königinne! Sie ist Euch nicht böse; ich weiß, wann sie die Wahrheit von Euch wüßte, sie sollte selbst für Euch bitten. Höret! wollet Ihr an die Königinne schreiben und ihr die Sache aus dem Grunde berichten und nichts, nichts verschweigen, so will ich Euch Dinten, Papir und Feder bringen. Ich begehre es, auff meine Seele! nicht zu lesen, nein, straffe mich Gott! wo ich darein sehen will; und auff daß Ihrs sollt gewisse seyn, so will ich Euch Lack geben, Ihr könnt es versieglen. Aber ich dencke, Ihr habet wohl kein Pitschafft?‹ Da ich ihm gantz und gar nichts antwortete, faßte er mich bey der Hand und rüttelte sie ziemblich stark und sagte: ›Hört Ihr nicht? Schlaffet Ihr?‹ Ich dreuete und schlug mit der Hand auff, hätte ihm gern einen Schlag auff die Nase gegeben, warff mich herumb zur Wandt. Er war erzürnt, daß sein Vorsatz ihm nicht glückte, ging und knurrte bey sich selber über eine Stunde. Ich konnte kein Wort verstehen außer diesem: ›Ja, ja! Ihr wollet nicht reden.‹ Dann murmelte er etwas zwischen den Zähnen: ›Ihr wollet nicht antworten; nu, nu! man wird Euch lernen. Ja, so Gott! Du so kalt, so Gott! fu, hum, hum, hum.‹ Dieses setzte er immer so fort, bis Raßmus Thurmwächter kam und ihm etwas zuflüsterte, dann ging er hinaus. Mir schien, daß da einer war, der mit ihm sprach, und so viel ich mercken konnte, muß es einer gewesen seyn, der ihn fragte, ob das Papir und die Dinten herauff gebracht werden sollten, denn er antwortete: ›Nein, es ist nicht nöthig; sie will nicht.‹ Der andere sagte: ›Sachte, sachte!‹ Der Schloßv. konnte aber nicht gut sachte reden, und hörte ich, wie er sagte: ›Sie kann das nicht hören, sie liegt im Bette.‹ Als er wieder herein kam, murrte er wieder bey sich selber und stampfte, weil ich nicht antworten wollte; er meine es so gut, die Königinn sey nicht so bös wie ich dächte; ging so und redete halblaut; wollte gerne, daß die Weyber kämen, that nichts anderes, als Raßmus bitten, er möchte nach ihnen aussehen. Bald darauff kam Raßmus und berichtete, nu gingen sie die Königs-Treppe hinauff. Es dawerte da wol noch fast eine Stunde, bis sie zu mir herein kamen und ihn ablöseten. Als sie Mittags-Mahlzeit hielten (denn mein Essen bestand aus einigen wenigen Citron-Schnitten mit Zucker), war der Schloßv. lange nicht so lustig, wie er sonsten zu seyn pflegte, schwatzete doch über allerhand, was sich zur Zeit zugetragen hatte, da er noch Bräutigam war; retirirte sich auch eher, als er sonst zu thun pflegte. Die Weyber, welche wieder blieben, sprachen über unterschiedliche indifferente Sachen, wozu ich auch zuweylen ein Wort gab und sie nach Mann und Kindern fragte. Anna las aus ihrem Buch einige Gebete und Psalmen, so daß der Tag darmit hin ging bis 4 Uhr, wo der Schloßv. sie ausließ. Er hatte ein Buch mit sich genommen, in welchem er ziemblich sachte las, während er bey mir die Wache hielt. Ich war dessen gar wol zufrieden, da ich vor ihm Ruhe hatte. Bey der Abend-Mahlzeit begann der Schloßv. unter anderem Gespräch denen Weybern zu erzählen, daß ein gefangener her geführet sey, der ein Franzos war, er konnte sich des Namens nicht recht erinnern; saß und kauete an dem Namen, gleich als ob er nicht recht darauff kommen könnte: Carl oder Char, er wüßte nicht, wie er hieße, aber er wäre früher viele Jahre in Dänemarck gewesen. Anna fragte, was es vor einer sey. Er antwortete, daß es ein solcher sey, der singen sollte, doch wüßte er nicht das Lied, ob er hier war oder nicht (es war durchaus nichts daran). Er sagte das nur, umb fragen zu können oder wahrzunehmen, ob es mich betrüben möchte. Dieses war ihm sonder Zweiffel so befohlen, denn als er fort war, fing Anna mit Cathrina ein Gespräch an über selbigen Carl, fragte mich endlich, ob wir einen Franzos in unseren Diensten hätten. Ich antwortete, wir hätten mehr als einen gehabt. Sie fragte weiters, ob einer unter ihnen sey, so Carl hieß und uns lange gedient habe. ›Wir haben einen Diener‹ (antwortete ich) ›einen Franzos, der Charle heißt, er hat uns lange gedienet.‹ ›Ja, ja,‹ sagte sie, ›der ist es; doch glaube ich nicht, daß er hier schon angekommen ist, aber sie suchen nach ihm.‹ Ich sagte: ›Dann ist er leicht zu finden, er war zu Brügge, als ich von dort wegging.‹ Anna meinte, daß er mit mir in Engeland gewesen sey, auch sagte sie: ›Dieser Karel weiß vieles, wenn sie ihn nur hätten.‹ Ich antwortete: ›Dann wäre zu wünschen, daß sie ihn hätten, umb seiner Wissenschafft willen.‹ Als sie vernahm, daß ich mich nicht weiter oder mehr um ihn bekümmerte, ließ sie das Gespräch fallen und redete über meine Schwester Elisabeth Augusta, daß sie an ihr jeden Tag vorbey ginge; sie stünde in ihrer Thür oder säße im Ercker, sie grüßte sie, aber fragte niemals mit einem Wort nach ihrer Schwester, da sie doch wüßte, daß sie mich im Thurme bediene. Ich meinte, daß meine Schwester nicht wisse, ob sie daran wol oder übel thäte. ›Ich kann nicht sehen‹ sagte Anna, ›daß sie betrübet ist.‹ Ich war der Meinung, daß das mindeste, worüber man sich betrüben könne, das beste sey. Später ward über andere Lappalia geredet, und beschloß ich den Tag mit lesen, befahl mich in Jesu Schutz und schlieff ziemblich gut in dieser Nacht.
Der 12. Augusti ging vorbey, ohne daß etwas sonderliches passirte, nur daß Anna mich damit betrüben wollte, daß sie sagte, grade über uns würde eine Kammer zurecht gemacht; für wen, wüßte sie nicht, sie erwarteten gewiß jemanden darinnen. Ich konnte selber die Mawer-Meister arbeiten hören. Selbigen Tag sprach Cathrina darvon, daß sie mich im Wolstande gekannt habe, segnete mich tausend Mal vor das gute, so ich ihr bewiesen hätte. Ich erinnerte mich nicht, sie jemals gesehen zu haben. Sie sagte, sie habe in Princesse Magdalenae Sybillae AdÜdes Kronprinzen Gemalin. Vorrathskammer gedienet, und als ich die Princessin besucht und im Schlosse gewohnet habe, hätte ich die in der Vorrathskammer mit einem runden Trinck-Geldt bedacht, wovon ein jegliches seinen Theil bekommen habe, dessen sie itzt danckbar gedencke. Ich lobte ihre Genügsamkeit und Danckbarkeit. Anna war mit dem Gespräch nicht zufrieden, sie brachte drey Mal was anderes hinein, aber Cathrina antwortete ihr nicht, blieb bey ihrer Sache, bis sie ausgeredet hatte. Der Schloßvoigt war den Tag auch nicht in guter Humeur, so daß weder zu Mittag noch zu Abend eine schmutzige Historie erzählet wurde.
Den 13. Augusti nachdem die Weyber in der Stadt gewesen und zurück gekommen waren, machte der Schloßvoigt gegen 9 Uhr auff und flüsterte ihnen etwas zu. Darauff trug er noch einen kleinen Stuhl herein. Ich merckte daraus, daß noch einer mehr als voriges Mal mich besuchen würde. Gegen 10 Uhr kamen zu mir herein Gf. Rantzow, der Feldt-Herr Skack, Canzeler Retz, Rentmeister Gabel und Secreterer Krag. Sie grüßten mich alle höfflich; die 4 nahmen Platz auff niedrigen Stühlen vor meinem Bett, und Krag setzte sich mit seinem Schreibzeug an den Tisch. Canzeler nahm das Wort und sagte: ›Seine königl. Majt., mein allergnädigster Herr und Erb-König, läßt Euch, Madame, wissen, daß Se. Majt. große Ursach hat zu dem, so er wider Euch thut, und daß er auff Eure Persohn susspition hat, daß Ihr Mitwisserinn in Eueres Mannes beabsichtigter Verrätherey seyd, und hätte Se. königl. Majt. wol gehofft, daß Ihr in gutem bekennen würdet, wer darinnen interessiret ist, und wie es sich recht mit der Sache verhält.‹ Als Canzeler zu reden auffhörte, antwortete ich, daß ich nicht wüßte etwas begangen zu haben, so mich suspect machen könnte, und rieff ich Gott zum Zeugen, daß ich von keiner Verrätherey wüßte, weshalb ich auch keinen Namen nennen könne. Gf. Rantzow sagte: ›Euer Mann hat es vor Euch nicht verborgen, dahero wisset Ihr es wol.‹ Ich antwortete: ›Hätte mein Mann einen so bösen Vorsatz gehabt, so glaube ich gewiß, er hätte es mir gesagt, aber ich kann mit einem guten Gewissen vor Gott im Himmel schwören, daß ich ihn niemals über desgleichen reden hörte. Ja, ich kann sagen, er wünschte dem Könige niemals böses, das ich je hörte, weshalb ich vollkommen glaube, daß ihm dieses von seinen Feinden fälschlich nachgesagt wird.‹ Gf. Rantzow und Canzeler neigten die Köpffe zusammen, an dem Feldt-Herrn vorüber und flüsterten lange mit einander. Endlich fragte Canzeler mich, ob ich, wenn mein Mann schuldig befunden würde, auch seiner Verurtheilung theilhaftig werden wolle. Dieses war eine sonderliche Frage, weshalb ich mich ein weniges bedachte; sagte: ›Wenn ich wissen darff, auff welches Fundament hin er beschuldigt wird, so werde ich darauff antworten, so weit es mir wissentlich ist, und so viel ich kann.‹ Canzeler sagte: ›Bedencket Euch wol, ob Ihr wollt.‹ Ich antwortete wie früher, daß ich ihm auff alles antworten wolle, was mir wissentlich sey, wenn ich nur erfahren könnte, auff was hin man ihn beschuldige. Gf. Rantzow flüsterte mit Krag, und Krag ging hinaus, kam gleich wieder herein. Bald darauff kam einer von der Canceley (den ich nicht kenne), hatte große Papire in den Händen. Gf. Rantzow und Canzeler flüsterten abermals. Darauff sagte Canzeler: ›Hier ist nu nichts weiter zu thun, als Euch wissen zu machen, was vor einen Mann Ihr habet, und Euch sein Urtheil hören zu lassen.‹ Gf. Rantzow befahl dem, so mit den Papiren hereingekommen war, vorzulesen. Zuerst wurde ein Papir vorgelesen des Inhalts, daß Corfitz, vormals Graf von Vlfelt, das Reich Dänemarck einem fremden Herrn angebothen und selbigem Herrn gesagt habe, er hätte die geistlichen und weltlichen in seiner Hand, so daß es ihm leicht sey, bemeldtem Herrn Dänemarcks Crone zu verschaffen. Darauff ward ein Papir vorgelesen, so die Vertheidigung der Geistlichkeit seyn sollte, worinnen sie protestirten, daß Corfitz Gf. von Vlfelt niemals eine Communication mit einem von ihnen gehabt, daß er auch zu keiner Zeit sich als Freund der Geistlichkeit gezeigt, viel weniger ihr einen Antheil an seinem bösen Vorsatz gegeben habe; versicherten Se. königl. Majt. ihrer Trewe und Unterthänigkeit etc. Darnach wurde ein Papir vorgelesen, geschrieben von Bürgermeister und Rath in Copenhagen, fast von gleichem Inhalt, daß sie mit Gf. Corfitz Vlfelt keinerley Correspondentz gehabt hätten und versicherten in gleicher Weise Se. kön. Mt. ihrer unterthänigsten Trewe. Darauff folgte die Verlesung des un-erhörten und un-gesetzlichen Urtheils, welches un-verhörter Sache über meinen Herrn gefället war. Dieses war so unvermuthet und betrübend wie schimpfflich und vor Gott und allen Recht liebenden Menschen un-verantwortlich. Da waren keine Documente angeführt, auff welche das Urtheil abgegeben war. Da ward nichts von Rede und Antwort gemeldt, da war kein ander Fundament als bloße Worte: daß er als ein criminel befunden sey, einem fremden Herrn Dänemarcks Crone angebothen und ihm weiß gemacht habe, er hätte geistliche und weltliche in seiner Hand, die es mit ihren unterschriebenen Protestationen anders bewiesen hätten, wannenhero er als ein criminel verurtheilt werde. Als das Urtheil mit allen unterschriebenen Namen vorgelesen war, brachte der Leser es mir und legte es vor mich auff das Bett. Ein jeglicher Mensch kann leicht bedencken, wie mir zu Muthe war, aber keiner oder wenige können begreiffen, wie es möglich ward, daß ich nicht von dem un-vermutheten Unglück erstickte, oder von Sinn und Verstand kam. Ich konnte vor heulen und weinen kein Wort herfür bringen. Dann ward ein Gebet vorgelesen, so von der Kantzel erlassen war, in welchem Corfitz verflucht und Gott gebeten wurde, daß sein grawes Haar nicht mit Frieden in die Grube kommen möge. Aber Gott, der gerecht ist, erhörte nicht die un-göttlichen Gebete der un-gerechten, sein Name sey gelobet ewiglich! Als alles vorgelesen war, beklagte ich mit Hertzens Seuffzern und wehmüthigen Thränen, daß ich den betrübenden Tag erleben mußte, bat sie umb Jesu Gerechtigkeit willen, daß ich sehen dürffe, worauff das harte Urtheil fundiret sey. Gf. Rantzow antwortete: ›Das könnet Ihr wol dencken, Madame, daß es Documente gibt, nach welchen wir fürgegangen sind; es sitzen von Euren Freunden welche im Rathe.‹ ›Ja, Gott bessere es!‹ (sagte ich.) ›Daß ich die Documente sehen dürffe, darumb bitte ich umb Gottes Willen. Les apparences sont bien souuant trompeuses. Was mußte mein Mann nicht leiden bey denen schwedischen in Schonen durch den langen Arrest, weil sie susspicirten, daß er mit Sr. kön. Mt. von Dänemarck und Sr. Mts. Ministri correspondiret hätte! Nu weiß es keiner besser, als Se. königl. Mt. und Ihr guten Herren, wie unschuldig er dafür litt, so kann dieses auch zum Schein glaublich seyn und sich doch in Wahrheit nicht so befinden. Möchte ich die Documente zu sehen kriegen?‹ Darauff ward nichts geantwortet. Ich fuhr weiter fort und sagte: ›Wie ist es möglich, daß ein Mann, so selbst erkennen kann, daß ihm der Tod auff den Fersen ist, ein solches Werck unternehmen und sich von seiner Pflicht ableitten lassen, da er es nicht that zu der Zeit als er keinem Herrn obligiret war, und ihm so große Versprechungen von dem Fürsten zu Holstein gemacht wurden, wie des Fürsten Brieffe beweisen, so nu in Sr. königl. Mts. Händen sind.‹ Gf. Rantzow fiel mir in das Wort und sagte: ›Die Brieffe fanden wir nicht‹. ›Ja, weiß Gott!‹ (antwortete ich) ›sie waren darunter, dessen bin ich gewiß.‹ Sagte ferner: ›Damals hätte er einem fremden Herrn etwas zu Willen thun können, damals hatte er Macht und Mündigkeit und fast die gantze Regierung in seinen Händen; sah doch nicht auff eigenen Profit, sondern setzte sein eigenes Vermögen daran, Sr. königl. Mts. Crönung zu beschleunigen, auff daß kein Hinderniß darzwischen kommen möchte.
Als königl.
Majt.
 todt war, gab es keinen auserwählten Printz, so daß es den Ständen freystand, den König zu wählen, der ihnen beliebte, weshalb der Hertzog von Holstein, Hertzog Friderich sel., meinem Herrn anboth, wenn er veranstalten wolle, daß er zum König gewählet würde, so solle das Land Fühnen ihm gehören, und solle eine doppelte
Alience zwischen seinen und unseren Kindern geschlossen werden. Aber mein Herr schlug dieses aus, wollte nicht helffen,
todt war, gab es keinen auserwählten Printz, so daß es den Ständen freystand, den König zu wählen, der ihnen beliebte, weshalb der Hertzog von Holstein, Hertzog Friderich sel., meinem Herrn anboth, wenn er veranstalten wolle, daß er zum König gewählet würde, so solle das Land Fühnen ihm gehören, und solle eine doppelte
Alience zwischen seinen und unseren Kindern geschlossen werden. Aber mein Herr schlug dieses aus, wollte nicht helffen,
 Sohn vom Reich zu verstoßen. Der Fürst hatte von unterschiedlichen ihre
vota gewonnen, doch mein Herr kämpffte ihnen entgegen.
Sohn vom Reich zu verstoßen. Der Fürst hatte von unterschiedlichen ihre
vota gewonnen, doch mein Herr kämpffte ihnen entgegen.
Fußnote aus technischen Gründen im Text wiedergegeben. Re.
Das ist nu sein Lohn! Ihr guten Herren, versündiget Euch nicht, die Ihr mich in Wolstand gesehen habt, und habet doch Mitleid mit mir! Bittet Se. königl. Mt., daß er milde seyn möge und nicht so strenge verfahre.‹ Canzeler und Rentmeister wurden darvon movirt, so daß die Thränen ihnen in die Augen kamen. Gf. Rantzow sagte zu dem Feldt-Herrn und zu Canzeler: ›Mir scheinet, es ist 14 Tage her, daß das Urtheil publiciret ward.‹ Canzeler antwortete: ›Es ist 17 Tage her.‹ Ich sagte: ›Zu der Zeit war ich noch in Engeland, und itzt werde ich umb Auskunfft in der Sache gefragt! O, bedencket dieses umb Gottes Willen, und daß keiner zu Widerspruch für meinen Mann da gewesen ist!‹ Gf. Rantzow fragte, ob ich dargegen berufen wolle. Ich antwortete: ›Wie soll ich gegen ein Urtheil berufen? Ich bitte eintzig und allein umb Jesu willen, das, so ich sage, möge consideriret werden, und daß ich das Vergnügen haben dürffe, die Documente zu sehen, auff Grund welcher das Urtheil gefället ist.‹ Gf. Rantzow antwortete wie früher, daß Documente da seyen, und von meinen Freunde etliche im Rathe säßen, fügte noch hinzu, daß alle übereins gestimmet hätten, nicht einer hätte etwas dargegen zu reden gehabt. Das, so ich dachte, durffte ich nicht sagen. Ich wußte wol, wie es in solchen absoluten Regierungen zugeht; da darff nicht widersprochen werden, da heißt es: Unterschreib, der König will es so haben, und frag nicht warumb, sonst kommstu in gleiche Verdammniß. Und fragte, ob mir erlaubt sey, gegen das Urtheil zu berufen. Alle schwiegen still. Ich schwieg und beweinete mein Unglück, das iremediable war. Als Krag das Protocoll vorlaß, hatte er geschrieben, daß ich, als ich gefragt ward, ob ich meines Mannes Urtheil wolle theilhafftig werden, geantwortet habe, ich wolle mich darauff bedencken. Ich fragte: ›Wie war das?‹ Strax antwortete Canzeler: ›Nein, sie sagte nicht also, sondern sie begehrte die Beschuldigungen gegen ihren Mann zu wissen.‹ Ich repetirte meine Worte abermals, weiß aber nicht, ob Krag sie schrieb oder nicht; denn ein großer Theil von dem, was ich sagte, ward nicht geschrieben. Krag ließ zu sehr die Affecte durch blicken und wollte gerne das böse schlimmer machen. AdÜHiernach kam folgender, später ausgestrichener Satz: – Er ist nun dort, wo keine falschen Schriften gelten. Gott nahm ihn schnell hinweg auf einer unreinen Stelle, rief ihn ohne Warnung vor sein Gericht. Und Gf. Rantzow, welcher der Haupturheber und Inventor des ungesetzlichen und in Dänemark ungewöhnlichen Urtheils war, erlebte nicht den Tag und die Freude, ein hölzern Bildniß exequiret zu sehen. Vgl. die Aufzählung am Ende der Vorrede, N. 1. Als dieses verrichtet war, stunden sie auff und gaben mir die Hand. Dieser harte Besuch dawerte über 4 Stunden. Sie gingen fort, hinterließen mich in Sorge, Seuffzern und weinen, ein höchst betrübtes, elendiges gefangenes Weyb, von allen verlassen, die sich ohne Rettung sah gegen Macht und Gewalt, die jeden Augenblick fürchtete, daß ihr Mann ihnen in die Hände gerathen könnte, und sie ihre Bosheit an ihm auslassen würden. Gott ließ an dem Tag ein groß Mirackel und Hertzenszeichen geschehen, indem er seine Krafft in mir schwachen bewies und mein Hirn vor Verwirrung bewahrte und meine Zunge, daß sie nicht vor Ungeduld überlieff. Gott sey tausend Mal davor gepriesen! Dein Lob will ich singen, so lange meine Zunge sich rühren kann, denn du warst damals und allezeit meine Wehr, mein Fels und Schild. Als die Herren weggegangen waren, kamen der Schloßv. und die Weyber, und es wurde auff einem Stuhl vor meinem Bette gedeckt. Schloßv. sagte zu mir: ›Esset, Leonora! Wollet Ihr nicht essen?‹ Indem er dieses sagte, warff er mir ein Messer auff das Bett. Ich nahm das Messer mit zorniger Hand und warff es auff den Boden. Er hob das Messer auff und sagte: ›Ihr seyd wol nicht hungrig? Nein, nein! Ihr habet heute ein Frühstück bekommen, da habet Ihr heute genung an; nicht? Gelt! Ja, ja, kommet Ihr lieben Weyberlein‹ (sagte er zu den Frawenzimmern) ›lasset uns etwas essen! Euch wird wohl hungern, das fühle ich an meinem Magen wol.‹ Als sie sich zu Tisch gesetzt hatten, begann er strax, sich voll zu stopffen, fuhr wie aus Versehen an seinem Mund vorbey und machte so viele Possen, daß es eine Schande war zu sehen, wie der alte Mann seine Freude über mein Unglück nicht simuliren konnte. Als die Mahlzeit zu Ende und der Schloßv. weggegangen war, setzte Anna sich vor mein Bett und begann über die Trawer und Betrübniß zu reden, die man auff dieser Welt habe, und über des Himmels Wonne und Herrlichkeit: wie die Peyn, so wir hier erleiden, nur gering sey gegen die ewige Seligkeit und Freude, wannenhero wir auch den Schmertz nicht achten, vielmehr daran dencken sollten, mit einem guten Gewissen zu sterben und es nicht zu beflecken, sondern alles aussagen sollten, was uns beschwere, denn es würde ohnedies nicht anders. ›Gott gebe‹ (sagte sie) ›daß keiner sich umb eines andern willen plage!‹ Nachdem sie den Tratsch einige Male repetiret hatte, sagte sie zu mir: ›Ist das nicht wahr, Frau?‹ ›Ja gewiß ist es wahr‹ (antwortete ich), ›Ihr sprechet sehr christlich und nach der Schrifft.‹ ›Weshalb wollet Ihr dann‹ (sagte sie weiters) ›Euch für andere plagen lassen und nicht sagen, was Ihr von ihnen wisset? Ich fragte, wen sie meine. Sie antwortete: ›Ich kenne sie nicht.‹ Ich antwortete: ›Ich auch nicht.‹ Sie fuhr doch fort und sagte, daß sie nicht wolle umb anderer willen sich peynigen und plagen lassen, wer es auch wäre; wenn sie schuldig seyen, so müßten sie leiden, sie wolle nicht für sie leiden; ein Weybes-Mensch sey leicht verführet; man müsse seine Seligkeit lieber haben als alle Sippschafft und Freunde. Da sie mit dem Geschwätze nicht wieder auffhören konnte, wollte ich sie ein weniges divertiren, fragte sie, ob sie eine Predigers-Tochter sey, und sintemalen sie mir früher ihre Herkunfft erzählet hatte, so nahm sie diese Frage desto übler auff und ward gantz erzürnet; sagte: ›Wenn ich auch nicht eines Predigers Tochter bin, so bin ich doch eine gute ehrliche Bürger-Tochter und nicht von den geringsten eine. Ich hätte zu meiner Zeit, als ich noch eine Jungfer war, nicht daran gedacht, daß ich einen Schuster kriegen würde.‹ Ich sagte: ›Euer erster Mann war ja auch ein Schuster.‹ ›Das ist wol wahr‹ (antwortete sie) ›aber das machte sich auch gantz doll mit dieser Heyrath;‹ begann darüber eine gantze Geschichte zu erzählen, so daß ich Ruhe vor ihr bekam. Cathrina ging auff und nieder, und als Anna ein weniges stille schwieg, sagte sie mit gefalteten Händen: ›O, Gott! Du, der du allmächtig bist und alles vermagst, bewahre den Mann, dem sie nachstellen, und laß ihn niemals in seiner Feinde Hände gerathen! O Gott, erhöre mich!‹ Anna sagte zornig zu ihr: ›Cathr., weet Ji ock, wat Ji seggen? AdÜD. i. Catharina, wißt Ihr auch, was Ihr sagt? Wie könnt Ihr so reden? – › Jesus, wäß Du sin Gleidsmann!‹ D. i. Jesus, sei Du sein Geleiter. Wo snack Ji so?‹ Cathr. antwortete: ›Ja, ick weet wol, wat ick segge. Gott bewar em vnd lat em nimmer siine Fiinde to Deel werden! Jesus, wäß du sin Gleidsmann!‹ Diese Worte brachte sie mit fließenden Thränen herfür. Anna sagte: ›Ick denck, de Frue is nicht klog.‹ Catharinae guter Wunsch vermehrte meine Thränen, und sagte ich: ›Cath. läßt sehen, daß sie eine rechte Christinn ist und Mitleid mit mir hat; Gott lohne es ihr und erhöre sie und mich!‹ Anna wurde still darauff und war seitdem nicht mehr so gesprächig. Gott, der du ein Vergelter alles guten bist, gedenck Cathr. dieses auff das beste, und sowie du sie damals erhörtest, erhöre ihr Gebet auch fürderhin, umb was sie dich auch bitten möge! Und Ihr, meine lieben Kinder, wisset, daß, wenn das Glück es so fügt, und Ihr sowol ihr wie ihrem eintzigen Sohn irgend einen angenehmen Dienst erzeigen könnet, Ihr dessen meiner wegen verpflichtet seyd, denn sie war mir ein Trost in meiner größten Noth und schlich sich offt zu mir, umb mir ein Wort zu sagen, wovon sie meinte, es wäre mir zur Erleichterung. Der Schloßv. kam wie gewöhnlich umb 4 und machte denen Weybern auff, setzte sich auff die Banck und stellte den hohen Stuhl mit Licht vor sich, hatte ein Buch mitgebracht, las laut Gebete vor ein seliges Ende, Gebete vor Todes-Noth, und wenn einer die zeitliche Straffe vor seine Missethat erdulden soll. Er vergaß auch nicht das Gebet vor einen, der verbrennt werden soll; darbey seufzete er, so geistlich war er in gantz kurzer Zeit geworden. Nachdem er alle Gebete gelesen hatte, stand er auff, ging hin und wieder und sang Leichenpsalmen; wenn er nicht mehre wußte, fing er bey dem ersten wieder an, bis die Weyber ihn ablöseten. Cathr. klagte, daß ihr Sohn kranck geworden sey, war sehr darob bekümmert. Ich nahm mich ihrer Trawer an, und sagte, daß sie ihres Sohnes Kranckheit der Königinn melden solle, dann würde wol eine andere an ihre Stelle ordiniret; bat sie, sich zufrieden zu geben, das Kindt würde wol wieder besser werden. Während der Abend-Mahlzeit war der Schloßv. sehr lustig, erzählte allerhand plumpe Narretheydinge. Nachdem er fort war, las Anna das Abend-Gebet. Mir war in dieser Nacht sehr schlimm zu Muth, warff mich offt in dem Bette herumb, und war da eine Nähnadel, an der ich mich riß; ich bekam sie heraus und habe sie noch. Man muß wissen, daß die Feder-Decke einen alten Ueberzug hatte und frisch gefüllet ward, als ich auff der Rhede lag, daher blieb in der Eile die Nähnadel darinnen.
Den 14. Augusti, als der Schloßv. zeitlich auffmachte, sagten die Weyber ihm, daß ich in der Nacht sehr kranck gewesen sey. ›Ja, ja,‹ (antwortete er) ›es wird wol wieder besser.‹ Und als die Frawenzimmer sich anschickten, zur Königinn hinauff zu gehen (was sie stets thun mußten), sagte Anna draußen vor der Thür zu Cathrina: ›Was sollen wir der Königinn sagen?‹ Cathr. antwortete: ›Was sollen wir anderes sagen, als daß sie still schweiget und nichts sagt?‹ ›Ihr wisset sehr wol, daß die Königinn sich darmit nicht begnügt.‹ ›So können wir ihr auch nichts vorlügen‹ (antwortete Cathrina ), ›sie sagt ja nichts, da wäre es wol Sünde.‹ Ich hörte selber dieses Gespräch. Zur Mittags-Mahlzeit kam Cath. zurück, sagte, daß die Königinn versprochen hätte, eine andere statt ihrer zu verordnen; schlich sich Nachmittags wieder zu mir, umb mir ein Wort über die nächste Kammer zu sagen, von welcher sie glaubte, sie würde für mich und niemand anderen zurecht gemacht, sagte mir Gute Nacht und versprach, meiner fleißig in ihren Gebeten zu gedencken. Ich danckte ihr vor gute Dienste und vor ihr gutes Hertz gegen mich. Gegen Uhr 4 ließ der Schloßv. sie und Anna hinaus. Er sang einen Psalm nach dem andern, ging zur Treppe und wurde ihm die Zeit lang bis Uhr 6, da kam Anna mit Maren Blocks. Bey der Abend-Mahlzeit erzählte der Schloßv. wieder von seiner Ehe, sonder Zweiffel Maren zu gefallen. Anna ließ mich in Ruh, und lag ich dann stille vor mich hin. Maren konnte den Abend wegen Anna nicht darzu kommen, mit mir zu sprechen.
Am 15. und 16. Augusti passirte nichts sonderliches. Wenn der Schloßv. Anna am Morgen und am Nachmittag hinaus gelassen hatte, blieb Maren Blocks bey mir, und der Schloßv. ging seiner Wege und schloß zu, so daß Maren Gelegenheit hatte, mit mir allein zu sprechen; erzählte verschiedenes, unter anderem, wie die Königinn denen drey Frawenspersonen, so mich auskleideten, meine Sachen gegeben habe, auff daß sie sie unter sich vertheilten. Sie fragte mich, ob ich Botschafft an meine Schwester Elisabet senden wolle. Ich danckte ihr, ich hätte nichts gutes ihr vermelden zu lassen. Ich begehrte Näh-Nadel und Zwirn von Maren, umb sie zu prüfen. Sie antwortete, mir dieses hertzlich gern verschaffen zu wollen, wenn sie dürffte; das koste ihre gantze Wolfahrt, wenn die Königinn das zu wissen bekäme, denn sie hatte so strenge verbothen, daß jemand mir Nadeln gebe, weder Stecknadeln noch Nähnadeln. Ich fragte: ›Aus welcher Ursach?‹ ›Deshalb,‹ sagte sie, ›daß Ihr Euch nicht selber morden sollet.‹ Ich versicherte sie, Gott habe mich besser erleuchtet, als daß ich mein eigener Mörder sein sollte. Ich erkannte, daß mein Kreutz von der Hand des Herrn käme, daß er mich züchtige als sein Kind; er werde es mir auch tragen helffen; das traute ich ihm wol zu. ›So hoffe ich denn, mein Hertz,‹ (sagte Maren) ›daß Ihr Euch nicht selber morden werdet; dann sollet Ihr auch Nadel und Zwirn haben; aber was wollet Ihr nähen?‹ Ich gab vor, daß ich einige Knöpffe an mein weißes Nachtwams nähen wolle, riß auch ein Paar ab, umb ihr später zu zeigen, daß ich selbige einnähte. Aber es verhielt sich so, daß ich einige Ducaten umb mein Knie in Linnen eingenähet hatte; selbige hatte ich behalten, da ich die Strümpffe selbst nieder strich, als sie mich auskleideten, und Anna hatte mir auff mein Begehren ein Tuch gegeben, weil ich vorgab, ich hätte einen Schaden am Bein. Dieses Tuch nähte ich umb das Linnen. Sie waren alle in der Meinung, ich hätte ein heimbliches Gebreste, denn ich lag in dem linnenen Rock, so sie mir gegeben hatten, und ging in meinen Strümpffen zu Bett. Maren meinte, ich hätte eine Funtanele an dem einen Bein, vertraute mir, daß eine Jungfer bey Hofe, deren Namen sie nannte und die ihre sehr gute Freundin sey, eine Funtanele hätte, was niemand außer ihr wüßte, nicht einmal die Bett-Reiniger der Jungfer. Ich dachte bey mir: da schweigestu gut von deiner Freundin; machte sie nicht weiser, ließ sie in diesem Fall glauben, was sie wollte. Ich war sehr schwach an den beiden Tagen, und da ich nichts weiter verzehrte als Zitron und Bier, ward der Magen dadurch geschwächet und gab es zuletzt von sich. Als Maren dem Schloßv. darvon erzählte, antwortete er: ›Das ist gut, so kombt das böse vom Hertzen ab.‹ Anna war nicht mehr so geschäfftig, aber der Schloßv. war ebenso lustig wie zuvor.
Den 17. Augusti machte der Schloßv. vor 8 Uhren nicht auff, und Anna fragte ihn, wie es zuginge, daß er so lange geschlaffen habe. Er schertzte ein weniges; später zog er sie zur Thür hin und flüsterte mit ihr. Er ging aus und ein, und Anna sagte so laut zu Maren, daß ich es hören konnte (obwol sie that, als ob sie flüstere): ›Ich bin so bange, daß mein Leib zittert, übrigens geht es mich nicht an. Jesus bewahre mich! Ich wollte, ich wäre unten!‹ Maren sah betrübt aus, aber weder antwortete sie noch sprach sie ein Wort. Maren kam leise zum Bett und sagte: ›Es kommet gewiß jemand zu Euch.‹ Ich antwortete: ›Lasset ihn in Gottes Namen kommen.‹ Da war ein Lauffen die Treppe auff und ab, und auch oben, denn die Commissarien kamen alleweyle durch die Gemächer, umb nicht über den Platz zu gehen. Meine Thüren waren wieder geschlossen. Bei jedem Mal, daß einer auff der Treppe lieff, schauderte Anna und sagte: ›Ick bäwe recht!‹ Das Laufen dauerte bis gegen elff. Als der Schloßv. auffmachte, sagte er zu mir: › Leonora, Ihr sollet auffstehen und zu die Herren gehen!‹ Gott weiß, daß ich kaum gehen konnte, und Anna erschreckte mich, sagte zu Maren: ›O, dat arme Mensch!‹ Marens Hände zitterten, als sie mir die Pantoffel auffsetzte. Ich konnte nichts anderes glauben, als daß ich gepeyniget werden sollte, tröstete mich darmit, daß ich hoffte, meine Peyn werde nicht lang dauern, denn mein Körper war so matt, daß es schien, der Geist müsse jeden Augenblick von dannen fahren. Als Maren mir die Schürtze umb mein langes Kleid band, sagte ich: ›Nun, sie versündigen sich wol schwer an mir, Gott gebe mir Krafft!‹ Der Schloßv. eilte, und als ich fertig war, nahm er mich beim Arm und führte mich. Ich wäre gern seiner Hülfe ledig gewesen, aber ich konnte allein nicht gehen. Er führte mich in das nächste Stockwerck hinauff, dort saßen Gf. Rantzow, Skack, Retz, Gabel, und Krag um den Tisch. Sie erhoben sich alle vor mir, als ich herein kam, und ich machte eine Reverentz, so gut ich konnte. Für mich wurde ein kleiner niedriger Stuhl in der Mitte vor den Tisch gesetzt. Canzeler fragte mich, ob ich nicht mehre Brieffe gehabt hätte, als die mir in Engeland abgenommen wurden. Ich antwortete nein, ich hätte nicht mehre, dort nahmen sie mir alle meine Brieffe. Er fragte weiter, ob ich damals keine Brieffe vernichtet hätte. ›Ja,‹ (antwortete ich), ›einen riß ich entzwey und warff ihn in das heimbliche Häuschen.‹ ›Warumb thatet Ihr das?‹ fragte Gf. Rantzow. ›Weil‹ (antwortete ich) › Ziffern darauff standen, und obwol sie von keiner importance waren, so fürchtete ich gleichwol, daß es Verdacht erregen könnte.‹ Gf. Rantzow sagte: ›Wenn die Stücke nu noch auffbewahret wären?‹ ›Das wäre zu wünschen‹ (antwortete ich), ›denn dann könnte man sehen, daß nichts verdächtiges darinnen war, und verdroß es mich später, daß ich es entzwey gerissen habe.‹ Darauff zog Canzeler einen Bogen Papir herfür, auff den hie und da Stücke von selbigem Brieff geklebet waren, und reichte ihn Krag zu, der ihn mir gab. Gf. Rantzow fragte mich, ob es nicht meines Mannes Hand sey. Ich antwortete ja, es wäre seine Hand. Er sagte: ›Ein Theil der Stücke, die Ihr entzwey risset, ist gefunden, und ein Theil ist fort. Das, so gefunden ward, ist gesammelt und abgeschrieben;‹ fordete darauff die Abschrift vom Canzeler, der sie Gf. Rantzow gab, und er reichte sie mir, sagte: ›Sehet dort, was da fehlt, und saget uns, was es gewesen ist, so da fehlt.‹ Ich nahm es und blickte darauff und sagte: ›An einigen Stellen, wo nicht zu viele Wörter fort sind, kann ich wol errathen, was fehlt, aber wo ein gantzer Satz fort ist, da kann ich es nicht wissen.‹ Das meiste von dem Brieff war gesammelt und nichts dazwischen fort, und bestand es alles zusammen aus Lustigkeit und Schertz. Er ließ mich wissen, daß man ihm von Dänemarck geschrieben habe, man erwarte den Cur-Printzen von Saxen AdÜPrinz Georg von Sachsen mit der ältesten Tochter Friedrich's III. Anna Sophia., so sich mit der Princessin von Dänemarck verloben sollte; machte sich lustig darüber, wie sie ihre Kehlen schmieren und ihre Backen auffblasen würden, auff daß sie mit einer guten grace und Stimme eines jeglichen Titteln gebührlich ausposaunen könnten, und mehr desgleichen, so er weitläufftig ausgemalet hatte, und die Art und Weise beschrieb, die Gf. Rantzow anwendete, umb die Leute seine Titteln wissen zu machen, was bey der Mahlzeit geschah, wo einer stand und den Gästen seine Titteln herlaß, fragte auch erst jeden besonders, ob er seine Titteln kenne; war einer darunter, der sie nicht kannte, so mußte strax der Secreterer herbey und sie vorlesen. Es schien, daß Gf. Rantzow solches auff sich bezog, denn er fragte mich, was mein Mann darmit meinte. Ich antwortete, nicht wissen zu können, daß seine Meinung eine andere gewesen sey, als wie er schrieb; er meine sonder Zweiffel diejenigen, so solches thäten. Cantzeler wandte das Gesicht von Gf. Rantzow ab und verzog den Mund ein weniges zum schmunzeln; desgleichen that auch Gabel. Und war unter anderem solches über den Cur-Printzen geschrieben, daß er sich nu vielleicht Hoffnung mache, Dänemarcks Crone zu erben; › mais j'espère – – – cela ne se fera point.‹ Ueber die Worte, so darinnen fehlten, fragte Gf. Rantzow, was es wäre. Ich sagte, wenn ich mich recht erinnere, so hätte dort gewiß gestanden: qu'en 300 ans. Er fragte weiter, wo hie und da etwas fehlte, dessen ich aber nicht recht eigentlich mich erinnern konnte, und doch nichts auff sich hatte. Ich meinte, daß man von denen vorhergehenden und nachfolgenden Worten leicht errathen könne, was fehlte; man sähe außerdem zur Genüge, daß alles Schertz sey, was Gabel auch fandt und sagte: › Ce n'est que raillerie.‹ Aber Gf. Rantzow und der Feldtherr wollten es nicht als Schertz passiren lassen. Skack sagte: ›Man meinet offt was anderes unter dem Schertz und brauchet Namen, worunter man anderes versteht.‹ Denn in dem Brieff war etzliches über trincken vermeldet, war auch von denen Schweitzern ihrer Manier die Rede, so sie bey der Mahlzeit hätten und waren alle Tittel der Cantons-Herren auffgezählet, weshalb Skack meinte, daß die Städte-Namen anderes zu bedeuten hätten. Ich antwortete Skack nicht, aber da Gf. Rantzow immerfort drängte, daß ich sagen solle, was mein Mann darmit meinte, antwortete ich, daß ich nicht wissen könne, ob er eine andere Meinung gehabt hätte, als geschrieben standt. Skack schüttelte den Kopff und meinte ja, weshalb ich sagte: ›Ich weiß kein Landt, wo sie bei denen Mahlzeiten den Brauch haben, wie im Schweitzerlandt; gibt es andere Orte, wo sie denselbigen Brauch haben, so hat er vielleicht auch diese darmit gemeinet, denn hier ist nur die Rede von trincken.‹ Gabel sagte wieder: ›Das ist nur Schertz.‹ Die Ziffern, umb deren willen ich den Brieff entzwey riß, waren zum Glück vollständig, und nichts fehlte. Gf. Rantzow gab mir einen Bogen Papir, auff welchen Stücke von meines Herrn Brieff geklebet waren, und fragte mich, was die Ziffern bedeuteten. Ich antwortete: ›Ich habe nicht den Schlüssel und kann sie aus dem Kopff nicht aufflösen.‹ Er meinte, ich könnte es wol. Ich sagte, ich könne es nicht. ›So sind sie aufgelöset‹ (sagte er), ›und wir wissen, was sie bedeuten.‹ ›Desto besser‹ (antwortete ich). Darauff gab er mir die Auslegung zu lesen, und waren sie von dem Inhalt, daß unsere Söhne von Rom geschrieben hatten und Geldt begehrten, woran es knapp war, denn der Juncker war nicht daheim. Ich gab Gf. Rantzow das Papir zurück, ohn etwas zu sagen. Gf. Rantzow begehrte von dem Rentmeister, daß er den Brieff lesen möge, und begann Rantzow abermals mit seinen Fragen, wo hie und da etwas fehlte, daß ich es sagen sollte. Ich gab ihm die selbige Antwort wie zuvor; aber da er bey einer Stelle, wo einige Worte fehlten, mich hart bedrängte, sie zu sagen, und man aus dem Text sehen konnte, daß sie etwas spöttisch waren, (sintemalen ein spöttisches Wort geschrieben stand), sagte ich: ›Ihr könnet von selbiger Art so viele darzu setzen, als Euch gelüstet, wenn eines nicht genung ist; ich weiß sie nicht.‹ Gabel sagte nochmals: › Ce n'est que raillerie.‹ Dann ward nicht weiter über die Brieffe gefragt; aber Gf. Rantzow inquirirte von wegen meiner Juëlen, fragte, wo der große Demant AdÜVermuthlich zur Zeit, als er dort als Gesandter im Jahre 1647 war. Uebrigens ist es bekannt, daß die Königin Anna von Oesterreich bei dieser Gelegenheit Leonora Christinen eine goldene mit Diamanten besetzte Uhr von großem Werth verehrte. (Soph. Birk. Smith' dän. Ausgabe.) sey, den mein Mann in Franckreich erhielt. Ich antwortete, selbiger sey schon lange verkaufft. Ferner fragte er, wo meine großen Häng-Perlen seyen, welche ich wie eine Feder auff meinem Hut getragen hatte, und wo meine große Tour Perlen sey. ›Alles dieses,‹ antwortete ich, ›ist schon lange verkaufft.‹ Er fragte weiter, ob ich denn keine Juëlen mehr hätte. Ich antwortete: ›Nu habe ich keine.‹ ›Ich meine,‹ (sagte er) ›anderswo.‹ Ich antwortete: ›Etliche ließ ich zurück.‹ ›Wo da?‹ (fragte er). ›Zu Brügge,‹ antwortete ich. Darauff sagte er: ›Nu habe ich Euch umb etwas zu fragen, Madame, was mich selber angehet: Habet Ihr meine Schwester in Paris das letzte Mal besucht, als Ihr dort waret?‹ Ich antwortete: ›Ja.‹ Er fragte, ob ich bey ihr drinnen im Kloster war, und wie das Kloster hieße. Ich berichtete ihm, daß ich in dem Kloster gewesen sey, es hieße Couvent des Filles Bleues. Darzu nickte er, wie umb es zu bestätigen. Er wollte auch wissen, ob ich sie gesehen habe. Ich sagte, daß niemand in dem Kloster sich von anderen als von den Aeltern sehen ließe, nicht einmal die Geschwister dürfften sie sehen. ›Das ist wahr,‹ sagte er, stund darmit auff und gab mir die Hand. Ich bat ihn, daß er Se. königl. Mt. zu Mitleid gegen mich bewegen möge, er aber antwortete mir nichts. Als Rentmeister Gabel mir die Hand gab, bat ich ihn umb das gleiche. Er antwortete: ›Ja, wenn Ihr bekennen wollet;‹ ging damit hinaus, ohn eine Replicque anzuhören. Und hatten sie sich über drey Stunden mit den Fragen auffgehalten. Darnach kam der Schloßv. herein und sagte zu mir: ›Nu sollet Ihr hier innen bleiben, das ist eine schöne Kammer, ist frisch gekalcket und schön weiß gemacht; gebet Euch nu zufrieden.‹ Anna und Maren kamen auch herein. Gott weiß, ich war sorgenvoll, müde und matt, hatte un-leidlichen Kopf-Schmertz; mußte doch, ehe ich zur Ruhe kam, so lange sitzen, bis die Bettstatt aus der Dunckeln Kirche genommen und hieher gebracht war. Anna bemühete sich unterdessen in der Dunckeln Kirche, alle Löcher aus zu kratzen, meinte dort noch etliches zu finden, aber vergebens. Das Frawenzimmer, so bey mir allein bleiben sollte, kam dann auch herein. Ihr waren 2 Rdlr. pr. Woche zugesagt; Ihr Name ist Karen Ollis Tochter. Nachdem der Schloßvoigt mit denen Weybern und Maren gespeiset hatte, sagten Anna und Maren Blocks mir Gute Nacht; die letztere zeigte große Affection. Der Schloßv. riegelte zween Thüren vor meinem innersten Gefängniß zu. In der innersten Thür ist ein viereckiges Loch, so mit eisernen Riegeln verwahret ist. Der Schloßv. wollte vor dieses Loch auch ein Schloß hängen, doch unterließ er es auff Karens Bitte, denn sie sagte, sie könne keinen Athem schöpffen, wenn dieses geschlossen würde. Dann hängte er Schlösser vor die äußerste Kammer-Thür und die Thür zur Treppe; hatte daher vier Schlösser und Thüren zwey Mal am Tage auff und zu zu schließen. Hier will ich mein Gefängniß beschreiben. Es ist eine Kammer, so 7 von meinen Schritten lang ist und 6 breit; darin stehen zween Betten, ein Tisch und zween Stühle. Sie war frisch gekalcket, was einen argen Stanck abgab; übrigens war der Fußboden so dick voll Un-rath, daß ich glaubte, er sey von Lehm, während er doch mit Mawer-Steinen belegt war. Sie ist 9 Ellen hoch, gewölbet, und zu allerhöchst ist ein Fenster, so eine Elle im Vierkant hat. Davor sind doppelt dicke Eisen-Gitter, außerdem ein Drahtwerck, welches so eng ist, daß ich den kleinen Finger nicht in die Löcher stecken kann. Dieses Drahtwerck hatte Gf. Rantzow mit großer Vorsicht so bestellt (wie der Schloßv. mir später sagte), auff daß nicht Tauben einen Brieff hereinbringen sollten, was er wol in einem Romans gelesen hatte, daß geschehen war. Ich war schwach und im Hertzen tieff betrübet, erwartete eine gnädige Erlösung und ein Ende meines Jammers, schwieg stille und beklagte mich nicht, antwortete wenig, wenn das Weyb zu mir sprach. Zuweylen kratzte ich in Gedancken an der Wand, weswegen das Weyb zu der Meinung kam, ich sey verwirret im Kopff, sagte es dem Schloßv., und dieser es wieder der Königinn, welche während jeder Mahlzeit, wenn die Thür offen war, fleißig Boten sendete, umb zu erfahren, wie es mit mir stünde, was ich sagte, was ich thäte. Das Weyb hatte dann nicht viel zu sagen, umb ihrem Eid Genüge zu leisten, welchen sie vor dem Schloßv. abgelegt hatte. Aber später hatte sie was, sich beliebt darmit zu machen. Und da meine Krafft täglich abnahm, freuete ich mich auff mein Ende, ließ am 21. Augusti den Schloßv. herein fordern, begehrte von ihm, daß er umb einen Geistlichen anhalten solle, der mir das Sterbe-Sacrament reichen könnte. Dieses ward strax bewilliget, und Sr. kön. Mts. Hoff-Predicant, Magister Mathias Foß erhielt den Befehl, mich zu versehen, welcher von wegen seines Ambtes sowol wie in Folge des Befehls mich ermahnete, ich möge mein Gewissen nicht beschweren; ich könne versichert seyn, daß ich auff dieser Welt meinen Mann nie mehr zu sehen bekäme; bat mich, ich solle sagen, was ich von der Verrätherey wüßte. Ich vermochte vor weinen kaum ein Wort hervor zu bringen, sagte, ich könne vor Gott im Himmel bezeugen, vor welchem nichts verborgen sey, daß ich nichts von dieser Verrätherey wisse; ich wüßte wol, daß ich in meinem Leben meinen Mann nie wieder zu sehen bekäme; ich befehle ihn dem Allerhöchsten, der meine Un-schuld kenne; bäte Gott nur umb ein seliges Ende und scheiden von dieser übeln Welt; begehrte nichts von dem Geistlichen, außer daß er in seinen Gebeten meiner gedencken möge, daß Gott durch den Tod meinem Jammer ein Ende machen wolle. Der Geistliche versprach, dieses getrewlich erfüllen zu wollen. Es hat Gott nicht gefallen, mich in diesem zu erhören, hat meinen Glauben ferner prüfen wollen, indem er mir seit der Zeit viel Sorge, Betrübniß und Widerwärtigkeit schickte. Er hat mir auch das Kreutz tragen helffen und selbiges an seinem schwersten Ende erfasset; sein Name sey gepriesen ewiglich! Als mir das h. Nacht-Mahl gereicht war, tröstete M. Foß mich und sagte mir lebewohl.
Ich lag dann drey Tage still vor mich hin, nahm wenig oder nichts. Der Schloßv. fragte offt, ob ich etwas zu essen oder zu trincken begehrte, oder ob er dem König etwas sagen solle. Ich danckte ihm, ich begehrte nichts.
Am 25. Augusti importunirte der Schloßv. mich flugs mit seinem discours, meynte, ich hätte üble Meynung von der Königinn. Er entnahm es daraus: Tages zuvor hatte er zu mir gesagt, Se. königl. Majt. hätte befohlen, was ich aus Küche und Keller begehrte, sollten sie mir gleich ausfolgen; worauff ich dann antwortete: ›Gott erhalte Se. Majt.! er ist ein guter Herr; möchte er gut für böse Menschen seyn.‹ Und sagte er da: ›Die Königinn ist auch gut,‹ worauff ich nichts antwortete; er wollte nu die Rede auff die Königinn führen und hören, ob er nicht irgend ein Wort aus mir heraus bringen könnte; sagte: ›Die Königinn beklaget Euch, daß Ihr Euch so habet verführen lassen. Ihr habet selber Euer Unglück gewollt, das thuet ihr leyd; sie ist nicht erzürnt, sie hat Mitleyd mit Euch.‹ Und als ich nichts antwortete, repetirte er es abermals, und darzwischen sagte er: ›Ja, ja, mein liebes Fräwlein! es ist so, wie ich sage.‹ Ich war sehr verdrossen über den Schnack, sagte: › Dieu vous punisse!‹ ›Ho, ho!‹ (sagte er) ›sie will pißen!‹ rieff Karen, ging hinaus und schloß die Thüren. Darmit bekam ich un-vermuthet Ruhe vor ihm. Lächerlich war dieses, daß das Weyb mich itzt nöthigen wollte, mein Wasser von mir zu lassen, weil der Schloßv. es gesagt hatte. Ich bat sie, zu gedencken, daß sie itzt nicht ein Kind zu warten hätte (sie war früher Wärterinn bey Kindern gewesen). Sie konnte nicht so leicht aus dem Wahn kommen, blieb lange darbey, bis ich ihr was anderes zu verstehen gab.
Als ich wahrnahm, daß mein Magen Speise begehre, und ich die Speise bey mir zu behalten vermochte, ward ich un-geduldig, daß ich nicht sterben konnte, sondern in so großem Elend leben sollte; begann mit Gott zu disputiren und wollte mit ihm rechten. Mir schien, solches nicht verdient zu haben; ich vermeinte, von groben Sünden weit reiner zu seyn als Dauid, der doch sagen durfte: ›Soll es denn vergeblich seyn, daß mein Hertz un-sträflich wandelt, und ich meine Hände in Un-schuld wasche, und ich werde täglich geplaget und meine Straffe ist jeden Morgen da?‹ Ich meinte eine so große Straffe nicht verdient zu haben, mit der ich gestrafft ward; sagte mit Hiob: ›Laß mich wissen, warumb du mit mir haderst? Gefällt dirs, daß du Gewalt thust und mich verwirffst, den deine Hände gemacht haben?‹ Ich vergaß nichts von all dem, womit Hiob sich rechtfertigen wollte, anzuführen, und schien mir, daß ich es billigerweise auff mich appliciren konnte. Ich versuchte mit ihm und Jeremia den Tag meiner Geburt und war sehr un-geduldig, behielt es aber bey mir und sprach nicht laut; entschlüpfte mir zuweilen ein Wort, so war es doch auff teutsch (sintemalen ich die Bibel meistens auff teutsch gelesen hatte), so daß das Weyb nicht verstand, was ich sagte. Sehr beunruhigt war ich durch husten und warff mich auff dem Bette hin und her. Das Weyb fragte mich offt, wie es ginge. Ich bat sie, mir Ruhe zu lassen und nicht mit mir zu sprechen. Mir war niemals besser als in der Nacht, wenn ich merkte, daß sie schlieff; dann konnte ich meine Thränen un-gehindert fließen lassen und meinen Gedancken freien Lauff geben. Da ging ich denn mit Gott ins Gericht. Ich rechnete alles auff, was ich in meinem Leben unschuldig gelitten und ausgestanden hatte, hielt Gott vor: Ob ich von meiner Pflicht abgewichen sey? Ob ich weniger für meinen Ehegemahl hätte thun sollen, als ich gethan habe? Ob das nu mein Lohn sey dafür, daß ich ihn nicht zur Zeit des Unglücks verlassen wollte? Ob ich itzt darvor gepeynigt, geplagt und verspottet werden solle? Ob so vieles un-sägliches Unglück, so ich mit ihm ausgestanden, nicht genung sey, daß ich nu schließlich zu diesem unheilbaren großen Unglück solle conserviret bleiben? Ich will meine Un-vernunft nicht verhehlen. Ich will meine Sünden bekennen. Ich fragte: Ob itzt noch etwas schlimmeres übrig sey, weswegen ich leben sollte? Ob es wol einen Jammer auff Erden gebe, den man mit meinem vergleichen könne? Bat Gott, er möge ein Ende machen, denn er hätte keine Ehre darvon, mich so leben und geplagt werden zu lassen; ich sey doch nicht von Eisen und Stahl, sondern von Fleisch und Blut. Ich bat, er möge mir eingeben oder mich im Traum verständigen, was ich thun solle, meinen Jammer abzukürtzen. Wenn ich lange disputirt und mir den Kopff zerbrochen, mich auch so verweint hatte, daß es schien, als wären keine Thränen mehr vorhanden, fiel ich in Schlaff, erwachte aber mit Schrecken, denn ich hatte im Traum un-erhörte grewliche Fantasien; so daß mir zu schlaffen grauete, begann dann wieder, mein Elend zu beklagen. Endlich sah Gott auff mich mit seinen Gnaden-Augen, so daß ich den 31. Augusti in der Nacht einen ruhigen Schlaff hatte, und gerade, als es tagte, erwachte ich mit nachfolgenden Worten im Munde: ›Mein Kind, verzage nicht, wann du von Gott gestrafft wirst; denn welchen der Herr lieb hat, denn züchtiget er. Er steupet aber einen jeglichen Sohn, den er auffnimmt.‹ Ich sprach die letzten Worte laut aus, dachte, das Weyb schlieffe; vielleicht erwachte sie zugleich, und fragte sie mich, ob ich etwas begehrte. Ich antwortete: ›Nein.‹ ›Ihr sprachet doch‹ (sagte sie), ›und nanntet Euere Strümpffe; das andere konnte ich nicht verstehen.‹ Ich antwortete: ›So muß es im Schlaff gewesen seyn; ich begehre nichts.‹ Lag dann stille vor mich hin und besinnete mich; erkannte und gestand meine Thorheit, daß ich, die ich doch nur Erde und Staub, Moder und Asche, ja schändlicher Mist war, mit dem allerhöchsten, un-begreifflichen Gott ins Gericht gehen, mit meinem Schöpffer und seinem Rathschluß hadern, ihn meistern und entgegenreden wollte. Mich überfiel ein hefftiges weinen, bat inniglich und von Hertzen umb Gnade und Verzeihung. Hatte ich mich früher mit Dauid gerühmet und auff meine Un-schuld gepocht, so bekannte ich anjetzto mit ihm, daß keiner vor Gott gerecht sey, ja nicht einer. Hatte ich mit Hiob thöricht gesprochen, sagte ich auch mit ihm, daß ich un-weise gehandelt und über Dinge geredet, so mir zu hoch waren und ich nicht verstand. Ich flehte umb Gottes Gnade, verließ mich auff seine große Barmhertzigkeit; hielt ihn vor Mosen, Josua, Dauid, Jeremia, Hiob, Jonas, und andere, so hochbegabte Männer waren und doch so schwach, daß sie in der Zeit der Noth gegen Gott knurrten und murrten; bat daß er mir, dem allergebrechlichsten Irden-Gefäß, aus Gnade vergeben wolle, ich könnte doch nicht anders seyn als wie er mich geschaffen habe. Alle Dinge seyen in seiner Macht; es sey ihm leicht, mir Geduldt zu geben, so wie er mir früher auch Krafft und Muth gab, so harte Schläge und Stöße auszuhalten. Und bat ich Gott (nächst meiner Sünden Vergebung) umb nichts anderes als gute Geduldt, die Zeit meiner Erlösung abzuwarten. Gott erhörete mich gnädiglich, er verzieh mir nicht allein meine thörichten Sünden, sondern gab mir auch das, worumb ich nicht gebeten hatte, denn Tag für Tag nahm meine Geduldtigkeit zu. Sagte ich offt mit Dauid: ›Wird denn der Herr ewiglich verstoßen, und keine Gnade mehr erzeigen? Ist's denn gantz und gar aus mit seiner Güte? Und hat die Verheißung ein Ende? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu seyn und seine Barmhertzigkeit vor Zorn verschlossen?‹ so sprach ich auch weiter mit ihm: ›Ich muß das leiden; die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern.‹ Ich sagte aus dem 119. Psalm: ›Es ist mir lieb, Herr, daß du mich gedemüthiget hast, daß ich deine Rechte lerne.‹ Gottes Krafft that in mir seine Wirkung. Mir kamen viel tröstliche Sentenzen aus der heiligen Schrifft in den Sinn, vornehmlich diese: ›Sofern wir mit Christo leiden, sollen wir auch mit ihm herrlich gemacht werden.‹ Item: ›Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.‹ Item: ›Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.‹ In Sonderlichkeit dachte ich offt an Christi Worte bey Lucam: ›Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte Geduld darüber haben? Ich sage Euch, er wird sie erretten in einer Kürze!‹ Ich erkannte in meiner Betrübniß, welchen Nutzen man darvon hat, in der Jugend Psalmen und biblische Sprüche gelernt zu haben. Glaubet mir, meine Kinder, das ist mir in meinem Elendt ein großer Trost gewesen. Deswegen übet Euch in der Jugend darinnen, was Eure Aeltern Euch in der Kindheit haben lernen lassen, anjetzto! (sage ich) itzt da die Betrübniß Euch noch nicht so hart heimsuchet, auff daß, wenn sie kommt, Ihr bereit seyd, sie zu empfangen und Euch mit Gottes Wort zu trösten.
Ich begann nach und nach mich zu Frieden zu geben, mit dem Weyb zu sprechen und dem Schloßv. zu antworten, wenn er mich anredete; das Weyb erzählte mir etzliches, sagte, der Schloßv. habe ihr wol befohlen, daß sie ihm alles sagen solle, was ich redete und thäte, aber sie sey zu weise, als daß sie solches thun würde; sie verstände sich nu besser als in den ersten Tagen darauff, wie sie sich anstellen solle; er ginge hinaus, sie aber bliebe mit mir eingeschlossen, sie wolle mir trew seyn. Und als es schien, daß ich nicht recht glaubte, was sie sagte, schwur sie hoch und theuer, bat Gott, sie an dem Tag zu straffen, wo sie falsch wider mich handeln würde, streichelte und klopffte meine Hand und legte sie an ihre Wange, bat, ich möge ihr glauben, brauchte die Worte: ›Meine hertzliebe Fraw, Ihr könnet mir glauben: so wahr ich Gottes Kindt bin, will ich Euch nie hintergehen! Nu, ist das nicht genung?‹ Ich antwortete: ›Ich will Euch glauben;‹ dachte nicht anders, als daß ich das sagen oder thun wolle, was sie divulgiren könnte. Sie ward sehr froh, daß sie mir den Mund geöffnet hatte, und sagte: ›Als Ihr so stille vor Euch hin laget, und ich niemand hatte, mit dem ich sprechen konnte, da war ich trawrig und wollte nicht lange mehr dieses Leben führen, wenn sie mir auch doppelt so viel gäben, denn ich wäre doll geworden. Ich hatte Angst vor Euch, aber noch viel mehr vor mir selber, daß mir im Kopff die Schrauben los gehen würden.‹ Sie schnackte so fort und fandt auch allerley lustiges. Als sie jung war, hatte sie bey einem Geistlichen gedienet, so sein Gesind zur Gottes-Furcht hielt, dort hatte sie Gebete und biblische Sprüche auswendig gelernt; konnte auch die Kinder-Lehre mit der Auslegung, sang auch ziemblich gut. Sie wußte einigermaaßen, wie sie vor Gott wandeln und sich gegen ihren Nächsten verhalten sollte; aber sie handelte dem gerade zuwider, denn sie war von einer bösen Natur. Sie war eine ältliche Frawenspersohn, wollte sich doch zu denen mittel-älterlichen rechnen. Es schien auch, daß sie in ihrer Jugend hüpsch und etwas locker gewesen war, sintemalen sie noch von ihrer Leichtfertigkeit nicht lassen konnte, und schäkerte offt mit dem Thurmwächter, mit des Schloßv. Kutscher, Namens Peder, und mit einem gefangenen, so Christian hieß (über diesen gefangenen wird mehres gemeldet werden); er ging frey im Thurm herumb. Wenn ich speisete, hatte das Weyb Gelegenheit, mit denen drey Mannsbildern zu sprechen. Der Kutscher halff dem Thurmwächter, so Raßmus hieß, die Speisen herauff tragen. Maren Blocks ließ mich offt durch vorbem. Kutscher grüßen und sandte mir allerley Art canticirten Zucker und Zitronen, ließ mich auch ab und zu wissen, was sie neues wußte. Alles dieses mußte durch das Weyb verrichtet werden; und kam das Weyb eines Tages herein, als die Thüren geschlossen waren, und grüßte mich von Maren Blocks; sagt: ›Frau, wollet Ihr Euren Kindern in Schonen schreiben, es ist nu eine sichere Gelegenheit.‹ Ich antwortete: ›Meine Kinder sind nicht in Schonen, doch kann ich Botschafft nach Schonen bringen, so habe ich dort eine Freundin, die mich wol wird wissen lassen, wie es meinen Kindern geht.‹ Sie gab mir ein Stück zerknittertes Papir und einen Stifft zum schreiben. Schrieb mit wenigen Worten an F. Margrete Rantzow, daß sie meinen elendigen Zustandt wol kenne, vermuthete doch, daß ihre Freundschafft dadurch nicht geringer worden sey, bat, sie möge mich wissen lassen, wie meine Kinder sich befänden, und durch welchen Zufall sie nach Schonen gekommen seyn sollten, wie berichtet wurde und ich doch nicht glaubte. Dieses war es, was ich schrieb und dem Weybe gab; hörte nichts weiter davon, meine, daß es so befohlen war, umb zu erfahren, an wen ich schreiben würde etc. (Sie hatten die Zukunfft voraus gesagt, denn einige von Euch, meine lieben Kinder, sollten später nach Schonen kommen.) Ich nähete den Brieff oder Zettel so zu, daß er nicht zu öffnen war, ohne daß man es sehen konnte. Ich fragte das Weib mehre Male, ob sie nicht wüßte, ob der Brieff fortgeschickt sey. Sie antwortete immer, sie wüßte es nicht, und das mit einer sauren Miene; sagte endlich einmal (als ich sie abermals gebeten hatte, Peder zu fragen): ›Der, so es haben sollte, wird es wol gekriegt haben.‹ Diese Antwort machte mich nachdencken, und fragte ich seitdem nicht weiter.
Ich blieb dann allweyl zu Bett, theils aus der Ursach, weil ich nichts hatte, die Zeit da mit zu vertreiben, theils für Kälte, denn in der Kammer meines Gefängnisses wurde vor Neujahr kein Ofen gesetzt. Ich begehrte zuweylen von dem Weyb, sie solle bey Peder durchsetzen, daß ich ein wenig Seide oder Zwirn bekäme, umb darmit zum Zeitvertreib auf dem Stück Tuch, das ich hatte, zu nähen, erhielt aber die Antwort, er dürffe nicht. Lange Zeit darnach bekam ich zu wissen, daß sie Peder nie darumb gebeten hatte. Es kam böses genung, so mich in anderen Gedancken erhielt, als daß ich mir die Zeit mit einer Arbeit zu vertreiben brauchte. Es geschah am 2. September, daß ich in der Frühe jemanden über dem Gemach, wo ich liege, gehen hörte, weßhalb ich das Weyb fragte, ob sie wüßte, ob dort eine Kammer sey, (denn das Weyb gehet jeden Sonnabend mit dem Nachtkessel hinauff). Sie antwortete, ja es sey ein Gefängniß, wie dieses, und draußen stände die Folterbanck, (was auch so ist). Sie bemerkte wol, daß ich Angst hatte, sagte: ›Helff Gott! Wer es auch seyn mag, der dort sitzet, so soll er gewiß gepeinigt werden.‹ Ich sagte: ›Fraget Peder, wenn aufgeschlossen wird, ob dort ein gefangener ist.‹ Sie sagte, sie wolle dieses thun, und derweyl fragte sie mich und sich selber, wer es doch wol seyn könnte. Ich konnte es nicht errathen, noch weniger durffte ich ihr meine Furcht zu erkennen geben, welche sie doch bemerckte und deshalb vermehrte, denn nachdem sie gegen Mittag mit Peder gesprochen hatte, Wenn sie mit jemand sprach, so konnte ich es nicht sehen, denn es geschah auf der Treppe. und die Thüren geschlossen waren, sagte sie: ›Wer es ist, so dort gefangen sitzet, mag Gott wissen. Peder wollte nichts mit mir sprechen.‹ Bey der Abend-Mahlzeit machte sie es ebenso, fügte aber hinzu, daß sie ihn gefragt habe, aber er wolle nichts antworten. Ich beruhigte mich, da ich oben keinen mehr gehen hörte, und sagte: ›Da ist kein gefangener oben.‹ Es war auch nicht. ›Woher wisset Ihr das?‹ fragte sie. ›Ich urtheile es daraus,‹ sagte ich, ›daß ich seit heut morgen oben niemand habe gehen hören; ich meine, wenn einer oben sitzt, so würden sie ihm wol was zu essen geben.‹ Daß ich ruhig zu Sinn war, gefiel ihr nicht, weshalb sie mit Peder und er mit ihr mich zu troubliren suchten. Am anderen Tag, als nach der Mittags-Mahlzeit geschlossen ward, (was meistens durch Peder geschah), und er meine innerste Thür, so nach innen geht, an sich zog, steckte er den Kopf herein und sagte: › Casset!‹ Sie stand neben der Thür, that, als ob sie ihn nicht recht verstanden hatte, sagte: › Peder sprach von einem, so gefangen ist, aber ich konnte nicht verstehen, wer es ist.‹ Ich verstandt ihn schon, aber that auch, als ob ich ihn nicht verstände. Welchen Tag und welche Nacht ich hatte, weiß niemand, außer Gott. Ich dachte hin und her. Offt schien mir, es könnte wol so seyn, daß sie ihn ergriffen hätten, obwol Cassetta Unterthan des Königs von Spanien war, denn wenn eine Verrätherey suspiciret wird, so wird nicht observiret, was für ein Unterthan der seyn mag, so suspect ist; lag in der Nacht und weinte heimblich und beklagte, daß der wackere Mann meiner wegen in Verdruß kommen sollte, weyl er meinem Herrn den Willen gethan hatte und mir nach Engeland gefolget war, wo wir von einander schieden, ich muß sagen, wo Petcon und sein Anhang uns trennten und mich gefangen herführten. Ich lag ohne Schlaff bis gegen Tag, da fiel ich in einen Traum, der mich erschreckte. Ich glaube‚ daß meine Gedancken ihn verursacht haben. Mir kam vor, Cassetta würde so gepeiniget, wie er mir einmal erzählt hatte, daß ein Spanier gepeiniget worden war; vier Schnüre waren umb Hände und Füße gebunden und jegliche Schnur war in einer Ecke der Kammer fest, und ein Mann schlug baldt auff eine Schnur baldt auff die andere; und sintemalen mir schien, daß Cassetta nicht schrie, vermeinte ich, daß er todt sey, schrie laut und erwachte darvon. Das Weyb, so schon lange wach gewesen war, sagte: ›O Herr Gott, liebe Frau! was fehlet Euch? Ist Euch übel? Ihr habt sehr schwer geschlaffen und nu schriet Ihr gar laut!‹ Ich antwortete: ›Es war im Traum: mir fehlet nichts.‹ Sie sagte weiter: ›Dann habt Ihr etwas böses geträumt.‹ ›Das kann wol seyn,‹ antwortete ich. ›O sagt mir, was Ihr geträumt habt; ich kann Träume auslegen.‹ Ich antwortete: ›Als ich schrie, vergaß ich meinen Traum, übrigens kann niemand so gut Träume auslegen als ich‹ (ich dancke Gott, daß ich der Träume nicht achte); und hatte dieser Traum nichts anderes zu bedeuten, als wie gesagt ist. Als nach der Mittags-Mahlzeit die Thür geschlossen ward, sagte das Weyb von selbst (denn ich fragte nicht weiter nach gefangenen): ›Da sitzet keiner gefangen; Peder soll die Schwerenoth kriegen für seinen Tratsch! Ich fragte ihn, wer dort gefangen sitze; da lachte er mich aus. Da ist keiner, gebet Euch zu Frieden!‹ Ich sagte: ›Sollte mein Unglück andere hineinziehen, so würde mir dieses sehr leid thun.‹ So ging es hin bis mitten in Sept., da führten sie zween unserer Diener gefangen her, welche in die Wache gesetzt wurden, den einen, Nels Kaiberg, der als Taffeldecker diente, und den anderen, Frans, so als Lacquei diente. Nach Verlauff einiger Wochen wurden sie nach einer examination los gegeben. Zur selbigen Zeit wurden zween Franzosen gefangen hergeführt: ein alter Mann mit Namen La Rosche und ein junger Kerl, dessen Namen ich nicht weiß. La Rosche wurde hier in den Thurm geführt und in das Gitterloch gesetzt. Dort hatte man einen Pfühl auff den Boden geworffen, darauff lag er; war einige Monate lang nicht aus seinen Kleidern. Seine Nahrung bestand aus Brodt und Wein, andere Speise wollte er nicht nehmen. War beschuldigt, mit Corfitz correspondiret und dem König von Franckreich versprochen zu haben, er wolle ihm Crooneborg überlieffern. Reimte sich das nicht gut darmit, daß mein Herr zween Potentaten das Reich Dänemarck angebothen haben sollte? Diese Auskunfft hatte Hannibal Sehsted gegeben, der zu jener Zeit in Franckreich war, und er hatte sie von einem Herrn, welcher damals Hannibal zu Willen war und zuvor La Rosche zu Willen gewesen war und sich vielleicht später mit ihm erzürnet hatte. Ein anderer Beweis für diese Anschuldigung war nicht da. Vielleicht trug ein Verdacht darzu bey, sintemal dieser La Rosche sammt dem andern, jungen Kerl mich zu sehen begehrte, als ich zu Dovers in Arrest war, was auch geschah, und sie machten mir la révérence. Wol möglich, daß er mit mir hat reden wollen und mir sagen, was er in London hatte sprechen hören und wovon ihm schien, daß ich es nicht fürchtete. Aber da ich Karten spielte mit einigen Damen, die gekommen waren, umb mich zu beschauen, so konnte er nicht mit mir allein reden, fragte mich, ob ich das Comedien-Buch hätte, so die Gräffinn von Pembrocg AdÜMary Sidney, Gemalin von William Herbert Grafen von Pembroke. hatte erscheinen lassen. Ich antwortete: ›Nein.‹ Er versprach mir, es zu senden, und da ich es nicht bekam, glaube ich, daß er etwas mir zur Warnung da hinein geschrieben hatte, womit Braten sich später wichtig machte. Wie alles dieses auch seyn mag, La Rosche AdÜVgl. Einleitung: La Roche. litt unschuldig und konnte mit seinem Eid erhärten, daß er sein Lebtag nicht mit meinem Herrn gesprochen, noch weniger mit ihm correspondiret hatte. La Rosche hatte ich nie zuvor gesehen, eben so wenig seinen Compagnon, nicht eher als in Dovers. In summa: nach einigen Monaten un-schuldiger Leiden ward er los gegeben und nach Franckreich zurück gesendet. Der andere, junge Kerl saß in einer Kammer in Arrest, die bey der Gesindestube ist. Er war nur der Genossenschafft wegen gefangen genommen worden, ohn daß man ihn weiter beschuldigte. Im Anfang, als diese Menschen gefangen saßen, war ein Gewisper und Geflüster zwischen dem Schloßv. und dem Weyb, so wie auch zwischen Peder und ihr; der Schloßv. machte auch selber meine Thür zu. Ich merckte wol, daß da etwas im Anzug sey, fragte aber nicht. Peder berichtete später dem Weyb, daß es zwey Franzosen seyen, und etzliches über die Sache, doch nicht so, wie es war. Kurtz bevor sie los gegeben wurden, sagte der Schloßv.: ›Ich habe zwey parle mi franço gefangen; was die gethan haben, weiß ich nicht.‹ Ich fragte ihn nicht weiter darumb, aber er spaßte und sagte: ›Nu kann ich fransch lernen.‹ ›Da will Zeit zu‹ (sagte ich). AdÜEs folgte der später ausgestrichene Satz: – Im selben Sept. Monat starb Graf Rantzow; erlebte nicht den Tag, ein Bildniß exequiret zu sehen, was er so sicherlich gehofft hatte, da er der Erste war, der diese Art Schimpf in diese Lande introduciret hat. Vgl. die Aufzählung am Ende der Vorrede, N. 1.
Am 9. October war das Fest unserer Princessin Anna Sophia und des Cur-Printzen von Saxsen. Des Morgens, als die Festlichkeit angehen sollte, sagte ich zu dem Weyb: ›Heute werden wir fasten bis gegen Abend;‹ denn ich glaubte nicht, daß sie an mich denken würden, oder daß ich einige Lebensmittel erhielte, bevor die anderen tractiret waren, wenigstens nicht zu Mittag. Sie wollte die Ursache wissen, weshalb wir fasten müßten. Ich antwortete: ›Das sollt Ihr heute Abend wissen.‹ Ich lag und dachte an das unbeständige Glück, daß ich, die ich vor 28 Jahren eben so großen Staat wie itzt die Princessin hatte, nu gefangen lag und gantz dicht an der Wandt, wo meine Braut-Bettkammer gewesen ist; danke Gott, daß ich mich nur wenig darumb bekümmerte. Gegen Mittags-Zeit, als die Trommeten und Heerpaucken sich hören ließen, sagte ich: ›Nu gehen sie mit der Braut über den Platz nach dem großen Saal.‹ ›Wie wisset Ihr das?‹ sagte das Weyb. ›Ja, ich weiß es,‹ sagte ich; ›mein Geist hat mir das gesagt.‹ ›Was ist das vor einer?‹ fragte sie. ›Das kann ich Euch nicht sagen‹ (antwortete ich). Und sintemal die Trommeten jedes Mal bliesen, wenn ein neuer Gang Speisen und das Confect auff getragen wurden, so sagte ich es. Und bevor man anrichtete, wurde auff die Heerpaucken geschlagen. Wenn dann angerichtet ward, was draußen vor der Küche auff dem Platz geschah, so sagte ich jedesmal: ›Wir bekommen noch keine Speise!‹ Als die Uhr gegen 3 war, sagte das Weyb: ›Nu schrumpffet mein Magen gantz ein! wann werden wir Speise kriegen?‹ Ich antwortete: ›Das ist noch lange hin. Der zweyte Gang ist nu erst hinauff gekommen: gegen 7 Uhren können wir was bekommen, früher kriegen wir es nicht.‹ Es geschah, wie ich sagte. Umb 7½ Uhren kam der Schloßv., entschuldigte sich, daß er wol die Speise gefodert hätte, aber die Köche hatten alle Hände voll. Das Weyb, so immer meinte, daß ich zaubern könnte, ward in ihrer Meinung darüber befestiget. Der Schloßv. erzählte dem Weyb etliches von der Pracht, und Peder sagte ihr auch was, so daß es ihr schien, daß ich nach dem Brauch früherer Zeit was wissen konnte. Am nächsten Tag wurden Ritter geschlagen, und jedes Mal wenn die Trommeten bliesen, sagte ich nicht allein: Nu wird da ein Ritter gemacht,‹ (denn ich konnte den Herold aus dem Fenster rufen hören, aber nicht verstehen was er sagte), sondern sogar, wer Ritter geworden war, denn das rieth ich, da ich wußte, daß auch solche im Rath saßen, so früher nicht Ritter waren; und weil es sich so befandt, glaubte die Weybspersohn steiff und fest, daß ich zaubern könnte. Ich merckte es ihr an, da sie mir Fragen stellte, die ich nicht wissen konnte, worauff ich offt Antwort von doppeltem Sinn gab; dachte, vielleicht möchte die Furcht, die sie hatte, daß ich wissen könnte, was geschehen würde, sie hindern mich mit Lügen zu umbgarnen. Sie flüsterte seit der Zeit lange nicht so viel mit dem Schloßvoigt. Sie erzählte von einer, so sie vor eine Zauberinn hielt, was doch in nichts anderem bestand als in der Wissenschafft, Frantzosen zu curiren und denen Huren ihre Leybes-Frucht ab zu treiben und anderen Ungebührlichkeiten. Mit selbigem Weyb hatte sie viel verkehrt.
Einige Zeit nach des Cur-Printzen Abreyse dachte man daran, ein hölzernes Bildniß hinzurichten, und ward am Vormittag meine Kammer auff geschlossen, gefegt, rein gemacht und Sand gestrewet. Die Königinn wollte, daß dieses hölzerne Bild in meine äußere Kammer gebracht und so vor die Thür gestellt wurde, daß es zu mir herein sah, wenn man meine innere Thür auffschlösse; aber der König wollte dieses durchaus nicht. Als gegen Mittag auff geschlossen, und das Weyb auff der Treppe gewesen war und mit dem Kutscher gesprochen hatte, kam sie herein und zu mir an das Bett, stellte sich wie verblüfft und sagte in einer Hast: ›O Jesus, Frau! da kommen sie mit Eurem Mann!‹ Die Zeitung erschreckte mich, was sie wol bemerckte; denn als sie es sagte, erhob ich mich im Bett und streckte meinen rechten Arm aus und war nicht im Stand, ihn gleich wieder zu mir zu ziehen. Das hat sie vielleicht doch verdrossen, denn ich blieb so sitzen und sprach kein Wort, weshalb sie sagte: ›Meine hertzliebe Frau, das ist Eures Mannes Bildniß.‹ Darauff sagte ich: ›Gott straffe Euch!‹ Sie ließ dann ihr böses Maulwerck los, meinte, ich hätte Straffe verdienet, nicht sie, brauchte viele unnütze Worte. Ich schwieg gantz still, denn mir war gantz schwach, wußte nicht, wo mir der Kopff stand. Des Nachmittags hörte ich ein großes Gemurmel von Volck auff dem inneren Schloßplatz, da wurde das Bild von dem Büttel in einer Schubkarre über die Straße geführt und in den Thurm unterhalb meines Gefängnisses ein gesetzt. Den nächsten Morgen gegen 9 Uhren ward das Bildniß von dem Büttel auff das jämmerlichste tractirt AdÜAm 13. November 1663., gab doch keinen Laut von sich. Bey der Mittags-Mahlzeit erzählte der Schloßv. dem Weyb, wie der Büttel den Kopff von dem Bild ab geschlagen, den Rumpff in 4 Theile getheilet hatte, die dann auff vier Räder gelegt, und an den Galgen gehängt wurden, und der Kopff ward auff dem Rathhaus aus gehängt. Der Schloßv. stand in der äußeren Kammer, schrie bei der Erzählung gar laut, auff daß ich es hören sollte, repetirte sie drei Mal. Ich lag und dachte nach, was ich thun sollte; ich konnte mir nicht mercken lassen, daß ich dessen nicht groß achtete, denn dann würde vielleicht was anderes ausgedacht worden seyn, so mich betrüben möchte, und in der Hast konnte ich auff nichts anderes kommen als dem Weyb mit einer Trawermüthigkeit sagen: ›O, welch ein Schimpff! Redet mit dem Schloßv. und saget ihm, er möge den König bitten, daß das, so auffgerichtet ist, herunter genommen werde und nicht bestehen bleibe!‹ Das Weyb ging hinaus und sprach leise mit dem Schloßv., aber er antwortete laut und sagte: ›Ja wol, hier unter? Dar sollen mehr herauff, ja mehr, mehr herauff!‹ sagte fast den gantzen Tag die selbigen Worte. Ich lag still vor mich hin, sprach nichts, hing meinen eigenen Gedancken nach. Baldt tröstete ich mich und hoffte, das, so mit dem Bildniß geschehen war, sey ein Zeichen, daß sie den Mann nicht kriegen konnten; dann wieder behauptete die Furcht ihren Platz. Den Schimpff achtete ich nicht, denn es gibt all zu viele Exempel von großen Herren in Frankreich, deren Bildnisse und Contrafeie vom Büttel verbrannt wurden, und die doch später wieder zu großer Ehre gelangten. Als zur Abend-Mahlzeit wieder auff geschlossen ward, gab es ein zischeln zwischen dem Schloßv. und dem Weyb. Es ward auch ein Lacquei gesendet, der stand draußen vor der äußeren Thür und ließ den Schloßv. zu sich herausrufen (mein Bett steht dicht vor den Thüren, wenn dann alle drey Thüren geöffnet sind, so kann ich bis zur Treppen-Thür sehen, welche die vierte Thür ist). Was das Weyb dem Schloßv. berichtet hat, kann ich nicht wissen, denn ich hatte den Tag über nichts anderes geredet, als begehrt, daß sie mir reiche, was ich bedurffte; sagte auch nichts weiter, als nach mehren Tagen das selbige abermals, so daß der Schloßv. müde ward, das Weyb länger zu fragen; denn sie hatte ihm nichts über mich mitzutheilen, und quälte ihn allweyl mit dem Begehren, sie wolle hinaus kommen: sie könne ihr Leben nicht länger so hinbringen. Aber da sie keinen andern Trost von ihm erhielt, als daß er ihr schwur, sie käme nie heraus, so lange sie lebe, so that sie einige Tage nichts anderes als weinen; und sintemalen ich sie nicht fragen wollte, warumb sie weine, so kam sie eines Tages heulend zu mir an das Bett und sagte: ›Ich bin ein elendiges Mensch!‹ Ich fragte sie, weshalb? was ihr fehle? ›Mir fehlet genung‹ (antwortete sie). ›Ich bin so dumm gewesen und habe mich vor Geldt einschließen lassen, und nu seyd Ihr bös auff mich und wollet nicht mit mir sprechen.‹ Ich sagte: ›Was soll ich sprechen? Ihr wollet vielleicht etwas haben, umb es dem Schloßv. zu hinterbringen.‹ Darauff fing sie an sich zu verfluchen, wenn sie dem Schloßv. ein Wort sagte, was ich spräche, oder was ich mir zu Hertze nähme, ich möge ihr nur glauben und mit ihr reden; warumb sollte sie mir untrew seyn? ›wir müßten doch zusammen bleiben, so lange wir lebten;‹ darzu viele eindringliche Worte, daß ich nicht ungehalten seyn möge; ich hätte wohl Ursach darzu; fürder wolle sie keine Ursach geben, daß ich ungehalten seyn möchte, denn sie wolle mir trew seyn. Ich dachte: du sollst nicht mehr zu wissen kriegen als was noth thut. Ich ließ sie dann weiter schwatzen und ihre gantze Lebensgeschichte erzählen, und was so bei den Bawern passiret. Sie war zwey Mal mit Pachtern verheurathet gewesen und hatte nach der letzten Wittibschafft Holger Winds Gemalin als Wärterinn gedienet, so daß es ihr nicht an allerley Tratsch fehlte. Sie hatte mit ihrem ersten Mann ein Kindt gehabt, so nicht alt worden war, und hätte ich wol aus ihren eigenen Worten einen Verdacht kriegen können, daß sie wol hatte geholffen, dieses Kindes Tage zu verkürtzen; denn einmal kam die Rede auff die Wittiben, so sich abermals verheurathen, da sagte sie unter andern: ›Die, so sich ein zweytes Mal verehelichen will, darff keine Kinder haben, dann einiget sich nie der Mann mit der Fraw.‹ Ich hatte viel dargegen zu sagen, auch, daß ich sie fragte, was denn eine Fraw machen sollte, so ein Kind mit ihrem ersten Mann hätte. Sie antwortete in der Hast: ›Das Kissen auff den Kopff legen!‹ Das konnte ich nicht vor recht halten, sondern vor eine große Sünde, legte es weitläufftig aus. ›Was Sünde‹ (sagte sie), ›wenn das Kind immer siecht und der Mann darob grimmig wird?‹ Ich antwortete, wie es sich gehört, und sie war nicht wol zu Frieden. Sothanes Gespräch legte keinen guten Grund bey mir über die Trewe, so sie mir gelobet hatte.
Das Weyb lavirte dann, brachte mir Botschafft von dem Kutscher, was neues passirte. Maren Blocks schickte durch sie ein Gebet-Buch, und das heimblich, denn ich durffte durchaus kein Buch haben, auch keine Nähnadel oder Stecknadel, darauff hatte das Weyb nach der Königinn Befehl dem Schloßv. einen Eyd abgelegt. Das Jahr ging so hin. Am Neujahrs-Tag wünschte das Weyb mir ein glückliches Jahr. Ich danckte ihr und sagte: ›Das kann Gott geben.‹ ›Ja,‹ (sagte sie) ›wenn er will.‹ ›Will er es nicht‹ (antwortete ich) ›so geschicht es auch nicht, und dann gibt er mir auch Geduldt, mein schweres Kreutz zu tragen.‹ ›Es ist doch schwer‹ (sagte sie) ›für mich; was würde es nicht für Euch seyn. Möchte es nur so bleiben und nicht schlimmer werden für Euch!‹ Mich dünckte, daß es für mich nicht schlimmer werden könnte, sondern besser; denn der Tod, wie er auch seyn mag, würde meinem Elendt ein Ende machen. ›Ja‹ (sagte sie) ›es ist nicht gleich viel wie man stirbt.‹ ›Das ist wol wahr,‹ antwortete ich; ›einer stirbt in Verzweifflung, der andere mit freyem Muth.‹ Der Schloßv. sagte mir an dem Tag kein Wort. Des Weybes Gespräch mit dem Kutscher dawerte lange; sonder Zweiffel hat sie ihm unsere Unterredung erzählet.
Im Martii Monat kam der Schloßv. herein und that gantz milde, sagte unter anderem: ›Nu seyd Ihr Wittib, nu könnt Ihr wol sagen aller Sachen Beschaffenheit.‹ Ich antwortete ihm mit einer Frage: ›Können Wittiben aller Sachen Beschaffenheit sagen?‹ Er lachte und sagte: ›Ich meine es nicht so; ich meine diese Verrätherey!‹ (Ich antwortete:) ›Ihr könnt andere darnach fragen, die es wissen; ich weiß von keiner Verrätherey!‹ Und da ihm schien, daß ich nicht glaubte, mein Mann sey todt, nahm er ein Advis herfür und ließ mich es lesen, vielleicht am meisten deswegen, weil mein Mann dort schlimm behandelt war. Ich sagte nicht viel darzu, nichts anders als: ›Die Avisen-Schreibers sagen nicht allzeit die Wahrheit. Das konnte er so nehmen, wie er wollte. Ich lag dann so vor mich hin in der Hoffnung, es möchte so seyn, daß mein Herr durch den Tod seinen Feinden entgangen wäre, und dachte bey mir selbst mit größter Verwunderung, daß ich den Tag erleben sollte, wo ich meinen Herrn todt wünschte; fiel abermals in betrübte Gedancken und mochte nichts reden hören. Das Weyb meinte, ich sey betrübt, daß mein Herr todt sey, tröstete mich, und das gantz vernünfftig, aber über ihren Trost ward das Angedencken vergangener Zeiten wieder stärcker, so daß ich lange Zeit darnach meinen Sinn nicht wieder zur Ruhe setzen konnte. Euer Zustand, meine hertzlieben Kinder, bekümmerte mich. Ihr hattet Euren Vater verloren, mit ihm Hab und Gut; ich bin gefangen und elend, kann Euch nicht helffen, weder mit Rath noch mit That; Ihr seyd landflüchtig und in der Fremde. Für meine Söhne, die drey ältesten, ist mir nicht so angst wie für meine Töchter und meinen jüngsten Sohn AdÜVgl. das Verzeichniß der Kinder Ulfeldt's und Leonora Christinens weiter unten.. Ich saß gantze Nächte hindurch in meinem Bett, denn ich konnte nicht schlaffen, und wenn ich Kopff-Schmertzen habe, so kann ich mit dem Kopff nicht auff dem Kissen liegen. Ich bat Gott von Hertzen umb eine gnädige Erlösung. Es hat Gott nicht gefallen, aber er gab mir Geduldt, mein schweres Kreutz zu tragen.
Mein Kreutz war mir so viel schwerer in der ersten Zeit, sintemalen so strenge verbothen war, mir weder Messer, noch Scheere, noch Zwirn oder etwas zu geben, womit ich mir die Zeit hätte vertreiben können. Später als mein Gemüth ein wenig zur Ruhe kam, dachte ich daran, etwas vor zu nehmen, und da ich eine Nähnadel hatte, wie gemeldet ist, so löste ich die Bänder in meinem Nachtwammes auff, so breite leibfarbene Taffet-Bänder waren. Mit der Seide nähete ich auff das Stück Tuch, so ich hatte, verschiedene Blumen mit kleinen Stichen. Als dieses ein Ende hatte, zog ich Fäden aus meinem Bettlaken, zwirnte sie und nähete dar mit. Als das zu Ende ging, sagte das Weyb eines Tags: ›Was wollet Ihr nu machen, wenn dieses aus ist?‹ Ich antwortete: ›O, ich werde schon was zu thun kriegen, sollten die Raben es mir auch bringen, so bekomme ich es.‹ Darauff fragte sie mich, ob ich etwas mit einem zerbrochenen hölzernen Löffel anfangen könnte. Ich antwortete: ›Vielleicht wisset Ihr einen?‹ Nachdem sie einen Tag gewartet hatte, zog sie einen herfür, von dem das Blatt halb abgebrochen war. ›Aus dem‹ (sagte ich) ›könnte ich wol was machen, hätte ich nur ein Geräthschafft darzu. Könnet Ihr den Schloßv. oder Peder Kutscher überreden, mir ein Messer zu leihen?‹ ›Ich will sie darumb bitten,‹ (sagte sie) ›aber ich weiß wol, es geschicht nicht.‹ Daß sie dem Schloßv. etwas darvon sagte, konnte ich aus seiner Antwort vernehmen, denn er antwortete laut: ›Sie hat kein Messer nöthig; ich will das Essen für ihr schneiden. Sie könnte leicht sich Schaden darmit thun.‹ Als ich einmal den Schloßv. umb eine Scheere bitten ließ, umb darmit meine Nägel zu schneiden, antwortete er und das laut: ›Was‚ was? Die Nägels sollen ihr wachsen als Adlers Klawen, und die Haar als Adlers Federn!‹ Was ich dachte, weiß ich wol; ob ich Klawen und Flügel hätte. Was sie dem Kutscher sagte, weiß ich nicht (das weiß ich, sie sah es nicht gerne, daß ich ein Messer bekäme, denn sie hatte Angst vor mir, wie ich später zu wissen kriegte). Das Weyb brachte die Antwort von dem Kutscher, daß er für sein Leben nicht dürffte. Ich sagte: ›Könnte ich ein Stück Glas erhalten, so will ich sehen, was ich mit dem Stück Löffel-Schafft mir zu Nutze machen kann;‹ bat sie, in einem Winckel zu suchen, der in der äußersten Kammer ist, wo aller Unrath hingeworffen wird, was sie auch that, fand nicht allein Glas, sondern sogar ein Stück von einem zinnernen Deckel, so auff einem Krug gesessen hatte. Mit dem Glas machte ich aus dem Löffelstumpff eine Pinne mit zween Zincken, worauff ich Band machte, und die noch in Gebrauch ist (die Seide zu denen Bändern nahm ich unten von meinem Nachtwamms). Das Stück Zinn-Deckel bog ich dergestalt zusammen, daß es mir später als Dintenfaß diente. Es ist auch noch in meiner Verwahrung. Zum Zeichen der Trewe brachte das Weyb mir zur selbigen Zeit eine große Knopff-Nadel, die mir ein gutes Geräthschafft war, umb den Anfang des Ausschnittes zwischen den Zincken zu machen, den ich später mit Glas schabte. Sie fragte mich, ob ich nicht etwas ausdencken könnte, womit sie spielen könnte, die Zeit werde ihr so lang. Ich sagte: ›Gebet Peder gute Worte, dann bringt er Euch wol ein wenig Flachs für Geld und eine Hand-Spindel.‹ ›O was!‹ antwortete sie, ›sollte ich itzt spinnen? Der Teuffel mag spinnen! Für wen sollte ich spinnen?‹ Ich sagte: ›Die Zeit darmit zu vertreiben. Ich wollte wol spinnen, wenn ich nur was darzu hätte.‹ ›Das dürffet Ihr nicht, hertzliebe Fraw‹ (sagte sie); ›ich wage schon das äußerste mit dem, so ich Euch gegeben habe.‹ ›Wollet Ihr etwas zu spielen haben?‹ (sagte ich) ›so verschaffet Euch einige Nüsse, dann wollen wir dar mit spielen.‹ Das that sie und wir spielten mit ihnen wie die kleinen Kinder. Ich nahm auch drey von denen Nüssen und machte Würffel daraus, setzte auff jeglichen zweyerley Zahlen, und spielten wir auch dar mit. Und auff daß man den ⨀ kennen möchte, so ich mit der großen Knopffnadel Ich nahm meine Nägel mit der Nähnadel ab, ritzete sie so lange, bis sie abfielen. Den Nagel am kleinen Finger an meiner rechten Hand ließ ich wachsen, umb zu sehen, wie lang er wol werden könnte; aber ich stieß ihn un-versehens ab und habe ihn noch. machte, bat ich sie, mir ein Stück Kreyde zu verschaffen, was sie auch that, und rieb Kreyde hinein. Bemeldte Würffel kamen weg, ich weiß nicht wie; ich bin der Meinung, daß der Kutscher sie kriegte, vielleicht damals als er das Weyb umb die übergebliebenen Lichter und den Zucker foppte. Denn er kam eines Mittags gantz außer Athem zu ihr und sagte, sie solle ihm die Lichter geben und den Zucker, so er ihr von Maren Blocks gebracht hatte, und was dar sonst wär, so nicht gesehen werden dürffte, denn in unserem Quartier sollte Haussuchung gehalten werden. Sie lieff darmit unter der Schürtze hinaus, und sagte mir nichts davon, bis die Thür geschlossen war. Ich versteckte, so gut ich konnte, an mir meine Pinne, meine Seyde und den Nählappen mit Nähnadel und Knopffnadel. Aus der Haussuchung ward nichts und war es nur des Kutschers Possen, umb von ihr die übergebliebenen Lichter herauszukriegen, für welche sie ihn später noch offt verfluchte, wie auch für den Zucker.
Ich war immer bey der Arbeit, so lange ich Seyde von Nachtwamms und Strümpffen hatte, strickte mit der großen Knopffnadel, auff daß es recht lange dauern möchte. Von der Arbeit habe ich noch einiges in meinem Verwahr, auch die Klöppelstäbe, die ich mir aus Pflöcken machte. Mit Beutteln, so mit Sand gefüllet waren, schlug ich Schnüre, aus denen ich mir eine Binde machte, (die verschlissen ist), denn ich durffte kein Schnürleib haben, wie offt ich auch darumb bat; die Ursache, weshalb, ist mir noch un-bekannt. Mit dem Stück Kreyde vertrieb ich mir offt die Zeit, malte darmit auff ein Stück Brett oder auff den Tisch, wischte es wieder aus, machte Reime und dichtete Psalmen. Der erste war der, den ich aber doch gedichtet habe, bevor ich die Kreyde bekam. Ich sang ihn niemals, sagte ihn aber für mich selbst her.
Ein Morgengesang nach der
Melodey:
Dich will ich ewig preisen etc.
1.
Dem Herrn will ich lobsingen,
So lang mein Auge wacht,
Und Danck will ich ihm bringen,
Will preisen seine Macht
Und übergroße Huld,
Der seine Wächter sandte,
Mein Lager mir umbspannte
Und wachte mit Geduld.
2.
Die Thränen rannen nieder
Gar saltzig in den Mund;
Offt glaubt ich, nimmer wieder
Zu sehn die Morgenstund.
Doch der Herr
Zebaoth
Geboth dem Schlafe leise,
Der dann in holder Weise
Erfüllte sein Geboth.
3.
O, Jesu, Herr des Lebens,
Leg mir dein Rüstzeug an!
Dann streit ich nicht vergebens,
Will kämpffen wie ein Mann
Gen Satan, Sünd und Tod
Und Fleisch und Eingeweyde,
Auff daß mich garnichts scheide
Von dir in dieser Noth.
4.
Hilff! Hilff mir! Reich die Hände!
Mein Kreutz ist allzu schwer!
Faß es am schwersten Ende,
Sonst trag ich es nicht mehr!
Erdrückt mich allzumal!
Ich will schon fast verzagen
Vor Schmertz und eitel Plagen!
Im Fleische brennt dein Pfahl!
5.
In Gnaden wolle lindern
Der Vaterlosen Noth!
Laß aus an meinen Kindern
Dein Gnadenborn, o Gott!
Sey du ihr Vater mild,
In schwerer Drangsal stütz sie,
Vor ihren Feinden schütz sie
Sey, Starcker, du ihr Schild!
6.
Ich armer Staub und Aschen,
Noch eines hab ich noth:
Thu mich nicht überraschen
Mit einem schnellen Tod!
In Ruhe und Verstand
Und vollen klaren Sinnen
Laß ziehen mich von hinnen
Einst in dein Gnaden-Land.
Auff teutsch dichtete ich nachfolgendes Lied, das ich öffters sang, da sie nicht teutsch verstandt.
Ein Liedlein – einigermaßen auff die Melodey als das Lied:
Was ist doch auff dießer Welt, das nicht felt? etc.
1.
Sprich Vernunfft zu meiner Seel:
Dich nicht quäl,
Besser Leben dir erwähl!
Es ist doch nicht zu erlangen
Das fürbey
Wieder sey,
Wie man's thut anfangen.
2.
Warumb dann bekümmerst dich
Aengstichlich,
Seuffzest immer, bist trawrich?
Du kannst es mit vielen Sorgen
Aendern nicht.
Das geschicht,
Was geschehn soll morgen.
3.
Hab'n verlohren Haab und Guth,
Zwar weh thut.
Schöpfe wieder ein frisch Muth!
Es war überflüßig kröhtig,
Die Natur
Hat doch nur
Weinig davon nöthig.
4.
Ist der Leib gefangen hir,
Glaube mir,
Es g'ring zu schätzen steht bey dir.
Du bist frey und ungebunden
Keine Hafft
Hat die Krafft
Dich zu können wunden.
5.
Endlich ist es gleiche eben viel,
Wann dein Spiel
Hat erreichet seinen Ziel,
Und du mußt vom Leibe scheiden;
Es geschicht
Oder nicht
Auff Stroh oder Seiden.
6.
Wol dann, frisk auff, meine Seel!
Dich nicht quäl,
Daß nichts deiner Ruhe fehl!
Gott in Noth dich nicht läßt stecken,
Er weiß wol,
Wann's seyn soll,
Hülffe zu erwecken.
Ich vertrieb so meine Zeit in Ruhe, bis
Doctor Otto Sperling
AdÜ(Vgl. Einleitung.) Die Regierung der Niederlande hatte Briefe von Sperling aufgefangen, welche sie an Hannibal Sehsted auslieferte, als dieser von seiner Gesandtschaftsreise von Paris nach Dänemark zurückkehrte. Ueber die Gefangennahme Sperling's wird in
Hap. mod. Europa folgendes erzählt: ›Hier stehet nicht zu verschweigen, was dem
Doctor Sperling begegnet, der, wie oben gemeldet, vor 12 Jahren, weil ihn das
justificirte Weib, des Giffts halben, mit eingemischet hatte, sich von Hof endlich freiwillig wegbegeben. Dieser hatte, nach der Zeit, zu Hamburg sein
Praxim, oder
Patienten-Cur getrieben, unterdessen doch auch mit dem Ulefeld fleissig Schreiben gewechselt. Es waren aber einige seiner Brieffe, so mit ungewöhnlichen Geheimniß-Zeichen oder
Characteren geschrieben, von den Dähnen aufgefangen, daher sie einen Argwohn gefasset, ihm wären die meisten Verborgenheiten des Ulefelds unverborgen, und darauf
gespeculirt, wie man ihn am füglichsten mit List möchte fangen.
Endlich ward diese Verrichtung einem Kriegs-Mann, Namens Hagedorn, anbefohlen, welcher den Handel auch gar artlich außgeführet, indem er zum
Doctor Sperling gangen und sich gestellet, als käme er, denselben zu begrüssen, daß er einen in dem Städtlein Altona (nahe bei Hamburg) Bett-lägerigen
Patienten besuchen möchte. Damit der
Doctor hierzu desto williger wäre,
präsentirte er ihm einen Gold-Gulden, durch welches guldene Lock-Brodt dieser Sperling gekörnet ward, aufzusitzen, und mit ihm unverzüglich nach besagtem Dähnischen Städtlein zu fahren, daselbst zog man das Netz zusammen und der Vogel war gefangen. Er ward gebunden, und, wiewol mit großem Unwillen des Raths zu Hamburg, nach Coppenhagen geführet, allda für dem König und den Staats-Rath gestellet und Gerichtlich
examiniret. Worauf er zuvörderst offentlich um Verzeyhung gebetten, und versprochen, daß, weil er der Königl.
Clementz vertrauete, auch, gemeinem Rufe nach, sein
Patron allbereit Todes verfahren wäre, er freywillig, ohne einigen Betrug, alles bekennen wolte. Hat also seine Geheim-Schrifft erkläret, darzu, was ihm sonst wissend, alles unverholen gebeichtet, und dardurch sein Leben gerettet, jedoch gleichwol, damit er nicht gantz ungestrafft bleibe, eine immer-währende Gefangnüß bewohnen müssen.‹
AdÜ
Dr. Gallois in seiner ›Geschichte der Stadt Hamburg‹ erwähnt dieses Vorfalls als eines Gewaltstreiches, den Friedrich III. sich in Hamburg erlaubte und der großes Aufsehen erregte, folgendermaßen: ›In Hamburg lebte der dort geborne
Dr. med. Otto Sperling, hochgeachtet als Arzt und sehr befreundet mit dem dänischen Reichshofmeister Corfitz Uhlefeldt, welcher ihm auch den Titel eines Hofmedicus verschafft hatte. Die Gemalin Uhlefeldt's, bekanntlich eine Tochter Christian's IV. aus der morganatischen Ehe mit Christine Munk, lernte von Sperling die lateinische Sprache, was ihn in die hochstehende adelige Familie zuerst eingeführt und bewirkt haben mag, daß er mit Uhlefeldt in beständiger Correspondenz blieb. Als nun letzterer durch die Sehestedtsche Kabale gestürzt und 1663 wegen angeblicher verrätherischer Correspondenzen abwesend zum schimpflichen Tode verurtheilt wurde, spürte man in seinen Briefen nach und entdeckte unter seinen Papieren in Chiffern geschriebene Briefe Sperling's, den man für den Mitwisser seiner Pläne hielt. Hagedorn, ein in Altona wohnender dänischer General-Adjutant und Obristlieutenant, mußte Sperling unter dem Vorwande, ihn zu seiner kranken Frau zu holen, in eine Kutsche locken und fuhr mit ihm aus dem Thore, wo dänische Soldaten ihn aufgriffen, ihn nach Glückstadt und dann nach Copenhagen brachten. Hamburg setzte einen Preis auf Hagedorn's Kopf, beschwerte sich und bewog auch Schweden, da Sperling Vicarius am Dom war, das nämliche zu thun; doch wurde hierauf keine Rücksicht genommen, sondern man machte Sperling den Proceß, begnadigte ihn aber zu lebenslänglichem Gefängniß, da er Alles gestand, was er wußte und auch seine Briefe bereitwillig entzifferte. Sein Sohn war der berühmte Alterthumsforscher und Polyhistor gleiches Namens.‹ gefangen hier in den Thurm geführet ward; sein Gefängniß ist unterhalb der Dunckeln Kirche. Sein Schicksal ist beklagenswerth. Als man ihn in den Thurm brachte, war er mit Eisen an Händen und Füßen gefesselt. Der Schloßv., so in früheren Zeiten nicht sein Freund war, freuete sich hertzlich über des
Docters Unglück und daß er in seine Hände gefallen war, so daß er den Abend nichts anderes that als trällern und singen; sagte zu dem Weyb: ›Meine Karne, wollet Ihr dantzen? Ich will singen.‹ Er ließ den
Docter die Nacht in seinen Eisen liegen. Aus dem murmeln und Zulauff des Volckes, sowie aus dem zuschließen seines Gefängnisses, das unter meinem war (wo Eisenriegel vor die Thür gelegt wurden), konnten wir vernehmen, daß ein gefangener eingeführt sey.
Selbiges Gefängniß ist draußen, in dem der Docter sitzt. Wo er sitzt, ist es ganz dunckel. Die Freude, so ich an dem Schloßv. wahrnahm, machte mir Furcht, desgleichen, daß er nicht allein meine Thür selber auff und zu machte, sondern auch das Weyb verhinderte, zur Treppe hinaus zu gehen, lehnte sich an die äußerste Thür von meinem Gefängniß. Der Kutscher stand hinter dem Schloßv., machte viele Zeichen; aber da der Schloßv. sich hin und her wendete, so konnte ich ihn nicht recht sehen. Am andern Tag gegen 8 Uhren hörte ich die eisernen Riegel und die Thür unten auff machen, konnte auch hören, daß das innerste Gefängniß geöffnet ward (da führte man den
Docter zum Verhör hinaus). Das Weyb sagte: ›Dar wird gewiß ein gefangener sitzen; wer kann es wol seyn?‹ Ich sagte: ›Es scheint wol so, daß ein gefangener eingeführet ist, sintemalen der Schloßv. so fröhlich ist. Ihr werdet es wol von Peder zu wissen kriegen, wenn auch nicht heute, so doch ein ander Mal. Ich beklage den armen, wer er auch seyn mag.‹ (Gott weiß, mein Hertz war nicht so freymüthig, wie ich mich anstellte). Als zu Mittag bey mir auff gemacht ward (was nach zwölff Uhr war, denn bevor der
Docter wieder hinein gebracht wurde, öffnete man nicht bey mir), da war der Schloßv. noch lustiger als gemeiniglich, tantzte vor sich selbst und sang: ›Lustig,
Curage! Es wird sich wol schicken!‹ Als er die Speise geschnitten hatte, lehnte er sich an die äußerste Thür von meinem Gefängniß und verhinderte das Weyb hinaus zu gehen, sagte zu mir: ›Ich soll Euch grüßen von dem Herrn
General Major von Alfelt; er sagt, es wird nu bald gut, Ihr sollt Euch nur zu Frieden geben. Ja, ja, nu wird es bald gut!‹ Ich that, als nähme ich es in dem Sinn auff, als die Worte waren, und bat ihn, den
General Major für seinen Trost zu dancken; und sintemalen er die selbigen Worte
repetirte und darbey sagte: ›Ja, fürwahr! das sagte er,‹ so erwiederte ich mit einer Frage: ›Wo mag doch das herkommen, daß der
General Major suchet alleweil mich zu erfrewen? Gott erfrewe ihn wieder! Ich habe ihn nie vorhin gekannt.‹ Der Schloßv. erwiederte gantz und garnichts darauff. Während der Schloßv. mit mir sprach, stand der Kutscher hinter ihm und erzählte, daß der gefangene an Händen und Füßen gebunden gewesen sey, daß er einen Bart hätte und eine
Calotte auff dem Kopff und ein Tuch umb den Hals. Das konnte mich nicht klüger machen, als ich war, aber mich noch mehr betrüben konnte es wol. Zur Abend-Mahlzeit war das Weyb auch verhindert, mit dem Kutscher zu sprechen, und machte der Kutscher wieder die selbigen Zeichen, denn der Schloßv. stand an der nämlichen Stelle, sprach aber nichts, ich auch nicht.
Umb den
Docter zu betrüben und zu erschrecken, öffnete der Schloßv. bey ihm früh Morgens, nachdem das Urtheil gefället war, und that, als ob der geistliche zu ihm kommen sollte. Am Morgen darauff ward der
Docter abermals zum
Examen hinauff geführt, und der Schloßv. verhielt sich wie früher. Als er dar fand und grübelte, fragte ich ihn, wer der gefangene unten sey. Er antwortete, es sey keiner unten. Darbey ließ ich es bewenden, und als wir dann über was anderes sprachen, schlich das Weyb sich hinaus zu Peder, der ihr in der Hast sagte, wer es sey. Es ging dann einige Tage in der selbigen Weise. Als das Urtheil über den
Docter gefällt war, und es sich mit der
Execution hinzögerte,
Als der Schloßv. in den ersten Tagen vor mir sang, sagte er: ›Du mußt auffsingen, du Vogel, wo ist dein samten Rock?‹ lachte darbey, was er nur konnte. Ich schloß aus dem Gesang, wer es seyn könnte. und ich nichts mit dem Schloßv. sprach, außer wenn er mit mir redete, kam er herein und sagte: ›Ich vernehme wol, daß Ihr könnt abmessen, daß ein gefangener dar unten sitzet. Das ist auch wahr, aber es ist verbothen, Euch zu sagen, wer es ist!‹ Ich antwortete: ›So begehre ich es auch nicht zu wissen!‹ Er fing an, einige
compassion zu bekommen, und sagte: ›Gebet Euch zu Frieden, mein liebes Frewlein, es ist nicht Ewer Mann, nicht Ewer Sohn, Tochter, Swager oder verwandter; es ist ein Vogel, der sollte singen, und er will nicht, aber er muß wol, er muß wol!‹ Ich sagte: ›Ich sollte wol können rathen aus aus Euer
discours, wer es ist. Kann der Vogel singen, daß in den Ohren kann klingen, so wird er es wol thun; aber die
Melodei, die er nicht weiß, wird er auch nicht singen können!‹ Darnach ward er still, wendete sich und ging hinaus.
Allmälig wurde es auch still mit dem Docter, so daß nichts mehr darüber gesprochen ward, und kam der Schloßv. dann und wann herein, wenn auffgeschlossen ward, und machte sich offt lustig mit dem Weyb, wollte, sie sollte Reverenz vor ihm machen, zeigte ihr, wie sie ihre Füße setzen und ihren Körper halten müßte, recht auff Tantzmeisters Art. Er erzählte auch verschiedenes, so in früheren Zeiten passiret war, einen Theil darvon zu dem Zweck, mich mit der Erinnerung an meinen früheren Wolstand zu betrüben: wie es bey meiner Hochzeit zuging, wie der sel. König mich geliebt hätte; erzählte gantze Geschichten darvon, vergaß nicht, wie ich gekleidet war, und alles das sagte er vor keinen andern als vor mich selbst, denn unterdessen stand das Weyb auff der Treppe und tratschte mit dem Thurmwächter, dem Kutscher und dem Gefangenen Christian.
Maren Blocks, die mich fleißig dann und wann grüßen und wissen ließ, was neues vorkam, gab mir auch zu erkennen, daß sie in der Meinung sey, ich könne zaubern; denn sie schrieb mir einen Zettel Peder hatte vor einiger Zeit 8 Ducaten in einem Papir zu mir herein geworffen, sagte, als er die Thür schloß: ›Ihr Kammerjungfer!‹ Und da das Weyb es wußte, gab ich ihr einen darvon und Peder einen. Ob mein Kammermädchen ihm mehre gegeben hatte, weiß ich nicht; sie hatte mehre bey sich verborgen. auff welchem stand, daß sie mich bäte, zwischen Jungfer Carisse und einem Alfelt Unfrieden zu stifften, mit großer Weitläufftigkeit, daß der Alfelt ihrer nicht werth sey, aber Skinckel sey ein braver Kerl ( Carisse verheyrathete sich später mit Skinckel). Da das Schreiben offen war, kannte der Kutscher dessen Inhalt, und das Weyb auch. Ich war flugs darüber erzürnet, aber sagte nichts. Das Weyb konnte es wol an mir mercken, daß ich es übel auff nahm, sagte: ›Frau, ich weiß wol, was Maren will.‹ Ich erwiederte: ›Könnet Ihr ihr darzu helffen?‹ ›Nein!‹ schwur sie und lachte hertzlich. Ich fragte, was daran zu lachen sey. ›Ich lache,‹ sagte sie, ›weil ich an die gewisse Cathrine dencke, von der ich früher erzählt habe, welche einmal einen Rath jemandem gab, der Zwietracht zwischen zween Männern stifften wollte, so gute Freunde waren.‹ Ich fragte, was das vor ein Rath war. Sie sagte, man müsse dorten Haare sammeln, wo zween Katzen sich gerissen hätten, und die Haare zwischen die beyden werffen, so man entzweyen wollte. Ich fragte, ob die Kunst ginge. Sie erwiederte: ›Es ward noch nicht recht versucht.‹ ›Vielleicht,‹ sagte ich, ›daß die Katzen nicht beyde schwartz waren?‹ ›Ho, ho!‹ sagte sie; ›ich höre wol, daß Ihr wisset, wie man es machen muß.‹ ›Ich habe mehr als das gehöret,‹ erwiederte ich; ›zeiget ihr die Kunst, so werdet Ihr wieder Zucker Candii kriegen, aber lasset Euch nicht wieder wie neulich von Peder dar bey foppen. Im Ernst gesprochen! Peder soll Maren Blocks bitten, sie möge mich mit solchen Begehren verschonen!‹ Daß sie sowol wie Maren in dem Gedancken war, ich könne häcksen, das gab sie auff vielerley Weise zu erkennen. Ich gab auch offt mit meiner Rede Anlaß darzu; dachte, wie mein sel. Herr zu sagen pflegte, (wenn er in seinen jungen Jahren jemanden weiß machen wollte, er verstünde die schwartze Kunst), daß sie den fürchten, von welchem sie diese opinion haben, und nicht wagen, ihm böses zu thun. Und geschah es eines Tages zur Mittags-Mahlzeit, als der Schloßv. drinnen bey mir saß und plauderte, daß das Weyb mit den anderen auff der Treppe einen langen Schnickschnack über die Häcksen führte, so man in Jütland ergriffen hatte, und daß der, welcher zur Zeit Land-Richter in Jütland war, es mit denen Häcksen hielt und sagte, es gäbe keine Häcksen. Als die Thür geschlossen ward, hatten wir genung über Häcksen zu plaudern, und sagte sie: ›Dieser Land-Richter ist von Euerer Meinung, daß es eine Wissenschafft ist und keine Zauberey. AdÜLandrichter in Jütland war damals Villum Lange. Merkwürdigerweise wird von ihm ein Brief aufbewahrt, worin eine Hexenangelegenheit besprochen wird und er sich im Ganzen recht vernünftig über Hexenwesen ausspricht, wenn er auch nicht eine so vollkommen vorurtheilslose Auffassung an den Tag legt, wie ihm hier zugeschrieben wird. Wolff, Grissenfeldt's Levnet. (Soph. Birket Smith' dän. Ausgabe.)‹ Ich sagte so, wie ich vorhin gesagt hatte, daß ein Part mehr Wissenschafft hätte als ein anderer Part, und ein Part brauchte seine Wissenschafft darzu, böses zu thun; obwol es natürlicher Weise geschehen könnte und nicht mit des Teuffels Kunst, so sey es doch nicht erlaubt in Gottes Wort, die Natur zu gebrauchen, umb darmit böses zu thun; es sey auch nicht billig, dem Teuffel die Ehre zu geben, so ihm nicht zukomme. Wir plauderten so lange, bis sie zornig ward, sich niederlegte, schlieff ein weniges; darmit war der Zorn vorbey.
Einige Tage darauff sagt sie: ›Euer Kammerjungfer, die unten in des Schloßvoigten Stube sitzet, fragt so fleißig nach Euch, und was Ihr thut. Ich habe Peder darvon erzählt, was Ihr genäht habt, und von den Bändern so Ihr macht, aber er hat mir zugeschworen, er wolle es keinem Menschen sagen außer Maren Lars Tochter; sie möchte so gern hier bey Euch seyn.‹ Ich erwiderte: ›Das würde ihr nicht nütz seyn, mit mir gefangen zu sitzen, würde nur ihr Glück verderben; denn wer weiß, wie lange ich leben kann?‹ Erzählte von selbiger meiner Kammerjungfer, daß sie seit ihrem 8. Jahr in meinem Brodt gewesen sey, was ich sie haben lehren lassen, und wie tugendsamb sie war. Darauff sagte sie: ›Das Mädchen will gerne sehen, was Ihr genähet habt; Ihr sollt es gleich wieder bekommen.‹ Ich reichte es ihr, und sie gab es beim ersten Mal als die Thüren geöffnet wurden, dem Schloßv., welcher es zur Königinn trug; (zwey Jahr darnach sagte der Schloßv. es mir selbst, und daß die Königinn geantwortet hätte, als der König sagte: ›Man mögte ihr wol was zu thun geben!‹ ›Das wäre nicht nöthig. Es ist ihr gut genung! Sie hat es nicht besser haben wollen).‹ Ich fragte offt nach dem genähten Stück, erhielt aber zur Antwort, daß Peder nicht im Stande sey, es von dem Mädchen zurück zu erhalten.
Gegen Spätherbst begann der Schloßv. zu siechen, ward krank und konnte nicht viel thun, ließ den Kutscher offt allein auff und zu schließen, sowol unten bey dem Docter wie bey mir. Die Eisenstangen wurden unten vor dem äußersten Gefängniß nicht mehr vorgelegt, aber bey mir wurden 4 Thüren geschlossen. Eines Tags, als Peder schließen sollte, warff er mir einen Strähn Seide Da mein Linnenzeug in der Gesindestube gewaschen ward, geschah es einmal, daß eine Magd dort un-versehens einen gantzen Flock Zwirn in einem reinen Hemd mußte vergessen haben, worüber ich zu dem Weyb sagte: ›Sehet Ihr, wie die Raben mir den Zwirn bringen!‹ Sie ward zornig und schimpffte; ich lachte und gab ihr Schertz zur Antwort. herein und sagte: ›Machet mir daraus einen Riemen vor meine Hosen!‹ Ich that so, als ob ich es nicht hörte, fragte das Weyb, was es war, so er sagte. Sie sagte mir die selbigen Worte. Ich that so, als ob ich es nicht glaubte, lachte darüber und sagte: ›Soll ich ihm das Band machen, so will er wol, daß Ihr ihm seine Hose zubindet.‹ Darüber war dann viel lächerliches Geschwatze. Als bald gegessen werden sollte, so sagte ich zu dem Weyb: ›Gebet Peder seine Seyde zurück und sagt, daß ich noch niemals einen Hosen-Riem gemacht habe; ich weiß nicht, wie man ihn macht‹ (so was mußte ich mit lachendem Mund entgegennehmen!)
Zur Zeit als unser früherer Hoff hier in der Stadt (auff welchen wir durch Urkunde Verzicht leisteten, als wir auff Borringholm gefangen saßen) nieder gebrochen, und eine Säule (oder was es ist) zu meines Herrn Schimpff auffgerichtet ward, kam der Schloßv. herein, als er Mittags auff machte, und setzte sich auff mein Bett (ich war damals etwas unpäßlich), begann von früheren Zeiten zu plaudern (ich wußte schon, daß man den Hoff abzubrechen begann), rechnete alles auff, wovon er meinte, das verloren zu haben mich betrüben könnte, sogar mein Caret und die Pferde. ›Aber‹ (sagte er) ›das alles ist nichts gegen den schönnen Hoff!‹ (strich ihn auff das herrlichste heraus;) ›der lieget nun darnieder, und ist kein Stein auff dem andern. Ist das nicht zu beklagen, mein liebes Frewlein?‹ Ich erwiderte: ›Der König kann mit dem seinigen machen, was er will; der Hoff ist eine geraume Zeit nicht unser gewesen.‹ Er fuhr fort und bejammerte das schöne Haus und die Wohnungen mit dem Gartten, so darbey war. Ich fragte ihn, wo der Tempel Salomonis wäre geblieben? Das schöne Gebäu, da wäre kein Stein von mehr zu finden; man wüßte nicht die Stelle zu weisen, wo der Tempel und das kostbare Königs-Haus gestanden. Er antwortete nicht ein Wort, ließ den Kopff hängen, grübelte und ging hinaus. Ich zweiffle nicht, daß er berichtet hat, was ich sagte. Seit dem Tag fing er an, sich mehr und mehr höfflich anzustellen, sagte auch, Se. Majt. hätt befohlen, er solle mich fragen, ob ich was aus der Küche, dem Keller oder von dem Zuckerbäcker begehrte, dann solle es mir gegeben werden; war auch befohlen, mir zweymal in der Woche Confect und Streu-Zucker zu geben, was auch geschah. AdÜDie folgende Fußnote ist die Verbesserung einer anderen, die im M. S. überstrichen ist; diese lautet folgendermaßen: – Der Streu-Zucker war in reinem Papier, dessen ich mich bediente, um darauf zu schreiben, was ich dichtete und notiren wollte; ich machte Tinte von Kerzen-Rauch, der von einem silbernen Löffel abgestrichen und mit Bier präparirt war. Meine Feder war aus einem Hennen-Flügel genommen; das Geräthschaft war ein Stück Feuerstein. Ich habe es noch in meiner Verwahrung. Ich schrieb verschiedenes aus der Bibel auff das Papir, in welchem der Zucker mir gegeben ward. Mein Dintefaß war das Stuck von einem zinnernen Deckel, so das Weyb gefunden hatte, die Dinte war von Kertzen-Ruß, mit einem Löffel auffgefangen, und die Feder aus einem Hennen-Flügel, mit dem Glasstück zu recht gemacht. Das habe ich noch aufbewahrt. Ich bat den Schloßv., Königl. Majt. vor die Gnade zu dancken, lobte, wie billig, auff das unterthänigste des Königs Güte. Der Schloßv. wollte die Königinn loben, hätte er nur etwas finden können; sagte: ›Die Königinn ist auch eine liebe Königinn!‹ Ich antwortete nichts darauff. Er kam auch einige Zeit darnach mit einem Befehl von dem König, daß ich begehren solle, was ich von Kleidern und Linnen haben wollte; das ward auff geschrieben, und ich erhielt es später, ausgenommen ein Schnürleib, das wollte die Königinn nicht zugestehen. Die Ursach darvon konnte ich nie zu wissen kriegen. Es war auch der Königinn nicht recht, daß ich ein Flaschen-Futteral mit sechs kleinen Flaschen bekam; darinnen war Schlag-Wasser, Kopff-Wasser und hertzstärckendes Wasser. Alles dies, sagte sie, könnte ich wol entbehren; aber es kam so, daß nämlich in dem Deckel ein Kupfferstich ist: des Herodes Tochter mit dem St. Johannis Haupt auff einer Schüssel, da lachte sie und sagte: ›Das wird ihr eine Hertzstärckung seyn!‹ Dieser Kupfferstich gab mir zu bedencken, daß Herodias noch Schwestern auff Erden hatte.
Der Schloßv. verblieb in seiner Feinheit, lieh mir auff Begehr eine deutsche Bibel, sagte darbey: ›Das thue ich aus gutem Hertzen, habe dessen kein Befehl; die Königinn weiß es nicht.‹ ›Das glaube ich‹ (erwiederte ich), und danckte ihm; aber ich bin der Meinung, daß der König es wol wußte. Einige Tage darnach ließ Maren Blocks ihr Gebet-Buch zurück fordern. Ich hatte das Weyb ein Morgen- und Abend-Gebet auswendig gelehrt und alle Morgen- und Abend-Seuffzer, die sie mir Abends und Morgens vorsagte. Ich erbot mich, sie lesen zu lehren, wenn sie sich ein Abc verschaffen wollte. Darüber lachte sie spöttisch und sagte: ›Die Leute würden dencken, ich sey doll, daß ich nu will lesen lernen.‹ Ich vermeinte, sie mit raison zu persuadiren, daß sie dann was hätte, die Zeit darmit zu vertreiben; aber weit davon: sie wüßte so viel, wie sie brauchte. Ich suchte überall nach etwas, umb mir die Gedancken zu verschlagen, und da ich gewahr ward, daß der Töpffer, als er den Ofen auffstellte, ein Stück Thon draußen in der andern Kammer liegen ließ, bat ich das Weyb, es mir zu geben. Der Schloßv. sah, daß sie es nahm, fragte aber nicht, wo zu. Ich präparirte den Thon mit Bier, machte verschiedenes, wovon offt etwas wieder umbgearbeitet ward; unter anderm den Schloßvoigt sein Bildniß und des Weybes Bildniß, kleine Krüge und Schaalen. Und da mir einfiel, zu versuchen, ob ich etwas zu machen im Stande wäre, worauff ich einige Worte an den König setzen könnte, so daß der Schloßv. es nicht merckte (denn ich wußte wol, daß das Weyb nicht schweigen würde; sie würde bald erzählen, was ich vor hätte), so formirte ich einen Becher über der Hälfte des Bechers, worin man mir den Wein gab, machte ihn unten rund, setze ihn auff drey Knöpfe und schrieb auff die Seite des Königs Namen. AdÜNach diesem Satz folgten einige Worte, die sorgfältig ausgestrichen sind und von welchen Hr. Birket Smith mit großer Mühe folgende erkannt hat: Unter dem Boden diese .... il y a un... (voyez?) un Auguste. Er meint, daß Leonora Christina sich während des Schreibens anders bedacht und den Satz nicht vollständig ausgeschrieben, sowie das wenige schon Geschriebene sorgfältig ausgestrichen habe. Er führt eine Stelle aus Leonora Christinens handschriftlicher Selbstbiographie an, in welcher die Geschichte mit dem Becher folgendermaßen erwähnt wird: Notre femme forme un gobelet sur un gobelet d'un demi pot, y met le nom du Roy & de la Reine, le met sur trois boutons, & au dessous le fond elle ecrit à la Reine. Ich hatte ihn eine Zeit lang und wußte nicht, auff welche Weise berichtet werden könnte, womit ich mich beschäfftigte, sintemal das Weyb so hoch und theuer geschworen hatte, es nicht zu erzählen; sagte eines Tags: ›Fragt der Schloßv. Euch nicht darnach, was ich mache?‹ ›Ja, gewiß that er es,‹ (erwiederte sie), ›aber ich sage, daß Ihr nichts thut als in der Bibel lesen.‹ Ich sagte: ›Ihr könnet Euch wol darmit beliebt machen und sagen, daß ich Bildnisse von Thon mache; das darff er wol wissen.‹ Sie that dies und drey Tage darnach kam er zu mir herein, war gantz mild und fragte, womit ich mir die Zeit vertriebe. Ich antwortete: ›Mit Bibel lesen.‹ Er meinte, daß ich davon auch müde würde. Ich sagte, ich möchte gerne inzwischen was anderes zu thun haben, aber ich dürfte ja nicht. Er fragte, wozu ich den Thon haben wollte, den das Weyb mir herein gebracht hätte; er hätte es wol gesehen, als sie ihn herein trug. Ich sagte: ›Darvon habe ich einige kleine Lappalia gemacht.‹ Er begehrte, sie zu sehen. Also zeigte ich ihm zuerst des Weybes Bildniß; das gefiel ihm sehr, da es ihr ähnlich war; dann einen kleinen Krug, und zuletzt den Becher. Er sagte stracks: ›Dieses alles will ich mit nehmen und lassen es dem König sehen; Der Schloßv. sagte mir später, daß die Sachen von Thon in des Königs Kunst-Kammer gesetzt seyen, darzu eine Rippe von einem Schaaf-Braten, die ich als Messer brauchte, so er auch dem König gab und vermeinte (wie er sagte) mir darmit ein Messer zu Wege zu bringen. vielleicht werdet Ihr alsdann Urlaub kriegen, etwas in den Händen zu haben für Zeit Verdreib.‹ Ich war wol zufrieden. Dieses geschah zur Mittags-Mahlzeit. Zur Abend-Mahlzeit kam er nicht herein. Am nächsten Tag sagte er mir: ›Ja, mein liebes Frewlein, Ihr hättet mich bald in Unglück gebracht!‹ ›Wie so?‹ (fragte ich). ›Ich habe dem König eine supplication von Euch gebracht! Die Königin wurd es nicht gewahr, aber der König sahe es strax und sagte: So! Bringst Du mir nu supplic. von Leonora? Ich erstarrete, sagte: Gnädigster König! Ich habe nichts schrifftliches gebracht! Sieh hier! sagte der König und wies mir, daß unter dem Boden des Bechers etwas französch stand. Die Königin fragte, warumb ich etwas geschriebenes auffbrächte, das ich nicht verstunde. Ich schwur, daß ich keine Achtung darauff gegeben, bat umb Gnade. Der gute König nahm mich in Verantwortung, und gefiel ihm die invention nicht übel. ›Ja, ja, mein liebes Frewlein! versichert Euch, daß der König Euch ein gnädiger König ist, und wäre er versichert, daß Euer Mann todt wäre, Ihr würdet hier nicht sitzen bleiben!‹ Ich war der Meinung, daß meine Widersacher wol wüßten, daß mein Mann todt sey. Ich mußte mich so in Gottes und des Königs Willen zu Frieden geben. Ich erhielt nichts, womit ich mir die Zeit hätte vertreiben können, ausgenommen das, so ich mir heimlich zuwendete, und fragte seitdem der Schloßv. niemals, was ich mache, aber er kam jeden Abend herein und saß lange und plauderte mit mir; war schwach und es kam ihn schwer an, die Treppen herauff zu steigen. Wir brachten so das Jahr zusammen hin.
Der Schloßv. bekam allmälig Mitleid mit mir, gab mir ein Buch, das gantz artig ist, Wunderwerck tituliret AdÜSonder Zweifel die deutsche Uebersetzung von Conr. Lycosthenes' Werk: Prodigiorum ac ostentorum chronicon. Der übersetzte Titel lautet, etwas abgekürzt, folgendermaßen: Wunderwerck oder Gottes vnergründtliches vorbilden, das er inn seinen geschöpffen allen ... erscheynen ... lassen. Auß Herrn Conrad Lycosthenis Latinisch zusammen getragener Beschreybung ... durch Joh. Herold ... Verteutscht. Basel, 1557. Fol. Das Buch handelt von Wundern jeder Art und ist recht unterhaltlich, nicht zum geringsten wegen der zahlreichen höchst naiven Bilder. (Soph. Birk. Smith' dän. Ausgabe.). Es ist in Folio, alt und hie und da entzwey, aber ich begnügte mich wol mit der Gabe. Und da er lange in den Abend hinein saß, manchmal bis 9 Uhr, und mit mir sprach, ärgerte sich das gifftige Weyb; Den Tag, als der Schloßv. das Thon-Zeug mit nahm, war das Weyb auff mich erzürnet, weil ich ihm einen kleinen Krug gab, den ich gemacht hatte; sagte, er sey ihr zum Spott gemacht: die alte Vettel mit den Krug! ich hätte ihm die Katze mit geben sollen, die ich auch gemacht hatte. (Ich sagte): ›Das kann noch geschehen.‹ sagte zu Peder: ›Wäre ich an des Schloßvoigten Stelle, so würde ich ihr nicht so wol trauen, wie er es thut. Er ist schwach; was, wenn sie nu hinaus lieffe und das Messer nähme, so draußen auff dem Tische lieget, und es ihm hinein stäche? Mir könnte sie wol leicht das Leben nehmen, da ich doch da drinnen sitze mit dem Leben an einem Faden.‹ Wie ungereimt die Rede auch war, so brachte sie doch zu Wege, daß nicht allein das Messer unter den Tisch gestecket ward, sondern der Schloßv. lange Zeit hindurch nicht zu mir herein zu kommen wagte, Zuerst, als die Furcht des Schloßv. so groß war, wagte er nicht in dem äußeren Raume allein zu seyn. Peder oder der Thurmwächter durfften nicht beyde von ihm gehen. Ich wußte nicht, was es bedeutete. setzte sich draußen vor meine äußerste Thür und schwatzte dort eben so lange wie zuvor, so daß es daran nicht fehlte (ich kriegte den Tratsch nicht eher zu wissen als nach drey Jahren, als der Gefangene Christian es erzählte, der damals des Weybes Geschwätz gehöret hatte). Einst, als der Schloßv. sich vorgenommen hatte, zum h. Nacht-Mahl zu gehen, stand er draußen vor meiner äußersten Thür und nahm seinen Hut ab, bat mich umb Verzeihung: er wüßte, daß er mir vieles zuwider gethan hätte, aber er wäre ein Diener. Ich antwortete: ›Hertzlich gern verzeihe ich es Euch!‹ Dann ging er weg, und Peder schloß die Thür; das Weyb sagte etwas zu Peder über den Schloßv., aber ich konnte es nicht recht verstehen. Sonder Zweiffel schalt sie auff den Schloßv., denn sie war so zornig, daß sie pustete; konnte den Zorn nicht an sich behalten, sondern sagte: ›Pfui über den alten Narren! Hol ihn der Teuffel! Ich sollte umb Verzeihung bitten? Nein, (schwur sie,) um Gottes bittern Tod wollte ich es nicht! Twi, twi!‹ und spuckte aus. Ich sagte später: ›Was gehet es Euch an, daß der Schloßv. mich umb Freundschafft bittet? Verlieret Ihr was darbey? Wollet Ihr nicht christlich leben und nach der Kirchen Ordinantz, so seyd wenigstens nicht zornig auff den, so es thut! Glaubet auch sicherlich, daß Gott Euch straffen wird, wenn Ihr nicht bereuet, was Ihr gethan habt, und Euch nicht mit Euren Widersachern versöhnet, bevor Ihr mit Gott Euch zu versöhnen trachtet!‹ Sie meinte, er habe nichts anderes gethan als das, so ihm befohlen sey. Ich sagte: ›Ihr guten Leute alle zusammen wisset selbst am besten, was Euch befohlen ist!‹ Sie fragte: ›Thue ich Euch was?‹ Ich antwortete: ›Ich weiß nicht, was Ihr thut. Ihr könnet mir so viel vorlügen, daß ich es selbst nicht weiß.‹ Darauff begann sie eine lange Geschichte, schwur und versuchte sich auff ihre Treue: sie hätte nie jemanden etwas vorgelogen noch jemanden was böses gethan. Ich sagte: ›Ich höre, Ihr machet Euch rein mit dem Pharisäer.‹ Sie erhob sich mit einer Furie von ihrem Sitz und sagte: ›Was? Scheltet Ihr mich einen Pharisäer?‹ ›Sachte, sachte!‹ (sagte ich); ›so lange nur einer von uns zornig ist, hat es nichts zu sagen; aber werde ich auch zornig, so möchte was anderes darauff folgen!‹ Sie setzte sich mit einer spöttischen Mine und sagte: ›Ich glaube wol, daß Ihr nicht gut seyd, wenn Ihr zornig werdet! Es wird von Euch wol gesagt, daß Ihr in früheren Tagen nicht viel ertragen konntet, sondern gleich schluget. Aber jetzt –‹ (darmit schwieg sie). ›Was mehr?‹ (sagte ich). ›Meinet Ihr, daß ich nicht jemanden etwas thun könnte, wenn ich wollte, so gut wie damals, wenn mir jemand was gethan hätte, so ich nicht leiden konnte? Jetzo viel eher! Sie brauchen mir ein Messer deswegen nicht zu versagen, weil ich Euch vielleicht morden würde; das kann ich mit meinen bloßen Händen thun. Ich kann den stärcksten Kerl mit meinen bloßen Händen erwürgen, wenn ich ihn un-versehens zu fassen kriege, und was könnte mir mehr geschehen, als mir geschicht? Deshalb gehabt Euch nur ruhig!‹ Sie schwieg still und machte keine Minen mehr, war betrübt, durffte sich nicht bei dem Schloßv. beklagen. Was sie zu denen auff der Treppe sagte, weiß ich nicht, aber als sie herein kam, als Abends geschlossen ward, hatte sie geweinet. Ziemblich lange nach diesem Streit hatte ich einen Streit mit ihr umb etwas Bier, das sie sich gewöhnt hatte auff den Fußboden zu gießen, sagte: das sollten die unterirdischen haben. Ich hatte ihr das verbothen, aber sie that es abermals, weshalb ich sie bey dem Kopf nahm und diesen mit meinen Händen zurück stieß. Sie kriegte einen Schreck, denn das ist gerade so als wenn der Kopf abfallen würde. Ich sagte: ›Das ist ein Vorschmack.‹ Am Sonntag, des Mittags, wünschte ich dem Schloßv. Glück und sagte: ›Ihr seyd glücklich! Ihr könnt Euch mit Gott vergleichen und sein Leib und Blut theilhafftig werden; das ist mir verbothen‹ (ich hatte zwey Mal in zween Jahren den geistlichen begehrt, kriegte aber jedes Mal zur Antwort: ich könnte nicht sündigen, da ich itzt gefangen säße; ich hätte keinen geistlichen nöthig). Und da ich etwas weitläufftig darüber mit dem Schloßv. redete, sagte ich, daß die, so mir Christi Nachtmahl vorenthielten, meine Sünden auff sich nehmen müßten; man sündigte sowol mit Gedancken, wie mit Worten und Thaten, weshalb der Schloßv. versprach, nicht von dem Begehren abzustehen, daß ein geistlicher zu mir kommen möchte; fragte, wen ich begehrte. Ich sagte: ›Des Königs Hoffprädikant, den ich im Anfang meiner Betrübniß hatte.‹ Er sagte: ›Das wird wol swärlich geschehen.‹ Ich war zufrieden, wer es auch seyn mochte. Einen Monat darauff empfing ich das h. Nachtmahl von dem deutschen Geistlichen M. Hieronimus Buk, der sich das erste Mal gantz anständig benahm, aber mehr über das Gesetz sprach als über das Evangelium. Der Schloßv. wünschte mir Glück, und ich danckte ihm, denn er hatte es mir zu Wege gebracht.
In diesem Jahr ließ der Schloßv. zu Pfingst-Abend Maj-Bäume in mein inneres Gefängniß, sowie auch in die Vorkammer setzen. Von den Aesten brach ich kleine Zweige, schabte die Rinde mit Glas ab, weichte sie in Wasser, legte sie in die Presse unter ein Brett, worauff man den Fußboden-Schmutz hinaus zu tragen pflegte, so daß sie flach wurden, setzte sie später zusammen und machte einen Weber-Kamm daraus. Peder Kutscher ließ sich dann überreden, mir ein wenig groben Zwirn zu geben, den ich als Auffzug brauchte. Die Seyde nahm ich von meinen neuen seydenen Strümpfen, so man mir gegeben hatte und machte mir breite Bänder daraus (das Geräthschafft und einen Theil der Bänder habe ich noch). Der eine Baum (der aus dem dicksten Ende eines Zweiges gemacht war, den Peder abgeschnitten hatte), war an dem Ofen fest gemacht, und den andern befestigte ich an meinem Leib. Das Weyb hielt mir den Auffzug; sie war zufrieden, und konnte ich nicht bemerken, daß sie was darvon sagte, denn der Schloßv. beklagte damals offt, daß ich nichts hätte, mir die Zeit zu vertreiben, und er wüßte doch, daß dies meine Freude in früheren Zeiten gewesen sey etc. Ich machte mir die Licht-Scheere zurecht, dar mit zu schneiden. Als Balcke zu mir kam und mir auff mein Begehr Zeug zu Unter-Hosen brachte und das Maß wissen wollte, sagte ich, ich wolle sie selbst nähen. Er lachte und sagte: ›Wer soll sie schneiden?‹ Ich erwiederte, ich könne es selber mit der Licht-Scheere. Das wollte er gerne sehen, sah es auch mit nicht geringer Verwunderung. Er blieb wieder eine lange Zeit nach den Mahlzeiten bey mir, da die Furcht ihm vergangen war, oder er konnte sich deren nicht mehr erinnern, denn das Gedächtniß begann, ihn im Stich zu lassen. Er erzählte dann allerley, was er nicht sollte. Er nahm merklich ab und ward sehr schwach, blieb dann später draußen sitzen und las laut, bat Gott umb sein Leben: ›Ja‹ (sagte er), ›nur etzliche Jahr!‹ Wenn er einige Erleichterung hatte, plauderte er immerfort; kroch an der Wand entlang bis zur Thür und sagte: ›Ich möchte zwey Dinge wol wissen! Das eine ist, wer nach mir sollte Schloßvoigt seyn. Das andere ist, wer meine Tyrelyre‹ (das war Tyre, sein Weyb) ›haben sollte.‹ Ich erwiderte: ›Das ist eine Wissenschaft, die Ihr nu nicht erfahren könnet, insonderheit wer Eure Fraw wieder freyen würde. Ihr könnet vielleicht beyde schon gesehen haben, aber Ihr könnet Alters halben noch lange leben.‹ ›O‹ (sagte er), ›Gott gebe das!‹ und sah zum Fenster hinauff. ›Meint Ihr das, mein allerliebstes Frewlein?‹ ›Ja, das meine ich‹ (erwiderte ich). Wenige Tage darauff bat er mich abermals umb Verzeihung, wenn er mir seit dem letzten Mal etwas zuwider gethan hätte, nu wolle er sich mit Gott versöhnen, ehe er schwacher würde, weinte und schwur, sagte: ›Für wahr, das schmertzet mir noch, daß ich habe Euch offt betrüben sollen, und Ihr tröstet mich.‹ Am Sonntag Mittag wünschte ich ihm Glück zu seinem geistlichen Mahl. So schleppte er sich mit großer Beschwerde durch etwan 14 Tage hin, und da ich vernahm, daß zween ihn die Treppe so gut wie herauff tragen mußten, ließ ich ihm sagen, daß er unten im Erdgeschoß des Thurmes bleiben möchte; er könnte versichert seyn, ich würde nirgends hin gehen. Er ließ mir dancken, kroch zum letzten Mal zu meiner Thür und sagte: ›Wann ich das thäte, und die Königinn erfuhr das, so wäre ich umb mein Hals.‹ Ich sagte: ›So gebet Eure Schwachheit zu erkennen und legt Euch zu Bette! Es kann wieder besser werden. Ein ander kann unter dessen für Euch auffwarten.‹ Da nahm er seine Mütze ab für den Rath und sagte mir Lebewohl. Seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehen. Einen Tag darauff kroch er in die Thurmstube, kam aber nicht weiter.
An seiner Stelle wurde einem mit Namen Hans Balcke befohlen, Obacht auff die gefangenen zu geben. Er war sehr fein. Er war seines Handwercks ein Tischler; sein Vater hatte während meines Wolstandes viel für mich gearbeitet, er war auch ein Tischler gewesen. Selbiger Mann war auff sein Handwerck in Italien und Teutschland gereiset, konnte auch etwas italiensch. An ihm hatte ich guten Umbgang, und da er im Thurm draußen in der Vorkammer speisete, bat ich ihn, bey mir zu speisen, was er auch 14 Tage lang that. Eines Tages, als er draußen den Braten geschnitten hatte, ließ ich ihn bitten, herein zu kommen. Er ließ sich entschuldigen; dieses kam mir wunderlich für. Nachdem er gespeiset hatte, sagte er, Peder Kutscher hätte ihn gestichelt, und es sey ihm verbothen, mit mir zu speisen. Wenn er später etwas lange bey mir fand und mit mir plauderte, bat ich ihn selber, er möge gehen, auff daß ihm dies nicht auch verbothen werde. Er hatte einmal eine sehr große Knopfnadel in seinen Aermel gesteckt, um die bat ich ihn. Er sagte: ›Ich darff sie Euch nicht geben, aber wenn Ihr sie selbst nehmet, so kann ich nichts darvor.‹ So nahm ich sie, und sie war mir seitdem offt zu Nutz. Er gab mir verschiedene Bücher zum lesen und war in jeder Weise höflich und fein. Seine Feinheit ist wol Ursach gewesen, daß die Gefängnisse ihm nicht lange anvertraut blieben, denn er war auch sehr gut gegen Doctor Sperling, gab ihm Stücke von dem Braten, der zu mir herauff kam, und andere gute Speise. Er war in seiner Kindheit Gespiele der Kinder des Docters gewesen. Er plauderte auch zuweylen lange mit dem Docter, sowol wenn er auffschloß als auch wenn er zuschloß, so daß es den Knechten nicht gefiel. AdÜHier folgte der später ausgestrichene Satz: – Außerdem gab es noch eine andere Ursache, weßwegen ihm nach Verlauf von 20 Wochen sein Amt abgenommen ward, was später gemeldet werden soll. So lange Balcke des Schloßv. Stelle versah, tranck er zu jeder Mahlzeit meinen Wein, was sonst der Thurmwächter, der Kutscher oder der gefangene Christian thaten, wenn der alte Schloßv. nicht mochte, so daß dieses auch darzu beitrug, Balcke zu vertreiben. Der Schloßv. lag beständig im Bette, bestrebte sich so offt er konnte, wieder auff zu kommen, aber es war wenig Aussicht darzu. So lange der Haupt-Schlüssel ihm nicht abgenommen war, gab er sich zu Frieden. Mein Kammermädchen, Maren Lars-Tochter, war bey Hoff so in Gunst gestiegen, daß sie offt oben im Frawenzimmer saß und allerhand verrichtete. Eines Tags sagt das Weyb zu mir: ›Das ist doch ein sehr getreues Mädchen, so Ihr habt! Sie spricht nu vor denen da oben, wie Ihr gar nicht glauben werdet.‹ Ich erwiederte: ›Ich habe ihr erlaubt, alles zu sagen, was sie weiß. Daß sie mich verleumden möchte, davor ist mir nicht bange.‹ ›Nicht?‹ (sagte sie spöttisch) ›Warumb mochte sie sich dann wol auff ihre bloßen Knie geworffen und sich verflucht haben, wenn sie wieder zu Euch ginge?‹ Ich sagte: ›Sie wollte ja selbst bey mir bleiben (nach Eurer eigenen Aussage), aber sie darff ja nicht; deshalb braucht sie sich nicht verfluchen.‹ ›Weshalb (sagte sie) ›meint Ihr denn, daß sie so gut bey Hoff angesehen ist?‹ ›Meinet Ihr,‹ sagte ich, ›daß, wenn jemand bey Hoff wol angesehen ist, es darumb sey, weil er Lügen im Munde führet? Ich bin sicher, daß mein Mädchen niemanden verleumdet, am wenigsten mich; dar bin ich nicht bange vor.‹ Das Weyb ward zornig und ließ deswegen lange das Maul hängen. Einige Wochen darauff ward Maren Lars-Tochter aus ihrem Arrest entlassen und wurde Kammer-Jungfer bey der Gfn. Friis; und brachte Balcke mir einiges Linnenzeug, so sie von meinem noch übrig hatte. Darob ärgerte sich das Weyb nicht wenig, insonderheit, als ich sagte: ›So trew, sehe ich doch, ist mein Mädchen mir noch, daß sie nicht das Leinzeug behält, wie sie leicht hätte thun können, denn ich konnte nicht wissen, ob es ihr nicht mit dem übrigen abgenommen ward.‹
Sehr übel zufrieden waren alle meine Wächter mit Balcke, insonderheit das Weyb, so sich wegen verschiedenem erzürnte, weil er sie verachtete, sagte sie, denn er hätte ihr einen Kessel für den Nachtstuhl gebracht, der schwerer war als der frühere (der leck war); aber am allermeisten, weil er ihr sagte, daß sie als ein Heyde lebte, sintemalen sie nicht zum h. Nacht-Mahl ginge. Denn als ich einmal, während Balcke mich bediente, das h. Nacht-Mahl nahm, da fragte er sie, ob sie nicht auch communiciren wollte, worauff sie antwortete: ›Ich kann nix teutsch.‹ Balcke sagte: ›Ich werde es so einrichten, daß der geistliche zu Euch komme, so Lohn davor kriegt, daß er den gefangenen das Nacht-Mahl reichet.‹ Sie erwiderte, daß sie an diesem Ort nicht mit rechter Andacht gehen könne; käme sie hinaus, so wolle sie gern. Balcke predigte ihr, wie ein geistlicher es nur hätte thun können, auff das schärffste. Als die Thür geschlossen war, ging ein pusten und blasen los, und knüpffte sie allzeit ihr Wamms auff, wenn sie zornig war. Ich sagte nichts, aber dachte, nu bricht das böse wol aus, sonst erstickt sie; was auch geschah, fluchte Balcke mit dem ärgsten, was ihr nur einfiel. Sie hatte unerhörte Flüche, so daß es grewlich zu hören war, unter anderen diese: ›Gott verdamme ihn auff ewige Zeit, dann brauche ich ihn nicht jeden Tag zu verfluchen!‹ Item: ›Gott laß ihn verdunsten wie den Thau vor der Sonne!‹ Dieses fluchen konnte ich nicht ausstehen, sagte: ›Verfluchet Ihr den Mann, weil er Euch Gottes Wort fürhält und will, daß Ihr Euch mit Gott versöhnen und Eure Sünden berewen sollt?‹ ›Ich fluche ihm nicht darumb‹(sagte sie) ›aber von wegen dem schweren Kessel, den der verdammte Kerl mir gegeben hat und den ich die steile Treppe Das ist auch eine böse Treppe, dar auff bis zur Stelle zu kommen, wo der Nachtkessel ausgegossen wird. hinauff tragen muß, da soll doch der Böse in ihn fahren! Will er aus sich auch einen Priester machen? Ja, er ist wol ohne Fehl, der lumpige Gast!‹ fing von vorne an zu fluchen. Ich schalt sie aus und sagte: ›Was, wenn er nu wüßte, daß Ihr ihm so fluchet, meinet Ihr nicht, er werde es zu Wege bringen, daß Ihr beichten müßtet? Es sind fast zwey Jahr, daß Ihr nicht an Gottes Tisch waret, und Ihr könnt den geistlichen haben und Ihr wollet nicht!‹ Das besänftigte sie ein wenig, und sagte: ›Wie sollte er es zu wissen kriegen, außer Ihr saget es ihm?‹ Ich sagte: ›Was hier drinnen geschicht und gesagt wird, gehet keinen was an außer uns zwey; es ist nicht vonnöthen, daß andere es wissen.‹ Darmit war es gut; sie legte sich schlaffen, da verging der Zorn, aber der Haß blieb immerfort.
Der Schloßv. lag so hin in großer Pein, konnt weder leben noch sterben. Eines Mittags, als Balcke auffschloß (was just 20 Wochen war, nachdem er zu mir gekommen war), kam mit ihm ein Mann herein, sehr schlecht gekleidet, in einem grauen, zerrissenen, fettigen Rock mit wenigen Knöpffen, die man zuknöpffen konnte, mit einem alten Hut, worauff eine hängende Feder saß, so weiß gewesen, aber für Schmutz nicht zu kennen war. Er hatte zween leinene Strümpffe an und ein Paar sehr verschlissene Schuhe, die mit Bindtfaden auff gebunden waren. Gabel hatte gesagt (wie mir später berichtet ward), daß ich mich vor dem Mann erschreckt und gemeinet habe, er sey der Büttel. Ich sah ihn nicht davor an, wol aber vor einen verarmten Ritter; meinte, er solle den Dienst thun, welchen Peder Kutscher versah. Balcke ging an den Tisch draußen und schnitt den Braten; ging dann vor die Thür der äußeren Kammer, standt mit seinem Hut in der Hand, machte eine Reverentz und sagte: ›Hiermit nehme ich meinen Abscheid; dieser Mann soll Schloßv. seyn.‹ Ich fragte, ob er nicht wieder zu mir käme. Er erwiderte: ›Nein, nicht vor dies Mal.‹ Darauff danckte ich ihm für seine höffliche Bedienung und wünschte, daß es ihm wol gehen möge. Peder Kutscher schloß die Thür zu, und der neue Schloßv., welcher Johan Jäger hieß, ließ sich den ganzen Tag nicht vor mir sehen, auch des Abends nicht. Ich sagte dem Weyb am Morgen: ›Fraget Peder, wer der Mann ist‹ was sie auch that; kam mit der Antwort zu mir, daß es derjenige sey, der den Docter gefangen genommen habe; AdÜNeben der Note ist noch eine andere im M. S. ersichtlich, die doch später ausgestrichen ist. Sie lautet folgendermaßen: Balcke hat mich 20 Wochen bedient, und er ward angeklagt, daß er mir gesagt habe, was Neues passirte. Dies sollte dadurch bewiesen werden, daß er mir erzählt hatte, Gabel sei Statthalter geworden, den ich dann später vor M. Buck so titulirte. Balcke konnte sich eines Tages für lachen nicht halten, denn während er stand und mit mir sprach, standen das Weyb und das Mannsvolck draußen auff der Treppe und kicherten und lachten; und sagte er: ›Da draußen ist der Tratsch-Markt! Warumb richtet Peder es nicht so ein, daß es verbothen wird: Ihr könnet wol zu wissen kriegen, was passiret, ohne mich.‹ und itzt sollte er Schloßv. seyn, aber noch hätte er nicht den Hauptschlüssel bekommen. Es dauerte nicht viele Tage, als er mit dem Hoffmarschalck zu dem alten Schloßv. kam, und da wurde der Schlüssel dem alten genommen und ihm gegeben. Der alte lebte nur bis zu dem Tag darauff; befriedigte in beiden Theilen seine curieusité: sah den, so Schloßv. nach ihm ward (zu seiner Betrübniß), und der Docter, welcher ihn curiren sollte, bekam seine Tyrelyre, ehe das Jahr zu Ende war.
Der neue Schloßv., Jäger, begrüßte mich etzliche Wochen lang nicht, sprach auch nicht mit mir. Er schloß selten meine Thüren zu, aber meistens machte er sie selbst auff. Endlich, als er Schuhe auff die Füße kriegte, nahm er seinen Hut ab, als er auff geschlossen hatte, und sagte: ›Guten Morgen!‹ Ich danckte ihm mit vielem Danck. Zu dieser Zeit war das Weyb sehr lustig. Sie hatte ihren freyen Tratsch mit Peder Kutscher (der nach einigen Monaten wieder wie früher auff den Thurm kam) und mit dem gefangenen Christian, der große Freyheit hatte und zu dieses Schloßvoigts Zeit mehr und mehr Freyheit bekam, fürnehmlich als Raßmus Thurmwächter Pförtner ward, und einer mit Namen Chresten an dessen Stelle kam. Unter anderm Schnickschnack, den sie vor mir führte, sagte sie, daß diesem Schloßv. verbothen sey, mit mir zu sprechen. Ich sagte: ›Das ist mir sehr lieb, dann kann er mir nichts vorlügen,‹ (ich bin der Meinung, daß er nicht mit mir sprechen durffte, so lange Peder die Speisen auff den Thurm trug und dort diente; denn als er Peder wegen Dieberey, wobey dieser ertappt ward, abgeschafft hatte, kam er später dann und wann herein. Das erste Mal hatte er einen Rausch.) Er wußte, was Peder von Balcke gesagt hatte, was er mir berichtete. Während Balcke mich bediente, ward ein Klapp-Tisch angebracht, das Brod und die Becher darauff zu setzen, wie auch des Weybes Essen, die zuerst aß, sobald die Thüren geschlossen waren. Früher war nichts da, als der Nachtstuhl, umb die Speisen darauff zu setzen; der war des Weybes Tisch.
Bevor ich etwas melde von den Anschlägen Christians, des gefangenen, gegen mich, will ich mit wenigen Worten seine Missethat berichten, umb deren willen er gefangen war. Er hatte Maans Arnfelt als Lacquey gedienet. Er mit anderen Lacqueyen fingen Streit mit einem Mann an, so dem Christian ein Vater gewesen war und ihn von seiner Jugend an auffgezogen und allzeit Sorgfalt vor ihn gehabt hatte. Der Mann ward tödtlich verwundet, rieff in seiner Todsnoth: ›Gott straffe dich, Christian, was vor ein Sohn bist du! Deine Hand hat mich getroffen!‹ Die anderen Lacqueyen lieffen jeder seines Wegs, aber Christian ward ergriffen. Sein Degen wurde blutig befunden. Er leugnete allweil, daß nicht er es war, so den Mann stach. Er ward zum Tod verurtheilt; aber da des todten Mannes Wittib die Execution nicht bezahlen wollte, blieb Christian einstweylen gefangen sitzen, und sein Juncker bezahlte vor ihn den Unterhalt. Drey Jahre saß er schon, ehe ich in das Gefängniß kam, und drey Mal ward er anderswo hin gebracht; zuerst aus dem Kerckerloch in die Dunckle Kirche, später hierher, wo ich sitze. Damals war hier ein großes doppeltes Fenster mit Eisen-Gittern, das zugemauert ward, als ich herein sollte; und erzählte später Christian, wie die Mägde in der Vorrathskammer ihm manchen Krug Bier zugeschantzt hätten, den er mit einer Schnur herauff zog. Als ich hierher geführet ward, wurde er hingesetzet, wo der Docter ist, und als der Docter eingeführt war, ging Christian seitdem frey im Thurm herumb, zog für den Thurmwächter das Seygerwerck auff, schloß bey den gefangenen unten auff und zu, ja hatte sogar offt die Schlüsseln des Thurms. Ich erinnere mich auch itzt, daß der Thurmwächter Raßmus einmal bey dem alten Schloßv. zu Mittag in meiner äußersten Kammer saß und der Schloßv. Peder mit einem Aufftrag wegschicken wollte; sagte zu Raßmus: ›Gehet hin und macht auff! Peder soll was bestellen.‹ ›Vader‹ (sagte Raßmus), ›Christian hat den Schlüssel.‹ ›So!‹ (sagte der Schloßv.) ›Das ist hüpsch!‹ Und darbey blieb es, denn Raßmus sagte: ›Ich bin wol sicher, daß Christian nirgends hin geht.‹ So nahm nach und nach Christians Freyheit und Gewalt zu, seit Peder Kutscher fort kam, und bediente diesen Schloßv. bey Tisch in meiner äußersten Kammer.
Eines Tags, als das Weyb von oben herunter kam, wo sie den Nacht-Kessel gereiniget hatte, und die Thüren geschlossen waren, sagte sie zu mir: ›Dieser Christian, der hier ist, hat mit mir da oben gesprochen. Er kann es garnicht beschreiben, wie elend es dem Docter gehet, wie hart er gefangen sitzt, und was vor schlechte Speisen er kriegt, seit Balcke weg ist. Er hat nicht länger Licht, als die Mahlzeit währt, und keine Beleuchtung außer durch das Loch in seiner Thür, so in die äußere Kammer geht. Er bat mich, daß ich es Euch sagen möchte; die Thränen kamen ihm in die Augen, so großes Mitleyd hatte er mit ihm.‹ Ich sagte: ›Das ist auch alles, was man thun kann, und es ist christlich, mit seines Nächsten Unglück Mitleyd zu haben. Der arme Mann muß sich gedulden so gut wie ich, und wir müssen uns mit einem guten Gewissen trösten. Je härter er leidet, je eher nimmt es ein Ende; er ist ein alter Mann.‹ Zween Tage darauff kam sie wieder mit einem Tratsch von Christian; der Docter ließe mich grüßen, und er frage so fleißig, ob ich gesund sey; sagte ferner: Christian würde ihm wol geben, was ich ihm sendete. Ich nahm das als eine Versuchung an, sagte endlich, daß Christian ein Stück von dem Braten nehmen könnte, wenn der Schloßv. bey mir sey, und er sollte sich nach etwas umbsehen, wo man Wein hinein gießen könnte, dann könnte sie ihn insgeheim aus meinem Becher hineingeben und Christian bitten, den Docter zu grüßen. Das ward angenommen, und hatte ich einige Tage Ruh. Christian richtete sich sehr nach dem Weyb, veranstaltete auch Zwist zwischen ihr und dem Thurmwächter, machte es gleich wieder gut, so daß es an Tratsch nicht fehlte. Endlich sagte sie einmal: ›Das ist doch ein ehrlicher Kerl, dieser Christian! Er hat mir erzählt, wie unschuldig er in das Gefängniß gekommen und verurtheilet ist. Er ist bange, daß Ihr dencken möchtet, er äße und träncke das, so Ihr dem Docter schicket. Er schwur mit seinem höchsten Eid, daß er Euch trew seyn werde, wenn Ihr dem Doctor ein Wort schreiben wollet. Christian hatte mir etliche Stücke Feuerstein gegeben, die so scharff sind, daß ich seine Leinwand darmit nach dem Faden schneiden kann. Die Stücke sind noch in meiner Verwahrung; und machte ich unterschiedliche Arbeit mit diesem Geräth fertig. An meiner Trewe, hoffe ich, zweiffelt Ihr nicht!‹ fing an, sich zu verschwören und verfluchen, wenn sie mich betrügen würde; sagte, er hätte ihr keine kleineren Eide geleistet, ehe sie ihm glaubte. Ich sagte: ›Ich habe ihm nichts zu schreiben, ich weiß nicht, was ich schreiben sollte.‹ ›O‹, sagte sie, ›schreibet nur zween Worte, auff daß der alte sehen möge, daß er ihm trawen kann! Wollet Ihr Dinten haben, so kann Christian sie Euch wol geben.‹ Ich erwiederte: ›Ich habe was, umb darmit zu schreiben, wenn ich will, und ich kann ohne Dinten und Papir schreiben.‹ Das konnte sie nicht begreiffen. Da nahm ich etzliche Stücke Zucker-Mandeln und machte mit der großen Knopffnadel Buchstaben darauff, setzte auff 4 Mandeln die Wörter: non ti fidar! von fidar setzte ich die Hälffte des Wortes auff je eine Mandel. Ich hatte auff diese Weise einen Tag Ruhe und etwas, die Zeit darmit zu vertreiben. Ob nu der Doctor nicht sehen konnte, was auff denen Mandeln geschrieben stand, oder ob er Christians Trewe prüfen wollte, weiß ich nicht, aber Christian brachte dem Weyb einen Zettel von dem Docter an mich, voll von Lamentationen über unseren Zustandt, und daß meine Tochter Anna Cathrina oder auch Cassetta Ursach seines Unglücks seyen. Darüber wollte ich mehr wissen, begehrte es schrifftlich von ihm (wir schrieben einander auff italiensch.) Er antwortete, daß die eine oder der andre seinen Brieff auff dem Tisch irgendwo hätten liegen lassen, wo er gefunden und dann abgesendet ward; denn ein Schreiben von ihm war Ursach seines Unglücks. Ich schrieb ihm zurück, daß es nicht glaublich sey, sondern daß susspiciret war, er correspondirte mit meinem Herrn, und daher auff seine Brieffe gefahndet ward. Je mehr ich ihm dies zu raison führen wollte, desto mehr opiniastre ward er darin, Das ist ihm angebohren. und schrieb später, dies wäre Cassettae finesse, ihn in das Netz zu kriegen, umb mich da heraus zu bringen. Als er auff diese Art zu schreiben anfing, bekam ich eine sonderliche opinion von ihm, gerade als wollte er mir etwas heraus locken, umb es vorzuweisen; bedachte mich einige Tage, ob ich antworten solle. Endlich antwortete ich in dem Sinn, niemand wüßte besser als er, daß mir von keiner Verrätherey wissentlich sey; wie seine Correspondentz mit meinem Herrn kundt geworden sey, das könnte ihm nicht helffen; wozu er verurtheilt sey, wüßte ich nicht, über mich sey kein Urtheil gefällt. Es dawerte etzliche Wochen, ehe der Docter schrieb. Endlich theilte er mir mit wenigen Worten die Sentenz über ihn mit, und wir correspondirten dann und wann mit einander.
Der Schloßv. ward nach und nach umgänglich, kam zu jeder Mahlzeit herein und erzählte allerhand Possen und Narretheydinge, was er in seiner Jugend getrieben, wie er Trommel-Schläger gewesen sey und sich vor meinem Schwager Gf. Pentz zum Narren gemacht habe AdÜGraf Christian Pentz, Commandant von Glückstadt, derselbe, welcher 1644 den Hamburgern vorwarf, daß sie schlechte Neutralität hielten und die Schweden mit Zufuhr und Munition versorgten. (Gallois; Geschichte der Stadt Hamburg.) Vgl. das Verzeichniß der Kinder Christian's IV. und Kirsten Munk's weiter unten., und wie er vor Geld und Gunst den Hund spielte und unter den Tisch kroch, erschreckte die Gäste und biß sich vor einen Ducat mit einem Hund. Wenn er einen Rausch hatte (was offt war), so gauckelte er, machte Pussinel aus sich, zuweylen Wahrsagerinn und dergleichen. Als Chresten Thurmwächter und Christian, der gefangene, vernahmen, daß der Schloßv. Possen trieb, machten sie es eben so, lärmten mit dem Weyb in der Vorkammer, so daß wir unser eigen Wort nicht hören konnten. Sie saß auff Christians Schooß und benahm sich sehr leichtfertig. Eines Tags war sie etwas unpäßlich, machte sich ein Warmbier, setzte es draußen auff das Feuerfaß. Der Schloßv. saß drinnen bey mir und plauderte; Chresten und Christian schäkerten mit ihr da draußen, und Christian sollte das Warmbier umrühren und schmecken, ob es warm genung wäre. Chresten sagte zu Christian: ›Trinck es aus, wenn dich dürstet.‹ Die Worte waren nicht so schnell gesagt, wie die That geschehen war, und fast zur selben Zeit standt der Schloßv. auff und ging weg. Als die Thür geschlossen war, wollte das Weyb fast unmächtig werden. Ich meinte, es sey vor Kranckheit und war angst, sie möchte schnell sterben, und daß mir die Schuld an ihrem Tod auffgebürdet werden würde, fragte hastig: ›Ist Euch übel?‹ Sie antwortete: ›Mir ist übel genung,‹ bekräfftigte es mit einem schweren Fluch, begann, ihr Wamms auff zu knöpffen. Da sah ich, daß sie zornig war, wußte wol, daß die Vermaledeyungen ihrem Hertzen Lufft machen würden, was auch geschah. Sie verfluchte und schalt die, welche sie arme krancke so genarret hätten, es wäre ihr so übel, hätte den gantzen Tag keinen warmen Löffel im Leibe gehabt. Ich sagte: ›Gebet Euch zufrieden, Ihr werdet schon ein Warmbier kriegen!‹ Sie schwur einen großen Eid, wo sie das her kriegen sollte? es wäre Sommer-Tag und kein Feuer im Ofen, und man könnte nicht jemanden rufen, der einen hören möchte. Ich sagte: ›Könnet Ihr schweigen, so will ich den Topff zum kochen bringen.‹ ›Ja, (schwur einen schrecklichen Eid) ich kann wol schweigen, und werde es nimmer sagen.‹ Darauff ließ ich sie drey Stücke Ziegelsteine nehmen, so allzeit hinter dem Nacht-Stuhl lagen, und auff diese ihren Topff mit Bier und Brodt setzen (alles was sie thun sollte, mußte schweigend geschehen; sie durffte mir, wenn ich umb was fragte, nicht mit Worten antworten, wol aber mit Zeichen). Sie setzte sich neben den Topff und rührte mit einem Löffel darin. Ich saß immer am Tage auff meinem Bett und dann ward der Tisch vor mich gestellt; hatte ein Stück Kreyde und schrieb allerley auff den Tisch, fragte dann und wann, ob der Topff schon koche. Sie guckte fleißig hinein und schüttelte mit dem Kopff. Als ich drey Mal gefragt hatte, und sie sich zu mir wendete und sahe, daß ich lachte, da geberdete sie sich wie eine Tolle, warff den Löffel aus der Hand, den Stuhl überkopff, riß abermals ihr Wamms auff und sagte: ›Der Teuffel mag so gefoppt werden!‹ Ich sagte: ›Etwas besseres seyd Ihr nicht werth, da Ihr glaubet, daß ich zaubern kann.‹ ›O! (schwur einen schweren Eid), hätte ich nicht geglaubt, daß Ihr zaubern könnet, so hätte ich mich niemals mit Euch einsperren lassen, wisset Ihr das?‹ Ich dachte nach, was man darauff antworten könnte, sagte aber nichts, lachte insgeheim und ließ sie austoben. Später weinte sie und beklagte sich sehr. ›Nu nu‹ (sagte ich). ›gebet Euch zu Frieden! Ich werde den Topff ohn Häckserey zum kochen bringen.‹ Und da wir Feuerzeug hatten, befahl ich ihr, Feuer zu schlagen, und drey Stück Licht-Enden anzuzünden und unter den Topff zu setzen. Darvon kochte der Topff, und sie küßte ihre Hand und warff mir zu, war sehr froh. Ich gab ihr auch später ein oder zwey Mal Urlaub, sich auff diese Weise Bier zu wärmen; alleweil konnte es nicht geschehen, denn wenn der Wind auff das Fenster stand (das mit einer langen Pike zu öffnen war), so konnte der Rauch nicht hinaus ziehen. Ich sagte: ›Dencket an Euren Schwur und plaudert nicht aus, was hier geschicht, sonst werden uns die Lichter weggenommen; zum wenigsten werden wir deren etzliche verlieren.‹ Sie sagte fest: nein, das solle nicht geschehen. Ich vernahm damals nichts darüber, wol aber viele Jahre später, daß sie gesagt hatte, ich hätte zween halb-lose Fußboden-Steine auffgenommen (was dann von einem geistlichen anders berichtet ward, wie später gemeldt werden soll). Sie hatte auch erzählt, daß ich auffgestiegen wäre und hätte den Seil-Täntzern auff dem Schloßplatz zugesehen, was wahr ist. Denn als Chresten eines Mittags dem Weyb sagte, daß auff dem innern Schloßplatz Seil-Täntzer sich würden sehen lassen, und sie mir dies berichtete und fragte, wie das wäre, und ich es ihr sagte, beklagte sie sich, daß sie es nicht zu sehen kriegen könnte. Ich sagte, das könnte wol geschehen, wenn sie später den Mund halten wollte. Sie schwur wie gewöhnlich ja mit einem Eid. Darauff ließ ich das Bettzeug aus dem Bett nehmen und die Bretter aus dem Boden und das Bett vor dem Fenster aufrecht stellen und den Nacht-Stuhl oben darauff. Um auff die auffgerichtete Bettstatt zu kommen, ward der Tisch an die Seite gesetzet, und ein Sessel an den Tisch, um auff den Tisch zu kommen, und ein Sessel auff den Tisch, um auff den Nacht-Stuhl zu kommen, und ein Sessel auff den Nacht-Stuhl, so daß wir gemächlich flehen und schauen konnten, aber nicht beide zugleich. Und ließ ich sie zuerst hinauff steigen, und ich fland und gab Acht, ob das Bett zu krachen anfing; sie sollte dafür Wache stehen, wenn ich oben war. Ich wußte auch wol, daß die Täntzer im Anfang nicht ihre besten Künste machten. Die Seil-Täntzer machten etwas, so ich früher nie gesehen hatte. Der eine hatte einen Korb an jedem Bein, in jedem Korb saß ein Jung von 5 Jahren, und ein Frawenzimmer ließ sich auff das Seil fallen und sprang wieder auff. Aber zur Zeit des anderen Weybes sah ich einen, der sich mit seinem Kinn auffhängte und wieder auff das Seil sprang. Ich konnte dem König und der Königinn in die Augen sehen; sie standen in dem langen Saal, und wunderte ich mich später, daß sie das Auge nicht auff die Stelle richteten, wo ich stand. Ich ließ es mir vor dem Weyb nicht mercken, daß ich sie sah. Zur Zeit dieses Weybes bekam ich einmal Lust, die Leute in die Schloß-Kirche gehen und wieder aus der Kirche kommen zu sehen. Da ward das Bett wieder auffgestellt, und ich saß lange dar oben, bis alle wieder aus der Kirche waren. Das Weyb wagte nicht, auff zu steigen, sagte, daß sie voriges Mal bange genung war und froh, als sie unten wieder ankam.
Das erste Mal, als ich zu dieses Schloßv. Zeit communicirte, wurden zween Messing-Leuchter auffgestellt, ein jeglicher in seiner Art, mit Talg-Lichtern. Das hat dem Weyb mißfallen, gleichwol sagte sie nichts zu mir. Aber als sie endlich zu beichten genöthiget war nach mehr als drey Jahren, die sie von dem Tisch des Herrn sich fern gehalten hatte, bat sie Chresten Thurmwächter, zu ihrer Tochter zu gehen (die in der Stadt einem Zimmermann diente), auff daß sie ihr ein Paar schöne Messing-Leuchter und ein Paar Wachs-Kertzen leihe. Könnte sie ihr auch ein feines Drillich-Tuch verschaffen, so möchte sie ihr bestes thun; sie wolle es bezahlen. Ob das Weyb früher an Leuchter und Licht gedacht hatte, so mir vorgesetzet wurden, oder ob es Chresten selbst dünckte, daß es nicht schicklich wäre, für sie besser herzurichten, weiß ich nicht, aber ehe der Priester kam, schloß Chresten die äußerste Thür meines Gefängnisses ab, sagte: ›Karen, reichet mir den Leuchter heraus und die beyden Lichter!‹ Wie sie sich geberdete, ist nicht zu beschreiben: ob er nicht mit ihrer Tochter gesprochen habe? und vieles dergleichen (ich wußte damals nicht, was sie von Chresten begehrt hatte). Er antwortete ihr nichts auff ihre Frage, forderte den Leuchter und die Kertzen. Sie wollte lange nicht, sondern fluchte und schalt. Ich lag noch und fragte sie: ob ich ihre Magd seyn und es vor sie thun sollte? ob sie ihm vorenthalten könnte, was er begehrte? So reichte sie es ihm denn durch das Loch der äußersten Thür mit so vielen Verfluchungen gegen ihn, daß einem davor grawen mußte. Er lachte laut und ging weg. Das machte sie noch viel grimmiger. Ich that mein bestes, sie zu besänftigen, sagte ihr, daß solches eine verdammliche Vorbereitung sey, hielt ihr die Sünde gantz weitläufftig vor. Sie meinte, daß der Sünde beginge, der die Ursach darzu gebe. Ich fragte sie endlich: worin das h. Nacht-Mahl bestände? ob es in Leuchtern und Lichtern bestände? schalt sie aus, daß sie auff das äußere und nicht auff das inwendige sehe; bat sie, auff ihre Knie zu fallen und Gott hertzlich umb ihrer Sünden Vergebung zu bitten, daß er ihr nicht ihre Thorheit anrechnen möge. Sie antwortete, daß sie dies thun wolle, that es aber nicht gleich. Ich meine, daß der geistliche Das war der geistliche, so die gefangenen versah, und da sie in der Vorkammer versehen ward, so hörte ich jedes Wort, das der geistliche sagte, aber nicht, was sie erwiederte. wol über alles, was sie betraff, von Chresten unterrichtet war, denn er fragte sie nur: wo sie geboren sey? wo sie gedienet habe? und solches mehr; später: ob sie ihren Beicht-Zettel habe, und wie lange es her sey, daß sie zum h. Nacht-Mahl war? Darauff nahm er ihr die Beichte auff eine sonderliche Weise ab, zuerst wie jemandem, so für grobe Sünden Rede zu stehen hatte, dann wie einer Sünderin, welche Todesstraffe erleiden und sich zum Tode vorbereiten sollte; tröstete sie endlich und verrichtete sein Ambt. Da alles fertig war, und sie zu mir herein kam, wünschte ich ihr Glück. ›Ja wol, Glück!‹ (antwortete sie) ›kann da Glück bey seyn? Darvon habe ich mehr böses als gutes! Für wahr, könnte ich heraus kommen, so wollte ich stracks zum h. Nacht-Mahl gehen; dieses achte ich vor nichts!‹ Ich fiel ihr gleich in das Wort und sagte: ›Bedencket Euch, was Ihr sagt! Lästert Gott nicht, das will ich nicht hören! Ihr wisset wol, was Gottes Wort von denen sagt, so Christi Leib und Blut unwürdig annehmen und seinen Leib mit Füßen treten?‹ ›Mit Füßen?‹ (sagte sie). ›Ja, recht mit Füßen!‹ sagte ich und machte eine gantze Predigt darüber. Sie hörte zu, wie es den Anschein hatte; aber als ich schwieg, sagte sie: Er versah mich wie eine Missethäterinn und eine, so vom Leben soll. Ich habe keinen gemordet (ich dachte: man weiß nicht was); Ihr Kind! warumb sollte ich sterben? Gott der allmächtige gebe –‹ darmit schwieg sie. Ich predigte ihr abermalen vor und sagte, daß sie den ewigen Tod von wegen ihrer Sünden verdient hätte und fürnehmlich deswegen, weil sie sich so lange von Gottes Tisch fern gehalten. ›Diese Beichte‹ (sagte sie) ›habe ich Chresten zu dancken; Balcke hat auch wol mit geholffen,‹ fing an, die beyden zu verfluchen. Ich drohete ihr mit einer zweyten Beichte, wenn sie nicht mit solchen Worten innehielte, ich könnte es nicht vor Gott verantworten, darbey zu schweigen, und sagte ferner: ›Redet Ihr so zu Chresten, so könnet Ihr sicher seyn, daß er Euch verklagt.‹ Dies hielt sie etwas im Zaum, und ging sie den Mittag nicht auff die Treppe hinaus. Sie war in jeder Art ein boshaftes Weyb, gönnte keinem gefangenen ein wenig Speise. Ein armer Küster war mein Nachbar in der Dunckeln Kirche; ich gab ihr ein Stück Braten vor ihn. Sie wollte es ihm nicht hin bringen, was sie doch leicht konnte, ohne daß jemand es gesehen hätte. Als ich später die Speise sah, hielt ich mich darüber auff. Da sagte sie: ›Warumb sollte ich es ihm geben: Er hat mir nie was gegeben; ich kriege nichts davor.‹ Ich sagte: ›Ihr gebet nichts von dem Eurigen weg!‹ – Selbiger Küster saß gefangen, weil er sein eigenes Korn zurückgenommen hatte, sintemalen der, welchem er es verkaufft hatte, es ihm nicht bezahlte. Er sang jeden Tag fleißig und Sonntags so wie ein Prediger vor dem Altar und antwortete etc.
Sie war seit der Zeit lange nicht so lustig mit dem Mannsvolck. Bey mir beklagte sie sich offt, daß sie schwach sey und sich mit dem neuen Kessel überhoben habe, so Balcke ihr gegeben; sie könne es nicht aushalten, habe den Schloßv. gebeten, daß sie hinaus kommen dürffe, er aber habe geantwortet, sie solle auff dem Thurm sterben. Ich sagte: ›Der Schloßv. kann Euch ja noch nicht recht verstehen; bittet Chresten, daß er vor Euch spreche! Solches that sie auch, kam aber mit der selbigen Antwort zurück; sagte eines Tags: ›Ich sehe wol, hertzliebe Frau, daß Ihr mich eben so gern los seyn wollet, wie ich gerne gehen will. Was habe ich vor all mein Geldt? Ich kann es nicht genießen und ich kann Euch nicht recht dienen.‹ Ich sagte: ›Geldt kann viel ausrichten. Schencket dem Schloßv. etzliches Geldt, dann wird er schon vor Euch sprechen. Begehret eine von denen Scheuer-Weybern, daß sie den Kessel statt Euer trage, diese könnet Ihr mit wenigem bezahlen.‹ Das letzte that sie erst nach etzlichen Wochen; endlich sagte sie eines Tages zu mir: ›Nu habe ich dem Schloßv. einen silbernen Becher machen lassen.‹ (Ihre Tochter kam so offt zu ihr an die Treppe, als sie begehrte, und hatte sie Erlaubniß, den gantzen Nachmittag unten zu bleiben, unter dem Vorwand, mit ihrer Tochter zu sprechen. Ob sie Geschencke davor gab, weiß ich nicht, aber ich war wol darmit zufrieden, alleine zu seyn. Sie war doch einmal in Angst, daß ich es dem geistlichen sagen würde.) In summa: Der Schloßv. traute sich nicht, bey dem König für sie zu sprechen. Da bat sie mich um Rath. Ich sagte: ›Bleibet im Bette liegen, wenn hier gespeiset wird, dann will ich hinausgehen und mit dem Schloßv. reden,‹ Das geschah. Im Anfang machte er einige Difficulteten, sagte: ›Die Königinn wird sagen, daß da Schelmstücke hinter stecken.‹ Ich sagte, sie könnten das Weyb vicitiren und examiniren, wenn sie hinaus käme, wir wären nicht so vertrauliche Freundinnen gewesen, ich wüßte, daß das Weyb mir zur Bedienung gegeben sey; wenn sie nicht länger könnte, sondern im Bette liege, so hätte ich keinen Dienst von ihr, noch weniger könne ich sie bedienen; sie diente ja vor Geldt, es würde wol genung Frawenzimmer geben, so den Dienst annehmen wollten. Drey Tage darauff, als der König von Fridrichsborg kam, trat der Schloßv. herein und sagte, das Weyb könnte an dem Abend hinunter gehen; er hätte eine andere, so Chresten recommandiret hatte, und ein gesittetes Weyb seyn sollte (was sie auch ist).
Also kam Karen Ols Tochter hinunter, und Karen Nels Tochter dafür herauff. Und kann ich wol sagen, daß es einer der glücklichsten Tage während meiner damals harten Gefangenschafft war; denn ich ward ein un-trewes gottloses lügenhaftes Sie hatte Chresten länger als ein halbes Jahr hindurch, bevor sie weg kam, gebeten, dem Schloßv. zu sagen, wie ihr Leben an einem Faden hinge: ich hätte eine Lehm-Kugel in meinem Tuch, darmit hätte ich gedrohet, ihren Kopff in Stücke zu schlagen (ich sagte eines Tags, daß man jemanden mit sothaner Kugel todt schlagen könnte). Dergleichen Lügen dichtete sie viele, wie ich später erfuhr. und un-gesittetes Weyb los und bekam davor ein christliches trewes wahrhafft gutes (ja all zu gutes) Weyb. Als das erste Weyb Abscheidt nahm, sagte sie: ›Lebet nu wol, Fraw! Nu können wir uns beide frewen.‹ Ich antwortete: ›Das ist wol eines der wahrsten Worte, so Ihr in Eurem Leben gesprochen habt.‹ Sie antwortete nichts, sondern lieff, alles was sie konnte, so daß man keine Kranckheit oder Schwäche an ihr vermerckte. Sie lebte nicht gantz ein Jahr darnach, litt harte Peyn 6 Wochen lang in ihrem Bett, bevor sie starb, woran, weiß ich nicht.
Am nächsten Tag nach dem Anlangen dieser Karen saß sie Nachmittags gantz betrübt. Ich fragte, was ihr fehlte. Sie sagte: ›O, ich habe nichts zu thun und ich durffte keine Arbeit mit mir nehmen! Ich langweil mich zu Tode.‹ Ich fragte, welche Arbeit sie machen könnte. ›Spinnen‹ (antwortete sie) ›ist meistentheils meine Arbeit; ich kann auch grob nähen und etwas stricken.‹ Von allem diesen hatte ich nichts, ihr zu helffen; zog einige Enden Seyde herfür, die ich von dem, was ich abschneide, auffbewahre, die aber zu kurtz sind, umb darmit zu arbeiten, und andere Zupff-Seyde von Nachtwämmsern und Strümpffen, wozu ich mir eine Hechel von kleinen Knopffnadeln, Die Knopffnadeln hatte ich dem ersten Weyb vor einiger Zeit weggestohlen. Sie hatte sich diese sammt einigen Nähnadeln verschafft, gedachte sie vor mir zu verbergen, trug sie in ihrem Busen in einem Papir, dachte nicht daran. Am Abend, als sie ihren Unterrock fallen ließ, umb zu Bett zu gehen, fiel das Papir auff den Boden. Nach dem Klang hörte ich, was es war. Eines Sonnabends, als sie mit dem Nacht-Kessel hinauff ging, nahm ich bemeldte Nadeln aus ihrem Kasten, und sie wagte nicht, darnach zu fragen; sah später mich selbige brauchen und sagte niemals was darüber. die an ein Stückchen Holtz gebunden waren, gemacht hatte; darmit hechelte ich bemeldte Seyde und macht selbige brauchbar, Hauben darmit zu stopfen; und sagte zu ihr: ›Dar habt Ihr was zu thun; hechelt mir das!‹ Sie wurde so von Hertzen froh, daß es mir ein rechtes Behagen war. Ich fandt aus ihrer Erzählung über dies und das, so ihr in ihrem Leben arriviret war, daß sie ein gutes Hertz hatte, daß sie offt wegen ihrer Leichtgläubigkeit war betrogen worden. Sie hatte mich auch in meinem Wolstand gekannt, hatte eines Rathmanns Fraw gedienet, so bey meiner Hochzeit Vorgängerinn gewesen war, und konnte sich des Auffwandes mit Feuerwerk und anderer Herrlichkeit sehr wol erinnern; weinte, als sie es erzählte, und hatte ein großes Mitleidt mit mir. Sie war von Jütland, eines Bawern Tochter, war aber mit einem Regiments Quartiermeister verheyrathet gewesen. So kriegte ich allmälig Affaiction zu ihr, bat sie, Christian zu grüßen und zu fragen, wie der Docter sie befände; sagte ihr, daß Christian wol zuweylen uns einen Dienst erzeigen und eines oder das andere vor uns kauffen könnte, denn er hätte einen Jungen, ja zuweylen zwey, so vor ihn Auffträge besorgten, aber ich hätte dem früheren Weyb nicht getraut, so daß er niemals etwas vor mich kauffte, auch wollte das vorige Weyb nicht spinnen; aber Christian sollte uns itzt herbey schaffen, was wir haben wollten, vor unsere Kertzen. Und da sie sich nichts daraus machte, Wein zu trincken (denn zu jeder Mahlzeit erhielt das Weyb damals eine viertel Kanne franschen Wein), so sagte ich: ›Gebet Chresten Eueren Wein, wie ich Christian meinen Wein gebe, dann kann Chresten ihn bey dem Keller-Burschen stehen lassen und ihn jede Woche nehmen, so daß es ein Profit vor ihn ist, und dann sieht er nichts, wenn er auch vielleicht was mercket.‹ Das geschah, und ließ Christian uns zween Handspindeln machen. Meine war nur klein, aber ihre, wie es sich gehört. Ich spann ein weniges, drehte es zu Zwirn, welcher noch in meiner Verwahrung ist. Christian verschaffte ihr so viel Flachs, als sie vor Geldt begehrte, brachte ihr gleich einen ganzen Krantz in seiner Hose herauff. Später entstand offt Streit zwischen Karen und Christian, worüber etzliches gemeldt werden soll. Ich sagte damals unter anderem (umb sie in bessere Homeur zu bringen): ›Nu seyd Ihr bös auff Christian, aber Ihr habt offt Eure Finger geleckt nach dem, so er in seiner Hose hat.‹ Zuerst sagte sie: ›Fi, awi!‹ lachte später über die Maßen, als sie verstandt, was ich meinte. Denn er hatte den Flachs in seiner Hose verborgen, den er vor sie kauffte. Sie spann auff der Handspindel recht viel, und ich machte mein Gewebe auff einem Stuhl, den ich auff dem Tisch nieder legte, bandt das eine Bein mit Bändern und Schnüren, die ich selbst gemacht hatte, so, daß wenn in die Treppen-Thür der Schlüssel gesteckt ward, ich mit einem Zug mein Gewebe lösen und den andern Baum losmachen konnte, der an meinem Leib befestigt war, und alles war weg gelegt, ehe die innerste Thür geöffnet wurde. Ich machte mir auch ein Speilholz (früher hatte ich Aufzüge), so daß ich alleine webte; hatte auch einen richtigen Weber-Kamm gekriegt; so waren wir sehr fleißig, eine jegliche bey ihrer Arbeit.
Der Schloßv. war voll Narrethey, machte Possen, wie Buben sie zu machen pflegen; wollte mit dem Weyb schäkern, aber sie wollte nicht mitthun. Er war fast jeden Tag zu Mittag betruncken, wenn er herauff kam. Später kam er selten des Abends herauff, schickte statt seiner einen Diener, welcher sich draußen auff die Mauer im Fenster schlaffen legte. Er wollte auch mit mir schertzen, sperrte den Mund auff, und ich sollte ihm etwas hinwerffen und sehen, ob ich seinen Mund treffen könnte. Ich lachte und sagte: ›Wo doll siet Ji!‹ bat ihn, näher heran zu kommen, so wollte ich sehen, ob ich ihn treffen könnte. ›Neen, neen‹ (sagte er), ›so wär ick doll! Ji skolle mi wol en Orfigen gäffwen!‹ Eines Mittags kam er mit einer sonderlichen Façon von einer Sprütze herauff, die rund wie eine Kugel war, und saß eine gantz kleine wintzige Röhre darin, kaum zu erkennen; war gantz artig. Wenn auff eine Stelle gedrückt ward, so sprützte das Wasser heraus, gantz hoch und weit weg. Er war naseweiß und sprützte auff mich. Als er wahrnahm, daß ich ungehalten ward, kam er mit der Sprütze zu mir, lieff weg und setzte sich dann und riß den Mund auff, was er nur konnte, bat mich, hinein zu sprützen, wenn ich könnte. Ich wollte keine Spielerey mit ihm anfangen, denn aus seinen Geschichts-Erzählungen kannte ich seine Plumpheit wol, gab ihm die Sprütze zurück. Als Karen den Braten herein tragen sollte, hatte der Schloßv. die Sprütze zwischen denen Beinen, saß auff einem niedrigen Stuhl und konnte doch dem Weyb in das Angesicht sprützen; war ein ziemblich Stück von ihr, und die Kugel war nicht größer als eine große Pflaume. Sie wußte nichts von der Sprütze (ist auch etwas hastig in ihrer Rede); sagte: ›Gott gebe, daß Ihr die Schwerenoth kriegt, Hr. Schloßv.! Pißet Ihr auff mich?‹ Der Schloßv. lachte wie einer, der un-sinnig ist, so lieb war ihm das. Er ward nach und nach zahmer und zahmer, kam selten nüchtern herauff, legte sich auff des Weybes Bett und schlieff, während ich speiste, so daß Chresten und das Weyb ihm vom Bette helffen mußten, wenn sie ihn auffgeweckt hatten. Die Schlüssel zu den Gefängnissen lagen an seiner Seite, und der Haupt-Schlüssel dar neben (verwahrte er nicht seine gefangenen sehr gut?) Ich sagte eines Tags zu dem Weyb:›Wäre nicht die Königinn da, die den König auff mich zornig macht, so würde ich dem Schloßv. schon davor bezahlen, daß er Doctor Sperling ausfindig machte. Ich würde die Schlüssel nehmen, wenn er schlieff, und auffpassen, wenn Chresten mit dem Becher käme, dann gleich zur Königs-Treppe hinauff gehen und dem König die Schlüssel bringen, so wie ein Lacquei es mit dem alten Schloßv. gemacht hat. Aber ich würde bey diesem Konig nichts darmit gewinnen, würde vielleicht noch strenger gehalten.‹ Er fürchtete sich nicht, daß ich ihn morden würde. Eines Abends war er betruncken oder stellte sich so; fing in seiner Weise an, mich carressiren zu wollen, und versuchte, meine Knie zu fühlen, faßte den Rand des Rockes an. Ich stieß ihn mit dem Fuß weg und sagte nichts anderes als: ›Wan Ji duen siedt AdÜD. i. Wenn Ihr betrunken seid., so blifft van mii und kombt hir nicht binnen, dat säg ick Ju!‹ Er sagte nichts, stand auff und ging fort; kam auch später nicht herein, wenn er betruncken war, sondern blieb draußen in der Vorkammer, legte sich im Fenster nieder, woselbst eine breite Banck von Steinen gemawert war; dort lag er und schlieff eine Zeit lang, nachdem meine Thüren geschlossen waren, dann kamen sein Kutscher und Chresten und schleppten ihn hinunter. Zuweylen kam er herein, wenn er nicht betruncken war, gab mir auch einige alte Kartenblätter, die ich zusammennähete und daraus einen Schrein machte. Christian beschlug ihn mit dünnen Tannenstäben, worauff ich später flickte, auch gelangte ich insgeheim dazu, ihn mit Farben zu bemalen. Ich habe ihn auffbewahret. Der Schloßv. sah ihn später, aber fragte nie, woher der Beschlag gekommen sey. Im Anfang, als diese Karen den Schloßv. noch nicht kannte, wagte sie sich nicht so dreist zu den gefangenen in der Dunckeln Kirche, umb ihnen etwas zu geben, denn sie sagte: ›Der Schloßv. glotzet mich so an.‹ Ich sagte: ›Es gehet ihm wie denen kleinen Kindern, sie sehen ein Ding steiff an und wissen nicht, was es ist.‹ Das ist auch so; er kümmerte sich umb gar nichts. In diesem Schrein (wenn man ihn so nennen kann) habe ich all meine Arbeit und Geräthschafft, und steht er am Tage auff meinem Bett.
Christians Gewalt nahm zu. Er bediente nicht allein draußen bey Tisch, sondern schloß sogar meine Thür dem Thurmwächter vor der Nase zu. Er kam mit dem Räucher-Faß in meine Kammer, wenn das Weyb den Nacht-Kessel hinauff trug; ja er ward später so dreist, daß er alles that, was er nicht lassen wollte, hatte über die gefangenen unten zu befehlen. Chresten machte sich auch des Schloßvoigts geringe Auffsicht zu Nutze, lag zuweilen während der Nacht unten in der Stadt, kam offt betruncken zur Abend-Mahlzeit. Eines Abends war Chresten betruncken und hatte unten einige Scheiben mit der Hand ausgeschlagen, so daß die Finger blutheten; meinen Wein-Becher schmiß er auff die Erde, daß er barst und sich verbog, und da der Becher außen gantz bluthig war, als er zu mir herein kam, und Bluth in den Wein gekommen zu seyn schien, sprach ich etwas ernst mit dem Schloßv. darüber. Er sagte nichts anderes als: ›De Man is doll!‹ nahm den Becher und ging selbst in den Keller hinunter und ließ den Becher ausspühlen und anderen Wein hinein geben. Wie sie sich später verglichen, weiß ich nicht. Die Beulen sind an dem Becher ausgeklopffet worden, aber der Sprung am Rande ist noch da; das kombt dem Wein-Schencken zu Paß, denn nu geht kaum eine viertel Kanne in den Becher. Christian hielt sich einmal männlich gegen den Schloßv., als er sich unten mit etzlichen gefangenen gerauffet hatte, und Chresten dieses dem Schloßv. klagte, der herein kam und Christian in das Kerckerloch setzen wollte; aber er stieß den Schloßv. von sich und sagte, daß er nichts mit ihm zu schaffen hätte, von ihm sey er nicht gefangen gesetzt; brauchte sein Maulwerck, daß der Schloßv. Gott danckte, als er weg ging. Christian rieff ihm dann noch aus dem Fenster nach und sagte: ›Ich weiß Schliche von Euch, aber Ihr wisset keine von mir.‹ (Eines kenne ich, das er wußte, und zwar nichts geringes. Da war ein Corporal, so einen Soldaten todt gestochen hatte, und mit Trommelschlag gesucht ward; den verbarg der Schloßv. mehre Wochen im Thurm.) Am nächsten Morgen verdroß es Christian, und er fürchtete, eingesperret zu werden, kam zu meiner Thür, bevor sie auff geschlossen ward Die Angeln an meiner äußersten Thür sind so weit von der Wandt, daß sie mehr als eine Handbreit offen ist, so daß ich verschiedenes großes dar zwischen herein gebracht habe, und ist sie oben mehr offen, so daß wenn ich meinen Arm durch das Guckloch meiner innersten Thür stecke und ihn hinauff strecke, ich bis nach oben reichen kann, das Weyb aber nicht., (wie offt geschah, daß die Vorkammer auff gemacht wurde, ehe die Speisen herauff kamen, so auch immer im Winter des Morgens, wenn man Feuer im Ofen draußen anmachte), und bat mich, beim Schloßv. vor ihn zu sprechen, was ich dann auch that, so daß es blieb wie es war, und Christian so brav ward wie zuvor.
Das Weyb und ich lebten in guter Einigkeit mit einander. Zuweylen waren einige kleine Krackehle zwischen Christian und ihr, aber das hatte damalen nichts zu sagen. Ich stillte seinen Zorn mit Wein und Kertzen. Dieses Weyb hatte einen Sohn, der starb, gleich nachdem sie zu mir gekommen war, und eine Tochter, die noch lebet; sie diente damals bey einem Schneider, aber jetzo ist sie mit einem Kauffmann verheyrathet. Die Tochter erhielt auch manchmal Erlaubniß, mit ihrer Mutter auff der Treppe zu sprechen. Das verdroß Christian, sintemal er meinte, daß durch sie allerhand besorgt werde; drohte offt darmit, sagen zu wollen, was er nicht wußte, sondern nur meinte, so daß das Weyb offt betrübt war (sie weinet leicht und lacht leicht.) Ich konnte sie baldt trösten. Wir brachten unsere Zeit sehr gut hin. Ich lehrte sie lesen, begann mit A. b. c., denn sie kannte keinen eintzigen Buchstaben. Ich hielt meine bestimmten Stunden, sie zu unterrichten. Sie war damals ihre 60 Jahr alt. Und als sie schon etlichermaßen buchstabiren konnte, Sie hat eine sonderliche Art zu buchstabiren; denn wenn sie die zwey Sylben zu der dritten legen soll, hat sie die erste vergessen. Muß sie aber, so kann sie das Wort recht lesen, wenn sie die erste Sylbe buchstabiret. Die Wörter von zween Silben buchstabiret sie, die von 4 Sylben liest sie. nahm sie einmal das Buch und wendete es auff und nieder, fing an, ihre Augen zu reiben und sagte: ›Herr Gott, wie ist denn das eigentlich? Ich kenne‹ (schwur sie bei Gott) ›nicht einen Buchstaben!‹ Ich standt hinter ihr und konnte mich kaum für lachen halten. Sie rieb abermals die Augen (und da sie ziemblich hastig in ihren Worten ist), zeigte sie mit einer Hast auff ein O und sagte: ›Ist das nicht ein O?‹ ›Ja!‹ sagte ich und lachte, als sie sich zu mir wandte. Darmit ward sie erst gewahr, daß sie das Buch verkehrt hielt, warff sich auff das Bett und lachte, daß ich meinte, sie würde für lachen bersten. Und als sie eines Tags lesen sollte und ihre Hand-Spindel nicht weglegen mochte, wollte es nicht recht fließen, und verlor sie die Lust; sagte: ›Bin ich nicht toll, daß ich in meinen alten Tagen will lesen lernen? Was habe ich darvon? Ich hab viel Geldt auff meinen Sohn gewendet, ihn lesen lernen zu lassen, und seht! ist er nicht todt?‹ Ich wußte, wie viel sie vermochte, ließ sie so für sich hin sprechen. Sie warff das Buch auff ihr Bett, setzte sich an ihre Arbeit und sagte: ›Was habe ich nöthig, in einem Buch lesen zu lernen? Ich kann, Gott sey Danck, meine Morgen- und Abend-Gebete lesen‹ (ich dachte: übel genung! Von ihrem Cathechi. wußte sie sehr wenig.) Ich sagte (mit Sanftmüthigkeit): ›Das ist wol wahr, Karen! Ihr habet nicht nöthig, in einem Buch lesen zu lernen, Ihr könnet hüpsch auswendig lesen.‹ Ich hatte kaum diese Worte gesagt, so sprang sie auff, nahm ihr Buch wieder und begann zu buchstabiren. Ich rieth weder zu noch ab, ging mit ihr umb wie mit einem guten einfälttigen Kind. Einmal fragte sie mich, ob sie nicht ein Buch kriegen könnte, wo q und x nicht darin wären, denn diese Buchstaben konnte sie nicht behalten. Ich antwortete: Ja, wenn sie selbst ein solches wollte drucken lassen.
Ich fiel in diesem Jahr in Kranckheit AdÜIm M. S. stand eine Anmerkung, die doch später ausgestrichen ist und folgendermaßen lautet: Als diese Karen zu mir kam, ließ sie mir keinen Frieden, daß ich den Fußboden möchte reinigen lassen; denn ich fürchtete dasjenige, was auch geschah, daß nämlich der Stank uns Krankheit zuwegebringen würde. Da lag ellenhoch Menschen- und Boden-Dreck auf einer Stelle. Als sie ihn gelöst hatte, mußte er liegen bleiben, bis die Thür aufgeschlossen ward. Ich legte mich in's Bett, zog die Decke über den Kopf und hielt die Nase zu. – An diese Stelle habe ich die Anmerkung gebracht, die sich im M. S. hinten auf den losen Blättern befindet, wie oben erwähnt ist. Anno 1666, bald nachdem Karen Nelß Tochter zu mir gekommen war, merckten wir erst, daß ein Stein-Boden in der Kammer meines Gefängnisses war, als ein Stück zusammen gebackter Unrath abgebrochen wurde, und die Steine zu Tage traten. Ich hatte ihn vor einen Lehm-Boden angesehen. Die vorige Karen, Olis Tochter, war von denen eine, so den Un-rath fegen, ihn aber nicht weg nehmen. Diese Karen plagte mich un-ablässig, fast jeden Tag, daß wir überall auff reißen möchten, und das auff einmal: es wäre baldt geschehen. Ich meinte, daß es uns übel bekommen würde, wenn es auff einmal geschehe, denn darzu brauchte man Wasser, umb es auff zu weichen, und der Stanck in dem beklommenen Loch würde uns Kranckheit zuwege bringen, aber ein Stück nach dem andern lösen, das könne leichter geschehen und ohn Ungemach. Sie blieb bey ihrer Meinung und bey ihrem Begehren; glaubte, den Schloßv. oder den Thurmwächter überreden zu können, daß sie die Thür so lange offen stehen ließen, bis rein gemacht sey. Aber als der Thurmwächter ihr eine Balje mit Wasser herein gebracht hatte, schloß er die Thür zu. Ich legte mich zu Bett, deckte mich dicht über dem Gesicht zu, und sie schrapte und fegte den Un-rath. Die Menge des Un-flathes war un-glaublich. Er hatte sich seit vielen Jahren angesammelt, denn es war ein Missethäter-Gefängniß gewesen, und darinnen hatten sie auff dem Fußboden ihre Notdurfft gemacht. Sie legte den Schmutz-Kram in eine Ecke, und war dessen Mannigfaltigkeit so groß wie ein gantzes Fuder. Er blieb bis gegen Abend zur Zeit des Abend-Essens liegen, da wurden die Thüren erst geöffnet. Es geschah, wie ich fürchtete: wir wurden beide kranck. Das Weyb kam zuerst wieder auff, denn sie konnte an die Lufft gehen, ich aber blieb in dem beklommenen Loch, wo fast kein Licht war. Wir gewannen das darbey, daß der Flöhe Mannigfaltigkeit uns Tag und Nacht plagte, und waren sie ihr anhänglicher als mir, so daß sie offt nahe daran war, zu weinen. Ich lachte und machte einen Spaß daraus, sagte, sie wollte alleweyle was zu thun haben, nu hätte sie Zeit Vertreib; wir konnten aber nicht arbeiten. Die Flöhe saßen gantz dicht auff unseren Strümpffen, so daß die Farbe der Strümpffe nicht zu erkennen war, und streifften wir sie von uns ab in das Wasserbecken. Brachte darbey in Erfahrung, daß ein Floh einen anderen gebiert. Denn als ich ihre Mannigfaltigkeit betrachtete und wie sie schwimmen konnten, ward ich gewahr, daß etzliche kleine Füße hinter dem Floh krabbelten, dachte, es sey ein besonderer Schlag. Endlich sah ich, was es war, nahm den Floh, aus dem der kleine zum Fürschein kam, auff meinen Finger, und er hinterließ Geburths-Zeichen; sprang strax, aber die Mutter saß ein wenig, bis sie wieder zu sich kam, konnte auch zum ersten Mal nicht so weit springen. Dieses Ergötzen hatte ich mehr als einmal, bis die Flöhe zu Grunde gerichtet waren. Ob alle Flöhe auff die Weise geboren werden, kann ich nicht wissen, aber daß sie aus Unrath und Lehm gezeugt werden, das habe ich auch in meinem Gefängniß gesehen und gemerckt, wie sie nach und nach vollkommen geworden sind und von sonderlicher Farbe, grade so wie die Materie war, aus welcher sie gezeuget wurden. Ich habe sie auch sich parren sehen. und da der Schloßv. zu der Zeit Mittags nicht mehr zu mir herein kam und Abends den Diener herauff schickte, so bat ich das Weyb, sie möchte ihm sagen, daß ich kranck sey, und daß ein Doctor zu mir kommen möchte. Das Weyb sagte ihm das (denn damals verstandt er schon dänisch und das Weyb verstand etwas teutsch), und als sie sagte: ›Ich bin bange, daß sie stirbt,‹ so antwortete er: ›Lat se starffwen för en Düffwel!‹ Ich hatte das tägliche Fieber, hatte Hitze, aber keine Kälte; und da zum großen Theil die Ursach meiner Kranckheit war, daß ich Obstruction hatte, begehrte ich ein Clistier. Darüber lachte der Schloßv. spöttisch. Das hörte ich, ließ begehren, daß er zu mir herein kommen sollte, was er auch that. Ich sprach ihm ziemblich ernst zu, sagte ihm, es sey nicht des Königs Wille, daß er nicht mehr Sorgfalt vor mich haben sollte, als er zeigte; er habe mehr Sorgfalt vor seinen Hund als vor mich (was er auch hatte). Darauff zog er bessere Miene auff, fragte, was ich haben wolle, und ich sagte, was ich begehrte, und bekam es. Ich hatte mich bey dem Gespräch ein wenig alterirt, so daß ich schwach wurde. Das Weyb weinte und sagte: ›Ich fürchte, Ihr sterbet, hertzliebes Fräwlein! und dann werden die schlimmen Mägde aus der Wäschestube Eure Füße und Hände waschen‹ (eine von den Mägden da unten war sehr un-fein gegen mich mit ihren Reden, die sie mir vermelden ließ). Ich erwiderte, daß ich kein Wort dargegen sagen würde. ›Was‹ (sagte sie unwillig); ›wollet Ihr das leiden?‹ ›Nein,‹ schwur sie, ›das wollte ich nicht! Ich wollte es nicht leiden, wenn ich an Eurer Stelle wäre!‹ Darauff sagte ich, wie der Philosophus sagte: ›So leget meinen Leuchte-Stab zu mir, mit dem kann ich sie von mir fern halten, wenn ich todt bin.‹ Auff dem Stab saß ein blecherner Leuchter, so zuweylen an die Seite meines Bettes gesetzet ward etc. Den brauchte ich als Knüpff Block. Da besann sie sich erst und redete vor sich hin über Grab und Begräbniß. Ich versicherte sie, daß mich dieses durchaus nicht bekümmere; wenn ich todt sey, so sey mir solches gleich; ob sie auch meinen Körper an den Strand legten, so würde meine Seele für Gottes Thron kommen am jüngsten Tage des Gerichts und besser bestehen als vielleicht viele, so in Särgen liegen, mit Silber beschlagen, und in herrlichen Begräbnissen. Aber daß ich, wie der Schloßv., die leichtfertigen Worte sagen würde, ich wollte auff dem Hügel von Waldby begraben werden, von wegen der schönen Fernsicht, das nicht. Ich begehre nichts anderes als ein selig Ende. Wir sprachen über des Schloßvoigten Un-Feinheit, über allerhand, was er that und dessen wegen es ihm übel ergehen würde, wenn die Königinn es wüßte, über seine Gottlosigkeit, daß er, wenn er zum h. Nacht-Mahl gewesen war, sagte, er sey durch die Musterung gegangen, und anderes mehr. Es war keine Gottes-Furcht in ihm.
Ich begehrte, auff den Tod bereittet zu werden und ließ M. Buck bitten, umb sieben Uhr Morgens zu mir zu kommen, denn gegen 8½ Uhr begann das Fieber. Der geistliche kam nicht vor 9½, als die Fieber-Hitze schon begonnen hatte (denn sie trat schon etwas später ein). Als ich meine Beichte gesagt hatte, begann er über Mord und Todtschlag zu predigen, über Dawid, so an Urie Tod schuldt sey, obwol er ihn nicht mit seiner eigenen Hand todt schlug; sprach von der Sünde, wie es seine Pflicht war, und von der Straffe, so darauff folgt. ›Ihr‹ (sagte er) ›habt General Fux getödtet, denn Ihr habt einen Diener darzu erkaufft, der ihn hat getödtet.‹ Ich antwortete: ›Das ist nicht wahr! Das habe ich nicht gethan!‹ ›Ja freylich,‹ (sagte er); ›der Diener ist in Hamburg, der hat es selber gesagt.‹ (Ich antwortete:) ›Hat er das gesagt, so hat er gelogen, denn mein Sohn gab Fux sein Tod mit einem Stilet. Ich wußte nicht, daß Fux in Brügge war, ehe und bevor ich seinen Tod erfuhr. Wie könnte der Diener dann sagen, daß ich's gethan hätte? Auff mein Befehl ist es nicht geschehen, aber daß ich mich nicht sollte haben gefrewet, daß Gott den Bösewicht gestraffet, das gestehe und bekenne ich.‹ Darauff antwortete er eben so: ›Das hätte ich selber gethan.‹ (Ich sagte:) ›Wie Fux mit uns in unserem Gefängniß auff Borringholm gehandelt, weiß Gott. Das ist nu vorbey, und ich gedencke des nicht mehr.‹ ›Da thut Ihr recht an‹ (sagte er), und fuhr dann in seinem Ambt fort. Als alles verrichtet war, sprach er mit dem Schloßv. außerhalb der Thür meiner Vorkammer, grade vor der Thür der Dunckeln Kirche und sagte, daß ich mich kranck machte, ich sey nicht kranck, ich sey für lauter Bosheit roth im Angesicht; er habe mir die Wahrheit gesagt, und darüber sey ich zornig geworden. Christian stand innerhalb der Thür der Dunckeln Kirche, denn zur selbigen Zeit waren keine gefangenen darinnen, und hörte das Gespräch, erzählte es mir, als ich wieder auff zu stehen anfing und mit ihm an der Thür sprach.
Einige Zeit darnach sagte Christian mir eines Tags gar heimlich: ›Wollet Ihr, so will ich Euch Botschafft an Euere Kinder in Schonen bringen.‹ Ich fragte, auff welche Art das geschehen könnte. Er sagte: ›Durch mein Mädchen. Sie ist wol trew; sie soll doch darhin reisen.‹ Er wußte, daß ich noch etzliche Ducaten hatte, denn Peder Kutscher hatte es ihm vertrawet, wie er mir selbst gesagt hat. Ich nahm das Erbieten an, schrieb an meine Kinder, gab ihm einen Ducat für die Reise des Mädchens. Das Mädchen war eine Metze, der er die Ehe versprochen hatte, und die schloß der Thurmwächter, der frühere sowol wie Chresten, bey Christian ein, ging selbst hinaus und ließ sie alleine. Sie verrichtete ihren Aufftrag und kam mit einem Schreiben von meiner Schwester und ihnen zurück. Von allem diesen wußte das Weyb nichts.
Nach und nach ward Christian auff vielerley Weise
insolent. Wenn er mit der Tasche seines Buben ankam, in welche das Weyb ihm Speise geben sollte, so warff er ihr selbige zu, war zornig, wenn vor ihn selbst nicht Braten für den Abend auffbewahrt war, daß er die Tasche nicht gleich wieder zurück kriegen konnte, verfluchte den Tag, an dem er zu meiner Thür kam und mit mir gesprochen oder mir irgend etwas mitgetheilt habe. Sie war trawrig, sagte mir aber nichts. Es währte nur einen Tag, da klopffte er wieder an die Thür und sprach wie gewöhnlich darvon, was er newes gehört hatte. Das Weyb saß auff dem Bett und schlug 15 Kreutze (er konnte sie nicht sehen, mich auch nicht). Als er fort gegangen war, erzählte sie, wie schrecklich er sich verflucht habe
etc. Ich sagte: ›Des müsset Ihr aber nicht achten; er hat früher zur Zeit der anderen Karen gar viel gethan.‹ Sein Muth nahm täglich zu. Die Speisen wurden offt eine halbe Stunde früher herauff getragen, ehe der Schloßv. kam. Inzwischen schnitt Christian den Braten und nahm sich selbst das Stück, so er haben wollte (da ich ihm früher bey jeglicher Mahlzeit ein Stück hinaus schickte, Fisch oder anderes, was er begehrte). Der dumme Schloßv. ließ es so
passiren, war froh, dencke ich, daß er ihm die Mühe abnahm; gab nicht Acht darauff, daß in der Schüssel etwas fehlte. Ich ließ es eine Zeit lang so
passiren, denn es geschah nicht so regelmäßig jeden Tag. Aber wenn er Speise vor seinen Jung haben wollte, so sagte er nichts anderes als: ›Was zu essen in mein Jung sein Beuttel!‹ Darüber lachten wir später offt, als er weg war, aber dermalen nicht, denn er wurde von Tag zu Tag schlimmer. Er konnte nicht leiden, daß wir lachten und fröhlich waren; wenn er solches draußen hörte, ward er grimmig. Möchte man klagen und zagen, so wollte er herbey schaffen, was er zu Wege bringen konnte.
Er hatte mir in den Tagen seiner guten Laune vor Geldt und Kertzen verschafft, was ich begehrte, so daß ich sowol Messer wie Scheere hatte, darzu Seyde, Zwirn und unterschiedliches die Zeit dar mit zu vertreiben. Das verdroß ihn später. Eines Tags horchte er und hörte, daß wir lachten; denn das Weyb erzählte gerade was ergötzliches von eines Schuljungen Mutter in Friderichsborg (dort hatte sie gewohnt), wie die Mutter des Jungen nicht wußte, wie sie den Schulmeister
tittuliren sollte; nannte ihn: Herr
Willas
AdÜDen Titel ›Herr‹ führten nur Ritter und Geistliche. ›Mester‹ (Meister) war die dänische Form für Magister.. Er sagte: ›Ich bin kein Herr.‹ ›Dann Meister,‹ sagte das Weyb. ›Ich bin auch kein Meister,‹ sagte er; ›ich bin schlecht und recht
Willas.‹ Da sagte das Weyb: ›Mein guter schlecht und recht
Willas! Mein Sohn schleckt alleweil den Rahm von meinen Butten, wenn er heim kommt. Wollet Ihr ihn wieder schlecken und das mit einer tüchtig scharffen Ruthe auff seinem Steiß?‹ Indem wir darüber lachten, kam er zur Thür und vernahm die Worte, als ich sagte: ›Das hängt wol nicht so zusammen, man muß allzeit etwas hinzusetzen, wenn es nach was aussehen soll.‹ Er kam auff den Gedanken, daß wir über ihn sprächen, und daß wir ihn auslachten. Bey der Mahlzeit sagte er zu dem Weyb: ›Ihr waret gar lachlustig heute.‹ Sie sagte: ›Wißt Ihr nicht, warumb? Das kommt weil ich zu denen Lecher gehöre‹ (das war ihr Zunamen). ›Es wäre wol eine gute That,‹ sagte er, ›Euch mit einander das lachen zu vertreiben; über mich habet Ihr gelacht.‹ Sie schwur nein, daß sein Name nicht genannt ward (wie es auch war), aber er ließ es nicht gelten. Sie geriethen in Wort-Wechsel. Sie erzählte mir das Gespräch, und er kam einige Tage nicht an die Thür, und ich schickte ihm auch nichts, denn grade zu der Zeit war ein armer alter Mann mein Nachbar; dem ließ ich einen Trunck Wein geben. Christian kam wieder an die Thür und klopffte an. Er klagte gar sachte über das Weyb, bat, ich sollte sie davor durchnehmen, was sie ihm antwortete, da er doch gehört hätte, wie sein Name genannt ward. Ich schwur ihm zu, daß zu der Zeit nicht einmal an ihn gedacht wurde, ich könnte sie nicht ausschelten von wegen der Worte, so wir mit einander gesprochen hätten; ich wollte Ruhe innerhalb unserer geschlossenen Thür. ›Ja‹ (antwortete er), ›Hausfrieden ist gut, sagte das alte Weyb.‹ Darmit ging er. Später machte er uns allerhand Verdruß, kam dann wieder an's Land gerudert. Dann wollte er wieder, daß ich nach Schonen schreiben sollte.
Gleich nachdem die Weybspersohn in Schonen gewesen war, gab er mir eine Schachtel voll von Stücken Wachs, worauff alle Thurm-Schlüsseln abgedrückt waren; darbey war geschrieben: Die wird mein Mädchen in Schonen machen lassen. Ich verbarg dies vor dem Weyb, so grade den Nachtkessel hinauff trug, und am nächsten Sonnabend darauff gab ich die Schachtel zurück mit Dancksagung: es läge mir nichts daran, auff diese Weise aus dem Thurm zu entkommen. Das gefiel ihm nicht, das sah ich wol. Ich sagte, ich wäre zufrieden, daß ich einen
Part von meinen Kindern bey meiner Schwester wüßte; wo meine Söhne seyen und wie es ihnen ginge, das wüßte ich nicht; ich gäbe sie in Gottes Schutz. Das war ihm auch nicht zu Danck, und redete er so, als wenn er meinte, daß ich kein Geldt mehr hätte; sagte es aber damals nicht grade aus. Aber eines Tags, als er seinen tollen hatte, kam er zur Thür und hatte eine Kanne mit Wein (den ich ihm fast zu jeder Mahlzeit gab) in seiner Hand und sagte: ›Könnet Ihr mich sehen?‹ (denn es war eine Spalte in der äußersten Thür, aber man konnte von so weit doch nicht recht da durch sehen). ›Hier stehe ich mit meiner Kanne Wein und will zum letzten Mal auff Euere Gesundtheit trincken.‹ Ich fragte: ›Warumb zum letzten Mal?‹ ›Ja!‹ schwur er, kam dann der Thür näher und sagte: ›Ich will keinen Dienst mehr thun; darumb weiß ich auch wol, daß ich keinen Wein mehr kriege.‹ Ich sagte: ›Ich dancke Euch vor die Dienste, so ihr mir geleistet habt; ich begehre keinen mehr von Euch, aber deshalb werdet Ihr doch noch Wein kriegen.‹ ›Nein!‹ (sagte er) ›Keinen Dienst mehr! Hier ist nichts mehr zu holen.‹ ›Das ist wahr‹ (antwortete ich). ›Ihr kennet mich nicht‹ (sagte er); ›ich bin nicht so, wie Ihr glaubet; es ist leicht, mit mir anzufangen, aber nicht leicht, mit mir auszukommen.‹ Ich lachte leise und sagte; ›Ihr seyd weit besser, als Ihr Euch selbst macht. Morgen werdet Ihr anderen Sinnes seyn.‹ Er fuhr fort, sich selbst gantz übel zu beschreiben (es war aber lange nicht so schlimm, wie er wircklich ist). Ich konnte nicht anders als über ihn lachen. Er tranck aus der Kanne, setzte sich auff den Stuhl da draußen. Ich rieff ihn und bat ihn, zur Thür zu kommen, ich wolle mit ihm sprechen. Da saß er wie ein Geck und sprach zu sich selber: ›Sollte ich zur Thür gehen? Nein,‹ schwur einen grewlichen Eid, ›das thue ich nicht! O ja, zur Thür? Nein, Christian, nicht!‹ Lachte dazwischen aus vollem Hals, brüllte laut: den Tag wo er zu meiner Thür ginge oder er mir einen Dienst erzeigte, da solle der Teuffel ihn zerreißen und zerschmeißen. Ich ging von der Thür und setzte mich, mir grauete vor dem Kerl seiner Tollheit und großen Dreistigkeit. Er ging dann etliche Tage und schwieg, wollte keinen Wein annehmen. Speise ward ihm nicht angebothen, denn er blieb wie früher darbey, den Braten zu schneiden, bevor der Schloßv. herauff kam. Da zu der Zeit der Schloßv. zuweylen wieder herein kam und mit mir sprach, bat ich ihn, daß Christian als ein gefangener nicht die Freiheit haben sollte, meine Speise zu besudeln. So ward es ihm fürder verbothen. Etzliche Tage darauff warff er dem Weyb die Tasche auff die Treppe und sagte: ›Gebet was zu essen in meinen Jung sein Beutel.‹
Zur selbigen Zeit saß ein Bawer in der Dunckeln Kirche gefangen vor ein loses Maul, so er gegen den Landvoigt gehabt hatte; ich ließ ihm Speise geben. Er war ein großer Schelm. Ob er von andern angestifftet war, weiß ich nicht, aber er sagte zu Karen, wenn ich an meine Kinder schreiben wolle, so wollte er den Brieff bestellen. Ich ließ antworten, daß ich ihm danckte; ich hätte ihnen nichts zu schreiben, auch nichts womit ich schreiben könnte. Der Schelm antwortete: ›Ja so! Ja so!‹ Dem wurde im allergrößten Gehorsam nachgekommen und ein Stück Braten oben in den Beuttel gelegt. Das besänfftigte ihn etwas, so daß er zu Mittag mit dem Weyb sprach und selber einen Trunck Wein begehrte; aber er drohte dem Weyb, er wolle ihr das lachen vertreiben. Ich fürchtete mich nicht vor dem bösen, so er mir thun konnte, aber das verdrießliche Leben war mühsamb. Ich ließ ihm keinen Wein anbiethen, außer er begehrte welchen. Er pflegte mir jede Woche vor Kertzen die
Avisen
AdÜSoweit aus dem Zusammenhang zu schließen ist, daß nämlich die in Rede stehenden Avisen wöchentlich oder sogar mehre Male in der Woche erschienen, muß man zunächst an deutsche Zeitungen denken. Die erste wöchentliche Zeitung war Jörgen Göde's
Ordinarie Posttidende, deren erste Nummer 1673 erschien. Bording's
Danske Mercurius, der 1666 zuerst erschien, war eine Monatsschrift. Doch bereits mehrere Jahre früher wurden in Copenhagen wöchentliche deutsche Zeitungen herausgegeben, ja, eine derselben, Henrik Göde's
Europaeische Wochentliche Zeitung, erschien seit 1664 zweimal die Woche. Vielleicht ist es gerade diese Zeitung, die Leonora Christine gehabt hat. (Soph. Birk. Smith' dän. Ausgabe.) zu verschaffen, und da er mir vor die Kertzen der ersten Woche die
Avisen nicht brachte, so schickte ich ihm keine Lichter mehr. Er fuhr doch fort, am Sonnabend mit dem Räucher-Faß zu kommen und meine Thür zu schließen. Wenn er mit dem Räucherkraut herein kam, sah er auff die Wandt, wollte mich nicht ansehen. Ich redete ihn einmal an, fragte nach dem
Doctor, und er antwortete nichts. So ging es einige Wochen; dann besänfftigte er sich, brachte dem Weyb
Avisen von der Zeit, wo er sie zurück behalten hatte, zusammen gerollet und mit einem Faden gebunden. Als am Abend der Schloßv. herein kam und saß und plauderte (er hatte einen kleinen Spitz), und Chresten in den Keller gegangen war, gab das Weyb ihm die
Avisen zurück, danckte in meinem Namen und sagte, es sey mir nichts an denen
Avisen gelegen, ich hätte sie so viele Wochen entbehret, könnte auch fürderhin ohne sie seyn. Er ward so grimmig, daß er mit den Zähnen die
Avisen entzwey riß, riß sein Wamms auff, daß die Knöpffe auff den Boden sprangen, steckte einige
Avisen in Brandt, heulte, schrie und knirschte mit den Zähnen. Ich suchte etwas, worüber ich mit dem Schloßv. lachen möchte, sprach so laut ich konnte, um Christian zu übertäuben.
Es war höchlichst zu verwundern, daß der Schloßv. den
Allarm nicht hörte, den Christian machte. Selbiges Mal, erinnere ich mich, erzählte er, wie er einen von denen Hoffbedienten mit einer Maus in einer Schachtel erschreckt hätte. Das Weyb kam herein blaß wie eine Leiche, sah mich an; ich winckte ihr, sie möchte wieder hinaus gehen. Dann kam Christian dicht an meine Thür und heulte, schleuderte seinen Pantoffel in die Luft und dann an meine Thürschwelle, machte es mehre Male so. Als er vernahm, daß Chresten mit den Bechern herauff kam, warff er sich auff die Banck, auff welcher der Schloßv. zu liegen pflegte, und schmiß abermals seinen Toffel an die Wandt hinauff. Chresten blieb in Verwunderung stehen mit den Bechern in der Hand. Er sah wol, daß etwas los war zwischen dem Weyb und Christian, und daß das Weyb bange war; er konnte aber die Ursach nicht errathen und zu wissen kriegen; glaubte auch nicht, daß es mich etwas anging, sintemalen ich lachte und mit dem Schloßv. sprach. Als die Thüren geschlossen waren, da ging das jammern los. Das Weyb sagte, daß er ihr gedrohet hätte: er würde ihrer Tochter wol verbiethen, auff die Treppe zu kommen und ihren Tratsch zu führen, und anderes, was sie nicht durffte. Ich bat sie, sich zu Frieden zu geben; er wäre nu toll, das ginge wol vorüber; er würde sich wol bedencken, ehe er etwas davon sagte, denn dann müßte er fürchten, daß das jenige, so er ihr herauff gebracht habe, auch an den Tag käme, und dann würde er selbsten die Schwerenoth kriegen vor seine Mühe; der Schloßv. hätte ihrer Tochter Urlaub gegeben, zu ihr zu kommen, wem sollte er es also klagen? (Ich dachte wol anders, denn wenn er diesen Weg gehen wollte, so fände er wol einen andern, dem er es klagen konnte, er, der so viel Freyheit hatte; er konnte herein und hinaus bringen, was er wollte, sprechen, mit wem er wollte, im Wächtergang). Sie weinte und stellte sich gar übel an, sprach von jemand, der nicht viel überleget, sagte ein Mal: ›Wenn ich keinen Frieden vor ihm haben soll, so muß ich – ja, so muß ich –.‹ Sie kam nicht weiter und konnte nicht darauff kommen, was sie mußte. Ich lächelte darzu und sagte endlich: ›Christian ist toll, ich werde ihn morgen schon steuern; lasset mich ihn nur bezähmen! Schlaffet Ihr itzt nur ruhig!‹ Sie schlieff später ein, doch nicht so bald; bedachte, was auff sothane Tollheit folgen könnte. Am Morgen gegen Mittag sagte ich ihr, was sie Christian sagen sollte, und daß sie sich stellen möchte, als wenn sie nicht wol zu Frieden sey; sollte anfangen, ihn zu verfluchen und sagen: ›Daß doch der Teuffel in Euch fahre vor das, so Ihr sie gelehret habt! Sie hat ihre Toffeln abgezogen, wie Ihr es macht, und schlug mich darmit auff den Kopff. Sie ist zornig, nahm all das artige Zeug, so sie angefertigt hat, und warff es in den Nacht-Stuhl. ›Nu,‹ sagte sie, ›soll keiner was darvon haben.‹ Darüber lachte er wie ein Geck, das gefiel ihm. ›Ist sie recht auffgebracht?‹ (fragte er). ›Ja‹ (schwur sie) ›das ist sie.‹ Da lachte er laut auff der Treppe, daß ich es hörte. Er war 14 Tage lang fügsam, begehrte dann und wann Wein und Speise, kam auch zur Thür und erzählte unter anderem, er habe gehört, daß der Printz
AdÜD. i. Christian V., verheyrathet mit der Prinzessin Charlotte Amalie von Hessen-Kassel. (nu unser König) sich verheyrathen werde. Ich hatte es wol auch gehört, ließ mir aber nichts mercken, denn der Schloßv. hatte es gesagt, und außerdem erhielt ich die
Avisen ohne ihn. Und da ich ihn umb nichts fragte, ging er gleich weg; sagte später zu dem Weyb: ›Sie ist zornig, und ich bin es auch. Will sehen, wer zuerst einander nöthig hat.‹ Dem Weyb drohete er sehr; sie wollte, daß ich ihm gute Worte gäbe. Ich sagte ihr, so komme man mit ihm nicht zurecht, wenn man ihm allzeit die freundliche Seite zeige.
Er verleitete den Schloßv., eine junge Katze, die ich hatte, gantz oben vom Thurm hinunter zu werffen, und lachte mir gar spöttisch zu, als er dem Weyb seine Mannes-That erzählte, sagte: ›Die Katze war räudig, die Katze war räudig! Ich ließ mir nicht mercken, daß es mich verdroß. Da er nu von Zeit zu Zeit
insolent ward, mehr als man
toleriren konnte, sagte ich eines Tags zum Schloßv., daß ich mich darüber verwunderte, wie er einem gefangenen zugestände, meine Thüren auff und zu zu schließen und das zu thun, was der Thurmwächter eigentlich thun sollte; ob ihm nicht schiene, daß ich mich bey sothanen Umbständen hinaus
practiciren könnte, wenn ich ohne des Königs Willen hinaus wollte? Christian sey ein gefangener, so zum Tode verurtheilet sey; er würde mich schon aus den Thurm hinaus schaffen. Der Schloßv. saß und glotzte wie einer, so nicht recht begreifft, erwiderte nichts als: ›Ja, ja!‹ aber er verhielt sich doch meiner Warnung gemäß, so daß entweder er selbst auff und zu schloß oder auch Chresten (ich habe gesehen, daß Christian die Schlüssel aus Chrestens Hand riß und meine Thür schloß, und das zu der Zeit, als er anfing, so un-sinnig zu werden). War Christian zuvor noch nicht toll, so ward er es itzt, insonderheit zu der Zeit, als Chresten mit dem Räucher-Faß herein kam, und das Weyb oben war. Dann stand er gerade vor mir in der Vorkammer, blickte mich an wie ein Gespennst und knirschte mit den Zähnen; und als er sah, daß ich das übrige Räucherkraut aus Chrestens Hand nahm (das er mir allzeit selbst in Pappir gab), so schlug er ein Trutz-Gelächter auff. Als am Abend auffgeschlossen ward und Christian mit dem Weyb in's Gespräch kam, sagte er: ›Karen, saget zu Ihrer Gnaden, daß ich Euch und ihr eine Teuffels-Geschichte machen werde! Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, daß Chresten ihr einen Brieff gab. Ey, war es darumb, daß sie nicht zuließ, daß ich mit dem Räucherwerck hinein ging, weil ich ihr nicht Botschafft nach Schonen besorgen wollte? Ey, kriegt sie auch die
Avisen von ihm? Ja, saget ihr, so große Dienste ich ihr geleistet habe, ein so großes Un-glück werde ich ihr itzt bereitten.‹ Gott weiß, welche Nacht ich hatte! Nicht weil ich seine Drohung fürchtete, denn ich achtete die Worte gantz und garnicht; das Un-glück wäre nur über ihn zuerst gekommen. Aber das Weyb war so betrübt, daß sie nichts that als jammern und klagen, am meisten über ihre Tochter, des Schimpffes halber, so ihr widerfahren würde, wenn sie ihre Mutter in die Dunckle Kirche setzeten, ja, ihr später das Leben nähmen. Dann fiel ihr ein, daß ihre Tochter mit ihr auff der Treppe geredet habe; schrie dann wieder: ›O, meine Tochter, meine Tochter! Sie kommt in das Zucht-Haus!‹ Ich sagte nichts anderes als: ›Gebet Euch zu Frieden! Es wird lang nicht so schlimm, wie Ihr glaubt.‹ Aber als ich wahrnahm, daß sie sich keiner
raison bequemen wollte, denn sie rieff nur: Ach, ach! sobald ich sprechen wollte, saß im Bett auffrecht, hielt ihren Kopff zwischen beyden Händen und weinte, daß sie nur so in Wasser schwamm, dachte ich, wenn keine Thränen mehr vorhanden seynd, so hält sie wol auff. Ich sagte später, als sie sich ein weniges besänfftigte: ›Das Un-glück, mit dem der verdammte Mensch uns drohet, kann man nicht mit weinen abwenden. Gebet Euch zur Ruhe und leget Euch schlaffen! Ich werde desgleichen thun, und will Gott bitten, mir bis morgen den besten Rath ein zu geben.‹ Das besänfftigte sie ein weniges, aber wenn ich glaubte, sie schlieffe, kam sie wieder mit allen den Dingen zum Fürschein, so sie fürchtete: sie habe mir von ihm Zetteln, Messer und Scheere und anderes herein getragen, das verbothen war. Ich antwortete dann und wann nur: ›Schlaffet, schlaffet! Morgen will ich mit Euch sprechen.‹ Das halff nichts. Die Glocke schlug zwey, als sie noch sprechen wollte und sagte: ›Dem armen alten Mann dar unten wird es übel ergehen.‹
1666. Während Karen Nils Tochter mich bediente, war ein Nürrenberger in der Dunckeln Kirche mein Nachbar; war beschuldet, ein Falsch-Müntzer zu seyn. Dem trug sie jeden Tag Speise hin. Er sang und las fast Tag und Nacht und sang sehr gut. Er sang den Psalm:
Herr, deine Ohren neige zu mir! langsam auff mein Begehren. Ich schrieb ihn auf und setzte ihn später aus auff dänisch. Und da er offt zur Nacht-Zeit laut betete und seine Sünden bekannte, Gott umb Vergebung bat und viele Male rieff: Du mußt mir helffen, Gott! Ja, Gott, du mußt mir helffen, sonsten bistu nicht Gott. Du mußt gnädig seyn!‹ so daß das rufen mich am schlaffen hinderte, so ließ ich ihn durch Karen bitten, daß er möchte sachte beten, was er dann auch that. Er kam für einige Wochen auff den Holm und ward dann los gegeben.
Auf dem ›Holm‹ ist das Copenhagener See-Arsenal, wo Gefangene zu groben Arbeiten verwendet wurden. Ich that, als ob ich schlieff, aber die gantze Nacht bis 5 Uhr und länger kam kein Schlaff in meine Augen. Als zu Mittag auff geschlossen ward, hatte ich ihr schon bedeutet, was sie Christian sagen sollte, und ihr zu verstehen gegeben, daß er durch seine Drohungen von ihr Geldt und von mir Kertzen zu erlangen gedächte, wollte uns zwingen, wie es ihm gut dünckte; aber er hätte eine andere vor sich, als er wol glaubte. Sie sollte nur thun, als ob sie sich an seinen Schnickschnack nicht kehre, nichts zu ihm sagen als: Guten Tag, außer er redete mit ihr; und wenn er frage, was ich geantwortet hätte, möchte sie thun, als ob sie nicht wüßte, daß sie mir was mittheilen sollte. Wiederholte er es dann, so sollte sie sagen: ›Das sage ich ihr nu garnicht! Seyd Ihr noch eben so unsinnig wie gestern Abend? Thut, was Ihr wollet!‹ und darmit weg gehen. Dieses Gespräch wurde gehalten, und er drohete ihr ärger als zuvor. Das Weyb hielt sich standhaft, war doch hertzlich betrübt, als unsere Thüren geschlossen waren; aber da sie leichten Sinnes ist, so lachte sie offt mit Thränen in den Augen. Ich wußte wol, daß Christian sich erbietten werde, mir allerhandt newes zu schreiben und sich darmit wieder beliebt zu machen, aber ich hatte dem Weyb verbothen, seine Zetteln anzunehmen, so daß er sehr grimmig ward. Ich bat sie, ihm zu sagen, er solle sich hüthen, wenn er könnte; hätte er Lust zum bösen, so würde es vor ihn am schlimmsten seyn. Darüber lachte er gar spöttisch und sagte: ›Saget ihr, vor sie wird es am schlimmsten seyn. Vor das, so ich vor sie gethan habe, gebührte mir der Wein, den sie mir gegeben hat; saget ihr das! Ich werde selbst alles bekennen; und sollte ich auch an den Pranger kommen, so soll Chresten doch die Schwerenoth kriegen. Er hat ihr Brieffe von ihren Kindern gebracht.‹ (Der Schelm wußte wol, daß ich mir vor dem Weyb nichts hatte mercken lassen, weder davon, daß er mir Botschafft nach Schonen an meine Kinder gebracht, noch von dem Wachs, in dem die Thurm-Schlüsseln abgedrückt waren; darumb sprach er so frey zu ihr.) Als unsere Thüren geschlossen waren, machte dieses unser Gespräch aus. Ich lachte darüber und fragte das Weyb, welche Schande wol so groß seyn könnte, als am Pranger stehen; nahm es als ein frevelhafftes Wort auff, was es auch war, bat sie, ihm zu sagen, daß er sich nicht bemühen möchte, sich selbsten anzugeben, ich wolle ihm die Mühe abnehmen und (wenn er wollte), dem Schloßv. den nächsten Tag alles sagen, was er für mich gethan habe; er hätte vielleicht was vergessen, aber ich könnte mich dessen wol erinnern. Als das Weyb ihm dieses sagte, antwortete er nichts, sondern lieff hinunter, hielt sich einige Tage still und sprach so gut wie nichts mit dem Weyb. Eines Sonnabends, als das Weyb mit dem Nacht-Kessel oben war, kam er zu ihr herauff und wollte sie überreden, einen Zettel für mich anzunehmen, aber sie schwur, das dürffe sie nicht. ›Alsdann saget ihr‹ (sagte er), ›daß sie mir die Scheere und das Messer zurück geben soll, so ich ihr gegeben habe; das will ich haben, und soll sie sehen, was ich thun kann. Ihr sollt mit einander die Schwerenoth kriegen!‹ Sie kam herunter blaß wie eine Leiche, so daß ich meinte, sie hätte sich überhoben. Sie erzählte ihr Gespräch und sein Begehren, bat mich so sehr, ich möchte ihm die Sachen geben, dann würde er ruhig seyn. Ich sagte: ›Was ist denn mit Euch? Habt Ihr Euren vollen Verstand? Sagt er nicht, daß wir die Schwerenoth kriegen sollen, wenn er die Scheere und das Messer zurück bekombt? Es ist nicht an der Zeit, es ihm zu geben. Verstehet Ihr nicht, daß er sich fürchtet, ich werde die Sachen sehen lassen? Meine Arbeit, denckt er, ist fort, und die Zetteln sind nicht mehr da, so daß nichts mehr da ist, womit man ihm drohen kann, als diese Sachen. Heut Abend müsset Ihr nicht mit ihm sprechen. Sagt er was, so antwortet nicht.‹ Abends schlich er sich heran und sagte in der Vorkammer zu ihr: ›Bringt mir die Scheere und das Messer heraus!‹ Sie antwortete nichts. Am nächsten Morgen, gegen Mittag, bat ich sie, ihm zu sagen, daß ich nichts von dem seinigen hätte; ich hätte sowol Scheere wie Messer selbsten bezahlt, und zwar mehr, als sie doppelt werth sind. Ob der Botschafft ward er grimmig, knirschete mit denen Zähnen und kreischte. Sie ging von ihm weg und vermied so viel es möglich war, allein mit ihm zu reden. Als er merckte, daß das Weyb keinen Zettel von ihm entgegen nehmen wollte, benutzte er eine Zeit, als der Schloßv. nicht da war, und warff einen Zettel zu mir herein auff den Boden (und wäre selbiges Mal fast eine sonderliche Geschichte
passiret; denn als er die Zetteln hinein werffen wollte, ging des Schloßv. großer Hund vorbey, der zottiges Haar hat, und fiel der Zettel dem Hunde auff den Rücken, aber fiel wieder ab in die Ecke, wo der Hund schnüffelte). Auff dem Zettel stand: ›Gebet mir das Messer und die Scheere zurück, oder ich werde Euch ein so großes Unglück bereiten, wie ich Euch früher Dienste erzeigt habe, und will ich Euch das Messer und die Scheere bezahlen, müßte ich auch meine Hosen verkauffen. Gebt es mir strax!‹ Er ging etzliche Tage lang wie ein verstörter Mensch herumb, sintemalen ich nicht antwortete oder ihm durch das Weyb etwas sagen ließ; so daß Chresten das Weyb fragte, was sie Christian gethan habe, er ginge unten und knirschte mit den Zähnen und heulte wie ein toller Mensch. Sie antwortete, die dar unten müßten am besten wissen, was ihn anginge; er sähe wol, daß hier mit ihm recht freundlich geredet werde. Charfreytag Mittag war er gantz ergrimmt, schwur und verfluchte sich, ob er sich nicht selbst angeben sollte,
repetirte all das frühere, setzte hinzu, daß ich ihn verführt, durch Wein und Speise, Lichter und gute Worte betrogen hätte; er mache sich nichts daraus, wie es ihm auch gehen würde, wollte gerne von Büttels Hand sterben; aber ich, sie und Chresten sollten nicht entwischen. Der Nachmittag war nicht sehr erfrewlich für uns. Das Weyb war betrübt: ich bat sie, sie möchte sich zufrieden geben; es sey keine Gefahr bey sothaner Tollheit, wol aber ein großer Verdruß, weit härter als mein Gefängniß; aber ich wollte doch wol mit dem Schelm fertig werden. Sie nahm ihr Buch und las darin, und ich setzte mich und dichtete ein geistlich Lied über Christi Leiden nach der
Melodei: Wie der Hirsch im Durste lechzet.
Selbiges Lied war später Ursach, daß Christian wieder gantz artig ward, wie er mir später selbst erzählte; denn er hörte es mich einmal singen, und sagte er, daß es sein Hertz gerühret und Thränen in seine Augen gebracht habe (ich hatte damals kein anderes Schreiberzeug, als wie gemeldt ist).
Früher pflegte Christian mir an den Pfingst-Abenden farbige Eier zu verschaffen; damals stand es noch richtig bey ihm im Kopff. Als die Thür geschlossen ward, sagte ich zu Chresten: ›Vergesset morgen nicht weich-gesottene Eier!‹ Als Ostern Mittags das Essen herauff kam, und die Eier nicht gleich mit kamen (sie waren eine Neben-Speise) sah Christian mich an und machte mir drey bis vier Mal eine lange Nase (ich war gewohnt vor der Thür meiner Kammer auff und nieder zu gehen, wenn auffgeschlossen war). Ich blieb stehen und sah ihn an, zuckte die Achseln ein wenig. Bald nach diesen grimasses kam Chresten mit einer Schüssel voll weich-gesottener Eier. Christian schlug die Augen zuerst nieder, dann richtete er sie gegen mich, erwartete vielleicht, daß ich ihm itzt eine lange Nase machen sollte. Aber nichts weniger als dieses. Als das Weyb an die Treppe kam, sagte er: ›Es waren keine bunten Eier da.‹ Sie hinterbrachte es gleich, so daß ich sie bat, sie solle sagen, daß ich die weich-gesottenen Eier äße und die farbigen auffbewahrte, wie er sehen könnte (und schickte ich ihm vom vergangenen Jahr eines, auff welches ich etzliche Blumen gezeichnet hatte; das hatte er mir selbst gegeben, aber vor Kertzen). Er nahm es an; schrieb mir aber dann etwas auff einen Zettel, das war gantz rar. Es sollte von denen schweren Nöthen der Henne mit dem Ey handeln. Er wollte spitzig seynd, aber es hatte keinen rechten Schick. Ich kann mich dessen nicht mehr recht erinnern, ausgenommen, daß er schrieb, es wäre ein faules Ey gewesen, das ich ihm geschickt habe; sein Ey möchte blühen, wenn meines schon faulen würde. Was er darmit meinte, weiß ich nicht; vielleicht meinte er, ich würde in Elend sterben und er dagegen in Freyheit leben. Die Meynung ist verkehrt, denn sein gottloses Treiben in seiner Freyheit hat ihn später zur Verzweifflung gebracht, so daß er sich selbst todt schoß. Ob Gott mir in dieser Welt die Freyheit geben wird, ist ihm allein bekannt. Den Zettel warff er auch zu mir herein. Ich antwortete nichts darauff. Er ging wieder einige Tage und sagte nichts böses; dann ließ es ihm wieder keine Ruh. Ich glaube wol, es that ihm leyd, daß er Chresten offt meinen Wein im Becher zurück bekommen sah. Zuweylen beschenckte ich den Schloßv. darmit. Speise erhielt er auch nicht, weder vor ihn noch vor seinen Buben. Eines Tags sagte er zu dem Weyb: ›Was düncket Euch, daß wol der Schloßv. sagen würde, wenn er wüßte, daß Ihr denen gefangenen was zu essen gebt von seiner Speise? (Die Speisen, so von meinem Tisch kamen, wurden zu dem Schloßv. hinunter getragen). Saget ihr das!‹ Das Weyb fragte, ob sie es mir in seinem Aufftrag sagen solle. ›In wessen Aufftrag sonsten?‹ antwortete er. Ich ließ ihm erwidern, daß ich von denen Speisen, so zu mir kämen, so viel nehmen könnte, wie mir beliebte; mir würden sie nicht zugemessen oder zugewogen; mit dem, so ich nicht haben wollte, könnten sie thun, was die wollten, welche Recht darauff hätten; früher gehöre es keinem. Darmit konnte er uns auch nicht bange machen. Dann kam er eines Tags wieder mit dem alten Schnickschnack herfür, daß er die Scheere und das Messer haben wolle, und drohete er, sich selber anzugeben; und da es fast zu der Zeit war, daß ich das h. Nacht-Mahl nahm, sprach ich zu dem Weyb: ›Sagt ihm ein vor alle Mal: wenn er sich nicht in Zucht halten kann, werde ich, sobald der geistliche kommt, ihn angeben, und die erste Karen soll Rede stehen; sie soll, ja so mir Gott! erst herbey, denn sie ließ seiner wegen keine Ruh, ehe ich mich mit ihm einließ. Sie soll in gutem oder in bösem die Wahrheit sagen, dann werden wir sehen, wen das Unglück trifft.‹ Er könnte thun, was ihm beliebte, ich aber wollte Ruhe haben; er möge mich mit seinen Zetteln verschonen, oder ich würde sie vorzeigen. Als das Weyb ihm das sagte, dachte er nach; fragte: ›Sagt sie das?‹ ›Ja‹ (schwur das Weyb) ›das that sie!‹ Sie sagte noch mehr: ›Was glaubt er wol? Meinet er, daß ich als eine gefangene, die nirgends hin gehen kann, davor büßen werde, weil ich die Dienste eines gefangenen annahm, der eine Freyheit hat, die ihm nicht gebühret?‹ Er stand und ließ den Kopff hängen und antwortete gantz und gar nichts. Das setzte den Kerl zurecht, und hörte ich seitdem nicht ein un-schickliches Wort von ihm. Er sprach freundlich und gut mit dem Weyb auff der Treppe, erzählte, was er newes hörte, und war ganz geschäfftig; und als sie ihn einst nach seinem Becher fragte, umb Wein hinein zu geben, sagte er trawrig: ›Ich habe keinen Wein verdient.‹ Das Weyb sagte, er könnte gleichwol Wein kriegen, ich begehrte keinen Dienst mehr. So bekam er hie und da Wein, aber nichts zu essen. Seinen Buben mit Namen Paaske konnte er nicht so sehr hüten, daß das Weyb ihm nicht ein Stück von einer Speise vor die Thür legte. An dem Tag, als ich das h. Nacht-Mahl nahm, kam er an die Thür und klopffte leise. Ich ging zur Thür. Er grüßte und wünschte mir Glück mit gantz guter Manier, sagte darbey, daß er wüßte, ich hätte ihm verziehen, was er mir zuwider gethan habe. Ich antwortete ja und gab keine weitere matière zu der Frage; er auch nicht, sprach über andere Kleinigkeiten und ging dann weg. Darnach kam er jeden Tag zur Thür und erzählte, was er newes hörte; bekam auch Wein und Speise. Er sagte unter anderem, daß viele der Meinung seyen, alle gefangenen würden losgegeben, wenn der Printz (nu unser König) seine Hochzeit hielte, wie erzählet wurde, daß die Braut binnen einem Monat ankommen (es war Ende Aprilis, als darüber gesprochen ward) und daß die Hochzeit auff dem Schloß gehalten würde. Mit der Ankunfft der Braut zog es sich hin bis Anfangs in Junio, und da ward die Hochzeit in dem Schloß zu Nykjøbing auff Falster gefeyert. Viele waren der Meinung, daß es dort geschah, damit nicht die Braut mich und den Docter los bitten sollte. Die Braut hatte zu Nykjøbing vor mich gebeten, aber kein Gehör gefunden. Das sey gefährlich vor Land und Leute. Als die Braut nach Copenhagen geführet werden sollte, sagte ich zu Christian: Nu ist es Zeit vor Euch, los zu kommen. Lasset Euer Mädchen auff passen und einen Knie-Fall vor dem Wagen der Braut thun und eine Supplique überreichen, dann bin ich sicher, daß Ihr los kommet.‹ Er fragte, wie das Mädchen darzu kommen sollte, vor ihn zu bitten. Ich sagte: ›Es ist ja Euere Braut.‹ ›Nein (schwur einen gräßlichen Eyd), das ist sie nicht! Sie bildet sich das wol ein, aber ich will sie (schwur abermals) nicht haben.‹ ›Dann lasset sie in der Meinung‹ (sagte ich) ›und ihre supplication wie vor ihren Bräutigam machen.‹ ›Ja‹ (sagte er) ›das kann sie wol thun.‹ Es geschah so wie ich gerathen hatte, und Christian kam den 11. Junii 1667 los. Er nahm keinen Abscheidt von mir, ließ mich nicht einmal durch den Thurmwächter oder den Buben grüßen. Der Danck gegen sein Frawenzimmer war, daß er den selbigen Abend ihr die Fenster einschlug, und er rumorte in Trunckenheit dergestalt auff der Straße, daß er in den Rathhaus-Keller Es war ein Sonntag; das war die Ehre, so er Gott erzeigte. Er ging in's Wein-Haus statt in's Gottes-Haus. Umb 12 Uhren kam er heraus. gefangen gesetzet ward; kam doch den nächsten Tag heraus. Sein Bursch Paaske, nahm von seinem Herrn Abscheid. Als er ihn fragte, ob er uns etwas von ihm sagen sollte, antwortete er: ›Sag ihnen, daß ich sie zum Teuffel schicke!‹ Paaske, der diese Botschafft brachte, sagte, er hätte Christian geantwortet: ›Meinerhalben!‹ (denn Christian suspicirte Paaske schon, daß er dem Weyb Dienste erzeige.) Wir hatten ein hertzliches Gelächter über diese Botschafft; denn ich sagte, Paaske kriegte den halben Theil davon, alsdann bekäme ich nichts. Unsere Freude war nicht gering, daß wir des gottlosen Menschen quit geworden waren.
Wir lebten dann in guter Ruhe im 1668. Jahr, ich schrieb und war mit unterschiedlichem zur Hand-Arbeit providiret, so daß Chresten nichts für mich kauffte außer einem Paar Bücher, und die mußte ich doppelt und mehr als doppelt mit Kertzen bezahlen. Karen blieb das erste Mal an die vier Jahr bey mir; und da ihre Tochter sich damals verheyrathete, und sie gern auff die Hochzeit gehen wollte, sprach sie mit mir darüber, wie man das anstellen könnte, denn sie möchte gerne wieder kommen, wenn das Weyb, das ich statt ihrer bekäme, weg ginge. Ich wußte nicht, ob das geschehen könnte, wol aber, daß sie hinaus kommen würde, ohne sich kranck zu stellen, das wollte ich wol zuwege bringen. Der Schloßv. hatte damals schon als Bevollmächtigten Peder Jensen Tøtzløff, der hin und wieder sein Ambt verrichtete. Ihm ließ ich den Vorschlag machen und beklagte darbey die Kümmerlichkeit des Weybes; redete später mit dem Schloßv. selbst darüber, der war gantz willig darzu, denn er mochte nicht nur diese Karen wol leiden, sondern er hatte auch ein Weyb im Haus, so er gern zu mir bringen wollte.
Karen Nels Tochter kam denn eines Abends hinunter und eine teutsche mit Namen Cathrina kam davor herauff. Karen nahm mit fließenden Thränen Abscheidt. Sie hatte fast den gantzen Tag geweinet, und versprach ich ihr, mein bestes zu thun, daß sie wieder zu mir käme, wenn die andere wegginge. Die Cathrina war von Jugend auff unter denen Soldaten gewesen, war mit einem Lütenant verheyrathet zu der Zeit, da der Schloßv. Trommel-Schläger war, und stand Gevatter zu einem seiner Söhne; verarmte nach ihres Mannes Tod, saß und spann bey des Schloßv. Weyb vor Speise und Tranck. Sie war flux dem trincken ergeben, und ihre Hände zitterten, so daß sie nicht den Becher halten konnte, sondern ihn gegen ihren Leib stützen mußte, desgleichen die Suppen-Schüssel. Der Schloßv. sagte mir, bevor sie herauff kam, daß ihre Hände manchmal ein wenig zitterten, doch nicht alleweil; sie wäre kurtze Zeit vorher kranck gewesen; es würde wol wieder vergehen. Als ich sie selbst fragte, wie sie das gekriegt hätte, sagte sie, das hätte sie schon viele Jahre. Ich sagte: ›Ihr seyd nicht ein Weyb, das mich recht bedienen kann, denn wenn ich kranck werde, wie ich es vor einem Jahr oder etwas später war, so könnet Ihr mich nicht bedienen.‹ Sie fiel gleich auff ihre Knie nieder, weinte bitterlich, bat umb Gottes willen, daß sie bleiben dürffte; sie sey eine arme Wittib, und sie hätte dem Schloßv. die Hälffte des Geldes versprochen, so sie verdiente; sie wolle Gott hertzlich bitten, daß ich nicht kranck werden möchte, und sie würde mir trew seyn, ja für mich sterben. Mir schien, daß das letzte zu viel gesagt war, als daß ich ihr hätte glauben können (sie hielt doch Wort und that, was ich ihr befahl, und ich ward zu ihrer Zeit auch nicht kranck). Sie mochte nicht arbeiten. Sie legte sich meistens, wenn sie gegessen hatte, gleich nieder und zog die Decke vor die Augen, sagte: ›Nu kan ick nichts sehen.‹ Als sie wahrnahm, daß ich es wol haben mochte, wenn sie plauderte, so erzählte sie gantze Comedien in ihrer Weise, agirte selbige auch offt und stellte unterschiedliche Personen für. Wenn sie eine Geschichte zu erzählen anfing und ich mitten in der Erzählung sagte: ›Das wird einen jämmerlichen Ausgang nehmen,‹ so sagte sie: ›Nee, dat krigt en gut Ende;‹ machte ihrer Geschichte auch ein gutes Ende. Umgekehrt, wenn ich das Gegentheil sagte. Sie tantzte auch vor mir und das vor 4 Persohnen, redete darzwischen vor eine jede, statt welcher sie tantzte, kniff den Mund und die Finger zusammen. Die Comedianten nannte sie Medicoanten. Zu ihrer Zeit fiel manches vor, das mich hinderte, auff ihre Possen zu hören und zu sehen. Ein Paar Monate darnach sie zu mir gekommen war, bekam sie das kalte Fieber. Sie weinte und war bange. Ich war wol mit ihr zufrieden, gedachte zu sehen, was der Glaube ausrichten könne, schrieb etwas auff einen Zettel und hängte ihn ihr um den Hals. Das Fieber ging weg, und schwur sie, daß alles böse im Körper wie auff einmal ihr in die Beine gefahren sey, als ich ihr den Zettel umb den Hals hing. Sie kriegte auch strax dicke Beine.
Es geschah, daß
Walter, der in Folge von
Dinas Sache aus Dännemarck verwiesen war, von Schweden kam und sich unbekannt in Copenhagen auffhielt; er ward ergriffen und hier in den Thurm gesetzt, unten im Erdgeschoß des Thurms. Er war
suspiciret, etwas zu
tramiren. Zur selbigen Zeit saßen ein französcher Koch und ein schwedischer Bäcker mit ihm, so beschuldiget waren, den König und die Königinn haben vergifften zu wollen. Der schwedische ward in's Gitterloch gesetzt, gleich nachdem
Walter gekommen war. Es dawerte etzliche Tage, ehe ich
Walters Ankunfft wissen durffte, wußte es aber doch. Eines Tags zur Mittags-Zeit, als
Walter und der Franzos laut schrien (denn sie
disputirten allzeit mit einander), fragte ich den Schloßv., was er dar unten vor Gäste hätte, die französch redeten. Er antwortete, er hätte welche von verschiedenen
Nationen, erzählte dann, wer sie seyen, aber warumb sie säßen, wüßte er nicht, insonderheit
Walter's Beschuldigung nicht. Die zwey vorbemeldten kriegten Krakehl mit einander, so daß
Walter zu dem Schweden in das Gitterloch gesetzt ward, und der Franzos in die Dunckle Kirche, woselbst er kranck wurde und kam nie an das Guckloch in der Thür, sondern lag drinnen. Ich durffte ihm nichts senden wegen der Beschuldigungen wider ihn.
Walter saß lange dar unten, und der Franzos kam heraus. Als
M. Bock zu mir kam, mir Christi Leib und Bluth zu reichen, erzählte ich ihm vor dem h. Nacht-Mahl die Angelegenheit
Walters, die wol bewiesen war, aber sagte ihm darbey, daß zu der Zeit, als ich durch Uldrich Christian Gyldenlöve aus dem Reich Dännemarck verwiesen wurde, da hätte bemeldter Gyldenlöve mir geschworen, daß der König damals nicht recht von der Sache überzeugt war, und ich hätte beklagt, daß Se.
Maj. nicht darnach getrachtet habe, sich zu überzeugen; ersuchte den geistlichen, den Statthalter zu bitten, er möge zuwege bringen, daß
Walter itzt in
Dinas Sache
examiniret werde, und daß er und ich in etlicher
Ministri Gegenwart
confrontiret werden möchten; das könnte ohn großen
bruit geschehen, denn die Herren könnten durch den geheimen Gang in den Thurm kommen. Der geistliche versprach, dieses auszurichten,
Als der geistliche von mir ging, sprach er mit Walter vor dem Gitterloch, sagte ihm mein Begehren, und was darauff folgen würde.
Walter lachte spöttisch und sagte: ›Ick häbbe nicht en Haar, dat dar för bange is, dat de Sake skulle gerört werden. De Königin weed dat wol, sagt Ji dat ock.‹
NB. Waährend
Walter im Gitterloch saß, hatte er an die Königin geschrieben, aber der König bekam es. that es auch, und wurde
Walter den dritten Tag darauff in die Dunckle Kirche gesetzet, so daß ich eine lange Zeit hindurch jeden Tag erwartete, wir würden in's Verhör kommen, doch diejenigen, so die Macht hatten, verhinderten es.
AdÜNämlich Königin Sophia Amalia und ihr Anhang. Ich sah durch ein Loch in meiner äußersten Thür zur Zeit als
Walter in die Dunckle Kirche hinauff geführet ward. Er weinte sehr laut. Später sah ich ihn einmal vor dem Loch der Thür seines Gefängnisses. Er war sehr beschmutzt, hatten einen breiten Bart voll von Un-rath, große Zotteln.
Walter blieb dann sitzen, stritt fast jeden Tag mit Chresten, schalt ihn einen Dieb und Rauber (denn Chresten hatte etzliche
Ducaten gefunden, so
Walter unter einem Stuhl verborgen hatte; der tolle
Walter ließ den Schweden sehen, daß er
Ducaten und ein Tintenfaß unter dem Stuhl zwischen die Gurten steckte, und später schlug er den Schweden, der ihn verrathen hatte). Chresten ließ
Walter unter dem Vorwand, daß er Bewegung machen sollte, hinaus gehen; inzwischen untersuchte er den Stuhl. Man kann sich wol dencken, daß das ewige schelten Chresten verdroß,
procurirte ihm nicht sonderlich gute Speise aus der Küche, so daß er von den zween Gerichten, so ihm
ordiniret waren, zuweilen keines essen konnte; und als
Walter einmal sagte: ›Wolltet Ihr mir nur ein Gericht geben, wovon ich essen kann, so wäre es schon genung,‹ richtete Chresten es so ein, daß
Walter nur ein Gericht bekam und offt nicht mal von dem essen konnte (das war Chrestens eigener Schade, denn er kriegte sonst die übrigen Speisen, wollte sie aber gerne missen, wenn es dem anderen übel erging). Einmal kam Chresten mit einem Zimmet-Reis zu ihm, fing strax einen Krakehl mit ihm an, so daß der andere zornig ward (grade wie die Kinder) und nichts essen wollte. Christen trug den Reis gleich wieder weg und lachte hertzlich. Ich sagte in des Schloßv. Gegenwart zu Chresten: ›Hat Gott lange gewartet,
Walter zu straffen, so kommt es itzt desto ärger, denn er hätte nie in un-barmhertzigere Hände fallen können als in Euere.‹ Er lachte hertzlich darüber, und der Schloßv. that desgleichen. Und da ein Loch von der Dunckeln Kirche in die äußerste Vorkammer reicht, so können die, so darinnen sind, hinauff ruffen, so daß man deutlich hören kann, was sie sagen. So rieff
Walter einmal dem Schloßv. zu und bat ihn, er möchte ihm ein Stück Braten geben. Der Schloßv. rieff ihm zu: ›Ja, man skal Ju en Rotte braaden!‹ Ich schickte ihm ein Stück Braten durch Chresten. Als er es entgegen nahm und erfuhr, daß ich es ihm schickte, da weinte er. So ging die Zeit hin, ich hatte immer Arbeit, schrieb auch viel.
Aus Büchern, die mir heimblich geliehen wurden, und das mit bemeldter Feder und Tinte auff Stücke Pappir, wie ich sie grade bekommen konnte. Dem geistlichen ward es überdrüssig, mir das h. Nacht-Mahl zu reichen, ließ mich 13, 14 Tage wartten; wenn er dann kam, verrichtete er sein Ambt
par manière d'acquit. Ich sagte nichts darüber, aber das Weyb, so eine teutsche ist, erhielt auch von ihm das h. Nacht-Mahl; sie hielt sich darüber auff, insonderheit einmal (das letzte Mal, als sie von ihm versehen ward); denn da wartete ich 4 Tage auff ihn, ehe es ihm zu Paß war, und da kam er, es war gerade ein Dinstag, gegen 9 Uhren. Er grüßte nie, noch weniger wünschte er Glück zu dem Unternehmen. Da sagte er, als er die Hand gab: ›Ich habe nicht lange Zeit zu warten; ich muß ein Kindt tauffen.‹ (Ich wußte wol, daß dieses nicht wahr sey, antwortete aber:) ›In Gottes Nahmen!‹ Als er dem Weyb die Beicht abnehmen sollte, mochte er sich nicht setzen; sagte: ›Nu macht fort! Ich habe keine Zeit;‹ ließ ihr kaum Zeit, ihre Beicht herzusagen,
absolvirte sie schnell und las die Weihe wie auff der Post. Als er weg war, wurde das Weyb sehr un-geduldig, sagte, daß sie bey einem Soldaten-Geistlichen im Felde das h. Nacht-Mahl nahm, als die gantze
Compagni desgleichen that (sintemal selbige bereit stand, sich nächsten Tags mit dem Feind zu schlagen), aber der geistliche hätte nicht ›so Gottes Wort utgejaget, als diße gedan had;‹ sie hätte nichts darvon. Ich tröstete sie, so gut ich konnte, las und sang ihr vor, sagte, sie solle berewen und sich ihre Sünden leid seyn lassen, sich Mühe geben, ihr Thun und Treiben zu bessern und sich nicht durch die geringe Andacht des geistlichen irre machen lassen; sie solle Christi Leyden und Verdienst zur Vergebung ihrer Sünde sich zu eigen machen, seinen Leyb und sein Bluth hätte der geistliche ihr in dem Brote und dem Wein gereichet. ›Ja,‹ antwortete sie, ›ick skal mii, will's Gott, bäteren.‹ Ich sagte: ›Will Ji mii holden, dat Ji mii gelofft häbt?‹ Ihr Gelöbniß war, sich nicht so zu betrincken, wie sie es einmal gethan hat. Ich will nicht unterlassen, dieses zu vermelden. Sie erhielt, wie gesagt ist, eine viertel Kanne franschen Wein bey jeglicher Mahlzeit, und ich eine viertel Kanne rheinschen Wein. Beide Theile konnte sie trincken, ohne gantz betruncken zu seyn; denn zu ihrer Mahlzeit tranck sie den franschen Wein, legte sich dann; wenn sie Nachmittags auff stand, tranck sie meinen Wein.
Chresten war mit dem Weyb nicht wol zu Frieden, denn er bekam zu ihrer Zeit nie einen Trunck Wein, so daß er einmal den Wein aus ihrer Kanne stahl und davor Piße mit Wasser hinein gab; da machte sie einen Heyden-Lärm, bat mich umb Gottes willen, ich solle ihr Urlaub geben, Chresten mit der Kanne auff den Schädel schlagen zu dürffen. Sie kriegte diesen Urlaub nicht; sagte es Chresten später, daß sie es meinetwegen nicht dürffte. Sie hatte auff der Wange eine große Narbe, so ihr ein Soldat früher vor eine solche That beygebracht hatte. Vom Abend bewahrte sie meinen Wein bis zum Frühstück auff, aber einmal hatte sie in einer Kanne sowol meinen wie ihren Wein, so daß sie zu Mittag zwey viertel Kannen Wein hatte; da saß sie und pichelte ihn so sachte in sich hinein, und ich achtete nicht darauff, saß just in einer
Speculation über ein Muster, so ich häkeln wollte. Endlich sah ich sie an, als es so lange dawerte, daß sie sich nieder legte; da kehrte sie alle Gefäße umb, eines nach dem anderen, und war nichts darinnen. Ich redete sie an und sprach: ›Wo is et? Häb Ji all de Wiin utdruncken?‹ Sie konnte kaum antworten, wollte stehen und konnte nicht. ›Tho Bäd, Ji fulle Söwge!‹ (sagte ich). Sie wollte gern, aber konnte nicht, spie an sich hinunter, kroch an der Wandt entlang, eine Schüssel zu holen. Als sie die Schüssel hatte, konnte sie nichts darmit anfangen. Ich sagte, sie solle nach dem Bett kriechen und sich nieder legen. Sie kroch hin und fiel mit der Nase auff das Bett, und die Beine standen auff der Erde. Dort spie sie abermals, blieb so liegen und schlieff (wie zu Frieden ich war, ist leicht zu dencken). So schlieff sie ein Paar Stunden, hatte doch den Rausch nicht gantz ausgeschlaffen; denn als sie sich rein machen sollte, blieb sie eine gantze Weyle auff einem niedern Stuhl sitzen, die Schüssel zwischen denen Beinen, das Haar umb die Ohren. Das Schnürleib nahm sie ab, es zu trocknen, und so saß sie mit offener Brust, alles standt offen und zween schlimme schwartz-braune Flaschen hingen heraus, beklagte sich, betete, Gott möge ihr helffen; sie wär dem Tode nah. Ich war wol zornig, aber ich konnte mich kaum für lachen halten bey dieser schlimmen Schilderey. Als das jammern und klagen kein Ende nahm, sagte ich in Zorn: ›Ja, Gott skull Ju wol helpen, Ji versaapen Düffwel! Hin naa de
Cordegarde mit Ju! Ick wil so en Fulfack nicht bii mii hebben. Hin! Slaapt bäter ud, en lat mii nicht hören, dat Ji von Gott sprächet, wan Ji duen siit, dan so is Gott wit van Ju, und de Düffwel bii Ju!‹ (Ich lachte später über mich selbst). Sie legte sich wieder, und gegen 4 Uhren war sie wieder gantz nüchtern, machte vollkommen rein, saß dann und weinete leise. Dann warff sie sich mit großer Hast mir zu Füßen, hielt sich daran fest, heulte und posaunete zum Himmel hinauff und bat umb Gottes willen, ich möchte ihr es dieses eine Mal vergeben, das sollte nie wieder geschehen; erzählte, wie sie den Wein auffbewahrt habe
etc.; wollte ich sie nur noch ein halbes Jahr behalten, dann hätte sie so viel, daß sie sich in ein Spittel-Haus zu Lübeck einkauffen könnte. Ich dachte, ich wollte sie wol hüthen, daß sie nicht wieder so viel auff einmal bekäme, wie auch, daß ich vielleicht eine in anderer Weyse schlimmere statt ihrer wieder kriegen könnte. Karen konnte zu der Zeit nicht kommen, denn ihre Tochter sollte in das Wochen-Bett, und ich wußte, daß sie dann nicht ruhig gewesen wäre. So versprach ich ihr denn, sie so lange zu behalten. Sie hielt auch Wort; und ich richtete es so ein, daß sie keinen Wein mehr bekam, welchen auch die Weyber seitdem nicht mehr erhielten; mein Wein allein konnte ihr keinen Schaden thun. Mit
Walter war sie gantz vertrawlich. Sie hatte ihn früher gekannt, und war Chresten der Meinung, daß er ihr all sein Geldt gegeben habe, ehe er kranck ward; denn er sagte, daß
Walter kein Geldt mehr hätte. Was daran war, weiß ich nicht. Trew war sie nicht, denn sie stahl mir zuerst ein messingene Strick-Nadel, die ich damals brauchte; sie war wie eine Haar-Nadel geformt und glaubte das Weyb nicht anders, als daß sie von Goldt sey. Da meine Kammer nicht groß ist, so konnte sie bald durchsucht werden; aber ich suchte drey Tage hindurch jeden Tag und konnte die Nadel nicht finden. Ich konnte wol wissen, daß sie sie hatte, denn sie ist nicht so klein, daß man sie nicht hätte sehen können, weshalb ich später sagte: ›Es liegt mir nicht viel an dieser Messing-Nadel; ich kann vor 2
![]() eine wieder kriegen.‹ Den nächsten Tag zeigte sie mir die Nadel in einer großen Ritze auff dem Fußboden zwischen denen Steinen. Sie fandt später, kurtz bevor sie fort kam, einen meiner güldenen Ohrringe, den ich verlor und der sonder Zweiffel an dem Kissen sitzen geblieben war, denn er war ein Schlangen-Ring, der kam nicht wieder, ich mochte ihr darüber sagen, was ich wollte. Sie suchte ihn zum Schein in dem Un-rath draußen. Sie wußte, ich durffte nicht darüber reden, daß ich ihn vermißte.
eine wieder kriegen.‹ Den nächsten Tag zeigte sie mir die Nadel in einer großen Ritze auff dem Fußboden zwischen denen Steinen. Sie fandt später, kurtz bevor sie fort kam, einen meiner güldenen Ohrringe, den ich verlor und der sonder Zweiffel an dem Kissen sitzen geblieben war, denn er war ein Schlangen-Ring, der kam nicht wieder, ich mochte ihr darüber sagen, was ich wollte. Sie suchte ihn zum Schein in dem Un-rath draußen. Sie wußte, ich durffte nicht darüber reden, daß ich ihn vermißte.
Der Schloßv. kam zu der Zeit selten herauff; Peder Jensen bediente mich. Zu der Zeit waren 6 gefangene meine Nachbarn. Die 3 waren Bawern von Femeren, so beschuldigt waren, Schafe ausgeführt zu haben, die anderen 3 dänische. Sie hielten sich in zwey Theilen zusammen, und da die Dänen der Thür zunächst waren, so gab ich ihnen was zu essen; sie waren auch etzliche Zeit vor den anderen gefangen gesetzt. Wenn die Danen nach ihrem Brauch ihre Morgen- und Abend-Psalmen sangen, so brüllten die Deutschen aus Leibes-Kräfften einen anderen Gesang, umb sie zu überschreyen, sangen meistens das Dorothea-Lied. Königl. Majt. war kurtze Zeit kranck, starb den 9. Februarii 1670. Und da selbigen Tags umb 12 Uhr auff dem Schloß geläuttet ward, konnte ich wol wissen, was solches zu bedeuten hatte, das Weyb aber nicht. Wir sprachen mit einander darüber, wer es seyn könnte. Sie konnte wol mercken, daß ich trawrig war, und sagte sie: ›Das könnte wol vor den König seyn, denn das letzte Mal, als ich ihn hier von der Treppe aus dem Wagen steigen sah, da konnte er nur kümmerlich gehen, und da sagte ich bey mir selbst, daß es wol bald mit ihm vorbey wäre. Ist er todt, so kommet Ihr los, das ist gewiß.‹ Ich schwieg und dachte was anderes, was auch geschah. Gegen 4½ Uhren ward gemeiniglich Feuer in dem Ofen da draußen gemacht, und das von einem Burschen, den Chresten damals hatte. Den rieff ich zur Thür und fragte ihn, warumb zu Mittag eine gantze Stunde geläuttet ward. Er antwortete: ›Ich darff es nicht sagen; es ist mir verbothen.‹ Ich sagte, daß ich ihn nicht verrathen wolle. So sagte er denn, daß der König in der Morgenstunde gestorben sey. Ich ließ den Thränen ihren freyen Lauff, die ich verhalten hatte, worüber das Weyb sich verwunderte und einen langen Tratsch machte. Ich schwieg zu alle dem was sie sagte, denn ich trauete ihr nie; bat sie, Chresten zu fragen, wenn er die Thür auff schlösse, was das läuten bedeutete. Sie that es, aber Chresten antwortete, daß er es nicht wüßte. Der Schloßv. kam selbigen Abend herauff, sprach aber nicht mit mir. Am nächsten Tag zu Mittag kam er auch herauff. Ich begehrte, mit ihm zu reden und fragte, warumb geläuttet ward. Er antwortete spöttisch: ›Wat is ju daran gelegen? Lüded het nicht alle Dage?‹ Ich antwortete und das etwas zornmüthig: ›Wat mii daran gelegen is, dat wet Gott! Dat wet ick ock, dat för Jues Glicken de Klocke oppet Slot nicht wird gelüdt!‹ Er nahm seinen Hut ab und machte eine Rewerentz und sagte: ›Waßet anders nicht, dat de Frue mii wolde?‹ Ich antwortete: ›Ju St. Marten kombt ock wol en Mal.‹ ›St. Marten?‹ sagte er und lachte, ging damit weg und hinaus zu Walter, standt sehr lange und flüsterte mit ihm vor dem Guckloch; ich konnte ihn sehen, das wußte er wol. Als ich Kleider bekommen sollte, begehrte ich Trawer-Kleider. Da fragte der Schloßv. mich, vor wen ich trawern wollte, und das gantz spöttisch. Ich antwortete: ›Dat is nicht för Ju Mom; de kombt mii nicht toe för to truren. All is Ju Möm lang dodt, so men ick, dat ji doch wol Orsake hefft to truren, so wol als ick.‹ Er sagte, er wollte es berichten; gleich bekam ich es nicht. Er hat ihm sonder Zweiffel von des Königs Tod gesagt und ihm Hoffnung gemacht, daß er aus seinem Gefängniß kommen werde. Gott gedachte es anders zu machen. Walter ward kranck, lag lange Zeit gantz elendiglich. Er war schlimm gegen Chresten, nahm Un-rath vom Boden und warff ihn in die Speisen, spuckte in das Bier und ließ Chresten das sehen, wenn er die Kanne fort tragen sollte. Chresten bekam alle Tag die Titteln Dieb und Schelm, so daß es leicht zu dencken ist, wie Chresten ihn plagte. Wenn ich ihm etwas Speise schickte, gesottenes und gebratenes, so kam Chresten darmit zurück und sagte, er wolle es nicht haben. Ich bat Chresten, es bey ihm stehen zu lassen, er äße es wol später. Das geschah einmal, und ließ Chresten mich sehen, wie es voll war von Schnodder und Un-flath. Chresten ließ mich einmal ein Brod sehen, woraus Walter die Krumen genommen und es voll Stroh und Un-rath gestopfet hatte, ja mit seinem eigenen Un-rath! Wenn Chresten Walter im Bett umbwenden sollte, so schrie dieser so erbärmlich, daß ich Mitleid mit ihm hatte und bat Chresten, er möge nicht so un-barmhertzig gegen ihn seyn. Er lachte und sagte: ›Er ist ein Schelm.‹ Ich sagte: ›Dann ist er in seines Meisters Händen.‹ Das gefiel Chresten wol. Walter litt viele Schmertzen; endlich erlösete Gott ihn. Seine Leiche blieb im Gefängniß, bis sein Bruder kam, der ihn in der teutschen Kirche begraben ließ.
Als ich vernahm, daß Karen wieder zu mir kommen könnte, und die Zeit zu Ende war, die ich der anderen versprochen hatte, sie zu behalten, kam Cathrine hinunter, und Karen wieder zu mir. Das war leicht zu Wege zu bringen, denn der Schloßv. war nicht wol zufrieden mit Cathrina; sie gab ihm nichts von ihrem Geldt, wie sie ihm versprochen hatte, statt dessen allerley leere Worte: daß es nicht sein Ernst sey, daß er nichts von ihr haben wolle etc. Der Schloßv. nahm auch das Weyb scharff in's Examen, daß sie mir gesagt hätte, der König sey todt: es würde nicht so gut gehen, wie ich dächte. Sie gab ihm Schlag vor Schlag. Der Schloßv. fing auch flux an, mich gering zu schätzen, als er vernahm, daß meine Erlösung nicht zu erwarten sey.
Als die Zeit kam, wo ich gewöhnt war, mich versehen zu lassen, bat ich den Schloßv., er möge zuwege bringen, daß ich den Hoff-Predicanten,
D. Hans Læt bekäme; der frühere Hoff-Predicant,
D. Mathias Foß hatte mich zum ersten Mal in meinem Gefängniß versehen. Der Schloßv. brachte mein Begehren an; ward von königl.
Majt. auch bewilliget.
D. Hans Læt war schon unten im Thurm, wurde aber zurück geruffen, sintemal die Königin-Wittib (die noch auff dem Schlosse war) es nicht wollte; und ließ der Schloßv. mir durch Peder Jensen sagen, der König hätte gesagt, ich sollte bey dem geistlichen bleiben, an den ich gewöhnt war, so daß die
preparatoria, die zu dieser christlichen Mahlzeit vonnöthen sind, den nächsten Tag hingesetzet wurden, als
Mag. Buck zu mir kam und mich un-gewöhnlich grüßte, wünschte mir mit einem langen
Sermon Glück zu meinem Vorhaben,
tittulirte mich: Ihr Gnaden. Als er sich setzte, sagte er: ›Ich hätte gerne gewünschet, daß D. Hans Læt wäre an meine Stelle gekommen.‹ Ich erwiederte: ›Das hätte ich auch gewünschet.‹ ›Ja‹ (sagte er), ›ich weiß wol, warumb Ihr das so gewolltet haben. Ihr wollet neues wissen, und das ist mir verbothen. Ihr habt schon einen umb's Brot gebracht.‹ Ich fragte ihn, ob ich jemals begehret, von ihm neues zu wissen. ›Nein,‹ (erwiederte er) ›Ihr wisset wol, daß Ihr von mir nichts würdet erfahren; darumb habt Ihr mir auch nicht gefraget.‹ ›Meint der H.
Mag. dann‹ (sagte ich), ›daß ich D. Hans Læt habe begehrt, umb neues zu wissen?‹ Da stutzete er; sagte endlich: ›Ihr habt
D. H. Læt haben wollen, umb für Euch beym König zu sprechen.‹ (Ich sagte:) ›Dar kann wol etwas an seyn.‹ Darauff begann er, sich auff allerley Weise (wie ich nie zuvor gehöret habe)
Unter seinen gräulichen Flüchen war auch der, ›daß er an der Zungen mögte verlähmen, wann er nicht für mich gesprochen.‹ Das Jahr darauff schlug Gott ihn mit Verlähmung an der Zungen, ward vom Schlag gerührt, lebte noch 8 Tage, war bey Sinnen, hatte aber keine Sprache, und starb; erlebte doch den Tag, daß ein anderer geistlicher mich versah. zu verfluchen: wenn er nicht für mich gesprochen habe. (Ich dachte: ich glaube wol, daß du für mich gesprochen hast, aber nicht auff's beste.) Er hatte mir ein Buch gegeben, das ich noch habe, ist:
St. Augustini Manuali, das hatte Statthalter
Gabel gekaufft, was er mehr als einmal sagte, schwur bey Gott, das hätte dem Herrn Statthalter 1 Rdlr. gekost (mir fielen die 5 tausend Rdlr. ein, so
Gabel erhielt, darmit wir auff Borringholm aus dem
Arrest heraus kämen, aber ich sagte nichts darzu; vielleicht
repetirte er deshalb die Gabe so offt). Ich fragte ihn, wen ich umb's Brod gebracht habe. (Er antwortete:) ›Hanns Balcke! Der hat Euch gesagt, daß Rentmeister
Gabel Statthalter ist, und das hätte er nicht thun sollen.‹ (Ich sagte:) ›Ich glaube nicht, daß Balcke hat gewußt, daß er's nicht sagen sollte, denn er hat's mir nicht als eine Heimlichkeit gesagt. Man sollte können sagen, der H.
Magister hätte Balcke umb's Brot gebracht.‹ Darob ward er flux erzürnet, und darüber kamen unterschiedliche
disputte.
Vernahm da, daß dieses die Ursach war, daß Balcke weg kam. Er fing so gut wie von vorne wieder an, daß ich
D. Læt haben wollte, er wüßte wol warumb. Ich sagte: ›Ich bin nicht eigentlich darauff gestanden,
D. Læt zu begehren, sondern, wo nicht ihn, dann den Schloß-Prediger oder einen andern.‹ (Er fragte:) ›Warumb einen andern?‹ (Ich erwiederte:) ›Darumb, daß es nicht alleweile dem H.
Magister gelegen ist. Ich habe 10, 12 ja 14 Tage nach ihn warten müssen, und das letzte Mal that er sein Ambt in großer Eyle, so daß es nicht seine Gelegenheit ist zu kommen, wann ich ihn begehre.‹ Er saß und drehte die Worte, wußte nicht recht, was er antworten sollte, sagte endlich: ›Ihr meint, nu soll es besser gehn, weil der König Friderich todt ist. Nein, Ihr betrügt Euch! Es wird mit Euch schlimmer gehen, schlimmer wird es Euch ergehen!‹ Und da er sich
alterirte, so ward ich gesetzter und fragte mit Sanfftmüthigkeit: warumb das? und woraus er das schließen könnte? Er antwortete: ›Ich schließe das daraus, daß Ihr habt Eueren Willen nicht kriegen können‚ einen andern Prediger und Beicht-Vater zu erlangen; so ich versichre Euch, es wird her nachmals nicht besser. Ist König Friderich todt, so lebt König Christian.‹ Ich sagte: ›Das ist ein schlecht
Fundament; Euere Drew-Worte haben keinen Grundt. Habe ich dies Mal keinen andern Beichtvater können erlangen, darumb ist es nicht gesagt, daß ich ein ander Mal nicht sollte einen andern bekommen. Und was habe ich gethan, daß es vor mich könnte schlimmer werden?‹ Er wurde immer zorniger und zorniger und rieff etzliche Male laut: ›Schlimmer, ja schlimmer wird's werden!‹ Da antwortete ich auch zornmüthig: ›Ey, so laat het heran weyen!
AdÜD. i. Ei, so mag es heranwehen!‹ Darauff ward er gantz still, und sagte ich: ›Ihr habt mir eine gute Vorbereitung gemacht; nu, in Gottes Nahmen›!‹ Darauff sagte ich meine Beichte, und er that sein Ambt und ging dann fort ohn anderen Abscheid als daß er die Hand gab. Ich erfuhr später, daß, ehe
M. Buck zu mir kam, da ging er zum Schloßv., der im Bett lag, und bat ihn, daß er Knud, so damals Cammer-
Page war, sagen möchte, was vor ein
sacramensch Weyb ich wäre, wie ich ein Loch in den Fußboden gegraben hätte, umb mit dem
Docter zu sprechen (was eine Un-möglichkeit war), und ich hätte
practiciret, auff zu steigen und auff den Platz zu sehen; bat mehrere Mal den Cammer-
Pagen, es etzliche Male zu sagen: ›Das ist ein
sacramensch Weyb!‹
Chresten, der mit Karen so wie mit mir nicht wol zufrieden war,
tittulirte uns eines Tags, als er etwas zu einem von denen Haus-Knechten sagte, worüber dieser ihn fragte: Wer es gesagt hätte? Chresten antwortete: ›Sie, die vor sie dar oben sitzet.‹ Als mir dieses berichtet ward, lachte ich und sagte: ›Das ist gantz recht, wir sind beide zween Sie-Menschen.‹
AdÜ
AdÜ(Auf Dänisch: Det er ret nock; wii erre begge toe Hunner.) ›Ilun‹ heißt auf Deutsch: sie, und ›hender‹ (hende) ihr; toe Hunner heißt auf Deutsch: zwei Siee. (Vgl. Dr. Daniel Sander's Wörterbuch d. deutschen Sprache.) Sie-Mensch ist nach der Art wie Sie-Mann gebildet; die Wiedergabe des dänischen Wortspiels ist, wie mir scheint, nicht leicht möglich.
Selbiges Jahr Ende Aprilis ward meine Thür an einem Nachmittag auffgemacht, und kam der Schloßv. mit einigen Damen, die sich etwas zur Seite hielten, bevor er gesagt hatte: ›Hir sind welke Hoff Jomfern, de hebben Verlöf an Ju toe spreken. AdÜD. i. Hier sind einige Hof-Jungfern, die haben Erlaubniß, mit Euch zu sprechen.‹ Zuvörderst kam eine Jungfer herein, die ich nicht kannte. Darauff erschien die Hertzogin von Glücksburg, Fräwlein Augusta, die ich wol erkannte, denn sie war nicht sehr verändert. Darauff die Churfürstinn von Saxen, die ich auch wol erkennen konnte nach ihrem H. Vater, und zuletzt unsere allergnädigste Königinn, welche ich am meisten beschaute, und fandt die Liniamente in ihrem Angesicht so, wie Peder Jensen sie beschrieben hatte, sah auch einen großen Demant auff ihrem Armbandt und einen auff dem Finger, wo der Handschuh auffgeschnitten war. Ihre Majt. stützte sich gegen den Klapp-Tisch gleich nach dem Gruß, F. Augusta lieff hin und wieder in jeden Winckel, die Churfürstinn hielt sich an der Thür. F. Augusta sagte: ›Fi, was is hier ein häßlich Gemach! Hier könnte ich nicht einen Tag in leben. Mir wundert, daß Ihr habt es so lange können ausharren.‹ Ich antwortete: ›Das Gemach ist nu so, als es Gott und Ih. Majt. gefällt, und so lange Gott will, so werde ich's ausharren können.‹ Sie fing ein Gespräch mit dem Schloßv. an, der halb betruncken war, und redete mit ihm über Balckes Heyrath, der gerade am selbigen Tag Hochzeit mit seiner dritten Ehefraw hielt; sprach übel davon, so offt zu heyrathen, und der Schloßv. erwiderte allerhand Blöd-Sinn darauff. Sie fragte mich, ob ich Flöe hätte. Ich antwortete, daß ich ihr ein Regiment Flöe lieffern könnte, wenn sie sie haben wolle. Sie antwortete hastig mit einem Fluch und schwur, sie begehrte sie nicht. Ich ward etwas spöttisch ob ihrer Frage und mich verdroß die Frewde, so sie über meine elendigen Umbstände zu erkennen gab, weshalben ich, als sie mich fragte, ob ich ›Filtz- oder Wandtleuße‹ hätte, ihr mit einer Frage antwortete und sie fragte, ob mein Schwager Hannibal Sehested noch lebte? AdÜHannibal Sehsted war im September 1666 gestorben. Diese Frage machte sie etwas kleinlaut, denn daran merckte sie, daß ich sie kennte. Sie antwortete nichts. Die Churfürstinn, die wol von den Intriguen meines Schwagers mit F. Augusta AdÜNach dem Zusammenhang ist anzunehmen, daß hier auf ein Liebesverhältniß der genannten Personen angespielt wird. Herzog Ernst Günther von Glücksburg soll auch, wenigstens eine Zeitlang, gegen Hannibal Sehsted eine feindliche Stimmung genährt haben. (Soph. Birket Smith' dän. Ausgabe.) gehöret hatte, ging schnell nach dem Tisch (dort lag das Buch, in welchem Karen zu lesen pflegte und das sie mitgebracht hatte), nahm das Buch, schlug es auff und fragte, ob es mein Buch sey. Ich antwortete, es gehörte dem Weyb, welches ich lesen gelehrt hätte, und als ich der Churfürstinn den gebührenden Tittel Durchleuchtigkeit gab, sagte F. Augusta: ›Ihr irret! Ihr verdenckt Euch! Sie ist nicht die, Ihr meint.‹ Ich antwortete: ›Ich irre nicht.‹ Darnach sprach sie weiter nichts, gab mir die Hand, ohn ein Wort zu sagen. Die gnädige Königinn sah immerfort trawrig aus, sprach nichts. Als Ihre Maj. mir die Hand gab, küßte ich ihre Hand und hielt sie fest, bat Ihre Maj., für mich zu intercediren, zum wenigsten für einige Linderung meiner Gefangenschafft. Ihre Majt. erwiderte nicht mit Worten, sondern mit fließenden Thränen. Desgleichen that auch die tugendsame Churfürstinn; sie weinte sehr wehmüthig. Und als sie in die Vor-Kammer gelangten und meine Thür geschlossen war, sagte sowol die Königinn wie die Churfürstinn: ›Das ist Sünde, so mit ihr zu handlen!‹ Eine jede zuckte die Achseln und sagte: ›Gott gebe, daß es bey mir stünde! Sie sollte dar nicht sitzen.‹ F. Augusta drängte sie zum fortgehen und klagte es später der Königinn-Wittib, die sagte, daß ich es mir selbst zu dancken hätte; ich hätte verdient, ärger behandelt zu werden als so.
Als des Königs Leiche weggeführt, und die Königinn-Wittib vom Schloß gezogen war, begehrte ich von dem Schloßv., daß er in meinem Aufftrag umb einen anderen geistlichen für mich anhalten sollte, entweder umb den Schloß-Prediger, den Arsenals-Geistlichen oder umb den, so die gefangenen zu versehen pflegte; denn könnte ich keinen andern kriegen als
M. Buck, dann sollten sie selber die Sünde auff sich nehmen, denn vor ihm wollte ich nicht mehr beichten. Es dauerte ein kleines, aber endlich wurde mir der Schloß-Prediger bewilligt, zu der Zeit
M. Rodolff
Moth. Gott, der mir immer in all meiner Widerwärtigkeit bey gestanden, der mir in meiner Trawer und Betrübniß un-vermuthet Trost gesendet hat, gab mir in diesem Mann einen sonderlichen Trost. Er tröstete mich mit Gottes Wort, er war ein gelehrter und umbgänglicher Mann und ein Fürsprecher bey kön.
Majt. Die erste Gunst, so er mir zu Wege brachte, war, daß ich ein anderes Gemach erhielt, 1671 den 16.
Julii, und Bischoff D. Jespers Postille. Später verschaffte er mir nach und nach größere Gunst; ich erhielt 200 Rdlr. Gnaden-Geldt, um mir selbst die Kleider, die ich haben wollte, zu kauffen und was ich sonsten begehrte, die Zeit darmit zu vertreiben.
Etzliches von meinem Geldt verwendete ich auff Bücher, und ist es merk-würdig, daß ich von
M. Buck seinen Büchern erhielt (da sie
auctioniret wurden), unter anderen den großen
Folliant Martilegium
AdÜ, den er mir nicht leihen wollte. Ich schrieb ab und
vertirte aus unterschiedlichen Materien von spanschen, italienschen, französchen und teutschen Authores. Fürnehmlich schrieb ich aus und übersetzte in die dänische Sprache die Weybes-Persohnen von unterschiedlichem Stand und Herkommen, derer von den
Authores lobend gedacht wird als streithaffte, trewe, keusche, verständige Regentinnen, geduldige, standhaffte und gelehrte.
AdÜVermuthlich:
Martilegium der Heiligen; Straßburg, 1484, Fol.
Im selbigen Jahr ward Ihre Maj. die Königin schwanger, und Ihr. Majts. Fraw Mutter, die Landt-Gräffinn von Hessen, kam herüber, ihr das Wochen-Bett zu bereitten. Am 6. Septem. besuchte Ihre Durchleuchtigkeit mich in meinem Gefängniß, wollte anfangs ungekannt seyn; hatte in ihrem Gefolge eine Princessin von Curland AdÜMarie Amalie, Princessin von Curland, verlobt (1673 verheirathet) mit dem ältesten Sohn der Landgräfin von Hessen Hedwig Sophie. (Soph. Birk. Smith' dän. Ausgabe.), so mit der Landt-Gräffinn ihrem Sohn verlobet war, ihre Hoffmeisterinn, eine Wallenstein von Geschlecht, und ihres Hoffmeisters Fraw. Die Landt-Gräffinn begrüßte mich mit einem Kuß, desgleichen thaten dann die anderen. Die Fraw des Hoffmeisters kannte ich damals nicht mehr, sie aber hatte mich früher in meinem Wolstand im Haag gekannt, als sie Jungfer bey der Gräffinn Leuenstein war, ihr kamen die Thränen in die Augen. Die Landt-Gräffinn beklagte mein arges Schicksal und meine schlechten Umbstände. Ich danckte Ihrer Durchleuchtigkeit vor das gnädige Mitleidt, so sie mit mir hatte, sagte, daß Ihre Durchleuchtigkeit sehr viel helffen könnte, meine Bande zu lindern, wenn nicht gantz auff zu lösen AdÜIm selben Jahr den 18. April hatten Leonora Christinens Töchter dem König um Freilassung der Mutter ein Gesuch überreicht, das auf ein blauseidenes Band geschrieben war. Vgl. das Verzeichniß der Kinder Ulfeldt's weiter unten.. Die Landt-Gräffinn lächelte und sagte; ›Ich sehe wol, Ihr nehmt mich an für eine andre.‹ Ich sagte: ›Ihr Durchleuchtigkeit Port und Ansehn wird Ihren Stand nicht können verbergen, wäre sie schon in Bawer-Kleider.‹ Das gefiel ihr; sie lachte und schertzte, sagte, das hätte sie nicht gedacht. Die Hoffmeisterinn stimmte mir bey und sagte, ich hätte sehr wol gesprochen, daß ich sie an ihrem fürstlichen Ansehn erkannt hätte. Darnach sagte die Landt-Gräffinn: ›Ihr kennet diese nicht,‹ und zeigte auff die Princessin von Curland; sagte dann, wer sie sey, darnach auch, wer ihre Hoffmeisterinn und wer ihres Hoffmeisters Fraw sey, welche war wie gemeldt ist; sprach über das Mitleid, so selbige Fraw mit mir hatte, und sagte darbey: › Et moy pas moins.‹ Ich danckte Ihrer Altesse très humblement et la prioit en cette occation de faire voir sa généreuse conduitte.‹ Ihre Durchl. sah nach dem Schloßv., als ob sie sagen wollte, daß wir nicht zu lange französch sprechen möchten, nahm ihren Handschuh ab, gab mir die Hand, drückte sie und sagte: › Croyez moy, je fairez mon possible.‹ Ich küßte Ihr. Durchl. Hand, und darauff nahm Ihr. Durchl. Abscheid mit einem Kuß.
Die tugendsame Landt-Gräff. hielt ihr Wort, konnte aber nichts ausrichten. Als ihre Majt. die Königinn in Kindes-Nöthen war, ging sie zum König, nahm ihm das Versprechen ab mit Hand und Mund, daß, wenn die Königinn einen Sohn gebären würde, ich auff freien Fuß kommen sollte. Gott erlösete Ihr Majt. den 11 Oct. Nachts zwischen 1 und 2 von unserem Croon-Printzen. Als alle anwesenden sich, wie billig, über des Printzen Geburth freweten, sagde die Landt-Gräffinn: ›O, wie wird die gefangene sich frewen!‹ Die Königinn-Wittib fragte: ›Warumb?‹ Die Landt-Gräff. erzählte des Königs Gelöbniß. Die Königinn ärgerte sich so, daß ihr übel ward, lösete ihr Wamms und sagte, sie wolle nach Haus, wolle nicht wartten, bis das Kind getauffet wäre; ihr Caret kam auff den Schloß-Platz. Der König persuadirte sie endlich, zu bleiben, bis die Tauffe verrichtet wäre, mußte ihr mit einem Eyd versprechen, daß ich nicht los kommen sollte. Das verdroß die tugendsame Landt-G. nicht wenig, daß die Königinn ihren Sohn dahin brachte, sein Gelöbniß zu brechen; bestandt darauff, daß ein König sein Gelübt halten müßte. Die Kön.-Witt. antwortete: ›Mein Sohn hat vorhin ein Gelübt gethan, das hat er mit dem Versprechen an Euer Liebden gebrochen.‹ Die Landt-G. sagte endlich: ›Kann ich nicht der gefangenen die Freyheit zu Wege bringen, dann zum wenigsten, daß sie meiner Vorbitte halber an einen bessern Ort mit etwas Freyheit mögte geführet werden. Es ist dem Könige doch nicht reputiirlich, daß sie da sitzet. Sie ist doch eines Königs Tochter, und ich weiß, daß ihr in vielen Unrecht geschicht.‹ Die Kön.-Witt. ärgerte sich über die Worte und sagte: ›Nu soll sie nicht auskommen; da soll sie besitzen bleiben!‹ Die Landt-G. antwortete: ›Will Gott, so wird sie wol aus kommen, wann schon Ihr Majt. es nicht wollen;‹ standt auff und ging hinaus.
Den 18 Oct. ließ die Hoffmeisterinn Wallenstein Peter Jensen Tøtzløff zu sich rufen und überliefferte ihm auff Befehl ein Buch, tittuliret: D. Heinrich Müllers Geistliche Erquickstunden, er stellte es mir mit einem gnädigen Gruß von der Landt-Gräffinn zu. Ich sendete am selbigen Tag durch Tøtzløff Ihr. Durchl. meinen pflichtschuldigen Danck, und brachte Tøtzløff das Buch an die Hoffmeisterinn mit der Zumuthung zurück, daß sie Ihr. Durchl. zu vermögen suche, daß Ihr. Durchl. mir die hohe Gunst erweysen wolle, ihren Nahmen und ihr Symbolum in das Buch zu setzen zum Andencken an Ihr. Durchls. Générosité und Güthe. Ich beklagte meine Lage auch in dem, daß ich von diesem Ort aus Ihrer Durchl. hohes Lob und preis-würdige Wolthaten nicht verbreiten und der Welt bekannt machen könnte; wollte darumb thun, was ich vermöchte, und Ihr. Durchl. sammt gantzer fürstlicher Familie in mein Gebeth einschließen zu allem Wolergehen ihrer Seele und ihres Leybes (ich habe das gethan und will es thun, so lange Gott mir das Leben vergönnet).
Am 23. Oct. bekam ich das Buch durch Tøtzløff zurück und fandt hinten im Buch von der Landt-Gräffinn eigener Handt nachfolgendes:
1671.
Ce qui n'est pas en ta puissance,
Ne doit point troubler ton repos;
Tu balance mal à propos
Entre la crainte et l'espérence.
Laisse faire ton Dieu et ton roy,
Et suporte avec passience ce qu'il résoud pour toy.
Je prie Dieu de vous faire cette grâce, et que je vous puisse tesmoigner, combien je suis
Madame
Vostre très affectionée
à vous servir
![]()
Das Buch ist noch in meiner Verwahrung; und ließ ich durch Tøtzløff die Hoffmeisterinn bitten, meine allerergebenste Dancksagung bey Ihrer Durchl. vor zu tragen, und später, wenn die Landt-G. reisefertig wäre, mich bey selbiger Gelegenheit in Ihr. Durchl. continuirliche Gnade recommandiren etc.
In demselbigen Jahr 1671 kam Karen Nels Tochter von mir von wegen ihrer Schwachheit. Eine Nacht war ein Weyb bey mir mit Namen Margrete, so eine Leibeigene in Holstein war. War ihrem Guts-Herrn entlauffen, ein sehr un-schickliches Bawern-Weyb, weshalb sie auch am nächsten Tag gegen Abend weg geschickt ward, und kam statt ihrer eine mit Namen Inger, eine lockere Weybs-Persohn. Selbiges Weyb gab sich aus vor das Ehe-Weyb oder die Wittib von einem Unter- Officierer; hatte lange in Hamburg gedienet als Wärterinn bey Wöchnerinnen. Mit dieser ging es mir so, wie offt geschicht, daß man eine Sache zu erlangen sucht und das zu eigenem Verdruß. Chresten hatte für diese bey dem Schloßv. geredet und sie vor mir gelobt, aber der Schloßv. nahm auff eines andern recommandation die vorbem. Margrete. So lange Hoffnung war, daß die Landt-G. meine Freyheit erlangen würde, so lange war dieses Weyb schicksamb, aber später fing sie nach und nach an, sehen zu lassen, was in ihr stak, und daß sie Dina nicht umbsonst ähnlich war. Sie machte mir allerley Verdruß, was ich mit Geduldt entgegen nahm, dachte bey mir selbst, daß es noch eine Widerwärtigkeits-Prüfung sey, so Gott mir auff erlegte, und kamen mir offt Dinae Umbtriebe in den Sinn, und ich dachte: Sollte diese wol nicht auff irgend einen Dinas-Schlich sinnen? (Sie ist dessen wol fähig, hätte sie nur einen Anführer, wie Dina ihn hatte). Unter anderem Verdruß, so nicht unter die geringen gerechnet werden kann, war dieser: ich war einmal nicht gantz wol auff, hatte in der Nacht wenig oder garnicht geschlaffen und mich am Tage zum schlaffen auff das Bett gelegt; da wollte sie mir nicht die Ruhe gönnen, sondern kam leise auff ihren Socken herbey und neckte einen Hund, den ich hatte, Selbiger Hund war von isländischer Art, nicht hüpsch, aber sehr trew und weise. Sie schlieff jeden Nachmittag auff dem Stuhl, und wenn sie dann eingeschlaffen war, ließ sie ihre Hände nieder hängen. Da paßte der Hund auff und lieff stille hin und biß sie in die Finger, daß das Bluth herfür kam. Wenn sie ihre Pantoffeln ab warff, nahm er einen, setzte sich darauff. Ohne bluthige Finger oder Beine kriegte sie ihn nicht wieder. damit er knurrete, mich zu wecken. Ich fragte sie, warumb sie mir nicht das schlaffen gönnte. Sie antwortete: ›Ich wußte nicht, daß Ihr schlieffet.‹ ›Warumb‹ (sagte ich) ›ginget Ihr dann auff Eueren Strumpff-Socken?‹ Sie erwiderte: ›Sahet Ihr das, dann schlieffet Ihr auch nicht‹, lachte hertzlich in sich hinein (sie saß alleweile vor meinem Tisch und wendete mir den Rücken zu; ob sie dieses that, weil ihr eines Auge aus war und sie so vor dem Tage sitzen wollte, weiß ich nicht). Ich mochte kein Gespräch mit ihr haben, lag stille; und dachte sie, daß ich schlieff, stand abermals auff und neckte den Hund. Ich sagte: ›Ihr verdreistet Euch auff meine Geduldt, läufft mir aber einmal die Galle über, so werdet Ihr sicherlich etwas zu sehen kriegen, Ihr verdammtes schlimmes Ding!‹ ›Verdammtes schlimmes Ding!‹ sagte sie bey sich selbsten und lachte leise. Ich bat Gott, daß er mich behüthen möge, auff daß ich mich nicht an diesen Abschaumb vergreiffe. Und da ich das andere Gemach hatte (wie gemeldt ist), Anno 1672 den 4 Maj. ward einer von denen Haus-Knechten auff Dieberey ertappt; ihn hatte Adam Knudt, damals Cammer-Juncker, selbst gesehen, wie er aus des Königs Hosen, die an der Wandt hingen, eines Morgens frühe mehre Ducaten nahm. Zuerst war er einige Stunden mein Nachbar in der Duncklen Kirche, dann wurde er in das Gitterloch gesetzt, und da er gepeinigt werden sollte, ward er davor heimlich gewarnt (was doch verbothen war), so daß er, als der Büttel kam, erhenkt gefunden ward. Sollte heißen, er hätte sich selbsten auff gehängt, was nach dem Augenschein nicht möglich war; und fandt man ihn mit einem Tuch umb den Hals, so eine Windel von Chresten Thurmwachters Kindern war. Chresten wurde mein Nachbar, kam zum Schein vor Gericht, ward frey gesprochen und kam wieder in seinen Dienst. so ging ich da hinaus, spatzierte zwischen 4 und 5 Uhr. Sie wusch und platschte dar draußen, goß das Wasser gerade dort aus, wo ich meinen Gang nahm. Ich sagte ihr etzliche Male, sie solle ihr pantschen seyn lassen, sie gösse das Wasser kreutz und quer auff den Fußboden, ich machte meine Kleider schmutzig, und offt wäre nicht ein Tropffen vor den Hund zu trincken, und der Thurmwächter müßte ihr das Wasser aus dem Küchen-Brunnen holen. Das halff nichts. Eines Tags fiel ihr ein, grade als die Glocke 4 geschlagen hatte, hinaus zu gehen und alles Wasser auff den Fußboden zu gießen, kam dann wieder herein. Als ich zur Thür kam, ward ich das gewahr; ohne irgend ein Wort zu sagen, schlug ich sie zuvörderst auff den einen, darnach auff den anderen Kieffer, so daß das Bluth aus Nase und Mund herfür sprang, und sie gegen ihre Banck fiel und sich die Haut von ihrem Schienbein stieß. Sie begann ihr Maulwerck zu brauchen und sagte, solche Ohrfeigen hätte sie ihr Lebtag nicht gekriegt. Ich sagte strax: ›Halttet das Maul, oder Ihr kriegt noch mehr solche! Ich bin itzt nur ein wenig erzürnt, machet Ihr mich aber recht erzürnt, so werde ich Euch lahm schlagen!‹ Sie schwieg vor das Mal, machte mir doch all den kleinen Verdruß, wie sie nur konnte. Ich nahm es alles mit Sanfftmüthigkeit auff, fürchtete mich, daß ich mich an ihr vergreiffen möchte. Sie wußte nicht, was sie anstellen sollte, mir Verdruß zu machen. Sie hatte einen silbernen Fingerhut, worauff ein fremder Name stand; den, sagte sie, hätte sie auff der Straße gefunden. Ich fragte einmal, wo sie etzliche Tücher gefunden hätte, so sie besaß, von holländschem feinen Linnen mit Spitzen daran, stand auch ein anderer Name darauff, gestickt mit blawer Seide und auff jeglichem ein differenter Name. Die hätte sie auff einer Auction in Hamburg gekaufft. Sie stellte sich so an, als könnte sie teutsch, und wenn sie ein Morgen-Lied sang (was aber selten geschah), so mengte sie teutsche Wörter dahinein. Ich fragte sie einmal, ob sie wüßte, wie ihrer Mutter schwartze Katz auff dänisch hieße, und redete etwas, worüber sie zornig ward. Ich dachte, das, so sie auff ihrem einen Auge hätte, käme auch wol von etwas dergleichen gefundenem her; und da ich sie baldt darauff fragte, durch welchen Zufall sie den Schaden an ihrem Auge hätte, verstandt sie ohne Zweiffel meine Frage recht wol, denn sie ward erzürnt und etwas still; sagte: ›Welchen Schaden? Meinem Auge fehlet nichts; ich kann, Gott sey Danck, mit ihnen beiden sehen.‹ Ich ließ es darbey bewenden. Kurtz nach diesem Gespräch kommt sie eines Tags von dem Häuschen herunter und sucht in ihren Taschen, sagt aber nichts, bis zum Nachmittag, als die Thüren geschlossen waren, da durchsucht sie all ihren Kram, sagt: ›Wenn ich doch nur wüßte, wo er seyn kann?‹ Ich fragte, was sie suche. ›Meinen Fingerhut‹ (sagte sie). ›Ihr findet ihn wol‹ (sagte ich) ›suchet nur recht darnach!‹ Und da sie schon begann, darnach in ihren Taschen zu suchen, ehe sie ihn nöthig hatte, vermeinte ich, daß sie ihn mit einigem Papir, das sie brauchte (und kauffen ließ), könnte aus der Tasche gezogen haben, sagte es auch, aber es konnte nicht so seyn. Am anderen Tag gegen Mittag that sie wieder, als ob sie da oben suchte, und als die Thür geschlossen war, fing sie an, ihr Maulwerck los zu lassen, machte einen langen Discours über den Fingerhut: wo er wol abgeblieben seyn könnte? Hier wäre niemand, und käme niemand herein, als wir beide, gab mir zu verstehen, daß ich ihn genommen hätte; nahm ihre große Schachtel, die sie besaß, und kramte alles aus, was sie darinnen hatte, sagte: ›Nu könnet Ihr sehen, daß ich ihn nicht habe.‹ Ich sagte, daß ich mich nicht darumb kümmerte, ob sie ihn hätte oder nicht, aber ich vernähme, daß sie mich des Diebstahls zeihe. Sie blieb bei ihren Worten und sagte: ›Wer sollte ihn sonst genommen haben? Hier ist ja keine andere, und ich habe Euch alles sehen lassen, was mein ist, und er ist nicht da.‹ Da merckte ich erst, daß sie wollte, ich möchte sie in gleicher Weise sehen lassen, was ich in meinem Karten-Schrein auffbewahrte, denn sie hatte nie etwas von meiner Arbeit gesehen, die ich vor ihrer Zeit gemacht hatte. Ich sagte: ›Ich kümmere mich gar nicht darumb, was Ihr mit Eurem Fingerhut machet, und ich halte mich vor zu gut, mit Euch zu zancken, oder Eure plumpe un-verschämte Beschuldigung zu achten. Ich habe, Gott sey Danck, noch genung in meinem Gefängniß, mir was davor zu kauffen, etc. Aber so wie Ihr ihn vielleicht gestohlen habt, so wollet Ihr nu, daß er Euch wieder gestohlen sey, wenn es wahr ist, daß Ihr ihn verloren habt.‹ Darauff antwortete sie nichts, so daß ich glaube, sie hatte ihn selbst und wollte nur durch diese invention meinen Kram zu sehen bekommen. Da es im Weihnachts-Monat und kalt war, und Chresten vor der Abend-Mahlzeit im Ofen Feuer machte, sagte ich zu ihm in ihrer Gegenwart: ›Chresten, Ihr seyd glücklich, daß Ihr nicht wie ich des Diebstahls geziehen werdet; denn Ihr hättet ihren Fingerhut oben im Häuschen finden können und es nicht von der Kantzel verlesen lassen, denn er ist früher von Inger gefunden, aber nicht von der Kantzel verkündiget worden.‹ Das war ihr wie ein Feuerschwammb in ihre Nase, und ging sie zu Werck wie ein tolles Mensch, brauchte ihr un-verschämtes Maulwerck; sie hätte ihn nicht gestohlen, aber ihr sey er gestohlen; fluchte und ließ übel an. Chresten befahl ihr zu schweigen; sie solle bedencken, wer ich sey, und daß sie mir diente. Sie antwortete: ›Ich werde nicht schweigen, und wenn ich vor dem König selber stünde!‹ Je sanfftmüthiger ich in meiner Rede war, desto grimmiger ward sie; endlich sagte ich: ›Wollet Ihr mit mir in einen Wunsch einstimmen: daß die mit ihrem lincken Auge nicht mehr sehen möchte, als die mit ihrem rechten Auge siehet, die den Fingerhut zuletzt gehabt hat?‹ Sie fluchte und sagte, sie könnte mit beyden Augen sehen. Ich sagte: ›Nu gut, so bittet Gott mit mir, daß die auff beyden Augen möchte blindt werden, die ihn zuletzt hatte.‹ Sie knurrte leise bey sich selbsten und lieff in das innerste Gemach, sprach nie mehr von ihrem Fingerhut; ich auch nicht. Gott weiß, daß ich dieses Umbganges hertzlich überdrüssig war. Ich bat Gott nur um Geduldt und dachte: Das ist nur eine Geduldts-Uebung; Gott verschonet mich davor mit anderer Betrübniß. Ich konnte die occasion, daß sie mich des Diebstahls beschuldiget hatte, nicht benutzen, sie los zu werden, sah aber von weitem eine andere kommen. Der Schloßv. kam eines Tags zu mir herauff mit etwas Zwirn, so zu verkauffen war, ziemblich grob, umb Strümpffe und Nacht-Wämmser daraus zu machen. Darvon kauffte ich 2 Pfund und er behielt ein Pfund, sagte: ›Dar kan de Frue mii wol en Par Strömpe von binden.‹ Ich sagte ja (denn sie konnte nichts anderes als stricken). Als er weg ging, sagte sie: ›Dar in sind auch ein Paar Strümpffe vor mich, denn ich kriege doch sonst keinen anderen Arbeits-Lohn.‹ Ich sagte: ›Das ist denn auch genung.‹ Die Strümpffe vor den Schloßv. wurden fertig (sie saß einmal im halben Schlaff und machte eine falsche Tour rund umb den Strumpff unten am Fuß; ich wollte, daß sie es wieder auffmachen sollte. ›Nein,‹ sagte sie, ›daß kann wol so bleiben, der weiß nicht anders, als daß es so Mode in Hamburg ist. An dem andern Strumpff war keine Tour herumb. Der Schloßv. sprach nie darüber.
Als seine Strümpffe fertig waren, begann sie ein Paar für sich von dem selbigen Zwirn, saß und ergötzte sich darüber, daß es dem Schloßv. sein Zwirn wäre. Da, schien mir, war eine Gelegenheit gekommen, ihrer quit zu werden. Und da der Schloßv. selten herauff kam, und sie ihm die Strümpffe durch Tøtzløff hinunter schickte, bat ich Tøtzløff, es so einzurichten, daß der Schloßv. zu mir herauff käme, und daß er sich auff des Weybes Bett setzen und thun solle, als ob er sich an das Kissen lehnte und es zurecht legte (denn dar unter lag ihre Arbeit.) Das geschah. Der Schloßv. kam herauff, nahm das Strickzeug in die Hand und sagte zu Inger: ›Is dat noch en Par Strömpe för mii?‹ ›Neen, H. Slosv.‹ (antwortete sie), ›de sind för mii. Ji hebben Ju Strömpe gekregen, ick häbe se Ju daall geskickt.‹ ›I‹ (sagte er), ›dat is jo van min Twern! Dat sijet min Twern seer glick!‹ Sie schwur nein, das wäre nicht sein Zwirn. Als er hinab ging, seine Strümpffe und die Waage zu holen, sagte sie zu mir: ›Das ist nicht sein Zwirn, das ist nu meiner,‹ lachte hertzlich. Ich dachte: dar mag wol was anderes auff folgen. Der Schloßv. kam mit der Waage und denen Strümpffen herauff, verglich den Zwirn mit dem andern, und die Strümpffe wogen kaum ½ Pfd. Er fragte sie, ob das recht gehandelt wäre. Sie blieb darbey, daß es ihr Zwirn sey; sie hätte ihn in Hamburg gekaufft und mit hier herauff gebracht. Der Schloßv. ward zornig, sagte, das löge sie in ihrem Hals wie eine verdammte Hündinn. Sie schwur dargegen, daß es nicht sein Zwirn sey, dar wollte sie das Sacrament auff nehmen. Der Schloßv. ging weg, es grawete ihm vor sothanem Eyd. Ich schwieg bey ihrem Zanck gantz stille. Als der Schloßv. fort war, sagte ich zu dem Weyb: ›Gott bewahre! Wie konntet Ihr solche Worte sagen? Waget Ihr das Sacrament auff Lügen zu nehmen und das in meiner Gegenwart zu sagen, da ich doch wußte, daß es den Schloßv. sein Zwirn ist? Was seyd Ihr vor eine gottlose Creatur!‹ Sie antwortete mit einer halb lächerlichen Mine: ›Ich sagte, daß ich das Sacrament darauff nehmen wollte, aber ich thu es darumb nicht.‹ O, Dina, dachte ich, du gleichst ihr nicht vergebens; Gott behüte mich vor dir! Und sagte ich: ›Meint Ihr, daß solch leichtfertige Worte keine Sünde sind, und daß Gott sie nicht straffen wird?‹ Sie warff sich in die Brust und sagte: ›Ist etwas an dem Zwirn gelegen? Ich kann ihn bezahlen; ich habe ihn nicht gestohlen, er hat mir ihn selber gegeben. Ich habe gethan, wie es die Schneiders machen; die stehlen nichts, man gibt es ihnen. Er hat mir auch den Zwirn nicht zugewogen.‹ Ich antwortete ihr nicht mehr als: ›Ihr habet es ihm genommen! Ich kümmere mich nicht mehr darumb;‹ aber ich bat Tøtzløff, alles zu thun, darmit ich ihrer los würde, und eine andere bekäme, so einen guten Ruf hätte. Tøtzløff vernahm, daß Karen Begehren trug, wieder zu mir zu kommen; berichtete es mir. Der Schloßv. war auch darmit zufrieden. Dieses wurde vor Inger verborgen gehalten, bis alles so eingerichtet war, daß Karen eines Abends zur Mahlzeit herauff kommen konnte. Als der Schloßv. auffgemacht und sich in das innere Gemach gesetzet hatte, und das Weyb heraus kam, sagte er: ›Nu Inger, packt Ju Paknelken toe samen! Nu sköll Ji fort.‹ ›Ja, H. Schloßv.‹ (antwortete sie), und lachte, trug die Speisen zu mir herein und erzählte mir, was der Schloßv. gesagt hatte; sagte darbey: ›Das ist sein Spaß.‹ ›Ich hörte es wol‹ (antwortete ich), ›was er sagte; das ist nicht sein Spaß, das ist sein bitterer Ernst.‹ Sie glaubte es noch nicht, zum wenigsten that sie so, als ob sie es nicht glaubte, und lächelte, sagte: ›Das kann nicht sein Ernst seyn,‹ ging hinaus und fragte den Schloßv., ob es Ernst sey. Er sagte: ›Fort, fort! Hir is keen Tiit to pludern!‹ Sie kam wieder zu mir herein und fragte, ob ich sie los seyn wollte. Ich antwortete ja. ›Warumb das?‹ fragte sie. Ich antwortete: ›Es ist zu weitläufftig, darüber zu sprechen; das andere Weyb, so hier bleiben soll, ist unten.‹ ›Zum wenigsten‹ (sagte sie) ›lasset mich hier über Nacht bleiben!‹ (Ey, Dina! dachte ich). ›Nicht eine Viertelstund!‹ (antwortete ich) ›Hinweg, und nehmet Euer Zeug zusammen! Das ist schnell gemacht.‹ Sie that es, sagte nicht Lebewol, und ging zur Thür hinaus.
Karen kam so zum dritten Mal zu mir, blieb aber nicht ein volles Jahr, von wegen ihrer Schwachheit. Ueber Karen Nelßtochter will ich dieses melden daß sie, wenn ihr etwas zu Danck ging, strax ihr Buch nahm und darin las. Ich fragte, ob sie verstände, was sie lese. ›Ja gewiß‹ (antwortete sie), ›so wahr Euch Gott segnen möge! Wenn mir ein Wort fürkommt, das ich nicht verstehe, so geh ich weiter.‹ Ich lächelte ein wenig bey mir selbst, sagte aber nichts.
Anno 1673 ward M. Moth Vice-Bischoff auff Fünen. Ich verlor viel an ihm, und kam an seine Stelle H. Emmeke Norbye, der damals Schloß-Prediger ward, und war er in früheren Zeiten Griffenfeldts AdÜPeter Schumacher, geb. 1637 zu Copenhagen, ward 1672 in den Grafenstand erhoben und erhielt den Namen Griffenfeldt. Er war bekanntlich ein bedeutender Staatsmann und Minister unter Christian V. und ist Verfasser des sog. Königsgesetzes. (Vgl. Einleitung.) 1675 in Ungnade gefallen, ward er des Hochverraths schuldig befunden und zum Tode verurtheilt. In dem Augenblick, wo er mit großer Ruhe und Kaltblütigkeit dem Scharfrichter den Nacken zum tödtlichen Streiche hinhielt, ward er zu lebenslänglichem Gefängniß begnadigt und nach Drontheim gebracht, wo er im März 1699 starb. Cammerat gewesen; aber Griffenfeldt kannte ihn später nicht, so daß er mir bey Griffenfeldt nichts zu Wege bringen konnte. Brachte mir einmal als Antwort (als ich ihm unter anderem sagen ließ, daß Majt. gnädig sey, wollte nur jemand vor mich reden): Es wäre so, als wenn man dem König ein Pistoll auff die Brust gesetzt hätte, und er es verzeihen sollte.
Im selbigen Jahr ließ meine Schwester Elisabet Augusta mich durch Tøtzløff grüßen und fragen, ob ich Lust zu irgend einer Frucht hatte, dann wollte sie mir welche senden. Ich verwunderte mich über den Gruß, der mir von meiner Schwester im zehnten Jahr meiner Gefangenschafft kam, und sagte ich: ›Besser ist spät als niemals!‹ Ließ ihr nichts antworten.
Eines will ich doch vermelden, was sich zu Karen Nelß Tochters Zeit zutrug. Chresten, der eine Stunde vor der Abend-Mahlzeit Feuer im Ofen machen sollte (sintemalen dieser kein Wind-Ofen war), so daß der Rauch zur Thür nach der Treppe hinaus ziehen konnte, ehe ich speisete, kam eines Abends nicht vor 6 Uhren, und war gantz betruncken. Und als ich damals in dem äußersten Gemach neben dem Ofen auff einem Holtz-Klotz saß, so zurecht gehauen war, umb darauff zu sitzen, sagte ich, es sey zu spät zum einheitzen, denn nu müßte er in die Küche. Er achtete meiner sanfftmüthigen Rede nicht, bis ich ihm mit harten Worten drohete, er solle die Scheitter heraus nehmen. Er war grimmig, wollte die Zange nicht brauchen, dar mit die Scheitter heraus zu nehmen, auch wollte er Karen nicht erlauben, sie mit der Zange heraus zu nehmen, sondern riß sie mit denen Händen heraus und sagte: ›Mich kann nichts brennen.‹ Und da es eine kleine Zeit dawerte, ehe die Scheitter ausgelöscht waren, begann er doch zu fürchten, er werde schlechten Danck davor haben, daß er so lange zögerte, ehe er das Essen zu holen ging; setzte sich platt auff dem Boden nieder und war ziemblich kleinlaut, endlich platzte er los und sagte: ›Herr Gott, Ihr, die Ihr Haus und Hoff gehabt habet, wo sitzet Ihr nu?‹ Ich sagte: ›Auff einem Klotz!‹ Er antwortete: ›Ich meine nicht Euer Wohlgeboren.‹ Ich fragte: ›Wen meinen Euer edel Gestrengen denn?‹ Er antwortete: ›Ich meine Karen.‹ Ich lachte und sagte nichts weiter.
Alles zu verzeichnen, so mir verächtliches widerfuhr, würde zu weitläufftig seyn und nicht der Mühe werth. Eines will ich noch über Chresten Thurmwächter melden, der mir allerhand Verdruß am Ende dieses zehnten Jahres meiner Gefangenschafft machte. Unter anderem Verdruß stieß er einmal meinen Hund, so daß er schrie. Ich sah es nicht, aber hörte es, und das Weyb sagte mir, daß er es gewesen sey, so den Hund stieß. Ich war übel darmit zu Frieden. Er lachte darüber und sagte: ›Das ist nur ein Hund.‹ Ich gab zu verstehen, daß er den Hund stieß, weil er sich an mich nicht wagte. Da lachte er gar hertzlich und sagte: ›Ich mach mir nichts aus Euerem Zorn, wenn ich nur den Schloßv. zum Freund hab;‹ (dieses Gespräch fand statt, als ich speisete, und der Schloßv. drinnen bey mir saß, und Chresten standt und reckte und streckte seine Arme in der Thür meines Gemachs, wo ich speisete). Ich sagte: ›Der Schloßvoigt und Ihr sollet alle beyde die schwere Noth kriegen, wenn ich will; versteht Ihr das, Ihr guten Leute?‹ (Ich wußte all zu viele Schliche von ihnen, mehr als in einer Weise). Der Schloßv. saß wie einer, so weder hören noch reden kann, blieb sitzen, aber Chresten schob etwas beschämt von dannen, ohn weiter was zu sagen; hatte auch später einige Furcht vor mir, wenn er nicht über die Maßen betruncken war, denn alsdann kümmerte er sich nicht darumb, was er sagte, über hohe sowol wie über niedrige. Er hatte später ein freches Maul gegen das Weyb, sagte, er wolle den Hund schlagen und mich das sehen lassen. Das geschah doch nicht. Chrestens Dummdreistigkeit nahm zu, so daß Peter Tøtzløff dem Schloßv. über seine üble Aufführung berichtete, daß ich von wegen der tollen Wirthschafft derer gefangenen klage, welche des Nachts so lärmten, daß ich davor nicht schlaffen konnte, denn Chresten war des Nachts in seinem Haus und ließ die gefangenen thun, was sie wollten. Nach diesem Bericht hängte der Schloßv. des Abends ein Hängschloß vor die Thurm-Thür, so daß Chresten nicht hinaus konnte, ehe am Morgen vor ihn auffgeschlossen ward. Das verdroß ihn, er verlangte seinen Abscheidt, den er am 24. Aprilis 1674 erhielt, und kam an seine Stelle einer mit Namen Gert, so dem Schloßv. als Kutscher gedienet hatte.
In diesem Jahr den – Maj. AdÜDas Datum ist im Manuscript ausgestrichen. dichtete ich ein geistlich 1674 Lied zur Erinnerung an Gottes Güte, nach der Melodey: Nun ruhen alle Wälder.
1.
Auff, auff, du mein Gemüthe!
Gedenck an Gottes Güte
Und wie er gnadenreich
Auch itzt die Last hilfft tragen
Und läßt mich nicht verzagen,
Lieg ich in schweren Banden gleich.
2.
Nie will ich es vergessen,
Wie ich dereinst gesessen
Im finstern Kerckerloch,
Die Sorge nicht und Hertzqual,
Viel Spott und eitel Scheusal!
Und Gott, der Herr, erhielt mich doch!
3.
Denck an mein schwer Bedrängniß,
Mein schröckliches Gefängniß
In manchem langen Jahr!
Bin darumb nicht betrübet;
Der Herr, er prüft und liebet,
Er schirmt auch itzt mich wunderbar.
4.
Herbey, Hertz, Leib und Seele!
Auff daß ich Euch erzähle,
Was Gott an mir gethan!
Er thät Euch stets bewahren
Vor Wirrsal und Gefahren,
War es auch manchmal nah daran.
5.
Fast nahm es schon ein Ende,
Für Angst rang ich die Hände,
Doch er hat mich beschützt.
Er war an jedem Ort mir
Die Zuflucht und der Hort mir
Und wußte allzeit, was mir nützt.
6.
Danck sey dir, Quell der Gnaden!
Dein Arm wird mir nicht schaden,
Du straffest väterlich!
Wenn Uebermacht mich drückte,
Warst du's, der mich erquickte;
Und du beschirmtest mich.
7.
Vor dir, Gott, fall ich nieder: Gieb mir die Freyheit wieder, Eh ich zu Grunde geh! O, reich mir deine Hände Mach meinem Joch ein Ende! Doch nicht mein Will, dein Will gescheh!
In diesem Jahr am 25. Julii war königl. Majt. so gnädig, ein großes Fenster in meinem inneren Gemach wieder herstellen zu lassen, so zugemawert worden war, als ich in dieses Gemach geführt werden sollte. Es wurde auch ein Wind-Ofen gesetzet, dessen Rohr auff den Platz hinaus geht. Der Schloßv. war nicht wol darmit zufrieden, fürnehmlich weil er bey der Arbeit zugegen seyn mußte; das gefiel ihm nicht. Meine Thüren waren derweyl offen; es dawerte 12 Tage, ehe es fertig ward. Er war arg, wollte nicht, daß das Fenster so tieff hinunter ginge, wie es früher gewesen war, ehe ich hier gefangen gesetzt wurde; und ich überredete den Mawermeister-Gesellen, daß er die Mawer tief ausschlug, wie sie zuvor gewesen, was der Schloßv. unten vom Schloß-Platz aus gewahrte, kam herauff geloffen und schalt, war gantz grimmig. Aber da war nichts mehr zu ändern, denn der Fenster-Rahmen war schon gemacht. Ich fragte ihn, was es ihm schade, daß das Fenster einen Stein niedriger sey; es ginge ja nicht tieffer als die Eisen-Gitter, und es sey früher so gewesen. Er wollte seinen Willen haben, so daß der Mawermeister-Gesell einen Stein höher mawerte, als der Schloßv. da war, und ihn später wieder weg nahm, denn der Fenster-Rahmen, so fertig war, hätt sonst nicht gepaßt.
Im selbigen Jahr kam Karen Nels Tochter zum dritten und letzten Mal von mir, und an ihre Stelle kam eine Buchbinders-Wittib mit Namen Barbra. Sie ist ein melancholisch Weyb. Das Gewissen erwacht zuweilen, so daß sie offt ihre eigenen Vergehen erzählt (aber nicht so grob, wie sie gewesen sind und ich ausgefragt habe). Sie hatte zwey Kinder, und es scheint nach ihrer eigenen Erzählung, daß sie wol an ihrem Tod schuld gewesen ist, denn sie sagt: ›Wie kann man Sorgfalt vor ein Kindt haben, dessen Vater man nicht liebet!‹ Sie verließ ihren Mann zwey Jahre, bevor er starb, und zog nach Hamburg, ernährte sich durch spinnen; hatte auch zuvor einer Fürstinn als Spinn-Magd gedienet. Ihr Vater lebt und ist Kön. Majts. Buchbinder gewesen; ist anjetzo vom Schlag gerührt, liegt elendiglich. Ihr Bruder ist Buchbinder an des Vaters Stelle. Sie hat kein Mitleyd mit dem Vater, wünschet ihm den Tod (was auch wol das beste vor ihn wäre); aber daß sie sich so übel gegen ihre Schwester benimmt, so eines armen Schneiders Weyb ist, das verdrießet mich und sage ich ihr offt, daß sie daran zwiefach Sünde thäte; denn die bedürfftige Schwester kombt dann und wann, sich bey ihr etwas zu essen zu holen. Wenn sie nicht precis an dem Abend kombt, den sie mit ihr verabredet, so kriegt sie nichts, sie wirfft das Essen in's Häuschen. Wenn ich ihr mit Weitläufftigkeit die Sünde für halte, sagt sie: ›Dat Fleesch is doch verfuult.‹ Ich frage sie, warumb sie es faul werden lasse und es nicht bey Zeiten der Schwester gebe. Darauff antwortet sie, die Schwester sey dessen nicht werth. Ich sage ihr böses voraus, daß es ihr in Zukunfft gehen werde, wie unterschiedlichen anderen, die ich ihr für zähle. Dann wirfft sie den Kopff zurück und schweigt still.
Zu der Zeit sandte Ihre Majt. die Königinn mir einige Seiden-Rauppen zum Zeitvertreib. Als sie gesponnen hatten, schickte ich sie Ihr. Majt. in einer Schachtel zurück, die ich mit fleischfarbenem Atlas überzogen hatte, darauff hatte ich ein Muster mit Gold-Draht brodiret. Inwendig war die Schachtel mit weißem Taffet überzogen. Im Deckel war mit schwartzer Seyde ein unterthäniges Begehren genähet, daß Ihre Majt. gnädigst meine Bande lösen und mit der Hand der Gnade mich von neuem fesseln möge. Ihre Majt. die tugendsame Königinn hätte mich erhört, wenn es bey ihr gestanden hätte.
Der Schloßv. ward nach und nach etwas klüger und schicksamer, tranck auch lange nicht so viel und machte keine Possen. Ich hatte Ruhe innerhalb meiner Thüren. Das Weyb saß am Tage draußen in dem andern Gemach, lag auch dort in der Nacht, so daß ich begann, mich nicht mehr so sehr über mein böses Schicksal zu betrüben. Brachte so das Jahr hin mit lesen, schreiben und dichten.
Sintemal ich lange Zeit vorher, gleich darauff, als das Gnaden-Geldt bewilliget ward, mir nicht allein Historien-Bücher in allerley Sprachen gekaufft, sondern auch daraus die ruhmwürdigsten Weybs Personen genommen und übersetzt hatte, die berühmt waren als getrewe, keusche, vernünfftige, mannhaffte, tugendsame, gottesfüchtige, gelehrte und standhaffte, so machte ich Anno 1675 am 9 Janu. zum Zeitvertreib einen Reim an M. Thomas Kingo AdÜgeb. 1634 zu Slangerup auf Seeland, Bischof von Fühnen, ein vorzüglicher Dichter namentlich geistlicher Lieder, wird als Dänemarks erster lyrischer Dichter geschätzt. Er starb 1703. unter den Tittel: ›An den hoch berühmten Poet M. Tho. Kingo eine Bitte von einer Dänen-Fraw im Namen aller Dänen-Frawen.‹ Die Bitte bestehet darin, daß er die tugendsamen und preiswürdigen dänischen Weybs Persohnen in ihre Zier kleiden möge. Es gebe wol tugendsame von anderen Nationen, aber ich bäte nur umb das Lob der dänischen. Kingo kriegt es nicht zu sehen, aber wenn mein guter Freund AdÜD. i. Peder Jensen Tøtzløff., dem ich dieses anvertraue, leben bleibt, so kommt es wol noch in Euere Hände, meine hertzlieben Kinder.
Im selbigen Jahr am 11 Maj setzte ich ein streitendes Gespräch zwischen Vernunft und Sinn in Reime unter dem Tittel: Der Gefangenen Wittib Streit-Gedancken, oder der Streit zwischen Sinn und Vernunft.
Ansonsten fiel in diesem Jahr innerhalb der Thüren meines Gefängnisses nichts vor, das des auffschreibens werth wäre, ausgenommen eine Begebenheit, nehmlich, da des Morgens die äußerste Thür des Vorgemachs auff geschlossen ward, den Unrath hinaus zu fegen und reines Wasser herein zu bringen, und der Thurmwächter sie zuweylen offen stehen ließ, bis es Zeit zum essen war, dann schloß er sie wieder: so begab es sich, daß Feuer in der Stadt ausbrach. Ich und das Weyb lieffen in den Thurm hinauff, zu sehen, wo es brennte. Als ich auff der Stiege war, so zum Seiger-Werck hinauff führt, kombt der Schloßv. und hat einen Kerl aus der Silber-Kammer bey sich. Er ward zuerst meinen Hund gewahr, dann sah er etwas von dem Weyb, dachte wol, daß ich auch da sey; war so weise, nicht die Stiege herauff zu kommen, sondern blieb unten an den untersten Löchern, von wo man auff die Stadt hinaus lugen kann, und ließ mir Zeit, wieder herunter zu kommen und mich einschließen zu lassen. Gert war betrübt, kam später zur Thür und klagte mir seine Noth. Ich tröstete ihn: es würde keine Gefahr haben. Ehe der Schloßv. zu Mittag die Thür auffmachte, schlug er Gert mit seinem Stecken, daß er schrie, und sagte der Schloßv.: ›Du skalt, vor den Düwel, weck!‹ Als der Schloßv. herein kam, nahm ich zuerst das Wort und sagte: ›Ji hebben Sünde dar von, dat Ji den armen Düwel slaaen. He kunde dar nicht tho AdÜD. i. Er konnte nicht dafür.. De Racker kam effen op, als he min Dör wollte thomacken, ende dar öfwer vergat he dat.‹ Er dreuete Gert sehr und sagte: ›Het schulle mii noch nicht so sehr verdrohten hebben, wenn de fremde Kärel nicht wehre bi mii gewesen.‹ Mir fielen gleich die Worte ein, so er lange Zeit vorher zu mir gesagt hatte: daß kein Frawens-Mensch schweigen könnte, aber alle Manns-Persohnen könnten schweigen; (als er diese Rede hielt, dachte ich, wenn das so sey, so könnten meine Widersacher glauben, daß ich, wenn ich etwas von dem gewußt hätte, worauff sie hinzielten, es nicht hätte verschweigen können). Itzt antwortete ich ihm so: ›I, hwat hefft dat op sigk? Dat was jo en Mands-Persohn; de können alle swiigen. Hir iß keen Skade geskeen.‹ Er konnte sich für lachen nicht halten und sagte: ›Ja, Ji siin guth genock.‹ Ich redete dann mit ihm und versicherte ihn, daß ich nicht zum Thurm hinaus zu gehen begehrte ohn des Königs Willen, wenn sie auch Tag und Nacht alle Thurm-Thüren offen stehen ließen, und sagte auch, daß ich schon seit langer Zeit hätte hinaus kommen können, wenn das mein Fürsatz wäre gewesen. Gert blieb in seinem Dienst, und der Schloßv. sagte niemals zu Gert, daß er mich des Morgens einschließen sollte.
Zu der Zeit hatte ich mir ein Clavicordium gekaufft, und da Barbra gut singen konnte, spielte ich Psalmen, und sie sang, so daß uns die Zeit nicht lang ward. Sie lehrte mich Bücher einbinden, so weit ich dessen bedurffte. Ich hatte auff Begehren eine Ratze von dem Schloßv. bekommen, welcher er den Schwantz abschnitt; die setzte ich in ein Pappegojen-Bawer und gab ihr zu essen, so daß sie sehr zahm ward. Diesen Zeitvertreib wollte das Weyb mir nicht gönnen, und da das Bawer in dem anderen Gemach hing, und es unten aus Eisendraht Gitter bestand, damit der Un-rath hinaus fallen konnte, so verbrannte sie die Ratze mit einer Kertze von unten. Es war leicht zu mercken, aber sie leugnete es.
Mein Beicht-Vater, H. Emmeke, wurde Prediger in Kiøge An. 1676. Im selbigen Jahr ward mein Gnaden-Geldt vermehrt, und bekomme ich jedes Jahr 250 Rdlr. So stehet in der Ordre, daß die 200 Rdlr. zur Anschaffung von Kleidern gebraucht werden sollen, und die 50 Rdlr., etwas zu kauffen, die Zeit darmit zu vertreiben. Gott segne und bewahre gnädigst kön. Majt. und gebe, daß er viele glückliche Jahre erleben möge.
Zu der Zeit war Brant Zahl-Meister.
Im selbigen Jahr den 17 Dec. kam Barbra von mir, verehelichte sich mit einem Buchbinder-Gesellen; berewete es später. Und da ihr Mann 1½ Jahr nach ihrer Hochzeit starb, und das hastig, kam Barbra in Verdacht. Sie kam später in das Haus ihres Bruders und verfiel in Kranckheit. Das Gewissen erwachte, und sie ließ Tøtzløff zu sich holen und sagte ihm so gut wie gerade aus, daß sie ihren Mann vergifftet hätte; bat ihn, mir das zu sagen. Ich verwunderte mich nicht sehr darüber, denn nach ihrer eigenen Erzählung hatte sie zuvor an ihren eigenen Kindern Mord geübt; sagte aber zu Peter Tøtzløff, er möchte nichts darüber reden; wolle Gott es offenbaret haben, so geschehe es gleichwol; der Bruder und die Magd im Hause wüßten es; er solle nicht wieder dahin gehen, wenn sie ihm auch Bothen schickten. Sie ward gantz un-sinnig, lag elendiglich in ihrem eigenen Un-rath. Der Bruder ließ sie später in das Pest-Haus führen.
An Barbarae Stelle kam eine mit Namen Sitzel Klemmings Tochter; ihr hatte Maren Blocks den Dienst zuwege gebracht, sintemal Sitzel ihr Geldt schuldig war. Sie ist eine lockere Weybes-Persohn, und Maren gab sie vor eine Jungfer aus; hatte eine weiße Haube auff ihrem Kopff, als sie heran kam. Sitzels Schuldt an Maren war daher gekommen, daß Maren, sintemalen Sitzel Knöpffe machen konnte, und die Knopffmacher Krackehl mit ihr hatten, ihr einen Königs-Brieff zu Wege brachte, umb sie von der Widerrede der Knopffmacher zu befreyen, unter dem Fürgeben, daß sie gebrechlich sey. Als die Thür am Abend geschlossen war, begehrte ich, den Königs-Brieff zu sehen, so Maren ihr zu Wege gebracht hatte. Und als ich sahe, daß dort standt: das gebrechliche Weybs-Mensch, so fragte ich sie, was vor ein Gebrechen sie hätte. Sie antwortete, sie hätte kein Gebrechen. ›Warumb‹ (fragte ich) ›habet Ihr Euch dann vor gebrechlich aus gegeben?‹ Sie antwortete: ›Das hat Maren Blocks gethan, mir den Königs-Brieff zu Wege zu bringen.‹ ›Hier in dem Brieff‹ sagte ich, ›werdet Ihr ein Weybs-Mensch genannt und nicht eine Jungfer; seyd Ihr denn verlockt worden? Sie ließ den Kopff hängen und sagte leise: ›Ja.‹ Ich war nicht sehr zu Frieden; sagte: ›Mit lügen hat Maren Blocks Euch den Königs-Brieff zu Wege gebracht und mit lügen Euch zu mir geführt, wie wird dann Euer Dienst seyn?‹ Sie gab gute Worte, versprach, gut zu dienen, mir nie etwas zuwider zu thun. Sie ist ein gefährliches Mensch; es ist nichts gutes an ihr; dreist, un-verschämt, fürchtet nicht, sich mit einem Kerl zu rauffen. Sie schlug zu gleicher Zeit zween Knopffmacher, die ihr die Arbeit wegnehmen wollten, so daß sie das Feldt räumen mußten. Bey mir hat sie keine Gelegenheit, ihren bösen Sinn so vollkommen sehen zu lassen; er läßt sich aber auff allerley Art erkennen. Ich wehrte einmal eine Raufferey zwischen ihr und Maren Blocks ab. Denn als Maren Blocks ihr Geldt wieder kriegte, so sie für Sitzels Königs-Brieff ausgelegt hatte, wollte sie sie von mir weg und eine andere an ihre Stelle bringen, aber ich ließ Maren Blocks sagen, daß sie nicht glauben dürffe, sie könne mir eine herbey bringen, die ich entgegen nehmen müßte; vor dieses Mal sey es schon genung. AdÜEine Anmerkung im M. S. zu dem Inhalt dieser Seite ist später übergestrichen und lautet wie folgt: – In diesem 1676. Jahr verehelichte der Schloßv. sich zum dritten Mal, mit einer Frau, die auch zwei Männer gehabt hat. An. 1677 den 9. Aug. starb meine Schwester Elisabeth Augusta.
An H. Emmeke Norbyes Stelle ward H. Johan Adolf Borneman Schloß-Prediger, ein sehr anständiger und gelehrter Mann, der zu der Zeit mein Beicht-Vater wurde, und versah er mich zum ersten Mal Anno 1677 den 10. Aprilis.
Im selbigen Jahr am 9. October war mein Beichtvater Magister Hendrich Borneman, Probst an Unserer Frawen Kirche (ein fürtrefflicher gelehrter Mann), da sein Bruder, H. Johan Adolf Borneman, mit Königl. Majt. verreiset war.
Ich habe, Gott sey Danck ! dieses Jahr in Ruhe verlebt, gelesen, geschrieben und verschiedenes gedichtet.
Anno 1678 ward mir zu Wege gebracht, daß mein Beicht-Vater, H. Johan Adolf Borneman, alle 6 Wochen zu mir kam, und hielt einen kleinen Sermon.
In diesem Jahr, am Ostertag, ward Jungfraw Agneta Sophia Budde hier in den Thurm geführt. Ihr Gefängniß war oberhalb meines innersten Gemachs. Sie ward beschuldigt, die Gräffin Skeel mit Gifft haben umbbringen zu wollen, und da sie eine junge Persohn war und eine Zofe hatte, die sie bedienen sollte und auch jung war, so tobten sie dergestalt am Tage, daß ich wenig Ruhe vor ihnen hatte. Ich redete aber nicht darüber, meinte, daß sie wol würde stille werden, wenn sie vermerckte, daß es an den Hals ging. Aber nein! sie war lustig bis zu dem Tag, da sie hingerichtet ward. Im selben 1678. Jahr, den 4. Marti, bekam ich zur Nachbarin ein Weyb mit Namen Lucia, die bey F. Rigitze Grubbe diente. Sie ward von Jungfer Agneta Sophia Budde beschuldigt, daß sie die jenige gewesen sey, die sie auff Veranstaltung ihrer Fraw überredet hätte, Gräffin F. Birrete Skeel zu vergeben, und daß Lucia ihr das Gifft gebracht habe. Es waren Zeugen da, von welchen Lucia das Gifft gekaufft hatte. Dieses Weyb war eine standhafftige, getrewe Dienerinn. Sie nahm alles, was ihr aufferlegt wurde, mit allergrößter Geduldt entgegen, war in dem Dunckeln Gefängniß getrost. Hatte zween Manns-Persohnen zu Cameraden, welche beyde schrien, seufzeten und weinten. Von der Gräffin Skeel (von der sie ernähret werden mußte) ward ihr Fleisch gesendet, das von Maden wimmelte, und schimmliges Brodt. Ich erbarmte mich ihrer (nicht von wegen ihrer Fraw, denn die hat nichts gutes an mir verdienet und die Wolthaten früherer Zeiten übel belohnt, sondern aus Mitleidt), sandte ihr Speise und Tranck und Geldt, damit sie Gert milde stimmen möchte, der zu hart gegen sie war. Sie wurde gepeinigt, wollte aber nicht das geringste von dem bekennen, dessen sie beschuldiget war, vertheidigte alleweil ihre Fraw. Sie blieb dann eine Zeit lang sitzen.
Im selbigen Jahr, am 19. Julii in einer Morgenstunde‚ ward der Thurmwächter Gert von einem zum Tod verurtheilten Dieb erschlagen, dem er all zu viel Freyheit gab. Ueber diesen Vorfall will ich etwas weitläufftiges vermelden, sintemal ich Gert gerathen, diesem gefangenen nicht so viel Freyheit zu geben; aber er achtete meinen Rath nicht, zu seinem eigenen Un-glück. Dieser Dieb war zur Nachtzeit in eines Predigers Haus eingebrochen und hatte einen Brau-Kessel gestohlen, trug ihn auff seinem Kopff nach Coppenhagen; ward am Morgen darmit im Thor ergriffen und hier in den Thurm gesetzt. Er wurde verurtheilt, gehenckt zu werden, (hatte schon mehrfach Dieberey begangen). Der Prediger ließ es mit der Execution hinstehen, wollte ihn nicht hencken lassen; dann wurde gesagt, er sollt auff den Holm, es dawerte aber lange, ehe er dahin kam. Im Anfang und so lange als man darüber sprach, daß er auff den Holm sollte, war er mein Nachbar in der Dunckeln Kirche, stellte sich gantz gottesfürchtig an, las (zum Schein) andächtiglich, bat Gott umb seiner Sünden Vergebung mit gar tieffen Seuffzern. Der Schelm wußte, daß ich ihn hören konnte, und sandte ich ihm denn auch zuweylen was zu essen. Gert erbarmete sich seiner, ließ ihn am Tag in das Erdgeschoß des Thurmes gehen und setzte ihn Nachts wieder fest. Später ließ er ihn auch in der Nacht unten im Thurm liegen. Und da ich den Dieb ein oder zwey Mal gesehen hatte, wenn meine Thür offen stand, und er vorbey ging, schien mir, daß er ein mörderisch Angesicht hätte, weshalb ich, als ich wahrnahm, daß der Dieb Abends nicht in die Dunckle Kirche gesetzt ward, zu Gert sagte, daß er zu viel wage, wenn er ihn zur Nachtzeit unten bleiben lasse; es stecke ein Schelm in ihm; er werde gewiß einmal entweichen, dann gerathe er seinetwegen in Un-glück. Gert meinte nicht, daß der Dieb weg zu lauffen begehre; er brauchte nicht mehr zu fürchten, gehenckt zu werden; er habe sich so gefrewet, daß er auff den Holm kommen sollte, es sey keine Gefahr darbey. Ich meinte, das sey eine Freude, so nicht weitter komme als bis an die Lippen; bat ihn, er möge ihn Nachts einschließen. Nein, Gert fürchtete nichts; er ließ (was noch mehr war) den Dieb statt seiner in den Thurm hinauff gehen und das Seygerwerck stellen.
Drey Tage bevor der Mord geschah, sprach ich des Morgens als Gert meine Thür auffgeschlossen hatte, mit Gert über die Gefahr, der er sich mit der Freyheit des Diebes aussetze, die Gert aber nicht fürchtete. Unterdessen setzt mein Hund sich gerade vor Gert und heult ihm in's Gesicht hinauff. Als zu Mittag gespeiset ward, läufft der Hund hinunter und heult 3 Mal vor des Thurmwächters Thür. Nie zuvor hatte ich den Hund heulen hören.
Am 19. Julii (wie gemeldt ist), als Gertis un-glückliche Morgenstunde gekommen war, kam der Dieb vom Seygerwerck herunter und sagte, daß er nicht allein darmit fertig werden könne, die Stricke seyen verwickelt. Der Schelm hielt da oben eine Eisen-Stange bereit, umb dar mit seinen Fürsatz in's Werck zu setzen. Gert ging nach oben, wurde aber herunter getragen. Der Dieb lieff hinab, nachdem Gert todt war, machte seinen Schrein auff, nahm das Geldt heraus und ging aus dem Thurm. Es war gerade ein Freytag, und da sollte zur Predigt geläutet werden. Die, so läuten sollten, klopfften an die Thurm-Thür, aber keiner machte auff. Tøtzløff kam mit dem Haupt-Schlüssel und schloß auff, sprach mit mir und verwunderte sich, daß Gert nicht da sey. Ich sagte: ›Recht geheuer ist es nicht; heut Morgen zwischen 4 und 5 war ich etwas unpäßlich; da hörte ich dreye hinauff gehen und eine Weyle darnach zwey wieder herunter kommen.‹ Tøtzløff schloß meine Thür zu und ging hinab. Indessen kombt auch einer von denen Läutern herunter und berichtet, daß Gert da oben todt liege. Als der todte besichtiget ward, hatte er mehr als eine Wunde, aber alle hinten am Kopff. Er war ein sehr kecker Mann, feurig und starck; es hätte ihm das nicht so leicht einer anthun können. Der Dieb ward selbigen Abends ergriffen, und bekannte er, wie es zugegangen war: daß nehmlich ein gefangener, so im Gitterloch saß, ein Lizenciat mit Namen Moritius AdÜDieser Mauritius ließ sich in dem Hochverrathsproceß gegen Grisffenfeldt als Spion benutzen, ward aber später wegen falschen Zeugnisses und Meineids zum Tode verurtheilt, dann zu lebenslänglichem Gefängniß begnadigt und starb in der Festung auf Bornholm., ihn darzu überredet habe. Selbiger Moritius hatte viel von Gert auszustehen. Wahr ist es, daß Gert von ihm zu viel die Woche vor seine Kost nahm. Wahr ist es aber auch, daß dieser Moritius ein sehr gottvergessener Kerl ist; der Prediger, so ihn versieht‚ gibt ihm kein gutes Zeugniß. Ich glaube wol, daß Moritius Mitwisser war, ich glaube auch, daß ein anderer gefangener, so im Erdgeschoß des Thurmes saß, seine Hand im Spiel hatte. Denn wer sollte hinter dem gefangenen Dieb die Thurm-Thür wieder zugeschlossen haben, wenn es nicht einer von ihnen gethan hätte? Denn als nach dem Schlüssel gesucht ward, fand man ihn oben im Thurm verborgen; das konnte der Dieb nicht thun, nachdem er aus dem Thurm war. Der Dieb konnte auch nicht Gertis Schrein auffschließen und sein Geldt nehmen ohn Mauritii Wissenschafft. Den anderen gefangenen mußte es auch wissentlich seyn. Mir scheint, es wurde verhindert, daß nicht mehre bey diesem Mord sterben sollten; denn die Beschaffenheit der Sache ward nicht allein nicht untersucht, wie es gebührt hätte, sondern sie setzten auch den Dieb unten in den Thurm hin. Er war mit eisernen Fesseln gebunden, aber Moritius konnte jeden Tag mit ihm sprechen, weshalb der Dieb denn von seiner früheren Aussage abging und sagte, er habe den Mord allein begangen. Ward am 8. Aug. hingerichtet, und Moritius wurde nach Borringholm gebracht und dort gefangen gesetzt.
An Gerts Stelle ward Thurmwächter einer mit Namen Johan, der ein Norweger war, ein sehr einfältiger Mann. Die Hoffleute hielten ihn sehr zum besten. Die gefangene Jungfer und ihre Zofe fixirten ihn das erste Mal als zu seiner Zeit die Zofe den Nacht-Kessel ausgießen sollte. Das Häuschen war nicht weit von der Thür ihres Gefängnisses. Der Thurmwächter ging unterdessen hinunter und ließ die Thür offen stehen. Sie lieffen und polterten herumb. Als sie ihn die Treppe herauff kommen hörten, versteckten sie sich. Er fandt das Gefängniß leer, war betrübt und wehklagte. Die Jungfer piipte wie ein Kindt, bis er sie hinter einer Thür fandt. Johan ward froh, erzählte mir später die Geschichte. Ich fragte, warumb er nicht so lange bey ihnen geblieben sey. ›Was?‹ (antwortete er) ›Soll ich bey dem Schmutz-Kram bleyben?‹ Auff solch dumme Rede war nichts zu sagen.
Ich hatte Ruhe innerhalb meiner Thüren und ergötzte mich mit lesen, schreiben und anderer Hände Arbeit, begann an meinem Todtenkleid zu nähen und sticken, wozu ich Kattun, weißen Taffet und Zwirn gekaufft hatte.
Am 7. Aprilis entwich ein junger Kerl aus dem Thurm, so mit Eisen-Boltzen umb die Beine in das Erdgeschoß des Thurmes hinunter ging. Selbiger gefangener hatte Gelegenheit, seine Boltzen ab zu lösen, wußte auch, daß Tölpel Johan den Thurm-Schlüssel unter sein Kopffkissen zu legen pflegte. Er hielt auch eine eiserne Pinne bereit, umb die Thür auff zu schließen, wo der Thurmwächter schlieff; machte sie leise auff, nahm den Schlüssel, schloß den Tölpel wieder ein und ging aus dem Thurm. Der einfältige Mann ward gefangen gesetzt, aber nach 6 Wochen Verlauff wieder los gegeben.
An seine Stelle kam einer mit Namen Olle Mathisen, der von Schonen war; er hatte sein Weyb mit sich im Thurm. Gegen Ende dieses Jahres, am 25 Dec., ward ich kranck an einem Fieber; und erhielt D. Mynchen Befehl, mich zu besuchen und in seine Cur zu nehmen, welchen Befehl er auch mit großer Sorgfalt erfüllte. Er ist ein sehr anständiger Mann, milde, vorsichtig in seiner Cur. Ich gelangte 10 Tage darnach wieder zu meiner Gesundheit.
Im Beginn des 1680. Jahres ließ Sitzel Klemmings Tochter sich von Maren Blockis überreden, sich mit einem von des Königs Leib- Garde zu verloben. Kam fort den 26. Novem.
An ihre Stelle kam eine mit Namen Margrete. Als ich sie zuerst sah, kam sie mir etwas verdächtig für, und schien mir, daß sie mit einem Kindt ging; ließ es mir doch nicht mercken bis Januarii Monat, den letzten Tag. Da stellte ich ihr eine Frage, aus der sie vernehmen konnte, was ich meinte. Sie antwortete mit Lügen darauff, aber ich fiel ihr strax in's Wortt; und wendete sie eine sonderliche List an, so sich nicht ziemet zu vermelden, umb ihre Lügen zu beweisen; aber ihre List konnte vor mir nicht bestehen, so daß sie später bekennen mußte. Ich fragte sie nach ihrem Kindes-Vatter (vermeinte, daß es des Königs Leib-Kerl sey, so in Arrest unten in der Kammer des Schloßv. war, sagte es aber nicht.) Sie antwortete dermalen nicht auff meine Frage, sagte aber, sie sey noch nicht so weit: ihre Dickigkeit wäre mehr vom Fett als vom Kindt, denn es rühre sich noch nicht. Dieses Weyb war früher, ehe sie zu mir kam, in Dienst bey der Fraw des Schloßv. gewesen, und hatte der Schloßv. mir weiß gemacht, sie sey verehelicht. Da geschah es, daß ich sie eines Tags nach ihrem Leben und Treiben frage; darauff erzählt sie ihre Herkunfft, wo sie diente, und daß sie 2 Banckerte hätte, einen jeglichen mit seinem Vatter, zeigt indessen auff ihren Leib und sagt: ›Ein Vatter soll sich auch wol zu diesem bekennen, und das ein wackerer Vatter! Ihr kennet ihn wol? Ich sagte: ›Ich habe des Königs Leyb-Kerl wol auff dem Platze gesehen, aber ich kenne ihn nicht.‹ Sie lachte und antwortete (in ihrer Mutter-Sprache): ›Neen, bi Gott! dat is nicht em; dat is de guthe Slosv.‹ Ich glaubte es wahrlich nicht. Sie schwur darauff und erzählte mir einige Umbständlichkeiten. Mir schien, ich müßte ihrer baldt los werden, begehrte, mit der Fraw des Schloßv. zu sprechen, die auch zu mir kam. Ich sagte ihr meinen Verdacht über das Weyb, und worauff mein Verdacht beruhete, ließ mir aber nichts merken von dem, was das Weyb mir selbst bekannt und gesagt hatte; bat die Fraw des Schloßv., sie möchte das Weyb mit guter Manier von mir entfernen. Sie verwunderte sich über meine Rede, zweiffelte, daß es wahr sey. Ich sagte: ›Ob es so ist oder nicht, entfernt sie, je eher je besser.‹ Sie versprach, es solle geschehen, aber es geschah nicht. Margrete machte sich nichts daraus, daß es bekannt wurde, daß sie mit einem Kindt ging, erzählte es dem Thurmwächter; sagte eines Tages zu ihm: ›Olle, wie war es mit Euerer Fraw, als sie Zwillinge kriegte? Ging da nicht ein Strich längs ihrem Bauch hinunter?‹ Ole antwortete: ›Das weiß ich nicht. Fraget Anne darnach!‹ Margrete sagte, daß da ein Strich an ihrem Bauch hinunter ginge, meinte, sie hätte Zwillinge. Eines Tags, als sie ein Tuch über die Lehnen von meinem Arm-Stuhl nähen sollte, sagte sie: ›Nu hat sich der Gottes Engel gerühret!‹ Und als die Fraw des Schloßv. nicht hielt, was sie versprochen hatte, und die Schwester von Margrete offt in den Thurm kam, so fürchtete ich, daß die Schwester ihr etwas zustecken möchte, das Kindt dar mit zu vertreiben (was später auch wol geschah), weßhalb ich eines Tages zu Margrete sagte: ›Ihr sagt, daß der Schloßv. Vatter zu Euerem Kindt ist, aber das waget Ihr ihm nicht selbst zu sagen.‹ ›Ja,‹ schwur sie, ›und ob ich das wage! Meinet Ihr, daß ich nicht was von ihm haben will, mein Kindt zu ernähren?‹ ›Dann will ich ihn holen lassen‹ (sagte ich), ›nur umb zu hören, was er sagen wird‹ (es war damals sehr selten, daß der Schloßv. zu mir kam). Sie bat mich, ich solle es nur thun; er könnte nicht leugnen, daß er der Vatter zu ihrem Kindt sey. Der Schloßv. kam auff mein Begehren. Ich fing die Rede in Gegenwart des Weybes an, sagte, daß Margrete nach ihrer eigenen Aussage mit einem Kindt ginge; wer der Vatter dar zu sey, könne er sie fragen, wenn er wollte. Er fragte sie, ob sie mit einem Kindt ginge. Sie antwortete: ›Ja! en Ji siin Fader dar tho.‹ ›Ick?‹ (sagte er und lachte) ›Wat för en Snack is dat?‹ Sie fuhr fort in ihrer Rede, schwur, kein anderer als er wäre Vater zu ihrem Kindt, sagte die Umbstände, wie es zugegangen sey. Der Schloßv. sagte: ›Wo dull is datt Wiif!‹ Sie brauchte flux ihr Maulwerck, so daß ich ihr befahl, hinaus zu gehen; sprach dann mit dem Schloßv. allein, bat ihn, bei Zeiten nach einem andern Weyb für mich sich umb zu sehen, ehe es mit ihr zum äußersten käme; ihren Tratsch zum schweigen zu bringen, darzu fände er wol Rath. Sagte ihm mit etzlichen Worten die Wahrheit, daß er seine Metze herauff geführt hätte, mich zu bedienen. Er antwortete: ›Sie lügt, das boshafftige Mensch! Ich habe Tøtzløff schon befohlen, er soll sich nach einer anderen umb kiken. Miin Frue häfft mi gesägt, wat Ji verleeden to ehr säde. AdÜD. i. Was Ihr vor Kurzem zu ihr sagtet.‹ Nach diesem Gespräch ging der Schloßv. weg. Peter Tøtzløff sagte mir, daß eine englische Frawenspersohn begehret hätte, bey mir zu seyn, könnte aber nicht vor Ostern kommen.
Vier Tage darnach begann Margrete zu klagen, es ginge ihr schlimm, und sagte sie des Vormittags zu mir: ›O, ich dencke, es wird mir übel ergehen; mir ist so schlimm.‹ Ich dachte gleich das, so ich gefürchtet hatte, was nämlich die häuffigen Besuche ihrer Schwester zu bedeutten hätten, schickte strax zu Peder Tøtzløff, und als er zu mir kam, erzählte ich ihm meinen Verdacht über Margrete, bat ihn, er möge sich alle Mühe geben, mir noch selbigen Tags das englische Weyb herauff zu schaffen. Inzwischen ging Margrete auff das Häuschen, war über 5 Viertelstunden oben, kam herunter und sah aus wie eine Leiche; sagte: Nu wird es wol gut mit mir werden. Was ich dachte, wollte ich nicht sagen (denn ich wußte, daß sie, wenn ich sie nach der Ursach ihres schlimmen Aussehens gefragt hätte, es gleich alles bekannt haben würde, und das wollte ich nicht wissen); sagte darumb: ›Wenn Ihr Euch ruhig verhaltet, so wird es wol gut. Heut Abend kommt ein andres Weyb.‹ Das gefiel ihr nicht; sie meinte, daß sie jetzo wol bleiben könnte. Ich achtete weder auff das jetzo noch auff ihre andern Worte, sondern blieb darbey, daß ein anderes Weyb käme. Das geschah auch, und am 15. Martii des Abends kam Margrete fort, und statt ihrer kam ein englisches Weyb mit Nahmen Jonatha, so mit einem Dänen war verheyrathet gewesen mit Nahmen Jens Pedersen Holme.
Als die Margrete fort war, erzählte man mir von der Fraw des Schloßv., daß sie gesagt habe, ich hätte Margrete überredet, sie möge aussagen, daß ihr Mann der Vatter zu Margaretae Kind sey.
Obwol es mich nicht angehet, will ich doch kurtz vermelden, auff welche betrügliche Weise die guten Leute später diese Margrete verheyratheten. Sie machten einem Buchbinder-Gesellen weiß, daß sie verehelicht gewesen sey, zeigten sowol ihm wie auch dem Prediger, so sie einsegnen sollte, ihrer Schwester Heyraths-Schein. Ole Thurmwächter ward von dem Schloßv. mit einem Knüppel auff seinem Rücken gewixt, als Margrete fort war, und wurde ihm fürgehalten, er hätte gesagt, was Margrete ihm über ihre Dickigkeit berichtet hatte.
Im selbigen Jahr, am Weihnachts-Tag des Morgens, erlösete Gott D. Otto Sperlings schwere Bande, nachdem er hier im Blawen Thurm 17 Jahr, 8 Monathe und 4 Tage gefangen gesessen hatte, in seines Alters 80. Jahr, weniger 6 Tage. Er war lange kranck, doch nicht bettlägerig. Doctor München bediente ihn ein paar Mal mit seinen Medicamenten. Er wollte zu keiner Zeit, daß der Thurmwächter ihm das Bett bereittete, konnte sich erzürnen, wenn Ole sich darzu erboth und zu verstehen gab, der Doctor sey schwach. Es durffte auch keiner zugegen seyn, wenn er sich niederlegte. Wie er in der Weih-Nacht auff den Fußboden kam, weiß man nicht; da lag er und klopffte auff den Boden. Der Thurmwächter konnte sein klopffen nicht hören, denn er lag weit von des Doctors Gemach; aber ein gefangener, so im Erdgeschoß lag, hörte es, klopffte dann an des Thurmwächters Thür und sagte ihm, daß der Doct. lange geklopfft hätte. Als Ole herein kam, fandt er den Doct. auff dem Boden liegen, mit einem reinen Hemdt halb bekleidet. Er lebte noch, stöhnte sehr, redete aber nicht. Ole nahm einen gefangenen zu Hülffe und hob ihn in das Bett und schloß wieder zu. Am Morgen fandt man ihn todt, wie gemeldt ist.
An. 1682, im April Monat, ward ich kranck und bettlägerig durch einen sonderlichen Umbstand, so mich lange gequälet hatte; war eine steinige Materie, die hatte sich quaguliret und in meinen Gedärmen bis zum Fundament nieder gesenckt. Doctor München brauchte alle dienlichen Mittel gegen diese Schwachheit; konnte aber nicht glauben, daß die selbige die Beschaffenheit hätte, wie ich meinte und ihm berichtete: daß ich in der That wahrnehmen könne, es sey ein Stein, so sich im Gang des Gedärmes befinde. Er meinte, wenn das sey, so würden die Medicamente, die er angewendet habe, ihn wol aus treiben, denn es war an dem Tag, wo ich mir selbst 3 Mal Clistiere versetzete. Die Clistiere mit anderer natürlicher Materie kamen herfür, aber der Stein klemmte sich im Gang und schien rund zu seyn, denn ich konnte ihn nicht ergreiffen mit einem Instrument, so ich mir hatte machen lassen. Zu der Zeit mußte der Doctor mit Sr. Majestät nach Holstein reysen. Ich brauchte wol die Clistiere nach D. Münchens Anweysung, aber es blieb immer so wie zuvor. Endlich versetzte ich mir ein Clistier, gantz von Oel. Das that erst am nächsten Tag des Morgens früh seine Wirckung; da schoß außer anderer Materie ein großer Stein herfür, und schlug ich mit einem Hammer ein Stück von ihm ab, umb zu sehen, wie er innen beschaffen sey, fandt ihn wie aus Strahlen zusammen gesetzt, an etlichen Stellen wie vergüldt, an anderen Stellen wie versilbert. Er ist fast einen halben Finger lang und volle 3 Finger dick und ist noch in meiner Verwahrung. Als D. München zurück kam, ließ ich ihn wissen, wie es mir mit mir stand. Er war zu der Zeit bey der Hoffmeisterinn F. Sitzele Grubbe. D. München ließ durch Tøtzløff begehren, er wolle den Stein sehen. Ich ließ antworten, daß wenn er zu mir kommen wollte, so werde er ihn zu sehen kriegen. Ich wollte ihn nicht senden, denn ich wußte wol‚ daß ich ihn nicht wieder bekommen hätte.
Anno 1682 den 11. Junii dichtete ich nachfolgendes geistliches Lied.
Kann gesungen werden wie:
Singen wir aus Hertzens-Grund.
1.
Was ist unsere Lebenszeit
Anderes als täglich Streit?
Was ist unsere Arbeit doch,
Unsere Knechtschafft, unser Joch?
Sind sie anders als umbsunst?
Was nützt Wissenschafft und Kunst?
Alles schwindet wie ein Dunst.
2.
Warumb denn bekümmerstu
Dich umb solches? Gib dir Ruh!
Warumb denn so keck verfichtst
Du den Schemen, eitel nichts?
Gibt es hier wol einen Mann,
Der sein Schuld bezahlen kann,
Wenn der Mahner klopffet an?
3.
Nackend kam ich auff die Welt
Und scheide wie ich herbestellt.
Der Herre gibt, der Herre nimmt,
Und es ist gut wie er's bestimmt.
Gelobet sey der Nam des Herrn:
Ihm vertraw ich hertzlich gern!
Meine Stunde ist nicht fern.
4.
Herr, noch eines will ich flehn:
Laß mich dein Haus noch einmal sehn,
Daß ich dort mit Lob und Preis
Singen mag nach frommer Weis,
Loben deiner Gottheit Macht
Und was Jesus hat vollbracht,
Was er uns zu Weg gebracht.
5.
Sagestu dann auch zu mir:
Ich hab keine Lust an dir,
Du gehst nicht zum Himmel ein. –
Ei, mein Jesus, sieh darein!
Kann ich nicht zu Recht bestehn,
Laß mich deine Wunden sehn:
Gottes Gnad kann nicht vergehn.
Am 27. Junii sandte die Königin mir etwas Seyde und Silber mit dem Begehr, ihr eine Blume zu sticken, so auff Pergament gezeichnet war; sandte auch eine andere Blume, die gestickt war, auff daß ich sehen könnte, wie die Arbeit seyn sollte, so die güldene Arbeit genennet wird. Ich hatte nie zuvor an solcher Arbeit gestickt, denn das schlägt sich flux auff die Augen; übernahm es doch und sagte, ich wolle es machen, so gut ich könnte. Am 9. Julii sendete ich der Hoffmeisterinn, F. Sitzel Grubbe, die Blume, so ich gestickt hatte, mit dienstfertigem Begehr, selbige auff das unterthänigste Ihr. Majt. der Königinn zu überreichen. Der Königinn gefiel diese Blume gar wol und sagte sie, daß sie vor den anderen herfür stach, so etzliche Gräffinnen vor sie gestickt hätten.
Ich stickte später 9 Blumen von Silber und Seyde in der güldenen Arbeit und sendete sie der Königinn Hoffmeisterinn mit dienstfertigem Begehr, selbige Ihr. Majt. der Königinn unterthänigst zu presentiren. Die Hoffmeisterinn ließ mich der Königinn Gnade versichern: Ihre Majt. wolle mir zween silberne Flaschen geben; aber darvon habe ich bis jetzo noch nichts gespüret.
Ich flickte im selbigen Jahr eine Tisch-Decke mit Flock-Seyde in neuen von mir ausgedachten Flammen, staffirte sie mit Tafft und Silber-Frantzen; ließ selbige durch F. Hoffmeisterinn Grubbe Ihr. Majt. unterthänigst presentiren, welche sie in Gnade auffnahm. Am 29. November vollendete ich meine Arbeit, so ich zu meinem Todtenzeug gemacht habe. Die war aus Zwirn gewirkt. Auff das Kissen stickte ich an dem einen Ende nachfolgendes:
Viel Hertzenssorg und Noth, viel Angst in stillen Nächten Thät ich auff diesem Tuch allhier zusammen flechten!
Auff das andere Ende dieses: – (
![]() Das Kissen war mit meinem Haar gestopfft.)
Das Kissen war mit meinem Haar gestopfft.)
Wenn einst auff dieses Haar mein müdes Haupt sich neigt,
Dann ist mein Leib erlöst, mein Seel gen Himmel steigt.
Auff das Augen-Tuch war gestickt:
Ich weiß es gantz gewiß, daß du, mein
Jesus, lebest
Und meinen morschen Leib einst aus dem Staub erhebest
Und ihn von neuem schmückst mit herrlicher Gestalt,
Führst ihn vor deinen Thron, du hohe Allgewalt!
Da werde ich alsdann mit himmlischem Entzücken
Im majestätschen Glantz dich, großer Gott, erblicken.
Nicht fremd wirstu mir seyn. Mein Gott, ich werd dich sehen!
Hilff
Jesu, Bräutigam, laß mich vor dir bestehen!
Ihre Majt. die Königinn war alleweil gnädig, sendete mir auff's neue eine große Menge Seiden-Rauppen, umb sie zum Zeitvertreib vor sie zu füttern und deren Gespinnst Ihr. Majt. zurück zu senden. Die tugendsame Königinn schickte mir einige Male auch Pommerantzen, Citronen und von den großen Almanachen etzliche, und das durch einen Zwerg, so recht ein hurtiger Kerl ist. Seine Mutter und sein Vater hatten meiner sel. Schwester Sophia Elisabet und meinem Schwager Graf Pentz gedienet.
Der königl. Kinder Hoffmeisterin, F. Sitzel Grubbe, war sehr höfflich und gut gegen mich, schickte mir etliche Male Citronen, Pommerantzen, Multebeeren und andere Früchte je nach des Jahres Zeit.
Eine Jungfer, von Geschlecht eine Donep AdÜDonep, eine hessische Familie. Vgl. die Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans aus den Jahren 1676 bis 1706. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Ludwig Holland. Stuttgart, 1867., sendete mir auch ein paar Mal Obst.
Die Jungfern am Hoff schickten mir einmal etwas verworrene Seyde von der Rauppen-Seyde, so sie abspinnen wollten und nicht recht mit umb zu gehen wußten; ließen mich bitten, das zu ordnen. Ich hatte anderen Zeitvertreib, den ich nicht gern bey Seite legte (denn ich war in der Arbeit, meine Heldinnen zu sammeln), aber ich that ihnen doch ihren Willen. Ich habe auch in meinem Gefängniß eine Erfahrung über Rauppen erlangt. Hatte einen Zeit Vertreib, zu sehen, wie sie sich veränderten. Die Rauppen waren anscheinlich von einerley Schlag, gleich gestreifft und von gleichen Farben. Aber nicht aus allen kamen Schmetherlinge. Es ist gantz artig zu sehen, wie ein Part, wenn sie sich verändern wollen, sich irgend wo anstemmen, wo gegen es auch seyn mag, und einen Faden (wie Seyden-Wurmb Faden) an beyden Seiten befestigen, ziehen ihn über den Rücken hin und wieder wol an die 50 Mal, alles auf der selbigen Stelle, beugen sich offt mit dem Rücken, umb zu sehen, ob die Fäden auch starck genung seyen; wenn nicht, so ziehen sie noch mehr Fäden. Ist das geschehen, verändern sie ihre Gestalt in großer Eile und werden dick, mit einer Schnautze vorn, so am Ende spitzig ist, nicht un-gleich einem Fisch, den die Hollander Knorr nennen; haben auch eben solche Flossen auff dem Rücken und eben solchen Kopff. In dieser Bildung bleiben sie 16 Tage, dann kombt ein weißer Schmetherling heraus. Aber bey einigen Rauppen kommen aus ihren beiden Seiten kleine wintzige Rauppen wie Maden herfür, weißlich, breit an einem Ende und spitz an dem andern Ende. Die umbspinnen sich selbst mit einer großen Geschwindigkeit, eine jegliche vor sich. Dann überspinnet die Rauppe sie ziemblich dick, wältzet sie herumb, so daß sie fast wie runde Bälle werden. Darinnen liegen sie gantz eingetrocknet, essen nichts, werden so mager wie eine Fliege, ehe sie stirbt. Zwölff Tage darnach kommen kleine Fliegen aus dem Ball, und sieht der Ball dann aus wie ein kleiner Bienen-Korb. Ich habe bey dem selbigen Schlag Rauppen gesehen, wie kleine lebende Rauppen aus dem Nacken der alten kamen (was ich vor das rarste halte), aber sie lebten nicht lange, aßen auch nichts. Die Mutter starb strax nachdem der kleine heraus gekommen war. Meine fast 20-jährige Gefangenschaft konnte der Königinn-Wittib Hertz gegen mich nicht rühren (da ich doch mit einen gutem Gewissen vor Gott bezeugen kann, ihr niemals Ursach zu solcher Un-gnade gegeben zu haben). Mein allergnädigster Erb-König war so gnädig, ließ in den früheren Jahren etliche Male durch seine hohen Ministri Fürbitte bey seiner königl. F. Mutter für mich thun. Dann war die Antwort sehr hart‚ und ihre Titteln waren: ›Verräther‹ und ›eben so gut als ich;‹ wies ihnen die Thür. All die Gnade, so mir durch Königl. Majt. widerfuhr, wie: das äußere Gemach, das große Fenster, das Geldt, über das ich selber verfügen konnte, verdrossen die Königinn-Wittib auff das hefftigste; gab auch ihr Mißbehagen Sr. Königl. Majt. auff schlimmste Weise zu erkennen. Und da sie auch erkundet hatte, daß ich ein Clavicordium besäße, verdroß sie das insonderheit, und sprach sie mit dem König gar übel darvon; wannenhero der Schloßv. eines Tags zu mir kam und sagte, der König hätte ihn gefragt, wie er darzu komme, mir ein Clavicordium zu verschaffen. ›Ick‹, sagte der Schloßv., ›stund verbast, wußte nicht, wat ick seggen skulle.‹ (Ich dachte: du weißt viel darvon, was auff dem Thurm geschicht. Ich sah ihn nicht mehr als drey Mal im Jahr.) Ich fragte, wer dem König was von dem Clavicordium gesagt habe. Er antwortete: ›De aalde Königinn; se häfft ere Spionen öffwer all, end se häfft den König so hart thogesprocken, dat het en Schande is, dat he Ju so grote Friiheit gifft;‹ faßte darmit das Clav. an, grade als ob er es weg nehmen wollte (und sagte:) ›Ji möten dat nicht häbben.‹ (Ich sagte:) ›Laet Ji dat staan! Ick hebbe Verlöf von Ih. Majt. miinen allergnädigsten König, für dat Gelt, mii gnädigst vergönt is, tho kopen, wat ick wil tho min Tiidsverdriff. Dat Clavic. is kehnen im Wege und de königliche Frue Moder tho kehnen Schaden.‹ Er zog doch daran und wollte es mit hinunter nehmen (es standt auff einem Schranck, den ich mir gekaufft hatte). Ich sagte‚ mit etwas lauter Stimme): ›Ji söllen mii dat staan laten, bit Ji mii min Gelt wedergewen, dat ick daför gegewen häbbe; so möge Ji dar mit doen, wat Ji wil.‹ (Er sagte:) ›Dat wil ick den König säggen.‹ Ich bat ihn, das solle er nur thun. Später ward nichts mehr darüber gesprochen, er Schloßv. sagte mir später, daß der König gelacht habe, als er Sr. Majt. meine Antwort über das Clavicordium mittheilte, und hatte gesagt: ›Ja, ja.‹ und habe ich das Clavicordium noch, spiele doch selten darauff. Ich schreibe und spute mich, meine Heldinnen einzukleiden, auff daß ich darmit fertig werde, und nicht Kranckheit oder gar der Tod verhindere, daß ich es vollende, oder auch der Freund, dem ich es anvertrawe AdÜD. i. P. J. T&oslah;tzløff., von mir kommt, dann käme es nicht, meine hertzlieben Kinder, in Euere Hände.
Am 24. Septr. ward mein Beicht-Vater M. Johan Adolf befördert; wurde Probst an Unserer Frawen Kirche. Er nahm einen sehr beweglichen Abscheid, und hatte er mich fast 6 Jahre versehen und war mein Trost gewesen. Gott weiß, wie un-gern ich ihn vermißte.
Im Anfang dieses Jahres war mein Beicht-Vater H. Peder Collerus, so damals Schloß-Prediger war. Besuchte mich auch mit seiner Trost-Predigt alle 6 Wochen. Ist ein gelehrter Mann, aber nicht wie Borneman.
Am 3. April wurde mir im Namen der Königinn ein alter gebrechlicher Hund zugesendet AdÜd. i. im Namen der Königin-Wittwe Sophia Amalia. (ich glaube, die Jungfern schickten ihn, umb der Mühsal quit zu seyn). Dem hatte ein Marder den Kieffer entzwey gebissen, so daß die Zunge an der einen Seite heraus hing. Alle Zähne waren weg; über dem einen Auge war eine feine Haut. Er hörte nur wenig, lahmte auff der einen Seite. Das schlimmste aber war, man konnte gar wol vermercken, daß er die Liebe über sein Vermögen hatte probiren wollen. Mir wurde gesagt, daß Ihre Majt. die Königinn den Hund sehr geliebt habe. Er war ein kleiner Bollognes; sein Name war Cavaillier. Die Königinn meinte, daß er mir nicht lange beschwerlich seyn werde. Ich hoffte das selbige.
Am 12. Aug. dieses Jahres vollendete ich das vorgenommene Werk, und sintemal meine Entwurff-Schrifften über allerhand preiswürdige Weybs-Persohnen handelten, sowol über streitbare als auch über vernünfftige Regentinnen, über getrewe, über keusche, gottesfürchtige, tugendsame, unglückliche, gelehrte und standhafftige, so schien mir, daß sie nicht zu denen Heldinnen gezählet werden könnten, nahm etzliche von ihnen heraus und theilte sie in drey Theile, unter dem Tittel Der Heldinnen Zier AdÜEine Abschrift des ersten Theils befindet sich in Karen Brahe's Bibliothek zu Copenhagen. Dessen dänischer Titel lautet: Haeltinners Pryd. Er enthält Charakteristiken und Lebensbeschreibungen folgender Frauen: Deborah, Königin Margarethe, Thyra Danebod, Elisabeth von England, Tomyris, Isabella von Castilien, Zenobia, Johanna von Montfort, Artemisia, Svanhvita, Lagertha, Berenguela von Castilien, Hetha, Margaretha von Oesterreich, Semiramis, Amage, Victorina, Voada, Olafa, Camilla, und der Amazonen Marpesia, Lampedo, Antiope, Orithya, Penthesilea und Thalestris. (Soph. Birk. Smith' dän. Ausgabe.). Der erste Theil führt die streitbaren Heldinnen vor in ihrer Zierde. Der andere Theil meldt von getrewen und keuschen Heldinnen. Der dritte Theil von standhafftigen. Ein jeglicher Theil hat seinen Appendix. Ich hoffe zu Gott, daß diese meine Gefängniß-Arbeit Euch, meinen hertzlieben Kinder, zu Händen kommen werde. Hiernach gedenck ich, so Gott will, die anderen zu sammeln, nemlich: verständige, gelehrte, gottesfürchtige und die übrigen tugendsamen; werde sie nach ihren Verhältnissen einkleiden und ausstaffiren.
Ueber Jonatha, so mich itzt bedienet, will ich etzliches nach ihrem eigenen Bericht vermelden. Uebergehen will ich die Weitläufftigkeit, wie sie von ihrer Mutter weg kam; die Sache ist, daß sie gegen den Willen ihrer Mutter sich mit einen dänischen Kauffmann, mit Namen Jens Pedersen Holme, verheyrathete. Aber ihr Leben und Treiben ist (nach ihrer eigenen Aussage) so sonderlich, daß es werth seyn mag, etzliches darvon zu verzeichnen. Nachdem sie mit einander verheyrathet worden waren (sagt sie), verdroß es sie, und kam ihr alleweile in den Sinn, daß sie ihre Mutter erzürnt und daß sie sehr übel gethan habe. Die Mutter hatte ihr auch ein hartes Schreiben geschickt, worüber sie sich sehr betrübte; und verhielt sie sich gar widerspenstig gegen den Mann und in mancher Weise wie ein verzogenes un-verständiges Kindt, zuweylen auch wie eine, so ihre Vernunfft verloren hat und verzweiffelt ist. Es scheint auch, daß der Mann mit ihr umbging, wie sie gesinnet war, denn er ließ sie in Obacht nehmen als ein Kindt und handelte auch so mit ihr. Sie sagte ihm einmal, daß sie gesonnen sey, sich im Pæffling See zu ertränken, ein ander Mal, daß sie ihn todt schlagen wollte. Der Mann fürchtete keines von beiden Theilen; doch ließ er sie beobachten, wenn sie aus ging, wohin sie ihren Weg nehme. Und hatte sie sich einmal fest fürgesetzt, sich im Pæffling See zu ertränken, denn dieser Ort gefiel ihr; war auch unterwegs dahin, wurde aber zurück geholt. Sie schlug auch den Mann einmal in ihrer Weise. Er war eines Tags halb berauscht heim gekommen und hatte sich über ein Bett gelegt, so daß die Beine unten auff dem Fußboden standen. Sie sagt, daß sie ihn damals todt zu schlagen gedachte, nahm einen Stecken und wollte versuchen, ob er schlaffe, sprach laut mit sich selbst und schalt, berührte ihn mit dem Stecken leise an den Schienbeinen. Er that, als ob er schlieffe. Da schlug sie etwas stärcker. Hierauff griff er nach dem Stecken und nahm ihn ihr weg, fragte, was sie im Sinne hätte. Sie antwortete: ›Euch todt zu schlagen.‹ ›Er betrübte sich über meine Tollheit‹ (erzählt sie) ›und warff sich auff seine Knie, betete laut, bat Gott, er möge mich regieren mit seinem guten Geist und mir Verstandt geben.‹ Das artigste ist, daß ihr einmal in den Sinn kam, nicht bey ihrem Mann liegen zu wollen, legte sich auff eine Bank in der Kammer. Er gab ihr lange Zeit gute Worte, aber die richteten nichts aus. Er sagte später: ›Kleidet Euch aus und kommt und leget Euch, sonsten komm ich.‹ Sie achtete dessen nicht, da standt er auff, kleidete sie gantz nackend aus, klatschte sie mit seiner Hand auf ihr Gesitze und warff sie in das Bett. Sie schwur, daß sie etzliche Tage nicht auff ihrem Fundament habe sitzen können; das halff, und sie verfuhr fürderhin mit mehr Vernunfft. So übel sie mit dem Mann zu Frieden war, als sie ihn bey sich hatte, so betrübt war sie, nachdem er von ihr weg nach West-Indien reisete. Er sandte ihr mit denen retour Schiffen allerhand Waare, die sie verkauffen konnte, so daß sie ihren guten Unterhalt hatte. Da begab es sich, daß der Mann in West-Indien stirbt, und einer, so ihr die Zeitung bringt, berichtet, daß er von dem Gouverneur selbigen Orts mit Namen AdÜDer Name ist im Manuscript ausgelassen. Er hieß Jörgen Iversen und war der erste dänische Gouverneur auf St. Thomas. Ihm wurden mancherlei Unordnungen zur Last gelegt, und ward er in Folge dessen seines Postens enthoben. S. 238. AdÜDas von L. Chr. illuminirte Bild Christian's IV. mit dem Vers wird noch in der Sammlung auf dem Schloß Rosenborg zu Copenhagen auf bewahrt. – bey einem Gastmahl sey vergifftet worden, und das, weil er bereit war, heim zu reysen, und der Gouverneur sich fürchtete, daß Holme seine übeln Verhältnisse vermelden würde. Von diesen Bericht ward sie verstört, lieff Nachts im bloßen Hemdt auff die Straße hinaus und zanckte sich mit denen Nacht-Wächtern. Sie ging zum Admiral auff den Holm und verlangte Gericht über den, so nicht zur Stelle war, und beschuldigte ihn, obwohl sie ihm nichts beweisen konnte. So ging es eine Zeit, bis sie endlich etwas zur Ruhe gelangte, und Gott es so fügte, daß sie zu mir kam. Ich verkehre mit ihr wie mit einem gebrechlichen Glas-Gefäß, denn sie hat allerhand Schwachheiten. Offt zweiffelt sie an ihrer Seeligkeit, zählet alle ihre Sünden auff. In Sonderheit beweint sie, ihre Mutter so hoch erzürnet und sich darmit ihren Fluch zugezogen zu haben. Wenn diese Angst über sie kommt, tröste ich sie mit Gottes Wort und das gantz weitläufftig; entnehme der heiligen Schrifft, worauff ein bußfertiger Sünder nach Gottes Gnade sich zu verlassen habe. Bisweylen ist sie schwermüthig über die Auslegung der h. Schrifft, so ihr nicht an allen Stellen überein zu stimmen scheint, sondern sich widerstreitet. Darin berichtige ich sie je nach meinem Verstandt, so daß sie zuweylen Gott inniglich danckt, daß sie zu mir gekommen sey, wo sie Trost und Ruhe finde.
Ein Jahr oder zwey nachdem, daß sie bey mir war, erkundete sie, daß der Gouverneur, den sie in vorbem. Verdacht hatte, nach Copenhagen gekommen sey. Sagte zu mir: ›Ich vernehme, der Schelm ist anhero gekommen. Ich bitte umb meinen Entlaß.‹ Ich fragte sie, warumb. ›Weil‹ (antwortete sie) ›ich ihn ermorden will.‹ Ich konnte mich kaum für lachen halten, sagte doch: ›Jesus bewahre mich! Wenn Ihr diesen Fürsatz habt, so lasse ich Euch nicht hinaus.‹ Und da sie ein Mensch ist, dessen gleichen ich nicht gekannt habe, denn sie konnte mit harten Worten schelten und hatte sittsame Aussprache und Gelassenheit darbey, so wollte ich, das sie mir sagen und zeigen möchte, wie sie es anstellen würde, dem Gouverneur das Leben zu nehmen (sie ist ein kleines Weyb mit zarten Gliedern). Da figurirte sie, als ob ihr Feind auff einem Stuhl säße, und sie hätte ein großes Messer unter ihrem Fürtuch. Wenn er zu ihr sagte: ›Weyb, was wollet Ihr?‹ so wollte sie das Messer in ihn hinein schlagen und rufen: ›Das hastu Schelm verdient.‹ Sie wolle nicht von der Stelle gehen, sondern gern sterben, könnte sie ihm nur das Leben nehmen. Ich sagte: ›Es ist doch so schimpfflich, von Büttels Hand zu sterben.‹ ›O nein!‹ (antwortete sie) ›es ist nicht schimpfflich, vor eine ehrenhaffte That zu sterben;‹ und meinte sie, daß der, so von Büttels Hand sterbe, christlicher von dannen ginge, als mancher, so auff seinem Siechen-Bett sterbe; und es sey nicht Sünde, den todt zu schlagen, der nach Art der Schelmen einen anderen gemordet hätte. Ich fragte sie, ob sie nicht meinte, daß der sündigte, der einen anderen todt schlüge. ›Nein‹ (antwortete sie), ›wenn der es verschuldet hat.‹ Ich sagte: ›Keiner darff sein eigener Richter seyn, weder nach Gottes noch der Menschen Gesetz; und was sagt uns das 5. Geboth Gottes?‹ Sie antwortete mit den vorigen Worten darauff, daß sie gerne sterben wolle, wenn sie nur dem Schelm das Leben nehmen dürfft. ( N. Man muß wissen, daß sie sagte, sie könne wegen meiner nicht, denn ich wolle sie nicht hinaus lassen.) Sie macht Sünde aus dem, so nicht Sünde ist, und das, was Sünde ist, will sie nicht vor Sünde passiren lassen. Sie sagt, es sey Sünde, einen Hund, eine Katze oder einen Vogel todt zu schlagen: die unschuldigen Thiere thäten nichts böses; ja es sey noch größere Sünde, die armen Beester hungern zu lassen. Ich fragte sie einmal, ob es Sünde sey, Fleisch zu essen. ›Nein‹ (antwortete sie), ›nur dem, so das Thier todt geschlagen hat, ist es Sünde.‹ Sie schwur, wenn sie sich durchaus verheyrathen müßte und zwischen einem Schlachter und einem Büttel wählen sollte, so wolle sie lieber den letztern haben. Sie erzählet unterschiedliche Streitigkeiten, die sie mit solchen gehabt hat, so entweder Thiere schlugen oder sie hungern ließen. Eine Geschichte will ich nicht unvermeldt lassen, die gantz artig ist. Sie verkauffte (sagte sie) einst einem Schlachter etzliche Schweine. Als der Schlachter-Geselle denen Schweinen die Füße zusammen binden und sie auff einer Stange fort tragen wollte, da thaten ihr die armen Schweine leid und sagte sie: ›Was, wollet ihr ihnen das Leben nehmen? Nein, das will ich nicht!‹ warff ihm das Geldt wieder hin. Ich fragte sie: ob sie nicht wüßte, daß man Schweine schlachte? und was sie meinte, warumb der Schlachter sie gekaufft habe? ›Ja‹ (antwortete sie), ›das wußte ich wol. Hätte er sie auff ihren Beinen fort gehen lassen, dann hätte ich mir nichts daraus gemacht; aber die armen Beester so zu binden und sie schreien zu hören, das konnte ich nicht leiden.‹ Es würde zu weitläufftig sein, alle ihre extravaganten Grillen zu verzeichnen, so sie von sich selbst erzählt. Aber bey alle diesem ist sie nicht thöricht, und glaube ich wol, daß sie dem trew ist, den sie lieb hat. Mir diente sie sehr gut und mit großer Sorgfältigkeit.
Bemeldter Gouverneur wurde, als er sich auff der Reise von West-Indien zurück befand, von etzlichen gefangenen, so auff dem Schiff waren, todt geschlagen. Das Schiff kam durch ein wunderlichen Zufall mit denen Mördern nach Copenhagen; (wurden wegen ihrer Missethaten zum Tod verurtheilt). Jonatha meinte, daß der Gouverneur einen all zu guten Tod gehabt hätte, daß es Sünde wäre, wenn einer davor das Leben einbüßen sollte. Ich übe mich mit Jonatha in der englischen Sprache. Sie hat etwas von ihrer Mutter-Sprache vergessen, sintemal sie sich viele Jahre nicht darinnen geübet hat; und da sie fleißig die englische Bibel liest und nicht gleich alle Wörter versteht, so unterweise ich sie, indem ich nicht allein aus den vorhergehenden und nachfolgenden Worten den Sinn erkennen kann, sondern auch daraus, daß etzliche Wörter auff französch auslauffen, doch mit einem andern accent. Und kommen wir offt mit einander in Gespräch über die Auslegung der h. Schrifft. Sie gibt sich vor calvinsch aus, ist aber nicht von der Meinung derer Calvinisten. Ich disputire nie mit ihr über ihre Meinung. Sie gehet alleweile zum h. Nacht-Mahl in die Kirche der Königinn. Als sie einmal von dort zu mir zurück kam, sagte sie, sie hätte ein Gespräch über Religion mit einem Weyb gehabt, so ihr grade ins Gesicht gesagt hätte, sie wäre nicht calvinisch. Ich fragte sie, von welcher Religion denn das Weyb glaubte, daß sie sey. Sie antwortete: ›Das mag Gott wissen. Ich bat sie, sie solle sich umb sich selber kümmern‹ (sagte Jonatha), ›ich sey eine Christinn, und dachte ich an Ewer Gnaden Worte (aber ich sagte sie nicht), daß alle die‚ so an Christum glauben und christlich leben, Christen sind, welchen Namen sie ihrem Glauben auch geben mögen.‹
In diesem 1684. Jahr sah ich die Königinn-Wittib von dem Sessel fallen, mit dem zum Königs-Gemach auffgehißt wird. Der Sessel lieff auff denen Rollen zu hastig nieder, so daß sie auff die Nase fiel und sich an den Knien stieß. Im selbigen Jahr nahm ihre Schwachheit täglich zu, aber sie hielt sich stärcker, als wie sie war; ließ sich bei der Taffel sehr geschmückt sehen und zwischen den Mahlzeiten hielt sie sich in ihren Gemächern.
Ich faßte mich in Geduld und dichtete nachfolgendes.
Ein Bericht über Gedächtniß und Muth, Gott zur Ehre auffgezeichnet von der leidenden Christinn in ihres Alters 63., ihres Gefängnisses fast 21. Jahr.
Die hingeschwundne Zeit kann keiner wiederbringen.
Noch dürffen alte Leut nach Jugend-Freuden ringen;
Ein gut
Gedächtniß doch findt die Vergangenheit,
Und Muth dem alten Mann selbst Krafft und Macht verleiht.
Wozu doch soll ich itzt mit dem Gedächtniß spielen
Und meiner Jugend Erd mit seinem Pflug durchwühlen?
Sie lieffert keine Frucht, denn sie liegt öd und brach,
Die Fuhren bleiben aus, dafür kombt Ungemach! –
In reicher Jugendzeit, in schönen Ehrentagen,
Da thät ich gar nicht viel nach diesen Dingen fragen.
Dann nahm das Alter zu, mit ihm das Mißgeschick,
Und trotz des äußern Scheins gab's nicht viel wahres Glück.
Der Ehe Wehestand, der Stand in hohen Ehren
Thun unablässig nur der Feinde Zahl vermehren.
Fort! Ehre, Reichthumb, Rang, entweicht mir aus dem Sinn!
Ihr ließet mich im Stich und seyd auff immer hin.
Ihr brachtet mich hieher, hier bin ich alt geworden:
So können Macht und Neid des Menschen Freude morden!
Gott war es dann allein, der mich hier nicht verließ,
Er linderte mein Kreutz, als mich die Welt verstieß;
Und da Verzweiflung mich schon wollte fast erreichen
Rieff er den Geist des Trosts: er sollt nicht von mir weichen.
Er gab dem Hertzen Krafft und stärckte Sinn und Muth;
Man sah es baar und klar: Gott war mir hertzlich guth.
Was
Muth ausrichten kann, will ich anitzt betrachten.
Ist wer mit Muth geschmückt, der mag sich glücklich achten.
Muth gibt dem dürren Leib die frische Jugend-Krafft,
Erhebt den müden Geist, daß er von neuem schafft.
Ich meine solchen Muth, den die Vernunft regieret.
Und nicht Dummdreistigkeit, so nur zu Frevel führet.
Es kombt weit offter vor, daß manch ein junger Fant
Muthlos zusammensinckt, wenn ihm das Glück entschwandt,
Als daß ein alter Mann, der weiß, wie hier auff Erden
Das Glück sein Spielchen treibt, für Schreck sollt thatlos werden.
Dann faßt er frischen Muth; an solchem Schilde prallt
Der Feinde Bosheit ab, der Uebermacht Gewalt.
Muth giebt der Seele Ruh und macht, daß wir betrachten
All irdschen Tand vor nichts und ihn nicht besser achten
Als eitel Borg und Lehn, das wir nicht länger han,
Als der, so uns es lieh, als Mahner klopffet an.
Der Muth dringt ins Geblüth, und dieses macht die Glieder
Gar feurig, starck und frisch, schafft auch dem Magen wieder
Die Luft zu Speis und Tranck, Verdawung noch darzu,
Erheittert unsern Sinn, gibt uns im Schlaffe Ruh,
Daß böse Träume nicht mit ihren Schreckenbildern
Viel grausamb Scheusal für die bange Seele schildern.
Muth streichet uns auch auff des Kerckers bittres Brod
Gar süßen Honigseim und lindert selbst den Tod.
Wol mir, mein Sinn ist frisch! Gesund seynd meine Glieder,
Und all mein Unglück beugt mich keineswegs darnieder.
Vernunfft, Verstandt und was man die fünf Sinne nennt,
Hat Gott bis heute mir recht gnädiglich vergönnt.
An mir wird offenbar des großen Gottes Güthe,
Drumb stimmet mit mir ein aus fröhlichem Gemüthe
In eitel Lob des Herrn: Du bist es, lieber Gott,
Der mir geholffen hat in Kummer, Angst und Spott.
Allmächtiger, davor will ich dir ewig dancken!
In meinem Glauben laß mich nie und nimmer wancken.
Und nimm mir nicht den Muth, denn ich will fröhlich seyn,
Bis meine Seele geht zum Paradise ein.
Geschrieben 1684 den 28 Februarii, so der 36. Jahres-Tag ist, seit der hochlöbliche König Christian der vierte der Welt gut Nacht sagte, und ich meines Lebens Wolfahrt.
Itzt bin ich im 63. Jahr meines Alters und dieser Gefangenschafft 20. Jahr, 6 Monate und 15 Tage; habe so den dritten Part meiner Lebenszeit in diesem Gefängniß zugebracht. Gott sey gelobt, daß so viel Zeit hin ist; hoffe, daß der übrigen Tage nicht viele seyn werden.
Anno 1685 den 14. Januario ergötzte ich mich, etzliche Reime zu machen, aus welchen die Wahrheit schertzweise gedeutet werden kann, unter dem Tittel:
Ein Hund, Namens Cavaillier, erzählet sein Schicksal.
Die Reime, vermuthe ich, werden Euch, meine hertzlieben Kinder, zu Händen kommen.
Am 20. Feb. starb die königl. Fraw Mutter, Königinn Sophia Amalia. Sie glaubte nicht, daß der Tod so hastig zu ihr kommen würde; aber als der Doctor sie warnete, daß der Tod nicht mehr lange auff sich würde warten lassen, verlangte sie, mit ihrem Sohn zu reden. Aber der Tod wollte nicht auff die Ankunfft Königl. Majt. warten, auff daß die kön. Fraw Mutter ihm ein Wort sagen könnte. Leben hatte sie noch; saß auff einem Sessel, aber sprachlos, und baldt darnach gab sie so sitzend ihren Geist auff.
Nach dem tödtlichen Abgang dieser Königinn war ich viel im Munde des Volcks. Ein Part meinte, daß ich auff freyen Fuß käme. Andere glaubten, daß ich wol aus dem Thurm heraus an einen anderen Ort gebracht würde, aber nicht die Freyheit erlangte.
Jonatha, die etzliche Tage vor dem Tod der Königinn von Ole Thurmwächter erkundet hatte, daß in der Kirche für die Königinn gebetet werde (was aber schon seit 6 Wochen geschah, daß dieses Gebet von der Kantzel verlesen wurde), war ebenso wie Ole Thurmwächter gantz betrübt. Ole, der sich und sie bisher mit den Berichten derer Lacqueien der Königinn getröstet hatte: daß die Königinn zur Taffel ginge, ansonsten wol sey, hätte zuweylen etwas Husten, glaubte nu, daß Gefahr darbey wäre, und der Tod erfolgen könnte, fürchtete, daß ich, wenn die Königinn stürbe, dann vielleicht aus dem Gefängniß heraus kommen möchte. Sie thaten ihr bestes, ihre Trawer zu verbergen, aber es hatte keinen rechten Schick. Sie vergossen manchmal gantz heimlich etzliche kleine Thränen. Ich that so, als ob ich es nicht merkte, und da keiner etwas darüber zu mir sagte, so gab ich auch keinen Anlaß, über die Materie zu sprechen. Ich hatte lange Zeit vorher zu Jonatha (wie früher zu einem der anderen Weyber) gesagt, daß ich nicht auff dem Thurm zu sterben vermeinte. Dessen erinnerte sie sich, sprach darüber. Ich sagte: ›Alles stehet in Gottes Hand. Er weiß am besten, was mir nütze ist vor Leib und Seel; ihm befehle ich mich.‹ Jonatha und Ole lebten so dahin zwischen Hoffnung und Furcht.
Am 15. Martii hielt die regierende Königinn ihre Ostern. Da kam Jonatha aus Ihrer Majts. Kirche gantz vergnügt, erzählte, daß eine fürnehme Persohn ihr gesagt habe, ich dürffe nicht daran dencken, aus dem Gefängniß zu kommen, wenn gleich die Königinn todt sey; das wüßte sie weit besser, und sie schwur darauff; (wie offt ich sie auch über die Persohn fragte, wer sie sey, so wollte sie sie doch nicht nennen). Ich lachte sie aus und sagte: ›Wer die Persohn auch seyn mag, so weiß sie grade so viel darvon als Ihr und ich.‹ Jonatha blieb fest bey ihrer Meinung, daß die Persohn es wol wüßte. ›Was wollet Ihr sagen?‹ (sagte ich) ›selbst der König weiß es noch nicht; wie sollen es denn andre wissen?‹ ›Der König nicht? Der König nicht?‹ (sagte sie gantz sachtmüthig). ›Nein der König nicht!‹ (antwortete ich). ›Er weiß es nicht, bevor Gott es ihm eingibt und so gut wie zu ihm sagt: Nu sollstu die gefangene los lassen!‹ Sie kam etwas mehr zu sich, sagte aber nichts. Und da sie und Ole nichts mehr über mich sprechen hörten, waren sie gantz getrost.
Den 26. Martii war das Leichenbegängniß der königl. Fraw Mutter, und ward ihre Leiche nach Roskild geführt.
Am 21. April supplicirte ich königl. Majt. auff nachfolgende Weise. Ich besaß des hochlöblichsten König Christian des vierten Bildniß in Kupferstich, ziemblich klein und in Oval. Das hatte ich mit Farben illuminiret und dar umb einen geschnitzten Rahmen machen lassen, hatte ihn selber vergüldet. Hinten auff das Stück schrieb ich nachfolgende Worte:
Mein Enckelsohn, so hoch in Ehren!
An Muth und Macht bistu mir gleich;
Thu endlich nun mein Kind erhöhren
Und sey wie ich an Gnade reich!
Dar zu hatte ich Sr. hohen Excellentz Gyldenløwe geschrieben, ihn dienstfertig gebeten, bemeldte Supplicque Sr. Königl. Majt. unterthänigst zu überlieffern, und sich meiner anzunehmen und mir zur Freyheit zu verhelffen. Seine hohe Exc. war zu der Zeit etwas incommodiret von seiner alten Schwachheit, so daß er nicht so baldt mündlich vor mich sprechen konnte; bat einen guten Freund, den Kupfferstich in aller Unterthänigkeit zu übergeben, was am 24. Aprilis geschah.
Von all diesem wußte Jonatha nichts. Peder Jensen Tøtzløff war mein Bothe. Er ist mir ein Trost in meinem Gefängniß gewesen, hat mir unterschiedtliche Dienste erzeigt, so daß ich ihm hoch verpflichtet bin. Und bitte ich Euch, meine hertzlieben Kinder, ihm die mir erwiesenen Dienste auff alle mögliche Weise zu vergelten.
Den 2. Maj kam ich ins Gerede bey dem Gemeinen Mann, daß ich sicherlich aus dem Gefängniß kommen werde; und waren etliche, die fragten den Thurmwächter, ob ich am Abend heraus käme, und wo? so daß es Ole zu grawen anfing, konnte sich nicht so starck halten, wie er gern wollte. Und sagte er zu mir mit betrübter Stimme: ›Mein gutes Fräwlein! Ihr kommet gewiß hinaus. Da sind etzliche, die glauben, Ihr seyd schon draußen.‹ Ich sagte: ›Gott wird es wol machen.‹ ›Ja‹ sagte er, ›wie wird es dann mir ergehen?‹ Ich antwortete: ›Ihr bleibet Thurmwächter, wie Ihr nu seyd.‹ ›Ja‹ (sagte er), ›das wird hüpsch werden;‹ wandte sich, konnte die Thränen nicht halten und ging von dannen. Jonatha vernahm, daß meine Erlösung nahete, wollte ihre Trawer verbergen; sagte: ›Ole ist sehr betrübt, ich aber nicht;‹ (und die Thränen standen ihr in den Augen) ›es wird vor gewiß gesagt, daß der König über-morgen abreisen wird. Kommet Ihr heraus, so geschicht es heute.‹ Ich sagte: ›Das weiß Gott.‹ Jonatha meinte, daß ich doch gewiß Hoffnung hätte. Ich sagte, ich hätte seit dem ersten Tag Hoffnung gehabt, als ich gefangen gesetzt ward, daß Gott sich endlich meiner erbarmen und meine Unschuldt ansehen werde. Ich hätte zu Gott alleweyle umb Geduldigkeit, die Zeit seiner Hülffe zu erwarten, gebetet, und die hat Gott mir auch gnädig verliehen. Ist die Zeit der Hülffe nu gekommen, so will ich Gott umb die Gnade bitten, daß ich seine großen Wohlthaten im rechten Sinn erkenne. Jonatha fragte, ob ich nicht sicher sey, hinaus zu kommen, ehe der König nach Norwegen reisete; man sagte vor gewiß, daß der König sich morgen früh auff die Reise begeben werde. Ich sagte: ›Es gibt keine Gewißheit über zukünfftige Dinge. Da können Umbstände in der Reise des Königs eintreten, und es kann auch kommen, daß meine Freyheit verhindert wird, wenn sie auch zur Stunde vielleicht schon resoluiret ist. Doch weiß ich, daß meine Hoffnung nicht zu Schanden wird. Aber Ihr verberget Euere Trawer nicht, was ich Euch nicht verdencken kann. Ihr habt Ursach, zu trawern, denn Ihr verliert mit meiner Freyheit Eueren jährlichen großen Lohn und Eueren Unterhalt. Die Weyber, so mich bedienten, bekamen jeden Monat 8 Rdlr. Denckt Ihr daran, wie offt ich Euch zuvor gesagt habe, daß Ihr Euer Geldt nicht so liederlich an Eueren Sohn wegwerffen sollt. Ihr könnet nicht wissen, wie es Euch in Euerem Alter ergehen wird. Wenn ich stürbe, so säßet Ihr in Armuth, denn so baldt bekommet Ihr kein Geldt, und Ihr gebet es vor die Lehrzeit des Jungen aus, so Euch nicht den geringsten Danck davor weiß. Sie ließ ihn das Bildschnitzer Handwerck lernen. Ihr habet mir selbst von seinem bösen Gemüth erzählt, und wie schlimm er Euch geantwortet hat, wenn Ihr ihm habt gute Lehren geben wollen. Nu in der letzten Zeit hat er es nicht gewagt, sintemalen ich ihm den Text gelesen und gedroht habe, ich wolle ihm ins Zucht-Haus verhelffen. Ich fürchte, er wird Euch ein böser Sohn werden.‹ Darnach ließ sie ihren Thränen freien Lauff und bat, daß ich, wenn ich hinaus käme, sie nicht verlassen möchte. Das versprach ich, sofern es in meiner Macht stände; denn ich konnte nicht wissen, wie meine Verhältnisse sich gestalten würden.
Dergestalt zögerte es sich einige Tage hin, so daß Jonatha und Ole nicht wußten, was daraus werden sollte.
Am 19. Maj des Morgens gegen 6 Uhr klopffte Ole gantz sachte an meine äußerste Thür. Jonatha ging hin. Ole sagte gantz leise: ›Der König ist schon weg, er reisete umb 4 ab.‹ Ob seine Freude groß war, weiß ich nicht, jeden Falls dauerte sie nicht lange. Jonatha erzählte mir Olis Zeitung. Ich wünschte königl. Majt. Glück auff seine Reise (ich wußte schon, welche Ordre er gegeben hatte), und schien mir aus ihrem Angesicht, daß sie einigermaßen content war. Gegen 8 Uhr kam Tøtzløff zu mir herauff und berichtete, daß Groß- Canzeler Graff Allefeldt dem Schloßvoigt eine königl. Ordre geschickt habe: daß ich meiner Gefangenschafft entlediget werden solle und hinaus gehen könne, wann es mir beliebte (diese Ordre war von Kön. Majt. unterschrieben, den Tag ehe Seine Majt. abreisete). Seine hohe Exc. war mit dem König gereist. Tøtzløff fragte, ob ich wollte, daß er schließen solle, sintemalen ich nu schon frey wäre. Ich antwortete: ›So lange ich innerhalb der Thüren von meinem Gefängniß bleibe, bin ich nicht frey; will auch mit Manier hinaus. Schließt die Thür und höret, was Schwester Tochter, Fräwlein Anna Catharina Lindenow, sagt, ob Seine hohe Exc. keinen Bothen zu ihr geschickt hat, (wie er versprochen), ehe er fort reisete. Als Tøtzløff weg war, sagte ich zu Jonatha: ›Nu in Jesu Namen, heut Abend komm ich hinaus! Nehmet Euer Zeug zusammen und schließet es ein, desgleichen will ich mit meinem thun; es soll hier bleiben, bis ich es kann abholen lassen.‹ Sie war etwas verblüfft, aber nicht betrübt; danckte Gott mit mir, und als zu Mittag auff geschlossen ward, und ich speisete, lachte sie über Ole, der sehr betrübt war. Ich sagte ihr, daß Ole wol seuffzen könnte, denn nu fiele ein fettes Stück Speck von seinem Kohl.
Tøtzløff brachte mir Antwort von Schwester Tochter, daß Seine hohe Exc. ihr habe sagen lassen, es stände ihr frey, mich aus dem Thurm zu geleitten, wenn sie wolle; ward so verabschiedet, daß sie selbigen Tags Abends spät herauff komme.
Der Schloßv. hatte große Hast, meiner los zu werden, sandte den Thurmwächter gegen Abend zu mir und ließ fragen, ob ich nicht hinaus wolle. Ich ließ antworten, es sey noch zu hell; (vielleicht waren etliche curieuse da, so mich zu sehen Lust hatten.)
Ich ließ durch einen guten Freund bey Ihrer Majt. der Königinn erkunden, ob ich nicht die Gunst haben dürffte, mich vor Ihrer Majt. Füßen zu beugen (ich konnte in das Gemach der Königinn durch den Geheimbgang kommen, so daß keiner mich sehen würde). Ihre Majt. ließ antworten, daß sie nicht mit mir sprechen dürffe.
Gegen 10 Uhr Abends machte der Schloßv. die Thür vor Schwester Tochter auff (in zwey Jahren hatte ich ihn nicht gesehen). Sein Compliment war: ›Nu, sköllen wii uns nu scheden?‹ Ich antwortete: ›Ja, nu is de Tiid gekaamen.‹ Da gab er mir die Hand und sagte: › Ade!‹ Ich antwortete mit dem selbigen Wort und Schwester Tochter lachte hertzlich.
Bald nachdem der Schloßv. weg gegangen war, gingen ich und Schwester Tochter aus dem Thurm. Ihre Majt. die Königinn vermeinte mich zu sehen, als ich heraus ging; war auff einen Balcon getreten. Aber es war ziemblich dunckel, dazu hatte ich einen schwartzen Flor vor dem Angesicht. Der Schloß-Platz bis hinunter zur Brücke und weiter hinaus war voll von Volck, so daß wir kaum uns bis zur Carete durch drängen konnten.
Die Zeit meiner Gefangenschafft währte 21 Jahre, 9 Monate und 11 Tage.
König Friderich der 3. ließ mich An. 1663 den 8 Aug. gefangen setzen, König Christian der 5. gab mir An. 1685 am 18 Maj die Freyheit. Gott segne meinen allergnädigsten Erb-König mit allen königlichen Glückseeligkeiten, gönne Sr. kön. Majt. Gesundheit und lege viele Jahre zu seinem Alter !
Darmit endigte meine Gefangenschafft.
Am 19. Maj, nach 10 Uhr Abends, ging ich aus meinem Gefängniß. Gott sey Lob, Preis und Ehre; er gewähre mir die Gnade, daß ich seine göttlichen Wolthaten erkennen möge und nie vergesse, sie mit Danck zu vermelden.
Hertzliebe Kinder ! Dieses ist der größte Theil des auffschreibens-werthen, so sich innerhalb der Thüren meines Gefängnisses mit mir zugetragen hat. Ich lebe itzt in der Hofnung, es möge Gott und Königl. Majt. gefallen, daß ich Euch selbst diesen Bericht kann sehen lassen; wo zu Gott seine Gnade gebe!
Geschrieben auff Husum AdÜD. i. im Amt Copenhagen auf Seeland. den 2. Junii, woselbst ich Sr. königl. Majts. Rückkunfft von Norwegen erwarte.

Anno 1683, Neu-Jahrs-Tag. An mich selbst.
Man sagt, das Glück sey doch ein wunderschönes Stücke, Und es verlangt, daß selbst die Macht sich vor ihm bücke. Doch sie ist selber blindt, ja manchmal fällt sie umb, Steht selten wieder auff, der Himmel weiß warumb. Sie wandert kreutz und quer mit guter Laune heute, Und könnt man ihr nur traun, so gäb es gute Beute. Doch ist sie wie das Glück, veränderlich im Flug, Und beyde, Wandersmann, sind eitel Lug und Trug. Das erste bricht gar leicht, die andere muß ringen, Und braucht man alle zwey zu Fallen und zu Schlingen. Du hast das Glück erfaßt und magst frohlocken nun, Vielleicht kommt morgen schon die kleine Sylbe Un. Dann sinkt dein Muth hinab, die Sylbe macht dich schlimme, Wärstu auch Goliath und noch einmal so grimme; Und du, der du gering, von Sorgen schon bist grau, Weißt nicht, ob sie auf's Jahr nicht kommet in dein Gau. Sie tummelt sich flux umb, Kopff über und Kopff unter Und wieder dann hinauff und macht es immer bunter. All das, so irdisch ist, es kommet und es geht, Drum halt ich mich an dem, was ewiglich besteht.
Den 14. Martii 1683 dichtete ich nachfolgendes:
Recht artig ist der Spruch, den ich zuweylen finde: Ein Freund sey viel mehr werth, als geldt-gefüllte Spinde. Doch fragen möcht ich wol: wo ist auff dieser Welt Ein Freund so tugendsamb, daß er gantz ohn Entgelt Dem andern hilfft aus Noth, aus Sorge, Angst und Kräncken, Ohn auch zugleich darbey recht brav an sich zu dencken? Neu ist doch so was nicht, denn Eigennützigkeit, Der folgte jedes Kind der Welt seit Olims Zeit. Die alten hörten schon die alten es beklagen, Und diese hörten von noch älteren es sagen: Bedrängte bleiben stets verlassen auff der Banck, Wenn nichts zu holen ist als Gottes Lohn und Danck.
Sieh, zum Bethesde-Fluß, da kam vor alten Zeiten Ein lahmer Mann herbey und bat bey allen Leuten Umb Hülff und Trost. Doch was? Sein Wort vergebens war Bey all den Tausenden. Ein jeder, Mitleyds baar, Hatt für ihn keine Hand, zum Wasser ihn zu führen, Das, wie's geschrieben steht, der Engel sollt berühren. Fast hätt er ausgehaucht den letzten Athem-Zug, Weil keiner nach dem Mann, dem pfenniglosen, frug. Wenn dann der Krämer nicht, der pflegt ohn Geldt zu handeln, Ihm mild gebothen hätt, zu stehen und zu wandeln.
Ihr Kinder in der Noth, seyd froh, verzaget nicht; Der Krämer ist noch da, und wie zuvor geschicht, Was er in Gnaden will. Er thut die Armen laben, Und Hülffe ist bey ihm ohn all Entgelt zu haben. Er reicht, kombt deine Zeit, dir seine Helffers-Hand Und kann erlösen dich aus Hafft und Eisenband.
Anno 1684, am ersten Tag. An Peder Jensen Tøtzløff.
Willkommen Neu-Jahrs Tag, wiewol dich Brahe reihet Als Eins der bösen Zahl, so uns das Jahr verleihet, Und meynet: was man auch mit dir zuerst beginn, Nicht blühn und grünen kann und nie Erfolg gewinn. Nu frag ich billig dies: wenn man vom bösen ließe Und gutes itzt zu thun, sich heut zuerst entschließe: Ob das nicht glücken wird? Wie sollt ein Vorsatz nicht Gut ausgehn, wenn auch heut zuerst darnach geschicht:? O Brahe, ich glaub fest: wenn wir was rechts beginnen, Heut oder wann es sey, und Gottes Gunst gewinnen, So fällt es glücklich aus und ist uns nur zu Nutz, Empfehlen wir es recht in des Erlösers Schutz.
Beginn mit Jesu Christ heut wie zu allen Tagen, Bet, daß dein Anschlag mög Gott Zebaoth behagen, So wirstu glücklich seynd, und keine Macht der Welt Kann hindern deinen Plan, wenn es nicht Gott gefällt! Mög dir ein holdes Glück des Segens reichlich spenden; Und der Herr Jesus Christ beschütz mit Gnaden-Händen Dich alle Tag. Das wünsch ich dir und bau in Ruh Auff unsern lieben Gott; hoff, er sagt ja dar zu.