
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Das Mittagessen war eingenommen, man hatte sich vom Tisch erhoben. Karl wollte das Zimmer verlassen, da rief ihn der Vater zurück.
»Ich habe mich davon überzeugt, daß du dein Abiturientenexamen im Frühling bestehen dürftest. Ich habe auch gehört, daß Peter im letzten halben Jahr ein fleißiger Schüler geworden ist und daß auch er versetzt werden wird. So will ich euch beiden eine besondere Freude machen. Wir fahren am Sonnabend nach Berlin zur Autoausstellung und kommen am Sonntag spät abends wieder zurück. Ich weiß, daß ihr beide viel Freude daran haben werdet. Ihr könnt mir helfen, einen neuen Wagen auszuwählen.«
Peter stieß einen Freudenschrei aus, während Karl stürmisch die Hand des Vaters ergriff und drückte.
»Hast du geahnt, was ich mir seit drei Monaten wünsche, Vater?«
»Geahnt nicht, aber immerfort gehört. Oft genug hast du davon erzählt, daß der Besuch einer Autoausstellung für dich das denkbar Schönste sei.«
»Wir kaufen eine fabelhafte Limousine. Ein schönes Hellgrau ist für weite Fahrten das Praktischste.«
»Unsinn«, rief Karl, »der neue Wagen muß dunkel sein. – Dunkelblau wirkt immer elegant!«
»Einer unserer Wagen war weiß«, ertönte da Mabels Stimme.
Pucki ging sofort zu dem Mädchen und legte ihm den Arm um die Schulter. Sie merkte, daß Mabel schon wieder mit den aufsteigenden Tränen kämpfte. Jedesmal, wenn die kleine Waise an irgend etwas erinnert wurde, das den Eltern besonders lieb gewesen war, brachen wieder Tränen durch; die Zeit hatte hier noch viel zu lindern.
»Weiß ist furchtbar unpraktisch«, rief Peter. »Vater, wann fahren wir?«
»Am Sonnabendnachmittag.«
»Freut euch nur nicht zu sehr«, warf Rudolf ein. »Ich müßte eigentlich mitgenommen werden, denn ich verstehe von Autos mehr als der Peter. Aber wahrscheinlich wird gar nichts aus der Fahrt. – Wahrscheinlich wird Sonnabend wieder ein Patient eingeliefert, dann ist der schöne Plan wieder zum Teufel. Ihr braucht euch noch nicht zu freuen, es klappt nicht!«
»Du weißt sehr genau, Rudolf«, sagte der Vater lächelnd, »aus welchem Grunde du daheim bleiben mußt.«
»Ich habe ja auch gar nicht gesagt, daß ich mitkommen möchte.«
»Weil du genau weißt, daß Jungen, die ein so schlechtes Zeugnis heimbrachten wie du, kein Anrecht auf eine besondere Freude haben.«
»Es gibt noch viele Autoausstellungen, und vor mir liegt ein langes Leben. Wenn ich mir später einmal einen eigenen Wagen kaufe – –«
»Halte endlich den Mund«, rief Peter, »sei nicht immer so frech! Vater, wenn aber wirklich am Sonnabend ein Patient eingeliefert wird?«
»Ich habe für Vertretung gesorgt.«
»Pah –« rief Rudolf und schnippte mit dem Finger, »auf einmal ist es ein so schwieriger Fall, daß Vaters Vertretung versagt. Ich habe so eine Ahnung, daß aus der Fahrt zur Autoausstellung nichts wird. Darum ärgere ich mich erst gar nicht, daß ich hierbleiben muß. Ich habe für den Sonntag schon allerlei vor!«
»Tante Pucki, werden sie doch einen weißen Wagen kaufen, so einen wie Eberhard hatte?« fragte Mabel wieder.
»Das wollen wir getrost Onkel Claus überlassen, kleine Mabel. Komm jetzt mit mir, ich gehe hinunter in den Garten, um Blumen für die Klinik zu pflücken; dabei sollt ihr mir helfen.«
Aber bevor Mabel das Zimmer verließ, wandte sie sich nochmals an Doktor Gregor. »Kaufe doch einen weißen Wagen, Onkel, dann denke ich, es ist der Wagen von Eberhard und Mary.«
Claus strich dem kleinen Mädchen zärtlich über das Haar. »Einen weißen Wagen werde ich bestimmt nicht kaufen«, dachte er dabei, »weil er mich zu stark an das schwere Unglück erinnern müßte, dem Bruder und Schwägerin zum Opfer gefallen sind.«
Liebevoll sagte er laut:
»Wir werden mal sehen, ob wir einen hübschen hellen Wagen finden. Er wird dir schon gefallen.«
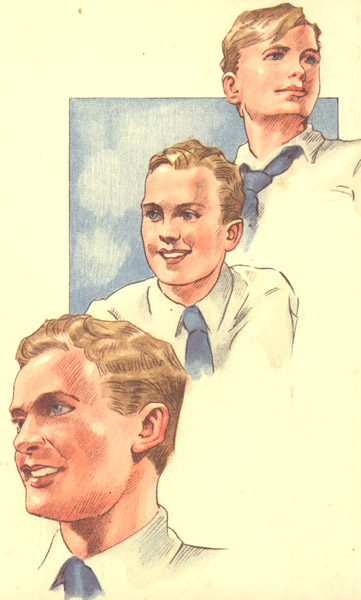
Als die drei Brüder dann allein waren, brach bei Karl und Peter die Freude erst richtig durch. Rudolf aber erhielt von Peter einen kräftigen Rippenstoß, als er wiederum meinte, daß die Berliner Reise gar nicht zustandekommen würde.
»Ich habe so eine Ahnung! Bei uns ist es ja immer so! Der Vater fährt nicht, wenn ein Kranker nach ihm schreit!«
»Du bist ja nur neidisch«, meinte Peter.
»Ich möchte dich mal in der Autohalle sehen«, gab Rudolf zurück, »du weißt ja kaum, was bei dem Auto vorn oder hinten ist. Aber ich, ich kenne jeden Wagen schon von weitem. Wenn ich dir etwas vom Zylinder erzähle, denkst du, ich meine Vaters Zylinderhut.«
»Dussel!«
»Du bist der Dussel! Du verstehst von Autos überhaupt nichts! Na, du wirst dich gut blamieren! – Aber – es kommt ja gar nicht zu der Fahrt!«
»Mach daß du 'rauskommst, oder ich schmeiße dich hinaus!«
»Ich gehe ganz von alleine!« Im Hinausgehen wandte sich Rudolf an Karl: »Ich werde am Sonntag wahrscheinlich die hübsche Marion treffen. Soll ich sie grüßen?«
Eine feine Röte stieg in das Gesicht des Primaners. Die blonde Marion war seine Schwärmerei. Karl hatte bisher nicht geahnt, daß der jüngste Bruder etwas von seiner heimlichen Liebe wußte.
»Ich werde sie von dir grüßen. – Wahrscheinlich werde ich mit ihr in eine Konditorei gehen.«
»Sie wird sich hüten, mit einem fünfzehnjährigen Bengel loszugehen«, rief Peter, »sie sieht dich noch nicht für voll an. Und nun mach, daß du 'rauskommst, ich habe noch zu arbeiten.«
»Arbeiten – arbeiten«, höhnte Rudolf, »natürlich, du mußt dich ja noch in ein recht gutes Licht setzen. Aber von Autos verstehst du trotzdem nichts!«
Die zurückbleibenden Brüder malten sich die Fahrt nach Berlin in den herrlichsten Farben aus. Schon daß sie mit dem Vater so lange ungestört zusammen sein konnten, galt ihnen als besondere Freude. Wenn der Vater einmal seiner schweren Pflichten enthoben war, konnte er so froh, so lustig sein, daß man glauben mochte, er sei selbst noch ein Student, der gerne einen übermütigen Streich macht. Im Berufe freilich war er ernst und gewissenhaft.
Schön war gewiß die Besichtigung der Ausstellung! Was war das für eine besondere Freude! Karl trug schon seit Jahren den Wunsch, einmal eine solche Ausstellung anzusehen. Schließlich aber saßen Karl und Peter wieder über ihren Schulaufgaben, und der Besuch der Auto-Ausstellung trat in den Hintergrund.
Es war gegen sechs Uhr nachmittags, als Karl seinen Bruder Peter aufforderte, einen Spaziergang mit ihm zu machen, um ungestört über die bevorstehende Reise nach Berlin reden zu können. Sie durchquerten den Garten und wollten durch die kleine Hinterpforte den Feldweg erreichen – da blieb Peter stehen.
»Hörst du was?«
Auch Karl hielt den Schritt an. Dort drüben stand die »Weinlaube«. Sie war zwar dick mit Efeu berankt, trotzdem hatten die Knaben dieses Plätzchen die »Weinlaube« getauft, weil einmal die Mutter darin gesessen und bittere Tränen vergossen hatte. Damals bangte sie um das Leben ihres Vaters. Ganz heimlich hatten sich die drei Knaben herangeschlichen und die Weinende belauscht. Seit jener Zeit konnten sie diese Laube nicht mehr leiden und mieden sie.
»Potzblitz, dort weint schon wieder jemand«, flüsterte Peter.
Wirklich vernahmen die beiden leises Weinen.
»Du – das ist doch Mabel?«
»Sie weint so oft«, sagte Karl. »Wollen wir sie mitnehmen zum Spazierengehen?«
Die Brüder horchten auf. Da hörten sie Mabels und Regines Stimme:
»Eberhard hat uns immer umarmt, der Onkel tut das gar nicht. Heute hat er Karl und Peter umarmt.«
»Aber Tante Pucki hat uns doch umarmt, Mabel.«
»Ja – aber sie umarmt ihre Kinder öfter.«
»Weine doch nicht so sehr, Mabel. Es ist doch hier alles hübsch.«
»Ich habe oft Sehnsucht nach Eberhard und Mary. Eberhard war immer so lieb zu uns.«
»Onkel Claus ist auch lieb zu uns – –«
»Ja, ja«, rief Mabel leidenschaftlich, »aber er umarmt seine Kinder so oft und uns nicht.«
Regungslos standen Karl und Peter da. Sie erinnerten sich sehr wohl daran, daß der Vater gerade heute, als er ihnen die Freude der Berliner Reise mitteilte, seine Arme um die Schultern seiner Söhne gelegt hatte. Das hatte Mabel gesehen, und sie litt schwer darunter. Wie weh mußte es noch in diesem Kinderherzen sein, daß eine einzige Handlung solche bitteren Tränen hervorpressen konnte. War der Vater nicht immer liebevoll und zärtlich zu den beiden Mädchen? Spielte er nicht sogar mit ihnen, sobald er irgendwie freie Zeit hatte? Hatte er sich nicht am vorigen Sonntag sogar mit den Puppenkindern beschäftigt?
»Jetzt fährt er mit ihnen sogar zur Autoausstellung«, klang wieder Mabels Stimme.
»Weil die beiden Jungens groß sind.«
»Ach, es ist schrecklich!« Dann wieder wildes Weinen, das besonders Karl tief ins Herz schnitt. Er erinnerte sich des Verses, den ihm der Vater vor wenigen Tagen gesagt hatte. Aber wie sollte er hier helfen? Ein Lächeln könne Schmerzen lindern, ein Wort die Sorgen fortnehmen? – Was sollte er in diesem Augenblick tun, um die Tränen Mabels zu trocknen? Ein freundliches Wort würde hier nicht viel nützen.
»Wollen wir lieber mit den Mädchen spielen und nicht spazierengehen«, flüsterte Peter. »Mache du wieder die Lehrerin, darüber haben sie doch so sehr gelacht.«
»Wir wollen ein Stück fortgehen, dann wollen wir sie rufen, so, als wenn wir sie suchten. Dann können wir mit ihnen spielen.«
»Ich sage es nachher der Mutti, daß sie mit ihnen sehr lieb sein soll.«
Nach wenigen Augenblicken ertönte lautes Rufen aus Karls Munde: »Mabel! – Regine! – – Wo steckt ihr? Wollen wir nicht zusammen spielen? Ich weiß was Feines!«
Die beiden Mädchen hörten die Stimmen. »Komm«, sagte Regine hastig.
Mabel hatte anfangs wenig Lust, dann aber trocknete sie sich die Augen und folgte der Schwester nach.
Wieder wallte heißes Mitleid in Karl auf, als er das verweinte Gesicht der Base sah. So fragte er in besonders herzlichem Tone, ob sie wieder Schule spielen oder die Puppenstuben herbeiholen wollten.
»Ich kann euch auch eine Geschichte vorlesen, wenn ihr wollt. Ich habe ein feines Märchenbuch.«
»O ja – lies uns etwas vor!«
»Wir gehen dort hinüber auf den Gartenplatz, ich hole rasch das Buch und lese euch was Lustiges vor.« Schon eilte Karl ins Haus. Er mußte ja erst nach einem Buche suchen. Es war rasch gefunden, und bald saßen die vier beisammen. Peter war es zwar ein wenig langweilig, denn die Märchen aus Tausendundeiner Nacht kannte er längst. Besonders jenes von »Aladin und der Wunderlampe« war von ihm schon mehr als ein dutzendmal gelesen worden. Aber sein Mitleid hielt ihn zurück. Er hatte sogar den einen Arm zärtlich um Mabel gelegt und zog sie mehr und mehr an sich. Das würde ihr gefallen, dachte er. Sie litt ja darunter, daß man nicht zärtlich genug zu ihr war.
Er ging sogar noch weiter. In leisem Flüstern klang es an Mabels Ohr: »Du bist ein reizendes Mädel, ich mag dich sehr gerne! Ich finde, du bist hübscher als alle anderen Mädchen, die ich kenne.«
Da machte sich Mabel unwillig frei. »Ich will zuhören – sei still!«
Ziemlich heftig ließ er sie los. Als er dann aber ihr verweintes Gesicht sah, legte er aufs neue seine Hand um ihre Schulter.
Am Abend desselben Tages forderte Peter den älteren Bruder auf, mit ihm ein Stück zu gehen.
»Ich habe etwas mit dir zu besprechen, Karl, ich grüble beständig nach, wie ich es anfangen soll.«
Als die Brüder dann unterwegs waren, begann Peter erneut: »Es muß anders werden! Hast du gesehen, wie Mabel jede Bewegung des Vaters und der Mutter genau verfolgt? Als mir der Vater heute nach dem Abendessen die Hand auf die Schulter legte, hat sie wieder ganz große Augen bekommen. – Weißt du, Karl, sie denkt, sie ist hier ein Stiefkind. Karl, das muß anders werden!«
»Wie meinst du das?«
»Es wird wohl schlecht gehen, daß wir dem Vater sagen, er soll die beiden Mädchen bevorzugen. Wir sind doch nun einmal seine rechten Kinder und ihm fest ans Herz gewachsen. – Wenn die Mädchen aber doch weinen –«
»Der Vater ist doch sehr lieb zu den beiden. – Freilich, vielleicht fühlen sie selber innerlich, daß es etwas anderes ist.«
»Das meine ich auch, Karl, so wird es sein. – Weißt du, mir tun die beiden Mädchen sehr leid.«
»Mir auch. – Darum habe ich mir vorgenommen, daß ich mehr denn je auf ihre Wünsche eingehen will.«
»Damit ist es nicht gemacht, Karl. Ihnen fehlt die Liebe des Vaters und der Mutter.«
»Die haben sie doch!«
»Nein, nicht so, wie sie es haben möchten. – Weißt du, wir müssen etwas anstellen, damit uns der Vater einmal vor den beiden Mädchen auszankt. Das würde ihnen wohltun.«
»Aber Peter, das ist doch ein ganz unmöglicher Gedanke. Da mache ich nicht mit!«
»Doch, Karlemann! – Sieh mal, wenn uns der Vater einmal schelten würde und dann zu den Mädchen ginge und ihnen sagte, daß sie lieber und artiger wären als wir, da würde sich Mabels Herz voll Freude füllen.«
»Nein, Peter, das ist Unsinn!«
»Es muß aber etwas geschehen!«
»Ich werde lieber einmal mit Mutti reden und ihr sagen, was wir heute gehört haben. Sie wird schon wissen, wie sie alles einrichtet.«
»Ich finde meinen Plan besser! Ich glaube, Mabel würde sehr vergnügt werden, wenn wir mal tüchtig gerüffelt und sie dagegen gelobt würde. Ich denke mir etwas aus; es braucht ja nichts Schlimmes zu sein.«
Vergeblich versuchte Karl, dem Bruder solche Gedanken auszureden. Peter blieb dabei, daß er ausgescholten werden müsse, um in den Waisen das Gefühl zu erwecken, daß sie den Eltern gleich lieb wären. Karl dagegen suchte sehr bald die Mutter auf. Er erzählte ihr von der weinenden Mabel.
Pucki war sehr niedergedrückt. Sie hatte geglaubt, daß die beiden Mädchen die Liebe der Eltern nicht so stark vermissen würden, weil Eberhard und Mary ja niemals verschwenderisch mit Zärtlichkeiten gewesen waren. Sie schien sich getäuscht zu haben. Hatte sie den Kindern zu wenig an Liebe gegeben? Bevorzugte sie ihre eigenen Kinder? O nein! Sie war stets eine gerechte Mutter, sie war sogar nachsichtiger gegen Mabel und Regine als gegen ihre drei Jungen.
»Was machen wir nur, Mutti?« fragte Karl. »Sieh mal, wir haben am Sonnabend die große Freude der Automobilausstellung. Da werden die beiden Mädchen sehr traurig sein. Aber – Mutti – es hat doch keinen Zweck, daß die beiden Kinder zur Ausstellung fahren. Was soll der Vater mit den beiden Mädels?«
»Hab keine Sorge, Karl, ihr beiden fahrt mit dem Vater nach Berlin, und ich will zusehen, daß ich den Zurückbleibenden auch einen Freudentag bereiten kann.«
»Wenn sie aber meint, daß sie zu wenig Liebe bekommt! Wenn sie sich zurückgesetzt fühlt? – Mutti, es gibt da ein Gedicht, an das muß ich immerfort denken. ›Es kostet dich wenig zu geben: Wort, Lächeln und helfende Hand.‹ – Es ist ja auch nicht schwer, lieb und nett zu sein, wenn ein anderer traurig ist. – Mutti, soll ich dem Vater sagen, daß er die beiden Mädchen statt meiner mitnehmen soll?«
»Nein, Karl, das kommt gar nicht in Frage! Es ist aber sehr nett von dir, daß du sogar auf dieses große Vergnügen verzichten willst, um Mabel und Regine eine Freude zu bereiten.«
»Was machen wir nur, Mutti?«
»Sei weiter nett zu den Kindern, denn hier kann nur die Zeit helfen.«
Mit erleichtertem Herzen verließ Karl die Mutter. Gewiß, wenn es durchaus nicht anders gegangen wäre, hätte er auch auf die Fahrt nach Berlin verzichtet, aber sehr schwer wäre es ihm geworden. – Nun bestand diese Gefahr nicht mehr, er durfte sich wieder auf den Sonnabend freuen.
Am nächsten Morgen, auf dem Schulwege, erzählte Peter seinem Bruder Rudolf von dem Leid der beiden Mädchen. Da er immer ein einfallsreicher Junge gewesen war, schilderte er Mabels Weh so ergreifend, daß der hitzige aber äußerst weichherzige Rudolf Mühe hatte, seine innere Bewegung zu unterdrücken.
»Da haben die beiden nun keinen Vater mehr, der sie liebhat, keine richtige Mutter, wie wir sie haben. Und wenn auch unsere Mutter ihnen viel Liebe schenkt, es ist doch etwas anderes, Rudolf, das fühlt man. Darum muß etwas geschehen, um die Kinder wieder froh zu machen.«
»Ja, ja, es muß etwas geschehen«, sagte Rudolf, »du hast recht! Wir haben unsere Eltern. – Du fährst sogar nach Berlin und die armen Mädchen nicht. – Wenn ich du wäre, ließe ich Regine oder Mabel fahren.«
»Nee«, rief Peter lebhaft, »das ist nicht nötig! Aber man könnte ihnen auf andere Weise etwas Liebes antun. Ich will gern einmal ausgescholten werden, wenn sich Mabel dadurch einbildet, daß sie unseren Eltern genau so lieb ist, wie wir es ihnen sind.«
»Ich werde einen Streich ausdenken, Peter. Es wird nicht schwer sein. Sie sollen nicht wieder weinen.«
Auf dem Heimweg aus der Schule flüsterten die beiden Brüder miteinander, wobei Peter immer wieder zustimmend nickte.
»Ja – so geht es! – Das ist ein Spaß, weiter nichts!«
Am selben Nachmittag schlichen die beiden Knaben fort. Kurz vor dem Marktplatz trennten sie sich. Peter ging allein weiter. Er suchte ein Auto und gab dem Chauffeur den Auftrag, ihn nach Holzau zu fahren. Der Chauffeur fuhr ab, aber schon an der ersten Querstraße pochte Peter an die Scheibe. »Halten Sie mal an, dort steht mein Bruder, dem habe ich etwas zu bestellen.«
Die Tür des Wagens wurde geöffnet und kurz darauf wieder zugeknallt. Rudolfs Stimme ertönte: »So, nun können Sie weiter nach Holzau fahren, aber ziemlich rasch. Mein Bruder hat Eile!«
An der Straßenecke standen lachend Peter und Rudolf. Peter war rasch aus dem Wagen gestiegen und ließ den ahnungslosen Chauffeur allein nach Holzau fahren.
»Was Schlimmes ist das nicht«, sagte Peter, »ein kleiner Streich, der mir höchstens einen Verweis einträgt. Diesen Verweis will ich vor den beiden Mädchen ruhig hinnehmen, damit sie sehen, daß wir auch ausgezankt werden. Dann freuen sie sich.«
Die Brüder kehrten befriedigt heim, denn sie hatten den festen Glauben, daß sie heute etwas Gutes vollbracht hätten.
»Ich weiß noch was«, flüsterte Rudolf dem Bruder zu. »Dort im Garten sitzen die beiden Mädchen und machen schon wieder traurige Gesichter. Wir wollen sie aufheitern.«
Aber weder Mabel noch Regine schienen in der Stimmung zu sein, auf die Späße der Vettern einzugehen. Das schnitt Peter wieder ins Herz.
»Wißt ihr was?« sagte er. »Wir schmeißen jetzt mit kleinen Steinen nach den Fenstern der Klinik.«
»Du bist ja verrückt«, rief Rudolf.
Peter trat ihm auf den Fuß und versetzte ihm heimlich einen Rippenstoß. »Ich will doch nur«, flüsterte er, »daß die Mädchen nein sagen. – Ich werde mich schwer hüten, Steine zu werfen. So dämlich bin ich nicht!«
»Nein, Sterne werfen wir nicht«, sagte Mabel, »in der Klinik liegen Kranke, sie würden noch kränker werden.«
Stürmisch umarmte Peter die Base. Eine solche Antwort hatte er ja nur gewollt. Er war so besessen von dem Gedanken, die Verwaisten aufzuheitern, daß er noch weitere Torheiten vorschlug, bevor sie endlich zu einer gemeinsamen Beschäftigung kamen. – –
Pucki blickte Rudolf erstaunt an, als er sie aufsuchte und ihr mitteilte, daß Peter die Absicht gehabt hätte, Steine in die Fenster der Klinik zu werfen. Einmal glaubte sie so etwas nicht, zum anderen war es ihr gänzlich neu, daß ein Bruder den anderen verklatschte.
»Hast du dir auch überlegt, Rudolf, was du mir soeben sagtest?« fragte sie streng.
»Ja, Mutti, er wollte die Fenster einschmeißen. Da sagte Mabel: ›Das tut man nicht, weil Kranke in dem Hause liegen.‹ Mabel hat sehr vernünftig und klug geredet.«
»Und nun kommst du zu mir und erzählst mir das alles?«
»Ja, Mutti. – Dann hat der Peter die Tür von Vaters Sprechzimmer mit Stricken zubinden wollen.«
»Ihr habt euch wohl sehr gezankt?«
»Ich wollte es dir nur sagen, Mutti«, rief Rudolf. Dann lief er davon, denn der vorwurfsvolle Blick der Mutter war schlecht zu ertragen.
»Du, Peter, ich habe dich verpetzt«, rief er dem Bruder strahlend zu, »jetzt bekommen wir beide beim Abendbrot eine Abreibung!«
»Wir müssen es so einrichten, daß wir die Eltern vorher nicht sehen, denn ihr Tadel muß vor Mabel und Regine erfolgen. – Na, die werden sich freuen, wenn wir 'runtergemacht werden.«
Peter kraute den Kopf. »Dann müssen wir die Sache wieder ins richtige Geleise bringen, denn ich habe gar keine Lust, vor den Eltern als ein gemeiner Kerl zu gelten. Aber erst muß Mabel gelobt werden.«
Währenddessen stand der Chauffeur vor Doktor Gregor und berichtete erzürnt, was ihm heute widerfahren sei.
»Angeführt hat mich Ihr Bengel! Den halben Weg nach Holzau bin ich gefahren, ehe ich bemerkte, daß mein Wagen leer war. Das macht vier Mark und achtzig Pfennige, Herr Doktor. Das Geld muß ich haben.«
Doktor Gregor ließ sich eingehend berichten, dann zahlte er die genannte Summe, gab dem Chauffeur aber die Versicherung, daß sein Junge einen derartigen Streich nicht wieder machen werde.
»Nun ja«, meinte der Chauffeur besänftigt, »Jungen in dem Alter machen gerne dumme Streiche. Mich hat es aber vier Mark und achtzig Pfennige gekostet.«
Claus nahm sich vor, seine beiden Söhne gehörig zu tadeln, außerdem würde er Peter die verauslagte Summe in zwei Monatsraten vom Taschengelde abziehen.
Bis zum Abendessen verbargen sich die Missetäter, dann fanden sie sich, äußerlich völlig ruhig, innerlich aber etwas bedrückt, am Abendtisch ein. Ein Blick in das Gesicht der Eltern genügte, um zu wissen, daß das Strafgericht nicht fern sei.
Aber beim Abendbrot entlud sich das Gewitter nicht. Erst als man damit fertig war, sagte die Mutter:
»Ich habe mit euch zu reden, Peter und Rudolf.«
»Ich auch«, fügte der Vater trocken hinzu.
Mabel und Regine, die das Zimmer verlassen wollten, wurden von Rudolf festgehalten.
»Ich weiß schon, Mutti«, sagte er hastig, »du willst den Peter auszanken, weil er die Fenster einwerfen wollte. – Denke mal, Vater, ohne Mabel wären jetzt die Fenster der Klinik kaputt!«
»Ich möchte das von dir hören, Peter«, sagte Pucki.
»Ach – ich hab' mir nicht viel dabei gedacht. – – Ich wollte ja nur mit kleinen Steinen werfen. Aber Mabel hat mich daran gehindert, und auch Regine meinte – – Na, da habe ich es gelassen, denn die Mädchen waren nicht für diesen dummen Streich.«
»Fenster einwerfen«, sagte der Vater erstaunt, »oder auch nur mit Steinen gegen die Fenster werfen? Was soll denn das, Peter?«
»Es war nur so ein dummer Gedanke von mir, Vater, aber Mabel hat mich daran gehindert.«
»Schämst du dich gar nicht? Und dir soll ich am Sonntag eine Freude machen?«
»Ätsch –« flüsterte Rudolf, »es wird doch nichts aus der Autofahrt!«
»Ich lerne dich heute von einer neuen Seite kennen, Peter. Es will mir gar nicht in den Sinn, daß du derartige dumme Gedanken haben kannst. Willst du mir vielleicht erklären, was dich zu solch einem Unsinn veranlaßt hat?«
Da wußte Peter nichts zu sagen. Ihm war jetzt wirklich nicht mehr ganz behaglich. Er erkannte, daß der ganze Plan, den er sich mit dem Bruder so schön zurechtgelegt hatte, geradezu verrückt zu nennen war. Er verdarb sich damit die große Freude der Berliner Reise und setzte sich obendrein in den Augen der Eltern in ein falsches Licht. Jämmerlich wurde ihm zumute.
»Ich verlange eine Antwort«, zürnte der Vater.
»Mabel hat mich ja daran gehindert«, stieß er erregt hervor.
»Schämt ihr euch nicht vor den kleinen Mädchen? Müssen euch jüngere Kinder belehren? – Das hast du sehr brav gemacht, Mabel, du bist ein sehr liebes Mädchen.« Als Doktor Gregor Mabel, die mit großen Augen neben ihm stand, dabei zärtlich an sich zog, stieß Rudolf einen Freudenschrei aus.
»Was soll das?« wandte sich der Vater ihm zu. »Jetzt kommst du an die Reihe. Was habt ihr heute nachmittag angestellt?«
Da kam auch die Schandtat der vorgetäuschten Fahrt nach Holzau ans Tageslicht.
»Marsch hinaus!« gebot der Vater. »Heute will ich euch nicht mehr sehen, und die vier Mark achtzig Pfennige bezahlst du, Peter. Ich werde sie dir von deinem Taschengeld abziehen. Wenn mir noch einmal derartige Lümmeleien zu Ohren kommen, werdet ihr euren Vater von einer neuen Seite kennenlernen.«
Die beiden Brüder wagten nichts zu erwidern. Wohl war ihr Ziel erreicht, aber glücklich fühlten sie sich nicht dabei. Die Worte des Vaters bedrückten sie schwer.
»Wir haben es doch gut gemeint«, sagte Rudolf draußen zu seinem Bruder. »Es war doch eine gute Absicht, die wir hatten.«
»Aber dumm angefangen«, antwortete Peter.
»Wenn ich nur wüßte, ob die Mädchen noch mehr gelobt werden. Aber horchen mag ich nicht. Ich habe gerade genug auf dem Buckel!«
Wenn sie beide gelauscht hätten, wären sie sehr zufrieden gewesen. Mabel und Regine bekamen viele liebe Worte von Doktor Gregor und Pucki zu hören. Besonders Pucki, die von Karl erfahren hatte, wie sehr die beiden Mädchen noch immer unter dem Verlust der Eltern litten, ließ all ihre Zärtlichkeit über die Kinder hinströmen.
Aber auch Doktor Gregor zog die Kinder an sich. Durch eine leise Andeutung seiner Frau war auch ihm klar geworden, daß die Kinder nach Vaterliebe hungerten.
»Ich möchte ja auch einmal eure Wuschelköpfe an mich drücken«, sagte er liebevoll. »Aber ihr habt immer so schöne Locken, da fürchte ich, sie in Unordnung zu bringen. Bei meinen Jungen macht es nichts, wenn ich sie zause – –«
»Bei mir auch nicht«, sagte Mabel gespannt.
»Na – darf ich? Soll ich dich mal tüchtig zausen?«
»Ach ja«, klang es mit bebender Stimme.
Da fuhr Claus den Kindern in die Haare, drückte die Wuschelköpfe fest an sich, ließ sie wieder los, lachte die Mädchen an und sagte fröhlich: »Nun weiß ich, daß ihr nicht aus Zucker seid. Jetzt kann ich euch auch mal beim Schopf nehmen. So gefällt es mir! Muß ja auch so sein! Ob Junge oder Mädel, ihr seid doch alle meine lieben fünf Kinder! Und heute habt ihr euch sogar großartig benommen. Das hat mich sehr gefreut.«
In Mabels und Regines Augen trat ein wundersamer Glanz. Die aufrichtige Zärtlichkeit des Onkels und seine lieben Worte taten den beiden unsagbar wohl. Und als er noch immer seine Arme um ihre Schultern liegen ließ, als sich beide Mädchen erneut an ihn schmiegen durften, war es ihnen, als fiele eine schwere Last von ihnen ab.
»Deine – – fünf – – Kinder –« flüsterte Mabel.
»Freilich, meine fünf Kinder! Soviel Finger an meiner Hand, soviel Kinder habe ich, und ihr seid der Goldfinger und der kleine Finger!«
Stürmisch griff Mabel nach der gespreizten Hand des Onkels und drückte einen Kuß darauf.
»Fünf Kinder«, wiederholte sie und begann wieder zu weinen.
»Meine fünf lieben, lieben Kinder«, wiederholte Doktor Gregor, nahm Mabel auf die Knie und trocknete ihr die nassen Augen.
Claus und Pucki brachten die beiden Mädchen zu Bett. Es waren aber keine traurigen Kinder, die heute einschliefen, sondern sie waren unendlich froh. Und als Doktor Gregor versicherte, daß er die Wuschelköpfe von nun an öfter einmal zausen werde, da lachten ihn vier Kinderaugen strahlend an.
Währenddessen war Karl zu seinen Brüdern gegangen. »Was ist denn los?« fragte er. »Seid ihr beide irrsinnig geworden?«
Da wurde dem Bruder gebeichtet. »Du hast nicht mitmachen wollen«, meinte Peter, »so haben wir beide es gewagt. – Fenster einschmeißen? Quatsch! Niemals habe ich daran gedacht.«
Als sie dann dem Bruder Karl alles eingehend erzählt hatten, brach dieser in lautes Lachen aus.
»Solch dumme Gedanken! Aber gut gemeint habt ihr es, das sehe ich ein! Ich meine nur, ihr hättet das einfacher haben können. Pfui Teufel, es muß dir doch mächtig in die Nase gestochen haben, als dich der Vater zur Tür hinausschmiß!«
»Er hat eben still geduldet«, rief Rudolf. »Peter ist in meinen Augen ein Ehrenmann!«
»Ja, ein anständiger Kerl ist er ohne Zweifel«, bestätigte Karl. »Was wollt ihr nun machen?«
»Die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben«, sagte Rudolf geknickt.
»Nee«, brauste Peter auf, »jetzt kannst du auch was für uns tun, Karl. Bis jetzt stehst du da wie ein Engel, und wir sind die schlimmen Kerle. Wahrscheinlich wirst du nun mit dem Vater allein zur Autoausstellung fahren! – Aber das sage ich dir, wenn du es nicht fertigbringst, daß ich mitfahre, dann – – dann sollst du mich von einer anderen Seite kennenlernen!«
Wieder lachte Karl. »Ich denke, die Eltern werden bald wieder die alte gute Meinung von euch haben. Nur in einem habt ihr verspielt. Für so dumm, wie ihr euch heute betragen habt, haben sie euch bisher nicht gehalten. Du willst ein Sekundaner sein!«
»Denke nur an deine Marion! Mit der hast du dich auch dumm benommen.«
»Wenn du nicht vernünftig mit mir reden kannst«, sagte Karl ein wenig verletzt, »lege ich bei den Eltern kein gutes Wort für euch ein.«
»Mach keinen Klamauk«, rief Rudolf, »geh lieber 'rüber und sage, wie sich alles verhalten hat, damit wir hier nicht wie die geprügelten Hunde sitzen müssen. Nun zeige, daß du ein Mann bist, Karl!«
Und Karl ging. Er fand die Eltern im Wohnzimmer. Anscheinend hatten sie das eigenartige Betragen der beiden Brüder gerade noch einmal besprochen.
»Wundert euch jetzt einmal über nichts«, begann Karl, »ich will euch erzählen, was heute mit Peter und Rudolf los war.«
Dann begann er zu berichten: Von der weinenden Mabel, von seiner ersten Aussprache mit Peter, von dessen Plan, etwas Dummes anzustellen. Er sprach davon, daß auch Rudolf eingeschaltet worden war und wie die Brüder, beseelt von dem Gedanken, den Basen etwas Liebes zu erweisen, den törichten Plan ausgeführt hätten.
»So ist es gewesen, Vater«, schloß Karl seinen Bericht. »Nun sitzen sie drüben und grämen sich. – Darf ich sie holen?«
Kopfschüttelnd hatte der Vater dem Bericht gelauscht. Ihm war jetzt erheblich leichter ums Herz. Auch aus der Mutter Antlitz war der kummervolle Zug gewichen; ihre Augen lachten wieder wie immer.
»Pucki, was sollen wir nun machen?« fragte Claus.
»Beiden die dummen, aber so lieben Gedanken vergeben.«
»Dann rufe sie, Karl.«
Er eilte aus dem Zimmer und brachte die Missetäter. Ein wenig scheu blickten sie den Vater an, fühlten sich aber beruhigter, als sich ihre Blicke mit denen der Mutter kreuzten. In Puckis blauen Augen lag so viel Liebe, so viel Stolz, daß beide sofort wußten, sie hatten nicht zu schlecht abgeschnitten.
»Karl hat mir alles erzählt«, begann der Vater, »ich bin trotzdem sehr erstaunt über euer Verhalten. Ich hätte nicht geglaubt, daß meine Söhne noch so große Kälber sind und Pläne machen, die jeglicher Überlegung entbehren. Konntet ihr nichts Besseres finden?«
Beide schwiegen. Sie fühlten deutlich, daß der Vater recht hatte, denn sie sahen doch selbst ihre Handlungsweise jetzt in einem anderen Lichte.
»Ihr habt es gut gemeint«, fuhr der Vater fort, »das sei die Entschuldigung. Eure Mutter hat soeben gesagt, es wären dumme aber liebe Gedanken von euch gewesen. In Zukunft nehmt euren Verstand etwas mehr zu Hilfe, sonst nützen euch eure guten Herzen gar nichts. Güte allein ist kein fester Wanderstab.«
»Nimmst du mich trotzdem am Sonnabend mit nach Berlin, Vater?«
»Ja.«
»Na, dann ist ja alles wieder gut!«
Rudolf blieb dabei, daß aus der Autofahrt doch nichts werden würde. Aber der Sonnabend kam heran, und die letzten Reisevorbereitungen waren getroffen.
»Ätsch«, sagte Peter, »wir fahren in einer Stunde!«
Da hieß es plötzlich, daß ein neuer Patient in die Klinik eingeliefert worden sei. Rudolf eilte zu seinem Bruder:
»Ätsch – ihr fahrt nicht!«
Peter war sehr betreten und lief hinüber in die Klinik. Die Nachricht von dem neuen Patienten wurde ihm bestätigt.
»Ich hab's ja gewußt, ich hab's ja gewußt«, schrie Rudolf.
Aber eine halbe Stunde später kam der Vater. »Na, seid ihr fertig? Ich hole den Wagen.«
»Ätsch«, sagte Peter, »wir fahren doch!«
Und als der Vater mit seinen beiden Söhnen abfuhr, hörte der zurückbleibende Rudolf nochmals den Ruf: »Ätsch, nun fahren wir doch!«