
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es waren drei herrliche Sommersonnentage, die Eberhard und Mary mit ihren beiden Kindern noch in Rahnsburg verlebten. Für morgen war die Abreise der Eltern geplant, die noch eine achttägige Fahrt ins Gebirge machen wollten. Auf der Heimfahrt wollten sie ihre Kinder wieder abholen, die Pucki inzwischen behüten sollte.
»Na, Pucki«, sagte Claus, »wird das nicht zu viel für dich werden? Waltraut fährt mit ihrem Manne am Sonnabend in die Ferien und übergibt dir Oskar, Ottilie und Olga. Die drei wilden O's werden dir zu schaffen machen. Nun kommen noch Mabel und Regine dazu. Unsere drei Jungen haben auch noch Ferien, du kannst dich also über Arbeitslosigkeit nicht beklagen.«
»Es wird schon gehen, Claus! Mabel will die beiden Mädchen durchaus nicht mitnehmen; sie meint, sie würden in den acht Tagen unter deiner und meiner Obhut viel Gutes lernen.«
»Das werden sie bestimmt, liebe Pucki!«
»Es ist nicht ganz leicht mit ihnen. Die beiden Mädchen sind schon recht selbständig und leider sehr verwöhnt. Sie passen nicht in unseren Rahmen hinein.«
»Du wirst schon mit ihnen fertig werden. Du hast ja schon oft bewiesen, wie gut du mit Kindern umzugehen verstehst.«
Am späten Nachmittag, als Mary bereits begann, die Sachen für den morgigen Reisetag einzupacken, zogen am Himmel dunkle Wolken auf. Allmählich färbte sich das Firmament graugelb. Besorgt schaute Pucki hinauf.
»Es gibt Hagel.«
»Oh, Hagel ist etwas Schönes«, meinte Mabel.
»Nein, mein Kind, Hagel im Sommer ist gewöhnlich recht schlimm, für viele Menschen sogar etwas recht Trauriges. Wie oft schon hat schwerer Hagelschlag innerhalb weniger Stunden alle Arbeit, alles Hoffen des Landmannes vernichtet. Bedenke nur, wenn alle die schönen Blumen im Garten vom Hagel zerschlagen würden! Wäre das nicht sehr traurig? Die armen Blumen wollten in der Sonne leben und weiterwachsen; plötzlich werden sie vernichtet.«
»Nun, da kauft man neue Blumen. Der Gärtner hat genug!«
»Die Blumen, die im Garten stehen, sind aber tot, sie können nicht mehr zum Leben erweckt werden. – Nun, wir wollen hoffen, daß uns kein Unwetter bevorsteht.«
Mabel ging davon. In einer Laube saß der fünfzehnjährige Rudolf und arbeitete emsig mit einer Laubsäge. Mabel trat zu ihm, schaute längere Zeit schweigend zu und fragte schließlich:
»Was wird das?«
»Wenn du nicht plauderst, sage ich es dir.«
»Also eine Überraschung? – Wahrscheinlich ein Geburtstagsgeschenk.«
»Ja – für Tante Agnes. Es wird ein Lampenschirm, den ich aus sechzehn Teilen zusammensetze. – Schau her, sieben Teile sind bereits fertiggestellt.«
»Kannst du den Lampenschirm nicht kaufen?«
»Natürlich, aber eine Handarbeit macht mehr Freude. Außerdem habe ich nicht so viel Geld. Ich muß ohnehin noch rote Seide kaufen, die wird dann unter das ausgesägte Holz geklebt.«
»Rote Seide? – Ich habe rote Seide.«
»Das wäre fein! Willst du sie mir schenken? Dann brauche ich sie nicht erst zu kaufen. Mein Taschengeld ist ohnehin schon draufgegangen.«
»Warte einen Augenblick, ich hole dir die Seide.«
Wenige Minuten später kam Mabel mit einem roten Seidenkleid zurück. Auch eine Schere hatte sie bei sich. »Wieviel brauchst du?« fragte sie.
»Aber Mabel – du wirst doch dein Seidenkleid nicht zerschneiden!«
»Das macht nichts! Wir kaufen eben ein neues. – Ich habe genug Kleider mitgebracht. Dieses rote Ding kann ich auch nicht leiden!«
Schon hatte sie die Schere angesetzt und schnitt in das Kleid hinein, bevor Rudolf das vorwitzige Mädchen daran hindern konnte.
»Laß mich!« rief Mabel eigenwillig, »ich will es so, und dabei bleibt es!«
»Nein, ich lasse dich nicht schneiden«, rief Rudolf und entwand ihr die Schere. »Deine Eltern haben dir das Kleid gekauft; es ist ein schöner, teurer Stoff, der wird nicht zerschnitten. Außerdem nehme ich die rote Seide bestimmt nicht von dir an!«
»Dann wird es eben zerrissen«, rief Mabel, packte den Seidenstoff mit beiden Händen und riß ihn auseinander. »So, du wirst mich nicht daran hindern! Ich kann das Kleid nicht leiden, ich will es nicht mehr haben, und dabei bleibt es!«
»Du bist ein unartiges Mädchen«, tadelte Rudolf, »du verdientest mächtige Keile! – Was hast du nun davon? Ich nehme die Seide nicht; ich kaufe mir, was ich brauche. Ich würde mich jedesmal ärgern, wenn ich den Lampenschirm ansehe und dann an deine Ungezogenheit denken müßte.«
»Du bist ein alberner Junge«, schalt Mabel. »Wir können schon ein Kleid zerreißen, wir haben immer Geld, um etwas Neues zu kaufen. Wenn ihr kein Geld habt, so ist das traurig, aber wir haben genug. Für Geld kauft man sich alles, was man braucht.«
»Das ist ein großer Unsinn! Für Geld kann man sich nicht alles kaufen!«
»Doch – für Geld bekomme ich alles: Kleider, Konfekt! – Wir können Reisen machen, wir haben zwei Autos, eine schöne Villa, und wenn sonst irgend etwas fehlt, kaufen wir es eben.«
»Und wenn ihr einmal schwer krank werdet?«
»Holen wir die besten Ärzte. Sie machen uns wieder gesund.«
»Mit Geld kann man sich doch nicht alles kaufen«, beharrte Rudolf. »Meinem Schulfreund ist die Mutter gestorben, und der hatte auch viel Geld, aber eine neue Mutter kann er sich nicht kaufen. Da nützt ihm alles Geld nichts.«
Mabel lachte keck auf. »Wahrscheinlich hat sie keine guten Ärzte gehabt, oder man hat diese Mutter nicht rechtzeitig ins Sanatorium geschickt. – Aber du bist eben ein langweiliger Junge! – Warum packst du denn deine Sachen zusammen?«
»Weil es dunkel wird. – Ich glaube, es gibt einen tollen Regen, da gehen wir lieber ins Haus hinein.«
»Hagel gibt es«, erwiderte Mabel altklug, »ich wollte, es prasselte einmal nur so vom Himmel herunter.«
»Damit alles kaputt geht! Was der Hagel zerschlägt, kann man auch nicht wieder kaufen.«
»Wir können es«, rief Mabel und eilte davon. Rudolf folgte ihr verärgert. Ihm mißfiel das kecke Mädchen, das immer nur auf sein Geld pochte. Es war gut, daß Mabel in acht Tagen wieder abreiste. Für diese Base fand er den rechten Ton nicht.
Tatsächlich ging ein heftiges Hagelwetter über Rahnsburg nieder. Pucki stand am Fenster und schaute hinaus in den Garten. Mabel trat zu ihr.
»Werden nun deine Blumen totgeschlagen, Pucki?«
»Hoffentlich nicht – hoffentlich leben die Blumen weiter. Aber sage mal, Kind, willst du mich nicht Tante Pucki nennen?«
»Warum soll ich dich immer Tante nennen? Mir gefällt Pucki viel besser! Ich sage Pucki, und dabei bleibt es!«
»Ich würde mich viel mehr freuen, kleine Mabel, wenn du Tante Pucki zu mir sagen würdest.«
»Ach, du brauchst dich über mich nicht zu freuen! Wir fahren in acht Tagen ab und kommen wahrscheinlich lange nicht wieder. Im nächsten Jahre fahren wir nach Italien, und nach Amerika fahren wir auch wieder einmal.«
Der Himmel klärte sich langsam wieder auf. Wohl hatte der Hagel manche Blume im Garten niedergebrochen, doch war das Wetter nicht schlimm geworden. Für den Landmann hatte es wahrscheinlich keinen großen Schaden angerichtet.
Währenddessen war Eberhard bei seinem Bruder Claus in der Klinik.
»Du mußt mir eine Viertelstunde deiner Zeit schenken, Claus, ich möchte ein ernstes Wort mit dir reden.«
»Schieß los, mein Junge. – Was hast du auf dem Herzen?«
»Am liebsten bliebe ich für ein Weilchen bei dir und ließe die Reise ins Gebirge schießen. Aber Mary will durchaus fort. Sie braucht viel Abwechslung. Wie anders ist eure Ehe als die meine!«
»Willst du damit sagen, Eberhard, daß du nicht glücklich bist?«
»Nein, Claus, das wäre die Unwahrheit! – Ich habe alles im Überfluß: ein wunderbares Heim, eine fröhliche Frau und zwei ungezogene und unerzogene Kinder. Das drückt mich vorläufig noch nicht. Trotzdem herrschen bei uns nicht die Harmonie und der Frieden, die in deinem Hause wohnen. Dabei heißt es doch immer, ein Arzthaushalt sei unruhig; aber deine Pucki gleicht alles wieder aus. Eine prachtvolle Frau!«
»Freilich, Eberhard!«
»Also Claus, – – ich – – Lache mich jetzt einmal tüchtig aus.«
»Warum?«
»Ich mag es dir gar nicht sagen, denn es erscheint mir albern.«
»Nun, so sage mir etwas Albernes! Das muß ich mir ohnehin manchmal anhören.«
»Claus, es könnte doch sein, daß uns der Tod näher ist, als man denkt. Wenn mir das geschähe, stände Mary ganz allein im Leben und würde bestimmt mit unseren beiden Mädchen nicht fertig werden. Ich möchte dich daher heute bitten – verlasse sie nicht.«
»Was soll das, Eberhard? Fühlst du dich krank? Drückt dich etwas? Sage mir die volle Wahrheit!«
»Ich fühle mich vollkommen gesund, Claus, mitunter kommen einem aber doch schwarze Gedanken. Wahrscheinlich sind sie unbegründet. Ich wollte ja nur von dir das Versprechen haben, daß du dich um meine Frau und meine Kinder kümmerst, falls es einmal nötig sein sollte.«
»Eberhard, jetzt bist du nicht aufrichtig!«
»Schau, Claus, ich bin in meinem Berufe allerhand Gefahren ausgesetzt, außerdem steht mir im Herbst wieder eine größere Reise ins Ausland bevor. Ich werde viel fliegen müssen. Es ist also immerhin möglich, daß mir einmal etwas zustößt. Gib mir dein Versprechen und mache dir weiter keine Gedanken.«
»Es ist niemals deine Art gewesen, Eberhard, schwarz in die Zukunft zu sehen.«
»Ganz gewiß nicht, Claus. Aber man hat doch Stunden, in denen einem solche Gedanken kommen.«
»Wenn es dich beruhigt, will ich dir gern das Versprechen geben, daß ich jederzeit deiner Frau und deinen Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehen werde.«
»Und daß du der Vormund meiner Kinder wirst, falls mir etwas zustößt.«
Claus schaute seinen Bruder forschend an. »Fast könnte ich von deinen Worten bedrückt werden.«
»Nein, Claus, dazu liegt wirklich keine Veranlassung vor. Es ist wohl nur eine Stimmung. Im Grunde bin ich voller Lebenslust.«
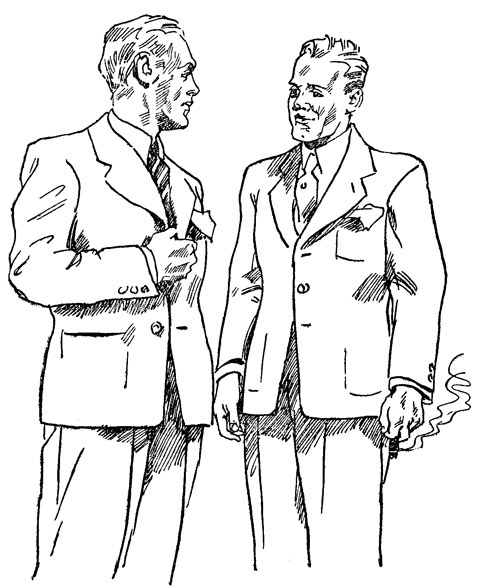
»Möge die traurige Stimmung recht bald wieder verfliegen, Eberhard. Doch wenn es dich beruhigt, gebe ich dir mein Manneswort, daß ich mich voll und ganz für die Deinen einsetzen werde. Ich glaube, ich kann dir dieses Versprechen auch für Pucki geben, die immer das richtige liebevolle Wort findet, wenn es gilt, anderen beizustehen. – Bist du nun zufrieden?«
»Ja, Bruder! Doch nun will ich dich nicht länger aufhalten. Wahrscheinlich rufen deine Patienten nach dir. Willst du nicht eine größere Summe Geldes von uns haben, um anzubauen oder dir das Leben zu erleichtern?«
»Danke, Eberhard, ich brauche nichts! Die beiden Freiplätze haben mir große Freude gemacht, die nehme ich gern an.«
»Sollen wir das Geld irgendwo festlegen?«
Claus lachte. »Ich werde euch schon mahnen, wenn ihr nicht rechtzeitig zahlt. Das Geschenk ist gegeben, das halte ich eisern fest!«
Während des Abends war Claus stiller als sonst. Oft beobachtete er seinen Bruder. Der schien zwar lustig, doch sah Claus eine kleine Falte der Sorge auf seiner Stirn. Was fehlte dem Bruder? Ob er ihn nochmals fragte? Ob er mit Mary sprach?
Im Laufe des Abends richtete Claus es so ein, daß er eine längere Unterhaltung mit seiner Schwägerin hatte. Sehr vorsichtig fragte er sie über Eberhard aus, konnte aber nichts erkunden. Er mußte sich schließlich damit abfinden, daß sein Bruder tatsächlich nur einer trüben Stimmung nachgegeben hatte, als er am Nachmittag die ernsten Worte mit ihm wechselte.
Am anderen Morgen war wieder herrlichster Sonnenschein. Es ging ans Abschiednehmen.
»Wir sind in acht Tagen wieder zurück«, sagte Mary. »Haltet meine beiden Mädchen kurz, falls sie unartig sind. Mabel und Regine, ich erwarte von euch, daß ihr euch in diesem Hause anständig betragt. Ich übertrage Tante Pucki alle Rechte, die eine Mutter hat. Ihr befolgt ihre Wünsche sofort. Das merkt euch!«
»Kommt recht bald wieder«, sagte Mabel. »Ich langweile mich hier schon.«
»Ihr braucht nicht so bald wiederzukommen«, rief Regine, »ich finde es hier ganz nett. Ich möchte am liebsten hierbleiben!«
»Das geht nicht«, lachte Eberhard.
»Doch – wenn ich mich ins Bett lege und krank bin, kann ich hierbleiben. Kranke Leute gehören nicht in die Eisenbahn und auch nicht ins Auto. Dann komme ich zu Onkel Claus in die Klinik, und Pucki pflegt mich. Ich habe Pucki lieb!«
Eberhards Hand lag in der des Bruders. »Dank für dein Versprechen, Claus!«
»Möchtet ihr die Reise nicht aufschieben? Du siehst so blaß aus, du gefällst mir gar nicht.«
Eberhard lachte. »Da würde Mary schön schelten! Nein, wir fahren in fünf Minuten ab.«
Noch einmal ein herzlicher Abschied. Mary setzte sich ans Steuer.
»Werdet ihr wieder über die Landstraße brausen?« rief Mabel.
»Freilich«, lachte die Mutter strahlend, »wir haben eine weite Fahrt vor uns.«
Langsam fuhr der elegante Wagen davon. Claus schaute ihm lange nach, dann nahm er seine Pucki fest in den Arm und strich ihr liebevoll über die Wange.
Fragend schaute sie den Gatten an. »Warum hast du so schwer geseufzt, Claus?«
»Ich weiß selbst nicht, Pucki, warum mir das Herz schwer ist. Vielleicht der Abschied vom Bruder. – Aber jetzt muß ich hinüber in die Klinik. Hoffentlich hast du mit den beiden Mädchen nicht zu viel Mühe. Übermorgen kommen noch drei hinzu.« – –
Wieder und wieder strich Claus mit der Hand über die Stirn. Es war ihm doch sonst möglich, seine Gedanken ganz der Arbeit zuzuwenden. Heute eilten sie immer wieder zu dem abgereisten Bruder. Als der Fernsprecher schrillte, fuhr er erschreckt zusammen.
»Ein Autounglück? Noch vor Holzau? Ich lasse sofort das Krankenauto abfahren und komme selbst mit. Zwei Personen verunglückt?«
Noch wußte er nichts Genaues, und doch war es ihm, als schnüre ihm eine unsichtbare Hand die Kehle zusammen. Kurze Befehle erteilte er einer Krankenschwester. Sollte er noch rasch hinüber zu seiner Frau gehen? Nein, eiligst fort an die Unglücksstelle!
Das Krankenauto folgte dem Wagen des Arztes. Die angegebene Stelle war bald erreicht. Kein Laut kam über die Lippen Doktor Gregors. Sofort erkannte er in der einen Toten seine Schwägerin Mary. Dann schaute er in des Bruders totenblasses Gesicht. Auch hier war nichts mehr zu helfen. Das Auto war völlig zertrümmert. Es war gegen einen Baum geprallt. Es mußte mit größter Geschwindigkeit gefahren sein. Alles deutete darauf hin, daß der Anprall entsetzlich gewesen sein mußte. Ein Arzt aus Holzau war bereits anwesend. Auch Neugierige hatten sich eingestellt. Doktor Gregor traf alle notwendigen Anordnungen; die Toten sollten nach Rahnsburg gebracht werden.
Es war eine traurige Heimfahrt. Wie benommen saß Doktor Gregor in seinem Wagen. Immer wieder mußte er an die gestrige Unterredung mit seinem Bruder denken. Zwei Kinder im Alter von zehn und acht Jahren waren plötzlich ihrer Eltern beraubt und zu Waisen geworden.
»Nimm dich meiner Frau und meiner Kinder an«, so hatte der Bruder gebeten.
Wie sollte er den Kindern die furchtbare Kunde mitteilen? Welchen tiefen Schmerz fügte er seiner Pucki zu, die so viel Liebe für Mary und Eberhard im Herzen trug! Noch ahnte keiner, was die letzten Stunden an Leid gebracht hatten. Wahrscheinlich hallte es in seinem Hause von fröhlichem Lachen wider. – Nun brachte er zwei Tote.
Mit größter Umsicht sorgte Doktor Gregor dafür, daß niemand seiner Angehörigen zugegen war, als man die beiden Verunglückten in die Klinik brachte.
Das war bald geschehen. – Jetzt stand ihm ein schwerer Gang bevor. Vor allen Dingen mußte er Pucki das Entsetzliche mitteilen; sie würde den Kindern die traurige Botschaft viel besser übermitteln können als er. Sie würde die rechten Worte finden und würde zu trösten verstehen.
Pucki stand in der Küche am Herd und hatte rote, heiße Wangen. Der Glanz ihrer Augen erlosch, als sie in das verstörte Antlitz ihres Mannes blickte.
»Claus«, rief sie bestürzt.
»Ich hätte gern ein paar Worte mit dir gesprochen, Pucki. Bitte, komme mit hinüber.«
Schon hatte sie die Küchenschürze abgelegt und nach dem Arm des Gatten gegriffen, der sie hinüber in das kleine Damenzimmer geleitete.
»Claus – was ist geschehen?«
»Ich muß dir eine sehr traurige Nachricht bringen – aber du wirst tapfer sein. – Eberhard und Mary haben einen schweren Autounfall gehabt. Ich komme soeben von der Unglücksstelle.«
»Tot?« hauchte Pucki und schloß die Augen.
»Ja, Pucki – sie sind wahrscheinlich beide sofort tot gewesen; sie haben nicht mehr zu leiden brauchen. Das Auto ist vollkommen zertrümmert.«
Sekundenlang rührte sich Pucki nicht. Sie lehnte den Kopf mit geschlossenen Augen an die Schulter des Gatten, dann lösten sich langsam unter den Wimpern die Tränen.
»Arme unglückliche Kinder.«
Claus legte den Arm um seine Frau; da barg sie das tränenüberströmte Gesicht an seiner Brust. Ruhig ließ er sie weinen; er konnte nichts anderes tun, als ihr blondes Haar streicheln. War ihm doch selbst das Herz wund und weh. Der Bruder mitten aus der Vollkraft des Schaffens gerissen! Durch eigene Unvorsichtigkeit aus dem Leben gegangen. Und die schöne, verwöhnte, reiche Mary, die das Leben mit vollen Zügen genießen wollte, lag nun leblos drüben in seiner Klinik.
»Wie kam alles?« fragte Pucki endlich.
Claus sagte ihr, was er wußte, und daß es im Augenblick nichts weiter zu tun gebe, als die Kinder vorzubereiten.
»Du mußt es tun, Pucki«, sagte Claus, »ich kann es nicht. Du findest die rechten Worte und den rechten Trost.«
»Claus«, klang es bebend, »ich weiß nicht, wie ich ihnen das sagen soll. – Es ist zu furchtbar! – Ach, laß mir noch Zeit!«
»Ja, Pucki – doch im Laufe des heutigen Tages müssen sie es erfahren.«
Das Mittagessen war qualvoll. Pucki brachte kaum einen Bissen herunter. Es war ihr bisher unmöglich gewesen, den ahnungslosen Kindern etwas zu sagen. Nicht einmal ihre eigenen Kinder wußten von dem gräßlichen Unglück.
Karl bestürmte die Mutter nach dem Essen, sie solle sich niederlegen, sie sei krank. – Da war es mit Puckis Fassung vorbei. Aufs neue begann sie bitterlich zu weinen, dabei erfuhr ihr Ältester, was sich ereignet hatte.
Er sagte es erschüttert den Brüdern. Rudolf drückte das Gesicht in beide Hände. »Mabel hat gesagt«, begann er schluchzend, »sie kann sich alles kaufen. Die Mutter meines Schulfreundes wäre nur gestorben, weil sie keinen tüchtigen Arzt gehabt hätte. Nun hat sie trotz ihres Geldes keinen Vater – und keine Mutter!«
Der fünfzehnjährige Knabe war so tief betrübt, daß ihn die Brüder trösten mußten. Immer aufs neue wiederholte er, von wildem Weh erfaßt, die Worte: »Was nützt nun das viele Geld? – Sie hat keinen Vater, keine Mutter mehr!«
Gegen drei Uhr stürmten Mabel und Regine zu Pucki ins Zimmer. Sie fragten, ob sie nicht mit dem Chauffeur eine Ausfahrt machen dürften.
»Jetzt muß es gesagt werden!« dachte Pucki und nahm in jeden Arm eines der Kinder. Sie wollte ihnen alles sagen und fand doch die rechten Worte nicht.
»Dürfen wir fahren, Pucki? Ich möchte gern! Aber wir sollen dir ja gehorchen. – Sage doch, daß wir ausfahren dürfen!«
»Tante Pucki hat etwas sehr Trauriges erlebt. Eure Tante Pucki muß immerfort weinen«, begann sie, und wieder wurden ihre Augen naß.
»Was hast du erlebt?«
»Eure Mutti ist krank geworden – auch euer Vater –«
»Da rufen sie einen Arzt und werden wieder gesund. Mary holt oft den Arzt.«
Pucki verkrampfte die Hände ineinander. Wie sollte sie den Kindern alles sagen?
»Eure Mutter ist aber sehr krank –«
»Heute früh war sie ja noch gesund«, rief Regine, »sie fährt ins Gebirge, da wird sie nicht krank! Sie wird nur krank, wenn sie sich langweilt.«
Immer fester drückte Pucki die beiden Mädchen an sich. Sie sprach davon, daß sie beide sehr liebhabe und wünsche, sie möchten noch ein wenig bei ihr bleiben. Hier gäbe es auch manches Schöne zu sehen. Sie wolle fleißig mit ihnen spielen. Pucki sagte das alles so heraus, wie es ihr gerade einfiel. Dann kam sie wieder auf die Krankheit der Eltern zu sprechen. Immer schwerer fiel ihr das Reden. Sie berichtete schließlich, daß man schon einen Arzt gerufen hätte, da die Eltern mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren wären.
Jetzt erst horchte Mabel auf. Ein gespannter Ausdruck kam in ihr Gesicht. »Was ist geschehen, Pucki?«
»Die Eltern sind bei dem Unfall schwer verletzt worden.«
»Ich will hin«, rief Mabel aufschreiend. »Wo sind Eberhard und Mary? Ich will sie sehen!«
Wieder suchte Pucki nach Worten, fand sie aber nicht. Mabel wurde plötzlich von wilder Angst ergriffen, gellend schrie sie die Frage heraus:
»Sind sie tot?«
Es war Pucki unmöglich zu antworten. Doch dieses Schweigen gab dem reifen Kinde die Gewißheit, daß ihre Vermutung richtig sei. Sie faßte nach Puckis Arm:
»Tot – – tot – – Mary ist tot? – Eberhard ist auch tot?«
Regine konnte gar nichts sagen. Sie drückte sich verängstigt in Puckis Arme, schließlich weinte auch sie. Sie weinte so heftig, daß der kleine Körper zitterte.
Nun war es heraus, und nun strömte aus Puckis Herzen all ihre große Mutterliebe. Sie wußte selbst nicht, was sie sagte, aber sie fühlte, daß ihr das heiße Erbarmen mit diesen Kindern die rechten Worte auf die Lippen legte. Zwar wurde sie oft durch das laute Aufschreien der beiden Mädchen unterbrochen, die, von Schmerz geschüttelt, sich ängstlich an sie drängten. Aber Pucki fühlte, daß beide Kinder bei ihr Zuflucht suchten und fanden.
Einmal kam Karl leise ins Zimmer, verließ es aber sehr bald wieder. Auch Doktor Gregor kam, blieb einige Augenblicke schweigend an der Tür stehen und ging wieder davon. Später wollte auch er mit den Kindern reden, aber vorläufig durfte er Pucki nicht stören.

Endlich wurde es Abend; noch immer kauerten die beiden Mädchen bei Pucki. Sie hatten verweinte Gesichter, und doch lag ein unbegrenztes Vertrauen zu Pucki in ihren Augen. Sie lauschten den tröstenden Worten der Tante. Wenn die Eltern tot waren, hatten sie ja keine Heimat, kein Elternhaus mehr.
»Pucki«, schluchzte Mabel auf, »dürfen wir nun bei dir bleiben? Schicke uns nicht fort, Pucki!«
»Ihr sollt immer bei mir bleiben, Tante Pucki möchte von heute ab euer Mütterchen sein.«
Wieder weinten die beiden Kinder laut auf. Es dauerte eine ganze Weile, bis ihr Schluchzen leiser wurde. Nach langer Zeit sagte Mabel scheu:
»Ein Hagelschlag ist gekommen, die Blumen hat er totgemacht. Auf mich hat es auch gehagelt. – Der Junge sagte, man kann sich nicht alles kaufen. – – Oh, Eberhard und Mary sind tot, sie kommen nie mehr wieder!«
»Pucki – Tante Pucki«, schluchzte Regine.
»Nun bin ich euer Mütterchen«, sagte Pucki, »und ihr seid meine beiden Lieblinge!«
An diesem Abend brachte Pucki zwei völlig erschöpfte Kinder zu Bett. Sie hatte keine Zeit, an sich zu denken, an den eigenen Schmerz, der auf ihr lastete. Und die beiden Mädchen, die sonst so selbständig waren, ließen sich wie kleine Kinder von Pucki betreuen, ließen sich von ihr zudecken und verlangten nur, sie möge an ihren Betten sitzenbleiben.
Da saß nun Pucki, hatte den Kopf in die Hand gestützt und sprach liebe und zärtliche Worte zu den beiden Mädchen.
Endlich schliefen sie ein. Da nahm Claus seine Frau fest in die Arme: »Willst du nicht endlich an dich denken, Pucki?«
Sie nickte nur weh.