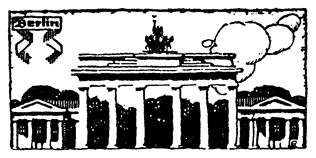|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am neundundzwanzigsten Juli des Jahres 1817 wurde den Berlinern ein absonderliches und aufregendes Spektakel zu teil.
Als der im zweiten Stock des Hauses Taubenstraße 31 wohnhafte Kammergerichtsrat Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, um seinem Nachdenken über den weiteren Verlauf der Geschichte von Meister Martin dem Küfner und seinen Gesellen etwas Anregung zu geben, eben die dritte Pfeife angebrannt hatte, bemerkte er etwas Seltsames.
Über dem Papier, das vor ihm auf dem Schreibtisch lag, blieb ein rosenroter Schein, obzwar der Fidibus längst schwarz und abgetan in seiner Porzellandose steckte. Während der Herr Kammergerichtsrat mit gespreizten Fingern über das Blatt fuhr, um sich zu vergewissern, ob diese Rosenfarbe nicht etwa nur in seinen Augen und ein Widerschein des Punschtopfes von gestern abend sei, knackte und knatterte etwas irgendwo in der Welt, als bräche man Bretter.
Gleich darauf spritzte ein spitzes Klirren, wie zersplitterndes Glas.
Der Kammergerichtsrat stieß in seinen Stuhl, tat einen Satz zum Fenster, sprang in der eigenen Spur zurück, daß die Quasten um seinen Magierschlafrock Arabesken tanzten.
»Frau,« rief er, »Frau … es brennt … das Schauspielhaus brennt.«
Die Frau Kammergerichtsrätin, die in der Küche im Haushaltungsbuch rechnete, in dem ihre großen Seufzer als Fettflecke zurückgeblieben schienen, ließ den Alarm beim anderen Ohr wieder hinausgehen. Es stand fest, daß es dem Gemahl beliebte, einen seiner grotesken Scherze in Szene zu setzen. Nein, es war ihr nicht darnach zumute, ihm den Gefallen zu tun und herbeizueilen, um mit einem Bocksprung und einer ironischen Reverenz empfangen zu werden.
Sie hörte den Herrn Kammergerichtsrat im Arbeitszimmer im Beschwörungston ausrufen: »Undine! Undine! Undine!«
Aber da sah sie über das freie Himmelsstück zwischen den kahlen Hofmauern eine dicke, schwarze Wolke mit einem rosigen Bauch wegschwimmen.
Der Feuerhai!
Da sprang sie auf, das hoffnungsvolle Rechnungsbuch und ein hoffnungsvoller Milchtopf polterten hinterdrein, und lief nach vorn.
Und wirklich, diesmal war es kein skurriler Spaß des Gatten, sondern bedrohlicher Ernst. Aus dem Dach des Schauspielhauses gegenüber würgten sich Flammen los und bäumten sich schwarze, wirbelnde Rauchsäulen, die Funken gegen das eigene Haus niederstießen.
Der Kammergerichtsrat stand still und hielt die Arme weit von sich gebreitet, hinter ihm lagen die Schlafrockquasten auf der Erde wie zwei gezähmte Schlänglein. »Was soll,« rief er, »was soll aus meiner ›Undine‹ werden? Dreiundzwanzigmal gegeben, so wird sie mir in diesem Haus nicht einmal majorenn. Was kann das Wassernixlein gegen die Elementarbrüder des roten Feuers? Der Baron wird Augen machen.«
»Ach, mit deiner ›Undine‹,« schrie ihm die Gattin in den Jammer, »leg Hand an.« Und sie begann sinnlos hin und her zu laufen, trug zusammen und wieder auseinander, schleppte sich an schweren Dingen ab, die sie mitten im Zimmer stehen ließ, um sich anderen zuzuwenden.
Der Kammergerichtsrat hatte indessen das Fenster geöffnet und beugte sich auf die Straße vor. Da unten drehten sich schon schwarze Wirbel von Menschen, in die von beiden Straßenenden immer neue Massen flossen. Gegenüber im brennenden Musenhaus sah man Leute laufen, ab und zu sprang einer ans Fenster und schrie in die Straße hinab. Und nun brach auch schon die Brandpolizei ein, keilte sich mit Leitern und Schläuchen in die Menge und fiel das Feuer an.
»Ich fürchte,« seufzte der Kammergerichtsrat, »ich fürchte, das ist die letzte Vorstellung. Bei bengalischer Beleuchtung des ganzen Schauplatzes.«
Die Leitern streckten sich an den Mauern hoch, unten flogen die Pumpenarme wechselnd in die Höhe, zwei Klumpen von Menschen streckten und duckten sich wechselnd.
Jemand trillerte auf einer Brandpfeife durch das Geschrei. An den Leitern schoben sich Männer hoch, schlaffe Schläuche nachziehend. Nun klebten sich die Leute fest, durch die Schlauchleiber lief Leben, straffte sie, und nun spie es aus schmalen Mäulern in den Feuerbauch. Dichte Rauchwolken schlugen zurück, Funkensprühen gab Antwort.
Um den Kammergerichtsrat stäubte rotes Gewürm, ein Feuertierchen hockte sich sengend in den Schlafrock, die schmale, knochige Hand drückte es tot.
Die Frau Rätin faßte die Schlafrockquasten an, riß an dem Herrn Gemahl, daß er einige Schritte zurücktaumelte.
»Fort vom Fenster; willst du mir verbrennen?«
Aber da polterte es auch schon die Treppen hoch; vier Brandleute schleppten den Wasserwurm ins zweite Geschoß, durch Vorraum und Zimmer ans Fenster.
»Wir müssen es von hier aus angehen.«
Das Wasser kam im Schlauch hinterdrein, machte das hänfene Rohr prall, zischte überraschend und scharf auf den Feind. Schwarz und triefend lag die Wasserschlange mitten im Zimmer. Jetzt war es, als wende sich das Feuer mit zweifacher Wut hierher; eine höllische Glut schlug herüber, Flammengehänge schwollen und bauschten sich vor den Fenstern, die Luft war heiß wie glühender Sand, röstete Gaumen, Hals und Lungen.
Die Brandleute legten Hand an die Möbel, denn es begann nach erhitztem Lack und versengtem Horn zu riechen. »Halt da,« rief der Kammergerichtsrat, »nicht anfassen; es geht wohl so vorbei.«
»Jesus, meine Zuversicht!« schluchzte die Kammergerichtsrätin, außer Atem und einem Weinkrampf nahe, »der Mann … steht da … tut nichts … so rühr dich doch!«
Wie sich aber der Herr Kammergerichtsrat wandte, da sah er, daß der Wasserwurm eine Wunde hatte. In der Seite hatte sich ein Loch aufgetan, aus dem kam ein dünnes Strählchen hervor, das in einem feinen Bogen durch das halbe Zimmer setzte und gerade auf dem beschriebenen Bogen niederplätscherte, der auf dem Schreibtisch lag.
Da fuhr aber ein hastiges Leben in das dürre, kleine Männlein. Zuerst riß es ihn zu einigen ziellosen Sprüngen. »Zur Feuersnot auch noch Wassersnot!« schrie er und zog sein Manuskript aus der Taufe. Das Brünnlein aus der Seite des Schlauches sprühte lustig weiter, und es war, als habe dies kleine Malheur im Zimmer den Leuten mehr den Verstand verwirrt als das große Unglück gegenüber.
Die Frau Rätin zog das ganz große Lamento: »Jesus, Jesus … die neuen Möbel … um Gott … dreihundert Taler sind hin …«
Sie stand, wie sie eben im Begriff war, zu retten, mit einer gestickten Schlummerrolle in der einen und dem Papierkorb in der anderen Hand, und die Tränen brachen ihr hemmungslos aus den Augen. Da sie der Rat so wehrlos sah, sprang er auf sie zu: »Da du,« rief er, »da du den Kopf verloren hast, brauchst du auch keine Schürze.« Und er tat einen gewaltigen Zug an den Bindebändern, daß die Schürze vorn sachte abglitt. Jetzt verstanden die Brandleute, was es galt, rissen das blau und weiß gestreifte Kattunding in Fetzen, wickelten, verbanden, verschnürten mit den Schürzenbändern, besserten den Schaden, daß kein Tropfen mehr durchdrang.
Der Rat rieb sich die Hände und tat einen seltsamen und vergnügten Sprung. »Sind wir nicht,« rief er, »sind wir nicht die rechten Schürzenhelden! So aber hat die Schürze wenigstens einmal in der Welt etwas Gutes gestiftet.« … –
Während der Kammergerichtsrat Hoffmann so sein Hab und Gut zwischen Wasser und Feuer hindurchbrachte, kroch ein zweijähriger Junge gar nicht weit davon auf einen Fenstertritt; etwas ging in dem Großen vor, das um ihn herum war. Lärm und Unruhe bestand, die Erwachsenen liefen, rissen die Fenster auf, etwas war zu Boden gefallen – vielleicht die Zuckerdose! Minna war fort, hatte ihn hingestellt, hatte gesagt, sie komme gleich wieder.
Da das aber wollte wissen, was es gab.
Nebenan schrie der Papa: »Jetzt kommt die dritte Brandspritze!« Und man hörte Bernhard quieken. Alles drängte sich nebenan im Eßzimmer an die Fenster.
Da das kroch auf den Fenstertritt, zerrte einen Stuhl, kletterte hoch. Haus, Straße, Menschen. Aber anders als sonst: das Haus rot, viel mehr Menschen als sonst auf der Straße.
Da das besann sich: was da rot um die Ecke schlug, war dasselbe, was in der Küche unter dem Herde tanzte, nur viel größer. Man konnte es nicht recht sehen, da kam immer nur so ein Arm vor, das andere war hinter der Ecke. Da das stemmte sich mit beiden Händchen gegen die Fensterscheiben und wäre vor Schreck beinahe hintenüber gefallen. Denn das Glas war glühend heiß und man hätte schreien mögen.
Da das aber wollte nicht schreien, und nun mußte es erst recht wissen, was es da draußen gab. Herunter vom Stuhl und vom Fenstertritt, zur Tür, wieder einen Stuhl her, hinauf, die Klinke nieder und hinaus. Die Vorzimmertür stand offen, nun ging Da das einmal dem Unbekannten zu Leibe …
Nachdem der Kammergerichtsrat Hoffmann sich überzeugt hatte, daß für seine Wohnung nichts mehr zu befürchten stehe und daß sie wohl behütet sei, begab er sich auf die Straße. Er liebte es, bei Aufläufen dabei zu sein; denn das mannigfache Gebühren der Menschen, die unterschiedlichen Temperamente gaben dabei Gelegenheit zu eingehenden Studien. Wo viele Seelen zusammenschlugen und in eins verliefen, gab es überdies höchst seltsame Erscheinungen, die zu dem, was der Einzelne in solchem Falle getan hätte, oft geradezu verkehrt standen.
Es schien, als sei es gelungen, das Feuer auf seinen Herd beschränken. Und wenn man auch das Schauspielhaus verloren geben mußte, so war die Nachbarschaft doch außer Gefahr.
Aber eben, als die Menge sich zu beruhigen begann und eine gemäßigte Schaulust eintrat, gab es in dem brennenden Gebäude einen Krach, als ob der Pfropfen aus einer großen Kinderpistole geschossen würde. Und gleich darauf stieg aus dem eingestürzten Dachstuhl ein ganzer Schwarm brennender Vögel, die sich funkenflügelschlagend und mit lodernden Schweifen in der Luft verteilten. Man sah sie einen Augenblick lang schweben und dann langsam auf die Nachbardächer niedersinken.
»Ach du mein,« rief jemand neben Hoffmann, »jetzt hat sich das Feuer an die Perückenkammer gefressen.«
Hoffmann sah den Nachbar an und erkannte den kleinen verwachsenen Theaterfriseur Simmel.
Und wahrhaftig, die Schwärmer, die da aus dem brennenden Haus aufflogen, waren aus der Perückenkammer gekommen. Es schien, als sei eine ganze altväterliche Gelehrtenzunft explodiert, alle Weisheit und Würde der Welt in Brand geraten. An die Korkzieher der Allongeperücken hatten sich rote, fressende Flocken gesetzt, von den eingedrehten Röllchen der friderizianischen Perücken standen Flammenflügel ab, auf denen sie mit feurigen Schwänzen wedelnd durch die Luft zogen.
»Ach du mein,« jammerte der Theaterfriseur, »Herr Kammergerichtsrat: meine schönen Perücken sind alle kaputt.«
»Menagier Er sich,« sagte der Rat, »menagier Er sich. Besser die Perücke brennt ab, als der Kopf. Mir geht drüben mehr kaputt als ihm.«
In diesem Augenblicke ging ein gewaltiger Stoß durch die Menge, denn die Feuerwehr war neuerdings in heftige Aufregung geraten und zog eine neue Schlauchlinie, um die Perückengefahr zu bekämpfen. Hoffmann flog gegen eine Wand und fühlte etwas Weiches zwischen seinen Beinen. Er griff hinunter und ertappte zwei Ohren und einen flaumigen Schädel.
»Unglückskind,« rief er, indem er einen zitternden und halb zerquetschten Jungen aus dem Gewimmel von Beinen herauszog, »Unglückskind, wie kommst du da hinunter? Weißt du nicht, daß man der Welt nicht vor die Füße laufen darf, wenn sie irgendwohin will?«
Der Junge sah den Herrn Kammergerichtsrat aus blauen Augen fest an, rückte sich dann, als sei der Mann eigens für ihn herbestellt, auf seinem Arm zurecht und legte ihm eine Hand auf den Hals. Hoffmann aber lief es bei dieser Vertrauenskundgebung des kleinen Geschöpfes warm im Herzen zusammen. Er zog einen Zipfel des quittengelben Schlafrockes, in dem er unter der Menge stand, heran und über den Jungen und drückte ihn fester an sich. »Blaue Augen!« murmelte er einer entlegenen Vergangenheit zu. »Aha!« machte der Junge auf seinem Arm und focht mit der freien Hand in der Luft. Es war aber auch eben das allerschönste Schauspiel für einen Jungen angegangen. Aus dem brennenden Haus hatte sich ein ganzes Volk von lodernden Perückenvögeln erhoben. Sie stiegen an, hielten sich infolge der Wärme oder aus anderen physikalischen Gründen längere Zeit schwebend, wobei sie Rauch und Funken von sich gaben, und nahmen dann den Kurs nach dem Dach der königlichen Seehandlung.
»Die Bank! Die Bank!« schrie man in der Menge.
Sogleich zielten zwei Wasserstrahlen nach dem bedrohten Dach. Eine besonders große Perücke aber hatte sich vom Schwarm getrennt und unternahm eine eigene Luftreise. Sie stieg höher und höher, als wolle sie den Himmel anbrennen. Quirle von Feuer drehten sich unter ihr, hinter dem Zopf pufften kleine Rauchwölkchen. Das war keine Perücke mehr, das war ein Brander, der, wo er hinkam, zünden mußte.
»Es ist Unzelmanns Perücke aus dem Dorfbarbier,« krähte der Theaterfriseur, der wieder neben dem Kammergerichtsrat gestrandet war.
Wasserstrahlen zischten machtlos hinter dem gefährlichen Ungetüm drein. Der Junge aber hopste auf Hoffmanns Arm, quiekte wie eine Maus vor Vergnügen und fuchtelte mit der Hand.
»Freust dich,« sagte der Kammergerichtsrat, »freust dich, daß die Perücken fliegen? Brav, mein Junge, ich freu' mich auch, wenn's den Zöpfen und Perücken zu heiß wird. Man muß ihnen bisweilen recht unterzünden. Muß nur einer da sein, der es auf sich nimmt, den Brand anzustiften. Wenn auch einmal so ein paar Dutzend draufgehen, es bleiben uns noch immer genug Perücken in Deutschland übrig. Ich muß das wissen, ich bin Kammergerichtsrat.«
Unzelmanns Perücke hatte den Höhepunkt ihres Anstieges erreicht, sie drehte sich oben hoch über den Dächern, den Spritzen unerreichbar. Alles war dem absonderlichen Phänomen zugewandt.
Da schlug ein Schuß in die Spannung. Man sah, wie der gefährliche Brandvogel oben zerstäubte, eine Wolke glühenden Puders verrieselte, schwarze Flocken krümmten sich, der rauchende, ohnmächtige Rest sank irgendwo zwischen den Dächern in einen Hof.
»Totgeschossen!« jauchzte der Kammergerichtsrat.
Im Dachfenster eines Hauses der Taubenstraße kniete ein Gardejäger, aus der Mündung seiner Büchse ging noch ein leichter, dünner Rauch aus, er winkte gelassenen Dank auf die Zurufe der Menge.
Auch der Kammergerichtsrat wedelte mit dem anderen Zipfel des quittengelben Schlafrockes seine Begeisterung hinauf: »Bravo,« schrie er, »bravo! Ein couragöser Mensch! Wenn alle Mordgewehre so gute Arbeit täten, so könnte man wohl mit der Soldateska einverstanden sein. So sind sie die einzigen, die noch den Perücken aufkommen …«
Plötzlich querte etwas Schweres den leichten Schwung seiner Seele. »Alle Heiligen,« knurrte er, »alle Heiligen … da stehe ich mit dem Jungen … indessen seinen Eltern vielleicht die Angst blutigen Schweiß austreibt. Da muß ich doch sogleich … wenn ich ihn nun schon einmal an mich genommen habe. Wer bist du denn?«
Der Junge spiegelte die Welt in blanken, blauen Augen. Hinter dem Erstaunen sah man scharfes Nachdenken, es war, als bilde sich eine Falte auf der glatten Stirn.
Wer man sei? Da das war man, von den anderen Otto genannt.
Dem Kammergerichtsrat wurde der Junge mit einem Mal so schwer, wie dem heiligen Christophorus der, den er über das Wasser zu tragen sich unterfangen hatte. Was einen solchen niederträchtigen Bengel so bleischwer machte, war die Verantwortung. Er rüttelte den Jungen ein wenig, wie man eine Medizinflasche schüttelt, damit das, worauf es ankommt, in die Höhe steige.
»Wie du heißt, Junge, frage ich! Otto? Also Otto. Mein Gott, was für ein Otto denn?«
Zum Sacktuch war kein Weg. Da saß der Junge drauf. Der Kammergerichtsrat wischte mit dem freien Schlafrockzipfel über die Stirn. Etwas fiel ihm ein: »Kannst du mir das Haus zeigen, in dem du wohnst?«
Otto zog wieder diesen Schatten von Falte in seine Stirn; o ja, das ging vielleicht noch. Er ritt vergnügt auf dem Arm und strebte voran durch die dünner werdende Menge in eine der Straßen hinein. Der Kammergerichtsrat merkte wie ein gelehriges Pferd auf jeden Ruck, während er bei sich zu Rate ging, ob es nicht besser sei, den Jungen sogleich der Polizei zu übergeben. Aber das kleine Händchen lag so warm an seinem Hals, es war ein so absonderliches Gemenge von Ärger und Zärtlichkeit, das er aus dem Abenteuer nahm, er fühlte sich durch den Bengel so ins väterlich Wichtige gehoben, daß er das alles nicht mit einem Mal abtun wollte.
Der Junge ritt indessen den Herrn Kammergerichtsrat in die Mohrenstraße hinein und lenkte zu jedem Haustor, um es ganz genau zu betrachten.
Gegenüber dem »Hotel de Brandebourg« hielt er sein Reitpferd vor einer Tür an, über deren Sturz eine Ente aus dem Stein gehauen war, die ein kunstverständiger Hausbesorger neuestens mit dem schönsten Blau angemalt hatte.
»Das sollte,« brummte der Kammergerichtsrat, »das sollte anstatt des Bären das Wahrzeichen der Stadt sein. Eine Ente in Blau … in Berlinerblau! Und hier bist du zu Haus, Junge? Der Himmel sei gepriesen … hoffentlich irrst du dich nicht.«
Aber der Junge lenkte seinen Freund sehr sicher zwei Stockwerke hinauf und vor eine Tür, die mit handbreitem Spalt klaffte, da Minna noch immer nicht zurückgekehrt war. Hier gab er dem Kammergerichtsrat plötzlich mit beiden Händchen einen Stoß vor die Brust, rutschte ihm glatt aus den Armen und stand auch schon auf strammen, geraden Beinen.
Während der Rat noch lauschte, ob nicht darinnen Türenschlagen, Jammer und Weinen zu hören sei, fühlte er, wie eine Kinderhand zwischen seine Finger drängte und wie der kleine Kerl ihn vorwärtszog.
Aber er hatte keine Lust, im quittengelben Schlafrock einen großen Familiendank einzuheimsen. »Nein,« sagte er, »nein, laß nur, mein Bengel … du hast Glück, sie sind noch nicht dahinter gekommen, daß du entwischt bist. Geh nur und gib acht, daß du deinen Mitbürgern nicht wieder unter die Füße kommst.«
Er drehte den Jungen an den Schultern der Tür zu, fühlte es ein wenig schmerzlich durch seine Brust ziehen, drehte ihn wieder zurück und klebte ihm einen Kuß auf die nasse Schnauze. Dann stopfte er ihn rasch durch den Spalt und zog die Tür zu.
Als er schon auf der Treppe war, besann er sich, tat einen verwunderlichen Hopser, der ihn um die eigene Achse kehrte, und sprang noch einmal zur Tür zurück.
Im Dämmer des Flures las er auf dem blanken porzellanen Wohnungsschild in zierlich schräg gestellten Schreibschriftzügen: »Rittmeister Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck, Rittergutsbesitzer.«
Pommern ist keineswegs das schlechteste unter den deutschen Vaterländern; es hat die pommerschen Gänsebrüste und die pommerschen Grenadiere, von denen jedes in seiner Art ein vollkommenes Ding ist.
Als der letzte der Eisriesen, die vor vielen hundert Jahren hier herum die Herren und breitmächtig über ganz Deutschland von den Alpen bis zum Meer gelümmelt waren, als der letzte und hartnäckigste dieser Riesen endlich vor dem heiligen Georg weichen mußte, da raffte er so viel Eis, als er nur konnte, in einen großen Sack, um es mit sich nach Norden zu schleppen, wo er sich eine feste Burg bauen wollte.
Der heilige Georg aber stand auf dem Brocken, hob die heilige Lanze, dieselbe, mit der er den Lindwurm abgeschlachtet hatte, daß die Sonne auf ihrer Spitze einen hellen Jauchzer tat, und warf sie dem Riesen nach. Sie blitzte über Elbe und Oder hinweg, fuhr dem Riesen in seinen Sack und riß ein dreieckiges Loch, wie man es in der Hose kriegt, wenn man über den Zaun klettert, in dem ein Nagel sitzt.
Da begann es aus dem Loch zu rieseln, ganze Stücke Eis, eines hinter dem anderen, und als der Riese sich jetzt hoch in die Luft erhob, um über die Ostsee zu kommen, verstreute sich der Eisregen weit über das ganze Land. Erst als der Riese ein gutes Stück in Schweden war, merkte er, daß sein Sack immer leichter wurde, und da beeilte er sich, davonzukommen, daß er wenigstens die größten Trümmer mit nach Norden brächte.
Der heilige Georg aber schnitt mit der Lanzenklinge die goldenen Seile durch, mit denen die Sonne bisher am südlichen Himmelsrand festgehalten war, daß sie nur gerade so mit einem Auge über Deutschland hinblinzeln konnte. Da rauschte sie mit einem Mal hoch hinauf, wie auf feurigen Flügeln, ganz voll Kraft und Herrlichkeit, und ließ, was sie nur an Wärme und Segen in sich hatte, auf Deutschland verströmen. Die kahlen Fluren wurden grün, das gelbe, verdrückte Gras verlor sich zwischen starken, weichen, saftigen Halmen, die Bäume in den Wäldern rüttelten ihre verbogenen Äste zurecht, in weißen Wolken stand die junge Pracht der Obstbäume auf der Erde; das Sonnengold, das in den Boden gesunken war, kam in breiten, wogenden, goldenen Wellen wieder hervor und rauschte über die Äcker der Ebenen das ewige Lied der Fruchtbarkeit.
Wo aber die Eisbrocken aus dem Riesensack hingefallen waren, da rannten und quollen die Tauwasser, und all das blanke, blaue Eis schmolz in Hunderte von Seen und Teichen hin. So kam es, daß Pommern zwischen Wäldern und Äckern mit blauen Wasseraugen gesprenkelt wurde und den klaren Himmel anlachen konnte wie kein anderes Land. Die Nachbarn links und rechts – Mecklenburg und Preußen – waren auch nicht übel mit Seen bedacht; aber Pommern hatte doch die schönsten; denn gerade über Schivelbein hatte der Sack des Riesen sein Loch bekommen. –
Man hatte das vom alten Brand, der solche Geschichten zwischen die Maschen seines Strickstrumpfes webte, wenn er in der Sonne saß und die braunen und roten Kühe die Zampelwiesen fleckten. Oder aber er stopfte diese Geschichten mit dem Kraut in den Pfeifenkopf und sog sie zwischen dem blauen Rauch behaglich wieder hervor.
Noch ganz andere Geschichten hörte man von ihm, die kein Mensch sonst wußte.
Da war die Oder, ein Fluß glaubte man? O ja, aber was für einer. Sie kam da irgendwo hinten zwischen den Bergen hervor, gar nicht weit von der Weichsel. Und kaum waren die beiden ein wenig aus dem ärgsten Gestein heraus, da gewannen sie enge Freundschaft und beschlossen, sie wollten beide denselben Weg nehmen: in die Ostsee. Das war nur ganz in Ordnung, denn jeder Fluß und jeder Mensch muß sich ein Ziel setzen und sich entscheiden, wohin er fließen will, darf nicht in der Welt umher irrlichtern, einmal dahin und einmal dorthin, sonst verläuft dem Fluß wie dem Menschen sein Leben schließlich im Sande. Aber die beiden Flüsse waren doch von ganz verschiedener Art, wie es ja auch nicht zwei Menschen gibt, die einander gleichen, auch wenn sie nahe beieinander entsprungen sind. Während die Weichsel nur daran dachte, ihre Wasser schön zu sammeln, zusammenzuhalten und richtig an das Meer abzuliefern, hatte die Oder ganz andere und recht erstaunliche Pläne. Sie wollte keine Dienstbarkeit tragen, vermaß sich, wenn sie ans Meer käme, die ganze Ostsee auszusaufen, und setzte auf dieses Vornehmen gegen die Weichsel eine Wette. Und so erzog sie sich zu diesem Zweck, straffte sich immer mehr, je näher sie ihrem Ziele kam, wurde sehnig und stark und riß mit einem Mal, als sie das offene Meer erblickte, ein Riesenmaul auf, einen ganzen Trichter von Maul, so daß zu sehen war, sie mache mit ihrer Absicht Ernst und es könne ihr am Ende gar gelingen.
Da wurde dem heiligen Petrus, dem Schutzpatron der Schiffer, der diesem Beginnen vom Himmel aus zusah, doch angst und bang. Denn wenn die Oder die Ostsee aussoff, dann saßen die braunen und roten Fischerboote mit lahmen Segeln auf dem Sande, und die Häringe, Aale und Flundern mußten sich wohl vier Beine wachsen lassen, damit sie spazieren gehen könnten. Also lief der gute Petrus von seiner Himmelstür weg geradenwegs vor den Allerhöchsten Thron, erbat die Erlaubnis, dem Unglück zu wehren, und rannte dann in den Himmelswinkel, wo die noch unerschaffenen Welten formlos auf einem Haufen lagen. Mit zwei Fäusten voll Weltenlehm sprang er dann vor die Himmelspforte und warf die Klumpen der Oder vor das eben aufgerissene Maul.
Das sind die Inseln Usedom und Wollin, und die liegen noch heutigen Tages da, damit die Oder nicht die Ostsee verschlucken kann.
Ja – ein Land, um das sich Riesen und Heilige wechselweise so viele Mühe gegeben haben, mußte wohl ein besonderes Stück Gotteserde sein.
Schönhausen in der Altmark, allen Respekt, da hatte die Herrschaft ihre Wurzeln, die Türme von Stendal und Tangermünde, o ja … aber Kniephof bei Naugard in Pommern, das war auch nicht schlecht. Man konnte stolz sein, daß man auch mit einem Bein in Pommern stand. Mit dem linken in Schönhausen, mit dem rechten in Kniephof, dann hatte man Berlin gerade mitten unter sich. Sie sollten sich nur nicht mausig machen, die Berliner; man hatte Stettin in der Nähe, und das durfte sich auch neben Berlin schon sehen lassen. Und wenn der Herr Rittmeister nächstens wieder zum Wollmarkt fuhr, so sollte er Otto nur mitnehmen.
Als der Neunzigjährige das zum erstenmal sagte, da schob sich die Kinderhand über seine rissige Runzelpfote: »Stettin, das ist die Stadt, wo sie für den Papa das Wetter machen?«
Warum?
Die Minna sagte es immer.
Da schmunzelte der Alte in den blauen Rauch: nun ja, das sei das Wollenwetter: wenn die Preise sänken, dann gebe es Nebel und Heiderauch auf des Herrn Rittmeisters Gesicht; wenn sie aber stiegen, dann kläre es sich auf und von den Augen zu den Mundwinkeln laufe lauter Sonnenschein. Und der Frau Rittmeisterin erschienen auf dem Himmel von Berlin gleich ein paar neue Kleider.
Das waren so Sommergeschichten. Die Wintergeschichten aber reihten sich alle um Napolium.
Napolium?
Na ja, Napolium, der wäre ein böser Mensch gewesen, der hätte Europa keine Ruhe gegeben, bis man ihn gefangen habe. Da liege er jetzt auf einer Insel im Weltmeer, an einen Felsen geschmiedet, und alle Tage komme ein Adler, reiße ihm mit dem krummen Schnabel die Seite auf und fresse ihm die Leber weg. Aber über Nacht wachse ihm die Leber immer von neuem, damit der Adler auch am nächsten Tag wieder seinen Fraß habe.
Er, der alte Brand, habe aber noch die Zeit erlebt, wo der Adler verzaubert und in Erz gebannt den Soldaten des Napolium habe voranziehen müssen. Und Otto solle nur den Herrn Rittmeister fragen, was das damals für Zeiten in Deutschland gewesen seien. Bis die Kosaken in Rußland dem Napolium auf die Strümpfe geholfen hätten.
Da war es nun am schönsten, wenn dazu über den Dächern die Windsbraut vor dem wilden Jäger floh und heulend in jedem Schornstein Zuflucht suchte. Da kam auch etwas in die trockene Stimme des Alten, das ganz seltsam ins Blut schlug. Nacht und bittere Kälte, Hunger und Sterbensmüdigkeit, die endlosen Schneefelder und die Kosaken mit den Lanzen hinterdrein – alles das war Gottes Finger gewesen. Nur ein Deuten, und die ganze Herrlichkeit war in den Schnee gesunken, und die vielen kleinen Schneewehen auf der Straße, das waren lauter Tote, unter jedem Hügelchen ein toter Mann oder ein totes Pferd.
Sie waren auch durch Kniephof gekommen, ein armseliger Trupp, Lumpen um den Leib, Fieber in den Knochen, Hunger in den Augen, Überlebende aus dem Weltgericht.
»Aber,« so schloß der Alte seine Geschichte von Napoliums Untergang in Rußland immer, »er hat uns auch deutsches Blut zu den Moskowitern verschleppt. Das mußte dort erfrieren und erschossen werden, verhungern und ertrinken. Und wenn alles andere bezahlt ist, das ist noch nicht bezahlt.«
Wenn man aber mit Geschichten bis unter die Mütze voll war, dann lief man mit Karl dem Urgroßvater davon und spielte sie alle in die Wirklichkeit hinein. Die Zampel war die Oder, und man schmiß vom Blockshügel mit Feldsteinen nach ihr, gerade dort, wo sie sich vermaß, breiter zu werden, damit sie, rechtzeitig zur Bescheidenheit gemahnt, nicht etwa sich unterfinge, den Teich auszutrinken.
Karl Brand kannte eine Menge geheimer Dinge. Wie man aus Pulver Speiteufel machte, die fauchend hin und her fuhren, als wollten sie die Welt zerreißen. Wie man aus Kürbissen Masken schnitzte, die, von innen durch Kerzen erleuchtet, auf alte Weidenstümpfe gesteckt wurden, daß die Mägde schreiend davonliefen.
Er konnte aus alten Säcken und Heu Lindwürmer bilden, die Otto, auf seinen Schultern sitzend, mit den heiligen Lanzen aus der Gärtnerkammer bekämpfte, bis das Heu aus tiefen Wunden hervorquoll.
Im Winter wurden dann die großen Feldzüge nach Rußland unternommen, und wenn sich die Kälte unter den Fingernägeln festbiß und man im tiefen Schnee bis über die Knie einsank, so brauchte man nur daran zu denken, was die Landsleute bei den Moskowitern hatten erdulden müssen, und man war fest gegen alle Unbilden.
Die Gefahren dieser russischen Abenteuer bestanden in anderem als Kälte und Schnee. Man mußte sich weniger vorsehen, daß man nicht den Kosaken, als vielmehr, daß man nicht der Mama in die Hände fiel. Die liebte den alten Kuhhirten nicht, und sein Urenkel war ihr ein Dorn im Auge. Was da das Kind zu diesem Umgang mit dem schwachsinnigen Greis und dem schmutzigen wilden Bengel trieb, war sicher nicht das reinliche und auf Distanz bedachte Menckensche Erbe. Es galt bisweilen, mit harten Händen einzugreifen.
Es war um Mittag ein weicher Schnee gefallen, der als dünne Decke über dem Eis und den schon ein wenig verfärbten alten Schichten von Weihnachten her lag.
Jetzt schwamm das leichte Gewölk zu Federn zerzaust unter der Sonne. Der Sechsjährige kam über den Hof. Irgend etwas in der Welt rief und rief. Bernhard saß oben hinter den französischen Büchern, dem war die Grammatik als Riegel vor die Welt vorgeschoben. Alle die weißen Hügel hatten Stimmen, denen man nicht widerstehen konnte. Es war alles viel schöner geworden, seit die schwarzen Tauflecke aus den letzten Tagen weiß zugedeckt waren.
Man mußte nur tun, als ob man gar nichts anderes im Sinne hätte, als etwa in den Stall zu gehen oder in der Schmiede zuzusehen. Mademoiselle schrieb einen Brief, aber jeden Augenblick konnte hinter ihm ein Fenster klirren und Mamas Stimme ihm seinen Namen wie eine Harpune nachschleudern. Otto sah diesen Namen leibhaftig und wie ein wirkliches Ding vor sich: mit zwei halbkreisförmigen Haken am oberen und unteren Ende, zwei Sicheln oder Klauen, die an kleine scharfe Spieße gebunden waren, das Ganze ein Instrument, das sich unerbittlich durch die Kleider bis ins Herz bohrte und mit dem einen die Mama aus dem entlegensten Winkel der Welt zurückholen konnte. Wenn der Vater den Namen sprach, so hatte das freilich ein anderes Ansehen: vorne und hinten je eine runde und schmalzglänzende Butterwecke.
So wedelte man in der Schlauheit seiner sechs Jahre über den Hof, strömte auf alle Fälle Unschuld und Harmlosigkeit aus. In der schwarzen Schmiede stand Jochen Hildebrand, der so groß war wie der alte Schrank vor der Schlafzimmertür. Die Mama aber sagte von ihm, er erinnere sie an das trojanische Pferd, und wenn der in Berlin in ein Haus hinein wolle, dann müßte man erst die Mauern für ihn einreißen.
Jochen Hildebrand stand, vorn und hinten schwarz, vor dem Amboß und schlug auf eine glühende Pflugschar los. Der Hammer war ihm leicht und drosch übermütiger zu als nötig war; denn Jochen Hildebrand war jung verheiratet, und in seinem neuen Heim wuchs ihm aus dem Glück die Kraft. Das Eisen stieß unter der Wucht der Schläge Schwärme von Funken aus, von denen die Dunkelheit der Schmiede gesprenkelt wurde.
Jochen sah den Jungen am Torpfosten lehnen. »Komm mal ran,« rief er, »hilf mir ein bischen. Ich hab' da den Teufel unter dem Hammer. Mein Vetter in Jüterbok hat mir'n geschickt. Er konnt' ihn nicht weich kriegen. Aber ich will ihm's schon besorgen.«
Otto schüttelte den Kopf und schielte nach dem Herrenhaus, ob die Fenster leer blieben. Und als Jochen nach einigen Hammerschlägen wieder hinsah, war der junge Herr fort.
Der war glücklich um die Ecke gekommen, und da stand auch schon Karl Brand, der den Freund vor einer Viertelstunde herausgepfiffen hatte. Es war der ganz große Pfiff gewesen, der etwas ungemein Wichtiges bedeutete und dem man un–be–dingt folgen mußte.
Otto kam atemlos an.
»Kommst du endlich?« warf ihm Karl vor. Er trug eine große Pelzmütze aus Kindertagen des Urgroßvaters, deren abgeschabte Stellen genau so aussahen wie die Haut des Neunzigjährigen und hatte einen endlosen Schal um den Hals gewickelt. Aber durch das dünne Röckchen fegte der Wind, und zu den Füßen hatte der Schnee durch mancherlei Fugen der Schuhe freien Zutritt.
Otto war vielleicht noch dünner angezogen; aber, wenn er zitterte, so war es nur die Erwartung, die ihn anspannte.
Sie trabten nebeneinander fort der Sandgrube zu, in der jetzt im Winter niemand etwas zu suchen hatte, außer wenn er etwa ein Geheimnis dort verbergen wollte.
»Was gibt's denn?«
»Warte nur … wirst schon sehen.«
Jetzt war man da; der Schnee bedeckte ein wüst zerkratztes Stück Welt. Zwischen den Maschen des Drahtnetzes, das da traurig in einem Winkel dem Sommer entgegenharrte, hatte sich das weiße Flockengewebe eingesponnen. Der Griff einer Hacke ragte aus dem Schnee wie der Knochen eines halbverscharrten Tieres.
Karl schlüpfte unter die überhängende Wand und begann zu graben. Etwas Hölzernes entwand sich dem Schnee und dem gefrorenen Sand, etwas in seinen Zwecken Unbegreifliches. Ein langes, in der Mitte dickeres, gegen die Enden schmäler verlaufendes und an ihnen aufgekrümmtes Brettchen. Und da kam noch ein zweites, ganz gleiches Ding zum Vorschein, gesellte sich dem ersten zum Paar. Was aber das Merkwürdigste war, die Brettchen waren in der Mitte durchbohrt und mit irgendwie kreuzweis durchgezogenen Stricken versehen.
Der Sinn dieser Vorrichtungen war vollkommen rätselhaft, sie waren nichts Vorhandenem und Bekanntem vergleichbar.
»Was ist das?«
Karl schnupfte auf, und ein Tröpfchen Feuchtigkeit unter seiner Nase verschwand blitzschnell dort, woher es gekommen war. Er strahlte Erfindertriumph.
»Faßdauben!« sagte er.
Ottos sämtliche Sinne wichen vor dem Sehen. Jetzt erinnerte er sich: vorgestern hatte man ein Branntweinfaß zerschlagen, das hatte dem Karl die seltsamen Brettchen geliefert.
Sie kletterten aus der Grube auf die Hügelkuppe, und Otto war stolz, daß er eines der Brettchen schleppen durfte. Oben angekommen, legte Karl die beiden Rätseldinger nebeneinander auf den Schnee, kniete hin und begann sie mit den kreuzweis durchgezogenen Stricken an die Füße festzubinden.
»Das sind Schlittschuhe,« sagte Otto.
»Nein!«
Jetzt erhob sich Karl, rot, schnaufend und glücklich. »Paß auf!« sagte er. Und sogleich begann er den Abhang hinabzugleiten, auf seinen beiden Faßdauben, in immer rascherer Fahrt, ein wenig schwankend zwar, aber immer wieder ins Gleichgewicht zurückkehrend. Er schoß den Wiesen zu, in denen der Morast, den hier die Zampel mitten hinein kleckste, als schwarzer Fleck lag. Noch ein Stück auf der Ebene trug ihn der Schwung hin, und es sah aus, als wolle er in den Tümpel, den die letzten Tautage erweicht hatten, hineinfahren. Aber am Rand des schwarzen Fleckes setzte er zu einem Bogen an, der ihn nach rechts abführte und auf der Schneefläche verlief.
»Hallo!« brüllte er hinauf.
»Hallo!« brüllte Otto zurück. Er tanzte auf seiner Hügelkuppe vor Aufregung, hob sich wie ein Reiter im Sattel dieses Erlebnisses, fühlte, von der Größe des Neuen überwältigt, auf einmal, daß diese Welt voll Wunder war.
»Noch mal?« brüllte Karl Brand.
»Ja–a!«
Es war etwas umständlich, die Faßdauben abzuschnallen; den Hügel zu erklettern und sie neuerdings unter die Füße zu binden.
Dann aber kam das Herrliche, dieses Sausen, das nicht Schlittenfahren war und nicht Eisläufen, dieses vollkommen Neue. Die Schalenden flatterten hinterdrein, die Pelzmütze schien, vom Wind gebläht, sich vom borstigen Schädel lösen zu wollen, es war eine Art von Fliegen, lieber Gott, eine Art von Fliegen.
Als Karl Brand mit seinem Brettchen den Hügel hinankam, legte Otto die Hand auf sie.
»Jetzt ich!«
»Nein!«
»Ja!«
»Was krieg' ich?«
Otto schlug eine Menge von nützlichen und vergnüglichen Dingen vor, eine ganze Schatzkammer von Jungenherrlichkeiten, Kreisel, Reifen, Bälle, Bilderbücher. Karls Begierden blieben endlich nach schweren Wahlkämpfen bei einem Federmesser mit fünf Klingen. Das war ein überraschendes Geschenk von Onkel Kessel, wegen Gefährlichkeit derzeit noch verboten, und vielleicht entschied gerade dieser Reiz für seine Erhöhung. Otto wußte, wo man es vor ihm versteckt hatte, und morgen wollte er es bringen.
Jetzt aber … jetzt aber trat er auf die Faßdauben, und Karl schnürte sie ihm an die Schuhe fest. Sogleich hatte man das Gefühl, daß man irgendwie auf unangenehme Weise ins Weltall verlängert sei und daß man keineswegs berechnen könne, was vorne oder hinten an den Enden der Faßdauben geschehe. Ein Bangen kroch herzwärts, eine Warnung, eine Ahnung von unglücklichem Ausgang. Aber da war nun einmal nichts mehr zu ändern, die Bahn war betreten und mußte durchlaufen werden.
»Paß auf,« sagte Karl, »daß du unten beidrehst, sonst fährst du in die Zampel.«
Otto wollte sich noch erkundigen, wie man denn dieses Beidrehen machen solle, da bekam er einen Stoß in den Rücken und die ganze Landschaft kam ins Gleiten. Gleich von allem Anbeginn war es entschieden, daß dieses Abenteuer kein gutes Ende finden könne. Der Stoß hatte ihn unvorbereitet getroffen, und so schoß Otto ungesammelt den Hang hinunter, mit dem dringenden Wunsch, umkehren und noch einmal und besser vorbereitet beginnen zu können. Indessen hob das Gleiten selbst ein mit Lust gemischtes Grauen in ihm hoch, das drängte ihm gegen den Magen, eine Zwiespältigkeit zerriß ihn; während er sich bemühte, indianischen Gleichmut zu wahren, zwang ihn etwas, mit den Armen verzweiflungsvoll um sich zu schlagen, und zwängte ihm die Beine auseinander. In den Ohren klopfte es ihm, als würde auf der Tenne gedroschen, der Hügel lief unbarmherzig an ihm vorüber aufwärts, ein Baum drehte sich um sich selbst wie ein Kreisel, etwas Schwarzes inmitten der sausenden Wiesen flog auf ihn zu.
Wie aus Weltenferne, vom Rande der Erde her, rief es hinter ihm: »Aufgepaßt!«
Beidrehen, jetzt war das Beidrehen da, von dem man nicht wußte, wie es anzustellen war! Vielleicht, indem man sich etwas auf die Seite legte und die Knie anzog … aber ehe man das machen konnte, war die letzte Welle da, mit der sich der Hügel auf die Wiesen niederließ; es war, als ob man einen neuen Schwung erhalte, der Schnee sprühte, die Faßdauben gaben ein heiseres, höhnisches Knirschen von sich …
Karl Brand, der brüllend hinterdrein gelaufen kam, sah, wie der junge Herr Otto geradewegs in den Zampelsumpf fuhr, wie sich die Faßdauben aufbäumten und den Abenteurer in den halbaufgetauten schwarzen Morast abwarfen. – –
Als der Herr Rittmeister vergnügt pfeifend die Treppe herabkam, um im Weinkeller für den heutigen Abend seine Wahl zu treffen, fand er im Winkel unter der Kellerstiege ein überraschendes Häuflein Elend. Es war wie ein kleiner Dreckklumpen, in den Reste eines blauen Anzugs eingebacken schienen und aus dem zwei Ärmchen hervorstanden, die eifrig hin- und herfuhren.
Der Rittmeister erkannte an den blonden Borsten seinen Sohn Otto und sah, daß er damit beschäftigt war, mit einem scharfen Holzspan die Dreckrinde von sich abzuschaben, auf daß der eigentliche Mensch wieder ans Licht käme. Da die von Schnee durchsetzte Moorerde aber noch keine Zeit gehabt hatte, zu trocknen, war der Erfolg der Mühe nur der, daß Otto die schwarze Schicht gleichmäßiger über sich verteilte.
Der Rittmeister schob den Arm in den Treppenwinkel, faßte einen trockenen Kleiderzipfel und zog das Häuflein dreckiges Elend vor die strafende Gerechtigkeit.
»So,« sagte er im allerschlimmsten Ton, »also so sieht man aus. Man schämt sich nicht. Man wälzt sich im Dreck, wie ein Schwein. Man gehört also in den Schweinstall.«
In den blauen Augen rang Verzweiflung. Aber man blieb aufrecht und stand dem väterlichen Zorn.
Der Rittmeister hielt inne, die schon erhobene Hand sank herab; ein gerechter Richter hört erst den Angeklagten! Was geschehen sei, fragte er kurz.
Da kam denn der Dreckklumpen zu Worten, und das ganze Faßdaubenunternehmen mit samt dem kläglichen Ende im Zampelmorast wurde vor den Richter hingebreitet. Karl Brand blieb verhohlen, denn der Freund hatte gebeten, ihn nicht zu verraten, und hatte sogar aus freien Stücken auf das Federmesser verzichtet.
Das Lachen war dem Rittmeister ohnehin immer näher als der Ärger, und wie er sich so den panierten Sünder besah, kam es breit und unaufhaltsam aus dem Herzen auf sein Gesicht. »Einen guten Tag hast du dir ausgesucht … wo Gäste kommen,« sagte er, »Faßdaubenfahren, hat man das gehört? Wenn dir die Mama abfaßt, so gibt's Verdruß … vorwärts, schau, daß du dir umziehst, Junge, und gib die Kleider der Annemarie, daß die Mama nichts merkt! Und wenn du mir noch einmal auf Faßdauben in die Zampel fährst, so nagle ich dir an den Ohren zu der Fledermaus ans Scheunentor.«
So hatte sich die strafende Gerechtigkeit dem Verbrecher als Hehler gesellt, und mit einigem schlechten Gewissen schob der Rittmeister seinen Jungen die Treppe hinauf und den Gang entlang vor sich her.
Aber es war manchmal, als ob die Mama wirklich hellsichtig sei und magnetische Felder um sich her auslege. Gerade, als sie an der Wäschekammer vorbeischlichen, tat die Klinke einen boshaften Knacks, die Tür ging auf und die Mama stand vor den Verschwörern gegen Zucht und Ordnung. Vor einer halben Stunde hatte sie die Mademoiselle beim Briefeschreiben erwischt und hatte sich sogleich, Übles ahnend, auf die Suche nach Otto gemacht.
Da stand er nun in seiner schwarzbraunen Glasur vor ihr und die schlimmste Ahnung war übertroffen. Vier Augen blickten ängstliche Erwartung. Nichts war so schrecklich, als wenn die Mama die Lippen schmal machte und ihr schönes Gesicht ganz regungslos wurde. In diesem Schweigen härtete sich ihr Blick zu etwas ganz Kaltem und Spitzem. Man fühlte sich auf den Hintergrund der Dinge fest genagelt; so mochte es einem Käfer zumute sein, der, aus einer Betäubung erwachend, sich in eine Sammlung gespießt findet.
Frau Wilhelmine Luise schob ihre Hand vor, als wehre sie etwas Unreines ab. Diese kleine Bewegung zeigte dem Verstocktesten seine Abscheulichkeit, sie enthüllte den ganzen Abgrund zwischen ihm und dieser Frau. Wo Wilhelmine Luise geborene Mencken stand, erglänzte der Adel der Sauberkeit, Ordnung, Wohlgezogenheit und Gesittung.
»Geh auf dein Zimmer und verwandle dich wieder in einen Menschen,« sagte sie mit ihrer weichen Stimme, deren Gesang auch durch den Ernst des Tadels nicht zersetzt wurde: »ich hoffe, du fühlst es wenigstens, wie weit du in diesem Zustand davon entfernt bist, Anspruch auf diesen Namen zu haben.«
Während der Verurteilte davonschlich, versuchte der Herr Rittmeister zu retten, was zu retten war: »Da steckt doch auch wieder dieser Karl Brand dahinter. Sie sind auf Faßdauben gelaufen …«
Wilhelmine Luise schob wieder die Hand vor: »Ich weiß es, Ferdinand … ich weiß es. Es ist nur bedauerlich, daß Otto diesen Hang überhaupt hat, und es wird darüber nachzudenken sein, wie dem abgeholfen werden könnte.«
Otto und Bernhard standen am Fenster und sahen die Schlitten kommen. Graf Wartensleben auf Schwirsen war wie immer der erste Gast. Er war vornehm genug, um es nicht nötig zu haben, durch Unpünktlichkeit noch vornehmer erscheinen zu wollen.
Es war ein lustiges Ding, weit hinten aus der Dunkelheit das feine Klingeln der Schlitten zu hören. Es war, als sei etwas vom Weihnachtsläuten zurückgeblieben und als schüttle es der Winter jetzt in Faschingszeiten aus seinen Falten, damit er sich gegen den Frühling hin von aller Sanftheit befreie. Die Schlitten säten das dünne Klingeln in die Finsternis, und aus jedem Ton wuchs in unbegreiflicher Schnelligkeit ein ganzer Schellenbaum. Ottos Phantasie wanderte immer weiter: so ein Schellenbaum war ein Wintergewächs, er schoß aus dem hingeworfenen Klangsamen auf den Landstraßen in einer Minute empor; aber er wurzelte nicht im Boden wie andere Bäume, sondern glitt auf Faßdauben mit der Geschwindigkeit eines Schlittens durch die Nacht.
Wenn er aber vor das Haus kam, dorthin, wo die Laternen das Dunkel mit gelben Strahlen gitterten, dann verschwand der Schellenbaum mit einem Ruck, und nur der Schlitten war da, in dem ein Wühlen und Ausschälen begann. Auch das war lustig, wenn die Diener vorsprangen, und es war fast wie eine Rauferei anzusehen, wenn sie an den schweren Pelzen zogen und in sie hineinstießen, bis dann endlich Männlein oder Weiblein als ein Kern zum Vorschein kam, der oft in gar keinem Verhältnis zur Hülle stand.
»Das ist Schötteritz,« sagte Otto, »da wird's lustig.«
Bernhard zog Falten des Bedenkens auf: »Ob sie dich heute hinunter lassen?« Seinem schwereren Gemüt war der wilde Tatendrang des Bruders nicht ganz geheuer.
Otto schwieg, ihm war weh zu Mut; die unglückliche Liebe zu seiner schönen Mama ätzte sein Herz.
Aber unten hatten sie sich nach dem Jungen erkundigt; Schötteritz hatte seine Frage hinausgeknallt, man konnte ihm nicht entgegenhalten, daß Otto wegen Hanges zur Crapule und Unsauberkeit eigentlich Zimmerarrest verdient hatte.
So wurden denn Bernhard, der in Gefahr gewesen war, aus strategischen Gründen Ottos Schicksal zu teilen, und der Verbrecher selbst von oben geholt. Die Kleiderrechen zu beiden Seiten des ziegelsteingepflasterten Hausflurs waren bereits voll von Capes, Mänteln und neckischen Hüten, Dingen, die man überflüssiger Weise unter den Schlittenpelzen mitgebracht hatte, nur um zu zeigen, daß man hinter Berlin nicht zurückstand. Man wußte, die Hausfrau hatte einen kritischen Blick für Toiletten und hielt etwas darauf, daß man auch auf dem Land nicht seinen äußeren Menschen vergaß. Es roch nach allerlei feinen und sprühenden Essenzen, und wenn die Tür geöffnet wurde, brachte die kalte Luft ganze Wolken von Duft in Wallung.
»Da seid ihr ja,« schrie Schötteritz, »Jungens, laßt euch ansehen. Gewachsen, Donnerschlag … beinahe ein Kopf, Otto … du wirst ein Mordskerl … das gibt Soldaten, Ferdinand. Rote Wangen, das ist brav … Bernhard, du siehst mir zu käsig aus … du hockst Stuben … das gibt's nicht. Schmeiß die Bücher in die Ecke.«
»Ich bin mit Bernhard recht zufrieden,« sagte die Hausfrau mit Bedeutung.
»Liebste, Beste, nur keine Musterknaben! Musterknaben bringen die Welt um keinen Schritt weiter. Musterknaben kommen mir immer vor wie Eichhörnchen, sie drehen den ganzen Tag unverdrossen ihr Rad, aber am Ende sind sie müde, und vollbracht ist nichts.«
Herr von Puttkamer auf Pansin erhob, seine sanfte Stimme: »Ich finde, wir haben schon zu viel Genies, Europa wird ihnen sogar zu klein, man hört, daß manche von ihnen andere Schauplätze aufsuchen müssen.«
Das war ein böser Stoß gegen Schötteritz, denn man wußte, daß mit dessen Sohn etwas nicht stimmte. Vor ein paar Monaten hatte der Junge Deutschland verlassen und war nach Amerika gegangen.
Schötteritz preßte sich gegen den weißen, heißen Kachelofen, man sah, wie er ausholte, um den kleinen, frommen Puttkamer in Grund zu schmettern.
Die Hausfrau überblickte die Situation: »Zu Tisch, meine Herren, zu Tisch.«
Man schob sich sogleich in den dreifenstrigen Saal, wo eine lange Tafel mit Silber und Damast das Licht in ein glitzerndes Bett fing. Alle anderen Teile der Stube leuchteten nur durch einen gelblichen Rauch, das ganze Haus schien seine Helligkeit jetzt auf diesem festen, jedem Gewicht gewachsenen Tisch zu sammeln. Wie die großen, blonden, lachenden Menschen jetzt lärmend ihre Plätze einnahmen, ging ein Atem von Lustigkeit und Essensfreude über sie hin. Ein Geschlecht von Soldaten und Bauern setzte sich zu Tisch, die Fäuste lagen wie Klötze zwischen den feinen Gläsern, die Hausfrau zog die Mundwinkel etwas herab, bei aller Taktfestigkeit ein wenig haltlos in diesem fremden Element.
»Immer was Neues schaffen,« sagte Bülow-Cummerow in das aufsteigende Geklapper der Essenshantierung, »man muß immer was Neues schaffen, lieber Puttkamer, darin hat Schötteritz recht.«
»Was ist Ihr Neuestes?« fragte Thadden, indem er die Schüssel mit Schleien, die der Diener ihm zum Ohr hielt, zu bequemerem Dreinfahren niederdrückte.
»Ich schreibe eben an einer Broschüre über die Notwendigkeit einer Organisation unseres Kreditwesens. Wir sind ja unter uns! Woran fehlt es uns? … Greifen wir uns ans Herz oder besser an die Brusttasche, denn sie ist der Sitz unseres Übels. Wer in seinem Kreise kräftig wirken will, muß Shakespeares Rat befolgen: ›Tu Geld in deinen Beutel.‹ Die Welt ist auf alle Fälle aus den Fugen, meine Herren, wir dürfen nicht daran denken, Überwundenes wieder einzurenken, das Abgetane zu beleben. Die Erinnerungen und die Tradition sind etwas Wunderbares; wehe uns, wenn wir vergäßen, daß wir Enkel sind. Aus diesem Zusammenhang mit den Geschlechtern vor uns fließt unsere beste Kraft; das ist unser innerer Halt, zu wissen, daß wir Tüchtiges leisten müssen, wir selbst, weil es unsere Erinnerungen von uns verlangen. Aber –«
Graf Wartensleben hob warnend seine Gabel, ließ seine klugen Augen blinken: »Aha, aber –!«
»Ja, es geht eben nicht mehr an, sich auf seine Erinnerungen zu berufen. Stärker als das Band der Abstammung ist das Band des Berufes. Wir gehören zusammen, meine Herren, nicht weil wir Adelige sind, sondern weil wir Grundbesitzer sind. Diese neue Zeit gibt weniger darauf, woher du kommst, als vielmehr darauf, was du tust. Man muß oben wieder Rücksicht auf uns nehmen, die Bürokratie muß aufhören, die erste Geige zu spielen, unsere Bedürfnisse müssen Preußen seinen Kurs geben. Es kommt soviel Neues in die Landwirtschaft, Anpassen ist die neue Parole, aber dazu gehört Geld. Wir gehen zum Juden, wenn wir Geld brauchen, und ich sehe die Zeit kommen, wo so irgendein Morgenschweiß einen von uns abschlachtet und sich mitten zwischen uns setzt. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Was die Kaufleute machen, müssen wir auch tun, uns vereinigen. Der einzelne ist heutigen Tages verloren; ich denke daran, eine Bank ins Leben zu rufen, eine pommersche ritterschaftliche Bank, in Stettin meinetwegen, die uns Kredit gewährt, damit wir Meliorationen vornehmen, damit wir mitkönnen. Wer stehen bleibt, ist verloren.«
Von der Osten lehnte sich zurück, schnaufte und sah kummervoll gen Himmel: »Kurz, Reformen, Reformen, Reformen!«
Dieser quecksilberne Bülow, der seine Gedanken wie ungesattelte Pferde ritt, wurde in seinem Kreis mit einigem Mißtrauen angesehen. Obzwar man nicht verkannte, daß er das Beste wollte, war aus seiner Vergangenheit etwas zurückgeblieben, das irgendwie an Mimen erinnerte. Schon daß er die Worte so rasch zu setzen verstand, machte ihn verdächtig. Verdächtig machte ihn, daß er seine Gedanken niederschrieb. In der Generation, die ihn umgab und deren Schwerpunkt im verflossenen Jahrhundert lag, war er der einzige, der sich mit dem Gegenwärtigen auseinanderzusetzen versuchte. Er trug einen Radmantel, so ein modisches und der Freisinnigkeit nahestehendes Kleidungsstück, und man sah ihn an, als ob er unter diesem Mantel vielleicht eine Konterbande von Ideen einschmuggeln wolle. Seine Vergangenheit, in der manches noch undurchforscht geblieben war und in der er sich diese Weltgewandtheit geholt hatte, glich einem der bunten Kinderkasten. Man konnte einmal unversehens an eine Feder drücken, und der Teufel des Liberalismus sprang heraus.
Otto, der mit Bernhard bei dem jungen Geflügel am unteren Ende der Tafel saß, schaute Bülow scharf an. Es kam bei ihm manchmal vor, daß er einen Menschen in einen Blick einspannte und daß dieser Mensch dann gleichsam ganz merkwürdig erhellt wurde. Otto sah ihn dann an, als ob er zum erstenmal vor ihm stünde. Jetzt fand er, daß der Sprecher ein feines, scharfes Gesicht hatte, hinter dem eine zitternde, unruhige Flamme brannte.
Etwas Weiches hopste in Ottos Augen; der junge von der Marwitz, Page am Hofe Seiner Majestät, der auf Urlaub daheim war, hatte in der Pause vor der Bratenschüssel aus seiner Serviette eine Maus verfertigt. Aus einem walzenförmigen Leib lugten zwei Ohren, hinten wedelte ein langer Schwanz. Das Ding sprang von Ottos Gesicht ab und gerade in Fräulein von Schötteritz' Schoß, die mit einem kleinen Schrei auffuhr. Sogleich duckte sich die ganze Schar zusammen, in einem Gefühl von Gemeinsamkeit, als eine im Augenblick zusammengerottete Bande von Verschwörern gegen die Langeweile.
Man ließ von den Reformen aber nicht so rasch ab. Das Thema reichte bis über den Braten hinaus. Bülow kochte Preußen und Österreich und ganz Europa an seinem neuen Feuer.
Auf des Hausherrn breitem Gesicht schmunzelte schon lange eine kleine Bosheit. »Lieber,« sagte er, »das Reformieren will verstanden werden. Da müssen Sie erst mal eine Schule errichten, sonst reformiert die ganze Welt darauf los, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Meine Frau hat auch das Reformieren im Blut. Aber im vorigen Sommer hat sie mich eine Drainage in meine Zampelwiesen hineinreformiert, die hat mich bis jetzt bloß dat Jeld aus meine Tasche abjeleitet.«
Es war Otto schmerzlich anzusehen, wie sich seine Mama mit schmalen Lippen und kalten Augen über diese Worte erhob. Wenn er auch faßte, daß der Vater damit bloß eine Niederlage vergalt, so stand er in diesem Augenblick doch bei seiner Mutter. Es war nur ganz in der Ordnung, daß ein Junge, der sich im Morast gewälzt hatte, seine Strafe bekam. Langsam suchte er die Frauen der Tafel ab und fand, daß seine Mutter die schönste war. Sie strahlte etwas Unsagbares aus, einen Adel, den die anderen nicht zu haben schienen und der sich gerade jetzt wie ein lichter Schein bewährte, als alles über die bekannten vergeblichen Bemühungen der Frau Rittmeisterin lachte.
Nach der Kompottschüssel fiel es Dewitz ein, daß er einen Brief von Major von Lützow erhalten habe und daß er einen Gruß an den Hausherrn bestellen solle.
»Geht's ihm gut? Ist er gesund? Das freut mir,« sagte der Rittmeister.
»Der dankt Ihnen ja sein Leben,« sagte das bleichsüchtige, pergamentfarbene Fräulein von Schötteritz und sah den Hausherrn verehrungsvoll an. In ihrer armen, trüben Seele, die in dem schwächlichen Leib nur ungern Aufenthalt genommen zu haben schien, brannte eine süße Andacht zu allem Heldischen.
»Ach was, Leben,« sagte der Rittmeister und wischte den Apfelsaft aus den Mundwinkeln, »das war in der Zeit, wo das Leben keinen großen Wert hatte, da braucht man kein Aufhebens darum zu machen.«
Man wußte, daß der Rittmeister im bösen Jahre 1809 den Major gerettet hatte. Der Schwerverwundete war von einem Vetter Bismarcks über die Elbe gebracht worden, der Rittmeister hatte ihn aufgenommen, verborgen und gepflegt. So hatte er in seinem kleinen Kreise der großen Zeit gedient, indem er der schweren Hand Napoleons Widerstand leistete und furchtlos Treue hielt.
Wenn die Sprache auf diese Zeiten kam, dann war es, als wüchsen diese Menschen auf ihren Plätzen und als würden sie in den Schultern breiter. Es waren die Schultern von Lastträgern, denen eine bittere Zeit unerhörtes Gewicht aufgeladen hatte, bis sie stöhnend und mit blutunterlaufenen Augen zusammenzubrechen drohten. Aber gerade da war es über sie gekommen, daß sie ihrer Kraft doch bloß die Richtung zu ändern brauchten, um Leid und Schmach zu wenden. In ihrem langsamen und wetterfesten Hirn war eine gefährliche Brunst von Freiheit aufgeglüht, und es gab nicht wenige unter ihnen, denen diese Freiheit wichtiger erschienen war, als das bisher höchste ihrer Gesetze, der Gehorsam gegen den König. Es gab fast in jedem dieser Geschlechter den einen oder anderen, der irgendwie auf eigene Faust Kleinkrieg geführt oder das Vaterland verlassen hatte, um in russischen Diensten gegen den Franzosen fechten zu dürfen. Der Begriff der Freiheit, wie er in diesen Köpfen Gestalt annahm, hatte nichts Spitzfindiges und Advokatisches, wie die Liberté der französischen Nation, sondern nahm aus Urzeiten dieser Geschlechter, aus dem wilden germanischen und wendischen Blut die Lust am Dreinschlagen an sich, straffte sich mit zähneknirschendem, hartem, zähem Zorn. Diese Zeit war noch nicht so fern, daß nicht in jedem Haus noch eine Lücke gewesen wäre, wo Unersetzliches fehlte. Es gab Plätze, die man leer ließ, weil einst liebe Menschen auf ihnen gesessen hatten. In den Kasten verkrochen sich leere Schatullen, die einst feine und zärtlich behütete Schmuckstücke verwahrt hatten. In den Rechnungsbüchern gab es leere Seiten, die sich nicht füllen wollten, während gegenüber die Zahlen wuchsen, die Abhängigkeit und Entbehrungen bedeuteten.
Alles das drückte sich in solchen Augenblicken auf den Mienen dieser Menschen aus, mit solcher Schärfe, daß alles Unterscheidende beinahe verwischt wurde und etwas Verwandtes auf die Gesichter aller trat, als gehörten sie zu einer einzigen Familie. Jeder von ihnen hatte eine beschämende Erinnerung, neben vielen erhebenden, die ihm das Gefühl hinterließ, als sei noch etwas Ungesühntes vorhanden, dessen Wucht nur verschmolzen zu werden brauchte, um noch einmal und noch gewaltiger gegen den Feind loszubrechen. Für Ferdinand von Bismarck war es die Erinnerung an den Tag, an dem ihm die Soldaten beinahe sein junges Weib vergewaltigt hatten, und an die Nacht, die er mit den Bauern und dem Pfarrer im Schönhausener Wald verborgen liegen mußte, während die Franzosen in Dorf und Schloß plünderten.
So wollte er nichts davon hören, als der junge Marwitz von Theodor Körner sprach und von der Einsegnung der Lützower zu Schönhausen. Er würgte noch an der bösen Erinnerung und überhörte die Aufforderung, zu erzählen. Erst als man den Rotgesiegelten brachte und Schötteritz ihm die Hand auf die Schulter legte, rüttelte er sich zurecht.
»Erzähle, Ferdinand,« sagte Schötteritz, »so was darf nicht vergessen werden. Man sollte aus diesen alten Geschichten eine zweite Bibel machen, und am Sonntag sollte der Pastor neben dem Stück aus der seinigen immer eines aus der unsrigen vorlesen, damit das Gedächtnis nicht vergehe.«
Ferdinand sah nach seiner Frau hinüber. Wilhelmine Luise blickte unentwegt vor sich auf das Tischtuch, als ob sie an allem keinen Anteil hätte. Er zerdrückte mit der Faust ein Brotmännlein, das seine Finger während der letzten nachdenklichen Minuten gebildet hatten.
Im Mai 1813 war es gewesen. In ganz Deutschland Waffengerassel und Hörner. Der Lützow war wieder voran und der Jahn: zwei Sturmvögel. In Schönhausen beißen sie sich fest, da muß man den Elbübergang decken. Und das Volk rechts von der Elbe muß wissen, daß man da ist, wenn einer zu den Waffen greifen will. Der Major und Jahn wohnen im Herrenhaus. Der Jahn hat den Kopf voll von seiner Turnerei, Turnerei zum Frühstück, zu Mittag, zum Abendbrot, Turnerei bis Mitternacht, wenn man beim Wein beisammen sitzt. Eine Menge junger Leute kommen an, die fechten wollen. Der Lützow lächelt und bringt ihnen Gewehrgriffe bei, der Jahn läßt sie laufen und springen. Immer neue Rekruten kommen, manchmal in ganz seltsamen Verkleidungen, als Hausierer, als Kutscher, als Viehhändler, einmal sogar einer in Weiberröcken. Unter Leibes- und Lebensgefahr haben sie sich durch das napoleonische Deutschland durchgeschlagen, aus Bayern, aus Österreich. Wenn sie nicht exerzieren, so lernen sie ihre Geheimschrift. Die besteht aus einem Gekrakel von Punkten, Kreisen und Haken, ganz wie bei den Indianern. Sie haben Zeichen für Straße und Wald und Fluß und Brücke, für Feind und Freund, für Entfernung, Zeit und Zahl. Das malen sie auf die Stadttore und auf die Scheunen. Wenn's einer sieht, der's nicht versteht, so meint er, die Buben hätten Langeweile gehabt und sinnloses Geschmier betrieben. Der Lützower aber weiß, da drüben im Dorf sind fünfundzwanzig der Unsern, und der und der ist mit dabei, und der Feind steckt drüben, jenseits des Flusses im Busch. Wenn sie nicht exerzieren und nicht Geheimschrift lernen, so lesen sie in den Büchern, die fast ein jeder im Mantelsack stecken hat, oder sie singen neue Gedichte. Die macht einer, der in Schönhausen beim Pfarrer wohnt. Der Pastor ist damals in jener Herbstnacht kleinmütig geworden. Er schreibt ins Kirchenbuch: Wer soll uns in dieser argen Zeit helfen, wo alles zerfällt? Aber sein Gast schreibt darunter ein Manneswort: Wir selbst, wenn wir Männer sind. Und zeichnet seinen Namen ein: Theodor Körner. Er hat seinen jungen Ruhm verlassen und seine junge Braut und sein Glück auf Deutschlands Karten gesetzt. Die Schar wächst, und geheime Boten kommen und gehen. Es heißt, die Lützower müssen nach Sachsen. Das ganze Korps rückt zusammen, in der Dorfkirche schwören die Rekruten auf die Fahnen. Der Pfarrer hält eine kurze Rede. Alle wissen, um was es geht. Pardon wird nicht gegeben und nicht genommen. Ein Bund der Rache ist unter den Lützowern. Der hat in der Kirche zu Grochow geschworen, den Napoleon zu fassen, lebendig oder tot. Da ist ein Gift in den Krieg gekommen. Die Wildesten haben dreißig Franzosen gefangen, furchtbar verstümmelt und dann davon gejagt. Die Franzosen aber haben zweiundzwanzig Lützower mit den Füßen nach oben an Bäumen gebunden, unter ihren Köpfen Feuer gemacht und sie langsam gebraten. Das Gift frißt nun weiter. Alle wissen das, aber alle haben helle Augen, und in keinem Gesicht steht Furcht. Nie zuvor und nie nachher hat die Orgel eine solche Stimme gehabt wie damals. Sie singen ein Lutherlied. Die Sonne scheint in die Kirche, und die Kirchenstühle sind wie aus Gold. An den Wänden stehen die Grabsteine der Bismarcks, und zwischen ihnen schwört die Jugend Treue und Rache, dann singen sie noch ein Lied, das ist von Körner, und der Dichter ist der einzige, der nicht mitsingt. Lützow und Jahn stehen mitten unter den Ihren. Jahns Brust arbeitet wie ein Blasebalg, und dann kommt es langsam und zögernd naß aus seinen Augen, tropft schwer auf den Rock …
Als der Rittmeister mit seiner kunstlosen Erzählung zu Ende war, räusperte man sich ein wenig, aber niemand sagte etwas. Die Hausfrau erhob sich, meinte, daß man die Herren allein lassen sollte, und befahl, daß die Kinder zu Bett gebracht würden.
Schötteritz fing Otto, als er auf seinem Rundgang um den Tisch zu ihm kam, am Arm und zog ihn zwischen seine Knie. Er schaute ihm so seltsam eindringlich in die Augen, daß dem Jungen ein Stechen durch die Brust ging. »Ferdinand,« sagte er dann, indem er sein knolliges Gesicht dem Freund zuwandte, »es ist mir, als sähe der Junge jemandem andern beinahe noch ähnlicher als dir. Heute weiß ich es: er hat ganz seines Onkels Gesicht, des Leopold, der bei Möckern gefallen ist.« –
Die Damen begaben sich in die Gartenstube, wo man auf den kleinen Tischchen Konfekt und süßen Wein vorfand.
»Aus Berlin? Von Josty?« fragte Frau von der Osten, indem sie eines der kleinen rosaroten Plätzchen vor den Mund hielt, das eine Taube mit einem Briefchen im Schnabel vorstellte. Und als habe sie die Bejahung der Frage abgewartet, um das süße Ding mit doppeltem Genuß zu verzehren, schob sie es auf das Kopfnicken der Hausfrau zwischen die hübschen, weißen Zähne.
Die Frau Rittmeisterin bat, man möge es ihr zugute halten, daß alles so einfach sei. Sie wisse recht gut, daß dieses Meublement keineswegs dem modernen Geschmack entspreche; aber man habe es eben so vorgefunden und müsse sich vorderhand darnach einzurichten versuchen, bis die Zeiten besser würden. Mit einem geringschätzigen Blick strich sie über den Raum hin, über den gedielten, schon etwas ausgetretenen Boden, die fleckigen Tapeten, die weißen Kachelöfen, die messingbeschlagenen Flügeltüren und die buntüberzogenen Rohrmöbel.
Man war daran gewöhnt, daß Wilhelmine Luise jedesmal, wenn sie Gäste empfing, dieselbe Entschuldigung vorbrachte.
Vielleicht würden die Zeiten besser, meinte Frau von Schötteritz, wenn einmal die pommersche ritterschaftliche Bank von Stettin im Gange sei.
Frau von Bülow war empfindlich und wollte die Ideen des bewunderten Gatten nicht verunglimpfen lassen. Man sollte doch zufrieden sein, wenn sich jemand fände, der für sie alle dächte, und die Früchte seiner Arbeit würden schon ihnen allen zugute kommen.
»Friederike, geh vom Fenster fort,« rief Frau von Schötteritz, ohne der empfindsamen Sekundantin weiter Rede zu stehen, »es zieht vielleicht und du erkältest dich wieder.«
Das bleichsüchtige Mädchen, das am Fenster in die Winternacht Heldengestalten geträumt hatte, kam gehorsam zum Tisch und begann mit spitzen, durchscheinenden Fingern im Konfektkörbchen zu stöbern.
»Achott ja,« seufzte die Schötteritz, »mit den Kindern! Sehen Sie sich mal das Ding an. Immer vierzehn Tage Regenwetter … wie die teueren Zeiten. Und wenn sie meinen Mann und mich ansehen! Und unsere Jungen! Lauter Prachtkerle. Wie kommen gerade wir zu einem solchen Grünspecht von Mädchen?«
Frau von Stötteritz war eine Kraftnatur, stämmig und immer bereit, den Teufel an den Hörnern zu fassen. Man erzählte von ihr in ganz Pommern, daß sie den Mist selbst aufs Feld fahre, in Hosen oben auf, und daß sie draußen werke wie ein Ackerknecht. Aber mit dem Gemüt schien es beschaffen wie mit ihrem Pfannkuchen. Sehr viel um und um und darin ein winziges Klümpchen Süßigkeit. Um durch die dicke, zähe Seelenhülle zu dem bischen Zartgefühl zu dringen, mußte man wohl einen guten Magen haben.
Der Grünspecht verfärbte sich bei dieser Anklage des Schicksals rot. »Mein Gott, Mama!« sagte sie und sah sich im Zimmer um wie eine Gefangene.
»Na ja!« fuhr die Mama fort, »können Sie sich vorstellen, daß dieses Mädchen Kinder kriegt? Den Storch möchte ich sehen, der das zustande bringt.«
Die Hausfrau war zu dem zitternden Kind getreten, legte den Arm um seine Schultern und neigte ihr Gesicht zu dem seinen. Sachte baumelten die schönen Korkzieherlocken, deren jede ein Glanzlicht trug, gegen die blassen Wangen. »Sie sollten etwas für Friederikes Gesundheit tun, liebe Frau von Schötteritz!« sagte sie.
»Wir leben doch auf dem Land,« posaunte die Mutter, »kann man denn Besseres für die Gesundheit tun?«
»Doch einmal den Arzt fragen!« meinte die Gräfin Wartensleben.
Frau von Puttkamer faltete die Arme, die in langen, schwarzen Garnhandschuhen steckten, über dem Magen. Diese Handschuhe gehörten zu ihr wie ihre Ohrläppchen oder ihre Nase. Man sah sie niemals mit bloßen Armen, und da sie die schwarzen Futterale auch beim Essen nicht ablegte, so liefen die abenteuerlichsten Gerüchte um, wie, daß sie eine Leichenhaut habe oder bis zum Ellenbogen tätowiert sei. Sie zwinkerte beim Sprechen mit den Augen, und das war dann, als seien ihre Blicke ein paar kleine Zuckerzangen, die sie blitzschnell auf und zu klappte, um ihr Opfer zu fassen.
»Die Ärzte,« sagte sie, »von denen darf man sich nicht zu viel erwarten. Wenn Gott einem Menschen die Kraft verleiht, so kann er Erstaunliches wirken, ohne Arzt zu sein.«
Frau von Osten nickte mit der kunstvollen Frisur, die von einem golddurchwirkten Damaststreifen turbanartig umflochten war, so wie man es in den Modeblättern von der Herzogin von Broglie in Paris sah. »Sie meinen den Mann, von dem jetzt ganz Berlin spricht. Ein Wundertäter, seine Kuren grenzen an Zauberei.«
»Er ist ein Erwählter Gottes,« bestätigte Frau von Puttkamer.
Frau von Schötteritz klatschte sich auf die Schenkel, das hörte sich an wie Peitschenknallen. »Ja, ich weiß. Er ist ein ehemaliger Pferdeknecht, namens Grube. Und seine Kuren bestehen darin, daß er den Leuten in den Mund spuckt.«
»Pfui!« entrüstete man sich.
Mit einem scharfen Zwinkern faßte die Puttkamer die Hausfrau. »Und doch muß etwas an solchen Dingen sein: Würde sonst unsere schöne und kluge Frau Rittmeisterin, deren überlegene Geistesgaben wir alle verehren, ihre Gesundheit dem Wunderdoktor Wohlfahrt anvertrauen?«
Wilhelmine Luise hielt noch immer das blasse Mädchen umschlungen. »Das ist etwas anderes,« sagte sie. »Wohlfahrt ist kein Pferdeknecht. Er ist Magnetiseur, und der Magnetismus ist eine wissenschaftliche Tatsache, keine Flunkerei.«
Frau von der Osten schob einen blaßblauen Genius, der auf einem Fuß aus dem Zuckerland herangeschwebt kam, in den Mund. »Wie ist das mit dem Magnetismus?« drängte sie, »man hört so viel davon. Sie müssen uns etwas davon erzählen.«
»Das ist wohl nur für die Eingeweihten,« kam die Gräfin Wartensleben der Hausfrau zu Hilfe.
»Es ist ein Geheimnis,« sagte die Rittmeisterin ruhig, »aber ein Geheimnis, das jeder von uns in sich verborgen trägt. Jede Seele hat ihre magnetischen Kräfte, die eine hat mehr davon, die andere weniger. Menschen, die Überfluß an magnetischen Kräften haben, können andern davon abgeben und ihnen dadurch helfen. Aber sie können auch Schaden anrichten, denn das ist das Seltsame dieser magnetischen Kraft, daß sie sowohl zum guten als zum bösen gerichtet werden kann. Es ist wohl dabei auch, wie in der Chymie, daß sich Verwandtes anzieht und Gegensätzliches abstößt. So hat man bei aller Dunkelheit der Materie doch wenigstens schon gewisse Prinzipien festgestellt. Und es ist ernsten Männern wie dem begnadeten Swedenborg, dem vortrefflichen Mesmer, wohl zuzutrauen, daß sie sich mit ihrem Thema gründlich auseinandergesetzt haben. Und ich kann aus Erfahrung sagen, daß an meinen Nerven durch Wohlfahrt sehr viel gebessert worden ist.«
Friederike sah zu der schönen Frau auf, und ihr Gesicht trug einen Ausdruck glücklicher Spannung: »Gott …« flüsterte sie, »man sagt, daß Sie hellsichtig sind.«
Wilhelmine fühlte ihre Hand von feuchten, kalten Fingern umkrampft. Sie schaute in die winterliche Finsternis, die unmittelbar vor den Fenstern begann und für das dünne Licht der Kerzen unempfindlich schien: »Bisweilen glaube ich es,« sagte sie.
Frau von Thadden, die mit einer robusten Art von Literaturbetrieb der Freundin nacheiferte, entsann sich jetzt mit einem kleinen Aufschrei des Entzückens, daß sie mitreden konnte. Sie war sehr stolz darauf, auskramen zu können, daß sie vor kurzem in irgendeinem Taschenbuch eine Erzählung gelesen habe, die sich mit den Geheimnissen des Magnetismus beschäftigte.
Mit einem kurzen Zusammenziehen der Augenbrauen sagte die Hausfrau, als sich die Leserin weder des Titels der Geschichte noch des Namens des Autors erinnerte, es müsse wohl eine Novelle des Kammergerichtsrates Hoffmann in Berlin gewesen sein.
»Kammergerichtsrat?« fragte Frau von Bülow in dem schnippischen Ton, mit dem ihres Gatten gründliche Verachtung aller Beamtenseelen weibliche Färbung angenommen hatte.
Ja, und dieser Mann sei als einer der genialsten Poeten aller Zeiten anzusehen, er habe die Nachtseiten des menschlichen Seelenlebens durchforscht und ihre geheimsten Rätsel in das Reich der Dichtung gehoben. Er gehöre schon lange zu ihren Lieblingen, und er sei es wert, der Lieblingsdichter der ganzen Nation zu werden, denn weit mehr als im Getöse des Krieges gewinne der Genius der Nation Gestalt in den Gefilden des Geistes, der Poesie, die allein das Göttliche der Menschennatur offenbaren könne. Und daß er daneben auch Kammergerichtsrat sei, sei keineswegs geeignet, ihn herabzusetzen, sondern müsse wieder nur als ein Beweis dafür angesehen werden, daß gerade in den Kreisen des Beamtenstandes, der verlästerten Bürokratie die geistige Blüte des Volkes gefunden werden müsse.
Man hörte mit einigem Erstaunen, wie die Hausfrau in dieser fast ein wenig kriegerisch gestimmten Erklärung aus ihrer kühlen Ruhe heraustrat. Gab sie damit eine Antwort auf vieles, das heute abend gesprochen worden war?
Frau von Puttkamer wagte sich zuerst wieder vor, sie nahm die schwarzen Futterale auseinander und faltete sie von neuem an derselben Stelle, als ob sie in dieser Bewegung frische Kraft in sich hineinpumpe. Da würde die Frau Rittmeisterin wohl auch für ihre beiden Söhne die Beamtenlaufbahn jeder anderen vorziehen.
Wilhelmine Luise sah zwischen ihr und Frau von Thadden hindurch in die Nacht vor den Fenstern. Man hörte nebenan ein Schieben, Klappern und Poltern, dazu ein zaghaftes Kratzen und Winseln von Saiteninstrumenten; da waren wohl die Musici angekommen, und man bereitete sich zum Tanz. Aus dem Zimmer, wo die Jugend beisammen saß, lief ein Lachen eine ganze Tonleiter hinab, und ein anderes jagte wie im Haschen hinterdrein.
»Es ist das höchste Ziel meines Lebens,« sagte die Hausfrau, »Söhne zu haben, in denen Bildung des Geistes und Herzens sich zu wahrhaftem Adel vereinigt. Das Haus meines Vaters ist mir darin ein Vorbild. Uns Frauen aber ist es verwehrt, das Höchste zu erreichen; was man uns zu lehren für gut findet, ist gerade nur dazu angetan, uns wie Mose das gelobte Land des Geistes vom Berge zu zeigen. Es weckt uns nur die Sehnsucht. Meine Söhne aber sollen im höheren Sinne zu leben lernen; ich will das Streben in ihnen erwecken, sich diese Güter des Geistes zu erwerben, sie sollen weiter in das Reich eindringen, das mir zu betreten versagt geblieben ist. Ich gehe ernstlich mit Gedanken über ihre Zukunft um; es wird Zeit, sie aus dieser Umgebung hier ins wirkliche Leben hinauszustellen. Sie sollen mir keine Soldaten oder Bauern werden.«
Nebenan tat es ein greuliches Grunzen und Quieken, als ob einem halben Dutzend Schweinen gleichzeitig die Schwänze geklemmt würden. Das war Schötteritz, der dem Baßgeiger den Bogen abgenommen hatte und einen Strich über das Instrument verübte, von dem alle Klangfurien entfesselt wurden.
Die Tür ging auf, und der Rittmeister stand da, breit, purpurn und vergnügt, ein Rotweinglas in der Hand.
»Meine Damen, der Tanz beginnt.«
Schon wallte es nebenan aus dem Familienzimmer in den Saal, Rosa, Hellblau und Weiß, Falbeln, Rüschen und Volants, Krepp, Mull und Batist. Friederike reckte den dünnen Hals aus dem dürftigen Ausschnitt. Denen drüben war alles mit vollen Händen gegeben, sie löffelte die armselige Wassersuppe des Glückes.
Die Damen begaben sich in den Saal, und der Rittmeister machte jeder von ihnen seine besondere Verbeugung. Als Frau von Puttkamer an ihm vorüberkam, blieb sie vor ihm stehen und zwinkerte heftig mit den Augen: »Lieber Rittmeister, Ihre Frau, Sie wissen ja gar nicht, was Sie an ihr haben … eine solche Frau … ich verehre sie unendlich … sogar Hellseherin ist sie, heute hat sie es uns gestanden.«
Der Rittmeister schob seinen Arm unter eines der schwarzen Futterale: »Ach, Liebe, Gute,« lachte er gemütlich, »mit Mines clairvoyance! Wat kauf ich mich dafür. Wenn die Hellseherei wat taugte, so hätte sie mich letztes Mal in Stettin vorhersagen müssen, wie es mit den Wollpreisen kommt. Ich hab' jehalten und hab' mir damit jeschnitten. Am Ende des Marktes ist die Wolle tiefer jestanden als am Anfang. Dat hätte sie mir doch sagen sollen.«
Oben lagen die Brüder in ihren Betten.
Als die Tanzmusik begann, richtete sich Otto auf; wenn man so im Dunkeln saß, so sah man, daß die Nacht keineswegs so finster war, es war genug verlorenes Licht in ihr, um an den morgigen Tag zu glauben.
»Du, Bernhard,« sagte er, »Bernhard … war die Mama nicht heute doch von allen die Schönste?«
Aber Bernhard gab keine Antwort, er schlief schon lange; da legte sich auch Otto wieder zurück, und aus dem Takte der Musik wob ihm der Schlaf eine dünne Decke.
Da gab es noch einen Frühling, einen Sommer und einen Herbst in Kniephof, und ehe der Winter schwach wurde, entschied es sich, daß auch Otto nach Berlin müsse, wohin ihm Bernhard vorangegangen war.
Schon seit dem Sommer hing das Schwert über ihm, und er wußte es seit jenem Abend, an dem der Vater so seltsam aufgeschlossen gewesen war.
Sie hatten einen Spaziergang gemacht und kehrten nun langsam und schweigend zurück, und Otto, der zuerst gemeint hatte, der Vater sei wegen des Mißlingens irgendeines landwirtschaftlichen Unternehmens bedrückt, merkte bald, daß ihn etwas anderes verstummen ließ. Die Feldbreiten wogten bis an den Horizont, längs der kleinen Wasserläufe dunkelten feuchte Wiesen, und im Kieferngehölz war ein Krächzen und Knarren von Hunderten von Dohlen, die dort ins Nachtquartier gerückt waren. Der Vater blieb am Waldrand stehen und legte die Hand an den Stamm einer Kiefer. Es war ein noch junger Baum, dessen Rinde sich nur nahe dem Boden rissig und borkig verhärtete, während sie oben noch in weichen, rötlichen Schuppen um das Mark lag.
»Fühl mal den Baum an,« sagte der Rittmeister, »spürst du, wie es drinnen auf- und niedergeht? Der Baum hat seinen Atem. Du glaubst, es ist dein Blut – aber nein, unter deiner Hand zuckt der lebende Baum, und spürst du, wie er sich in Treue und Vertrauen gegen dich stemmt? In den Büchern, die der Mama so gefallen, ist beschrieben, wie die Dichter, wenn ihnen etwas passiert, in den Wald hinausgehen, die Bäume umarmen und sich an ihnen ausweinen. Das ist weniger närrisch, als daß sie nachher hingehen und Bücher darüber schreiben. So ein Baum kann ein Freund sein, er hat seine Seele.«
Und wahrhaftig, es war vielleicht nur deshalb, weil der Papa so sprach, wie er noch niemals gesprochen hatte; aber jetzt fühlte Otto ganz deutlich, daß sich der Stamm gegen seine Hand lehnte. Wie ein Tier erwiderte der Baum die Liebkosung, beglückt durch diese Berührung einer Menschenhand. Es flutete warm durch den Arm in den Leib; und als strahle selbst von den Wurzeln durch den Boden das Glücksgefühl der Kreatur aus, so strömte es auch von unten her durch seine Sohlen und die zitternden Beine.
»Die Mama will dir nun bald nach Berlin schicken,« sagte der Rittmeister, indem er fortfuhr, den Baum zu streicheln, »du sollst ins Leben. Na jut! Und du sollst ein janz großes Tier werden. So'n Kabinettsrat, wie ihr Vater jewesen ist. Aber du sollst mir darüber nicht verjessen, daß du ein Bismarck bist! Werde ein treuer Diener deines Königs, aber merke dir, daß man uns vor zweihundertsechzig Jahren Burgstall wegjenommen hat. Dat war besser als Schönhausen, und so ist uns der König noch immer was schuldig. Und dat wissen sie auch janz jut. Und wenn der König vor jemanden Respekt hat, so sind's die Altmärker, die vier: die Schulenburg, die Knesebeck, die Alvensleben und die Bismarck.«
Es war Otto, als bestände zwischen dem, was der Vater über die Bäume, und dem, was er über die Bismarcks gesagt hatte, irgendein innerer Zusammenhang, den man nur dunkel erfassen konnte. Und er ging noch oft in diesem Sommer zu einem Baum, um die Hand an seine Rinde zu legen, und dann kam immer wieder dieses Erwachen einer schlummernden Kraft.
Er trug viel Liebe in die freundliche Welt seiner Heimat und empfing viel Liebe von ihr. Der alte Brand, der in diesem Jahr immer mehr einschnurrte, erzählte seine kuriosen Geschichten. Karl Brand aber wurde ein wenig mürrisch, als ihm Otto andeutete, daß er nun wohl bald nach Berlin müsse.
»Warte nur, ich komme schon auch nach Berlin.«
»Warum denn?« Otto faßte es nicht, daß jemand von Kniephof fort wollte, der bleiben konnte.
Aber Karl Brand war anderer Meinung: »Was du kannst, kann ich auch. Soll ich ewig hier sitzen und Schafe hüten? Berlin ist groß genug, daß ich auch noch unterkomme.«
Nach Weihnachten wurde Otto vor den fertigen Beschluß gestellt, und eine Woche später kam der große Schlitten aus dem Schuppen und pflanzte sich vor das Herrenhaus. Um die Mäuler der Pferde dampfte der Atem, der Kutscher schnürte an den Körben herum und prüfte die Knoten, denn was so ein richtiger pommerscher Landweg war, der hatte es, was Knotenlösen angeht, in sich wie weiland Alexander der Große.
Die Sonne schien den Pferden prall auf die Hinterteile, deren Haut sich faltenlos über festem Haferfleisch spannte. Während Otto schon bereit stand, war es ihm, als sähe er zum erstenmal, daß die Flecken am Schwanz des Schecken so angeordnet waren, daß sie ein richtiges Gesicht ergaben. Zwei helle Flecken als Augen, und unter einem dritten, den man ganz gut als Nase ansehen konnte, hing der Schwanz wie ein höchst merkwürdiger Schnurrbart in einer Strähne zur Erde. Und mit diesem zweiten Gesicht lachte der Schecke in den Wintermorgen hinein, während er zugleich in dem umgewandten Kopf einen Ausdruck von Verschmitztheit wies. Das war sehr lustig, und es war auch gar nicht einzusehen, warum es nicht lustig sein sollte, wenn man auf ein paar Wochen nach Berlin kam und dann wieder auf Ferien nach Haus durfte.
Und die Mama sagte: »Du darfst nicht vergessen, daß sehr viel dazu gehört, um in den Augen der Welt als gebildeter Mann zu bestehen. Das sollst du mir werden, wenn ich dich nicht zu den alltäglichen Menschen zählen soll. Ihr sollt mir hoch hinaus, ihr beiden …«
Dann kam der Vater im dicken Pelz aus dem Haus, klopfte dem Schecken auf sein zweites Gesicht, sagte etwas, das man nicht verstand, denn eben ging ein großes Summen durch die belebte und unbelebte Welt, und dabei schwang alles langsam um einen Mittelpunkt, der man selber war; die blaue Schürze, hinter der Trine Neumann heulte, drehte sich in bestimmten Zeiträumen vorbei. Man sah auch irgendwie durch alles hindurch der Mama blasses Gesicht; dann fühlte man sich zwischen viele Decken und Pelze und neben dem Papa eingekeilt, und plötzlich zog ein starker Ruck das Gesicht der Mama und Trines blaue Schürze und die vertrauten Fenster fort …
Vor der Schmiedekate stand Jochen Hildebrand und hob ein kleines Bündel hoch, in dem oben ein roter, runzeliger Apfel saß.
»Der Storch war da,« brüllte er, »ein Junge, Herr Rittmeister.«
»Zehn Stücke und ein Marsch,« brüllte der Rittmeister zurück.
Dort, wo der Landweg von der Zampel weg ins wilde Pommern strebte, kam noch ein letzter Gruß der Heimat. Ein Indianerpfeil flog über die Buschruten und blieb in den schweren Pelzfalten stecken; Otto löste einen Zettel vom Schaft: »Auf Widderseen in Berlin – Adjöh!« stand in windschiefer Keilschrift auf dem schmutzigen Papier, hinter dem Busch aber war Karl Brand auf Faßdauben zu sehen. Raketengleich flog ihm die Mütze aus den Händen hoch in die Luft, die herunterwirbelnde fing er kunstgerecht mit dem Kopf auf. Das war die Abschiedsvorstellung zu Ehren Ottos.
Der Papa hatte eine stille Zeit; nur wenn sie der pommerische Landweg aus einer Furche in die andere warf und sie gegeneinander stießen, sagte er: »Öha!« oder »Na na!« Es fiel ihm nicht ein, die Fahrt zu guten Lehren auszunützen, und es war offenbar, daß er seinen Abschied schon an jenem Abend im Sommer genommen hatte.
So kam man nach Gollnow, wo der Scheck und der Fuchs mitsamt Kutscher und Schlitten verabschiedet wurden, fuhr dann mit einem Schiffer auf einer schmutzigen Plätte die Ihna hinunter und dort, wo die Oder ihr übermütiges Maul aufzureißen begann, zwischen weißblauen Eisschollen auf einem Fischerboot nach der Stadt, wo sie das Wollenwetter machten. Es war, als hafte die engere Heimat noch immer zähe an den Sohlen, und auch als man auf die Schnellpost übergegangen war, zeigte sich keine Änderung im Takt. Jedes Wirtshaus am Wege war ein Magnetberg, vor dem es kein Entrinnen gab, und jedes hatte seine Besonderheit an weißen, roten oder grünen Schnäpsen, an denen ein Postillon, der etwas auf sich hielt, nicht vorüberfahren konnte.
Pommern schwand erst dahinten am Horizont weg, als man in Berlin war. Zuerst schien es freilich, als habe man auch hier dafür gesorgt, daß den Kniephofern nicht bange werde; denn die Straßen glichen mit ihren Pfützen und zerfahrenen Gleisen den Dorfstraßen der Heimat, und als der Post, die unter Schwanken und Tuten die Linden entlang fuhr, eine Herde von Kühen entgegenkam, da bimmelte gleich die ganze Zampelwiesenerinnerung in heller Fröhlichkeit. Dann aber kamen sie an der Königswache vorbei und sahen links und rechts je ein in Fetzen vermummtes Gespenst stehen, dem Otto keine Deutung wußte.
Der Postillon aber wußte sie: »Det sind die Herren Bülow und Scharnhorst, in Marmor ausjehauen, von Monsieur Rauch, die demnächst enthüllt werden sollen.«
Und als sie über den Gendarmenmarkt knatterten, zeigte der Postillon mit der Peitsche auf ein Gebäude, das so feierlich aussah wie eine Sonntagspredigt, und sagte: »Und det is das neue Schauspielhaus, erbaut vom Monsieur Schinkel an Stelle von det alte, wo abjebrannt is.«
Da kam Otto ganz aus Hintergründen ein Erinnern an Flammen und sprühendes Feuerwerk, und nun war es irgendwie entschieden, daß man nicht in Pommern war, sondern in Berlin.
Nicht lange, so war man vor dem Tor von Plamanns Lehranstalt, und Bernhard war da, half dem Vater aus dem Pelz, küßte seine Hand und umarmte den Bruder mit einem etwas erkältenden Ton von Wohlerzogenheit.
Im Flur, in dessen Steinboden mit kleineren farbigen Würfelchen nahe der Tür ein etwas absonderliches Bild von einem Hundevieh und die Worte Cave canem ausgelegt waren, kam ihnen ein kleines Männchen entgegen. Er machte immer drei Schritte und verbeugte sich dann händereibend: »Herr Rittmeister … hohe Ehre … Ihr Besuch ehrt mich in der Tat. Ich bin ungemein erfreut. Da haben wir also unseren neuen discipulus. Wollen uns schon Mühe geben, wird wohl seinem Bruder nicht nachstehen. Um es gleich vorweg zu nehmen, Herr Rittmeister, wir sind zufrieden … können beruhigt sein. Wird sich noch ganz zu Ihrer Freude entwickeln.«
Bei jeder Verbeugung glitzerte eine blanke Glatze im einfallenden Licht. Otto hatte den tollen Gedanken, man brauchte diesen Schädel nur mit den Erdteilen zu bemalen und mit Kreisen zu umspannen, um an ihm Länderkunde studieren zu können wie an dem Kniephofer Globus.
Das Männchen führte die Gäste unter Verbeugungen ins erste Stockwerk und ließ sie durch eine Tür mit der Aufschrift »Schulleitung« eintreten.
»Unser Rex ist famos, nicht?« flüsterte Bernhard.
Das Zimmer war kahl und ungeheizt; da es draußen wärmer geworden war, strömten die Wände die aufgespeicherte Kälte doppelt unangenehm aus, und das Unbehagen steigerte sich, wenn man den Kachelofen ansah, der trostlos und seine Überflüssigkeit betrauernd in der Ecke stand.
Der Leiter dieser Anstalt hatte ein dickes, in Leder gebundenes Buch mit abgegriffenen Ecken aus einer Tischlade genommen und aufgeschlagen. »Wollen doch gleich einmal die Personalia feststellen …«, sagte er, »… also Herr Otto von Bismarck, ehelicher Sohn des Herrn Rittmeisters Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck und der Frau Wilhelmine Luise geborene Mencken, geboren am 1. April 1815 in Schönhausen in der Altmark. Etcetera. Das habe ich schon vorher eingetragen. Nun die Vorkenntnisse.« Er stützte den Federkiel mit der Spitze gegen die von vielen Tintenklecksen befleckte Tischplatte und sah aus wie der Gott der Erwartung.
»Nun: Schreiben und Lesen … ja wohl. Sehr gut.« Er schrieb, zog die Augenbrauen hoch und spießte die Feder wieder gegen den Tisch. »Weiter: Zeichnen? Ach ja, habe ja die Blätter gesehen, die der Herr Bruder erhalten hat. Mit Talent und Geschmack gemacht. Französisch? Auch französisch … Bravo! Ausgezeichnet!« Er hüpfte auf seinen Stuhl, als sei ihm persönlich etwas Freudiges widerfahren. Er trug das vorhandene Wissen ein, schielte mit schiefgelegtem Kopf nach dem Blatt, legte dann das Löschpapier ein und klappte das Buch zu.
Dann schlug er die Hände mit einem lauten Knall zusammen und begann sie sogleich wieder zu reiben: »Da wollen wir schon etwas aus ihm machen. Ein guter Grund scheint vorhanden.«
Der Papa ergriff das Wort und fragte, ob er mit seinen Söhnen den Rest des Tages und den Abend außerhalb verbringen könne.
»Aber gewiß, gewiß,« buckelte das Männlein, »wollen nur den jungen Herrn erst behaglich einrichten. Christian! Christian! Herrn Otto von Bismarck auf Zimmer C.«
Der Diener, der schon unten bei dem Mosaikhund die Sachen übernommen hatte, erschien und führte Otto in ein Zimmer, von dem der neue Zögling vorläufig keinen anderen Eindruck hatte, als daß es ebenso kahl sei als das des Herrn Rektors. Er kam an einer Gruppe von Schülern vorbei, die ihre Köpfe zusammenschoben. Er fühlte, daß ihm etwas wie feindselige Neugierde entgegenschlug.
Dann ging er mit Bernhard und dem Vater fort, ein wenig durch die Straßen der Stadt; sie speisten in einer Gastwirtschaft, deren Wände in pompejanischem Rot gehalten waren und deren Kellner blaue Röcke mit silbernen Knöpfen trugen.
Dieser Abend zog sich müde und schleppend hin wie die Zampel, wo sie im Sumpf verläuft, und obwohl Otto wußte, daß mit dem Vater das letzte Stück lebendiger Heimat wegging, der Mensch, der ebenso lange wie er selbst die Luft von Kniephof geatmet hatte, wünschte er doch, es wäre schon zu Ende.
Als es dann aber wirklich so weit war und der Vater vor Plamanns Haus seine Stirn mit einem festen, kurzen Kuß berührte, während der Diener mit der Laterne mürrisch im geöffneten Tor stand, da sah er doch in die Zukunft wie in ein weites, leeres Rohr, und es war ihm, als müsse er sich an dieses Stück Heimat klammern.
Dann war alles aus. Der Diener schloß das Tor und schritt mit der Laterne die Treppe voran. Bernhard zog den Bruder hinten am Rock: »Otto, ich muß dir was sagen. Du mußt dich …« Aber es kam nicht dazu, daß Otto erfuhr, was ihm Bernhard zu sagen habe, denn der Diener öffnete mit einem strengen Gesicht, das jedes Flüstern verwies, einen schmalen Flügel der weißlackierten Tür.
Ein winziges Flämmchen brannte hinter rotem Glas an der Wand. Sogleich fuhren aus einigen der zehn Bettstellen, die den Raum so ausfüllten, wie die Zellen eine Honigwabe, ein paar Köpfe hoch, und eine scharfe Musterung begann. Niemand sprach, denn die Hausordnung verlangte nach neun Uhr abends unbedingtes Schweigen. Otto hatte auch keineswegs Lust, heute noch Bekanntschaften anzuknüpfen; er hätte nur gerne gewußt, was ihm Bernhard mitzuteilen habe; denn dieser fuhr so seltsam mit den Händen herum und zwinkerte so voll Bedeutung mit den Augen, daß es schien, er wolle dem Bruder geheime Zeichen machen.
Das Bett war wie ein Brett, das Polster nahm keinen Eindruck an, das Ganze war wie eine Einleitung in die Härte des Lebens.
Otto versuchte im Gebet an Gott heranzukommen. Er stellte sich alles recht genau vor, den Vater, die Mama mit den Locken, die Schmiede, Karl Brand, den Teich im Park, Trine Neumann, den Sandstein-Herkules, dem er unlängst eine Ladung Schrot in das Hinterteil geschossen hatte, den Schecken mit den zwei Gesichtern, und über alles das stülpte er sein Gebet wie eine Glasglocke. Zum Schutz, daß er alles so wiederfände, wie er es verlassen hatte.
Er hörte ein Flüstern: »Paß auf, was du träumst,« sagte jemand.
Als er einschlief, wiederholte sich ihm dumpf der Eindruck, er sei in eine enge Zelle gebettet, die mit anderen in eine Wabe gereiht war, und das Ganze bebe von Summen wie ein richtiger Bienenstock.
Es sollte sich zeigen, daß wirklich ein recht böses Bienenvolk aus den Zellen schwärmen könne, Bienen mit giftigen Stacheln.
Otto erwachte jäh, etwas war auf ihn niedergestürzt, sein Gesicht war verhüllt, der Hals eingeschnürt, es regnete Prügel. Seine Hände waren in die Finsternis geschraubt, seine Füße steckten in Flammen.
Der erste Gedanke war, des alten Brand Nachtmahre seien ausgebrochen und hätten ihn überwältigt. Unter den Schlägen spritzten vor seinen Augen Funken. Aber als habe einer dieser Funken ein Bild entzündet, war auf einmal seines Bruders Bernhard Gesicht da und sein heimliches Deuten.
Da zog Otto mit einem plötzlichen Ruck die Beine an und stieß sie mit voller Kraft von sich. Er spürte, wie er etwas fortschleuderte, dabei wurden seine Augen frei, er sah einen ganzen Knäuel von Gesichtern über sich, halb lachend, halb grimmig, sah Fäuste nach sich gestreckt. Er schnappte, packte mit den Zähnen einen Finger, biß zu. Jemand schrie unterdrückt. Irgendwie lockerte sich die Schraube. Otto riß den rechten Arm heraus, fuhr blind in den Knäuel, mit geballter Faust, noch einmal …
Da glitt ihm auch der linke Arm aus der Fessel. Nun krümmte er sich zusammen und stieß beide Beine mit der Kraft eines losschnellenden Astes nach vorn, sprang auf, in die Lücke. Es war gut, daß er von Karl Brand gelernt hatte, seine Fäuste recht zu gebrauchen, so schlug er sie von unten her gegen die Kinnbacken, oder schmetterte sie gegen die Magenwände …
Er sah undeutlich, daß irgendwo neben ihm Bernhard dreindrosch wie ins Kraut …
Plötzlich zerstob der Schwarm der Nachtmahre, man sah ein Flattern von Hemden, ein Hopsen in die Betten, so wie Frösche reihenweise in die Tümpel springen.
Bernhard stand neben Otto: »Rin in die Klappe! Der Dicke kommt!«
Da hopsten auch sie.
Als der Lehrer der Geschichte August Sammet, genannt der Dicke, einen Augenblick später in die Stube schaute, lag alles in friedlichem Schlaf, nur die Wandlampe blinzelte aus roten Lidern.
Am Morgen trat ein langer Kerl mit Sommersprossen, dessen Zeigefinger mit einem Leinenverband umwickelt war, auf Otto zu und fragte drohenden Tones: »Was hast du geträumt?«
Otto sah mit heiter blauen Augen drein: »Ich glaube – nichts! Es kommt vor, daß ich nachtwandle, aber am nächsten Tag weiß ich nichts mehr davon.«
Da reichte ihm der Lange die Hand: »Ich nehme dich auf! Tod den Tyrannen!«
Von den alten Spartanern weiß jeder gebildete Mensch, daß sie vor allem durch die spartanische Erziehung berühmt waren.
Diese spartanische Erziehung bestand darin, daß man auf hartem Lager schlief, schwarze Suppe aß, seinen Zeltgenossen auf Tod und Leben die Treue hielt, die Kinder bisweilen auf dem Taygetos aussetzte und sich von Füchsen, die man an der Brust verborgen trug, totbeißen ließ.
In Plamanns Schule waren diese Grundsätze ins zeitgemäß Deutsche übersetzt worden. Demnach hatte man die Aussetzung der Kinder und das Totbeißen durch Füchse ausgeschaltet. Aber das harte Lager, die strenge Zucht und vor allem die schwarze Suppe waren beibehalten worden. Ja, wenn man annehmen konnte, daß im Punkte der Abhärtung das Muster vielleicht nur eben erreicht wurde, so war es ausgemacht, daß durch die Plamannsche Suppe die spartanische an Schwärze noch übertroffen wurde. Und wie die Gelehrten bis heute nicht wissen, woraus diese Suppe eigentlich bestand, so wäre es auch vergebene Mühe gewesen, das Geheimnis der Zusammensetzung der Plamannschen zu ergründen.
Nur eine Person wußte es, Frau Adelheid Trh aus Neutomischl in Böhmen, die Plamannsche Küchenregentin, und auch die vielleicht nicht genau.
Man sagte von ihr, sie sei Anno 1813 Marketenderin gewesen und verarbeite noch heute die Abfälle aus jenen Tagen.
Jedenfalls hielt sie der Rex ob ihrer Küchenkünste lieb und wert, und je mehr es sich zeigte, daß der Stern seiner Anstalt im Herabsinken war, desto lieber und werter wurde sie ihm.
Auch das übrige Programm der Abhärtung wurde mit aller Unnachsichtlichkeit betrieben. Winters und sommers wurden die Jungen im Tagesgrauen aus dem gejagt, was anderswo Federn heißen mochte. Sie traten mit Seife und Handtuch in einem Zug an und marschierten auf den Hof, wo sie sich an der Pumpe waschen durften. Im Winter mußte man oft erst lange Bärte von Eiszapfen wegbrechen, ehe der kalte Strahl aus dem Rohr kam. Es war ein beliebter und unverdrossen wiederholter Witz, dem Neben- oder Vordermann so ein Stückchen Eisbart in die Tasche zu schieben, daß ihm dann während des Unterrichtes das Schmelzwasser in die Hosen lief. Da war es dann Ehrensache, sich nichts merken zu lassen, und dieser Heldenmut ersetzte einigermaßen die Probe mit dem Fuchs.
Denn was bei den Spartanern die Zeltgemeinschaft war, das war bei Plamann die Stubengenossenschaft. Die dreißig Pensionäre, die auf drei Zimmer verteilt waren, bildeten drei untereinander eng verbundene Gruppen, die wieder den Externisten gegenüber zu einem weiteren Verband zusammenwuchsen. Verrat kam nicht vor, und die Lehrer hätten den Versuch eines solchen als verabscheuungswürdig gerügt.
Im Plamannschen Olymp aber herrschte, wie es sich für einen anständigen Götterhimmel schickt, eine Dreifaltigkeit: neben Lykurgos standen auch, schon bei Lebzeiten zu den Sternen versetzt, Jahn und Arndt.
So wurden neben den lykurgischen Grundsätzen, die mehr aufs Negative hinausliefen, auch die neuen Jahnschen Leibesübungen betrieben, das sogenannte Turnen mit Laufen, Klettern, Stabspringen, Schwingen und Klimmen an quer gesteckten Stangen. Man schwamm. Man streckte die Glieder. Man focht. Man schlug mit Keulen um sich.
In der Geschichte aber lernte man von August Sammet, daß alle Regierungshoheit beim Volke sei und daß die Könige ihre Macht keineswegs von Gott, sondern von den Nationen empfangen hätten. Wenn demnach die Könige ihre Macht mißbrauchten, so stünde es beim Volk, sie ihnen wieder abzunehmen, und das heiße die souveräne Freiheit. Die Weltgeschichte habe diesbezüglich schon manche beachtenswerte Winke gegeben.
Diese aus Rücksicht aus die adeligen Schüler immerhin mit einiger Mäßigung vorgetragenen Lehren wurden in den Geheimbünden zu Dolchen, Messern und Pistolen. Es war fester Beschluß, daß Deutschland einig werden müsse, und wenn sich die Regierungen in ihrer törichten Kurzsichtigkeit nicht aufraffen wollten, den Völkern die gewünschten Verfassungen zu geben, so mußten sie eben weggefegt werden.
Ernst Krigar hob bei solchen Stellen immer die teutsche Schwurhand. Ein anderer sagt zur Bekräftigung seiner Rede: »Auf Ehre!« oder »So wahr mir Gott helfe!«, aber Ernst Krigar, Sprecher der Arminia, sagte: »Stein zu Stein, Bein zu Bein, Gras zu Grein« und kam sich dabei vor wie ein unmittelbarer Nachkomme der heiligen Vehme. Seine Sommersprossen funkelten dazu, als wären sie ins Gesicht eingelegte Metallplättchen.
Eines Tages aber sagte Otto, als der Sprecher wieder seinen Vehmeschwur getan hatte, mit einem abwesenden Ausdruck in den Mienen: »Glück und Glas, wie bald bricht das.«
Krigar fuhr herum, und die Haut zwischen den Sommersprossen schien einzusinken: »Wieso? Was meinst du damit?«
»Nichts!«
»Na, du mußt doch etwas meinen?«
»Nein – ich meine nur, das reimt sich auch. Und paßt ebensogut!«
Im übrigen aber hielt Otto die Treue, und als das Unglück mit der großen Fensterscheibe geschah, die von Ranft eingeworfen wurde, nahm er die Tat lieber auf sich, als daß er den Täter verraten hätte. Er schwor mit den anderen den Tyrannen Tod und Verderben, aber begriff doch nicht ganz, warum man Harmodios und Aristogeiton und Brutus so verherrlichte, da sie im Grunde doch nur Empörer gegen die Obrigkeit waren. Daß die Republik die beste Staatsform sei, war unzweifelhaft, – aber sie hatte den einen Fehler, daß sie keinen König an der Spitze brauchen konnte. Mit solchen Ansichten machte er sich einigermaßen verdächtig, und man beschloß, wenn es ja notwendig werden sollte, den König von Preußen zu töten, jedenfalls Otto von Bismarck nichts davon zu sagen.
Ansonsten war aber auch er davon überzeugt, daß Deutschland unbedingt einig werden müsse.
Er nahm an allen Übungen mit Ausdauer teil und ließ täglich die schwarze Suppe mit dem Hunger der Jugend über sich ergehen.
Wenn er seine stille Zeit hatte, ging er in den Garten. Plamanns Haus lag inmitten einer kleinen, von der Stadt scheinbar vergessenen Wildnis. Der Garten, der hinter dem Gebäude lag, war zu groß, um durchaus gepflegt werden zu können, und selbst wenn jeder der Schüler seinen Teil ordentlich bestellte, blieb immer noch genug Gestrüpp, das wirr war von üppigem Wachstum. Dort hatten die Germanenstämme von A., B. und C. ihre Schlupfwinkel und Kriegspfade, und ein quer durch die ganze Wirrnis getretenes Weglein war der Rennsteig.
So hatte er ein wenig vom Kniephof auch hier. Aber Kniephof war doch anders. Otto stand oft, wenn er durch das Gestrüpp geschlüpft war, am Zaun, faßte mit den Händen je eine Stakete und sah hinaus. In Kniephof lag, wo man vom festen Strand des Gutshofes hinaussah, die weite Welt wie ein Meer ohne andere Grenzen als den Himmel; es ließ sich denken, daß man da gehen konnte, bis die Füße abgelaufen waren. Hier aber sah man durch den Zaun in einen Nachbargarten, und wenn es hoch kam, jenseits dieses Gartens noch einen zweiten; aber dann stieß man doch wieder überall schon auf Hausmauern mit Balkonen, an denen immer Wäsche flaggte und schlug, wie Segel, die ein Schiff nicht weiterbringen.
Manchmal hörte er draußen ein Geräusch, das an Kniephof erinnerte, an das Klirren der Pflugscharen oder das Hämmern in der Schmiede. Dann sprang Otto zum Fenster. Aber es war nichts zu sehen als Frau Adelheid Trh, die auf dem Hof die großen Blechtöpfe von den Überresten der schwarzen Suppe säuberte oder mit den Holzklammern klapperte, die ihr zur Befestigung der Plamannschen Hemden auf den langen Leinen dienten.
Nur das Gackern der Hühner war ihm treu geblieben und trog ihn nicht. Wenn sie unten auf Plamanns Hof so recht spektakelten und mirakelten, dann sah er mit geschlossenen Augen die Strohdächer der Scheunen und das Storchennest auf der Schmiede.
Eines Tages brach er sein Schweigen: »Bernhard,« sagte er, »in vierzehn Tagen sind die Ferien da.«
Er wurde selbst rot über diese Worte, begann sofort gleichgültig zu summen und schlug mit den Büchern gegen den Tisch, als ob er etwas suche. Es war nur gut, daß Bernhard mit aufgestützten Armen über seiner Grammatik sitzen blieb und nichts gehört zu haben schien.
Das Zeugnis stellte Ottos guten Fortgang fest und war nicht karg mit dem Lob, das dazu dienen sollte, den Schüler zu noch größerem Eifer anzuspornen. Otto hatte keine Freude daran, es schien ihm ein wertloser beschriebener Wisch, denn tags zuvor war ein Brief aus Kniephof angelangt, in dem Vater mitteilte, daß Mamas Gesundheit nicht zum besten stehe und daß eine Badereise unbedingt nötig sei. So sei es ihm leider benommen, die beiden lieben Söhne daheim zu sehen.
Der Sommer ging trüb, heiß und langsam über dem Plamannschen Grundstück hin, der Herbst brachte die Freunde zurück, und über den Winter und den Frühling wuchs die Hoffnung wieder dem neuen Sommer zu.
Aber auch in diesem Sommer war es notwendig, Mamas Gesundheit im Bade zu kräftigen.
Es war Otto, als lege sich eine harte Rinde innen an die Brust. Wieder nichts! Wieder blieb die Zampel in der Ferne, das Gehämmer des Schmiedes sollte er nicht zu hören bekommen. So war er ein Kettengefangener, ein Galeerensträfling. Eine böse Absicht hielt ihn der Heimat fern. Es war mit Fug zu zweifeln, daß er seiner Eltern rechtes Kind sei, da sie ihn so von sich verbannten.
Onkel Fritz in Templin nahm sich des Knaben an. Er hatte ein lustiges kleines Gut, und Potsdam war in der Nähe. Man konnte ganze Sonntage lang vergessen, daß es ein Kniephof gab, wenn man im Boot lag und fischte, an hängenden, dickumbuschten Ufern entlang fuhr oder auf den Terrassen des Potsdamer Schlosses unter einem hellen Himmel ging, gegen den die dunkeln, gestutzten Hecken schwer und finster dastanden. Wenn man aber wieder in Berlin war und vom Stubenfenster aus den roten Abendhimmel sah, dann war Kniephof wieder da und die Sehnsucht brannte ihren glühenden Stempel in die Seele.
Der dritte Sommer brachte dieselbe Enttäuschung. Otto begann zu verstehen. Mamas System war die Ergänzung zu Plamanns spartanischer Erziehungsmethode. Er hielt sich den Spiegelscherben vor das Gesicht, der Bernhards beginnenden Rasierübungen diente, und sah, daß aus dem verzogenen Mund arge Bitternis in wehe Falten glitt.
Es hatte geregnet, und an den Büschen hingen glasige Wassertropfen.
Otto steckte im Arminenlager und las in Schillers Tell.
Auch der gehörte zu den Freiheitshelden; aber auch bei ihm war nicht darum herum zu kommen, daß er sich zu Unrecht seiner Obrigkeit widersetzte. Das in der hohlen Gasse war einfach scheußlicher Mord, wenn auch Schiller noch so viele Schändlichkeiten auf diesen Geßler häufte.
Ein Regenwurm mühte sich, aus der Erde zu kommen. Otto sah, wie er Ring auf Ring aus dem lockeren Müll zog und zu dem schon befreiten legte. Die Erde: welche zähe Kraft des Haltens die hatte.
Es flatterte ein kurzes Rascheln in den Büschen. Otto wandte sich nicht. Aber da war es ihm, als müsse ein Mensch in der Nähe sein, und nun drehte er langsam den Kopf über die Schulter.
Etwas Helles blinkte in der Lücke hinter dem Nachbarzaun. Ein Mädchengesicht mit blonden Locken drückte sich an die Staketen. Otto staunte hin, etwas Neues war in den Garten gekommen. Oft genug hatte er in den Nachbargarten gestarrt, um zu wissen, daß diese gelb besandeten Wege nur von einem alten Mann in schwarzen Kleidern und einer blassen, stillen Frau beschritten wurden.
»Wer bist du?« fragte das Neue.
Otto stemmte die Hand auf den Boden und erhob sich. Es regnete auf ihn herab und auf den Schiller, der neben dem Regenwurm liegengeblieben war. Otto stieß oben an die Büsche an, denn er war stark in die Höhe gegangen, wie ein Spargel, mit schlankem Leib und einem kleinen Kopf.
»Ich bin Schüler hier!« sagte er. »Und Sie? Ich kenne Sie nicht!«
Das Mädchen lachte: »Es gibt in Berlin noch viele Menschen, die du nicht kennst.«
Jetzt stand Otto nahe dem Zaun und sah, daß das Mädchen eine zarte, braune Haut hatte, auf der viel Sonne gewesen zu sein schien. Aber darunter war alles durchsichtig, und nur wo die Backenknochen gegen die Haut vordrangen, grenzten sich rote Flecken ab.
»Übrigens hast du recht,« sagte sie, »daß es dir auffällt. Ich bin erst seit einer Woche zurück. Berlin ist gräßlich, es sind so viele Menschen da.«
Aus tiefstem Herzen mußte man da zustimmen. Aber das Mädchen fuhr schon fort: »Ich war in Italien. Da drängt man sich nicht so wie hier, man hat Platz. Hier baut man immer nur – das ist häßlich. Dort läßt man verfallen – das ist traurig, aber schön.«
»Ja – Italien!« sagte Otto und hatte eine unklare Vorstellung von sehr viel Blau und etwas Weißem aus Stein zwischen dunklem Grün. Es war das aber mehr eine von Goethe kolorierte allgemein-deutsche Vorstellung von Italien als irgendwie eine besondere Sehnsucht.
»Wolltest du wohl auch gern einmal nach Italien?«
»O ja!« Aber zugleich wußte Otto, daß er die ganzen blauen und weißen Herrlichkeiten jenseits der Alpen einschließlich der Tempel Siziliens und des Kolosseums in Rom für den Winkel hinter dem Kniephofer Kuhstall hingeben würde, wo die Brennesselstauden durch die Böden alter, von rotem Rost zerfressener Blechtöpfe hindurchwuchsen.
»Man darf nur nicht krank sein, wenn man in Italien ist. Kranke haben es in Italien noch schlechter. Alles sagt: komm mit! und du mußt immer sagen: ich kann nicht! Die Berge winken: komm herauf! Die Seen lachen: komm herein! Und du hast nur immer die eine Antwort: ich kann nicht!«
Wie alt war dieses Mädchen eigentlich? Otto maß ihre Größe mit einem schnellen Blick, und alles, auch die Art ihrer Kleidung, wies darauf hin, daß sie nicht viel älter sein mochte als er selbst. Wie kam es wohl, daß sie zu ihm ›du‹ sagte, während ihm selbst sogleich von Anfang an das ›Sie‹ angeflogen war und nun nicht mehr von den Lippen wollte?
»Was liest du da?« fragte sie.
»Es ist Schillers ›Wilhelm Tell‹.«
»Ach, ich soll ja auch nichts lesen. Sie nehmen mir immer gleich das Buch aus der Hand. ›Schau in die Sonne.‹ Man kann doch nicht den ganzen Tag liegen und in die Sonne schauen. Man lernt ja viel dabei … ich habe gesehen, wie Pflanzen wachsen, wie sich Knospen entfalten, ein Blatt nach dem andern rollt sich auf … Schließlich mußt du doch wieder nach Berlin zurück. Alles hat ein Ende.«
Als Otto nach diesen Worten in die Augen seiner Nachbarin sah, wußte er auf einmal, warum ihm das ›Sie‹ an den Lippen klebte. Diese Augen waren viel, viel älter als das Persönchen, zu dem sie gehörten. Sie waren blau, aber von einem dunstigen Blau, wie es der Himmel vor langen Regenperioden hat, oder wie es sich aus trägen Wasserflecken spiegelt, an denen Sagen von Ertrunkenen haften. Dazu stimmten auch die ganz schwarzen Wimpern, die dieses Blau umstanden wie Zypressen oder dunkle Weiden. Und, ganz von selbst, ohne daß er hätte sagen können, wie seine Frage zu diesen Beobachtungen gehörte, sagte er: »Wie heißen Sie?«
»Helene.«
Ja, Helene; dieser Name war notwendig! Er stand schon in diesen Augen, in diesem Blau zwischen schwarzen Wimpern. Otto schauerte irgendwie in sich selbst zusammen, in einem geheimen Wissen, das er zurückdrängte.
»So rede doch auch endlich einmal. Wer bist du? Was für ein Landsmann?«
»Ein Pommer!« Er stellte das blank und kerzengerade hin, wie er selbst war.
»Baff!« machte Helene lachend. »Pommern grenzt an Rußland, und die Straßen sind dort mit guten Absätzen gepflastert, die den Wanderern verloren gegangen sind.«
Otto war keineswegs böse; jedem anderen wäre er mit der Faust unter das Kinn gefahren, dieses Lachen aber legte um jedes Wort ein hübsches, goldenes Rähmchen.
»Sie kennen Pommern nicht!« sagte er sanft.
Sie winkte ab mit einer reizenden Biegung der Hand: »Nein, da lieber noch Berlin.«
»Ach nein!« verwunderte er sich. »Ja, was gefällt Ihnen denn da?«
»Es gefällt mir ja nicht … aber es ist doch noch immer besser als die Wüste.«
Aber da war es, als werde ein großes Tor in Otto aufgedreht und als dränge es ihn unwiderstehlich, aus sich selbst hinauszutreten. Er begann langsam, ganz langsam, sehr behutsam; um nicht zu stolpern, sprach er gar nicht von den Dingen, die er besonders liebte, sondern mehr im allgemeinen von der Weite der Landschaft, dem Wechsel von Wiesen, Feldern und Wald, der Zampel, den Teichen, in deren Schilf die bunten Wildenten tauchten. Dann erst, nachdem das alles licht und zart ausgetuscht war, pinselte er seine besonderen Lieblinge hinein: den Schmied Jochen Hildebrand, der sich vor dem Teufel nicht fürchtete, den Schecken mit den zwei Gesichtern, Karl Brand und Trine Neumann, die immer einen nassen Schürzenzipfel hatte, weil ihr alles auf der Welt so nahe ging. »Und … und … und …« er sperrte sich selbst seine Rede, obzwar er noch bis obenhin voll war, denn er konnte doch einem Mädchen, das eben aus Italien kam, nicht gar so viel von Kniephof erzählen. Dort unten lag die Schönheit ja auf allen Straßen, vergoldete jede Oberfläche; in Kniephof war sie mehr hinter den Dingen versteckt, und wer nicht selbst dort gewesen war, konnte es vielleicht gar nicht so recht glauben. Er schwieg und schämte sich ein wenig.
Aber Helene sah von ihm fort: »Das ist ja doch ganz hübsch … hübscher, als ich es mir gedacht habe. Schließlich, was braucht der Mensch, um glücklich zu sein, anderes als die Erde unter sich und den Himmel über sich? Kennst du Clauren … der schreibt …« Sie unterbrach sich, schaute zwischen den Büschen durch nach hinten und sagte: »Ich glaube, Mama holt mich zum Essen. Ich muß fort. Wenn die mich hier findet, zwischen den Haselstauden, wo es so feucht ist … dann weint sie wieder stundenlang. Aber du bist doch morgen wieder hier … du mußt mir dann noch von deinem Kniephof erzählen.«
Die schlanke Hand drängte sich zwischen den Zaunstecken durch. Das Mädchen duckte sich, war weg, kaum daß die Spitzen der Haselstauden ein wenig schwankten, und schon sah sie Otto drüben neben dem schwarzen Kleid der Mutter als weißes Wölkchen von Schaum.
So bekam dieser Sommer, der Otto erst wie eine taube Nuß geschienen hatte, doch noch einen süßen Kern. Er sah nicht mehr in Bernhards Rasierspiegel, um festzustellen, wie die Bitternis vom Mund zum Kinn träufelte. Er fühlte nicht mehr mit Schillers Karl Moor und rottete den Ekel am tintenklecksenden Saeculum wieder aus seinem Herzen. Er wuchs irgendwie in eine allgemeine Güte und ein Weltverstehen hinein und hatte ohne allzuviel Gebetsorgen das Gefühl, rein und dem Herrn ein Wohlgefallen zu sein.
Und das kam alles aus diesen Stunden am Gartenzaun, in denen er von Kniephof sprechen durfte und für sein pommersches Hohelied im Austausch Bilder aus Italien bezog, die ihm recht sauber und lieb erschienen, ohne sonderliche Wünsche rege zu machen.
Dann zog der Herbst daher und die Schule füllte sich, Frau Adelheid Trh nahm wieder den großen Blechtopf vom Gestell, und die Schwaden der schwarzen Suppe zogen gleich finsteren Wetterwolken durchs Haus. Der Rex rieb in seine knochigen Hände viel Unbehagen hinein, denn wieder war die Zahl der Neueintretenden hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, und zu Ostern ging eine ganze Menge von Schülern an das Gymnasium ab.
August Sammet hatte es nach den Ferien viel schärfer auf die deutschen Fürsten als vorher. Die heiligen Farben schwarz-rot-gold sollten über ganz Deutschland wehen, und es war hohe Zeit, daß die Könige ihre im Jahre 1813 gegebenen Versprechungen wahr machten, sonst würde man sie daran mahnen. Mit Nachdruck! Er sprach auch von Verfassungen und eisernen Besen und daß man vor allem Österreich mißtrauen müsse. So wurde auch die Tonart in der »Arminia«, bei den »Hohenstaufen« und bei den »Barden« viel schärfer, und man war entschlossen, mit den deutschen Fürsten nicht mehr viel Federlesens zu machen. Krigar schwor wieder Stein und Bein, die Freiheit müsse her, oder es gäbe ein Unglück.
Otto blieb dabei, daß er sehr für Revolutionen sei, aber es dürfe nicht tumultuarisch zugehen. Am besten seien Revolutionen, die nicht von unten, sondern von oben ausgingen, und so sei es nur ganz in der Ordnung gewesen, daß der große Kurfürst endlich dem Kaiser die Zähne gezeigt habe.
Trotz dieser offenbaren Zurückgebliebenheit in nationalem Verstande behauptete sich Otto obenauf. Er war mehr als bisher Heerführer und Kommandant aller Festungen, nahm die Leitung einfach an sich und fand es selbstverständlich, daß die anderen sich fügten.
Ein Gerücht, das sich bald über ihn im stillen ausbreitete, trug nur dazu bei, ihn in seiner Stellung zu stärken. Man erzählte sich, daß er eine Freundin im Nachbargarten habe, die zu ihm an den Zaun komme und mit der er auch schon auf der Gasse gegangen sei. Man knüpfte keine Bemerkungen daran, man verspottete ihn nicht, denn man wußte von August Sammet, daß die Frauen bei den alten Germanen in höchster Achtung gestanden hätten. Man staunte nur und wäre geneigt gewesen, darin die Bestätigung einer höheren Lebensordnung zu erblicken, wenn man das mit soliden demokratischen Grundsätzen hätte vereinen können.
In Wahrheit war Otto mit der Freundin nicht so oft zusammen, wie er es wünschte, und der Winter trennte sie auf ganze Wochen. Nur zu oft klebte das dreieckige Stückchen Papier in der Ecke von Helenens Fenster. Und das hieß: »Ich bin krank, ich kann nicht.« Und nur selten konnte er sich über das weiße Viereck freuen, das ihm sagte: »Erwarte mich morgen vor dem Haus.«
Die Mutter saß immer nähend am Gartenfenster, und die Büsche waren kahl, da wären sie am Zaune gesehen worden. Darum mußten sie sich ein paar Minuten für ein flüchtiges Beisammensein im Haustor stehlen. Otto drängte Helene, doch auch einmal auf die Eisbahn zu kommen, aber für solche Wünsche hatte sie auf ihren längst wieder fahl gewordenen Wangen nur ein stilles, wehes Lächeln.
Nun setzte Otto seine Hoffnungen auf den Sommer, und er war diesmal gar nicht einmal so sehr auf Kniephof entbrannt. Wenn man ihm die Ferienfreude wieder versagte, so wuchs ihm daraus die andere, mit Helene von ihr zu sprechen.
Inzwischen aber war der Frühling gar nicht gut gegen Helene.
Wochenlang klebte das dreieckige Papier schon an ihrem Fenster …
Otto lag vor Troja und befehligte seine Heerhaufen zum Sturm gegen die heilige Feste.
Oben auf dem Sandhaufen stand Hektor-Krigar und drosch mit beiden Fäusten seine zottige Männerbrust. Die Sommersprossen funkelten in der Sonne, und er verhöhnte den Feind im homerischen Stil: »Ihr Kröten, ihr langsamen Schildkröten, die ihr mit der Milch von Affen genährt worden seid und euch an Weiberröcken gemästet habt, wo sind eure langen Ohren? Ihr habt sie daheim gelassen, daß wir euch nicht daran fassen können, aber wir wollen unsere Schwerter umkehren und euch den Buckel ausklopfen, wie Blücher. Kommt nur heran, ihr Blindschleichen, ihr räudigen Hunde, ihr Schafe im Wolfspelz, ihr ausgelassenen Beistriche, ihr traurigen Schmalzgesellen …
Wenn es ans Reden ging, dann ließ man Ernst Krigar gern die Vorhand, denn darin suchte er seinen Meister. Er schoß seine Worte wie aus Katapulten auf den Feind, und ehe er einmal zu schnaufen brauchte, hatten schon zehn Feinde den Atem verloren.
Der Turnlehrer Schmetter und August Sammet kamen auf dem zertretenen Streifen frühlingsjungen Grases den Spielplan entlang.
»Hören Sie,« sagte Schmetter und ließ den Adamsapfel weit aus dem offenen Kragen vorspringen, »dieses Maulwerk! Damit bringt man's zu was in der Welt.«
August Sammet schüttelte den Kopf: »Das Reden ist vorbei, lieber Kollege, jetzt wollen die Völker Taten sehen. Wir brauchen jetzt Männer des Handelns. Jawohl! – Da sehen Sie nur, wie hübsch das die Kerle machen.«
Otto hatte die Hand gehoben. Seine Achaier schoben die Schildränder zu den Augen und brüllten in die Höhlung. Der Gärtner hätte sich gewundert, wenn er gehört hätte, welche Resonanz seine Mistschwingen gaben, sobald man nur ordentlich brüllte. Dann stürmten die Achaier, ohne weiteres Brimborium, ohne trojanisches Pferd und Laokoon und sonstige homerische Umständlichkeiten auf das heilige Ilion los, und einen Augenblick war es, als wachse dort drüben eine Sandhose aus der Erde. Der Sand flog wie von Wurfschaufeln geschleudert gen Himmel, und wenn die Olympischen etwa Lust gehabt hätten, noch einmal in einen trojanischen Krieg einzugreifen, so hätten sie ganz gewiß Freund von Feind nicht unterscheiden können. Man sah bisweilen einen einzelnen Hosenfuß aus dem Sandwirbel vorschauen, oder ein Gesicht, an dessen Ohren zwei fremde Fäuste saßen, dann rollte ein verbissenes Kämpferpaar vom heiligen Ilion herab den Lehrern gerade vor die Füße.
August Sammet, der Tyrannenfeind und Revolutionär, kriegte ängstliche Augen. »Pfeifen Sie ab! Das geht auf Leben und Tod.«
Der Turnlehrer trillerte auf seiner Ordnungspfeife das Einstellsignal.
Als sich die Sandwirbel senkten und die Staubwolken hoben, sah man, daß die Achaier oben waren und die Trojaner zum größten Teil unten saßen.
Otto kam, vom Wink des Lehrers gerufen, heran. Der blonde, wirre Schopf hing ihm in die feuchte Stirn, die Augen waren groß und glänzten wie Stahl.
»Famos gemacht, Bismarck,« sagte Schmetter und legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Wenn's nur sonst auch so ginge,« seufzte Sammet, »aber da läßt er nach. Übereilt sich dann wieder und macht's um so oberflächlicher. Scheint allerlei Possen im Kopf zu haben und wird fein unterscheiden lernen müssen, wann der Ernst not tut und wann man sich laufen lassen kann.«
Bismarck steckte Lob und Tadel in einen Sack, der sich nicht allzu schwer trug, und wandte sich seinen Achaiern zu. Er gab Sammet im Grunde recht, der Frühling hatte ihn faul und übermütig gemacht. Nun war es ja so sommermäßig warm geworden, daß das niederträchtige dreieckige Papierzipfelchen endlich einmal verschwinden mußte.
»Sehen Sie,« sagte August Sammet hinter ihm, »hier schwebt der Aar des Sieges, und drüben fliegt der Totenvogel ins Haus.«
Im Hof des Nachbarhauses ging ein langer, hagerer Mensch in langem, schwarzem Schoßrock, schwarzen Kniehosen und schwarzen Strümpfen, einen schwarzen Dreispitz unterm Arm. Aus jedem fadenscheinigen Fleck, aus dem Glanz an Ärmeln und Schenkeln guckte ihm eine schäbige, berufsmäßige Trauer. Man sah ihn hinter den Büschen, die erst von dünnem Blätterschleier überzittert waren, ins Haus rücken.
»Der Konduktansager Haberland? Was will denn der dort drüben? Ist da jemand gestorben?«
»Sie wissen es nicht? Die hübsche Kleine. Die Enkelin vom alten Regierungsrat Emmerich. Lunge und so! Der Vater ist auch daran gestorben. Mein Gott, mit Geld ist auch nicht alles getan.«
Otto ging nach der eroberten Feste und ordnete die Achaier zum Rückzug. Jetzt – jetzt konnte er sich umwenden. Ja gewiß, das Fenster stand weit offen, das war in seinen Morgen hinein ein Jubel gewesen: man ließ ihr Sonne und Luft ins Zimmer, und so zögerte denn auch die Genesung schon über die Schwelle. Jetzt erst wußte er, daß dies hieß, eine Seele habe dort ihren Weg hinausgenommen. Das dreieckige Papierzipfelchen war verschwunden, aber Helene hatte ihm kein Zeichen gegeben, wo er sie erwarten solle.
Heute rührte er nur so obenhin in seiner schwarzen Suppe, obzwar sie Möllenhoff als ganz besonders kräftig rühmte, wahrscheinlich, weil der schwarze Ratz, den man heute morgen in der Rattenfalle gefunden hatte, hinein verarbeitet worden sei. Von jedem Knöchelchen, das er fand, behauptete er, es sei eine Ratzenpfote, so daß dieses Vieh schließlich in seiner Phantasie aus mindestens vierzehn Pfoten zu stehen kam. Otto nahm an dem Hallo keinen Anteil.
Am Nachmittag zog er sich vom Rex eine Rüge wegen vollkommener Unaufmerksamkeit zu.
Abends nahm er seine Rinde trockenen Brotes und verschwand still und ohne jemandem aufzufallen. Während er durch die Gänge schritt, hielt er das Brot in der Hand, um, falls ihm jemand begegne, den Anschein erwecken zu können, als gehe er noch, sein Abendbrot knabbernd, behaglich spazieren.
Am Ende des Korridors zweigte die Bodenstiege ab. Otto luchste nach links und rechts, dann lief er treppauf ins Dunkle, bis vor die Eisentür. Der Schlüssel war da, den hatte Adelheid Trh hergeben müssen. Jetzt ging es unter den Dachsparren hin; zwei Augen standen in der Finsternis, das war Kater Murr, der fauchend vorbeisprang. Dann am Ziegelunterbau des Kamins gab es großes Innenfeuerwerk, sprühende Funken spritzten aus der Stirn ins Gehirn, und Otto fühlte, wie unter seiner Hand die Beule schwoll.
Aber dann war er an der Dachluke und zog an der Schnur, das Fenster klappte auf, und man sah eine fahle Wolke am Himmel und einen einzigen Stern.
Das war furchtbar, ganz furchtbar traurig, denn der Himmel dahinter erschien vollkommen leblos und leer.
Aber nun galt es, weiterzukommen. Leise kantete Otto eine große Kiste herbei, kletterte hinauf, zwängte sich schlank und geschmeidig durch die Luke und saß nun, wirklich wie ein Nachtwandler, auf dem Dach, die Beine bis ans Knie gezogen, die langen Arme um die Knie gelegt. Um ihn rieselte Sternenlicht. Das Dach war feucht und schlüpfrig von Tau. Bellum gallicum, der Hofhund, schnupperte unten in den Winkeln herum und stieß bisweilen die Schnauze in die Luft, als sei da etwas nicht geheuer. Noch etwas aber war da, ein Atem, der die ganze Nacht erfüllte, etwas Unsichtbares, das aber trotzdem alle Poren durchdrang, und das war vielleicht das Leben dieser Stadt, die noch im Schlafen auf ihr Wachstum bedacht schien.
Otto löste langsam wieder seine Glieder aus der Verschränkung und begann ruckweise das Dach hinanzukriechen. Es war keine leichte Arbeit, und bisweilen rutschte er auf den feuchten, von glattem Moos bezogenen Schindeln ein ganzes Stück zurück. Seine Finger tauchten in den Flimmer des flüssigen Sternensilbers.
Jetzt war der First erreicht, und das Reiten war ein leichtes. Etwas wie Lust wollte aufkommen, eine verwegene Freude, hier oben das Dach zwischen den Beinen zu haben und das ganze Haus samt Plamann und allen Schülern wie ein großes Tier durch die Nacht zu spornen.
Wo der First endete, ging es nach dem Dach eines Vorbaues hinab, der aus der Feuermauer heraussprang. Otto beugte sich aus dem Schindelsattel, und das Herz zog sich ihm ein wenig zusammen. Es war viel tiefer da hinab, als es, vom Hof aus gesehen, den Anschein gehabt hatte.
Er wandte sich nach allen Seiten. Das schlüpfrige Dach hinabzukriechen, ging nicht an, hier schwang es sich besonders steil vom Rand zum First.
Es mußte gesprungen werden, und Otto sprang mit geschlossenen Augen, so leicht als möglich, landete auf allen Vieren, saugte sich sogleich mit dem ganzen Leib an das Dach, um nicht abzurutschen.
Sein Weg war nicht mehr weit: der Vorbau beugte sich zum Nachbarhaus hin, und dieses streckte sich ihm mit einem ähnlichen Auswuchs freundlich entgegen. Nur ein Spalt war dazwischen, die Grenze der Grundstücke, eine Schlucht der Abfälle und erledigten Dinge.
Immerhin war auch hier ein Sprung zu machen, der den Anschlag überstieg. Und er war ohne Unfall und ohne Lärm zu machen; denn das Licht, das drüben im schiefen Viereck auf den Schindeln lag, kam aus dem Fenster, das dieser Kletterei Ziel und Ende war.
Alles Bisherige war ohne einen bestimmten Plan entstanden, gleichsam nur Stück für Stück, eines aus dem anderen gewachsen, weil es sich eben so fügen mußte. Nur an einzelnen Stellen seiner Wanderung war es Otto gewesen, als greife hier etwas vorher wohl Erwogenes wie der Zahn eines Zahnrades an seinem richtigen Orte ein.
Erst vor diesem Sprung, der ihn zum fremden Haus führte, fiel ihn eine grimmige Klarheit an: daß er ausgezogen war, um die tote Freundin zu sehen.
Nun war es auch nicht mehr schwer, von dem flachen Dach aus das Gesims zu erreichen, das unter dem offenen Fenster hinlief. Er turnte mit einem Klimmzug hinan, klebte mit ausgebreiteten Armen an der Mauer, schob sich vorsichtig weiter und faßte den Fensterrahmen.
Jetzt saß er glücklich im Fenster, sah in den Raum.
Es war ein schmales Zimmerchen in einem lichten Blau, unter dessen Decke ein hübscher, beliebter Fries lief, in dem sich Genien mit Fackeln und Kränzen zu beiden Seiten eines flammenden Dreifußes einfanden. Otto sah ein kleines Wandbrett mit Büchern, einen kolorierten Stich, der irgendetwas Italienisches vorstellen mochte.
Das Bett war von der Wand abgerückt und mitten in den Raum gezogen, so daß zu beiden Seiten nur schmale Durchgänge verblieben. In diesen Durchgängen standen je drei Kerzen in hohen Leuchtern.
Da die Kopfwand des Bettes Otto zugekehrt war, sah er nichts weiter, als ein Stück Spitzenstoff am Fußende, das in seiner vollkommenen Regungslosigkeit grauenhaft war.
Otto zog das andere Bein nach, stand im Zimmer. Auf Zehenspitzen schlich er voran, wand sich zwischen den Leuchtern hindurch, sah zuerst am Rande des Blickfeldes etwas Schreckliches: eine Hand, deren Finger so nebeneinander lagen, als wären sie einander ganz gleichgültig geworden. Dann faßte er langsam das Gesicht ins Auge.
Es war manches da, was an die Helene erinnerte, die er kannte. Aber das meiste war ihm doch fremd, vor allem die stumpfe Gleichgültigkeit, die irgendwie über das ganze Gesicht gebreitet war. Etwas Abgebrauchtes lag vor ihm, etwas Nutzloses und dem Zufall Preisgegebenes, das sich selbst preisgegeben hatte.
Und eigentlich war auch der Schmerz gar nicht so groß, wie es Otto erwartet hatte. Es sprengte ihm nicht die Brust, es würgte ihm nicht die Kehle ab und preßte ihm keine Tränen aus. Er hatte nur ein wenig Angst vor dieser entsetzlichen Gleichgültigkeit des Leibes.
Und dann war noch etwas da. Eine harte Erbitterung, ein feindlicher Ingrimm gegen etwas, dem Otto in dieser Stunde keinen Namen wußte, das aber an dieser Fügung schuld war. Später erschrak Otto über die Empörung, als er erkannte, daß sie sich im Grunde gegen Gott gerichtet hatte.
Ein Flackern und Wehen ging über die Kerzenflammen hin.
Jemand war ins Zimmer getreten. In der Tür duckte sich der alte Herr aus dem Garten, im blauen Rock mit blanken Knöpfen. »Was macht Er hier? Was will Er hier?« Der Blick war nicht frei von ein wenig abergläubischem Schrecken.
Jetzt kam das, was Otto immer gewaltsam aus seinen Gedanken abgeschoben hatte: Rückzug und Kosten des Abenteuers.
»Ich bin Schüler bei Plamann nebenan.«
»So ist Er wohl der Junge, von dem Helene gesprochen hat? Hat sich wohl ihre Krankheit dadurch verschlimmert, daß sie zu Ihm an den Zaun und ins Haustor lief! Das erfährt man immer erst, wenn es zu spät ist. Und nun liegt mir auch die Mutter nebenan krank. Ich seh' Ihn nicht gern, das kann ich Ihm sagen.«
So stand Otto nun in der Schuld dieses alten, unglücklichen Mannes, das war eine schwere Bitternis.
»Wie kommt Er denn eigentlich hierher?«
»Über die Dächer!«
»So so … über die Dächer. So sollt' ich Ihn eigentlich wieder auf diesem Weg zurückjagen, wie Er es verdient. Aber da sie gut von Ihm gesprochen hat, so will ich Ihn vorne aus dem Haus lassen und seinem Rektor keine Meldung machen. So seh' Er sie sich denn noch einmal an.«
Der alte Herr zog ein großes Schnupftuch aus der Tasche, wandte sich zur Seite und schneuzte sich sehr vernehmlich. Otto schaute mit festem Blick nach dem gelben, spitzen Gesicht, dessen Backenknochen die schlaffe Haut spannten. Es schien ihm, als stünden die Lippen etwas weiter voneinander als vor ein paar Minuten. Vielleicht war diese Gleichgültigkeit nur eine Maske? Aber der Schmerz hatte sich verlaufen, Otto fand nicht in seine eigenen Tiefen. Er war froh, daß er nach einigen schweigend verbrachten Minuten gehen konnte.
»Ich danke Ihnen,« sagte er, als ihm der Regierungsrat selbst das Haustor öffnete.
Obzwar der alte Herr Wort hielt, kam Ottos Abenteuer hinten herum, auf Umwegen durch Küchen und Gesindestuben doch ans Licht. Christian berichtete, und Adelheid Trh wußte da bald, wozu Otto den Bodenschlüssel gebraucht hatte.
Es fiel ihm nicht ein, zu leugnen, als er zur Rede gestellt wurde, und so büßte er denn seine Strafe wegen nächtlichen Unfugs.
Die Hühner, die auf Plamanns Hof gackerten, hatten ganz sonderbare Namen. Sie hießen Deuterogunde, Kalbarilla, Segnalia oder ähnlich. Und inmitten dieser so erlesen benamsten Horde trug Kurzundgut, der Hahn, seinen stolzen, schillernden Schweif.
Ihre Namen hatten sie von Otto von Bismarck empfangen. Diese Hühner waren lauter Kniephofer Erinnerungen. Es waren Erinnerungen mit zwei Deinen und Stimmen und dem Kniephofer Jungen wert genug, daß er sie nicht alle miteinander in einen großen Knäuel zusammenschlug, sondern durch Namen fein säuberlich unterschied.
Sie waren zunächst einfach Hühner und betrugen sich hühnermäßig, mit Scharren und Gackern genau so wie ihre Kniephofer Gevatterinnen. Daneben aber vertrat jedes von ihnen noch etwas Besonderes. Die rostrote Deuterogunde etwa die Morgenstunden zwischen Tau und Tag, wenn in den Traum schon die ersten Geräusche des Lebens aus dem Hofe schlichen. Die weiße, sanfte Kalbarilla, die sich niemals vordrängte und so sachte aus der Hand fraß, daß man es kaum spürte, das waren die stillen Sonntagnachmittagsstunden im Sommer, wenn die Felder qualmten und überall der feine, gelbe Blütenstaub herumflog. Segnalia aber, die Gelbe mit der schwarzen Zeichnung auf den Flügeln, die den ganzen Tag geschäftig herumschoß und bisweilen ein gellendes Gegacker des Entsetzens ausstieß, die war Trine Neumann und keiner anderen zu vergleichen.
Über alles das hinaus aber hatten die Hühner in ihrer Gesamtheit noch eine dritte, sehr wichtige Bedeutung. Otto von Bismarck hatte von August Sammet erfahren, daß die römischen Auguren aus dem Appetit der Hühner die Zukunft vorhersagen konnten. Im Appetit der Plamannschen Hühner ließ sich nun keine Veränderung wahrnehmen. Sie fraßen jahraus, jahrein, etwa wie Plamannsche Pensionäre, wenn man ihnen plötzlich die schwarze Suppe entzogen und dafür Sandtorte vorgesetzt hätte. Aber es gab andere kleine Verschiedenheiten, die sich orakelhaft deuten ließen. Sie konnten nach links herum fressen und nach rechts herum, in die Sonne hinein oder in den Schatten hinein, und an das alles konnte man seine Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte hängen.
Otto stand im Hofe und befragte das Hühnerorakel. Ein Brief mußte kommen, und es handelte sich darum, ob er ein Ja brachte oder ein Nein.
»Warte du, Segnalia,« sagte er, als das gelbe Huhn voreilig drängend über seine Stiefelspitze stolperte, »es kommen alle dran. Geduld! Kalbarilla, näher! … komm!« Und er wiederholte sich die Bedingungen: wenn sie also der Hoftür zu fraßen, so hieß das, daß er diesmal nach Kniephof kommen dürfe, wenn sie aber die Richtung gegen den Gartenzaun einschlugen, so mußte er auch diesmal wieder hier bleiben.
Er rüttelte die ersparten Brotstückchen in seiner Hand. Deuterogunde sah mit gestrecktem Hals zu ihm auf, Segnalia legte den Kopf schief, funkelte aus bernsteingelben Augen, eines trat auf das andere, nur Kurzundgut, der Hahn, stand in vornehmer Entfernung und drehte ruckweise den Kopf.
Jetzt flogen die Brotstückchen aus Ottos Hand, wie ein Sämann säte er den Samen der Zukunft. Sogleich entstand ein wüstes Gewimmel zu seinen Füßen, man sah, wie sich Segnalia mit kurzen Flügelschlägen hineinstürzte, Kalbarilla fraß bescheiden und sanft den anderen alles zwischen den Füßen hindurch weg … zwei Hühner mit Schöpfen fanden Zeit zu einem ganz kurzen Gehacke … eine kleine Feder segelte über die eifrig pickenden Köpfe und senkte sich auf den Sand. Jetzt nahm Deuterogunde die Führung auf die Tür zu, fraß voran, und es schien, als würden ihr alle die anderen heiß und gierig nachfolgen.
Die Freiheit erschien in einem Tor von goldenen Stunden, einen Kranz von Sonnenstrahlen auf dem Haupt …
Aber da kam einem der Hühner, Tumulinde mit dem nackten Halse, plötzlich einer jener Einfälle, an denen Hühner schon einmal zu leiden scheinen. Sie schoß ohne jeden Grund mit leidenschaftlichem Gegacker aus der Schar der pickenden Genossinnen hervor und auf den Streifen Futter hin, der gegen den Gartenzaun schwenkte. Mit einem eilig aufgerafften Brocken floh sie der Kresse zu, die am Zaun in feisten Trieben wucherte. Und als hätte diese Tumulinde in ihres Hühnerhirnes Unverstand dem Schicksal einen anderen Weg gewiesen, so wandten sich nun auch alle die anderen ab und fraßen den Streifen entlang, der sich zum Garten hinzog.
Und somit war entschieden, daß man auch diesmal wieder angeschmiedet blieb. Aber das konnte man nun doch nicht ganz glauben, denn der Brief, den man geschrieben hatte, war zu beweglich gewesen. Und das war ja eben das Lustige an solchen Orakeln, daß man sie ganz gern annahm, wenn sie das Gute deuteten, und daß man, wenn sie widrig ausgingen, immer noch sagen konnte, es sei ein Unsinn.
Und jetzt ereignete sich etwas, das geeignet war, die Hoffnungen wieder zu beleben.
Kurzundgut, der Hahn, der seinen Hennen bisher alles allein gegönnt hatte, zog einen Fuß hoch, hielt ihn, gründlich erwägend, eine gute Weile in der Luft und setzte ihn dann zögernd nieder. Dann machte er es mit dem anderen ebenso und kam also langsam und bedächtig näher, wobei er den Kopf ruckweise drehte, daß der rote Kamm baumelte.
Dann geschah es, daß er sich bückte und sorgenvoll ein Brotstückchen fraß, wobei er tat, als sei ihm der Schlund zu klein.
Dieses aber bedeutete, daß etwas Ungewöhnliches geschehen würde, und gern legte man diesem Ereignis irgendeine Beziehung zu Kniephof bei. – –
Es erwies sich auch schon im Laufe dieses Sonntages, daß Kurzundgut wirklich etwas Kniephoferisches angesagt hatte.
Nach der schwarzen Suppe, die zu Ehren des Tages ein wenig ins Graue gemildert war, erschien Christian und drehte den Domestikendaumen nach dem Sprechzimmer: es sei jemand draußen … für den jungen Herrn von Bismarck.
Otto sprang auf und hinaus. Wahrhaftig, da war ein Stück Kniephof in Lebensgröße: Karl Brand. Er nahm sich nicht ganz so gut aus, wie unter dem pommerschen Himmel. Irgend etwas fehlte und irgend etwas war zu viel, und daß die Schuhe noch immer so freimütig ihr Inneres zeigten, wie nur je auf den Zampelwiesen, schien nicht ganz zu dem Sprechzimmer zu passen. Als repräsentativster Raum des Hauses hatte dieser sogar ein Sofa – ein Lotterbett, wie es Schmetter und Sammet nannten – und somit einen Hauch von Luxus, der Brands Erscheinung gänzlich abging. Alles das streifte Otto nur ganz flüchtig, drang gar nicht in ihn, denn in ihm war alles Freude und pulsender Sonnenschein.
Er faßte den Jungen an den Händen, zog ihn zum Fenster, tanzte vor ihm herum. »Ja du!« sagte er, »du … Karl … du bist es!« Er lachte ihm zu, eine Weile ganz wortlos. Auch Karl lachte schief und verlegen; irgend etwas paßte da nicht recht, und es wäre ihm sehr lieb gewesen, wenn der Junker sich vernünftiger angestellt hätte.
»Karl Brand aus Kniephof!« sagte Otto immer wieder; er wollte, wie in den Kniephofer Tagen, dem Freund etwas schenken und besann sich, daß er nichts besaß als etwas Geld, und daß es in Plamanns Haus keine Überreste von Mahlzeiten gab.
»Ja, wie kommst du nach Berlin?« fragte er endlich. »Nein, nein, nicht erzählen,« er sprang schon zur Tür, »Wir gehen aus. Heute ist Sonntag. Du erzählst es mir draußen.« Er sprang noch einmal zurück. »Warte, ich komme gleich.«
Er warf den Freund auf das Sofa. Eine Feder aus napoleonischen Zeiten sagte Ach!
Dann gingen sie nebeneinander durch den sonntäglichen Berliner Nachmittag. Es war eine bunte Zeit. Zu den weißen Kleidern trugen die Damen farbige Schärpen, sie trugen große farbige Maschen unter dem Kinn und große grelle Schleifen auf den Hüten. Diese Hüte hatten hohe Kappen, von denen breite Krämpen nach vorn und oben gerückt waren, so daß die Köpfe, von unten gesehen, auf dem goldgelben Stroh wie auf einem Heiligenschein saßen. Auch die Herren hatten ihre Röcke ins Blaue, Olivgrüne oder zumindest Schokoladenfarbene getaucht, und wer ganz mit der Mode gehen wollte, trug weiße oder wenigstens licht gestreifte Hosen, die unten eng an den Knöcheln saßen und oben gegen die Hüften ebenso schinkenartig anschwollen, wie die Ärmel der Damen vom Handgelenk gegen die Achseln.
Selbst die Droschken waren aufs Helle und Freudige gestellt, hatten blaue, rote oder grüne Kasten und rollten allesamt auf gelben Rädern dahin.
Jeden Augenblick kam ein kleiner Reitertrupp die Linden entlang, die Reiterinnen in kurzen roten Jacken, die mit der Gürtellinie abschnitten, und schmalkrempigen Zylindern, unter denen die Locken zu beiden Seiten des Gesichtes herunterrieselten.
Unter den Hufen der Pferde, unter den gelben Rädern der Droschken, unter den Füßen der Spaziergänger qualmte der Staub, zu dem die Hitze der letzten Tage die Oberflächen der Straßen zerpulvert hatte. Jede Bewegung der Spaziergänger, der Reiter, der Wagen löste gleichsam einen lautlosen Schuß, von dem man nur den Wirbel gelben Pulverrauches sah. In Manneshöhe breitete sich der gelbe Schleier über die ganze Straße, und was sich etwa davon absonderte und auf Menschen, Tiere und Häuser niederschlug, wurde durch die fortdauernden Staubexplosionen immer wieder ersetzt. Bisweilen durchdrang ein kurzer Blitz den Dampf dieses Kampfes um das Vergnügen, das Funkeln einer Schnalle, einer Agraffe, einer Brosche, eines Armbandes an schöner Hand.
Karl Brand trank dies alles mit dem ganzen Körper ein. Er sah, hörte und schmeckte Berlin zugleich, sog es mit allen Poren auf, hatte das Funkeln der bunten Farben in den Augen und fühlte den gelben Staub auf den Lippen. Ein unbeschreibliches, gespanntes und wütendes Wohlgefallen erfüllte ihn.
»Viel Geld!« sagte er.
Otto, der dem Freund pflichtgemäß Berlin zeigen wollte, aber sich danach sehnte, einen stilleren Winkel aufzusuchen, sah Karl erstaunt an. »Wie meinst du?«
»Es ist viel Geld unter den Leuten. Meinst du, diese Kleider kosten nichts, diese Pferde sind umsonst?«
Daran hatte Otto wahrhaftig noch nicht gedacht, den Berlinern nachzurechnen, was ihre Kleider kosten könnten. Es war Leben da, Frauen, Pferde, Wagen, das wimmelte, man saß bei Josty, bei Stehely, las Zeitungen, die Spenersche, die Vossische – das war Berlin, was weiter. Nun kam Karl Brand und meinte, das koste Geld. Es war möglich, aber was ging einen das an.
Karl Brand sah geradeaus, seine Stirn war, als ob man sie mit einem Hammer bearbeitet habe: »Weißt du, ich denke immer, es ist viel mehr Geld in den Städten als bei euch auf dem Land. Ihr tut doch nur so … da fährt einer zum andern und zwei zum dritten, und reihum kommen sie alle bei einem zusammen und fressen die Küche kahl, daß man hinterher auf acht Tage das Maul in den Rauchfang hängen kann. Es gibt Schlittenpartien und Jagden und Bälle, und doch ist nichts dahinter. Der Jude hat die Hand in euerm Sack, und die Herrlichkeit steht auf schwachen Beinen. Gebraucht wird viel und gewonnen wenig.«
Ja, daran mochte schon etwas sein, seufzte Otto. In Stettin machten sie noch immer das Wollenwetter, und bisweilen stand etwas davon in Papas Briefen.
»Siehst du,« sagte Karl, »so ist es. Ich glaube, das stirbt aus: Adel und so. Es kommt eine neue Zeit.«
»Das ist das Brandenburger Tor,« erklärte Otto, »schau, wie das dasteht. Es ist nach dem Muster der Propyläen in Athen erbaut, denn die Griechen, weißt du, hatten die feinste Baukunst. Man baut jetzt alles nach der griechischen Methode. Aber, weißt du, worüber man sich am meisten freuen muß? Das ist die Viktoria da oben! Die Franzosen haben sie uns schon einmal gestohlen. Nach Jena. Aber wir Preußen haben sie uns wieder aus Paris geholt und zurückgebracht. Jetzt trägt sie das eiserne Kreuz. Siehst du, dort oben unter dem Adler. Sie hat's verdient, sie war doch auch im Krieg.«
»Ja!« sagte Karl mit einem flüchtigen Blick nach oben. Was ging ihn Frankreich und die Viktoria an, das war vorbei und erledigt.
Sie durchschritten die Torfahrt.
»Weißt du,« sagte er, indem er Ottos Ellenbogen faßte, »woran das liegt? Ich glaube, es liegt daran, daß sie die Maschine haben. Die Maschine muß die Zeit anders machen. Ich bin in einer Weberei, wo sie Tuch machen. So eine Maschine ist wie ein Mensch so klug, sie macht alles, was zu ihrer Arbeit gehört, nur viel ordentlicher und schneller. So eine Maschine macht in einem Tag so viel, wie zehn Weber in einem Monat. Das muß doch alle Weber einmal umbringen, nicht? Einmal muß es so viel Maschinen geben, daß es keine Weber mehr geben kann. Und dabei frißt die Maschine nichts als Kohlen. Du gibst ihr Kohle, sie macht Dampf daraus und mit dem Dampf Tuch.«
Das war eine ganz neue Welt. Otto staunte den Freund an: »Ja … und darum bist du nach Berlin gekommen?«
»Was sollte ich auf Kniephof noch machen? Der Alte ist tot!«
Ist tot! Der alte Brand, der mehr als Neunzigjährige! Nie mehr würde er aus seinem schmutzigen Strickstrumpf Geschichten hervorziehen, nie mehr würden im blauen Rauch seiner Pfeife Gesichter von Riesen und Prinzessinnen erscheinen. So war eine Märchenwelt versunken. So war doch ein Stück Kniephof abgebröckelt, trotz des Gebetes, das er als schützende Glocke darüber gedeckt hatte.
»Ja … eine Tante ist hier in Berlin. Sie hat mich zu sich genommen, aber ich muß verdienen. Es geht uns nicht so wie euch, für uns arbeiten nicht die andern. Wir müssen für unser Stück Brot unsere eigenen Hände rühren.«
Ein leichter Wagen mit vier Füchsen sauste vorüber, den Baumgruppen des Tiergartens zu. Die schweißbedeckten Pferdeleiber glänzten durch den gelben Wirbel. Man sah ein junges Gesicht im Heiligenschein neben einem älteren, irgendwie komischen Herrn.
»Wer ist das?« fragte Karl mit brennenden Lichtern.
»Ich glaube, jemand vom Theater.«
Karl drängte dem Wagen nach, in den Tiergarten. Otto hatte auf einmal wieder diese peinliche Unsicherheit, er dachte, daß sein Freund auf den Zampelwiesen besser am Platz gewesen sei als hier im Leben der Stadt. Mit seinen breiten, festen Händen, deren abgekaute Fingernägel von schmutzigen Fleischkuppen überwuchert waren, mit dieser gehämmerten Stirn glich er irgendwie einem kleinen, hartnäckigen Instrument, das sich zu schaffen machte, wo ein feineres Werkzeug bessere Anwendung gefunden hätte.
»Nicht dorthin!« sagte er, indem er Karl am Arm zurückhielt. »Wir wollen anderswohin gehen.«
»Warum?«
»Komm nur!«
Sie gingen wieder die Linden entlang, zum Schloß, wo Karl eine sachverständige Musterung vornahm, dann über die Schleusenbrücke und an der Münze vorbei. In der Jägerstraße stiegen sie in ein Kellergewölbe. Man mochte meinen, in Kasematten zu stecken. Alles war ins Wuchtige und Solide gebaut, die Gewölbe, die Pfeiler, die Tische, sogar der Kellner, der aus einer Nische hervorkam wie aus Hintergründen der Geschichte.
Die beiden Jungen standen ihm kaum für die Mühe, die Hände aus den Taschen zu nehmen. Naserümpfend brachte er die zwei Flaschen Bier, die Otto bestellt hatte.
Durch das Fenster neben der Kellerstiege kam ein brüchiger, vergilbter Sonnenschein, der an den feuchten Wänden Schleim abzusondern schien.
»Warum schleppst du mich her?« fragte Karl mürrisch.
Otto nahm seine Hand, in einem Aufquellen der alten Freundschaft, einer weichen Innigkeit, mit einer Art von Achtung vor dieser Arbeitshand, die ihrem Herrn das Leben verdiente. »Ich kann nicht in den Tiergarten gehen. Ich kann nicht. Da sind Wiesen, die an Kniephof erinnern. Und dann Baumgruppen, Gebüsche. Wenn man da kommt, meint man, dahinter muß unser Park liegen oder das Haus. Dann aber steht ein Bettler da und spielt auf einer Drehorgel.«
Karl spaltete die Lippen und stieß die Luft mit einem kurzen Ruck aus. Immer wieder Kniephof! »Was hast du denn? Deine Eltern kommen ja oft nach Berlin.«
»Das ist nicht dasselbe, Karl. Aber ich war schon vier Jahre nicht draußen. Ich kann nichts mehr anschauen, was ein bißchen wie Kniephof ist. Die anderen laufen draußen herum, aber wenn ich vor die Tore komme und sehe, wie sie mähen oder Heu einführen, dann möchte ich heulen.«
»Ach Gott, nein!«
»So bin ich nun mal,« sagte Otto traurig. »Es ist eine Schande. Eine war da, die hat das verstanden, nur ein Mädchen, weißt du, aber die konnte stundenlang zuhören. Und dann – dann war ich wirklich daheim, dann war alles da, was mir fehlte. Sie ist mir gestorben.«
Karl war wenig bewegt, betrachtete den Freund mit ruhig wägenden Blicken. »Deine Mama fährt immer über die Ferien fort.«
»Sie nimmt mir die Heimat.«
Der Freund zog seine Hand mit einem ärgerlichen Zucken fort. Wieder fühlte er, daß sie irgendwie nicht zu Ottos schlanken Fingern stimmte, und ließ seinen Groll darüber schäumen: »Was willst du? Habe ich eine Heimat?«
»Du hättest doch in Kniephof bleiben können.«
»Ich will aber nicht, die Welt ist größer,« fauchte er.
»Wie mich das quält, Karl. Ich möchte so gern nach Haus. Da habe ich nun einen Brief geschrieben, in dem steht alles drin. Wenn sie das lesen, müssen sie mich nach Haus lassen.« Es jubelte in seiner Stimme. »Heuer sehe ich Kniephof. In acht Tagen bin ich schon auf dem Weg. Ich bete jeden Abend darum.«
Er sah in ein sonderbares Gesicht, in dem sich die Unterlippe vorschob, während die eine Wange von einer Falte gegen das Ohr gezogen wurde und sich ein Auge zusammenkniff.
»Betest du?« fragte Karl.
»Ja, ich bete jeden Abend um Kniephof.«
»Naja!« Die Grimasse löste sich wieder langsam auf. Die schmutzige Faust griff nach dem Glas. Karl trank langsam. Der Handrücken wischte über den feuchten Mund.
Otto sah gespannt nach allen diesen Hantierungen, die wie eine Einleitung zu etwas Bedeutendem aussahen. »Was meinst du?« drängte er.
»Ich meine, wenn du nicht betest, wär's dasselbe.«
»Man bringt doch seine Wünsche vor Gott …«
»Ach was, Gott! Gott gibt's nicht.« Er gröhlte in sich hinein: »Den haben sie schon längst in Frankreich abgesetzt. Nur in Deutschland brauchen sie ihn noch.«
Furchtbar fremd und kalt war das. Otto sah den Freund an, der wich seinem Blick aus und suchte etwas an der grünschillernden Wand. Er hätte ihm von seiner Zuversicht mittelten mögen, in der alle Hoffnung beruhte.
»Na, jetzt wollen wir aber gehen,« meinte Karl, »ich möchte noch Menschen sehen. Es ist lächerlich, in diesem Loch zu hocken.«
Sie trennten sich an der Münze, und Karl ließ sich lange drängen, ehe er ein halbes Versprechen gab, am nächsten Sonntag wiederzukommen, wenn er nichts Besseres zu tun wüßte.
Als Otto in die Anstalt kam, händigte ihm der gute Christian einen Brief ein, der schon am Morgen eingetroffen war, den er aber abzugeben vergessen hatte. Auf dem Umschlag winkten die schnörkelhaften Schriftzüge des Vaters. Unter freiem Himmel wollte er das lesen, wo man tief atmen konnte und wo das Glück seine Flügel breiten durfte, ohne an kahle Wände zu stoßen.
Er ging langsam in den Hof, die Hühner stürzten herbei, bereit, zu orakeln, so oft man es verlangte. Aber Otto brauchte keine Frage mehr zu stellen, er öffnete schon die Antwort des Schicksals.
Die Mutter schrieb:
»Mein lieber Sohn! Es erfüllt mich mit aufrichtiger Befriedigung, in deinem Brief die Versicherung zu lesen, daß auch dieses letzte halbe Jahr wieder einen guten Fortgang aufzuweisen hast, und somit meine Hoffnung bestätigt zu finden, daß es dir gelingen werde, das dir gesetzte Ziel zu erreichen. Ich kann dir nicht oft genug wiederholen, daß heutigen Tages nur eine allseitige Bildung fähig und würdig macht, die Laufbahn einzuschlagen, die ich dir ausersehen habe und die dich zu so hohen Ehren und solchem Ansehen führen soll, wie sie mein gottseliger Herr Vater genossen hat. Du schreibst, daß dir der große Mann, der deine Konfirmation vorgenommen hat, Schleiermacher, den Spruch zuerteilt habe: ›Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen!‹ Wahrhaftig, das ist ein guter Spruch, und man mag ihn gern sein lebelang bewahren; mit diesem Spruch will es mir aber wenig übereinstimmen, daß dein Französisch, wie das nach meinem Befehl eingelegte Blatt ausweist, noch immer recht mangelhaft ist und, abgesehen von jener Eleganz des Ausdruckes, wie sie nun einmal von dem gründlich gebildeten Menschen verlangt werden kann und muß, auch im einzelnen bisweilen recht grobe Fehlschüsse aufweist.«
Es folgte nun eine zwei Seiten lange Erörterung der Verstöße gegen Grammatik und Geist der französischen Sprache. Ottos Blicke flogen über die Blätter. Er suchte seines Herzens Heil. Was waren ihm da die französischen Mängel … Da … da stand es:
»Was nun deinen geäußerten Wunsch anbelangt,
heuer deine Ferien auf Kniephof zu verbringen, so muß ich dir bei aller Würdigung deiner Anhänglichkeit an die Heimat doch zu meinem Bedauern mitteilen, daß ich auch heuer nicht in der Lage bin, diesem Wunsch nachzukommen. Ich wollte, ich wäre es; denn dann stünde es mit meiner Gesundheit besser, als es in der Tat steht. So aber sehe ich mich leider auch dieses Jahr wieder genötigt, ein Bad aufzusuchen, was mir an sich schon wegen der damit verbundenen großen Kosten verdrießlich ist. Denn es steht ja nach wie vor mit der Wirtschaft nicht besser, und trotz meines lebhaften Interesses für den Landbau und trotz der von mir eingeführten Reformen will es nicht so recht vorwärts
gehen, wie es zu wünschen wäre, wovon ich dir ja, da du nun schon alt genug bist, um das zu verstehen, Mitteilung machen kann. Aber die Gesundheit ist das höchste Gut – nächst einer gediegenen Bildung natürlich – und so muß ich denn auch heuer wieder darauf verzichten, dich nach Kniephof kommen zu lassen.«
Vom Vater lag ein Blatt bei. Es enthielt Nachrichten von Haus und Hof. Die Pferdezucht schwang sich auf. Man hätte unlängst einen lustigen Abend bei Blankenburgs gehabt. Hingegen sei in den Schweinestall ein großes Sterben gekommen. Die Freunde freuten sich mit ihnen über den guten Fortgang der Söhne. Unlängst habe man eine neue Sandgrube angeschlagen und dabei eine Menge alter Scherben gefunden. Der Pfarrer habe gemeint, sie seien noch aus der wendischen Zeit. Otto solle sich hüten, sein Geld zu verborgen. Wenn man es wieder haben wolle, so mache man sich Feinde. Mit Kniephof sei es nun freilich wieder nichts. Die Mama habe immer ihre Nerven. Es sei anzunehmen, daß sie vor der Halsschwindsucht Angst habe, an der ihr Vater gestorben sei. Da sei Gott vor, aber man müßte doch ihren Willen tun und wieder ins Bad gehen. –
An diesem Abend rechnete Otto mit Gott ab.
Er konnte ihn ganz scharf ins Auge fassen, wie es ihm bisweilen mit Menschen erging, denen er auf den Grund sehen wollte. Und wahrhaftig, da geschah es, daß der alte Herr immer mehr in seinem Wolkenhimmel verschwamm, sich in Schaum und Nebel löste.
Man brauchte ihn ja nicht ganz abzutun, man konnte ihn in dieser Verdünnung immerhin bestehen lassen, aber das Persönliche, das Väterliche, das Behütende hatte er verloren. Gott hatte keinen Mantel mehr und keine Hände. Das strahlende Auge war einfach zu Licht geworden, von dem das Weltall durchdrungen war.
Und das Gebet? Das Gebet war ein Wälzen von leeren Worten. Helene war gestorben. Kniephof blieb versagt. Der Freund verlor sich.
Es war nur zweierlei möglich. Der Geist der Welt war absolute Unvernunft. Dann war das Gebet ebenso unvernünftig. Oder aber dieser verdünnte Gott war die absolute Vernunft. Dann wieder war das Gebet unnötig, weil die absolute Vernunft doch ohnehin alles auf die vernünftigste Weise anordnete und im Betenden nur zu sich selber sprach. Wenn man es nicht etwa als die frevelhafte Vermessenheit anzusehen hatte, sich von Gott unabhängig machen und ihn wie ein Negerzauberer dorthin locken zu wollen, wo man ihn haben wollte.
So war das Gebet nur das eine oder das andere: Unsinn – oder Lästerung.
Von diesem Abend an betete Otto nicht mehr.