
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mögen die Aventuren, die der ritterliche Johann von Luxemburg zeit seiner ganzen langen Regierung im Umkreis des Abendlandes gesucht, mit dem Preis seines Augenlichts, zuletzt seines Lebens (Schlacht bei Crecy 1346) bezahlt hatte, auch kaum zur kulturellen Hebung des Landes und dessen Hauptstadt beigetragen haben –; zwei Mächte hatten sie doch beschworen, die für Prags, für Böhmens, ja für Gesamtdeutschlands kulturelles Schicksal von größter Bedeutung werden konnten: er hatte Ostland von ansehnlicher Ausdehnung unter seiner Krone vereinigt und er hatte den Strom romanisch-westlicher Kultur osthin gelockt gen Prag. Dies neugewonnene Ostland auszubauen zu einer gesicherten Macht, ihm einen Mittelpunkt zu geben, wozu das alte Prag sich anbot, an diesem Mittelpunkt einen Kulturherd zu schaffen, der ausstrahlen konnte auf solch abendländisches Neuland –; das war die politische Aufgabe. Diese neue Kulturstätte zu speisen mit dem alten Kulturstrom, der aus der Antike nachwirkend damals in Paris sich sammelte, das war die geistige Aufgabe, wie sie aus Johanns Zufallsleben auf Erfüllung wartend schon sich abhob. Beides zu verwirklichen lag weder seinem Temperament, noch wurde sein Schicksal dazu durch politische oder geistige Mächte gewiesen. Sein Sohn Wenzel, als deutscher König Karl IV., war es, der diese macht- und geistpolitische Situation gestalten sollte.
Johann hatte das Kind nach dem geliebten Paris gesandt, hatte es dort bei seiner Schwester, des Dauphins Gemahlin, erziehen lassen. Dort hatte der junge Wenzel seinen Namen (tschechisch: Václav), der für die Franzosen unaussprechbar war, in Karl geändert. Das Pariser Generalstudium beherrschte seine Entwicklung. Pierre Roger, der spätere Papst Clemens VI., war sein Lehrer. Die hohe Scholastik, die damals und gerade in Paris reiches antikes Bildungsgut verarbeitete, bestimmte die Formung seiner geistigen Gestalt. Der sich straffende Zentralismus des französischen Königtums lehrte ihn Politik. Zwei Jahre Italien, wo er das Zufallsreich des Vaters verwalten sollte, lehrten ihn die Macht politischer Wirklichkeiten, die Menschen und Dinge noch eindringlicher kennen. So war alles der Schicksalsstunde Notwendige in ihm angelegt, als er kaum achtzehnjährig Böhmen als Regent betrat (1333).
Vor allem: Böhmen war ihm Mutterland. Noch ehe er in Prag einzog, war er am Grabe der Mutter im Kloster Königssaal niedergekniet. Dies Land weckte sein Blut –; wie der Westen seinen Geist geweckt hatte.
Als Mitregent des meist abwesenden Vaters regelte Karl die arg verwilderten Verhältnisse im Lande. Der Vater hatte ihm nur den Titel Markgraf von Mähren zugestanden, wohl um der eigenen Würde nicht Abbruch tun zu lassen durch den jungen Regenten. Beharrlich und zielsicher ging dieser ans Werk. Das Volk, die Städte faßten Zutrauen. Die Finanzen kräftigten sich, die Rechtsverhältnisse wurden sicherer. Auch der Adel mußte solcher zielbewußten Kraft sich beugen. Dem Vater, der von seinen Reisen aus Geld verlangte, trat der sparsame Landesherr entgegen: dem phantastischen Mittelalter die wirtschaftlich gesinnte Neuzeit. Noch im Jahre 1336 hatte Johann in der alten Judensynagoge nach Schätzen suchen lassen, und als sich an die 2000 Mark dort vorfanden, waren alle Juden pro forma ob der Verheimlichung verhaftet und nur gegen hohes Lösegeld freigelassen worden. Es war die oft geübte Methode, auf einfache Weise zu Geld zu kommen. Auch im Veitsdom war nach vergrabenen Schätzen gesucht, sogar die heiligen Gräber waren erbrochen worden. Karl verwahrte sich gegen derlei Gebräuche. Der Vater grollte ihm –; das Volk dankte es ihm durch aufrichtige Liebe. So sicherte der Regent den Boden, auf dem der König dann aufbauen konnte.
Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn blieb schwierig. Der verschwenderische Vater grollte dem Haushalter, der eitle Vater grollte dem Volksliebling. Aber solches alles waren nur Äußerungen tieferer Gegensätze: hier standen sich nicht nur Personen, sondern Generationen, und nicht nur Generationen, hier standen sich Zeitalter gegenüber. Ein neues Zeitalter stieg mit Karl herauf. Und eben Karl war sein erster weitblickender Gestalter. Er konnte es werden dank der repräsentativen Macht, welche die Umstände ihm zuwarfen: sein Vater hatte ihm die deutsche Königskrone erwirkt (1346).
Damit ist er in jenen Streit der Meinungen hineingestellt, der seit Maximilians I. Ausspruch von »des Reiches Erzstiefvater« seine Gestalt umzuckte. Erst neuere Forschung ist ihm gerecht geworden, hat erkannt, was dieser Herrscher im Gesamtschicksal des Reiches bedeutet. Er war es, der das immer schwankere Gefüge des Reiches auf die feste Grundlage einer starken Hausmacht stellte, eben seiner böhmischen Lande, die er dem Reiche innig einband und mit ihnen den schlesischen Osten, der so erst dem Reich politisch gesichert wurde. Er war es, der als Anreger einer frühen deutschen Renaissance Roms geistiges Erbe nun auch dem deutschen Osten einpflanzte, unter dessen Wirken jene ostmitteldeutsche Sprachbewegung einsetzen konnte, die unserer Sprache die heutige Form geschenkt hat. Von hohem Gesichtspunkt aus ist dieser Herrscher wahrlich ein deutscher Kaiser gewesen.
Von Prag aus gesehen mußte dieser Karl IV. von je als der große nationale Schöpfer und Gestalter erscheinen, als der er besonders im tschechischen Volksbewußtsein heute noch lebt: hier reden von ihm Dom und Brücke, Klöster und Kirchen, das gesamte Stadtbild und der majestätische Geist, der es umweht. Hier ist Karls Person in Stiftungen und Taten, in Erinnerungen und Bräuchen lebendig. Hier wirkt sein Bild noch heute als das des nationalen Königs.
Doch wir wollen hier die imponierende Herrschergestalt nicht von Ansprüchen eines Volkes gegen solche des andern verdunkeln lassen. Was er leistete, gehört beiden an. Von einer umfassenderen Warte aus als der eines nationalen Königtums war all sein Handeln bestimmt. Der neu durch Paris vorbereitete, jüngst durch die Italiener geweckte Universalismus des Menschen hatte in ihm gezündet. Auf dieser Grundidee ruhte der Bau seines geistigen und irdischen Reiches.
Neu waren auch seine politischen Ziele. Er setzte der mit ihrem Schwergewicht südwärts drängenden Imperiumsidee der Staufer –; noch sein Großvater Heinrich VII. hatte ihr bis zum Tod gedient –; den zeitgemäßen Gedanken einer ostwärts gerichteten Kulturpolitik entgegen. Dort im Osten, auf kolonialem Boden, getragen von der Tatenlust der Neustämme, war ein neues Deutschland entstanden. Das Kraftfeld, auf dem des Reiches Schicksal sich austragen sollte, verlagerte sich von den Gebieten der bisherigen Träger, der Altstämme im Westen, immer mehr gen Osten. Von hier aus, von einer starken Hausmacht im Osten aus, hatte schon der kluge Rudolf von Habsburg des Reiches Geschicke zwingen wollen. Besonnener und von der inzwischen herangereiften Entwicklung unterstützt, nahm Karl den zukunftsträchtigen Gedanken auf. Er brach mit dem »fahrenden Kaisertum« der Vorgänger, schuf sich die sichere Grundlage der Hausmacht und der Residenz. Er warf das Steuer abendländischer Kultur jäh herum, indem er die Oststadt Prag zu dieser Residenz erwählte. Im Osten ein Gegengewicht zu schaffen oder auch nur einen neuen Ausstrahlungspunkt für westliche Geistigkeit, das Schwergewicht des Abendlandes herüberzuheben aus dem Südwesten in den neugewonnenen Osten, das war das große Ziel, das diesem Monarchen vorschwebte. Prag wurde es zum Schicksal.
Die neu verpflanzte Kultur sollte verwurzelt werden. Kräfte, die im Boden schlummerten, sollten ihr entgegentreiben. Karl brauchte Volkstum. Er brauchte beide, das deutsche und das slawische Volkstum. Er knüpfte an die alte Geschichte des Landes an. Wenn er seinen Krönungszug vom alten Wyschehrad ausgehen läßt und ihn stromabwärts führt zum Hradschin, so erinnert er damit gleichnisweise an die alte Bedeutung der »Gründerburg«, wie sie die Geschichtsschreiber inzwischen ausgesonnen hatten. Das Hochzeitsmahl aber läßt er auf dem großen neuen Marktplatz in der Gallistadt rüsten, also mitten zwischen den Häusern der deutschen Stadtgeschlechter. Geschichte wird lebendig in seinen Institutionen.
Er schafft dem Slawentum auch die kirchliche Pflegestätte: er beruft Mönche aus Kroatien, stiftet ihnen bei St. Cosmas und Damian nahe am Wyschehrad ein Kloster (1348), in dem sie slawische Liturgie und glagolitische Schrift lebendig erhalten sollen, wie er es vom Papst sich erwirkt hatte. Er ruft damit bewußt jene alte Mittelstellung der Tschechen wieder auf, ihres Schicksals zwischen Ost und West, jetzt aber im gesicherten Bewußtsein, damit den Osten hereinzuziehen in die neugeschaffene Mitte. Wenn er die Würde der tschechischen Sprache hebt –; in Urkunden spricht er von der süßen und sanften Gewöhntheit der heimischen Sprache, vom edlen slawischen Idiom –;, so darf das auf seinen Wunsch, ein gleichwertiges Nebeneinander der Völker zu schaffen, gedeutet werden. Auch das deutsche Element will er stärker im Osten verwurzeln: er verhandelt mit der deutschen Hanse, um deren Kräfte ideell und praktisch hereinzuführen in seine Schöpfung. Der Welthandel soll nun über Prag geleitet werden (Venedig –; Prag –; Brügge!). Seine Handelsbestimmungen sollen Völkerstraßen bahnen vom äußersten Süden bis zum höchsten Nordosten, Straßen, auf denen die Kultur dann gleichläufig ziehen könnte. Prag sollte der große Umschlagplatz werden: ein Zentrum für den gesamten neuerschlossenen Osten.
Bewußt baut er am Kern der neuen Kultur. Drei Bildungsmächte ruft er auf, um sein Werk geistig zu durchdringen: Erzbistum, Universität und Kanzlei. Sie alle drei waren durch kirchliche Bindung zur Einheit geschlossen. Doch eine jede wirkte auf ihre Weise über diese Bindung hinaus. Sie alle drei senkten sich in den Wurzelboden einer Kultur: ins Leben des Volkes, hoben aus ihm die Kräfte, die ein geistiges Leben gesicherter aufwachsen ließen.
Mit dem Erzbistum erwirkte Karl seiner Stadt und seinem Volk jene geistige Unabhängigkeit vom Westen, vom Erzbistum Mainz, die Bøetislaw, Ottokar I. und Ottokar II. vergeblich erstrebt hatten. Bei seinen Besuchen am päpstlichen Hofe in Avignon, zuletzt 1343, hatte Karl gemeinsam mit seinem Vater Johann die päpstliche Einwilligung durchgesetzt: die Bulle vom Jahre 1344 erhob Prag zum Erzbistum, unterstellte ihm die andern Bistümer der böhmischen Krone: das alte Olmütz, das neugegründete Leitomischl. Breslau sollte –; es gelang nicht –; vom Gnesener Erzbistum losgelöst und ebenfalls dem neuen Erzbistum unterstellt werden. Der Erzbischof von Prag sollte künftighin die böhmischen Könige salben und krönen.
Diese geistliche Rangerhöhung traf Ernst Malowetz von Pardubitz, der seit 1342 Bischof auf dem Prager Stuhl war. Er war der Mann, die tiefsten Aufgaben der neuen Einrichtung zu erfassen und zu erfüllen. Die gingen auf Bindung zweier national verschiedener Volksstämme durch eine dritte überragende Geistesmacht. Eine solche war die kirchenlateinische Bildung, wie sie auf romanischen Hochschulen betrieben wurde. Der Pardubitzer hatte in Padua und Bologna studiert. Nun trug er die reiche, christlich geläuterte Geistigkeit, wie sie sich in seiner strengen und klarblickenden Person gestaltet hatte, nach Prag. Er glaubte, durch einen sittlich und geistig hocherzogenen Klerus am nachdrücklichsten auf ein zu bildendes Volksganzes wirken zu können. So ging er ans Werk. Er schickte begabte Kleriker auf die italienischen Hochschulen, daß sie deren Bildung nach Prag zurückbrächten. Er pflegte die hohe geistliche Dichtung, brachte sie, die in den Klöstern des Landes volksfern sich entwickelt hatte, dem neuausstrahlenden kirchlichen Leben zurück. Er ging streng gegen die Nachtseiten des christlichen Lebens damaliger Zeit vor: gegen das Unwesen der Gottesurteile, gegen die Ausschreitungen der Geißlerbrüder. Er hob sein Domkapitel, dem Karl schon 1343 das Kollegium der Mansionare beigefügt hatte. Diese Mansionare wirkten von Prag aus dann auch in der Nürnberger Frauenkirche.
Jetzt erstehen die Übertragungen und tschechischen Bearbeitungen der lateinischen Legenden und Meditationen. Die hohe deutsche Dichtung, wie sie auch am Prager Hofe Eingang gefunden hatte, nimmt die Einflüsse der geistlichen Dichtung auf. Heinrich von Mügeln, der deutsche Sänger, verfaßt seine lehrhaften Gedichte, und Mülich von Prag, die erste uns faßbare geistige Persönlichkeit, die das Prager Bürgertum stellt, ändert seine weltliche Minnedichtung in mystisch-religiöse, lehrhafte Art. Der Kult wird musikalisch ausgeschmückt. Das Kirchenjahr in Böhmen zählt bald 150 musikalische Fest- und Feiertage. Im Dom zu St. Veit sangen damals neben den 24 Mansionaren noch 30 Chorschüler und 12 Psalmisten. Bei St. Ambrosius, dem Kloster, das der Kaiser in der Neustadt, gegenüber dem Auslauf der Zeltnergasse, gestiftet hatte –; später erhielten es die schottischen Hibernermönche –;, wurde der Mailänder Ritus der Benediktiner gehalten. Im Kloster Emaus –; den Namen hatte das Volk geprägt nach dem Tag, an dem der Bau geweiht worden war (Ostermontag 1372) –; wird die slawische Liturgie gehalten. Das gottesdienstliche Leben Prags steigerte sich rasch zu hoher Blüte. Der von Frankreich her eindringende Marienkult senkte eine innige Note in den tiefen Ernst. Der Erzbischof schuf auch die Anfänge einer bischöflichen Bibliothek. Aus Avignon wanderten berühmte Bilderhandschriften nach Prag. Auf der erzbischöflichen Residenz arbeitete eine Abschreiberschule, um die heiligen Schriften allen Klöstern im Lande zu verschaffen. Alles, was dieser große Erzbischof unternahm, zielte auf Gründung einer starken eigenständigen geistlichen Kultur in Prag. Seine tiefchristliche Persönlichkeit verlieh diesem Wirken die innere Spannung.
Solcher Pflanzstätte christlicher Bildung mußte die Forschungsstätte angegliedert werden. Sie sollte dem geistigen Mittelpunkt stets neue Nahrung zuführen, an ihr sollten die geistigen Kämpfe der Zeit ausgetragen werden: das Generalstudium. Von Anbeginn seiner Regententätigkeit galt diesem Plan Karls Sorge, »in der Erkenntnis, daß die geistigen Güter besser, trefflicher und vornehmer seien als die Gaben der Natur und des Glückes …«, wie der Prager Domherr Franz des Kaisers Streben erklärt. Im Jahre 1347 entschied Papst Clemens VI. –; er war Karls Lehrer in Paris gewesen –;, daß in Prag ein studium generale vigeat in qualibet facultate, daß ein Generalstudium nach den Mustern der Studien in Paris und Bologna errichtet werde. Was Wenzel II. für das Land nicht hatte erreichen können, verwirklichte Karl IV. für das Reich: es erhält seine erste hohe Schule.
Sie war ein geistliches Institut. Der jeweilige Erzbischof war Kanzler. Der Studienbetrieb war in vier Fakultäten gegliedert, denen je ein Dekan vorstand: in die theologische, die juridische, die medizinische, die artistische. Dies alles nach dem Muster von Bologna und Paris. Nun das Neue: die Gesamtheit der am Studium Teilnehmenden, Magister, Bakkalauren und Studenten bildeten die universitas. Sie hatte aus ihrer Mitte den Rektor zu wählen. Der Begriff Universität deckte sich also nicht mit dem des Generalstudiums: er faßte nur den mehr verwaltungstechnischen Körper. Über ihm stand das Generalstudium mit dem erzbischöflichen Kanzler an der Spitze als geistliche und geistige Oberbehörde. (So war auch, als viel später, im Jahre 1372, die juristische Fakultät sich von den übrigen Fakultäten infolge interner Unstimmigkeiten schied und sogar ihren eigenen Rektor wählte, die Einheit des Generalstudiums dadurch doch nicht berührt: seine Organisation ertrug das Nebeneinander verschiedener Universitäten.) Die dritte Gliederungsschicht betraf die Nationalitäten: die am Studium Teilnehmenden gruppierten sich landsmannschaftlich. Die böhmische Nation umfaßte alle Einheimischen, Deutsche wie Tschechen, die unter der Krone Böhmens lebten, ferner die Ungarn und Siebenbürger. Zur bayrischen Nation zählte ganz Süddeutschland: Österreicher, Bayern, Franken, Schwaben, die aus Kärnten und Krain, aus der Schweiz und aus Tirol und aus Reichsitalien, die Hessen, die Rheinländer und Westfalen. Zur polnischen Nation gehörten außer den Polen, meist deutschen Kolonisten, noch die Litauer, die Preußen und die Schlesier. Zur sächsischen Nation zählte das ganze übrige Norddeutschland. Jede Nation verfügte bei wichtigen Entscheidungen über eine Stimme. Der Rektor sollte wechselnd aus den verschiedenen Nationen gewählt werden.
Ein ziemlich kompliziertes Wahlsystem galt sowohl für die Wahl des Rektors als für den ihm beigeordneten Universitätsrat. Rektor und Universitätsrat gemeinsam hatten die Gerichtsbarkeit über alle dem Studium Angehörigen. Sie hatten auch die Verwaltung der zum Unterhalt des Studiums –; meist von geistlicher Seite –; gestifteten Liegenschaften und Einkünfte zu führen. Diese Ökonomieverwaltung war, den zerstreuten Liegenschaften entsprechend, recht mühsam und umfangreich. Nun schlossen sich auch noch allerhand Gewerbe ans Studium an. Vor allem das Abschreibergewerbe blühte. Auch diese dem Studium verbundenen Gewerbe waren der Rechtsprechung des Rektors unterstellt, der Landesgerichtsbarkeit entzogen. Diese eigene Verfassung samt eigener Jurisdiktion schuf gleichsam einen eigenen Staat im Staate. Er hatte kirchlichen Charakter, zielte aber doch in die Welt.
Wichtig für die wirtschaftliche Grundlegung und auch für den geistigen Zusammenhang des Studiums wurden bald die Stiftungen der sogenannten Kollegien, in denen die unverehelicht lebenden Magister zusammen wohnten. Karl IV. selbst hatte im Jahre 1366 das Karlskollegium gestiftet. Dem waren zunächst ein Haus in der Judenstadt, das Haus des Juden Lazarus, als Heim und verschiedene Liegenschaften in der Umgebung Prags als Unterhaltsmittel zugewiesen worden. Noch im gleichen Jahre verfügte der Kaiser eine Verbindung dieses Kollegs mit dem Kollegiatkapitel bei Allerheiligen: jedes zur Erledigung gelangende Kanonikat bei Allerheiligen sollte mit dem jeweiligen Senior der Magister des Karlskollegs besetzt werden. Erst viel später (1383) wurde das Karlskolleg dann in das stattliche Eckhaus nahe der Gallikirche verlegt, das von dem reichen Bürger Rothlöw erworben worden war. (Heute wiederhergestellt entsprechend dem Bestand nach dem Umbau im Jahre 1718.) Um das Recht über dieses und das später (1380) von König Wenzel IV. gestiftete Wenzelskolleg sollten zu Ende des Jahrhunderts dann jene nationalen Streitigkeiten ausbrechen, die das Studium bis in seine Grundfesten hinein erschütterten. Jetzt aber schoß noch frische Kraft in die junge Gründung.
Zu Magistern waren berühmte Lehrer auswärtiger Studien berufen worden: Juristen aus Bologna, deren Studium von je in der Jurisprudenz florierte, Magister der freien Künste aus Paris, wo die freie Geistigkeit der Zeit ihre hohen Wellen schlug. Zahlreiche Magister stellten die Dominikaner bei St. Clemens. Auch die Schule der Minoriten bei Sankt Jakob wird im Zusammenhang mit dem Studium gerühmt. Kanoniker vom Domkapitel blickten schon auf eine ansehnliche Lehrtradition zurück. Eigene Gebäude für den Lehrbetrieb gab es nicht. Die Professoren hielten ihre Vorlesungen in ihren Wohnungen oder aber, falls sie Ordensgeistliche waren, in ihren Klöstern. Die Graduierungen zu den von dem Generalstudium zu vergebenden Würden des Magisters oder Doktors und Bakkalaureus waren feierliche Akte, denen der Kanzler in Person präsidierte. Lange, eingehende Prüfungen gingen ihnen voraus. Innerhalb der einzelnen Fakultäten wurden regelmäßige Disputationen abgehalten. In der Artistenfakultät war die glänzendste die sogenannte »Disputatio de quolibet«, die alljährlich einmal, gewöhnlich am 3. Januar, eröffnet und mehrere Tage hindurch gehalten wurde.
Karl erwirkte eine päpstliche Bulle, die den Orden der ganzen Christenheit empfahl, ihre jungen Ordensleute ans Prager Generalstudium zu schicken. Besonders die Dominikaner folgten diesem Ruf. So wuchs dieses Prager Studium. Karl hatte es mit so weitreichenden Machtbefugnissen ausgestattet, wie er es nimmer als bloßer böhmischer König, wie er es nur als Herrscher über das Reich, als deutscher Kaiser, verwirklichen konnte. So überragte Prag als Reichsuniversität dann auch die andern Studien, die bald darauf im aufstrebenden Osten, in Krakau durch Kasimir den Großen und in Wien durch Rudolf IV., als Landesuniversitäten gegründet worden waren.
Wir können uns das Leben an der damaligen Universität nicht bunt genug vorstellen. Studierende aus aller Herren Länder, aus allen Lebensaltern und Lebenslagen, Geistliche und hoher Adel und Bürgersöhne und Vaganten aus Böhmen und Italien, aus Frankreich und England, vor allem aber aus den deutschen Ländern finden sich in dieser Republik des Geistes zusammen! Karl hatte für weitestgehende Geleitsicherungen gesorgt. Bald war das Prager Studium eines der besuchtesten Generalstudien des Abendlandes. Phantastische Zahlen werden genannt. Auch bei vorsichtiger Schätzung muß man annehmen, daß die Zahl der Teilnehmer die Tausend weit überschritt. Das Zusammen so vieler Geistbeflissener ließ ein höchst lebendiges Treiben inmitten der Prager Städte erwachen, das nicht nur im Geistigen sich betätigte. Deutsche und tschechische Studentenlieder erklangen auf den Gassen, die alten Gewerbe hatten ihren Anteil an dem Leben, neue erstanden aus besonderen Bedürfnissen des Studiums. Prag war eine Studentenstadt geworden. Wenn sich in diesen ersten Jahrzehnten auch keine überragenden Gelehrtenpersönlichkeiten unter den Professoren nachweisen lassen –; erst in den Sechzigerjahren tritt in dem aus Paris zugewanderten Ericinio eine, wenn auch problematische, so doch überragende geistige Gestalt auf den Plan, der wir später noch begegnen werden, und der Jurist Bartolos de Sassoferrato war eine Leuchte seiner Wissenschaft –;, so schien es damals doch, als ob im Prag Karls IV. ein geistiges Gegengewicht gegen den Westen erwachsen sollte. Der Osten hatte sich sein geistiges Organ geschaffen.
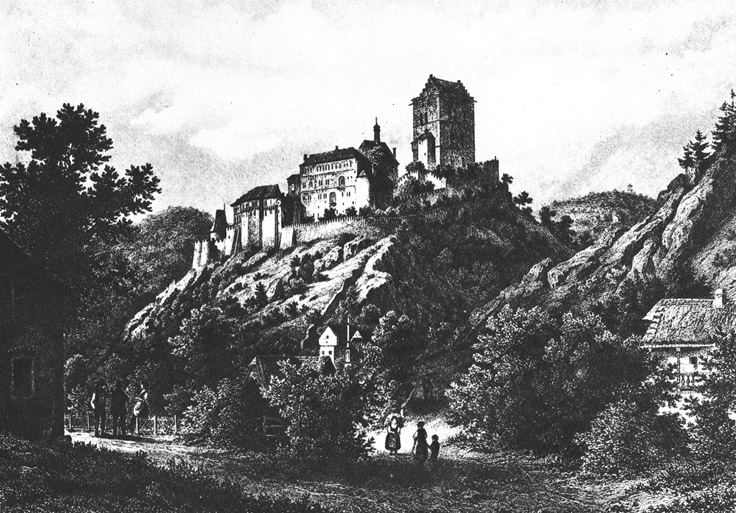
Burg Karlstein um 1840
(im Berauntal). Stahlstich nach einer Zeichnung von Vincenz Morstadt, gestochen von Fesca um 1840. Das Blatt zeigt den Bestand der in der Mitte des 14. Jahrhunderts durch die Architekten Karls IV. erbauten Burg vor der Restauration (1888-1897) durch Joseph Mocker
War Erzbistum und Generalstudium durch die Person des Kanzlers gleichsam von obenher verbunden, so war die dritte geistige Macht, die Karl in Prag errichtete, von unten her dem Generalstudium und auch dem erzbischöflichen Stuhl verknüpft: hier in der Kanzlei fanden sich zahlreiche Graduierte des Studiums als Notare und Protonotare oder auch nur als Schreiber zusammen, wirkten also den Geist des Studiums als Verwaltungsbrauch hinaus ins Land. Karl hatte die Reichskanzlei vom Sitz der Erzkanzler, der Erzbischöfe von Mainz und Trier gelöst, hatte sie selbständig gemacht, hatte sie in Prag konzentriert.
Bald sehen wir Johann von Neumarkt, einen schlesischen Geistlichen, der über Breslau nach Prag gekommen und dort in die Kanzlei eingetreten war (1347), als obersten Kanzler an der Spitze des Instituts (1353). Er ist es, der die geistige Haltung des gesamten Kanzleiwesens unter Karl bestimmt. Eine reiche, aufgeschlossene Natur, organisatorisch tüchtig, dem tiefsten geistigen Streben der Zeit verbunden und doch der Welt sehr zugewendet –; so war er der gegebene Mittelsmann zwischen dem rein geistlichen Studium und der aus dem Südwesten eindringenden Bildungswelt Franko-Italiens. Er greift die neuen Bildungsideen, die aus Italien herüberwehen, eifrig auf. Er läßt über das kanonische Recht, das drunten auf dem Generalstudium eifrig traktiert wurde, das zivile römische Recht eindringen in die Amtsführung der Kanzlei. Auch über das Stilistische bahnt er dem römischen Recht die Wege in die deutsche Rechtsprechung. Die alten Landrechte müssen darüber weichen. Karls frühere Versuche, die alten Rechtsbräuche zu ersetzen durch ein neues geschriebenes Recht –; auch hierin war er Verfechter von Ideen, die schon Wenzel II. vergeblich betrieben hatte –;, zu ersetzen durch die »Majestas Carolina«, Versuche, die auch dieser geachtete Regent gegenüber den Ständen nicht durchzudrücken vermocht hatte, reifen jetzt durch die Wirksamkeit der Kanzlei gleichsam unter der Hand heran. Johann von Neumarkt war der kluge Verwaltungspolitiker, der hier seinem kaiserlichen Herrn die Erfolge allmählich und von den Gegnern unbemerkt in die Hand spielte.
Vor allem aber: der Kanzler war ein sprachgewaltiger Mann. Er bildet sich an Cicero, liest Dante in der Ursprache –; er besitzt eine Handschrift der »Göttlichen Komödie« –;, tauscht Briefe mit Cola di Rienzo, mit Petrarca. Er führt die klassischen, in der leoninischen Ära einst wieder gepflegten cursus und numeri in die Kanzleisprache ein. Er sammelt Musterbriefe der Kanzlei zur Summa Cancelleriae Caroli IV. –; man glaubt den Schatten Peters von Vinea, des großen Kanzlers Friedrichs II., zu bemerken. Er bildet seinen Beamtenstab zu modern geschulten Juristen heran, reformiert in ihnen das ganze Land, das Reich.
Denn die Kanzlei ist Durchgangsstätte für alle späteren Notare, für die Schreiber in den Städten, für die Sekretäre des Adels. Von hier aus wirken Johanns Impulse persönlich hinaus ins Leben des deutschen Abendlandes. Hier lernten die späteren Stadtschreiber der größeren Städte Böhmens, Mährens, Schlesiens: ein Johannes von Gelnhausen, ein Wenzel von Iglau, ein Johannes von Saaz. Von hier mögen die Antriebe ausgegangen sein zu den Übertragungen der Heiligen Schrift in die Volkssprache, wie sie im 14. Jahrhundert nirgends so zahlreich sich finden wie im Wirkungsbereich dieser Stätte. Von der »Tepler Bibel« bis zur »Wenzelsbibel« des Prager Bürgers Rothlöw erstreckt sich die lange Reihe dieser frühen deutschen Bibelübertragungen.
Gerade damals drangen allüberall die Landessprachen herauf in die Gerichts- und Kanzleisprache, ein gewaltiger, elementarer Vorgang. Ein Glück für die deutsche Sprache, daß ein Johann von Neumarkt diese Bewegung von oben her aufnehmen, klären, bilden und gestalten konnte. Er ist ein schöpferischer Prosaist. Seine Übersetzungen Ciceronischer Reden zeigen bedeutende Sprachgewalt. Dem Kaiser übersetzt er die dem heiligen Augustinus zugeschriebenen Soliloquia als »Buch der Liebkosunge«. Er hebt die Urkraft der Sprache herauf in seine Urkunden und bereichert sie von oben her mit der ganzen Metaphernpracht des Lateins, wie es ihm aus dem Verkehr mit den italienischen Reformern zuströmt. Der Überschwang und die manchmal schülerhafte Begeisterung seiner Briefe klärt sich in der Zucht des Kanzleistils: hatte er ihn am hohen Latein der Neurömer geformt, so nährte er ihn an der deutschen Umgangssprache, wie sie damals in Prag sich herausbildete. Die Zuwanderung aus den verschiedenen deutschen Gebieten hatte sowohl ober- wie mitteldeutsche Spracherscheinungen dem Prager Idiom zugeführt und dies eben zu einer Zeit des Übergangs vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Das zusammen ergab die günstigste Grundlage für eine gemeinsame Schriftsprache, zunächst für Ober- und Mitteldeutschland. Johann von Neumarkt hatte also in Prag die Grundlagen für die folgenreiche mitteldeutsche Sprachbewegung bereitet, in die dann anderthalb Jahrhunderte später durch Luthers Bibelübersetzung der protestantische Osten und unter seiner Führung schließlich Gesamtdeutschland eingehen sollte.
In der Prager Kultur unter Karl IV. ist der Kanzler der Stilist und Ästhet, der dem großen Moralisten und religiosus Ernst von Pardubitz zur Seite tritt. Die Arbeit beider trifft sich im Kern: in der Durchbildung des heimischen Volkes. Sie trifft sich aber auch in den Außenbezirken: die erzbischöfliche und kaiserliche Kanzlei ergänzen gegenseitig ihre Bestände, tauschen Schreiben aus, sammeln gemeinsam Bilderhandschriften in Avignon und Kleinbildkunst in Italien. Und sie pflegen selbst eine bedeutsame Illuminatorenkunst. Des Kanzlers »Liber Viaticus« und der »Liber Pontificalis« sind kostbare Proben. Der »Liber Viaticus« ist um 1350 entstanden. Oberitalienische Einflüsse sind deutlich, die Figuren werden fest und substantiell. Italien war hier Lehrmeister für die kaiserliche Kultur. Aber schon stößt Eigenes hinzu. Sehr originale Haltung arbeitet an dem »neuen böhmischen Stil«. Avignon erklärt ihn nicht. Andere Handschriften der Zeit zeigen ihn ebenfalls: das »Orationale Arnesti« des Erzbischofs, das Missale eines Olmützer Bischofs (im Prager Domkapitel), das »Marienbuch« des Konrad von Heimburg (im Böhmischen Nationalmuseum). Lauter Großwerke einer heimischen Schule.
Die strenge ehrwürdige Gestalt des Erzbischofs ergänzt der Kanzler nach der weltoffenen Seite hin. Seine Briefe verraten oft, wie sinnenfreudig und übermütig das Leben am Hofe des genialen Kaisers war.
Denn sicher war es Genialität, was diesen Kaiser die Auswahl seiner obersten Beamten treffen ließ. Genial auch gegenüber den schwierigen nationalen Problemen, über die das Kirchenlatein eine hohe Einheit spannte. Seine religiöse Inbrunst lehnte sich an den Erzbischof an, den altadeligen Tschechen. Sein weltorganisatorischer Sinn stützte sich auf den Kanzler, den Deutschen. Nun fand er auch noch den bildenden Künstler, der seinen Architekturtraum –; er war ein Architekt im geistigen und im wirklichen Raum! –; erfüllen sollte: den Schwaben Peter Parler.
Bauen –; das scheint eine Leidenschaft des Kaisers gewesen zu sein. Als er, achtzehnjährig, ins Land gekommen war, stand die Burg verfallen, seit dem schweren Brand ums Jahr 1303 noch nicht wieder aufgebaut. Er hatte damals in einer bürgerlichen Unterkunft drunten in der Altstadt hausen müssen, wie er klagend berichtet. »… Das Königreich fanden wir also zerstört, daß wir auch nicht eine königliche Burg fanden, die nicht mit allem ihrem Zubehör verpfändet war, so daß wir nichts hatten, wo wir Aufenthalt nehmen konnten, außer in den Häusern der Städte, als wären wir ein gewöhnlicher Bürger gewesen … Die Prager Burg aber war so verwüstet, zerstört und heruntergekommen, daß sie seit den Zeiten des Königs Ottokar fast dem Erdboden gleich geworden war …« Aber gleich beginnt er mit dem Wiederaufbau der Burg. »Ad instar domus regis Francie« –; nach dem Muster des Hauses des Königs von Frankreich –; heißt es da. Aber der Schluß auf den Louvre oder ein anderes französisches königliches Schloß wird durch nichts im Baubefund gestützt. Karls Burgerneuerung war eine Wiederaufrichtung des Ottokarschen Palasbaus, mutmaßlich in französisch-gotischen Einzelformen und mit Inneneinrichtungen nach französischem Vorbild. Damals scheinen die Kellergewölbe verstärkt, mit kräftigen Gurten unterfangen worden zu sein. Da das aufgehende Mauerwerk zu Teilen noch im späteren (Wladislawschen) Saalbau steckt, läßt sich die Innenaufteilung des Hauptgeschosses erschließen: drei große Räume, deren einer der Thronsaal gewesen sein mag. Durch ein Portal gelangte man auf den Treppenaltan, von dem aus der Kaiser hinunterstieg zu Versammlungen auf dem Platz. Inmitten dieses Hauptgeschosses hatte sich der fromme Kaiser noch eine kleine Kapelle zu persönlichem Gebet einrichten lassen. Auch der Ottokarsche Westflügel wurde erneuert und in Entsprechung zu ihm wurde an dem Nordostende des Palasbaues ein zweiter Wohnflügel errichtet. (Später wurden in ihm zwei Stockwerke zusammengezogen und zum Landtagssaal ausgebaut.) Vom reichen plastischen und malerischen Schmuck dieses Palas sind Reste aufgedeckt worden.
Die Allerheiligenkapelle hatte der junge Markgraf ebenfalls in bösem Zustand angetroffen. Auch sie ließ er erneuern (1338). Und nun errichtete er an dieser Kirche ein Kollegiatkapitel von Propst, Dechant, elf Kanonikern und zehn Vikaren. (Wir hörten schon oben von ihm.) Zum ersten Propst bestimmte er seinen vertrauten Freund und Berater Oèko von Wlaschim, der später den erzbischöflichen Stuhl bestieg.
Neben dem Palas sollte der Dom aufragen. Wie um das Erzbistum anzulocken, hatte Karl gemeinsam mit dem Vater schon im Jahre 1344 den Grundstein zu einem prachtvollen neuen Dom gelegt, der den größten des Abendlandes gleichkommen sollte. Der Antrieb zum Neubau dürfte auf den Sohn zurückzuführen sein. Er hatte den Baumeister in Avignon geworben, einem Hochsitz damaliger Kunst. Dieser Matthias von Arras zeichnete ihm die Risse einer großen Kathedralkirche mit hohem Kapellenkranz. Rodez, eine Weiterführung Narbonnes, war Vorbild (Kletzl). Etwas nordöstlich der alten romanischen Basilika wurde mit dem Bau begonnen. So konnte jene zunächst noch ganz und auch unterm Fortschreiten des Neubaues doch in ihrem Westteil noch stehenbleiben, bis der Gottesdienst in den fertigen Teil des neuen Domes übertragen werden konnte. Die heiligen Gräber sollten nicht berührt werden: der neue Bau sollte später die Grabstätten Wenzels und Adalberts überfangen (vielleicht war hiefür schon damals ein Kapellenanbau geplant). Nun wuchsen die Grundmauern aus der Erde, die Wände der Ostkapellen stiegen auf, hohe gotische Fenster wurden eingesetzt, die ersten Pfeiler errichtet.
Ein anderer Monumentalbau erstand draußen im Land, einen gemächlichen Tagesritt von Prag entfernt. Dort im stillen Tal der Beraun wollte der Kaiser eine Burg errichten, welche die wertvollsten Reliquien, die er so eifrig sammelte, und die Kroninsignien, die er endlich nach dem Tode seines Gegenkaisers Ludwig von Bayern aus München überkommen hatte, aufnehmen sollte. Dieser »Karlstein« ist ein eigenartiger Bau geworden: nicht mehr die altüberlieferte deutsche Kaiserpfalz, sondern wieder reiner Wehrbau von einigermaßen kompliziertem innerem Gefüge. Anklänge an den französischen Donjon-Typus sind im turmartigen Hauptbau deutlich, wie überhaupt Planung und Aufbau französische Einwirkung zeigen. Mag nicht auch die Burg der Päpste zu Avignon eingewirkt haben? Gegen solche Grundideen des Baues kontrastieren dann aber seltsam die in den oberen Stockwerken eingebauten Kapellen. Sie bringen ein merkwürdiges Raumempfinden zum Ausdruck, für damalige französische Gotik jedenfalls ungewöhnlich. Breitlagernde Räume umfangen den Andächtigen. Die Wände sind mit buntem Halbedelgestein belegt, bald dumpf drohend, bald hell schimmernd. Darüber in langen Reihen in die Wände eingelassen die Tafelbilder des Theoderich (Kreuzkapelle), an andern die großen Fresken. Das ist eigenwüchsig böhmische Prägung. Das Land hat seinen Stil gefunden. »Auf dem weiten Erdkreis gibt es keine Burg noch eine Kapelle von so kostbarem Werke –; und dies mit Recht, denn hier sind des Reichs Kroninsignien mit dem ganzen Schatze des Königreichs aufbewahrt …«, berichtet des Kaisers Geschichtsschreiber Benesch von Weitmühl über Karlstein.
Doch vor die Vollendung Karlsteins fällt die folgenreichste Architekturtat des Kaisers, die das gesamte Stadtgefüge neu organisiert. Die Prager Altstadt samt der Kleinen Stadt unter der Burg war zu eng geworden für das großstädtische Leben, das die kaiserliche Residenz mit all ihrem Zubehör, mit der Ansammlung der neuen Bewohner, mit dem Gedränge der Fremden, die zu Hofe gingen, bedingte. Die Siedlungen drängten über Wenzels und Ottokars Mauerkranz längst hinaus. Vor allem die Moldau aufwärts, dem Wyschehrad zu, waren um die alten Kirchen herum neue Wohngebiete entstanden. Sie alle sollten nun mit einem Schlag dem Weichbild der Stadt einverleibt werden. Eine wahrhaft kaiserliche Planung, wie sie das Abendland in diesem Ausmaß noch nie gesehen. Sie entspricht nicht nur zeitlich der Universitätsgründung.
Alte Berichte sprechen von der neuen Stadtplanung als von Karls persönlicher Leistung. In den Ostertagen des Jahres 1347 war in deutscher Sprache die Gründungsurkunde auf Schloß Pürglitz (Køivoklaty) ausgefertigt worden. Am 8. März 1348 legt Karl eigenhändig den Grundstein zur neuen Stadtmauer. Die etwas schwülstigen Gründungsdekrete –; man glaubt schon hier Johann von Neumarkts frühen Stil zu vernehmen –; regeln bis ins einzelne die Verhältnisse in der neuen Gründung, so daß Karls persönlichste Teilnahme auch an der Planung kaum zu bezweifeln ist. Der weite Bezirk vom Petersviertel an der unteren Moldau entlang den Hügeln im Süden bis fast an den Fuß des Wyschehrad hin soll planvoll verbaut werden. Plätze von einer selbst für östliche Verhältnisse ungewohnten Größenerstreckung schaffen ein Achsensystem, das etwa radial zum Kern der Altstadt ausgerichtet ist. Süddeutscher Straßenmarkt (Roßmarkt, heute Wenzelsplatz) und ostdeutscher Rechteckmarkt (Viehmarkt, heute Karlsplatz) treffen in dieser großzügigen Prager Anlage zusammen. In dieses Achsensystem spannen sich Querstraßen in etwa rechteckiger Blockaufteilung. Der Gegensatz von sehr großen Freiplätzen und verhältnismäßig kleinen, genau abgemessenen Bauparzellen ist bezeichnend für die damalige Vorstellung »Stadt«. Die Mauern und Gräben zwischen der Altstadt und der neuen Gründung bleiben bestehen. Tore vermitteln den Verkehr. Das Gallitor öffnet sich unmittelbar zum neuen »Roßmarkt«. Die gesamte Neuanlage wird gegen Ost und Süd ummauert, nur die Moldauseiten bleiben unbewehrt. Warttürme in je 200 Meter Abstand sichern den Gürtel, nur fünf Tore führen ins Freie.
Und dieses sehr große Gebiet soll nun möglichst schnell besiedelt werden. Die Dekrete sichern allen, die sich hier anbauen werden, die gleiche bürgerliche Freiheit zu, wie sie den Altstadtbewohnern seit je zugestanden war. Diese Neustadt soll ein eigenes Gemeinwesen sein und wird mit »Nürnberger Recht« begabt. Grund und Boden wird in genauer Vermessung zugeteilt, wird allmählich Eigentum der Ansiedler. Außer den Grundsteuern sind keinerlei Haussteuern zu bezahlen, auf zwölf Jahre bleiben die neuen Bewohner überdies von allen sonstigen Abgaben frei. Aber spätestens einen Monat nach Zuweisung der Gründe muß der Ansiedler den Bau beginnen und spätestens achtzehn Monate nach der Zuweisung muß das Haus unter Dach stehen. Das Anwesen darf nicht höher als bis zur Hälfte seines Wertes hypothekarisch belastet werden, um Überschuldung des Besitzes und den daraus folgenden Verfall des Hauses zu verhüten.
Die Altstadt soll durch die Neuanlage entlastet werden: so sollen alle lärmenden und übelriechenden Gewerbe, die Mälzereien, Darren, Gerbereien, Brauereien, ferner Wagner und Zinngießer und Schmiede –; mit Ausnahme der Huf- und Wagenschmiede –; innerhalb Jahresfrist in die Neustadt verlegt werden. Aber die Altstadt soll unter der Neuanlage auch nicht zu kurz kommen. So dürfen zum Beispiel Juden aus der Altstadt nicht in die Neustadt verziehen. Wohl aber sollen in der Neustadt Juden von außerhalb neu angesiedelt werden. Bezeichnend, daß sich trotzdem kein neues Judenviertel in der Neustadt gebildet hat: die dort angesiedelten Juden scheinen ins Ghetto der Altstadt gezogen zu sein.
Um der Neuanlage ein eigenes wirtschaftliches Leben zu sichern, werden bestimmte Märkte aus der Altstadt hierher verlegt: der Dienstag-Wochenmarkt und der große Jahrmarkt am St.-Veits-Tag. Architektonisch, verfassungsrechtlich, wirtschaftlich war die neue Gründung ausgezeichnet gesichert. Die Beamten des Königs haben über all diese Vorschriften streng zu wachen, vor allem auf die besonderen Bauvorschriften, die genaue Höhen- und Breitenmaße der Häuser, besonders auch der Gassen und Plätze vorschreiben.
Karl bricht also mit dem Stadtgründungssystem der Pøemysliden, die den Lokatoren alle Einzelheiten überließen und nur die großen Einkünfte aus der Länderverteilung bezogen. Er nimmt auf das Stadtganze Bedacht, und er bleibt der alles bis ins einzelne regelnde Herr. Auch hier wieder fällt auf, wie selbstverständlich der Kaiser »regiert«. Man vergleiche nur diese Dekrete mit denen der Prager Schöffen unter Johann, und man wird spüren, wie jetzt alles vom König ausgeht und hier etwas wie ein aufgeklärter Despotismus –; wenn man diesen historisch erst viel später entwickelten Begriff hier vorwegnehmen darf –; im Wachsen ist, dem sich die Untertanen offenbar gern fügen. Aber trotz allem organisatorischen Bedacht auf ein Stadtganzes, das eine wirtschaftliche Einheit bieten soll, bleibt Karl zunächst doch bei dem althergebrachten Prinzip der Sonderstadt: die Neustadt erhält ihre eigene Verwaltung, eigene, vom König eingesetzte Schöffen, ihr eigenes Gericht. Die Vereinigung mit der Altstadt (1367) hält sich nicht. Die Mauern, die Alt-Prag umzirken, blieben bestehen. Zwischen Alt- und Neustadt zieht der tiefe Graben.
Das Neue lockt. Siedler in Mengen kamen. Das reiche Leben der Universitäts- und Residenzstadt bot Anziehungspunkte genug. Elf Jahre nach der Gründung will man schon 100 Fleischhauer in der Neustadt gezählt haben, was einen Schluß auf die Bevölkerungszahl erlaubt. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert saßen im Gebiet der Neustadt auch nicht mehr. Gesamt-Prag mag unter Karls späterer Regierungszeit an die 40.000 Einwohner gehabt haben.
Der Stadtkörper hatte sich stark gedehnt. Es bedurfte jetzt der monumentalen Durchgliederung, der Aufführung architektonischer Schwerpunkte, um die Gesamtstadt zu künstlerischer Einheit zu zwingen. Das Mittelalter monumentalisiert vornehmlich mittels seiner Gotteshäuser. An solchen war in der vergrößerten Stadt starker Bedarf. Die Kirchen der Altstadt waren zu klein geworden für die Mengen. Die neue, größere Franziskanerkirche steht im Bau, auch St. Ägidien. Neubauten sollen drüben in der Neustadt erstehen. Da werden Pfarrkirchen benötigt. Und der Kaiser stiftet Klöster. Gründung auf Gründung überliefern diese Jahre. Droben auf dem Hradschin wird am Ostteil des neuen Chors gebaut. Die alten Burgtürme im Osten und Westen des Burgbezirks werden zu neuem Glanz erweckt: der Kaiser läßt den »Weißen« und den »Schwarzen« Turm mit »goldenen« Dächern decken. Seit dem Eisgang im Jahre 1342 lag die alte Brücke über die Moldau in Trümmern. Der Verkehr zwischen Burg und Stadt wurde kümmerlich genug auf einer Notbrücke vermittelt, unwürdig der stolzen kaiserlichen Residenz. Große Bauaufgaben warteten allüberall der Verwirklichung. Der König plante und plante.
Der Meister, den er aus Avignon mitgebracht hatte, war gestorben (1352). Die dringenden Bauaufgaben erlaubten keine Unterbrechung der Arbeit. Schon im nächsten Jahre holt er Ersatz. In Schwäbisch-Gmünd, wo Meister aus der Kölner Dombauschule an einem sehr neuartigen Kirchenbau arbeiteten, hatte er den dreiundzwanzigjährigen Meistersohn Peter Parler angetroffen. Er schien ihm geeignet für die von ihm geplanten Aufgaben. Er warb ihn an für Prag. In diesem jungen, kühnen und sehr modern gesinnten Architekten erstand ihm der Baumeister, den er brauchte. Er verband vorzügliche technische Schulung mit sicherem künstlerischem Blick. Die Art, wie er den stockenden Dombau aufgriff, ungenügenden Substruktionen der Pfeiler nachhalf, wie er die überkommenen Risse später französischer Hochgotik dem modernen Empfinden anpaßte, sie überführte in die eigenen Ideen, das muß ihm Karls ganzes Vertrauen errungen haben. Der überträgt ihm nach und nach sämtliche Monumentalaufgaben, die er in Prag und Böhmen überhaupt zu vergeben hatte.
???$$$
Jetzt wird der Brückenbau in Angriff genommen; eine Großleistung damaliger Technik. Ein Meister Ottlinus wird in den Bauurkunden erwähnt. War er dem Architekten beigegeben? Wir glauben, Parlers Geist zu spüren. Der Neubau wurde nicht auf den Resten der alten Brücke gegründet. Die wurde weggeräumt –; damals keine leichte Aufgabe, wo doch ohne jede Sprengung gearbeitet, die Trümmer und Pfeilerreste der eingestürzten Brücke mit umständlich aufgerichteten Kränen aus den Fluten gehoben werden mußten. Dicht neben den alten wurden die neuen stärkeren Pfeiler errichtet. In freier Bogenfolge schwingt sich das Bauwerk über den Strom, gegen die Burgseite einmündend in den alten bestehenden Brückenkopf der Judithbrücke. Dessen Turmreste wurden in das neue Brückentor verbaut. Das schafft die sanfte Kurve der Brücke, die künstlerisch wie technisch gleich bedeutsam ist. Das künstlerische Moment –;: der Brückenlauf kurvt sich dem Stromlauf leicht entgegen –; ist zugleich ein technisches: der Wasserdruck wird dadurch in etwas abgeleitet. Vielleicht sprachen auch wehrtechnische Momente mit: da der Brückenkopf in anderer Flucht steht als der Brückenlauf –; durch die leichte Krümmung am Westende der Brücke –;, konnte von diesem Brückenkopf aus im Kriegsfall die ganze Brücke in die Flanke genommen werden, und umgekehrt: dieser Turm war von der Brücke aus ballistisch nur schwer zu erfassen. Das ganze Werk atmet noch die Wucht und die schwere Massigkeit, wie sie romanischen Bauwerken eignet. Dies aber keineswegs eine Rückständigkeit des durchaus gotisch fühlenden und konstruierenden Meisters, sondern vielmehr ein wesentliches Moment aller der Erde schwer verhafteten Nutzbauten auch noch des hohen Mittelalters: es ist, als ob sie das Erdverhaftete ihres Dienstes in die feinere Fügung der hohen Gotik aufzulockern nicht zuließen.
Mit dem Brückenturm auf der Altstädter Seite rammte der Meister die Brücke fest ins Ufer, wohl nicht ohne Bedacht auf die architektonische Entgegnung, die dieser machtvolle Torturm den Domtürmen oben auf dem Hradschin –; er sah sie im Geist schon vollendet –; einmal geben mußte. Wie die Brücke die Ufer verbindet, so bindet dieser Turm die Altstadtmassen rhythmisch an die Burgbauten drüben auf dem Hügel.
Die bekamen nun den großen zusammenfassenden Akzent: hinter dem Palast, über ihn emporwachsend, steigt der neue Chor in die Höhe. Peter Parler hatte des Matthias Grundplanung beibehalten. Aber in der Fortführung von Grundriß und Aufriß setzt er seine Ideen durch. Über den Ostkapellen beginnt Parlers Werk: die Fenster werden weit, neue, breiter fließende Profile hauchen dem Stein, dem ganzen Bau ein anderes Leben ein. Im Innern gürten klar gezogene Gesimse und die schwingende Triforiengalerie den Raum. Die Wände sind ganz aufgelöst in Fenster, auch hinter den Triforien ziehen sie abwärts. Und doch: die abschließende Fläche ist jetzt spürbarer als im hochgotischen Raum des vergangenen Jahrhunderts, besonders spürbar, wenn farbige Scheiben die einströmenden Lichter filtern. (Die weißen Scheiben des heutigen Zustandes verhärten das Licht.) Der Raum wird ruhig. Still gleitet er an den Diensten nieder, die aus den Gewölben sich lösen.
Ja, das ist die große Wandlung im Raumempfinden, wie Parler sie ausdrückte: ehedem stießen die straffen Dienste aus dem Boden hinauf, stemmten sich gegen die Last der Gewölbe. Jetzt schwingen diese Gewölbe im immer engeren Netz der Rippen, scheinen sich selbst zu halten. Die Dienste gleiten von ihnen nieder, nur noch leise Vertikalklänge im ruhigen, auf wagrechten Gliederungen ausgewogenen Raum. Alles aktive Tragen, Hinaufstemmen der Lasten spielt sich im Außenbau ab, wo die kunstreichen Gerüste, ein Dickicht aus Stein, den zarten Raumleib umstehen, ihn gleichsam schwebend halten zwischen den starken Pfeilern.
Ein solcher Raum drängt in die Breite. Gleich die ersten Kapellen im Norden, die Parler den vorgefundenen Ostkapellen anfügt, greifen in ruhiger Quadratform über die ursprünglich geplante Fluchtlinie hinaus. Im Süden schaffen solche Kapellen gar einen allmählichen Übergang bis zum hier weitausladenden Querhaus. Es war die Stelle, an der die heiligen Gebeine ruhten. Ihre Stätte sollte nicht angetastet werden. Die Weiterführung des Neubaues hatte die Ostteile der romanischen Basilika schon verdrängt. Nun wurde auch der Ostteil ihres südlichen Seitenschiffes vom Neubau überfangen. Parler komponiert eine besondere Grabkapelle: über quadratischem Grundriß geht sie auf, schiebt sich zum Teil in den südlichen Querhausflügel hinein. Zwischen Dienstbündeln und tieffluchtenden Gesimsen sind ruhige Wandflächen eingespannt, wie Bilder in ihre Rahmen. Malerei, zu der sie einluden, durfte denn auch üppig hier sich entfalten: ein Meister Oswald(?) schuf die Figurenzyklen, die in ruhigen Farben und stiller großer Form den Raum umziehen. Die Sockelwände dämmern im Schmuck eingelegten Gesteins. Es steigert das Fremdartig-Traute dieser Wenzelskapelle. Hier mag's einem sein, als ob man einen still fragenden Blick auf sich ruhen fühlte, dessen leiser Trauer und doch auch Zuversicht dieser Raum geweiht scheint. Vom Gesimse der Ostwand grüßt der Heilige nieder, den Blick auf die Tumba gerichtet. Ein Vetter Heinrich Parler, aus Freiburg, wo ein anderer Zweig der Parler arbeitete, zur berühmten Prager Hütte zugewandert, mag sie geschaffen haben.
Doch wir eilten der zeitlichen Darstellung voraus. Diese Ausschmückung der Wenzelskapelle fällt in die Siebzigerjahre, in die letzten von Karls Regierungszeit. Noch aber ist sein Werk in großer Entfaltung. Prag reift zu immer großartigerer Gestalt heran. Jener Rhythmus von Burgbauten und Brückenturm schlingt sich weiter in die Stadt hinein. St. Ägidien und St. Jakob kommen unter Dach. Im Herzen der Altstadt rüsten die Kaufleute schon wieder an einem Neubau ihrer Teynkirche. Ein hoher Chor wächst auf –; Einflüsse der Parler-Hütte sind deutlich. Geplant sind zwei mächtige Türme im Westen. Das zieht jenen Rhythmus mitten in die Stadt herein.
Und nun drängt auch schon die Neustadt an. Über die gleichmäßig gereihten neuen Bürgerhäuser steigen die Kirchenleiber empor. Dicht vor den Altstadtwällen wachsen hohe Mauern auf: nahe beim Roßmarkt wird am Chor der Klosterkirche Maria-Schnee gebaut. Karl hatte das Kloster 1348 den Karmelitern gestiftet. Es soll der höchste Chorbau in den Prager Städten werden. Erst unter Wenzel wird er vollendet samt dem schlanken Turm. Zum Aufbau des Schiffes ist es nie gekommen. Die Hussitenwirren verhinderten es, legten auch Chor und Turm in Trümmer (Chor heute restauriert). In der nordwestlichen Altstadt wird die Hl.-Geist-Kirche gebaut. Ebenfalls vor den Altstadtmauern, beim Einlauf der alten Osthandelsstraße, stiftet der Kaiser den Benediktinern eine Klosterkirche zum hl. Ambrosius. Die Stiftung sollte erinnern an des Kaisers Krönung mit der lombardischen Eisenkrone in Mailand. (Das Kloster kam später an die schottischen Hiberner.)
Im Westteil der Neustadt standen noch die Kirchen aus der romanischen Zeit. Nun wird im Südteil, wo das Gelände gegen Osten ansteigt, eine neue Pfarrkirche errichtet: St. Stephan, eine kaiserliche Gründung. Man folgt noch dem basilikalen Schema, allerdings sehr vereinfacht, mit einschiffigem Chor (nach Art der Bettelordenskirchen). Ein starker Turm springt vor die Westfassade vor. Die kleine romanische Stephansrotunde hinter der neuen Kirche wird nun dem hl. Longinus geweiht. Auch auf der andern Seite des großen Mittelplatzes (Roßmarkt) läßt der Kaiser eine Pfarrkirche errichten. Hier in St. Heinrich setzt sich der Hallengedanke restlos durch: drei gleichhohe Schiffe in breit behäbiger Einfaltung. Von den Westtürmen wird nur einer ausgebaut. Der lange Gassenzug, der den Mittelplatz im rechten Winkel schneidet, hatte durch den Kirchenbau eine architektonische Festigung erfahren.
Auch auf dem Wyschehrad regt sich bauliches Leben. Karl läßt die alte Basilika gotisch erneuern, wohl auch den Königspalast. Er ehrt die Stätten, wo seine Vorfahren hausten. Im Sluper Talgrund, unter dem Wyschehrad, bauen die Serviten –; Karl hatte sie 1360 nach Prag berufen –; ihr Gotteshaus, das einem damals aufkommenden reizvollen Typus folgt: an den in 7 Seiten des Zwölfecks geschlossenen Chor schließt sich ein quadratischer Schiffsraum, dessen Kreuzgewölbe von einer Mittelstütze empfangen werden (Wölbung erst nach den Hussitenwirren). Vor dem zusammengenommenen, straff aufgehenden Bauleib springt das Türmchen vor. Auf der Höhe darüber erstanden nun St. Apollinaris für ein Kollegiatskapitel, das der Kaiser gestiftet hatte, und nahebei, für die Augustinerinnen, St. Katharina mit dem schlanken Turm, wichtige Blickpunkte für die den Stadtkörper begrenzenden Höhen. Unten am Moldauhang geht der große Klosterbau von Emaus, Karls reiche Gründung, der Vollendung entgegen. Die Einweihung der Klosterkirche, einer breitgelagerten, ursprünglich turmlosen Halle, war ein stolzer Tag für den Kaiser (Ostermontag 1372). In großem kaiserlichem Ornat zeigt er sich dem Volk, um ihn ein festliches Gepränge. Viele geistliche und weltliche Fürsten des Reichs, fremde Gesandte, der ganze Hofstaat nehmen teil. Der Kaiser feiert das Gelingen seines Werks, des politischen draußen und drinnen, und auch des künstlerischen. Seine Stadt Prag reift ihrer künstlerischen Gestalt entgegen.
Und damals stiftete der Herrscher –; gleich einem Schlußstein an diesem geistig-künstlerischen Werk –; den Karlshof. Auf dem höchsten Punkt der Neustadt, auf dem Hügel oberhalb des Boticbaches, sollte der Neubau stehen, dem Rhythmus also, der vom Hradschin herabwirkt in die Prager Stadt, den letzten großen Aufklang sichernd.
Die neue Gründung galt den Augustiner-Chorherren, deren auf platonischer Tradition gründende Spekulationen der heimliche Renaissancemensch liebte. Heimliche Renaissance treibt auch in diesem merkwürdigen Kirchenbau. Auf den Kaiser selbst dürfen wir die Wahl dieses Typus denn doch wohl zurückführen: ein Oktogon, über dem sich ein Kuppelbau erhebt. Wollte er im Gleichnis architektonischer Nachfolge die Beziehung dartun, die ihn, den deutschen Kaiser, mit dem großen Vorfahren auf dem Thron, dem fränkischen Karl, verband? Er kannte Aachen. Karls des Großen Grabrotunde sollte also in neuer Prägung hier erstehen. Seiner Renaissancegesinnung mochte der Kuppelbau entsprechen. War Parler der Meister? Die heutige Kuppelwölbung entstammt der Mitte des 16. Jahrhunderts. Entspricht sie einer ursprünglichen? Oder hätte Karl die Rotunde doch mit innerem Stützenkranz errichten lassen, getreuer also dem Aachener Vorbild? Wäre die kühne Kuppel vielleicht doch erst später, vielleicht nach einem Einsturz der ersten Wölbung (auf Stützen?), über den äußeren Mauerring gezogen worden (Ende des 15. Jahrhunderts)? Die Sage, daß der Baumeister des Karlshofs, verzweifelnd am Gelingen des gewagten Werks, beim Niederbrennen des hölzernen Leergerüsts unter der Wölbung anläßlich der Ausrüstung der Kuppel in den Flammen umgekommen sei –; er habe sich dem Teufel verschrieben gehabt –;, könnte im Kern die verwehte Überlieferung eines Einsturzes halten. So grüßte nun über ein halbes Jahrtausend hinüber, über Stadt und Strom, der neue Rotundenbau, die Erinnerung an jenen alten, dessen letzte Hochmauerreste dem neuen Dome hatten weichen müssen.
So klang der Massenrhythmus der Türme und Kuppeln über dem karolinischen Prag. Er führte über die Gesamtheit der Prager Städte hinweg, band –; ganz gleichsinnig wie der Grundriß –; künstlerisch zusammen, was sozial und politisch die Zeit noch getrennt halten mußte. Die neue Zeit klang in ihm auf. Sie arbeitete sich auch im inneren Gefüge dieser Bauten stetig und folgerichtig hindurch zu neuen Gedanken. Gerade in der karolinischen Architektur Prags läßt sich verfolgen, wie das neue Raumideal der Halle sich allmählich durchsetzt. St. Ägidien hatte es nach Prag gebracht. Nun arbeitet es sich über die Hebung der Seitenschiffe bei St. Stephan und vor allem in der Teynkirche bis zur reinen Halle in St. Heinrich und bei Emaus in breiter Front durch. Auch Parlers empfindsamer Künstlergeist erkannte das Streben der Zeit. Er zwang es in Formen, die ihrerseits nun wieder die Zeit gestalten sollten. Seine Anregungen wirken von Prag aus in den Osten (Kolin, Kuttenberg), nach Süden (Prachatitz, Wien) und zurück nach dem Westen. (Einwirkungen der Prager Parler-Hütte in den süddeutschen Parler-Hütten sind deutlich.)
Im Kirchenbau vollendete sich damals die zeitgemäße Strömung: die Predigtkirche siegt über die Altarkirche. Das aber ist baulicher Ausdruck jener Bewegung, die den Prediger- und Bettelmönchen den Zustrom des Volkes bringt. Die Bewegung hatte schon in den ersten Regentenjahren Karls zu wilder, sogar tätlicher Hetze der Weltgeistlichen gegen die neuen Ordenskleriker geführt. Das Volk war den Pfarrkirchen, deren starr gewordener Kult die religiöse Sehnsucht nicht mehr befriedigte, entlaufen. Es wollte das eindringlich gesprochene Wort Gottes hören. Die Prediger- und Bettelmönche boten es. Die Bewegung hatte sich inzwischen zugunsten der Dominikaner und Franziskaner entschieden. Die Pfarrgeistlichen mußten ihr in der Form ihrer Gottesdienste schon Zugeständnisse machen.
Solche Spannungen ließen den Unterbau der karolinischen Kultur schon damals, wenn auch nur erst leise, erzittern. Der Oberbau rundete sich immer großartiger zur schöpferischen Mitte des Ostens. West- und südher schossen die Kräfte an. Männer wie Johannes von Neumarkt, der nach Avignon und vor allem nach Italien die eifrigsten persönlichen Beziehungen unterhielt –; wie Peter Parler, der seine Bauhütte aus den großen deutschen Hütten ergänzte und umgekehrt seine Kräfte an die Städte des Reiches aussandte, wie der Magister Ericinio, der mit den Hochschulen in Paris und Bologna in lebhafter Verbindung stand und die Disputationen des Prager Studiums belebte und auch wild erregte –;, sie und viele andere sorgten für den steten lebendigen Blutkreislauf in der Bildungssphäre des Hofes und der Stadt.
Berühmte Gäste schufen Bewegung und neue Ziele. Als Cola di Rienzo, der vertriebene römische Volkstribun, dämonischer Phantast, als Flüchtling und doch als hochgeehrter Gast am Hofe auf dem Hradschin erschien (1350), glaubte man in ihm den Genius des erwachenden Italien in Person begrüßen zu müssen. Und wahrlich: bestechend wirkte diese genialische Persönlichkeit. In ihm schien die stolze Pracht der Antike noch einmal aufzuleben. Er sprach das Latein schwungvoller als die alten Römer. Die Morgenröte der neuen Zeit schien in seinem Geist zu funkeln. Johann von Neumarkt jubelte, konnte sich nicht genug tun in Ehrungen des Gastes. Und alle übrigen mit ihm. Nur der Kaiser verhielt sich zurückhaltend und kühl. Rienzos Imperiumsträumen, die der Kaiser von Rom aus verwirklichen müsse –; solchen Phantastereien stand er skeptisch gegenüber. Seine im Politischen so praktische Natur hatte längst die eigentlichen Ziele der Zeit, seine eigenen erkannt. Er baute auf sicherem Boden seines Landes den Machtkern aus, mit dem er ein neues Abendland zu schaffen am Werk war. Da päpstlicher Bann dem angestaunten Flüchtling folgte, übergab ihn der Kaiser dem Gewahrsam des Erzbischofs. Der setzte ihn in milde Haft auf seinem Schlosse Raudnitz unweit Prag. Von dort her kamen nun Rienzos Briefe, entzückten den Hof, vor allem Johann von Neumarkt. Aber die politischen Mächte sind stärker als aller betörender Zauber des »Geistesritters«. Nach zwei Jahren wird der »Gottestribun« doch vor den päpstlichen Richterstuhl gebracht.
Einige Jahre später (1356) erschien in Karls Residenz der Dichterfürst Petrarca. Auch er voll phantastischer Pläne, wie er sie dem Kaiser schon anläßlich des ersten Zusammentreffens in Italien angesonnen hatte. Damals (1354) hatte Johann von Neumarkt seinen kaiserlichen Herrn auf dem Zug über die Alpen begleitet. Der Romtraum spukte all diesen Neurömern im Blut. Wieder lehnte der Kaiser kühl ab, nicht ohne Humor, immer aber voll Skepsis gegen die südländischen Träumer. Aber Petrarca, der Dichter, war doch gewaltiger Zündstoff für die neue Bildung, die eine Welt des Geistes aufzubauen, den Menschen als deren Mitte einzusetzen versprach, die das Individuum zum universalen Weltbürger steigern wollte. Er erstaunte über das Werk im Barbarenland, sah dort im festen Umriß schon verwirklicht, was er vielleicht so ganz anders erträumt haben mochte. Noch nach der Rückkehr in die Heimat schrieb er begeisterte Briefe zurück auf den Hradschin. Grollte insgeheim aber doch dem »derben« Kaiser, sicher auch in einiger verletzter Eitelkeit, die der lebenskluge Karl längst durchschaut hatte.
Dieser »derbe« Kaiser arbeitete inzwischen eifrig an der Durchdringung seiner Lande, vor allem seiner Hauptstadt mit dem neuen Kulturgut. Er hatte namhafte Maler nach Prag berufen, seine Schlösser und Kirchen auszuschmücken. Er war ein Kind dieser bildfrohen Zeit und ihr Führer. Jetzt wächst eine monumentale Malerei in Prag heran. Einwirkungen verschiedener Zentren mischen sich hier zu neuem Gehalt. Da wirkte als Hofmaler des Kaisers der aus Straßburg stammende Nikolaus Wurmser. Seine Hauptwerke schuf er in den Kapellen, Sälen und Treppenhäusern von Burg Karlstein. (Restaurierungen unter Rudolf II. haben das meiste vernichtet.) In der Wenzelskapelle dürften sich Werke des Meisters Oswald erhalten haben. Zu solchen deutschen Einwirkungen traten unmittelbar italienische: Tomaso Barisini aus Modena vermittelte –; in einiger Brechung –; die große oberitalienische Tradition durch eines seiner Hauptwerke: »Die Madonna mit dem Kinde zwischen den Heiligen Wenzel und Palmatius« auf dem Altar der Karlsteiner Kreuzkapelle. In Meister Theoderich von Prag trat der heimische Maler von großem Format in die Reihen der fremden. Er malt seine Tafeln für Burg Karlstein. Dort in der Kreuzkapelle sind sie noch streng architektonisch in die Wände eingelassen. Eine schwere Substanz ringt in diesen Gestalten um Form, im seelischen Ausdruck noch verhangen, oft gar dumpf. Aus Urwelten scheinen sich diese Gesichter langsam zu lösen, aber reiche Kräfte drängen schon ans farbige Licht. Die starke Wirklichkeit wird in dieser Malerei gestaltet.
Um diese Meister, deren Namen wir mit bestimmten Werken verbinden können, reiht sich die Vielzahl der andern, die da aus deutschen Städten zuwanderten, aus Augsburg, München, Regensburg, Passau, aus Erfurt, Halberstadt und vielen andern. Für alle war reichlich zu tun. Nicht der Kaiser allein war Auftraggeber. Ein großer Hof, eine reiche Stadt verlangte nach Ausdruck im Bilde. Und da waren die Kirchen, die alten, die neuen malerischen Schmuck verlangten, die neuen, die würdig neben die alten treten sollten. Freskenmalerei gedieh in Prag und Böhmen. Die großartigste Freskenfolge erstand damals im Slawenkloster Emaus. Dort im Kreuzgang waren Künstler am Werk, die in hinreißenden Szenen die malerische Höchstkultur der Zeit in Prag zur Wirkung brachten. Die Fresken sind heute zum Teil sehr schlecht erhalten, zum Teil (im Osttrakt) ganz verschwunden, Restaurierungen (noch aus der Barockzeit) haben den reinen Klang vielfach zerstört. Trotz allem: die monumentale Gesinnung jener großen Zeit schlägt noch immer durch. In die wuchtige Art giottesken Geistes schmelzen leisere Töne ein, wie Siena sie gebracht, wie Frankreich sie weitergeführt hatte. In 79 Bildern sind typologische Darstellungen gegeben: oben jeweils Szenen aus dem Leben Christi, denen in den Streifen darunter je zwei Szenen aus dem Alten Testament gegenübergestellt werden. Also das Schema der »Biblia pauperum« und des »Speculum humanae salvationis« (Heilspiegel), wie es damals in seinen oft einfachen, oft geheimnisvollen Entsprechungen immer wieder abgewandelt wurde. Formale Beziehungen zu Wandmalereien in Treviso und Padua, auch zu bolognesischen Miniaturen sind deutlich. In diese mischen sich klar vernehmbar Anklänge an die nordfranzösische Malerei: der Stilkreis der (um einige Jahre jüngeren) Apokalypse von Angers, der herrlichen Teppichfolge, scheint hier von größter Bedeutung. Er hat aus illuminierten Handschriften geschöpft, und diese Quellen müssen auch diese Fresken im Emaus-Kreuzgang und die böhmischen Handschriften, die eng mit ihm zusammenhängen, gespeist haben. Der Stammbaum der Luxemburger, der in kaiserlichem Auftrag auf Burg Karlstein damals entstand –; leider untergegangen –;, hängt engst mit den Emaus-Fresken zusammen. Und wie viele Werke dieser bedeutenden Malergeneration mögen verschwunden sein! Ihre stilistischen Ausstrahlungen sind in der deutschen und österreichischen Wand- und Glasmalerei um 1400 schöpferisch wirksam.
Zu den Fresken- und Tafelmalern, mit ihnen in engstem stilistischem Zusammenhang, traten die Buchmaler, die im aufstrebenden Prag reichste Beschäftigung fanden. Sie fußten auf der hohen heimischen Tradition. Auch in der Buchmalerei macht sich jetzt Verfeinerung, Zuspitzung, Verschleifung der Melodien bemerkbar. Die Klöster, die geistlichen Würdenträger, die weltlichen Großen –; sie alle ließen sich ihre heiligen Bücher ausmalen. Eine Illuminatorenkunst entsteht, die dann in den Tagen Wenzels IV. ihre höchste Blüte erreicht, sogar die Hussitenstürme überdauern konnte: ihre gesicherten Traditionen stemmen sich noch im 16. Jahrhundert der eindringenden Renaissance entgegen.
Sicher dürfen wir in der Organisation all dieser Maler in der »Prager Malerzeche« auch wieder Karls Einfluß vermuten. Wenn er, der die Persönlichkeit des Künstlers so achtete, daß dieser es wagen durfte, seine Porträtbüsten neben der des Kaisers aufzustellen (Triforiengalerie des Domes), wenn dieser Kaiser die Künstler zunftmäßig zusammenschließt zur »Zeche«, so nicht, um sie ins Handwerk hinunterzudrücken, sondern sie durch Zusammenschluß auch sozial zu heben. Dann aber auch, um in solchem Zusammenschluß die Schulung und weitere Ausbildung des Nachwuchses zu sichern, dessen sein Land bedurfte. Man wird die Gründung dieser Prager Malerzeche also doch nicht nur im Rahmen damaliger Zunftgründungen überhaupt sehen dürfen. Man hat in ihr, deren deutsch verfaßte Statuten uns erhalten sind, mit Recht eine Art früher Kunstakademie gesehen.
Neben der Malerei, vor ihr, steht eine große Bildhauerei. Plötzlich steigt sie auf, ein gewaltiger Einbruch in die Prager Atmosphäre. Bisher war Plastik in der Hauptsache auf Bauornamentik beschränkt gewesen. Das Wenige, was wir aus früheren Zeiten an Bildhauerei kennen, scheint Import zu sein. Jetzt verwurzelt sich in Prag, in den Ländern der böhmischen Krone, ein plastisches Schaffen von unerhörter Kraft und Eindringlichkeit. Es verwurzelt sich –; das heißt: es nimmt Kräfte aus dem Boden auf, arbeitet sie den Anregungen aus den Herkunftsgebieten ein, wird zum Ausdruck des karolinischen Prag. Diese Atmosphäre mußte auf solchen Ausdruck in der Plastik, auf solche Verleiblichung ihres Empfindens drängen, diese kraftbewußte, die Einzelpersönlichkeit herausprägende Kultur der Männer um Karl IV. Die hohe Zeit der deutschen Bildhauerei des vergangenen Jahrhunderts hatte hier noch kein Echo finden können. Erst jetzt war der Boden reif für diese Kunst der Vergegenwärtigung, der Gestaltung der Masse zum menschlichen Bild. Was in den Malereien eines Theoderich noch dumpf und befangen blieb –; in der Aussage durch den Stein gedieh solche Erdgebundenheit zum wesensgemäßen Ausdruck, ja durchbrach dessen Schwere zu unerwarteter Lebendigkeit.
Mit Peter Parler war solche große Kunst hier eingezogen. Überlieferungen der west- und südwestdeutschen Hütten brachen in dieser lebensstarken Luft unvermittelt zu Höchstleistungen vor. In den Kapellen des Veits-Chors sollten die Gräber der Pøemyslidenfürsten monumental gestaltet werden. Auf schweren Tumben liegen die Gestalten. Die großartigste Schöpfung, die Tumba des Ottokar I. (in der ursprünglich den Heiligen Adalbert und Dorothea geweihten Kapelle), wird dem Meister Peter selbst zugeschrieben (Sechzigerjahre). Wie ein Gebirge steigt diese körperliche Masse auf und nieder. Der Schädel, breit, massig, urtümlich, scheint vorbrechen zu wollen aus dumpfer Lauerstellung. Wo im Abendland war damals solche ungestüme Kraft am Werk? Und dies das Werk des Meisters, der oben die zarten Triforien schuf, die feinen Klänge der Raumfolgen abstimmte! Die übrigen Tumben (5) schließen sich dieser Schöpfung an. Keiner der Gehilfen erreicht die Größe des Meisters, doch der kraftvolle Geist der Hütte treibt auch in ihnen.
Eine formale Steigerung solch monumentaler Gesinnung war nicht möglich. Ein Weiter mußte in anderer Richtung durchbrechen. Das gelang in den Büsten auf dem Triforium im Hochchor. Dort sollten neben dem Kaiser, seinem Vater, seinem Sohn, seinen vier Gemahlinnen auch die höchsten Würdenträger der Kirche, die Baudirektoren und die beiden Meister Matthias von Arras und Peter Parler selbst von den Pfeilerwänden grüßen. Wir wissen, daß der Kaiser persönlich an der Aufstellung des Programms mitgewirkt hat. Erst nach seinem Tode kam es zur Verwirklichung. In den frühesten Büsten glaubt man Peter Parlers Gesinnung zu sehen. Dann schaffen andere Hände. Die Formen erweichen sich, die Massen quellen weich aus. Breite, lyrisch untertönte Gesichter kreisen um einige Porträttypen. Auf einige großformige Stücke könnte Pariser Einfluß (Louvre, Cölestinerkirche) gewirkt haben. Dann plötzlich wieder ein Wurf: die Büsten Peter Parlers und Wenzels von Radetz. Ein unmittelbarer Schüler des Peter Parler muß sie geschaffen haben. Durchbruch ins zwingend Porträthafte, dabei eine menschliche Größe und eine Formkraft, wie die abendländische Plastik sie nirgends sonst erreicht hatte (um 1390). Angesichts dieser Büsten erst ermißt man die Höhe damaliger Prager Kultur, die menschliche Bedeutung der sie tragenden Persönlichkeiten.
Eine stolze Schwebe, die nie lange sich halten kann. Weder im Leben selbst –; zur Zeit der Schöpfung dieser Büsten sank die Kulturwelle ja schon ab in die erschlaffende Atmosphäre eines Wenzel IV. –; noch in der Kunst –;, die Bildhauer der Parler-Hütte beugten sich mehr und mehr dem malerischen Zug der neuen Entwicklung. Der Reliefschmuck am Altstädter Brückenturm zeigt den Hang zum Erweichen der Formen, zum Verflüssigen der körperlichen Massen. Noch stählt zwar ein monumentaler Zug die Figuren, und stärkste Lebensnähe läßt auch hier den porträthaften Zug nachklingen –;: die prachtvolle Figur des alternden, gichtkranken, in sich zusammengesunkenen Kaisers! Der Trieb zum porträthaft Lebendigen schlägt einmal aus in den großartigen Versuch, den Qualentod der Ludmila –; sie war erwürgt worden –; realistisch zu schildern. Aber gerade in dieser Tumbenfigur über dem Grabmal der hl. Ludmila in der Georgskirche verspürt man die großartige innere Gehaltenheit dieser »Parler-Plastik«: noch die grausamste Schilderung bewahrt den Zug stilvoller Gebundenheit ans Ideal, die großen Linien klingen immer in reiner Melodiosität zusammen. In den Tympanonreliefs an der Teynkirche obsiegt der malerische Zug: Szenenschilderung in flächiger Behandlung breitet ein Schauspiel aus, dem mehr das Auge als –; wie ehedem –; das körperliche Empfinden des Betrachters folgt.
Wir nannten hier nur die Hauptstufen der Entwicklung innerhalb der Parler-Hütte. Einschüsse anderer Parler-Hütten –; in der Wenzelstatue der Wenzelskapelle zum Beispiel –; hatten immer für regen Kräfteaustausch gesorgt. Über alle ost- und mitteldeutschen Länder hat diese Prager Plastik ihre Einwirkungen ergossen, gleichläufig wie die Gesamtkultur dieser Stätte. Überall ist ein Abbröckeln der in Prag errungenen Monumentalität, der sie weiterführenden Porträthaftigkeit zu verspüren. Überall aber doch auch die tiefe Kraft, mit der die Prager Leistung die Allgemeinentwicklung weitertreibt.
Wir deuteten oben den Zusammenschluß der Maler zur Prager Malerzeche als eine Stärkung der künstlerischen Persönlichkeit unter Karl IV. Die Bildhauer verblieben, mit ihren Namen uns nicht faßbar, innerhalb der Bindung ihrer Hütte. Die geschlossene Hütte arbeitet auf dem Hradschin. In der offenen Zunft fanden sich die Maler und die andern. Und doch waren es die gemeinschaftlich so eng gebundenen Bildhauer der Parler-Hütte, die jener Zeit den höchsten Ausdruck ihres Strebens schenkten: das Abbild der in sich gegründeten Persönlichkeit.
Unter all dem hochgeistigen Kulturbetrieb blühte ein Bürgerstand heran, der die neuerschlossenen Handelswege, den gesteigerten Verkehr, das Anwachsen der Prager Städte klug zu nützen verstand. Die deutschen Geschlechter wahrten ihren Einfluß. Von Universität und Kanzlei strömten ihnen geistige Stützen zu. Der Großmarkt war ganz in ihren Händen. Die Stapelgerechtsame, denen gemäß alle über Prag geführten Waren zuerst einige Tage hier zum Kaufe angeboten werden mußten, gestatteten günstige Einkaufsmöglichkeiten. Die Rolandstatue, die später am Kleinseitner Ufer neben die Brücke gestellt wurde, ist Sinnbild dieser Gerechtsame. (Heute im Lapidarium, an ihrer Stelle eine getreue Nachbildung.) Die Silbergruben von Kuttenberg und Iglau, die teilweise in Händen von Prager Bürgern waren, spendeten leichten Reichtum. Man baute sich prächtige Kirchen, dachte an die Errichtung eines stolzen Rathauses. Einstweilen wurde das in einem Bürgerhaus (1338) eingerichtete für die amtlichen Zwecke besser ausgestaltet. Das »mazhaus« wurde erweitert, eine große Ratsstube wurde eingebaut, auch Wohnräume für den ersten Stadtschreiber. Und unten Gefängniszellen (1350). Der prächtige Erker am Südosteck des Turms wurde erst später (1381) angebaut. Im Prunk der Geschlechterhäuser eiferte man dem Vorbild italienischen und flandrischen Bürgerlebens nach. Blieben die Wohnhäuser zunächst auch nur bescheiden, so entfalteten sie in ihrem Innern doch Reichtum und Pracht. Aus Italien kamen die seidenen Stoffe, aus Augsburg die goldenen Geräte, aus Flandern die Gewebe. Und auch der heimische Markt bot immer reichere Schätze. Besonders das Kunsthandwerk blühte auf unterm Bedarf dieser Häuser. Von nationalem Zusammenschluß der Deutschen, von bewußter Betonung des eigenen Volkstums und zielbewußter Sammlung zu politischem Willen hören wir nichts. Alle Kraft dieser fürstlichen Kaufherren, dieser fleißigen Gewerbler, floß in die großen Handelsunternehmungen, in den Ausbau der gewerblichen Einrichtungen. So mußten die Deutschen denn auch beim Ausbruch der politischen und nationalen Kämpfe ohne Führung und wehrlos dem Sturme weichen.
Während in der Altstadt Prag die deutschen Bürger das Übergewicht behalten zu haben scheinen, erringen in der Neustadt bald schon die Tschechen die Mehrheit. Der Vorgang läßt sich an dem allmählich sich ändernden Stärkeverhältnis von deutschen und tschechischen Ratsherren der Neustadt gut verfolgen. Hier bot sich günstiger Ankauf, bot sich leichteres Eindringen in handwerklichen und geschäftlichen Erwerb. Auch in der »kleineren Stadt« (Kleinseite) scheint sich der gleiche Vorgang abgespielt zu haben. Die Tschechen rücken in breiter Front auf ins Bürgertum, stellen auch in den geistigen Berufen, am Generalstudium, in der Geistlichkeit immer mehr Vertreter, leisten Bedeutendes in der Kunst. In Neustadt und Kleinseite erringen sie die Mehrheit. Die Neustadt sollte ja denn auch bald den Hussiten die ersten Stützpunkte bieten.
Auch das Judentum in Prag war wieder stark geworden. Schon bald nach der Jahrhundertwende (1316?) hatten sich die Juden eine neue Synagoge errichten lassen: einen zweischiffigen Bau, mit fünfrippigen Gewölben –; das christliche Basilikaschema war den Juden verboten –;, noch herb wie frühe Gotik, im Raumbild schon dem neuen Geschmack entsprechend. Die Laubornamentik im Tympanon deutet auf deutsche Vorbilder des späten 13. Jahrhunderts, die Ornamentik im Innern aber, die achteckigen Pfeiler und anderes doch erst auf die ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts. Um sie gruppiert sich der Kern der Judenstadt, schon damals ein merkwürdiges Gewirr enger Gassen, in denen orthodoxe Lehre und weltliche Geschäftigkeit gegensätzlich genug sich mischten.
Diese Altstädter Judengemeinde war seit langem die Zentralbehörde aller Juden des Landes. Hier wurde vom eigenen Richter jüdisches Recht gesprochen, hier wachten die streng orthodoxen Rabbiner über die Lehre. Von hier aus wurden auch die Judensteuern des ganzen Landes eingetrieben und an die königliche Kammer abgeführt. Sie beliefen sich damals auf 400 Mark. Die Königsunmittelbarkeit der Juden unterstreicht auch im Politischen die Ausnahmestellung, in der sie inmitten der übrigen Stadtbevölkerung infolge ihrer Glaubens- und Rassenfremdheit lebten. Der König verfügt über sie. Der König entscheidet über ihren Wohnsitz. Der König kann ihre Schuldforderung annullieren, wenn er dadurch der Altstadt zum Beispiel ein Geschenk machen will (1362). Der König gewährt ihnen aber auch das Zinsnehmen –; allen Christen war es von der Kirche verboten –; und wacht über ihre Ansprüche, soweit sie nicht mit den Geboten der Kirche in Widerspruch geraten. Die hatte, indem sie den Christen den Wucher und alles Zinsnehmen streng untersagte, den Juden ein zweischneidiges Privileg gewährt. Das Darlehensgeschäft spielte damals schon eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Indem man es den Juden überließ, verknüpfte man sie doch immer wieder mit dem Gemeinwesen, aus dem man sie auf der andern Seite so geflissentlich auszuschalten suchte. Die Prager Synode vom Jahre 1349 hatte strenge Vorsichtsmaßregeln gegen das Eindringen des jüdischen Elements in die Christengemeinschaft geschaffen. Besonders in der geschlechtlichen Vermischung sah sie Gefahr. Und so gebot sie den Juden als Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Christen das Tragen des althergebrachten breitkrempigen Hutes an Stelle der Kapuzen, den Judenfrauen das Vornehmen einer Locke auf die Stirn unter dem Schleier. Am Karfreitag aber durfte sich überhaupt kein Jude in den christlichen Städten sehen lassen. Vollkommene Abschnürung also auf der einen Seite, heikelste Inanspruchnahme auf der andern. Unterirdisch wuchs der Hader, zumal die Juden Zinssätze bis zu 108 vom Hundert nehmen konnten. Unter Wenzel IV. brach der angesammelte Haß aus. In den Ostertagen 1389 überfiel das Volk die Judenstadt. Die Prager mußten dem König, der sich der Juden als bequemer Geldquelle bediente, mit 20.000 Schock büßen. Auch die Schätze der Judenstadt verblieben der königlichen Kammer.
Bewegt war das Leben in der Stadt. Fremde höchster und einfachster Herkunft bevölkerten die Herbergen, Gäste des Hofes, Fürsten, Gelehrte und Künstler brachten Anregung, Studenten trieben ihr Spiel. Das alles führte ein üppiges Leben herauf. Auch die geistlichen Stände verschlossen sich ihm nicht. Den Kaiser verdroß es. So weltoffen er war in seinem Bildungsstreben, so fanatisch gläubig war er doch in seinem religiösen Leben. Sein Reliquienkult kannte keine Grenzen. Auch das Volk sollte daran teilnehmen. Auf dem größten Platz der Neustadt, dem heutigen Karlsplatz, wurden auf hohem Gerüst am Tage der Heiligen Veit und Wenzel die Kroninsignien und die wertvollsten Reliquien dem Volke gezeigt. Diese Einrichtung führte nach des Kaisers Tod sogar zum Bau einer Kirche, der Fronleichnamskapelle. Fast in der Platzmitte, wegen des Gasseneinlaufes ein wenig zur Seite gerückt, stand dieser merkwürdige Bau bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts. Es war ein Zentralbau –; ein solcher war zur Schaustellung eines Heiltums, zur Darbietung nach allen Seiten hin ja am besten geeignet, war damals, nicht nur in Prag (Karlshof), auch beliebt –; über achtseitigem Grundriß. Von den Seiten scheinen Kapellen ausgestrahlt zu sein –; die verschiedenen Darstellungen zeichnen den Bestand alle verschieden –;, so daß eine Sternform entstand. Das ganze bekrönt von achteckigem (?) Zentralturm. Eine eigene Bruderschaft scheint für die Kirche gesorgt zu haben. –; Solche Darbietung machte Eindruck. Doch das Volk sank zwar in die Knie vor dem Heiltum, führte aber sein altes Leben weiter. Und die Geistlichen, die weltlichen und die Ordensgeistlichen, traten dem nur lax entgegen: sie wollten der Spenden und Pfründen nicht verlustig gehen durch allzuviel Strenge. Des Erzbischofs edles Streben richtete nicht viel aus. Gegen den von unten her aufbrandenden Lebensstrom vermochte die Zucht von oben her nichts mehr. Man mußte an der Wurzel ansetzen. In Predigt und Schule mußte an das Heil erinnert werden.
Man rief aus Wien den großen Bußprediger Konrad Waldhauser nach Prag (1358). Der hieb mit strengem Wort auf die Zuchtlosigkeit des Volkes ein. Zu seinen Predigten in der Gallikirche strömte reich und arm. Nun standen plötzlich auch die Predigerkirchen, die das Volk den Pfarrkirchen entzogen hatten, leer. Die Mönche grollten. Waldhauser predigte deutsch und lateinisch. Seine »Postille« wurde von den Studenten eifrig nachgelesen, wurde auch ins Tschechische übertragen. Die Bürger, die Massen aus dem niederen Volk, besannen sich. Man entzog dem allzu nachsichtigen Klerus die Gunst. Der suchte sich zu rächen. Er klagt beim Erzbischof, beim Papst gegen den »ketzerischen« Augustiner. Der aber brannte sein heiliges Leben und Wirken weiter, starb aber schon nach einem Jahrzehnt unermüdlichen Eiferns.
Doch sein Wort hatte gezündet. Schüler hatten es aufgenommen, trugen es nun weiter. Der Mährer Johann Milíè war sein großer Nachfolger in der Predigt. Mystische Klänge regen sich in seinem Wort. Er predigt tschechisch –; in der Ägidienkirche –;, predigt dem gemeinen Volk, reißt es mit, findet Beschützer in den höchsten Kreisen. Einem seiner Beschützer, Adalbert Rankov, unter seinem Gelehrtennamen Adalbertus Ranconis ab Ericinio, sind wir schon begegnet. Der Graduierte der Oxforder und Pariser Universität, die Leuchte des Prager Studiums, der die neuen Ideen von Paris hier einführt, verteidigt Johann Milíè gegen die Anklagen des Klerus. Die neue Richtung der Hochscholastik trifft hier mit dem einfachen Bußinstinkt des Volkspredigers zusammen. Kaiser und Erzbischof sehen in Milíè den Bundesgenossen gegen das überhandnehmende weltliche Leben in der Kaiserstadt. Der predigt schon in vielen Kirchen. Um auch den Deutschen verständlich zu sein, lernt er Deutsch, predigt nun auch in der deutschen Teynkirche. Er rast hinein in seinen Bekehrungstaumel. Die Askese peitscht ihn in einen Fanatismus, treibt ihn bis zur Verdammung selbst des Kaisers als des »Antichrist«. Er fordert tägliche Kommunion der Laien, gründet Beginenhäuser für gefallene Mädchen. Sein Feuerwort zündet im Volk. Viele besinnen sich. Aber die Klerikerschaft klagt ihn beim Papst der Ketzerei an. Er wandert nach Avignon, um sich vom Verdacht zu reinigen. Dort stirbt er im Jahre 1374. Bald war sein Wort verhallt, selbst in Prag, wo die Geistlichen ihn auch geistig totzuschweigen wußten.
Doch unterirdisch glomm der Brand weiter. Er sammelte sich in zwei Herden. Einmal in den Disputationen der Meister im Studium. Da schied er die Geister. Tiefere, wohl in der Rassenentwicklung liegende Ursachen gaben dieser Scheidung eine nationale Färbung: die vom Westen aus Paris und Oxford eindringenden modernistischen Ideen fanden bei den tschechischen Magistern lebendigste Anteilnahme. In ihren Kreisen war damals schon die erste tschechische Bibelübersetzung entstanden. In diese »realistischen« Ideen gingen nun die reformatorischen Ideen, wie sie im Prager Volksboden gärten, ein. Die deutschen Magister dagegen blieben bei dem überlieferten Nominalismus innerhalb der hohen Scholastik. Nicht daß sie weniger streng gegen die Mißbräuche im Volksleben, in der Haltung der Geistlichkeit aufgetreten wären. Teils schon vor und dann gleichzeitig mit den tschechischen Reformern hatten sie Besserung der verfallenden Zucht bei Klerus und Volk verlangt. Ein Heinrich Tetting von Oyta, ein Engelschalk und der bedeutende Matthäus von Krakau hatten sich stets eine freimütige Kritik der kirchlichen Zustände erlaubt. Von allem Umstürzlerischen aber hatten sie sich ferngehalten. Sie standen zur Kirche und bekämpften alle Reformerei.
Der zweite Herd für das unterirdische Feuer war das niedere Volk in Prag und in Böhmen überhaupt. Hier gab die soziale Schichtung nationalen Einschlag. Die Deutschen hatten teils durch Patriziermacht, teils durch Zunftzwang ihre soziale Stellung, die ihr überlegenes Können ihnen erobert hatte, unangreifbar gemacht. Die ansässigen Tschechen kamen trotz kräftigen Auftriebs gegen solche Organisation von Arbeit und Verdienst nicht an. Auch fehlte ihnen die Schulung, durch Leistungen aufzusteigen. So wuchs hier aus der sozialen Gedrücktheit ein nationales Ressentiment. Die reformerischen Ideen mußten hier Wurzel fassen.
Übernational aber blieb die Mißstimmung über den Klerus, dessen immer wachsende Liegenschaften im Land und mitten in der Stadt –; von Karl ansehnlich vermehrt –; von allen Abgaben frei blieben und so »totes Gut« im teuren Gemeindegrund schufen. 76 Kirchen oder Kapellen gab es damals in Prag, 24 Klöster, gegen 1200 Geistliche lasteten auf der Bevölkerung. Prag war ein Mittelpunkt kirchlichen Lebens im Abendland. Ungeheurer Pomp wurde entfaltet. Der Klerus verwilderte.
Karl sah die Schäden. Er dachte sozial. Als im Jahre 1360 Hungersnot die Bevölkerung geißelte, hatte er, um die Hungernden zu beschäftigen und mit Brot zu entlohnen, den Weiterbau der neuen großangelegten Ummauerung der ganzen Burgstadt betrieben. Hinter dem Hradschin hatte sich schon unter Johann eine neue kleine Stadt gebildet. Die wurde ins Großstadtgefüge einbezogen. Schwere Mauern, mit Wachttürmen versehen, zog er hinter den Siedlungen, hinter dem Strahower Stift entlang, quer über den Laurenziberg hinunter bis zur Moldau. Seine hochfliegenden Pläne wollten damals sogar noch dies abschüssige Terrain besiedeln mit Gewerben, die in der Stadt durch Lärm störten. In der Neustadt hatten sie sich offenbar unliebsam bemerkbar gemacht. Die Hauptsorge war ihm aber damals doch, der Bevölkerung über die Hungerzeit hinwegzuhelfen. Die Mauer über dem Laurenziberg heißt noch heute die Hungermauer. –; Auch gegen die kirchlichen Güter unternahm er Vorstöße. Bei der Gründung der Neustadt hatten weite Besitzungen vor den Toren der Altstadt enteignet werden müssen. Sie gehörten zum großen Teil dem reichen Kreuzherrenorden. Er wollte diesen Orden zuerst überhaupt nicht entschädigen. Nach Jahresfrist erst verstand er sich unter großen Abstrichen an den verlangten Summen zur Zahlung. Zum Schluß siegte eben doch wieder die Kirche über sein modernes soziales Empfinden.
Und hier stoßen wir nun doch an die Grenzen dieser großen Persönlichkeit. Die war in zwei Reichen verwurzelt, die geschieden von einander –; so scheint es –; ihr eigenes Leben führten. Streng mittelalterlich gebundene Gläubigkeit trieb diesen Kaiser in die Einsamkeit vor Gott, in ein weltflüchtiges Gleitenlassen aller Dinge. Die mystisch ausgestatteten Kapellen auf Burg Karlstein spiegeln Karls einsame Stunden. Der Osten lockt. Klare Entgegnung schuf jener andere Charakterzug, der in Tat und Organisation und Bildnertum, in großen modernen Zielen eine neue Welt aufrichten wollte, aufrichten mußte. Da wandelt sich jene Einsamkeit vor Gott zur Freude am Individuum, zur Lust an der freien Natur, zur Freude am Kunstwerk. Seine selbstbiographischen Aufzeichnungen –; wie stark er sich doch als eigene Persönlichkeit empfand! –; vermitteln uns den Kampf um einen Ausgleich zwischen diesen beiden Welten. Solange rationale Mächte Wuchs und Richtung seines Seins und Wirkens bestimmten, blieb die Einheit der Persönlichkeit gewahrt. Da erzwang der starke Geist den Ausgleich. Sobald aber irrationale Mächte gegen solch labilen Bau anrennen mochten, drohten Erschütterungen, die den Ausgleich hätten zerstören müssen.
Das Irrationale draußen: die reformerischen Sehnsüchte des Volkes, es hätte das Irrationale in seinem Innern furchtbar aufgewühlt, um so furchtbarer vielleicht, als das so Verwandte in beiden sich gegenseitig gespürt hätte, ohne doch als solches sich zu erkennen. Unerkannte Verwandtschaft drängt oft zum Haß. Einmal, vor Jahren, war Karl diese innere Verwandtschaft vielleicht schon aufgedämmert: damals, als der fanatische Milíè ihm den »Antichrist« ins Gesicht geschleudert, als der Kaiser ihm nichts darauf erwidert hatte. Jetzt war er alt. Sein Irrationales, sein Mysterium hatte er unverrückbar eingebunden in göttlich-kirchliche Zielsetzung der Welt und in die eherne Notwendigkeit des Herrscherberufs, dem jene zu verwirklichen aufgetragen war. Gegen solche innerliche Bindung mußte das Volksverlangen anprallen wie Empörung, Empörung gegen das göttliche und –; Tragik des Herrscher-Seins! –; Empörung gegen das weltliche Regiment. Geheimnisvolle Verwandtschaft hätte sich in tödlicher Gegnerschaft entzweien müssen. Und diese Gegnerschaft wäre auf beiden Seiten noch von den rationalen Komponenten vertieft worden. Das Volk schrie: Tod der Bildung! –; Karls tiefster Glaube aber war: Durch Bildung zum Heil! Unter dem Zusammenprall dieser beiden irrationalen Mächte wäre die hohe, so mühsam erkämpfte Ratio dieses Geistes endlich doch wohl zermalmt worden. Der Tod ersparte ihm die letzte Belastungsprobe (1378).
»Nirgends habe ich je eine so reiche und mit allen nur möglichen Dingen überschwemmte Stadt gesehen«, so schreibt Uberto Decembrio aus Vigevano, Teilnehmer an einer mailändischen Gesandtschaft, die im Jahre 1399 nach Prag kam, einem Freunde in der Heimat. »Gehst Du zum Markt, so denke an den alten Cato: ›Sei auf Deiner Hut, sonst bringst Du die volle Börse leer zurück.‹ Die Stadt bietet fast den Anblick der Romulusstadt. So wie sie ist sie mit Hügeln und Tälern geschmückt und statt dem Tiber fließt die Moldau mitten durch die Stadt, über die Karl IV. die hochberühmte Brücke hat schlagen lassen …« Und dann verbreitet er sich über die Vergnügungen des Volkes, über merkwürdige Sitten, über ein allzu freies Leben in den Straßen, über die Universität, die mehr in den Künsten, vor allem aber in der Theologie, weniger in Recht und Medizin glänze. Über den begonnenen Dom und manches andere noch. Er fand noch die Weltstadt vor, die Karl hatte erstehen lassen. Von der Krisenstimmung, die hie und da schon hervortrat, schreibt er nichts. Der prächtige Hof, den Wenzel IV. hielt, wenn er zu immer kürzeren Aufenthalten nach Prag kam –; er wohnte gern in dem Königshof in der Altstadt, den er sich bequem wie eine kleine Stadtburg hatte ausbauen lassen –; täuschte den Fremden darüber hinweg.
Und wahrlich: das Hofleben dieses der Bildung seiner Zeit zugetanen Fürsten, das elegante Leben, das dort herrschte, der freisinnige Ton, mit dem die Reformbestrebungen des Volkes und einiger Prediger bei Hofe besprochen wurden, das alles schien elastisch genug, um ernsteren Wirren wo nicht vorzubeugen, so doch auszuweichen. Hätte der Italiener tiefer geblickt, so hätte er damals schon Folgen tiefer Zerklüftungen allüberall sehen müssen. Spannungen trieben zwischen König und Adel. Der Adel des Landes hatte vielleicht am frühesten gespürt, daß des Vaters Kraft nicht mehr im Sohne weitertrieb. In Aufständen, die bis zur Gefangensetzung des Königs geführt hatten, hatte dieser Adel wieder seine alten Rechte ertrotzt. Spannungen trieben auch zwischen König und Kirche: zwischen dem Erzbischof Johann von Jenstein und dem freigeistigen Hofe. Über dem päpstlichen Schisma waren sie ausgebrochen, hatten zu wüsten Ausschreitungen des Königs gegenüber dem christlichen Oberhaupt des Landes geführt.
Johann von Jenstein ist eine der edelsten Gestalten jener Zeit. Auf der Universität –; er hatte an den Studien zu Prag, Padua, Bologna, Montpellier und Paris geweilt –; hatte er eine hohe Bildung genossen, aber auch ein ausschweifendes Leben geführt. Da hatte ihn ein erschütterndes Erlebnis gepackt. Seitdem gehörten sein Geist und sein Herz der Wiederaufrichtung der alten heiligen Kirche. Er griff mit äußerster Strenge in die geistlichen Übelstände seiner Heimat ein. Asketisches Leben und Charakterstärke ließen ihn vorbestimmt erscheinen zum Reformator der böhmischen Kirche. Tragisches Geschick aber zwang ihn, den Rechtgläubigen, der in allem gegen die heilige Kirche Gerichteten Häresie sehen mußte, zum Gegenspieler der mächtig anwachsenden Volksbewegung. Dies eine Tragik, die vielleicht auch Karls Schicksal geworden wäre. Für Jenstein kam sie in verzerrter Form zum Ausbruch. Nicht am Zusammenstoß mit der Volksbewegung sollte er zerbrechen. Die seltsam verschränkten Strömungen jener Tage schoben Wenzel als die handelnde Person der ihm gegnerischen Welt vor, den launenhaften König, der doch nur ein Schatten der eigentlich treibenden Kräfte war, der aber die Abneigung des Volkes gegen den strengen Erzbischof den eigenen Haßgefühlen nutzbar machte. Er war nur »Sohn«, nicht Erbe. Er war vollgesogen von höchster Bildung und verlangte nach gröbstem Genuß. Er war schwach, von Skepsis zerfressen, und sprach mit der Faust. Er war viel zu früh in den Machtwahn hineinerzogen –; jetzt zerbrach er ihm unter der Wirklichkeit, unterm Schmeichelwort von Günstlingen und Frauen.
Und doch sollte der große Jenstein über diesen Schatten stürzen. Der König wollte eine ihm genehme Abtwahl, in Kladrau, durchsetzen. Einer seiner Günstlinge sollte die freigewordene »Pfründe« dort erhalten. Der Bischof aber hatte den rechtmäßig gewählten Abt schon konsekriert, verweigerte die Zurücknahme. Der König, jähzornig und brutal, gebrauchte Gewalt. Er hatte den Erzbischof, der auf seinen Besitzungen in Raudnitz weilte, nach Prag beordert. Ein gütliches Übereinkommen sollte geschlossen werden. Aber bei der persönlichen Zusammenkunft beider im Johanniterspital, nahe dem erzbischöflichen Palast auf der Kleinseite, übermannt den König aufs neue der Zorn über den verhaßten »Gerechten«. Er tobt, läßt die Begleiter des Erzbischofs in Gewahrsam nehmen, läßt sie grausam foltern. Den verhaßtesten unter ihnen, den Generalvikar des Erzbischofs, Johannes von Pomuk, soll er eigenhändig mit brennender Fackel gepeinigt haben. Dann ließ er den zu Tod Verletzten, grausam gebunden, durch die Straßen schleppen, ließ ihn in tiefer Nacht von der Moldaubrücke herab in die Fluten stürzen und ertränken (20. März 1393). Die andern Festgenommenen hatte er gegen Eid unbedingten Stillschweigens freigelassen. Warum dieser unmenschliche Haß gerade gegen den Generalvikar? Nur wegen dessen Verantwortlichkeit für die Haltung des Erzbischofs? Oder sollte wirklich –; wie der Volksmund und einige Quellen behaupten –; das Vertrauen der gekränkten Königin Sophie zum Generalvikar Anlaß gewesen sein und die Weigerung des Standhaften, dies Vertrauen zu brechen? Märtyrerschicksal umspielt die Gestalt des Johannes von Pomuk. Aber erst mehr als 300 Jahre später wird ihm die Märtyrerkrone offiziell zuerkannt, damals als Johannes von Nepomuk auf Betreiben der Jesuiten, die einen volkstümlichen Heiligen gegen den Glaubensmärtyrer Johannes Hus wünschten, heilig gesprochen wurde (1729). Johannes von Pomuk (in Südböhmen) dürfte väterlicherseits deutschen Geblüts gewesen sein (aus dem Geschlechte der Wölflin). Der Erzbischof mußte weichen, er floh außer Landes. Auf dringende Bitten seiner Getreuen und Mittelsmänner des Königs, die dessen Bußfertigkeit beteuerten, kehrt er zurück. Aber das Wesen dieses Königs ließ ihn doch verzweifeln. Er floh wieder, jetzt nach Rom. Dort starb er.
Die eigentliche Spannung, die über Prag lastete, reichte tiefer. Nicht um Zuständigkeitsfragen zwischen König und Bischof ging es: das Volk stand auf gegen Rom. Den Inhalt, das religiöse Leben hatte es von dort genommen, die Form, gar die Ausartungen dieser Form lehnte es ab. Der säkulare Protest gegen das Blutsfremde hob an. Eigenes regte sich, wehrte sich gegen alles Fremde, zumal wenn es sich mit Rom verbündete. So wuchs mit der religiösen Gärung die nationale, in die eine soziale sich verflocht. Karls Humanismus schoß unvorhergesehene Triebe.
Der Stein war im Rollen. Die reformatorischen Bestrebungen, wie sie Waldhauser, der Deutsche, und Milíè, der Tscheche, gepredigt hatten, pflanzten sich weiter. Sie zünden im Generalstudium. Die Prager Atmosphäre liefert den theoretischen Diskussionen höchst wirksamen Sprengstoff. Die im Volke gärenden reformatorischen Ideen schärfen die realistische Richtung. Aus dem Abstrakten werden die Kämpfe herübergerissen ins höchst Konkrete, in die Prager Kirchen, schon in die Gassen. Und von dort hatten sie sich in den Schriften des südböhmischen Edelmannes Thomas von Štitný in die literarische Sphäre erhoben. Der wagt sich in seinen Traktaten und Abhandlungen, in denen er aus westlichen, oft recht orthodoxen Schriftstellern schöpft, bis in philosophische Spekulationen. Einwirkungen des Platonismus sind deutlich. Der Kern seiner schriftstellerischen Tätigkeit liegt aber immer in der rein menschlichen Haltung, die aus allen seinen Worten spricht. Er ist mit diesen Schriften der Begründer einer literarischen tschechischen Prosa geworden. In ihm ersteht der Wortführer echt tschechischen Geistes in der Literatur. Alle übrige tschechische Literatur vor ihm war dem überragenden Einfluß des Lateinischen und Deutschen im Motivischen wie im Formalen erlegen. In Štitný setzt sich das tschechische Element zum erstenmal durch. Jetzt tauchten auch überall die Bibelübersetzungen auf, tschechische, deutsche. Eine hochkultivierte Illuminatorentätigkeit verbrämte die Bewegung noch als Kunst.
Die mündet jetzt in ihren Spätstil ein: überzierlich, überfein, manieriert, rein böhmische Art. Während draußen schon die Wetter grollen, ziselieren diese Buchmaler um 1400 an ihrem Filigran. War es Hohn auf die Elemente draußen? War es Abseitigkeit? Ein Prachtwerk die »Wenzelsbibel« (um 1390). Das sechsteilige Werk ist nicht ganz vollendet. Ungleich gute Hände haben daran gearbeitet. Für die Spitzenkultur der Zeit ist es bezeichnend. Der reichste unter den deutschen Bürgern Prags, der Richter und Münzmeister Martin Rotlöw, den man später den Prager Fugger nannte, hatte die Anregung zur Verdeutschung gegeben, hatte sie dem König zum Geschenk gemacht. (Heute in Wien, Nationalbibliothek.) Und 1409 entsteht noch das Hauptwerk dieses Spätstils: das Missale Laurins von Klattau, das für den Erzbischof Zbynìk von Hasenburg gearbeitet war. (Wien, Nationalbibliothek.) So nahmen die obersten Schichten des Landes die Volksbewegung an, sublimierten sie durch die Kunst. Als solche genoß sie auch der zuschauende Skeptiker Wenzel, und ließ sie gewähren.
Die Bauten, die hier und dort noch im Gerüst standen, schritten nun langsamer fort. Auf dem Hradschin arbeitete noch die schwäbische Hütte. Der große Meister Peter war 1399 gestorben. (Sein Grabstein und der des ersten Dombaumeisters Matthias sind vor wenigen Jahren im Chorumgang aufgedeckt worden.) Im Jahre 1392 hatte er noch den Grundstein für den Langhausbau gelegt. Der sollte offenbar in fünf Schiffen aufgehen. Die Weitung des Raumes, im Chor schon begonnen, sollte hier entschlossen weitergeführt werden. In der Hütte arbeiteten damals schon die Söhne des alten Meisters mit: Wenzel und Johannes. 1396 erscheint Wenzel Parler als magister operis. Der alternde Vater hatte die Leitung der Hütte also schon dem ältesten Sohn übertragen, hatte aber zweifellos noch bestimmenden Einfluß auf die Weiterführung seines Baues sich gewahrt. 1396 hatte man mit der Grundlegung des südlichen der beiden zwischen Querhaus und Langhaus geplanten Türme begonnen. Aus den Fundamenten dieses Südturms wird ersichtlich, daß ursprünglich ein schwächerer Turm gedacht war. Während des Aufbaues aber scheint der Turmehrgeiz, der damals in den südwestdeutschen Städten aufkam, auch die Prager Hütte erfaßt zu haben: der quadratische Grundriß des Turmes wird auf etwa gleiche Größe mit dem der Wenzelskapelle gebracht, die blockartig auf der andern Seite (Ost) das Querhaus bedrängt. Bei dieser Erweiterung der ursprünglichen Turmidee mag die Absicht geleitet haben, diese der Stadt zugekehrte Südseite des Domes zur Schauseite auszugestalten, die Westseite zu entkräften. Das entsprach der im Innern zum Ausdruck gebrachten neuen Raumidee: der Raum sollte nicht mehr in eine Richtung wirken, er sollte allseitig ausstrahlen, sollte den Kubus füllen. Hier im Süden stand ja auch der kaiserliche Palast. In den repräsentativ ihm vorgelagerten Platz grüßte das reiche Mosaik, das (schon um 1370) überm Südportal eingelassen worden war. Diese Stärkung des Turmes kam aber zugleich auch dem traditionellen Streben der Hütte entgegen: der übermächtige Turm bedrängte das Querhaus, sog ihm die Wirkung ab, leistete also für den äußeren Eindruck dasselbe, was die Wenzelskapelle, die tief in den südlichen Querhausflügel eindrang, auch im Innern besorgte. Diese Reduktion, ja Verdrängung des Querhauses war einer der Grundgedanken, mit denen die Parlersche Richtung in die Spätgotik vorstieß. Ein einheitlicher weiter Raum sollte im Innern fluten, jede Unterbrechung, jede bestimmte Richtung und Gegenrichtung sollten unterdrückt werden. So wurden denn auch die dem Kircheninnern anliegenden Seiten des Turmerdgeschosses (Nord und Ost) in großen Arkaden geöffnet, um die Vierung gleichsam wie einen großen Hallenraum ins Querschiff hineinfluten zu lassen. (Die Architekten des Domausbaues im 19. Jahrhundert hielten diese Durchbrechung der Turmmauern für zu gewagt –; ein halbes Jahrtausend hatte die kühne Konstruktion gehalten! –;; sie mauerten sie zu. 1880.)
Damals hatte man dann auch die bisher geschonten Teile der alten Basilika abgebrochen. Der Turm kam an die Stelle zu stehen, wo die Gebeine des hl. Adalbert geruht hatten. (Die Grabstätte des hl. Wenzel war schon durch die Wenzelskapelle überfangen worden, was deren Herausschiebung gegen Süden bedingt hatte.) Adalberts Gebeine werden nun in den Ostteil des neubegonnenen Langhauses übertragen, vor die Mauer, mit der man den Ostchor provisorisch geschlossen hatte. Ein hölzerner Notbau wird über der Grabstätte errichtet. Auch die Altäre der abgebrochenen Basilika –; nur deren Nordwestturm scheint vorerst noch erhalten geblieben zu sein –; fanden hier vorläufige Aufstellung. Erst 200 Jahre später, als man auf den Domausbau endgültig verzichten zu müssen glaubte, ließ Erzbischof Brus eine Kapelle über dem Grab des Heiligen errichten (s.u.).
Wenzel Parler scheint um 1397 nach Wien berufen worden zu sein, wohl als Konstrukteur für den ebenfalls zu verstärkenden Südturm bei St. Stephan, in dessen Planung man dem Prager Beispiel gefolgt war. In der Leitung der Prager Hütte folgt ihm sein Bruder Johannes. Die Bauarbeiten schreiten jetzt immer langsamer fort. Der alte Meister Peter mußte von seinem Werk Abschied nehmen, als noch am Erdgeschoß des Turmes gebaut wurde. Johannes scheint seinen Vater nur um wenige Jahre überlebt zu haben: zwischen 1404 und 1406 scheint er gestorben zu sein. Die große Hütte verliert an Stoßkraft. Wertvolle Kräfte waren abgewandert. Im Obergeschoß des Turmes machen sich fremde Einflüsse bemerkbar. Zum Abschluß gedieh der Turm nicht mehr. Die Hussitenstürme setzten allem Bauen ein Ende (1421).
Um die Jahrhundertwende ging es allen Reformsüchtigen noch um Rettung der Kirche. Nur Reformen, noch nirgends Revolution. Bis in Johannes Hus der große Streiter erwacht, der die dunklen Kräfte ins Bewußtsein ruft. Und jetzt erst rüttelt die Bewegung an die Autorität der Kirche. Jetzt erst stand Böhmen auf gegen Rom.
Im Jahre 1391 hatte Johann Ritter von Mühlheim, einer der Günstlinge des Königs, inmitten der Altstadt die Bethlehemkapelle gestiftet. Hier sollte ausschließlich tschechisch gepredigt werden. Nicht daß damals nicht auch in andern Prager Kirchen tschechisch gepredigt worden wäre. Im Pfarrsprengel St. Johann an der Furt (nahe der Karlsbrücke) hörte man nur tschechische Predigt, obwohl die Hälfte der Sprengelangehörigen Deutsche waren. Ähnlich bei St. Maria an der Lake (Marienplatz). Bei St. Clemens am Poøiè (Deutschherrenstraße) beschweren sich Gemeindeangehörige, daß sie nicht beichten könnten, da der Pfarrer keinen deutschen Priester anstellen wolle. Die Tschechen drängen auf der ganzen Linie gegen das Übergewicht der Deutschen in der Altstadt an. In der deutschen Teynkirche kam es 1399 zu Krawallen, weil der Pfarrer den tschechischen Gläubigen hatte verwehren wollen, das Lied »Buoh všemohúcí« »Gott, der Allmächtige« in ihrer Muttersprache zu singen. Der beim Erzbischof Verklagte wird eingekerkert, ein tschechischer Prediger wird zu den deutschen eingesetzt.
Daß drüben in der Neustadt das tschechische Übergewicht bald gesichert gewesen zu sein scheint, hatten wir bemerkt. Die Fronleichnamskirche auf dem Heumarkt war eine der ersten Kirchen, in denen das Abendmahl unter beiderlei Gestalt gereicht wurde. Karls IV. Fürsorge hatte das tschechische Element in den Prager Städten gestärkt und gehoben. War früher in Klöstern und auf hohen Schulen wohl eine hochstehende geistige Führerschicht auch tschechischen Geblüts erstanden, der aber ein tragender Untergrund fehlte –; sie ergänzte sich meist aus den Schichten des Adels –;, so hatte sich unter Karls Bemühen eine tragfähige Mittelschicht herangebildet, die sich anschickte, über Gewerbe und Künste aufzusteigen in einen selbstbewußten Bürgerstand. Mit Recht konnte gesagt werden, daß »während der ganzen tausend Jahre, in welchen der Kampf zwischen Slawentum und Deutschtum in diesem Lande andauert, niemals die tschechische Sache auf besserem Wege war und sicherer zu ihrem Ziele fortschritt (ausgenommen die Hussitenzeit) als während der Herrschaft Karls IV. und seines Sohnes Wenzel«. Starke Antriebe aus nationalen und religiösen Sphären drängten empor, wurden aufgenommen von Oberschichten, die bald ehrlich die junge Kraft der Volksbewegung als Kräftigung der eigenen, schon etwas müden Kultursphäre begrüßten, bald lüstern den starken ungewohnten Brodem der Volksinstinkte in die dünne Luft einer überspitzten Hofkultur einlassen wollten.
Auch am Generalstudium war der Auftrieb des tschechischen Elements zu spüren. Zwar: zahlenmäßig ging der Aufstieg langsam vor sich. Der Anteil der böhmischen Nation an der Gesamtzahl der am Studium Teilnehmenden wuchs von einem Sechstel zu Karls Zeiten nur bis zu einem Fünftel um 1400. Um so nachhaltiger wurde um geistige und wirtschaftliche Durchsetzung gekämpft. Und an Stiftungen und Stipendien wurde die böhmische Nation schon im Jahrzehnt vor 1400 viel reicher bedacht als die andern, die um ihre Einkünfte schwer zu kämpfen hatten. Der tschechische Sieg anläßlich des Kampfes um die Besetzung freigewordener Stellen am Karlskolleg (1384) und am Wenzelskolleg war nur ein Fall unter vielen. Wenn also jetzt die Bethlehemskapelle ausschließlich dem tschechischen Gottesdienst gestiftet wurde, so muß das im Gesamtzug einer in vollem Gang befindlichen Bewegung gesehen werden.
Die drei ältesten Magister des Karlskollegs wurden zu Patronen der Kapelle bestimmt. Den Bauplatz hatte ein Bürger Køiž (Crux institor) geschenkt. Der Bau wurde schnell gefördert. In ihm scheint ein sehr frühes Beispiel der reinen Predigtkirche, ja des Predigtsaales verwirklicht worden zu sein: ein unregelmäßiges Viereck, wohl flach gedeckt, ohne jeden Chorausbau. Innen- und Außenwände waren sehr einfach gehalten. Vor der Kirche auf dem heutigen Bethlehemsplatz der Friedhof. In dieser Kapelle also sollte nur tschechisch gepredigt werden.
Hus tritt an. Er war armer Leute Sohn, stammte aus Husinec in Südböhmen. Er hatte in Prag Studium und Bakkalaureat, auch den Magister der Künste sich erkämpft. Ihm geht es um Wiclefs Lehren. Die hatten seit langem in Prager Gelehrten- und Studentenkreisen gewirkt. Der rege Austausch mit Oxford, den die englisch-böhmische Dynastenverbindung noch förderte, brachte zu den übermittelten Büchern die lebendige Wirkung. Die Magister am Generalstudium stritten um die Lehre des Engländers. Nun trug sie Hus mit tschechischer Predigt ins Volk. Er leugnete zwar nicht wie jener die Transsubstantiation. Aber er verteidigte Wiclefs Reformideen. Er verteidigte sie gegen das Generalstudium, das unter deutschem Einfluß Wiclefs Lehre und deren Verteidigung verwarf. Und verteidigte sie gegen den Erzbischof Zbynìk Zajíc von Hasenburg, der ihm trotz allem noch immer gewogen war. So warb er bei Hof, wo er der Königin Sophie, einer bayrischen Prinzessin, Beichtvater war. Sie scheint den Reformer besonders begünstigt zu haben. So warb er im Adel. Der König, der Hof, der Adel sympathisierten mit seinem Wirken: mit dem antirömischen, da es gegen den feindlich gesinnten Römerpapst ging, mit dem nationalen, weil es gegen die Deutschen ging, die Wenzel im Jahre 1400 abgesetzt hatten.
Hus predigte. Sein Wort riß das Volk mit. Und das Volk stützte ihn. Er diskutierte und warb unter den Magistern. Als der Erzbischof und mit ihm die offizielle Mehrheit der Universität in der Frage der päpstlichen Neutralität auf die Seite des Gegenkönigs Ruprecht von der Pfalz traten, hielt er die tschechische Minderheit beim König. Der brauchte das Votum der Universität für den vom Pisaner Konzil vorgeschlagenen, ihm gewogenen Papst. Von einer tschechisch eingestellten Universität wäre dies leichter zu erreichen, ließ ihm Hus bedeuten. Das Kuttenberger Dekret war die erwünschte Folge (1409). Das nationale Element in Hus' Wirksamkeit zeigte sich ohne Larve. Die einheimische böhmische Nation, Tschechen und ansässige Deutsche, hatte diesem Dekret zufolge künftig bei der Rektorswahl und bei allen Entscheidungen des Generalstudiums drei Stimmen. Die drei nichtböhmischen Nationen sollten nur eine haben. Für die Landeskinder Böhmens sei das Generalstudium gegründet worden, hieß es in dem Dekret, das übrigens gegen die Deutschen recht ausfällig gehalten war. Wie wenig stichhaltig dies Argument war, erweist die Gründungsgeschichte der Universität (s.o.). Der Kuttenberger Urbarschreiber Nikolaus Augustini (Nikolaus der Reiche, Angehöriger des Prager deutschen Patriziats!), ein Günstling des Königs, hatte es bei diesem durchzusetzen gewußt.
Die Deutschen –; auch die polnische Nation setzte sich zumeist aus Deutschen, den Kolonisatoren Schlesiens zusammen –; waren empört. Sie versuchen noch zu verhandeln. Alle Einwände und Vorschläge fruchten nichts. Nikolaus Augustini dringt als königlicher Kommissar mit Bewaffneten im Karolinum ein, fordert dem Rektor Henning von Baltenhagen die Universitätsinsignien, Siegel, Schlüssel, Kasse und Matriken ab, verliest den auf dem Hof versammelten Magistern das königliche Dekret, das ihnen die Annahme Zdenkos von Labaun, Dechant bei Allerheiligen, auch eines Günstlings des Königs, als Rektor anbefiehlt.
Aber die Gewaltmaßregel festigt nur die Haltung der Deutschen. Sie führen ihre Drohung aus: an die Tausend deutscher Professoren, Magister und Studenten wandern aus. Sie ziehen nach Erfurt, die meisten nach Leipzig. Vierzig Prager Professoren besteigen in Leipzig die Katheder. Das Prager Generalstudium war mit einem Schlage zur Landesschule herabgesunken. Der Welttraum Karls IV. war auch hier erloschen.
Wenige Jahre vorher war unweit von Prag, in der deutschen Stadt Saaz, die größte deutsche Dichtung des Jahrhunderts entstanden: »Der Ackermann aus Böhmen«, jener erschütternde Protest des Menschen gegen die Macht des Todes –; und sein Verzicht. Das Werk war aus der von Johann von Neumarkt gepflanzten Kulturstätte erwachsen: der Dichter, ein Johannes von Schüttwa (aus Schüttwa in Westböhmen stammend, auf dem Prager Generalstudium gebildet, dann in Tepl, später als Notar in Saaz, seit 1411 als Protonotar der Prager Neustadt tätig und dort behaust) scheint aus der kaiserlichen Kanzlei hervorgegangen zu sein. Die schönste deutsche Frucht jener Prager Renaissancebewegung war also gerade um jene Zeit reif geworden, als die letzten deutschen Träger eben dieser Renaissancebewegung aus Prag vertrieben wurden. Die große Aufgabe dieser Stadt, Vermittlerin zu sein zwischen Ost und West, versank unter den Wogen nationaler Verbitterung.
Über der geistigen Schädigung, die diese Zertrümmerung des überragenden Kulturzentrums für eine künftige Kultureinheit der Ostländer bedeutete –; Krakau hat später viel des in Prag Verlorenen an sich gerissen –;, über der wirtschaftlichen Schädigung, die der Auszug so vieler kaufkräftiger Scholaren für die Gewerbe Prags und Böhmens bedeutete, triumphierte der Jubel geretteter Nationalität. Den Prager Deutschen war ihr geistiges Bollwerk genommen, der Kirche eine mächtige Stütze.
Und weiter geht das Vordrängen der Tschechen, das Zurückdrängen der Deutschen. Von unten her schieben sich immer mehr Tschechen in die festen Wirtschaftsverbände der Deutschen hinein. Von oben her wird die Stärke des Deutschtums gemindert durch Maßnahmen des Königs. 1413 bestimmt er, daß bei der Ratserneuerung der Altstadt von nun an von den fünfzig vorgeschlagenen Bürgern die Hälfte Tschechen sein müßten, von denen dann neun Deutsche und neun Tschechen zu Ratsherrn bestimmt werden sollten. Das tschechische Prag beginnt.
Hus wurde der Führer der immer schärfer einsetzenden Bewegung. Die tschechischen Magister hatten ihn zum Rektor des Studiums erwählt. Dieses Studium stand nun als Ganzes zur Reformpartei. Hus protestierte von der Kanzel aus gegen den Erzbischof. Der hatte an die 200 beschlagnahmter Schriften Wiclefs –; ohne sie haben lesen zu können, wie ein tschechischer Spottvers behauptet –; im Hofe der bischöflichen Residenz verbrennen lassen. Hus wird die Predigt verboten. Er kehrt sich nicht daran. Die Geistlichkeit, die in Verdächtigung und offenem Kampfe gegen ihn vorgegangen war, wurde in Abwehrstellung gedrängt. Krawalle auf der Straße häuften sich. Die Priester wurden beschimpft, zum Teil schon verfolgt. Der Erzbischof mußte fliehen.
Jetzt wurde der König bedenklich. Sein Bruder Sigismund, nun deutscher König, drängte ihn zu Abwehrmaßnahmen. Der Papst hatte zugunsten aller Teilnehmer an dem heiligen Krieg gegen seine Widersacher einen Sündenablaß ausgeschrieben. Der König hatte dem zugestimmt. Hus protestiert, er kann nicht zurück. Der König bestimmte ihn zum Verlassen der Stadt, pro forma eine Verbannung (1412).
Nun rollte dessen Wort durch das südliche und südöstliche Böhmen. Landadel, Kleingewerbe, Bauern zogen ihm nach. Seine Schriften »Zur Erlösung der treuen Tschechen«, dann »Die Postille« und »Die Auslegung des Glaubens, der zehn Gebote Gottes und des Vaterunsers« und viele andere zündeten im Volk, zündeten auch in der Ferne. Lateinische Schriften »De ecclesia« (gedruckt 1558 in Nürnberg!) schrieb er zur Verteidigung seines Wirkens vor der weiten christlichen Welt. Er stützte sich auf die Bibel, auf Gottes Wort. Wiclef ist ihm die hehre Autorität. Die Kirche ist die Gesellschaft der gerechten Gläubigen. Die Prädestinationslehre klingt an. Der Papst ist Mitglied der Kirche wie jeder andere Christ. Roms Autorität wird bestritten. Der nationale Charakter der Kirche wird gefordert, wird geschaffen und verteidigt. Hus dichtet Kirchenlieder in seiner Sprache. Er festigt die eigene Schrift zur Aufnahme der hohen Gedanken. Von ihm rührt die im wesentlichen noch heute gültige diakritische Orthographie der tschechischen Schriftsprache her.
Das Volk ist mit ihm. Rom droht. Aber Hus wird sich reinigen vom Vorwurf der Ketzerei. Er zieht zum Konzil nach Konstanz. Des Königs Sigismund Geleitbrief sichert ihm persönlichen Schutz, soweit ihn nicht höheres Gericht dem weltlichen Arm entreißt. Dort aber in Konstanz bricht das Schicksal über ihm zusammen. Er ist nicht mehr Person, er ist Macht. Er ist der römischen Weltmacht die feindliche Gegenmacht. Und wird zermalmt. Das Konzil verurteilt Wiclefs Schriften. Das Konzil verhaftet Hus trotz Sigismunds Einspruch. Fordert von ihm Widerruf, foltert ihn. Der Standhafte wächst zu erhabener Größe. Das Konzil verurteilt. Der weltliche Arm muß das geistliche Urteil vollziehen. Am 6. Juli 1415 flammt der Scheiterhaufen über dem heldischen Streiter.
Jetzt erst wird Revolution, was nur Reformstreben war. Erste eigene Form der Bewegung bricht auf: das »Abendmahl unter beiderlei Gestalt«. Jakobell von Mies, Hus' Freund, hatte die Einführung der neuen Institution von Prag aus vom schon Verhafteten brieflich erwirkt. Der Kelch wird Symbol. Der Kelch wird Flamme, unter der sich die empörten Tschechen sammeln.
Der Prozeß gegen Hieronymus, Hus' Freund, peitscht weiter auf. Dessen Widerruf entmutigt. Aber sein neuerlicher Abfall, sein standhaftes Ende –; eindrucksvoller Abschluß eines nicht immer makellosen Wirkens –; empört und begeistert.
Die Nahsicht auf das Prag dieser Jahre zeigt arge Verwirrung. Neben hohem geistigem Aufschwung und heißem Bemühen um Wahrheit gärt in den Tiefen der dumpfe Aufruhr der Instinkte. Priesterhäuser werden geplündert. Kirchen werden erstürmt, der Kelch wird eingesetzt, das Symbol der Bewegung. In seelischen Tiefen mancher treibt echte Gläubigkeit urchristlicher Stimmung.
Die Führung hatten zunächst noch besonnene Magister der Universität. Sie wollten den Kampf mit geistigen Waffen austragen. Aber die Volksmassen hingen an den glühenden, aufpeitschenden Worten eines Johann von Seelau, eines entsprungenen Prämonstratensermönchs. Der predigt in der Maria-Schnee-Kirche, fanatisiert die Tausende. Und als der König, durch Drohungen des Konzils und des Stiefbruders Sigismund bewogen, nun ernstlich zu dem entscheidenden Einschreiten sich aufrafft, da finden die Massen in Jan Žižka von Trocnov den hartnäckigen Führer, der sie stärkt, ihrem Glauben zu folgen. Erzbischöfe spielen in diesen Jahren klägliche Rollen, wollen vermitteln, um sich an der Macht zu erhalten, müssen dann doch mit dem Interdikt die Aufrührer züchtigen. Vergebens. Die Massen sind gegen die Kirche. Der Zwist nistet in den Mauern, in den Häusern, in den Familien. Prozessionen durchziehen die Stadt. Die Glocken schweigen. Bewaffnetes Volk geht unter Johann von Seelau vor, um die neustädtischen Kirchen zu erobern. Sie sind noch in den Händen der Kirchlichen. St. Stephan wird überrumpelt und genommen. Auf dem Viehmarkt (Karlsplatz) frohlockt die Menge. Da kommt Tumult in die Menge. Man schreit: aus dem Neustädter Rathaus seien Steine geworfen worden. »Verhaßte deutsche katholische Schöffen, die dort sitzen!« Das Rathaus wird gestürmt, die Schöffen zum Fenster hinausgeworfen, drunten gelyncht. Der erste Prager Fenstersturz war geschehen (1419). Er sollte in die Jahrhunderte wirken. Die Menge tobt, stürmt weiter. Emaus wird geplündert. Andere Klöster und Kirchen fallen unter der Wut der Massen. Die Kleriker fliehen. Viele Deutsche fliehen. Im Sturm weniger Tage wird Prag zur tschechischen, zur Hussitenstadt.
Im ganzen Lande grollten die Gewitter. Auf die Kunde von Hus' Hinrichtung hatte der utraquistische Adel seinen »Herrenbund« gegründet. In all seinen Sprengeln erzwang er die Einführung des Kelches. Gegen ihn trat der »Katholische Herrenbund« zusammen, mit dem mächtigen Rosenberg an der Spitze. Das Land schien sich selbst zerfleischen zu wollen. Mehr ins Seelische wirkte die Bewegung beim einfachen Volk ein. In Südböhmen, den Wirkungsstätten des Hus während seiner Verbannung aus Prag, brandete sie mächtig auf. Zu fünfzigtausend versammelten sich die Scharen armen Landvolks, kleiner Leute und vieler vom Landadel auf den Bergen. Auf einem befestigten sie sich (1419), gründeten eine Stadt, tauften sie auf den biblischen Namen Tabor (1420). Hier unter den Taboriten schossen die radikalsten Lehren auf. Von hier aus wirkten sie auch ins gemäßigte Prag, wo Johann von Seelau, der Mönch, sie gierig weitertrug.
Die nächsten Jahrzehnte bieten das grausige, in vielem auch erhabene Schauspiel, wie ein geistiger Vorgang in sein Extrem getrieben, dabei von häßlichen Wirklichkeiten fast erstickt wird. Wie Persönlichkeiten von Mächten geschoben, auf Wellenberge gehoben, herabgeschleudert oder aber in ihrem Innersten verwandelt werden. Wie zuletzt eine eherne Tatsächlichkeit zwingt und siegt, so daß die schon ehemals Starken als die Stärksten aus den Kämpfen hervorgehen: der Hochadel Böhmens.
Wenzel war gestorben –; am Zorn über das aufrührerische Prag (16. August 1419). Am Tag nach seinem Tode waren die Stürme fesselloser ausgebrochen. Aber die Besonnenen suchten doch Verständigung. Auf dem Landtag, der noch im August sich versammelte, wurden die religiösen Forderungen angemeldet. Gemeinsam mit den Taboriten wurden die ziemlich allgemein gehaltenen »Prager Artikel« verfaßt. Es wurde gefordert: 1. Freie Predigt des Wortes Gottes. 2. Die Reichung der Altarsakramente unter beiderlei Gestalt. 3. Ein christliches Leben der Geistlichkeit, besitz- und machtlos. 4. Abschaffung aller Mißbräuche, die den göttlichen Gesetzen zuwiderlaufen, Bestrafung aller Todsünden. Eigens eingesetzte Beamte hatten für Einhaltung Sorge zu tragen. –; Man wollte die praktische Durchführung der Artikel sich offenhalten. Damals wurde auch verlangt, daß »besonders in den Städten Deutsche nicht in Ämter eingesetzt werden sollten, wo Tschechen regieren könnten und es verstünden«. Aber man wollte doch Versöhnung mit dem König.
Nachfolger Wenzels war dessen Stiefbruder Sigismund geworden. Er lehnte ab. Er wollte die einige Kirche retten. Er forderte auf einem Landtag für Böhmen und Mähren in Brünn (Weihnachten 1419), daß zum Zeichen der Unterwerfung des aufrührerischen Prag alle in den Straßen errichteten Barrikaden, alle gegen die Burg aufgebauten Verschanzungen beseitigt werden müßten, daß allen vertriebenen Nonnen, Mönchen und Deutschen freie Rückkehr gesichert werden müsse. Die Prager gehorchten. Sie wollten den Frieden. Aber sie konnten es nicht ertragen, daß nun die alte Ordnung im Lande wiederhergestellt werden sollte. Empörten sich dagegen, daß von Papst Martin V. die ganze Christenheit zum Kreuzzug gegen sie, die Ketzer, aufgerufen wurde.
Die Verbitterung stieg. Drohungen wurden wieder laut. Viele Deutsche fliehen, fliehen auf die Burg, die von den Königlichen noch gehalten wird, fliehen auf den Wyschehrad, auf feste Plätze draußen im Land. Die Prager sehen in den Flüchtigen Verräter. Sie konfiszieren ihren Besitz: Häuser, Weinberge, Landgüter. Hunderte reichster Anwesen fallen an die Prager Städte. Besonders die Altstadt wird reich. Aber das Überangebot an feilgebotenen Häusern entwertet sie schnell. Vieles zerfällt in den folgenden Jahren.
Die zurückgebliebenen Deutschen –; es waren ihrer nicht wenig –; müssen sich zum Hussitismus bekennen. Als eigenes Gotteshaus wurde ihnen die Heilig-Geist-Kirche zugewiesen. Später, in den sogenannten Sobìslawschen Rechten (um 1440), wird ihnen sogar das Bürgerrecht zugestanden und das Schöffenamt. Von den 18 Ratsmannen der Altstadt soll der dritte Teil aus Deutschen bestehen. Man sieht: eine starke deutsche Minderheit war trotz der Stürme geblieben und durfte bleiben. Wir wissen, daß viele von ihnen sich ehrlich zum Hussitismus bekannten: Einheimische, bei denen der von Karl IV. gepflanzte böhmische Landespatriotismus bis zum Eingehen in das Schicksal des Landes gediehen war; Zugewanderte, wie die Brüder Nikolaus und Peter von Dresden, die neben Jakobell von Mies für die Einführung des Kelches bei der Spendung des Abendmahls eingetreten waren. Aber diese Minderheit war wirtschaftlich und geistig aufgesogen von der tschechischen Mehrheit. Das eigenständige Prager Deutschtum war untergegangen.
Sigismund hatte Kreuzheere gegen das ketzerische Böhmen geworben, erschien nun mit Kriegsmacht vor Prag. Seine Niederlage am Veitsberg, der nach dem siegreichen Žižka später Žižkaberg genannt wurde, und am Wyschehrad, dem Stützpunkt der Katholischen, den er entsetzen wollte, leiteten ein blutiges Jahrzehnt ein. Das Jahrzehnt, da die noch geeinten Hussiten heroisch und brutal sich schlugen, da Religiöses und Nationales zusammentrafen gegen Katholizismus und Deutschtum, da das Kampflied: »Die ihr Gottes Streiter seid« ein begeistertes Heer mitriß, und alle Christenheit erschüttert wurde von den Siegen Žižkas, des Einäugigen, und nach dessen Schlachtentod Prokops des Mächtigen.
Droben auf der Burg saßen zu Beginn der Kriege noch die Königlichen, wehrten sich noch 1420 der Belagerung, noch 1421 des Sturms. Als sie dann (7. Juni) unter ehrenvollen Bedingungen abziehen, dringt der Pöbel ein, raubt, plündert, zerstört. Als reguläres Prager Kriegsvolk den Räubern Einhalt tut, stehen die Gotteshäuser schon verwüstet, der herrlichen Einrichtung beraubt. (Von der vorhussitischen Ausstattung des Doms haben wir genaue Kunde.) Der Palast steht ausgeplündert, die Häuser der Geistlichen und einige Adelshäuser liegen in Schutt und Asche. Ein Tag des Tobens länger –; und den Hradschin hätte gleiches Schicksal erreicht, wie es kurz zuvor den Wyschehrad getroffen hatte: Zerstörung bis zum Grunde.
Haupt und Herz der Bewegung war Prag. Aus der internationalen Königsstadt war die nationale Volksstadt geworden. Aus ihr trieben die geistigen Energien vorwärts. Der Landtag zu Tschaslau sah Prag auf der Höhe seiner politischen Macht. Das königlose Land wählte sich eine zwanziggliedrige Herrschaft, in der acht Bürger, sieben Herren vom kleinen Adel und nur fünf Barone saßen. Das Volk hatte gesiegt über die immer lauernde, oft vorbrechende Adelsherrschaft der Jahrhunderte. Prag war unbestrittener Vorort des hussitisch zusammengeschlossenen Böhmens. Prag gebot über die königlichen Städte. Prag gebot über das Land. Die um 1440 fabrizierten, dem Herzog Sobìslaw zugeschriebenen Stadtrechte spiegeln in Form einer Fälschung getreulich die Aspirationen des damaligen Prag. (Bezeichnend, daß diese einst den Deutschen verliehenen Privilegienurkunden gefälscht wurden: andere ein Stadtrecht begründende Urkunden waren, wie wir wissen, nicht da.) Sie bestimmen für den Fall der Erledigung des herzoglichen Stuhles den Bürgermeister der »Alten Stadt Prag« zum Landesverweser, dem alle Städte und Landesbeamten, selbst der Burggraf und der Landesrichter zu gehorchen hätten. Die Wirklichkeit entsprach dem Anspruch: Prag schuf die Macht, Prag rüstete die Heere, Prag gab die Parole aus für die geistige Politik. Damals maß es sich gern an der stolzen Größe der Stadtrepublik Venedig.
Solche Machtfülle nach außen –; war es wirkliche Macht: Auswägung der inneren Kräfte, Erprobung am Draußen? War es nicht eine Macht im künstlich verschlossenen Raum, gleichsam außerhalb der damaligen Welt? Es war gefährliche Isolierung, unter deren Druck dann auch die rassemäßigen Bindungen stärker wieder hervorgetrieben wurden: man verhandelte mit Polen, auch mit Litauen wegen der Übernahme der Königskrone durch deren Dynastien. Die säkulare Bestimmung, Vermittlungsort zwischen Ost und West zu sein, drohte ganz zu versinken.
Auch im Innern hatte der Hussitismus die Volksherrschaft gesichert. Statt Ratsherren und Schöffen des Patriziats, die längst vertrieben waren, saßen die Vertreter der »Nachbargemeinden« im Rathaus. Das deutsche Stadtrecht hatte man beibehalten müssen aus Mangel eines eigenen. Man hatte es ins Tschechische übersetzt. In der Volkssprache wurde Gericht gehalten. Statt der hohen Ordensgeistlichen –; auch sie waren geflohen –; bestimmten nun die Magister der freien Künste die Haltung der Universität.
Der Hradschin lag verödet. Das Domkapitel war geflohen. Nach dem Übertritt des letzten Erzbischofs Konrad, eines Westfalen, zum Utraquismus, der seinerseits ihn übrigens ignorierte, versuchte das Domkapitel von Zittau aus die Administration der verwaisten Erzdiözese zu verwalten. Die Burg stand leer. Der Veitsdom stand leer. Die Macht war herabgewandert über den Strom in die Altstadt.
Mittelpunkt des religiösen Lebens war die Teynkirche. Sie wurde Hussitendom. Von seiner Kanzel herab wurden die Bestimmungen der diskutierenden Magister verkündet. Die politische Macht saß im Prager Rathaus, die geistige im Prager Karlskolleg. Im Rathaus und Karlskolleg tagten die böhmischen Stände. Der hohe Adel sandte seine Sprecher dorthin. Er sah damals in Prag seinen zentralen Stützpunkt. Feindliche Mächte, die von außen andrangen, festigten zunächst diesen Bund zwischen Adel und Stadt. Auch Tabor kämpfte noch unter dem Banner Prags.
Aber diese Macht des hussitischen Prag war trügerisch. Von innen und von außen nagte der Wurm. Der breite Kulturstrom, der diese Stadt ein Jahrhundert lang durchzogen hatte, war versiegt. Die Burg, von der ehedem Ideen in die Stadt niedergeströmt waren, lag verödet. Wie eine anklagende Faust ragte Karls Dombau, ein Torso, in den Himmel. Die stürmenden Hussiten hatten ihn, das Symbol des gehaßten Rom, zerstören wollen (s. o.). Aber er wurde von den Bauern und Mälzern der Altstadt gegen die wütenden Massen verteidigt. Zum Andenken an diese Tat stiftete ihre Zunft ein Jahrhundert später den kostbaren Wenzelsleuchter, ein Prachtstück Nürnberger Renaissance aus der Gießerhütte des Hans Vischer. Heute noch ziert er die Wenzelskapelle. Die Kleine Seite war fast vernichtet. Viele Deutsche, die sie bevölkert hatten, waren vertrieben. Auch in der Altstadt lagen Ruinen, verödete Häuser. Der Volksdom streckte zwei unvollendete Turmstümpfe empor. Zum Ausbau war keine Zeit, keine Kraft. Alle Kräfte waren gebunden durch die Kriege nach außen, nach innen. Trotz aller Beschlagnahme der Güter von flüchtigen Deutschen, trotz aller Säkularisation der Kirchen und Ordensgüter wollte kein Wohlstand aufblühen. Der innere Markt war zerrüttet durch die Entwertung der konfiszierten Gründe, die vom Magistrat zu Spottpreisen angeboten wurden. Verfallende Häuser, verlassene Klöster lagen öde da. Gemeines Volk ward angelockt von draußen, schwoll gefährlich an. Es bedrohte die mühsam formende Arbeit der gemäßigten Magister. Der Welthandel des äußeren Marktes, ehedem in den Händen der Deutschen, war mit deren Vertreibung bei Ausbruch der Kriegswirren auf einen Schlag versiegt. Ein notdürftig erhaltener Bauernmarkt schuf weder Leben noch Reichtum. Das stolze Hussiten-Prag drohte zu verbauern, drohte in Masseninstinkten zu ersticken. Der allzu plötzlich überkommenen Aufgabe der Selbstherrschaft war es nicht gewachsen. Alles schien aufs Volk gestellt, aber eine Volkskultur vermochte die neue Volksstadt so plötzlich nicht zu wecken.
Noch durfte man hoffen auf die zündende Kraft der Idee. Die aber war im Grunde ethisch. War sie tragfähig für eine tief zu gründende, breit aufzubauende Kultur? Konnte sie es damals, zu Beginn des 15. Jahrhunderts, überhaupt sein, in jenen Zeiten, da subjektive Gefühle zwar schon sich aufbäumten gegen starr gewordene, überdies von den Trägern längst verratene Formen, da aber die Gemeinschaft doch noch dieser Formen bedurfte, um ihr Dasein zu zwingen? Gewiß: die nationale Stoßkraft war durch Hussens Kampfruf vereinheitlicht, der Weg zu einer nationalen Kirche war freigelegt. Der nationale Feind in jeder Gestalt war nach außen getrieben. Aber gerade diese Nationalisierung bereitete ja die Tragödie des Hussitismus vor. Er war in nationale Engen abgebogen, auch abgetrieben worden, statt allgemein christlich zu bleiben. Die gesamte Christenheit hätte ihn aufnehmen, hätte mit seinen Kräften das Urheberland stützen müssen. So aber waren die Träger der Besinnung zu Ketzern gestempelt, in Kriege gehetzt, die nationalheldische Züge zwar entwickeln, die religiöse Sorge aber verengen mußten. Und weiter: gar zu tief war das Gift sozialer Unzufriedenheit in die ersten Regungen der Bewegung eingedrungen, als daß es –; ehedem gegen die Deutschen gerichtet –; nun nicht im eigenen Lager hätte weiterfressen müssen.
Verderblicher aber, daß sich dem nun auch die religiöse Spaltung im Inneren zugesellte. Diskussionen zersetzten die gemeinsame Front. Die Idee drängte in ihr Extrem. Das fand seine Träger in den fanatisierten Massen Tabors. Von dort aus zündete es nach Prag herein.
Tabor gegen Prag –; so grollte schon in der Tiefe die Parole. Noch hielt äußere Not, die immer wieder anrückenden Kreuzheere, zusammen. Aber die ins Soziale auswuchernde Idee trieb auseinander. Prag, seit Jahrhunderten mit Kultur gedüngt, es mußte immer wieder Maß und Einsicht reifen lassen. Man hing an der Welt, an Macht und Besitz. Man spürte die »ewige« Suggestion der formenden Roma. Mag Tabor ihm darob Verrat am kostbarsten Gute vorwerfen, es war sein Schicksal. Hier hatte Rom doch schon im Blut gewirkt. Ein radikaler Protest konnte nicht mehr gelingen.
Ganz anders draußen, das revoltierende Land, das sich in Tabor einen Machtkern schuf. Es hatte von Rom den Mythos des Urchristentums wahrlich aufgenommen. Die Form aber verwarf es als lästiges, ja beleidigendes Kleid. Jetzt füllte es jenen Mythos mit Blut und Leben und warf ihn gegen Rom. Wollte Ernst machen mit dem Urchristentum, raste in seinem Fanatismus weiter, predigte die Gleichheit aller, Kommunismus der Güter und allgemeines Priestertum. Verwarf Besitz und alle Form, haßte Bildung, klagte wider alle Kultur. Die lungernden Proletariermassen der Prager Städte, vornehmlich der Neustadt, in der sich seit dem Neustädter Fenstersturz der ganze taboritisch gesinnte Anhang des Johannes von Seelau eingenistet hatte, säkularisierten Tabors Ideen: Empörung gegen die Mächtigen und Reichen schwelte in den Massen.
Die Universität disputierte. Sie war längst nicht mehr Forschungsstätte, sie war Konzilium der kämpfenden Führer geworden. Da stand der feine und besonnene Jakobell von Mies, neben Hus der bedeutendste, ja in manchem der richtunggebende Führer der Bewegung. Die Revolution hatte ihn nach Hussens Flammentod an die Spitze getragen. Er war Hussens Nachfolger als Prediger an der Bethlehemkapelle geworden. In diesen seinen Predigten der Jahre 1420 bis 1422 –; er hat sie in einer Postille »Die Auslegung der Apokalypse des hl. Johannes« herausgegeben –; begleitete er die kritische Entwicklung jener Jahre mit seinen Hoffnungen und Ängsten, mit Zweifeln und mit Dankgebet, mit Warnungen an die Mitstreiter und mit beschwörendem Anruf. Er hatte früh die Bürde einer formheischenden Welt erkannt und auf sich genommen. Seine Forderung auf Neugestaltung der Eucharistie –; er hatte sie vielleicht von den aus Dresden zugewanderten Predigern Nikolaus und Peter übernommen –; war solches Streben nach einer Form für die neue Bewegung gewesen. Jetzt mühte er sich um Ausgestaltung dieser Form, um sie der römischen entgegenzusetzen. Mit bedächtiger Entschiedenheit trieb er die utraquistischen Forderungen vor. Trieb sie aber stets nur bis zu einer Schärfe, die sich eben noch deutlich genug vom römischen Standpunkt abhob. Er führte die »eifrigen Kelchner«.
Aber seine Haltung weckte Gegnerschaft von beiden Seiten. Von rechts kämpften die »gemäßigten Kelchner« um eine Brücke zu Rom zurück. Ihr Sprecher war Johann von Pøibram. Der verfaßte apokalyptische Schriften, und kam doch nicht vom Zauber der römischen Herrschaft los. Von links aber wüteten die taboritisch gesinnten Massen. Johann von Seelau wiegelte sie auf, hetzte von der Kanzel, auf der Straße. Ihm ging es vielleicht noch um Radikalismus der Idee –; vielen unter den Massen ging es nur um deren materielle Folgen.
Kämpfe brachen aus. Der Altstädter Magistrat, vollziehende Behörde des Bundes, hielt es mit den Gemäßigten. Er glaubte, den Brand der Tiefen noch im Keim ersticken zu können, beorderte Johannes von Seelau und seine einflußreichsten Anhänger aufs Rathaus, ließ dort alle heimlich hinrichten. Das empörte Volk, vor allem Seelaus Anhang aus der Neustadt, stand auf, stürmte das Altstädter Rathaus, warf die Ratsherren aus den Fenstern, lynchte sie. Stürmte weiter, plünderte in den Klöstern, mordete, radikalisierte die Stadt. Die Idee drohte in der sozialen Revolution zu ersticken.
Auch in der Judenstadt fiel die Menge ein, hauste schrecklich. Die Juden hatten seit Ausbruch der hussitischen Wirren strengste Neutralität ängstlich bewahrt. Die hussitischen demokratischen Ideen zündeten wohl in der jüdischen Jugend. Aber strenge Rabbinatsreskripte (welche erhalten sind) verboten allen Gemeindegliedern jegliche Teilnahme am religiösen Disput. Gespräche, die christliche Bürger mit ihnen über diese Dinge anknüpften, sollten sie sofort fallen lassen. Jakobell von Mies hatte in seiner Schrift über den Wucher (1414) Assimilierung der Juden als einzige Lösung der schon damals als Problem empfundenen Judenfrage vorgeschlagen. (Ein Vorschlag, der übrigens keineswegs aus übergroßer Judenfreundlichkeit, sondern lediglich aus recht allgemein menschlichen, ja praktischen Beweggründen ergangen war.) Aber das Mißtrauen im Volk wurzelte zu tief. Das Ghetto blieb außerhalb der hussitischen Bewegung. Der Altstädter Magistrat hatte wie alle übrige königliche Macht auch das »Judenregal« übernommen, sorgte für Ordnung im Ghetto und trieb die Steuern ein. Vielleicht hatten sich die Juden eigenem Vorteil zulieb stark an die ihnen vorgesetzten Ratsherren angeschlossen. Vielleicht war es alter Haß, der das Volk in die Judenstadt trieb. Die Juden hielten sich nun noch ängstlicher vom geistigen und politischen Geschehen in den Prager Städten fern.
Die Bewegung trieb weiter. Man mußte mit den Taboriten einig werden. Neue Verhandlungen im Karlskolleg. Es ging um Äußerlichstes und um Innerlichstes: um Meßgewänder, welche die Taboriten verbannen wollten, und um das Wunder der Transsubstantiation, das die Taboriten leugneten. Johann von Pøibram, Sprecher der Prager, bestand auf seiner These. Statt der Einigung folgte verschärfter Kampf zwischen Prag und Tabor. Die Gefahr von draußen: der von neuem gegen Böhmen anrückende Sigismund führte zunächst noch einmal zur Einigung. Bei Taus wurde das Kreuzheer des Kaisers abermals vernichtend geschlagen.
Mit Waffengewalt war nichts auszurichten gegen das fanatisierte Volk. Der Kaiser sieht es ein. Rom sieht es ein. Man verhandelt. Auf dem Basler Konzil spricht Rokyzana, ein Schüler des inzwischen verstorbenen Jakobell von Mies, feurig für die Sache der Hussiten. Man disputiert, man lenkt ein. Rom scheint nachzugeben –; um desto entscheidender zu siegen. Der Konzilgesandte Philibert, Bischof von Coutances, setzt auf dem Novemberlandtag die vorläufige Annahme der »Basler Kompaktate« bei den utraquistischen Ständen durch. Diesen Kompaktaten liegen die »Prager Artikel« vom Jahre 1419 zugrunde. Sie machen den Hussiten das Zugeständnis, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu reichen. Aber nebensächlich scheinende Beifügungen heben den Wert der Zugeständnisse auf, schlagen in diese Reservate nachhaltige Breschen, durch welche die römische Kirche später mit aller Macht wieder vorbrechen konnte. Die Hauptforderung: der »Kelch«, wird entwertet durch die an seine Darreichung geknüpfte Bedingung, daß den Hinnehmenden eingeschärft werden muß, auch das Abendmahl unter einer Gestalt enthalte schon den ganzen Leib Christi –; was das zugestandene Kelchopfer zur leeren Geste stempelte. Ähnlich verklausuliert und dadurch abgeschwächt waren die übrigen Zugeständnisse. Und auch noch die Zusicherung auf späteren Ausbau dieser Kompaktate war zwiespältig.
Man zauderte in Prag. Man kämpfte. Man unterhandelte. Man war so müde. Müde der Kriege. Müde der Empörungen. Müde der formlosen schrecklichen Zeit. Der Prager Utraquismus: das war Universität, das war Adel und Besitz, war Sehnsucht nach Maß und Bildung. Man hatte nicht ungestraft abendländische Formung, das ist Rom, in sich aufgesogen. Nun war man zersetzt. Die revolutionäre Urkraft war gebrochen. Man kam nicht mehr los von jener Zaubermacht der Form, die man von sich aus trotz dem Bemühen mancher Edlen nicht erreichte. Auch hatte Rom den Trumpf in der Hand, daß diese Halbketzer die Weihe des Priesters verlangten und immer noch Rom als die Erbstätte der Weihen verehrten.
Ganz anders Tabor und die Seinen im Lande. Da stand die allgemeine Priesterschaft wie eine Mauer vor dem Einfluß Roms. Hier wucherte in lauter Fanatismen Rohstoff für neue Religionsbildung. Aber die Feuer hatten sich in äußeren Kriegen verzehrt, zur Läuterung der inneren Kräfte fehlte die reine Flamme. Man trieb immer tiefer hinab in Unform und Chaos.
Die Kompaktate waren der Keil, den Rom hineintrieb in die ungleichen Fronten. An ihm spaltete sich Tabor radikal von Prag. Rüstete gegen die einstigen Verbündeten, zog gegen die verhaßte »Stadt«. Die wurde auf diese Weise nach rechts abgedrängt, ging nun eindeutig mit dem Adel. Man witterte Bedrohung des Besitzes; fürchtete Zerschlagung aller noch gebliebenen Form durch die fanatisierten Landvölker. Man stellte Heere auf und kämpfte. Im Jahre 1434 traf die Taboriten das Verhängnis. Sie wurden bei Lipan vernichtend geschlagen. Rom hatte nur mehr einen Feind: den labilen, in sich angefressenen Prager Utraquismus. Er würde sich selbst zersetzen. Man hatte Zeit.
Und einstweilen hatte er sich durch die Kompaktate versöhnen lassen. Rom und der Kaiser, die organisierte Christenheit des Abendlandes, nahmen Böhmen wieder auf ins »Heil der Welt«.
Der Kaiser war 1436 eingezogen in Prag. Er war kein Hasser. Ihn hatten höhere Mächte zum Kampf getrieben. Nun mühte er sich um Ruhe für das arme Land. Man huldigte Sigismund vor dem Altstädter Rathaus, man huldigte ihm vor dem Neustädter Rathaus. Aber nicht er war Sieger im Lande. Sieger war der Adel, der den Aufstand der Taboriten zu brutaler Niederdrückung des Volkes ausgenutzt hatte, der dann beim Kaiser fast demütigende Zugeständnisse durchgesetzt hatte für seine Anerkennung. Von seinen Burgen aus begann er nun die Macht der utraquistischen Stadt, die ihm zu groß geworden war, anzunagen.
Zunächst kehrte Ruhe ein. Prag war noch aktives Haupt der Bewegung. Die Burg öffnete neuem Leben ihre Tore. Im Veitsdom amtierte wieder das Kapitel, das mit dem Kaiser zurückkam aus der Fremde. Drunten in der Stadt richtete Sigismund den Utraquisten im Emauskloster –; die Slawenmönche waren längst vertrieben –; das eigene Konsistorium ein: ein »gemäßigtes«. Christian von Prachatitz, ein Gelehrter, berühmt als Arzt und als Astronom, wurde erster Vorstand. Ihm folgte Johann von Pøibram, der alte Feind der Taboriten. Später Prokop von Pilsen, lauter Geistige, und das heißt: Gemäßigte.
Man wollte sich versöhnen mit Rom. Auch die Gegenseite zeigte versöhnliche Haltung. 1437 wurde auch das Heiltumsfest vor der Fronleichnamskapelle in alter Feierlichkeit wieder begangen. Der Kaiser ließ damals in lateinischer, tschechischer, deutscher und ungarischer Sprache verkünden, daß die Utraquisten in Böhmen und Mähren treue Christen und echte Söhne der Kirche seien. Von den tschechischen, von den hussitischen Bürgern waren damals Krone und Reichsinsignien, waren die heiligen Reliquien zur Kapelle geleitet worden. Man konnte zufrieden sein. Aber man sah doch mit Sorge das starke Vordringen der Katholischen unter der neuen Ära.
Die Idee, die, vom Taboritentum vorerst entlastet, ganz in den Utraquismus gezwängt worden war, mußte notwendig nun innerhalb dieses in ihre Extreme treiben. Die Gemäßigten standen unter Pøibrams Führung. Sie wünschten Aussöhnung mit Rom um jeden Preis, schließlich gar um den eines Verzichts auf den Ausbau der Kompaktate. Darum wurde jetzt gekämpft. Redestürme im Karlskolleg wirbelten die verführerische Persönlichkeit Rokyzanas, des einstigen Sprechers auf dem Konzil, zu führender Stellung unter den Radikalen empor. Sein hinreißendes Wort zwingt von der Kanzel im Teyn die Massen. Schüler des Jakobell von Mies, verteidigt er die alte Form des Hussitentums. Ihn hatten die Stände zum Erzbischof der Kalixtiner ausgerufen. Rom hatte ihn nicht bestätigt. Nun sah er, wie Rom auf seinem, dem hussitischen Boden vordrang, wie die Priester zurückkamen und die Klöster sich wieder füllten. Er raste gegen sie an. Er warf dem Kaiser von der Kanzel herab Begünstigung der Katholiken vor. Er mußte fliehen. Haß gegen den Luxemburger, den Deutschen lebt in ihm auf. Panslawistische Träume arbeiten sich in ihm hoch. Er wirkt von Königgrätz aus gegen Prag, gegen Pøibram, gegen das neue Konsistorium. Aber er bleibt verbannt.
In Prag wogt die Bewegung auf und nieder. Der alte Kaiser war gestorben. Nach vielen Wirren der Königswahl wird Albrecht, sein Schwiegersohn, im Veitsdom gekrönt. Ein vornehmer Mensch. Auch ihm war es Ernst um Befriedung des Landes. Er hatte sich Wahl und Krönung wieder durch große Zugeständnisse an den Adel erkaufen müssen. Und wieder waren die Kompaktate bestätigt worden. Aber das Volk glaubte doch die Katholischen durch den König begünstigt. Die alte Bewegung flackerte auf, nahm nationale Färbung an: der König war Deutscher. Dem Konsistorium stand damals noch der Gelehrte Christian von Prachatitz vor. Aber bei St. Michael predigte der hitzige Peter von Mladenowitz. Schon sollte in ganz Prag das Abendmahl nur mehr unter beiderlei Gestalt gereicht werden. Da stirbt der König auf einem Zug gegen die Türken.
In die Thronfolgerfrage drängt sich nun der neugestachelte Nationalismus. Rokyzanas panslawistische Ideen zünden bei den radikalen Utraquisten. Sie schlagen wieder einen Polenprinzen zum König vor, gegen Albrechts unmündigen Sohn Ladislaus. Machtfragen treten vor die religiösen. Sie entscheiden sich nicht mehr in Prag, sondern draußen im Land.
Dort gruppiert sich der Adel zu mächtigen Bünden, die dem unentschiedenen Prag die Macht absaugen. Da ist wieder der Bund der Katholiken unter dem in Südböhmen mächtigen, dem listigen und starken Ulrich von Rosenberg. Unter Meinhard von Neuhaus sammeln sich die »gemäßigten Kelchner«. Der besetzt die Prager Burg, bestimmt von hier aus die geistigen Schicksale der Stadt. Bestimmt sie fast bis zur Aussöhnung mit denen sub una. Den radikalen Kelchnern entsteht in Heinrich Ptáèek ein mächtiger Bündner in Westböhmen. Und nun flammen auch die Taboriten wieder auf unter den extremen Pikarden.
Rokyzana, der Verbannte, schürt die alten hussitischen Feuer. Ihn hatte die Begegnung mit Chelèický, dem edlen Widersacher aller Gewalt, geläutert. Während im Tumult der Stadt die gemäßigte Richtung des Utraquismus dem blutig unterdrückten Radikalismus nachzusterben schien, war draußen auf dem Land Chelèickýs Lehre erblüht, war aus den Radikalismen Tabors als zarteste Frucht gereift.
Chelèický war im Geiste des radikalen »Landes« aufgewachsen, hatte in seiner Jugend die Glut der Prager Disputationen erlebt. Doch als aus dem Glauben der Krieg sprang, hatte er, der reine Spiritualist, sich abwenden müssen. Radikal wie Tabor, doch ohne dessen Fanatismen, läuterte er sich zu einem reinen evangelischen Glauben. So grub er tiefer, als die Disputationslust der Städte, als der immer wieder ins Äußerliche getriebene Radikalismus der Taboriten es je vermochten, formulierte schon klar die Lehre von der Prädestination und –; was seine Anhänger später dem deutschen Protestantismus so nahebringen sollte –; von der Erlösung allein aus der Gnade. Hier war Religion im Werden –; alles Utraquistische war nur gläubiger Formalismus. Aber er gelangt nicht zum entscheidenden Durchbruch in der realen Sphäre. (Darf man ihn mit Sebastian Frank zusammen sehen, der vom »realen« Luther sich abwandte?) Er konnte nicht Gründer einer nationalen Kirche werden. Sein Wesen schreckte vor äußerer Formung zurück. Aber aus seiner Lehre erwuchsen die »Gemeinden der böhmischen Brüder«, die geistigen Erben aller Kämpfe dieser Zeit. Nach Prag wirkten sie in ihrer Reinheit erst viel später herein, als Eindringlinge fast. Auf seinem Boden fanden sie nur schwer Wurzeln. Jetzt aber trug Rokyzana die Chelèickýschen Gluten in die großen Kämpfe des Tages.
Er rang um die wahre Lehre, rang um Einheit der Bewegung. Er predigte im Lande. So zieht er nun auch die geistigen Kämpfe aus Prag heraus aufs Land. Er reißt die auf dem Kuttenberger Landtag versammelten Stände mit zur Gründung der einigen utraquistischen Kirche (1441). Der starke Ptáèek hatte zwischen ihm und dem Pøibramer vermittelt. Nun schwur man dem feurigen Rokyzana als dem Oberhaupt dieser Kirche die Treue. Und Rokyzana drängt weiter zur Entscheidung.
Taboritische Lehren schwelten wieder allüberall im Landvolk auf, das der Adel immer grausamer unterdrückte. Rokyzana sieht die Gefahr. Er drängt auf endgültige Abrechnung mit dem fanatisierten Geiste Tabors. Er kämpft mit geistigen Waffen. Auf dem Kuttenberger Landtag von 1443 disputiert er mit Niklas Biskupetz, dem fanatischen Taboritenpriester. Der unterliegt. Seine Lehre wird als ketzerisch verdammt. Tabor ist geistig und damit auch politisch erledigt.
Man hält sich für stark. Der Utraquismus war geeint. Das neue päpstliche Schema spaltete den Katholizismus. War es nicht günstige Schickung? Waren nicht zweimal schon Gesandtschaften der gegnerischen Päpste nach Prag gekommen zu Unterhandlungen (1441)? Konnte man heute nicht die Einigkeit in der Idee entgegenstellen? Aber alle Verhandlungen mit Rom hatten sich wieder zerschlagen. Und Albrecht, der Bayernherzog, hatte gar die ihm angebotene Krone Böhmens ausgeschlagen. Denen draußen schien noch immer ein Fluch über dem Land zu lasten.
Prag kümmerte indessen in lauter Unentschiedenheiten dahin. An der Universität, die durch den Verlust fast sämtlicher Güter arg heruntergekommen war, lehrten schon wieder katholische Magister, die sich durch wiedererrungene Pfründen selbständig erhalten konnten. Meinhards, des Burggrafen, Anhang erzwang die Einsetzung ihm genehmer Schöffen auf dem Rathaus. Das Volk litt unter dem wirtschaftlichen Niedergang. Man trieb unrettbar einer lauen Aussöhnung mit den Katholischen entgegen. Als im Jahre 1448 Johann von Carvajal als päpstlicher Legat erschien, zogen ihm die Geistlichkeit, Universität und Volk voll Hoffnung entgegen. Im radikalen Lager erhoffte man Bestätigung Rokyzanas als Erzbischof, im gemäßigten zumindest Bestätigung der Kompaktate. Aber Carvajal forderte vor aller solcher Bestätigung Herausgabe der kirchlichen, besonders der erzbischöflichen Güter, verlangte die unbedingte Anerkennung Roms. Das Volk schrie auf in Empörung. Kaum gelang es dem bedrohten Legaten, unter Rosenbergs Schutz zu entfliehen. Das Original der »Kompaktate«, das ihm zur Einsicht gegeben worden war, hatte er, vielleicht aus Versehen, auf seiner plötzlichen Flucht mit sich genommen. Man jagte es ihm auf der Straße nach Beneschau wieder ab. Der Bruch mit Rom war ärger als zuvor. Leider auch die Unentschiedenheit der Prager.
Da griff von außen eine starke Faust herein in die Prager Geschicke. Nach dem Tode Ptáèeks hatte Georg von Podìbrad, Herr auf Kunstadt, die Führung des Bundes der radikalen Kelchner übernommen. Ein junger, zielbewußter Baron, in ständigen Reibereien mit dem listigen Rosenberger an Einsicht gereift, hussitisch durchblutet durch die Freundschaft mit Rokyzana, ein echter Patriot, der die Macht des Landes und die Wahrheit der Lehre erzwingen wollte. Er überrumpelte die Stadt, vertrieb die Neuhaussche Besatzung, pflanzte das Kelchbanner auf und regierte.
Das Volk jubelte ihm zu. Die Herren draußen fügten sich seiner Entschiedenheit. Sogar der in seiner Macht getroffene Rosenberger machte gute Miene zum bösen Spiel. Mit einem Schlage war Prag wieder Mittelpunkt des politischen und religiösen Lebens. Denn Rokyzana, der feurige Kämpfer, war mit Georg eingezogen in die Stadt, predigte im Teyn.
Zunächst gab es Tumulte. Nationalismus loderte auf. Die Deutschen, die aus Wien und Leipzig zugewandert waren an die Prager Universität, zogen ab. Die Massen nutzten den Umsturz zur Plünderung von Klöstern, auch wieder zu einem Überfall auf die Judenstadt.
Aber bald zog Ruhe ein. Kluge Maßnahmen Georgs befriedeten die Stadt, bald auch das Land. Die Richtung der entschiedenen Utraquisten (radikalen Kelchner) war eindeutig gewiesen. Endlich glaubte man den Sieg der gerechten Sache gesichert. Zwei kraftvolle Naturen standen an der Spitze der politischen und der geistigen Kämpfe. Zwei starke Temperamente, durch innige Freundschaft verbunden. Hinter ihnen stand ein geeintes Volk. Nun konnte die Kraft des Volkes gesammelt vorquellen. Und dieser Kraft würde Rom sich beugen.
Aber im Kern dieser so günstig erscheinenden Konstellation lag schon das Gift, das die gesunde Kraft dieser Jahre zersetzen sollte. Auch dieser national-religiöse Traum endet in Fremdherrschaft, in Romtriumph und Adelsbeute. Prags Schicksal war eine Zeitlang der Volkskraft anheimgegeben. Aber diese Volkskraft hatte ihm keine Form gefunden. Erst fremde Mächte sollten sie bringen, viel später und erst nach blutigen Wirren.
Schon wenige Jahre nach Georgs Herrschaftsantritt –; die Stände hatten ihn zum Gubernator des Königreiches erwählt –; tastete verlockende Wirklichkeit vor. Rom nähert sich in verführerischer Gestalt: Äneas Sylvius Piccolomini, der gewandte Literat, tätig auf dem Basler Konzil, dann vertrauter Rat des deutschen Königs Friedrich III., kommt nach Böhmen. Er trifft den Gubernator, bespricht sich lange mit ihm. Noch stehen sich Mensch und Mensch gegenüber, zwei Geister, die sich schätzen. Äneas Sylvius rät zur Versöhnung mit Rom, schildert die Gunst solcher Versöhnung, spricht von der dadurch zu gewinnenden Macht des Landes. Georg antwortet frei und stark als Utraquist. Aber der erste Stachel sitzt in ihm: er ahnt, daß er Rom noch braucht.
Rokyzana, erbittert gegen Rom durch die dauernde Ablehnung seines, des geeinten Volkes Anspruchs auf die erzbischöfliche Würde, schaut aus nach Osten: ob nicht mit der griechisch-katholischen Kirche eine stärkende Vereinigung gelänge. Griechische Priester predigen im Teyn. Eine utraquistische Gesandtschaft zieht zum Griechenkaiser zur Verhandlung. Große Hoffnungen stehen über Prag. Aber der Fall Konstantinopels (1453) vereitelt den phantastischen Versuch. Als Gegenausschlag gegen Rom –; von Prag aus! –; war er wichtig. Eingliederung in große machtpolitische Realitäten war beide Male das Sehnen.
Man hatte sich nun doch für den jungen Sohn Albrechts, den nachgeborenen Ladislaus, entschieden, hatte ihn ins Land, auf die Prager Burg geholt. Georg von Podìbrad wurde ihm als Gubernator zur Seite gestellt. Die Anwesenheit des katholischen Königs stärkte die katholische Partei. Georg hielt kraftvoll am Utraquismus, bemühte sich aber um Aussöhnung der religiösen Gegensätze, so in der Stadt und im Land, wie nach außen mit Rom. Rokyzanas leidenschaftlichem Eifer wußte er durch kluge Verhandlungen zu begegnen. Ja, er bat wieder in Rom um dessen Bestätigung als Erzbischof. Man lehnte ab, wollte einen Landfremden mit dem Erzbistum betrauen. Äneas Sylvius, nun Kardinal in Rom, riet zu einem Einheimischen. Aber nicht zu Rokyzana –; das war für Rom unmöglich. Er riet zu Johann von Rabstein, seinem gelehrten Freund, mit dem ihn die Liebe zu den humanistischen Studien verband. Der war ein treuer Katholik und doch ein Patriot, der zu dem politisch für Rom so schätzenswerten Georg hielt. Impfte man –; so argumentierte der kluge Kardinal, der gebildete Europäer –; diesem ketzerischen Volke den Humanismus ein, gar durch einen einheimischen Erzbischof, so würde es bald mit seiner Protestation zu Ende sein. Über den Humanismus käme es unweigerlich zu Rom. Die Kurie konnte sich nicht dazu entschließen. Der erzbischöfliche Stuhl blieb weiter verwaist. Die Administratoren hüteten die katholische Lehre. Und Rokyzana rief das Volk gegen sie auf. Konnte jedoch nicht hindern, daß unter Georg katholische Magister wieder an der Universität lehrten.
Auch Deutsche faßten wieder Fuß. Sogar in der Stadt. Die Ruhe im Lande begünstigte den Handel. Der plötzliche Tod des jungen Königs brachte wieder das Auf und Nieder des Parteiengetriebes um die Königswahl. Sachsen, Frankreich, die österreichischen Herzöge, Polen bewarben sich. Die Stände debattierten. Aber die Volksstimmung, von Rokyzanas feurigen Reden getrieben, wuchs eindeutig der Erhebung des Volkskönigs zu, des starken und klugen Gubernators.
Die Wahl im Altstädter Rathaus geschah unter dem Einfluß des Prager Volkes, das draußen in den Gassen wartend und drohend stand. Die Herren, auch die katholischen, fügten sich. Georg hatte Wahrung des status quo versprochen, den Utraquisten überdies Kampf um die Kompaktate. Seine Ausrufung zum König war ein Volkstriumph. In begeistertem Zuge führte man ihn hinüber zur Teynkirche, wo Rokyzana ihm die Huldigung des Volkes entgegentrug. Ein Utraquist, ein Tscheche, war König (1458)!
Wer im Volk ahnte, daß diese Königswahl den Stachel senkte in Georgs Brust. Nur Rom konnte zum legitimen Herrscher krönen. Man bat den befreundeten Ungarnkönig um Bischöfe. Die kamen, doch mit strenger Weisung aus Rom. Und sie erzwangen vom König –; o furchtbare Verlockung der legitimen Macht! –; jenen geheimen Eid, in dem er sich verpflichtete, das Volk unter die Botmäßigkeit des römischen Stuhles zurückzubringen. Georg vertraute auf die Kompaktate. Die aber waren in dem Eide nicht erwähnt. Im hohen Veitschor jubelte das Volk dem gekrönten Utraquisten zu, den die schweigenden Bischöfe salbten.
Dreizehn Königsjahre. Zuerst eine Blüte des Landes, der Stadt. Der Volkskönig wohnte drunten in der Altstadt. An den Mauern, neben dem späteren Pulverturm, stand der Königshof. Von dort aus straffte er die Zügel im Lande. Der Markt erholte sich. Das arg verkommene Münzwesen wurde gesichert, so daß zwei neue Groschen auf einen guten alten kamen. Soziale Maßnahmen aller Art künden von Georgs gesundem realpolitischem Sinn. Das »Sobìslawsche Stadtrecht« wird neu ausgebaut. Das Wuchergeschäft der Juden wird geregelt. Gelehrte Männer vom In- und Ausland verkehren am Hofe. Der König läßt sich von ihnen beraten. Zage Anfänge einer neuen Kultur setzen an. Georgs gerechter Sinn schließt weder Deutsche noch Katholiken aus. Der streng romgläubige Johann von Rabstein ist sein Oberkanzler. Von ihm stammt –; erste eigenwillige Blüte des Humanismus in Böhmen –; der lateinisch geschriebene »Dialogus«, der die politischen Zustände unter Georg in edler Haltung schildert. Zum politischen Ratgeber hatte Georg den aus Sachsen berufenen Gregor von Haimburg. Ein anderer geistvoller Berater, Marini, trägt ihm hohe, auf ein neues Europa zielende Pläne zu. Prag lebt auf. An der Universität regte sich neues Leben. Wiener Studenten zogen zu. Katholische Magister durften lesen.
Auch einige Bautätigkeit erwacht unter Georg in Prag: er läßt die Türme der Teynkirche fördern. Das Kelchsymbol wird an der Stelle, wo früher die Jungfrau Maria die Fassade schmückte, angebracht. Der Kleinseitner Brückenturm wird erneuert, auch sonst wird viel Schadhaftes ausgebessert. Die vergangenen Jahrzehnte hatten viel zerstört. Auch einige vom Adel richten ihre Häuser wieder auf. So Johannes von Rosenberg im Burgbezirk (am Hirschgrabenhang, 1458).
Rokyzanas Argwohn erwachte. Warum noch immer keine klare Stellungnahme Roms? Warum noch immer keine Bestätigung der Kompaktate? Auch Roms Argwohn erwachte. Warum keine Verwirklichung des Eides? Warum die Duldung dieses Ketzers Rokyzana noch immer? Auf der Universität kam es zu Tumulten. Hilarius von Leitmeritz und Wenzel von Køižanov, ehemalige Kalixtiner, betrieben vom Lehrstuhl aus ein eifriges Konvertitentum. Rokyzana wetterte dagegen. Protestierend verlassen die Katholischen die Universität. Hilarius beginnt als Administrator des Erzbistums seine unheilvolle Tätigkeit auch gegen den König. Sein Gesinnungsgenosse Wenzel wird später sein Nachfolger in Amt und Tätigkeit.
Rom droht nachdrücklicher. Äneas Sylvius hat den Stuhl Petri bestiegen. Er ist des Verhandelns und Hinwartens müde. Durch Aufhebung der Kompaktate (1462) will er den »meineidigen« König zu klarer Haltung zwingen. Ihm genügt nicht die Verfolgung der »Brüdergemeinden«, die draußen im Lande unter der klärenden Organisation Bruder Gregors, des jungen glühenden Neffen Rokyzanas, immer mehr Anhang gewinnen. Tut es der ketzerische König nicht nur der Stärkung des nicht minder ketzerischen Utraquismus zuliebe? Die Hetze gegen Georg beginnt. Äußere Kriege zehren an der inneren Kraft. Das katholische Schlesien revoltiert. Ein Legat von Rom, Fantinus de Valle, schleudert dem König auf offenem Hoftag die Beschuldigung des Verrats ins Gesicht. Der König rast, kerkert den Legaten ein. Die Katholischen murren. Der katholische Adel droht. Rom zitiert den König vor Gericht. Das Interdikt bricht über Böhmen herein. Die Grundfesten wanken.
Ein erschütterndes Bild, wie dieser starke Mensch unsicher wird, wie er sich immer mehr im Netz seines zweideutigen Eides verfängt. Wie er von Rom abgestoßen wird, dem religiösen Radikalismus eines Rokyzana entgegen. Wie ihn der politische Verstand doch immer wieder wegdrängt von dessen Fanatismen zu Ausgleichsversuchen mit Rom, mit der Welt. Er versucht europäische Politik. Befragt kluge Männer um Ratschläge für innere, für äußere Maßnahmen. Hat Glückserfolge. Versucht Bündnisse der europäischen Fürsten, einmal gegen die Türken, dann gegen Rom, im tiefsten Herzen vielleicht für ewigen Frieden. Sein Ratgeber Marini arbeitet am ersten Projekt eines europäischen Völkerbundes. Mit viel Begeisterung und großer Festlichkeit wird vom König und vielen Gesandten der fremden Mächte seine Verwirklichung beschlossen. Er bleibt Traum.
Traum, dem die harte Wirklichkeit kraß gegenübersteht. Gunst des Augenblicks hebt diesen König hinauf in Machtsituationen, die ihm das hohe Ziel der deutschen Königskrone nahe erreichbar erscheinen lassen. Gekrönter deutscher König –; wie hätte er als solcher, frei von den Fesseln des furchtbaren Eides, den der böhmische König geschworen, gegen Rom auftreten können! Geheime Machenschaften im eigenen Lande, Bündnisse der katholischen Großen, Kreuzzüge gegen ihn von außen stürzten ihn wieder nieder. Exkommunikation –; gegen eine zweideutige Macht noch immer eine furchtbare Geißel –; peitscht ihn in jähe Entschlüsse. Die ruhige Politik seiner Anfänge weicht einer Jagd auf den Zufall. Auf der einen Seite verfolgt er die »Böhmischen Brüder« mit grausamem Schwert (1468). Auch Rokyzana sagt sich von jenen »Ketzern«, im utraquistischen Sinn, im Sinn des utraquistischen Staates, los. Auf der andern Seite konspiriert der König gegen den Papst, sucht europäische Höfe für seine Absetzung zu gewinnen. Das Herzensziel: Vererbung der Dynastie, muß er Augenblickserfolgen opfern: der Hilfe der polnischen Fürsten, denen er dafür Erbfolge in Böhmen versprechen muß.
Ihn peitscht Rom. Ihn peitscht Rokyzana. Zwischen zwei Mächten, die beide in seiner Brust verwurzelt waren, wird er emporgestemmt in furchtbare Einsamkeit: Rom flucht ihm, Rokyzana beschwört ihn. Zwischen den beiden Mächten wird er zerrieben. Gehetzt und gebrochen, ein gefällter Eichstamm, so sinkt er aus ungelösten Wirren ins Grab. Der Veitsdom gewährt es dem Müden. Das Volkskönigtum ist erloschen. Es hatte dem Volk keine Form gebracht (1471).
Fast gleichzeitig rafft seinen Freund, sein loderndes Gewissen, den jähen Rokyzana, der Tod weg. Er hatte leidenschaftlich seiner Wahrheit gedient, doch sein Temperament hatte ihn die listenvolle Wirklichkeit nicht sehen lassen. Sein aufrichtiges Feuer ging nicht ein in den ersehnten Kirchenbau. Es wurde von denen geläutert, die er hatte verfluchen müssen: von den Böhmischen Brüdern. Das war die Lage nach dem Tode Georgs und Rokyzanas: der Utraquismus und seine Stadt Prag waren verwaist –; die Entwicklung trieb draußen weiter.
Draußen im Lande, in verborgenen Zirkeln, zündete die Lehre der »Böhmischen Brüder«. Ihre Gemeinden, die über allen Verfolgungen nur immer mächtiger aufblühten und in Bruder Lukas einen einsichtigen, der Welt offener gegenübertretenden »Gesetzgeber« gefunden hatten, nahmen viel von Rokyzanas Geist auf und trugen ihn weiter. Des Bruders Lukas »Liederbuch« drang ins Volk. In Bruder Johann Èerny, dem berühmten Arzt, dem Verfasser tschechisch geschriebener medizinischer Werke, fand das Brüdertum selbständige Gestaltung.
Draußen entschied sich die Politik. Die Herrenbünde wählten ihre Könige: der (katholische) Grünberger Bund den Ungarnkönig Matthias Corvinus, der Utraquistenbund den Polenprinzen Wladislaw. Das führerlose Prag hängt in der Schwebe der Mächte, die draußen sich bekriegen. In Alt- und Neustadt schalten die Utraquisten, auf der Burg hat Rom in dem Administrator des Erzbistums, dem zielbewußten Johann von Kolowrat, der die Exkommunikation über den Volkskönig ausgesprochen hatte, einen starken Kämpen. Als endlich im Jahre 1478 ein König wieder einzieht in Prag –; die Burg ist in argem Zustand, er wohnt im Königshof der Altstadt –;, da ist er doch nur ein Schatten: der gutherzig edle, aber schwache Wladislaw aus Polen ist nicht der Mann, der das innerlich zerrüttete Prag wieder hinaufzuheben vermöchte in ein einiges stolzes Schicksal.
Parteigezänke wird, was Religionskampf war. Die geistige Nahrung der streng utraquistischen Bewegung wird immer armseliger. Man hält an der »legitimen« Priesterweihe fest. So ist man auf einen priesterlichen Nachwuchs angewiesen, der in katholischen Ländern unter Abenteuern und auch Meineid die Weihe sich hatte erschleichen müssen. Recht fragliche Elemente bestiegen nach und nach die Kanzeln. Die Lehre verarmte. Ganz anders draußen bei den »Brüdern«. Die hatten sich zu eigener Weihe entschieden, zogen durch feurige Predigt und evangelisches Leben das Landvolk, das vom Adel immer unmenschlicher bedrückt wurde, zu Trost und geistiger Rettung in ihre Reihen. Die besten Kräfte, die dem Utraquismus noch geblieben waren, flossen nun ab in die Brüdergemeinden.
Die Bischöfe, die den Utraquisten zu Hilfe kamen, beleuchteten grell die tragische Situation: nur Abtrünnige, von Rom Geächtete, die mit Hilfe der »Ketzer« wieder zu Macht und Ansehen kommen wollten, boten in Prag ihre Hilfe an.
Die Romgläubigkeit Wladislaws, des Königs, sicherte trotz aller Gerechtigkeit von oben dem Katholizismus stärkeren Einfluß. Es kam zu häßlichen Reibereien. Als am Fronleichnamstag des Jahres 1480 die Prozession der Utraquisten, die von der Teynkirche kamen, und die der Katholiken, die mit dem König vom Veitsdom herabschritten, einander begegneten, kam es zu Schlägereien unter den Teilnehmern. Wladislaw hatte den Altstädter Magistrat neu eingesetzt. Der Bürgermeister Wenzel Chanický, Besitzer des Hauses »Zum Hahn« hinter dem Rathaus, soll auf Ausrottung des Utraquismus konspiriert haben. Die Magistrate der Städte und einige vom katholischen Adel sollen sich mit ihm verbunden haben, die gesamte utraquistische Partei in der Nacht vom 25. zum 26. September 1483 auszurotten. Eine Bartholomäusnacht! Der König war damals gerade von Prag abwesend. Der Anschlag wurde verraten –; oder war es nur Verleumdung: das aufgehetzte Volk stürmte das Rathaus, warf den Bürgermeister zum Fenster hinaus, enthauptete ihn und andere Ratsherren am nächsten Tag auf dem Altstädter Ring.
Noch einmal flackerte die Bewegung auf, aber es waren nur Fieber des Erlöschens. Wieder wurden die Klöster geplündert, zerstört –; auch der vor kurzem erst wiedererstandene Karlshof –;, Mönche verjagt, Deutsche erschlagen, zum Schluß die Judenstadt überfallen. Die Bewegung erstickte in sich selbst. Überdies mahnten die Gemäßigten unter den Utraquisten selbst zur Ruhe. Das war nicht mehr das kämpfende Volk, war nur raublustiger Pöbel. So zog Rom die ordnungsliebenden Elemente nur fester an sich. Die Aussöhnung mit dem über den Aufruhr erschütterten König ein Jahr später brachte denn auch das gesamte Domkapitel bei St. Veit nach Prag zurück. Der Kuttenberger Religionsfriede sicherte beiden Parteien die Duldung.
Die Welt horchte auf. So sollte also Böhmen die erste Insel in den Wogen der religiösen Kämpfe sein, auf der die beiden kämpfenden Konfessionen friedlich beisammen leben konnten. Was auch die Zukunft noch bringen sollte –; dieser Friedensschluß war von weltgeschichtlicher Bedeutung (1484).
Ein mattes Auf und Nieder bezeichnet die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Das wirtschaftliche Leben in Prag scheint die Kräftigung, die Georgs Regierung ihm gebracht hatte, sich erhalten zu haben. Im Jahre 1475 gehen die Bürger an die Errichtung eines neuen Torturms neben dem Königshof: später Pulverturm genannt. Der König Wladislaw selbst legt den Grundstein. Im Künstlerischen zehrt dieser Turm, den ein Meister Wenzel beginnt, dann der Baumeister an der Kuttenberger Barbarakirche, Matthias Raysek von Proßnitz, hochführt, von alten Gedanken: Parlers Brückenturm ist Vorbild. Doch was dort kraftschwellendes, von der Architektur gebundenes Schmuckwerk war, ist hier zum könnerischen Zierat geworden. Andere Bauten dieser Jahre beschränken sich auf klaren Zweckdienst: der Turm neben der Heinrichskirche, später die Türme, die bei den Altstädter Mühlen für die damals in Angriff genommene Wasserleitung benötigt waren. Gewiß: das Projekt dieser Wasserleitung –; ihre Vollendung zog sich bis in die Mitte des nächsten Jahrhunderts –; spricht für die wirtschaftliche Regsamkeit der Stadt, für städtebauliche Initiative. Die Ideen im geistigen Leben aber verarmten. Auch die Tatsache, daß um 1489 der erste Prager Druck erscheint: eine Bibelübersetzung, widerspricht dem nicht. Die kulturellen Zirkel waren dünn gesät. Nur Rom drang langsam, aber stetig vor. Fast hätte der König im Jahre 1499 die Wahl seines Bruders zum Erzbischof durchgesetzt. Sie scheitert an der Weigerung Roms, die utraquistischen Priester durch den Erzbischof weihen zu lassen. Nichts Geistiges zündet. Während im Land auf Schlössern und in deutschen Städten, in Reichenberg, in Joachimsthal, in Eger der Humanismus erste Blüten zeitigt, zerreibt sich Prag in Parteigezänke und Intrige. Die Universität siecht dahin. Mittellos und ohne wahren geistigen Zeitimpuls verschließt sie sich armselig vor dem neuen südher erwachenden Ideal, fürchtet in ihm das Gift, das der kluge Äneas Sylvius vor einem halben Jahrhundert schon einimpfen wollte in das Hussitenland.
So bietet die Stadt, in der unter Karl IV. früheste Renaissance erwacht war, in der dann durch ein Jahrhundert hindurch um die dringlichsten religiösen Ziele des Zeitalters gekämpft worden war, um 1500 das Bild einer geistig ermüdeten Stätte. Die Religionen scheiden die Städte: auf Burg und Kleinseite wohnen die Katholischen, in Altstadt und Neustadt sitzen zumeist Utraquisten. Die halten an ihren Gebräuchen fest, gehen in ihren mit Fuchsfell gefütterten Hussitentalaren, den hohen Mützen aus Fuchsfell zur Kirche, tragen das Haar sorgsam in lange dünne Zöpfe geteilt, halten auf ihre Unterscheidung von den Römischen. Vom Land kommen die Bauern herein, sitzen, sobald sie ihr Marktgeschäft besorgt, in den Schenken und tun sich gütlich am »Altbier«, das in Prag gebraut wird, stopfen sich mit reichlich viel Essen voll und machen ihre derben Späße. An Kurzweil gibt's noch genug. Besonders die aufdringlichen Gunstbezeigungen an die Frauen fallen dem Johann von Butzbach auf, der damals nach Prag kommt. Er rühmt die Schönheit der Stadt, berichtet aber doch mehr von der damals schon sagenhaften früheren als von einer bestehenden. In nationaler Enge schienen die großen geistigen Möglichkeiten des Hussitismus erstickt. Bohuslaw Lobkowitz von Hassenstein, der größte Humanist Böhmens, zeichnet die damaligen Prager, »die Fresser und Trinker«, schonungslos. »Gegen Fremde sind sie freundschaftlich, nur gegen diejenigen haben sie eine Abneigung, die deutsch sprechen, denn sie halten die Deutschen für die größten Feinde ihrer Religion. Die Weiber sind schön von Gesicht, mit einer sittsamen Miene, meistens etwas stärker beleibt.« Ja, man aß viel in dieser Stadt und man haßte zu viel, nicht eben Regungen, die eine Kultur begünstigen. Nein, diese Stadt war abgeschnürt vom großen Atem der Zeit, dem machtlüsternen Adel von draußen preisgegeben, jetzt auch der geistigen Waffen beraubt.
Dieser Adel frißt sich immer nachhaltiger in die Stadtherrschaft ein. Allüberall im Osten unterwühlt er die Stellung der Deutschen (z. B. in Krakau). In Prag schaltet er fast unbeschränkt. Schon früher hatte er die erbliche Leibeigenschaft des Landvolkes durchgesetzt. Nun drängt er auch das Bürgertum aus den Landtagsbeschlüssen fast völlig hinaus, erzwingt sich neben den politischen auch gewerbliche Vorrechte, die von je den Städtern allein zugestanden hatten. Besonders um die Braugerechtigkeit wird Jahrzehnte hindurch gekämpft. Und um das Gericht. Der Adel siegt in beidem: erringt so die Braugerechtigkeit, zieht Streitfälle, die seit alters dem Stadtgericht zustanden, vors Adelsgericht. Er weiß sich zwischen König und Stadt zu drängen –; beherrscht beide.
Das Schicksal der Juden ist bezeichnend für die Lage. Sie werden zwischen den kämpfenden Mächten hin und her gerissen. Der König beruft sich auf das alte Judenregal. Das war aber in der königlosen Zeit auf die Altstadt übergegangen. Der Adel seinerseits will jedoch über seine Juden frei verfügen. Man will sich die nahrhafte Beute –; trotz aller Plünderungen waren die Prager Juden immer bald wieder dank ihres Wuchervorrechts und ihrer Geschäftigkeit recht zahlungskräftig –;, man will sich diese Beute gegenseitig entreißen. So haben die Juden drei Herren –; sie zahlen nach drei Seiten hin, um der öfters drohenden Ausweisung zu begegnen.
Die Wladislawische Landesordnung, dem König vom Adel diktiert, voll nationalistischer Vorbehalte gegen die Deutschen in rechtlicher und sprachlicher Beziehung –; tschechische Amtssprache! –;, besiegelt dem Adel die Vormacht im Land als stolze Beute aus diesem schrecklichen Jahrhundert. Der Königshof und die Stadt, sie sind nur Schatten der über ihnen lastenden Adelsgewalt.
Und doch sollte eben unter diesem Wladislaw der Hradschin in neuer architektonischer Pracht erstehen. Schon in den Siebzigerjahren war dort oben manches wieder aufgerichtet, anderes neu erbaut worden. Zuerst hatten einige vom Adel sich dort oben –; nahe der Landtafelräume! –; neue Häuser errichtet. Ein Rosenbergsches, ein Sternbergsches Haus erstanden am Hang des Hirschgrabens, unmittelbar nördlich des Veitsdoms. Auch die Geistlichkeit baute ihre unterm Hussitensturm in Schutt gesunkenen Häuser wieder auf. In den Achtzigerjahren war dann auch die Stadtseite des Burgbezirkes (Südseite) wieder neu besetzt worden. Da bauten der von Weitmühl, der von Schwamberg. Auch Bürgerliche bauten sich dort oben an, so Hans Beham aus Nürnberg, unter Wladislaw königlicher Agent, später königlicher Baubeauftragter bei Errichtung des neuen Saalbaus, der nun die Burgbauten krönen sollte.
Der König war bei den Massen nicht beliebt. Einmal hatten diese ihn, »den hergelaufenen Polaken«, gar in seinem Stadthof bedroht. Übersiedlung auf die feste Burg schien geraten. Auch gebot das königliche Ansehen den Wiederaufbau der verfallenen Königsstätte. Wladislaw schritt ans Werk.
Er hatte sich einen Meister von auswärts verschrieben. In Benedikt Rieth aus Piesting in Niederösterreich (später auch Benedikt von Laun geheißen, nach seinem dortigen Kirchenbau) hatte er den Architekten gefunden, der für die neuesten Bauideen der Zeit genialen Ausdruck brachte. Was schon dem großen Peter Parler als Ziel vorgeschwebt, was dann in Österreich und Süddeutschland weiter gediehen war und eben jetzt in Kirchenbauten des wirtschaftlich und kulturell so regen Erzgebirges aufgenommen und zur künstlerischen Vollendung geführt wurde: das einheitliche, Chor und Schiffe ineinander verflechtende Raumbild –; das wandte Benedikt Rieth (seine Beziehungen zu den obersächsischen Hütten, auch seine Einwirkungen dorthin sind erwiesen) nun auf den monumentalen Profanbau an. Und dies in der kühnsten Form: ohne Zwischenstützen sollten die Gewölbe auf den Außenmauern auflagern, über einem Saalraum, der mit seinen 62 Metern Länge und 16 Metern Breite der gewaltigste nicht nur in Böhmen, der Zeit überhaupt war. Die Gotik liebte die großen gewölbten Säle auch im Profanbau. In Klöstern, auf Ritterburgen (Avignon, Marienburg) hatte sie Säle von immer wachsenden Ausmaßen über immer dünner werdenden Stützen eingewölbt, getreuer Spiegel der kirchlichen Baugedanken. Jetzt war der Traum der Zeit erfüllt: der einheitliche Saalraum unter freischwingendem Gewölbe. Über dem Arkadengeschoß Ottokars ging er auf, verwandte die noch tragfähigen Teile der Hochmauern von Karls IV. Saalbau. Aber dessen (wohl flachgedeckter) Saalraum wurde in den Ausmaßen bis an die Grenzen des Möglichen gesteigert. Die gesamte Längserstreckung des Trakts, ehdem unterteilt, wurde zum Saal gebildet. In eine Höhe von 15 Meter wurden die Scheitel der Gewölbe hinaufgetrieben, dieser zuckenden Gewölbe, deren Rippen nur noch Nerven waren, nicht mehr tragendes Gerüst, die in kühn geführten Kurven zusammenschlugen zum kunstreich gezeichneten Netz, den im eigenen Verband gesicherten Gewölbekappen nur noch frei unterlegt. Schwere Wände stehen unter diesem Flammenspiel. Es ist, als ob schon der erdfestere Geist einer kommenden Zeit darinnen sich ankündigte, der den Menschen zurückrufen sollte zu eigenem Maß, aus den herrlichen Unermeßlichkeiten der letzten Gotik. Zur Zeit der Renaissance blieb der Norden in seinen Saalbauten ja denn auch lange –; noch Heidelberg –; in recht dumpfen Proportionen befangen. Erst zur Zeit Rudolfs II. begannen die Proportionen wieder zu klingen, allerdings in recht anderm Sinn als jene der letzten Gotik (Spanischer Saal). Die großen Fenster, die in Rechteckform in diese Wände eingelassen sind, dürfen aber doch wohl erst der Zeit einige Jahrzehnte später oder gar erst jener nach dem verheerenden Brand des Jahres 1541 zugeschrieben werden, trotz jener Inschrift über einem der Fenster, die ihre Entstehung in die Jahre der Aufführung des Saalbaus verlegt und die angesichts der sehr frühen Einbrüche italienischen Formguts in den Osten –; Ungarn, Slowakei, Wladislaw war auch König von Ungarn –; nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen ist. Diese reinen Formen italienischer Frührenaissance in Pfosten, Laibung, Kapitellen und Gebälk sind so ganz andern Geistes als jene Raumfeier des Deutschen.
Im Jahre 1487 war mit dem Aufbau begonnen worden. Die Fertigstellung mag sich über die Jahrhundertwende hinausgezogen haben. Für andere stolzere Feste, als das Prag dieser Tage sie zu bieten hatte, war dieser Saal das prächtige Gehäuse. Huldigungen und Krönungsmahle, sogar Turniere konnten später in diesem Raum abgehalten werden.
So stand nun in Prag dieser hohe Ausklang der Gotik unvermittelt über jenen Arkaden Ottokars, in denen der erste Hauch gotischen Lebens in Böhmen Gestalt geworden war. Benedikt von Rieth hatte den Pragern die letzten berauschenden Klänge einer Kunstzeit gebracht, die hier unter Schrecken der Bürgerkriege überhört worden waren.
Dieses Königs Seele scheint hohe Träume geborgen zu haben. Ins Politische konnte er sie nicht umsetzen. So wollte er sie in Bauten verwirklichen. Auch auf Burg Pürglitz im nahen Berauntale hatte er durch seinen Meister Rittersaal und Kapelle in diesen edlen Proportionen erneuern lassen. Er dachte an den Ausbau des Veitsdoms. Sein Baumeister begann schon mit der Fundierung des Nordturmes, der dem trutzigen Südturm der Parier entsprechen sollte, arbeitete auch schon an den Pfeilerfundamenten für das auszubauende Langhaus weiter. Er konnte es nicht über diese Anfänge hinaus fördern. Die Zeitläufte waren zu unsicher. Aber sonst hatte der Dom der Freigebigkeit dieses zwiefachen Königs –; auch Ungarn war an ihn gefallen, dort lebte er zumeist –; so manche Bereicherung zu danken. Im Südumgang des Chors hatte er sich von Benedikt von Rieth ein Oratorium bauen lassen, zu dem er vom Palast aus über eine Galerie direkt gelangen konnte. Dieser Emporeneinbau bringt die letzte Steigerung der im Saalbau angeschlagenen Formgedanken, fast schon ihre Übersteigerung. Alles Kernig-Struktive, das den Chorleib Parlers von draußen so scharf umrüstet, wuchert hier aus ins Vegetative, Blühende, pflanzenhaft Treibende. Rippenwerk wird zum naturalistischen Geäste, barocke Kurvatur schlägt schön hinüber in jene rauschende Formlust, die Prag zweihundert Jahre später begnaden sollte.
Auf das übrige Bautum des damaligen Prag konnte der große Impuls, der dort oben auf der Burg das Neueste und Letzte hervorbrachte, was der nordische Kunstkreis damals im Architektonischen zu sagen hatte, kaum einwirken. Vielleicht fällt in diese Zeit eine Neueinwölbung der Karlshofkirche. Neue kirchliche Bauten erstanden nicht und auch der Profanbau stieg nirgends ins Monumentale. Nur von einem einzigen unter den vielen Prager Kirchenbauten wissen wir bestimmt, daß er die hohe Welle der letzten Gotik aufgenommen hat, welche damals die deutschen Städte in Nord und West, in Süd und auch in Ost (Slowakei) so bestimmend umgestaltete. Es war gerade die kleine Kirche, in der jene Bewegung ihren ersten Stützpunkt errichtet hatte, unter deren krisenvoller Entfaltung alle bauliche Entwicklung verkümmern mußte: die Bethlehemskapelle. Die nahm jetzt deren letzte Stufe auf. Und sie war ja dazu vorbestimmt. Dieser Predigtraum hatte ja schon ein Jahrhundert vorher den Chorbau vermieden (s. o.). Inzwischen war auch die allgemeine Entwicklung zu grundsätzlicher Absage an den (ausgeschiedenen) Chorbau herangereift. Als man nun an die Einwölbung des Raumes herantrat, war die jetzt gewünschte Form schon gegeben: der Einraum. Hier mußte die neue Gesinnung widerstandslos sich einprägen lassen. Über Mittelstützen –; auch die überlieferte Dreischiffteilung wurde aufgegeben, wie damals an manchen Orten radikaler Neugesinnung –; wurde das verschlungene Netzgewölbe errichtet, an den Seiten noch einmal von Stützenreihen getragen. Im Außenbau wurden gegen den Gewölbeschub Strebepfeiler angebaut. Man ist versucht, den Vorgang gleichnishaft auszudeuten: auch die große Protestationsbewegung, die bald darauf vom Westen herüberwellte in dieses Land, in diese Stadt, konnte eingehen in vorgefundene Stimmungen, die ein Jahrhundert zuvor hier aufgebrochen waren. –; Im Jahre 1783 erst wurde diese Kapelle, einzige Künderin der reifen Spätgotik unter den Kirchen Prags, abgebrochen. Die Kapelle des Hus verschwand aus Prag gerade zu der Zeit, da das Toleranzedikt Josefs II. die letzten Schatten jener durch Hus geweckten Kämpfe zu tilgen unternahm.
Während in Prag die Parteien haderten, während draußen der Adel eine unbezwingbare Machtstellung gegen Volk und Stadt und König ausbaute und während unter solchem Druck die Innigkeit der Brüdergemeinden zu ansehnlicher kirchlicher Gemeinschaft gedieh, schoben sich –; zunächst fast unbemerkt –; zwei geistige Mächte in die böhmische Kultur ein, die allmählich auch Prag selbst zu schärferer Herausarbeitung der treibenden Ideen bestimmen sollten.
Das war einmal: der Humanismus. Von Italien her hatte er die nördlichen Lande erobert. Auch an Böhmens Grenzen erwuchsen überall lebhafte geistige Zirkel. Die Rosenberge hatten in ihren Städten, vor allem in Krumau, seit Jahrzehnten Hochsitze humanistischer Weltoffenheit und renaissancefreudiger Sammeltätigkeit begründet. Ihr traditioneller Katholizismus hing eng mit dieser Kulturfreudigkeit zusammen. In Eger trieb der deutsche Humanismus eine schöne Blüte: es wurde gedichtet, geschrieben, gedruckt, musiziert und philosophiert. Im Erzgebirge schossen in den kleinsten Gebirgsnestern humanistische Bestrebungen auf. Im jungen, sehr schnell aufstrebenden Joachimsthal wirkten bedeutende Geister.
Prag selbst verschloß sich dem fremden Strom. Was Georg von Podìbrads Sohn Ignaz, der Herzog von Münsterberg, literarisch von sich gab, war Ausdruck eines wollüstigen Lebens. In Johann von Rabsteins »Dialogus« konnten wir die erste Wurzel eines echten Humanismus auf Prager Boden begrüßen, noch streng national, aber doch schon aufgeschlossen der großen neuen Welle echten Menschentums. Um 1499 hatte dann Viktorin Kornel von Všehrd seine »Neun Bücher über die Rechte, Gerichte und die Landtafel Böhmens« geschrieben, in denen er in tschechischer Sprache die altüberkommenen Rechtsgewohnheiten der Tschechen preist und gegen das eindringende römische Recht verteidigt. Humanistisch in diesem Beginnen war sein gelehrtes Zurückgehen auf das eigene Volkstum, eine Besinnung, in der er die überkommenen Reformationsideen der Jahrhunderte den neuen Renaissanceideen einbindet. Jedoch sein Beispiel blieb vereinzelt im böhmischen Humanismus. Der bedeutet doch einen Bruch mit der Vergangenheit. Und die feindliche Stellung, welche die Prager Universität ihm gegenüber einnahm, verschärfte nur diesen Bruch. Ein Bohuslaw von Lobkowitz, als Utraquist geboren, doch von einer Pilgerfahrt nach Rom als glühender Katholik zurückgekehrt, meidet sein ganzes Leben lang das abtrünnige, das kulturfeindliche Prag. Er sammelt auf seinen Schlössern kostbare Bücher, wertvolle Kunstschätze, bekennt sich als Germane. Sein echter böhmischer Patriotismus, wie er in seinen Briefen an den Eichstädter Domherrn Bernhard Adelmann, den bekannten Humanisten und späteren Lutheraner, zum Ausdruck kommt (1507), sucht andere Wege als die der utraquistischen Landsleute, ja er geißelt in seinen in formvollendetem Latein geschriebenen Satiren die Sitten der Tschechen, das Leben der Prager. So wirkte er aus Ablehnung auf die Prager Atmosphäre ein.
Aber auch positiv begann nun schon Geistigkeit im Sinne des Humanismus einzuwirken. Humanistische Schriften wurden übersetzt. So im Auftrag der Boskowitze durch Huska von Ungarisch-Brod im Jahre 1487 die »Geschichte Böhmens« des Äneas Sylvius. In Prag selbst sorgte Gregor Hrubý von Jelení durch Übersetzungen nach Petrarca und Erasmus von Rotterdam für modernsten Bildungsstoff. Der von ihm geförderte Wenzel Písecký übersetzte aus dem Griechischen. Aber schon an Hrubýs Sohn, dem Zögling Píseckýs, Zikmund, zeigte sich wieder die alte Gegnerschaft der Universität gegen alles Humanistische: sie wies ihn zurück, so daß er außer Landes zog und in Basel bei Frobenius fruchtbar wirkte, dem eigenen Land also verlorenging.
Und doch: die Saat ging auf. Um die Jahrhundertmitte finden wir in Prag sehr lebendige Zirkel humanistischer Geistigkeit, wie den des Prager Richters Johann Hodìjowský von Hodìjow, bei dem die Anhänger der neuen Richtung aus beiden Nationen sich trafen und in Dichtung und Wissenschaft sich ergingen. Doch wenn man den witzigen Geist vernimmt, mit dem solche Sodalitates literariae auf die vernacula lingua niederblicken, das Tschechische, in dem die utraquistischen Pedanten der Hochschule tradierten, glaubt man wirklich jenes Gift schon aufgegangen, das der große Anreger Äneas Sylvius fast ein Jahrhundert früher hier einimpfen wollte. Begeisterte Jugend scharte sich um diesen Kreis.
Vor allem der Magister Matthäus Collinus von Chotìøin (Matouš Kolínský) hatte größten Zulauf. Er war in Wittenberg zum Magister promoviert worden. Dann hatte er das Lektorat für Homervorlesungen an der Universität innegehabt, das ein begeisterter Humanist, der Bürger Doktor Johann Franz von Königsberg, im Jahre 1537 mit tausend Schock böhmischer Groschen gestiftet hatte, um so den Einzug der klassischen Studien an der geist- und geldarmen Hochschule zu erzwingen. Aber Collinus hatte mit beißenden Epigrammen einen heißen Kampf gegen die bornierten Magister geführt und diese hatten ihn suspendiert. Nun las er in dem Haus nahe der Heinrichskirche, das sein Gönner Hodìjowský ihm geschenkt hatte, einem Haus, das noch karolinische Renaissancetradition hielt: es war der »angelische Hof«, den Karl IV. seinem Florentiner Hofapotheker Angelo zur Anlage des ersten botanischen Gartens überwiesen hatte. Hier trafen sich die humanistischen Freunde. Hier gingen auswärtige Gäste ein und aus. Begierig nahm man die Form auf, die Italien begründet hatte. Zu gierig vielleicht, denn man war ausgehungert.
So empfing man einmal begeistert einen Griechen, der sich von Italien aus in schwungvollen Briefen angemeldet hatte: einen gewissen Jakob Olympidor Palaeolog, der sich als letzten Abkömmling aus der Familie des unglücklichen byzantinischen Kaisers Constantin Palaeolog bezeichnet hatte. Ein Hellene in Prag! Wieder lockte der Osten, aber diesmal im westlichen Gewand! Die Hellenophilen waren begeistert. Und die bestechende Persönlichkeit des Griechen war dazu angetan, die Begeisterung immer von neuem anzufachen. Dieser Grieche kam in Prag durch Heirat zu Geld und bürgerlichem Ansehen. Er hatte durchblicken lassen, daß er von der Inquisition verfolgt werde wegen reformatorischer Umtriebe in Polen, Deutschland und Frankreich. Denn weit war er herumgekommen auf seinen abenteuerlichen Irrfahrten. Die Freunde fürchteten für ihn. Er aber wohnte unbesorgt im schönen Haus unmittelbar neben der Dominikanerkirche. Die Gunst von oben –; die königlichen Beamten traten für ihn ein –; sicherte ihn noch vor aller Verfolgung. Er wirkte kräftig im humanistischen Sinn. Er setzte gegen den Willen der Universität die Aufstellung eines Gedenksteins für seinen inzwischen verstorbenen Gönner Collinus durch: im Lektorium des Carolinums. Das Schicksal schien ihm günstig. Sein hochfliegender Geist riß diese Generation, die schon den Schatten der Gegenreformation über sich spürte, in aufrichtige Begeisterung für die Antike. Bis er in unbegreiflichem Übermut einen entflohenen Dominikanermönch bei sich beherbergte und dadurch in schwersten Verdacht kam. Flucht, Verhaftung, Abtransport nach Rom. Verurteilung und Feuertod waren das grausige Ende (1485). Die Episode ist bezeichnend für das Schicksal des Humanismus auf Prager Boden.
Mit dem ersten Aufblühen des Humanismus hatte sich in der Prager Judenschaft eine stärkere Regsamkeit gelöst. Sie äußert sich in den Drucken Gersons ben Salomo Kohen und seiner Genossen, später seiner Söhne. Hebräische Drucke hatte in Spanien und in Italien schon das 15. Jahrhundert hervorgebracht. Im Norden war diese Prager Druckerei die erste. Die geistige Herrschaft der Prager Judengemeinde über die Judenschaft ganz Böhmens und darüber hinaus ist hier greifbar dokumentiert.
Wir müssen uns wieder zurückwenden, um das Eindringen jener zweiten Geistesmacht zu verfolgen, die auf das Prag des 16. Jahrhunderts eingewirkt hat. Im Jahre 1517 hatte Luther seine Thesen an der Wittenberger Schloßkirche angeschlagen. Das zündete in Böhmen. Mußte zünden. In diesen Thesen waren Forderungen eindeutig formuliert, die in allen Hussitenforderungen getrieben hatten. Vor allem: hier revoltierte ein echter Religiosus, ein bis zum Grunde Erschütterter, dessen Erlebnis abgrundtief war und mächtig, religiösen Rohstoff ins furchtbare Paradox zu treiben, so das Geklüft des Worts zu gestalthaftem Mysterium zu verdichten.
Die Utraquisten horchten auf: es schieden sich die Geister. Die in der Formel Erstarrten erkannten die Gefahr. Die Brennenden vernahmen Lösung, die sie selbst durch ein Jahrhundert hindurch gesucht hatten: der Mensch allein vor Gott, ohne Mittler, ohne Werk, allein aus der Gnade die Erlösung. Hussens katholische Reformideen wuchsen plötzlich auf in die radikale Predigt Luthers. Der protestierende Osten erkannte noch einmal das gemeinsame Schicksal: Prager Scholaren zogen nach Wittenberg, saßen zu Füßen des Augustinermönchs und formten zu Wirklichkeiten der Seele, was in der Heimat seit langem um den entscheidenden Durchbruch rang.
Die Einwirkung des Luthertums auf Böhmen, auf Prag, gehört zu den interessantesten Erscheinungen des böhmischen Geisteslebens. Es stand entgegen der eingefleischte Utraquismus. Es stand entgegen –; stete Lockung für die Unentschiedenen und Formhungrigen: das mächtige Rom! Es stand entgegen das nationale Vorurteil, das eher von Italien, von Hellas die Formung entgegennehmen wollte als von dem bedrohlich starken Nachbar. Und war es denn Form! War es nicht viel eher neues Chaos, neue Verlockung zu wildem Aufruhr, wie sie ein kampfvolles Jahrhundert am Ende hatte ermüden lassen!
Trotz allem: in kleinen Rinnsalen zunächst, dann immer stärker werdend dringt Luthers Lehre herüber. In Prag hatte sie zuerst gezündet. Dann hatten nordböhmischer Adel, auch die Schlicke im Egerländer Gebiet, lutherische Prediger in ihren Schlössern aufgenommen. Jetzt kamen schon Hörer aus Wittenberg zurück nach Prag. Im Jahre 1519 predigt gar ein Einsiedler Matthias ganz öffentlich die Lehre Luthers auf Prager Boden. Auf die Kunde von Luthers Thesen hin hatte er seine Klause auf dem Berge Baubin verlassen. In der Thomaskirche auf der Kleinseite predigte der deutsche Augustinermönch Bruder Michel in deutscher Sprache. Die Deutschen drängten sich vor seiner Kanzel. Von den Ordensbrüdern wird er verstoßen. Er predigt in der Altstadt (Hl. Kreuz), wieder unter großem Zustrom. Bis er als Ketzer eingekerkert, dann aus der Stadt verwiesen wird. Sogar der neue Administrator des utraquistischen Konsistoriums, Magister Wenzel von Leitomischl –; er war Dechant bei St. Apollinar gewesen –;, wird von seinen Gegnern des Luthertums bezichtigt.
Im Jahre 1522 schreibt Luther persönlich an die utraquistischen Stände. Er spricht das entscheidende Wort: rät dringend die Abschüttlung des römischen Jochs, die eigene Priesterweihe. Nur durch eigene Weihe würden sie zu Selbständigkeit erstarken. Er rät zu dem, was die »Brüder« schon längst in Tat umgesetzt, wofür sie so arg gelitten hatten. Schriften der »Brüder« waren Luther wohlbekannt. Damals tauchte der Schwärmer Thomas Münzer in Prag auf, wird besonders von den Brüdern freundlich aufgenommen. In der Bethlehemskapelle und in der Fronleichnamskapelle predigt er deutsch und lateinisch. Und damals kam Gallus Cahera, der in Wittenberg Luthers Freund geworden war, nach Prag zurück. Er predigt Luthers Lehre im Teyn, wird Administrator des utraquistischen Konsistoriums. Luthers Schriften werden ins Tschechische übersetzt, werden viel gelesen. (Die Augsburger Konfession erschien um 1546 in tschechischer Sprache, wurde binnen hundert Jahren fünfzehnmal herausgegeben.) Schon auf dem Landtag von 1524 waren die von Luther entscheidend berührten »Neu-Utraquisten« in der Mehrzahl gewesen.
???$$$
Und Prag hatte entschlossen alle Priester der alten Ordnung vertrieben. Prag und damit das utraquistische Böhmen scheint wieder eingegangen in die große Ostbewegung, aus der religiös-nationale Motive sie vor einem Jahrhundert losgerissen hatten. Und war nicht Luther –; im Sprachlichen zumindest –; der vollendende Präger jener Bewegung, die unter Johann von Neumarkt in Prag so zukunftsvoll begonnen hatte! Deutscher Einfluß drang nun gerade auf jenem Gebiete wieder vor, auf dem er vordem so vernichtend geschlagen worden war: auf dem Gebiet des religiösen Protestes. Die deutschen Elemente, die sich mittlerweile in Prag zahlreich wieder niedergelassen hatten, spürten die Stärkung durch die neue Lage. Sie waren zu Vorkämpfern geworden, wo sie ehedem als »Reaktionäre« verhaßt waren.
Spaltung zwischen Alt-Utraquisten und Neu-Utraquisten war unvermeidlich. Machtfragen spielten wieder in die geistigen herein. Nie und nirgends, am wenigsten in Prag, kann geistiger Ablauf rein sich vollenden! Die Machtfragen wurden von den Magistratsparteien hereingetragen in die religiöse Spaltung. Die kämpften um Stärkung der Stadtgewalt.
Nach Wladislaws Tod (1516) war dessen unmündiger Sohn Ludwig zum König ausgerufen worden. Erst viel später (1522) war er nach Prag gekommen. Der Adel, die Bürger, die Juden holten ihn feierlich ein. Die Juden brachten ihm unter Gesängen die Thora entgegen: er möchte sie berühren. Sie erbaten dies Zeichen der Huld als Symbol für die Bestätigung der vom Vater verliehenen Privilegien. Der junge Pole soll die dargebrachte Thora nur mit der Reitpeitsche berührt, die also Beschimpften sollen hundert Dukaten für jene Peitsche geboten haben. Was nützte alle Demütigung! Sie blieben doch vom Altstädter Magistrat abhängig. Der konnte unter dem bedeutungslosen König seine Sache stärken.
Zwei ehrgeizige Männer standen in der Stadtherrschaft einander gegenüber: Johann Hlawsa von Mies, ein studierter vermögender Ratsherr, später in den Wladykenstand erhoben mit dem Beinamen von Liboslaw, Hofrichter der königlichen Städte, und Johann Pašek von Alt-Knin, später als Wladyk von Wrat genannt, Magister der Universität und Ratsherr, auch er sehr vermögend. Hinter ihnen spaltete sich die Bürgerschaft in Parteien. Hlawsas Anhang neigte zum Luthertum, Pašeks, des ehemaligen Magisters Richtung vertrat den verknöcherten Alt-Utraquismus.
Pašek verfolgt eine resolute Stadtpolitik. Auf sein Betreiben hin hatten sich 1518 Altstadt und Neustadt zu einer einzigen Gemeinde unter einem Magistrat, den Pašek diktatorisch beherrschte, vereinigt. Die verbundenen Städte waren eine Macht, mit der man zu rechnen hatte. Der junge König scheint Pašeks Gegenspieler begünstigt zu haben. Oder war es die neu-utraquistische Welle, die Hlawsa hob? Pašek mußte ihm im Ratskollegium weichen. Geheime Umtriebe, Intrigen. Im Jahre 1524 stürzte Pašek dann den Hlawsa. Ein Volksaufstand vertrieb die Neu-Utraquisten aus Magistrat und Stadt. Pašeks Reaktion triumphierte. Er hatte sogar den Cahera, Luthers Freund, mitgerissen, zum Abfall von der Sache der Lutherfreundlichen bewogen. Cahera verriet seinen Meister, wurde fanatischer Gegner des Luthertums. Im November dieses Jahres vermahnte ihn Luther in einem eigenen Schreiben aus Wittenberg. Umsonst.
Die Alt-Utraquisten herrschen in Prag. 1525 suchen sie wieder um Bestätigung der Kompaktate nach. Das alte Spiel scheint wieder aufzuleben. Bartoš Pisaø, ein Prager Leinwandhändler, hat in der »Prager Chronik« die stürmischen Ereignisse der Jahre 1524-1530 plastisch in einem kernigen Tschechisch beschrieben. Aber noch im gleichen Jahre 1525 dringt der Neu-Utraquismus wieder vor. Die Vertriebenen kehren zum Teil nach Prag zurück. Sie gewinnen wieder starken Anhang. Doch Pašek bleibt Herrscher über die Prager Städte. Oben auf der Burg hat der Katholizismus seine Stütze. Drei religiöse Mächte streiten um Vorrang und Macht.
Das ist die Situation, die Ferdinand antrifft, der Herzog von Österreich, der nach dem Tod des jungen Polenkönigs Ludwig zum König Böhmens gewählt wird (1526). Er hatte die Kompaktate, die ständischen Rechte, die gesamte Landesverfassung anerkennen müssen. Doch er wußte sein Ziel, hielt noch zurück.
Nun zog er auf dem Prager Hradschin ein. Und mit ihm Habsburg und Wien. Mit ihm auch Rom. Wieder einmal hatten politische Konstellationen für die Südwestpolitik entschieden. Also gegen den slawischen Osten. Aber auch gegen die ostmitteldeutsche Kultur, die eben jetzt unter Führung des Luthertums in neuem Aufstieg schien. Katastrophale Ereignisse sollten diese weittragende Entscheidung besiegeln.
Dynastisch und kulturell brachte Habsburg einen Vorsprung von hundert Jahren mit nach Böhmen, eben um das Hussitenjahrhundert. Wien hatte sich mächtig entfaltet. Der Donauhandel, die Stellung als Mittelpunkt einer gesicherten Monarchie begünstigten es. Die Universität, bald nach der Prager gegründet, und neuerdings der Humanismus, der im katholischen Wien auf alter Kultur weiterbauen konnte und jetzt gerade in Konrad Celtes und andern namhafte Wortführer aufstehen ließ, hatten die kulturellen Grundlagen gefestigt. Rom besaß hier seinen gut ausgebauten Stützpunkt. Von Wien aus wirkte es nun auf Prag ein.
Ferdinand ging zielbewußt vor, zunächst noch voll Zurückhaltung. Nur in die offenkundigsten Mißstände griff er mit entschlossener Hand ein: die Zwistigkeiten der Prager versuchte er auszugleichen durch Rückberufung des Hlawsa und seines Anhangs. Als Pašek sich dagegen verwahrte und gar mit der Macht der vereinigten Prager Städte auftrumpfen wollte, setzte Ferdinand ihn, den Primator, kurzerhand ab, verwies ihn, als er immer wieder mit den Magistraten konspirierte, aus der Stadt. Die Prager Städte wurden wieder getrennt, unter eigene Magistrate gestellt. Cahera, der aufrührerische Reden von der Teynkanzel herab gehalten hatte, wurde des Landes verwiesen. Die Ruhe in der Stadt war gesichert. Ein kluger »Protokonsul« amtete im Ratskollegium der Altstadt: Jakob Fikar von Wrat. Die Kirchen hatten sich gegenseitig zu dulden. Mit ruhigerem Fließen gelangte nun das geistige Leben auch wieder zu architektonischem Niederschlag.
Muß man die Renaissancearchitektur in Prag als fremden Eindringling bezeichnen? Das Neue erhielt seine Nahrung aus dem Süden, in vielen seiner monumentalen Äußerungen vermittelt durch den landfremden König, durch landfremde Orden. Aber die Prager Bildungsschicht war schon lange zur Aufnahme der neuen Formen gerüstet. Die zahlreichen humanistischen Kreise, die sich im Prag des 16. Jahrhunderts zusammengefunden hatten, trieben der neuen Kunst enthusiastisch entgegen. Blieb Renaissancekunst hier also nur Bildungsangelegenheit? Sie hat sich nicht wirklich einwurzeln können in den Prager Boden, wie ja auch in den germanischen Ländern kaum. In Prag besonders trieb die Empfindung aus mittelalterlichen Ausdruckswelten unmittelbar in barocke hinüber.
Immerhin: jetzt bedurfte dieser Prager Boden einer Schicht der Klärung und der Sammlung, der Beruhigung und des Neuansatzes formalen Ausdrucks, um wieder tiefer zurückzufinden zu den eigenen Grundkräften. In Prag sind die Bauten der Renaissancezeit denn auch nicht wie jene der mittelalterlichen und die späteren der Barockjahrhunderte zu ausschlaggebenden Elementen des Stadtbildes geworden. Aber als Zwischenschicht, die Abstand schafft vom Früheren, die neue Anregungen schafft für ein Künftiges, ist die Renaissance hier doch bedeutsam. Sie spielt hier also die gleiche Rolle wie in deutschen Landen, wenn auch ihre einzelnen Phasen gedrängter und verschlungener sich folgen wie dort, und wenn auch die eigentliche Krönung: die Selbstfindung der Nation in dieser Kunst –; wie sie einem Teil Deutschlands beschieden war –;, hier versagt blieb. Gerade das Fremde und sehr Bewußte dieser Kunst mag aber doch auch in Prag vorgearbeitet haben zu einer Art Selbsterkenntnis der Stadt als architektonisches Gebilde, die dann allerdings erst der Barock verwirklichen sollte. So erfüllt diese Renaissancearchitektur also eine ganz bestimmte Aufgabe innerhalb der Gesamtentwicklung der Prager Architektur, gliedert sich enger ein als der oberflächliche Blick es wahrnimmt.
Zunächst nistet sich Renaissancegeist in kleinen, schmückenden Zubauten ein: in Portalen, an denen Rustikaquaderung und Architekturbekrönung damals beliebt waren, in kleinen Höfen, die in frohen und auch ernsten Arkadenumgängen sich erweiterten, in den Kirchen im Schmuck der Altäre, in Epitaphien und Grabplatten, auf denen jetzt vielfach flämisch beeinflußte Skulptur sich ausbreitet. Auch Großbauten entstehen. Am Altstädter Rathaus wurde der Südflügel im neuen Stil umgebaut, die Fenster in klarer italienischer Prägung, auf einem die stolze Aufschrift »Praga caput regni«. Die Fenstereinbauten im Wladislawschen Saal auf der Burg klingen hier an. Die Neustädter bauten seit 1526 an ihrem großen neuen Rathaus. Teile des alten Baus –; so der starke Turm an der Ecke des Platzes –; werden in den Neubau übernommen. Die Fassade gegen den Platz zeigt in der Dachzone die großen Zwerchhäuser mit Blendengliederung, wie sie damals auch in Deutschland beliebt waren. Aber um dem weiten Platz davor ein architektonisches Gefüge aufzuzwingen, dazu reicht dieser Fassadenbau nicht aus. Solche Aufgaben löste in Prag erst der Barock. Die Teynschule erhält nun auch ein neues Gebäude. Man schuf sich allerorten das Gehäuse, wie es dem neuen Geist entsprach. Gotische Tendenzen wirkten zwar noch stark herein. Ja, hin und wieder kam es zu ausgesprochener Reaktion. Als aber Ferdinand selbst den ersten Monumentalbau errichten ließ, das Lustschloß Belvedere auf dem Hügel gegenüber dem Hradschin –; der tiefe Hirschgraben lag dazwischen –;, da war der Sieg der Renaissance entschieden. Ein Schub italienischer Meister und Handwerker war in die Stadt gekommen, hatte sich niedergelassen, und auch die heimischen Bauleute fügten sich der Mode.
Ferdinand hatte das Lustschloß seiner Gemahlin Anna zugedacht, um für ihre Neigungen das rauhe Prag südländisch zu verbrämen. Von wem die Pläne stammen, wissen wir nicht. Der König mochte sie sich aus Italien verschrieben haben: oberitalienische Prägung. Und zwar oberitalienische Frührenaissance, jetzt also doch schon etwas verspätet. Man hat den Palazzo della Ragione in Padua als Vorbild namhaft gemacht, den gleichen Bau, dessen Ideen auch Palladio in seiner Vicenzer Basilika weitergeführt hat. Der Vergleich des Palladiobaus mit dem Prager macht deutlich, wie unschöpferisch hier abgewandelt wurde. Ferdinand hatte den Auftrag zur Übersendung italienischer Bauleute im Oktober des Jahres 1534 gegeben, wenige Wochen nach dem Tode Benedikts von Rieth, des Prager Altmeisters spätgotischer Kunst. Wollte er dem großen Meister die Hintansetzung ersparen, dem wirklich genialen Künder eines jetzt überholten Ideals, überholt nicht von größeren Meistern in Prag, sondern von der unerbittlichen Zeit? Im Frühjahr 1535 war ein erster Trupp italienischer Bauarbeiter in Prag eingerückt, unter Führung des Hans von Spatio. Sofort wurde mit dem Aufbau begonnen. Drei Jahre später erschien Paul de la Stella de Mileto auf dem Plan, begann mit den bildhauerischen Arbeiten: sehr zarten und fein durchgeführten Ornamenten und auch figürlichen Darstellungen für die Brüstungen der Geländer, für die Friese. 1539 tritt Joan Maria (Austalis de Pambio) auf. Er versteht es, den Spatio aus der Bauleitung zu verdrängen. Aber Geldknappheit zwingt bald zur Unterbrechung der Arbeiten. Bei der Fortsetzung (nach 1545) ist Paul de la Stella der Bauleiter. Er stirbt 1552. Nun übernimmt Hans von Tirol die Weiterführung. 1555 wird mit dem Oberstock begonnen. Die Visierungen für den Schmuck der Oberstockfassade liefert schon Bonifaz Wolmut, ein gebürtiger Konstanzer, der nun aus Wien nach Prag berufen worden war. Als Steinmetz arbeitet ein Johann Baptiste Austalis, als Maurer wird genannt Ulrich Austalis. 1560 war der Außenbau beendet, auch schon in Kupfer eingedeckt. Im Bauverlauf hatten Formen der Hochrenaissance diejenigen der Frührenaissance verdrängt: in den Tür- und Fensterumrahmungen des Kernbaus finden sich Motive, die aus des Serlio großem Stichwerk genau kopiert sind.
Als Ganzes bedeutet der Bau für Prag doch eine Tat. Reines Italien war nun eingedrungen, schwang dort oben auf der vom Hradschin nur durch den Hirschgraben getrennten Höhe in wohliger Formenklarheit, Säulenumgänge und Altanen um den frei sich reckenden, in prachtvoller Kurvenschwingung abgedeckten Bau. Mochte das Werk, an italienischen Bauten der Zeit gemessen, auch nicht bestehen –; in Prag hatte man in ihm doch ein Vorbild, das zünden mußte, hatte Beispiele sehr reiner Einzelformen, vor allem der neuen klingenden Proportionen.
Das Beispiel wirkt. Auch der Adel bekundet nun wieder seine Machtansprüche in stolzen Bauten. Er will in nächster Nähe des Königssitzes, in nächster Nähe der Landtafelstätte hausen, auf gleicher Höhe. Man erwirbt Gelände auf dem Hradschin. Der Südhang, gleich östlich vom Königspalast, scheint besonders begehrt. Der war seit dem Hussitensturm noch nicht wieder dicht verbaut worden. Der verheerende Burgbrand (1541) hatte das wenige, was neu errichtet worden war, von neuem in Schutt gelegt. Da also bauten nun die Pernstein und Schwamberg auf Klingenberg und Rosenberg, die mächtigsten Geschlechter Böhmens.
Peter von Rosenberg, als Vormund des jungen Regierers dieses mächtigen Hauses, läßt von Meister Hans, einem »Wälschen« (Hans von Tirol aus Romaldo oder einem der zum Belvederebau berufenen Italiener?), einen mächtigen Palast beginnen. Die vorgelegten Pläne betreffen nur den Außenbau, fünf Türme sollen vor der Südfront aufgehen, das Innere –; Stiegen, Korridore, Einteilung der Säle und Gemächer –; soll späteren Entscheidungen vorbehalten bleiben. (Ein krasser Fall der neuen Einstellung.) Der Rohbau steht 1549 fertig. Peter war gestorben, andere Vormünder beaufsichtigen den Fortgang des Baus. Von 1551 ab leitet der junge Wilhelm die Arbeiten persönlich. Verschwenderisch wird gebaut. Die Arbeitseinteilung ist bezeichnend für die Lage auf dem Prager Baumarkt. Die Zurichtung des einfachen Steins (vom »Weißen Berg«) besorgen einheimische Meister, deutsche und tschechische. Den feineren Sandstein (aus Hloubìtin) und den Marmor bearbeiten italienische Kräfte. Der Palast umschließt einen prächtigen Säulenhof. Am Hangrand führen Säulengänge entlang, umgrenzen einen Garten, der viel bewundert wird. Eine Galerie führt hinüber zum Königspalast. Tischler und Schnitzer und Maler schmücken das Innere. Unter den Malern ist Francesco Floriani, der nachmals unter Maximilian II. Hofmaler und Architekt bei den Burgneubauten wurde.
Aber dem stolzen Rosenberg genügt der neue Palast noch nicht. 1573 kauft er des Nachbarn Schwamberg neuerbautes Haus dazu, läßt es niederreißen, läßt seinen Palast von dem italienischen Meister Ulrich (Austalis de Sala aus Lugano?) mit größtem Aufwand erweitern. Hier feiert der »regulus Rosensis« seine Feste. Herzöge, Kurfürsten, ja der Kaiser (schon Rudolf II.) selbst sind bei ihm zu Gast. Der Adel hat große Zeiten. Als Wilhelm stirbt (1592), erbt diesen gewaltigen Palast samt dem großen Besitz in Südböhmen der einzige Bruder Peter Wok. Auch der war kinderlos, auch er ein Verschwender. Vor allem in seinen alchimistischen Liebhabereien vergeudete er Riesensummen. Er brauchte Geld. Da Gefahr bestand, daß des Kinderlosen Besitz nach seinem Tode an die Krone fallen werde, mußte er auf Rudolfs Ansinnen eingehen, diesem gegen Verbürgung freien testamentarischen Verfügungsrechtes über einen Teil der Güter die Herrschaft Krumau (Südböhmen), den Palast auf dem Hradschin und einige andere Liegenschaften zu überlassen. Der Kaiser übernahm dafür noch einen Teil der Rosenbergschen Schulden, überließ ihm auch den Palast des Georg von Lobkowitz auf dem Hradschiner Platz, der durch Konfiskation an die Krone gefallen war. Der große Rosenbergsche Palast wurde also kaiserlich, er wurde mit dem Königspalast nun durch eine steinerne Galerie noch enger verbunden. Wok war in den Besitz eines anderen Palastes gekommen, dessen Baugeschichte und weitere Schicksale nicht minder interessant sind als die des ersten.
Johann von Lobkowitz hatte ihn auf dem Platz der Burg (neben der Kirche des heiligen Benedikt) begonnen, im gleichen Jahre wie der Rosenberger den seinen. Man will sich gegenseitig übersteigern. Lobkowitz baut »moderner«. Die Rosenberg-Fassade zeigte noch viel von mittelalterlicher Burgenart. Lobkowitz läßt sich von einem Italiener(?), einem Meister Augustus, einen Palast nach Art der Florentiner Stadtpaläste entwerfen: geschlossen aufgehender Kubus mit weit ausladendem Kranzgesims. Dies Kranzgesims in eigenartiger Fassung: über tiefer Hohlkehle, in welche Stichkappen eingeschnitten sind. (Auch dafür ein Vorbild in Oberitalien.) Über diesem echt toskanischen Kranzgesims aber geht an den Schmalseiten der nordische Spitzgiebel auf. Die heimische Überlieferung drängt also doch wieder herein in den neuen fremden Typus. Und auch die Grundanlage weicht von der italienischen Art ab: zwei Flügel im Winkelhaken zueinander gestellt, der eine am Hangrand großartig aufgehend, der andere gegen die Platzflucht vorstoßend. Der ganze Bau mit den jetzt in Prag üblich werdenden Sgraffitos überzogen, jenem Ersatz für farbige Fresken, welche die Prager Witterung nicht zuließ. Diese Sgraffitotechnik legt zwei verschieden gefärbte Mörtelschichten übereinander und kratzt die erwünschten dekorativen Muster aus der Oberschicht aus, so daß sie, anders gefärbt, auf der unteren zum Vorschein kommen, meist schwarz gegen hell gestellt. Der schräg aufgehende Sockel war in fingierten Bossenquadern, der Hauskörper in Diamantquadern, die oberen Teile in Ranken- und Blattornamentik geschmückt. 1563 dürfte der Palast vollendet gewesen sein. Im Innern große Säle und –; dies wieder ein Neues im Prager Palastbau –; breite, rechtwinklig gebrochene Treppenläufe. Ein kunstvoll angelegter Garten schmiegte sich zwischen die Flügel. Von den Erben des Erbauers hatte den Palast später der Obersthofmeister Georg Popel von Lobkowitz gekauft, dem er dann samt dem ganzen übrigen Besitz vom Kaiser konfisziert wurde (s. u.). Vom Kaiser erhielt ihn, wie gesagt, Wok Rosenberg. Nach dessen Tod ging er über die Schwambergs, Eggenbergs an die Schwarzenbergs über (1719), deren Namen er heute noch führt. (Zur Zeit Technologisches Museum.)
In diesen Jahren (1550) ließ sich auch Joachim von Neuhaus –; wir kennen das Geschlecht –; seinen neuen Palast errichten. Er baut unten zu Füßen der Burg, wo nun die »Neue Schloßstiege« am Südhang entlang hinaufführte: ein langer Trakt, die Hoffassade ruhig gegliedert, die Fassade zur »Neuen Schloßstiege« von gereihten Giebeln gekrönt, die nun schon das für alle künftige Prager Renaissancearchitektur so bezeichnende Motiv der gedrückten Formen bringen. Nicht mehr der freiansteigende Giebel, wie er aus dem Mittelalter heraufdrang, sondern flache Dreiecke, durch Horizontalbänder in mehrfacher Stufung noch lastender gemacht.
In all diesen Prager Renaissancepalästen treibt trotz mancher zarten und leichten Einzelformen ein schwerer Ernst. Viel Mauer bedrängt die Form und die Schmückung mit Sgraffitos steigert noch die dunklen Klänge. Das Bemühen um die wagrechte Gliederung läßt den Aufschwung der Giebel erlahmen, breite gedehnte Formen lasten über dem Block, geben ihm ein noch schwereres Gewicht. Es ist, als ob der Prager Boden sich wehre gegen die südliche Form, als ob er sich am Fremden räche, indem er es nur mißverstanden einläßt, so daß aller Ernst der neuen Form zu ernst, ihr Spiel nicht überlegen genug genommen ward. Aber gerade aus diesem Mißverstehen erwächst der höchst eigene Ton.
Prag begann sich wieder zu monumentalisieren. Den Fremden mußte es ein stolzer Anstieg scheinen. Nur der tiefer dringende Blick nimmt wahr, daß es kämpfende Mächte sind, die sich da aneinander emporstemmen. Das Kleid der Renaissance, das dem geistigen Gehalt des Humanismus, der neuen auch in der Reformation aufbrechenden Bildung so wohl entsprach, verdeckte noch alle tiefer lauernden Konflikte.
Aber plötzlich brachen sie auf. Ferdinand, deutscher König, zog für seinen Bruder Karl V. in den Krieg gegen die protestantischen Fürsten Deutschlands. Das Heer der böhmischen Stände, bei Kaaden versammelt, verweigert den Kriegsdienst gegen die Glaubensgenossen. Auf dringliches Bereden des Königs –; er hatte als seinen Sprecher zu den Pragern den Altstädter Protokonsul Fikar von Wrat geschickt –; folgten ihm die Städte und die Kreishauptleute. Andere zogen heim. Der König war erbost. Im nächsten Jahre (1547) ordnete er, ohne den Landtag um Bewilligung zu befragen, die allgemeine Heerfolge an. Das Land trotzte. Die Gemeinden der Prager Alt- und Neustadt errichteten im Carolinum einen Bund zur Verteidigung ihrer Privilegien. Viele Herren und Ritter schlossen sich an.
Aber der König, in Deutschland siegreich, beschließt, den Trotz des Landes in der Wurzel zu ersticken. Er zieht gegen Prag, besetzt mühelos Burg und Kleinseite, befiehlt sechshundert angesehene Bürger vor sein Gericht, verurteilt zwei vom Herrenstand und zwei aus der Bürgerschaft zum Tod durch das Schwert. Wegen Rebellion! Darunter auch den siebzigjährigen Protokonsul von Wrat: »als königlicher Beamter hätte er die Verpflichtung gehabt, ihm die Konspirationen der Prager zu melden«.
Die Stadt erzitterte. Der Adel duckte sich. Mit furchtbarem Schlag hatte Ferdinand die ständische Macht zertrümmert. Vor allem Prag sank bedingungslos unter die Faust des Siegers.
Ferdinand nahm der Stadt alles: die Bündnisgewalt mit andern Städten wurde aufgehoben, ein königlicher Hauptmann mit ausschließlicher Machtbefugnis über jede Stadt gesetzt. Alle Privilegien und Freiheitsbriefe mußten herausgegeben, die Waffen ausgeliefert werden. Zölle und sonstige Gemeindeeinkünfte mußten dem König abgetreten, Zahlung einer Bier- und Malzsteuer auf ewige Zeiten zugestanden werden. Das Richteramt wurde der Stadt genommen. Der König ernannte königliche Richter mit besonderer Instruktion. Der Altstädter Magistrat hörte auf, rechtliche Berufungsstelle für die andern Städte Böhmens zu sein. Auf der Burg wurde ein allgemeines königliches Appellationsgericht errichtet, Zentralberufungsstelle für die Städte, auch für jene, die nach Magdeburger Recht richteten (wie zum Beispiel die Kleinseite). Damit war also auch jede Berufung an jene protestantische Stadt, wie sie seit Jahrhunderten Brauch war, unterbunden. Der Protokonsul, von jetzt ab Primas genannt, wird dem König viel enger verpflichtet. Er rangiert vor dem im Turnus von vier Wochen wechselnden Bürgermeister und vor dem Rat. Er allein besorgt nun die Rechnungsführung der Stadt, für die man noch vor kurzem einen eigenen »Kammermeister« eingesetzt hatte. Die Grundlage für die später so überragende Stellung des Primators als alleinigen Stadtregenten, neben der das Bürgermeisteramt zur bloßen altherkömmlichen Zeremonie herabsinkt, ist gegeben. Alles in allem: Prag ist kein evangelischer Stand mehr unter den Ständen Böhmens –; Prag ist nur mehr dem König bedingungslos untertänige Stadt.
Damit war jenes grausige und doch in manchem auch eindrucksvolle Werk eingeleitet, das Habsburg durch Jahrhunderte in Prag und Böhmen durchführen sollte: die Rückholung des Protestantenlandes zur katholischen Kirche. Ferdinand hebt auch hierin vorsichtig an. Vielleicht waren es bei ihm damals noch gar nicht bewußt religiöse Motive, die ihn zur Züchtigung Böhmens veranlaßten. Vielleicht war es damals nur erst der Anspruch des Königs gegenüber den Ständen. Der erste Primator, den er nach dem Sturz der Stadt bestellt, ist ein ernster Utraquist, ein Verehrer des Hus und zugleich ein hochgeachteter Humanist: Duchoslaw Chmeliø von Semechow. Ihn betraut er mit wichtigsten Aufgaben, beruft ihn sogar in die Kommission zur Revision der ständischen Privilegien. Er denkt auch nicht an Entnationalisierung, im Gegenteil: er eifert den Zikmund von Puchow zur Abfassung seiner »Tschechischen Kosmographie« an. Sein Sohn, der Erzherzog Ferdinand von Tirol, den er zum Statthalter in Böhmen einsetzt, vertieft die kulturelle Richtung des Vaters.
Dieser Erzherzog Ferdinand muß ein freier lebendiger Mensch gewesen sein. Er hatte die schöne Philippine Welser, die Augsburger Patriziertochter, zur Frau genommen, ein Königssohn die Bürgerin. Ihr zu Ehren hatte er das Sternschloß erbaut, sagt das Volk. Er fühlte sich als Böhme. Zu Leibärzten hatte er den Deutschen Georg Handsch und den Tschechen Thaddäus Hajek (Tadeáš Hájek). Handsch stammt aus Leipa. Er hatte in Prag, dann in Italien gründliche Studien getrieben, spielte nun im Kreise des Richters von Hodìjov, dem auch Kolínský (Collinus) angehörte, eine belebende Rolle. Jetzt trug er die humanistische Bildung in die Kreise des Hofes. Hajek –; er schrieb sich Nemicus –; begründete die systematische Naturforschung bei den Tschechen. Er mißt und mappiert in der Prager Umgebung, übersetzt das »Herbar oder Kräuterbuch« des Andreas Matthiolis, treibt astronomische Forschung, setzt später die Berufung des berühmten Dänen Tycho de Brahe durch.
Nein, auf Entnationalisierung war diese Regierung keineswegs bedacht. Konnte doch gerade damals der nationalistische Wenzel Hájek von Libotschan auf den Wunsch des katholischen Adels und mit Unterstützung der Regierung seine »Chronik von Böhmen« zurechtzimmern (1541), ein schlimmes Machwerk mit katholischer Tendenz, das seine zersetzende Wirkung bis ins 18. Jahrhundert aufrechterhalten konnte, wo es dann von Dobner, dem böhmischen Gelehrten, entlarvt wurde. Nein, germanisieren wollte diese Politik nicht. Und so zeigen denn auch diese Jahre, die unter dem Zeichen humanistischer Kultur stehen, zumindest in den Sphären der Bildung ein gutes Zusammengehen der Nationen. Der vornehmlich unterm Luthertum einsickernde Zuwachs der Deutschen bereichert das kulturelle Bild der Stadt.
Und auch das Volksleben scheint damals von nationaler Gehässigkeit entgiftet gewesen zu sein. Berichte über ein Schützenfest im Jahre 1565 lassen gar eine gewisse Deutschfreundlichkeit der Bevölkerung erkennen. Die Nürnberger, zu denen damals mancherlei wirtschaftliche und kulturelle Fäden hinüberspielten, waren zum Fest gekommen. Waren von »Trummetern mit Zinken, Possaunen und Schalmayen« empfangen worden. Beim Abschied sagt der Münzmeister Hans Harter den Nürnberger Schützen Dank für ihr Kommen, und Albrecht Wolker aus Nürnberg quittiert mit herzlichen Worten.
Auch wirtschaftlich scheint sich Prag schnell von dem schweren Schlag des Jahres 1547 erholt zu haben. Ferdinand hatte bei verschiedenen Anlässen der Stadt Privilegien, die er anno 1547 genommen hatte, zurückgegeben. Das weiter aufblühende Bauleben der Stadt gibt uns von dem allem ein beredtes Zeugnis, bringt auch die internationale Befruchtung damaliger Prager Kultur zum Ausdruck. Es baut der Hof. Es baut der Adel. Es baut nun auch wieder das Bürgertum. Im Jahre 1541 hatte ein schrecklicher Brand auf Burg und Kleinseite arg gewütet. Der Veitsdom mußte neu eingedeckt, der Wladislawsche Saal mußte gründlich repariert werden. Eine königliche Bauhütte hatte reichlich zu tun. In den Fünfzigerjahren wird die italienische Richtung abgelöst, nein: ins Nordische aufgenommen von deutschen Meistern. Hans Tirol von Romaldo baut am Belvedere weiter.
Einige Jahre später (1555) erscheint als königlicher Baumeister Bonifaz Wolmut auf dem Plan, eine starke Architektenpersönlichkeit, die nun allen königlichen Bauten ihr Siegel aufdrückt. Zunächst setzt Wolmut dem Belvedere den leichten Oberstock auf. Einige der italienischen Bauleute scheinen nach Dresden weitergewandert zu sein, wo am neuen Schloßbau manche aus Prag bekannten Einzelformen auftauchen. Wolmut baut nach den italienischen Plänen weiter. Im Schmuckwerk macht sich schon nordischer Geist bemerkbar. Dann errichtet er an der Westwand des Veitsdomes, deren vorläufige Gestaltung man nun zur endgültigen ausbauen zu müssen glaubte –; man resignierte auf den Ausbau des Domes –;, die schöne, an Römerbauten gebildete Orgeltribüne, die den Triforienrhythmus des Chors aufnimmt und in schweren Klängen beendet. Das Vorlagenbuch des Serlio hatte Pate gestanden für das System dieser Tribüne. In ihren Gewölben nistet aber noch die Gotik. Ein allseits harmonischer Innenraum war nun geschaffen, der dem Zentralraumideal der Renaissance ungezwungen entgegenkam. Ja, so sinnvoll fügte sich diese Emporenwand dem Raumbild ein, daß man glauben konnte, Karl und sein Architekt wären einverstanden gewesen mit solchem Ausbau, hätten in ihm ihr heimliches Ideal anerkannt. Erst in unseren Jahren wurde die Wand abgebrochen, die Empore ins neue Nordquerhaus versetzt. Der Raum des neu errichteten Langhauses drängt nun kalt und etwas lärmend in die Stille des alten Chors. Der arg beschädigte Turm erhielt von Wolmut im Jahre 1563 die schon barock anmutende Haube, die der straff aufstrebenden Gotik des Turmkörpers den anmutigen und doch festen Ausklang gibt. Eine Restauration im Jahre 1770 hat diese Haube dann völlig ins Barocke gewandelt, wie wir sie heute noch sehen.
Im gleichen Jahr (1563) hat Wolmut die Landrechtsstube auf der Prager Burg –; sie schließt an den Wladislawschen Saal an –; zu erneuern. Da wird sein heimlich immer noch der Gotik ergebenes Herz von des Vorgängers Benedikt Leidenschaft gepackt: in großen Kurvenzügen läßt er die Gewölbe über den Saal schwingen. Stolz pocht er auf seine Leistung, die er der Benedikts an die Seite stellt: »umb welcher arbeit willen dem Maister Benedigt säligen vom könig Wladislaus ein hoher erntitl gegeben worden«. –; Auch bei den übrigen sehr umfassenden Erweiterungsbauten auf der Burg dürfte Wolmut maßgebend beschäftigt gewesen sein.
Als letztes seiner Werke erbaut er dann im Jahre 1568 noch das Ballhaus, ein in kraftvoller Halbsäulenordnung kernig hingesetztes Gebäude am Rand des Hirschgrabens, dessen ernst-schwere Art seiner Bestimmung, der Kurzweil eines bewegten Renaissancehofes zu dienen, merkwürdig wenig Rechnung trägt.
Wolmut liebte das Pathos der Neulateiner. Die Humanisten am Hof und in der Stadt mögen ihm begeisterten Beifall gezollt haben. Bauen war wieder eine Lust geworden. Sogar der Statthalter, der kunstsinnige Erzherzog, die Seele aller Kunstbestrebungen bei Hofe, ging unter die Architekten: er ließ nach eigenen Plänen jenes merkwürdige Jagdschloß unweit Prags aufführen, das über sechsstrahlig sternförmigem Grundriß ein kunstvoll durchdachtes, gerade dadurch aber recht verwickeltes Raumsystem zu zwingen sucht. Eine Laune vielleicht, aber auch als solche außerordentlich bezeichnend für die Mischung von Nord und Süd, die damals das Prager Bautum beherrschte, bezeichnend aber auch für die Mischung der Zeiten, die damals um Form rang. Das Hartgeschnittene, Aufsplitternde der Sternform ist wie Nachklang aus der spätesten Gotik. Die Einzwängung in die abstrakte »Figur«, dies Ringen ums »Gebilde« ist neuer Geist, südher bezogen, vom Norden ins Extrem gedrängt. Die ursprüngliche Gestalt mag durch Türmchen auf der Mittelkuppel und über den Ecken das Ganze dem nordischen Auge vertrauter haben erscheinen lassen. Und das Innere setzte dem schroffen Äußern unerwartete Zartheit entgegen: die in Muldenform mit Stichkappen eingewölbten Decken und die Wände prangen in feinster Stuckarbeit, die zarteste Reliefs in Arabesken und figürlichen Darstellungen phantastisch über die Flächen spinnt. So darf man auch auf hohe Kultur der Feste schließen, die der Statthalter dort seinen Gästen gab. Den Namen »Sternschloß« besiegelte das auf dem First angebrachte Emblem.
Auch in der Altstadt erstanden immer mehr Bauten im neuen Stil. Die Bürger wollten mit der Zeit gehen. Jakob der Jüngere Granow von Granowsky läßt im Teynhof ein neues Gebäude errichten. Über hohem, fest zusammengehaltenem Erdgeschoß ein ganz in klingende Arkaden aufgelöstes Stockwerk. Darüber wieder ein Wandgeschoß mit kleinen, in den Achsen der Arkaden liegenden, gekuppelten Fenstern. Abschließend –; wohl schon ursprünglich –; ein Steildach. Sgraffito schmückte auch hier die Wände. Hier und dort erstanden die schönen Höfe, zwischen den engen Gassenfluchten freie rhythmische Raumspiele schaffend. Der berühmte Buchdrucker Georg Melantrich von Aventin, ein Bahnbrecher der Prager Humanistenbewegung, baute sein Haus »Zu den zwei Kamelen« in entschlossener Renaissance (heute abgerissen). Das schöne Portal dieses Hauses (doppelte Säulen, Architrav, Tympanon) folgt einem Musterstich aus Androuet du Cerceaus »Triumphbogenbuch«, das neben Serlios Stichwerk stark auf die Prager Baumeister wirkte. Französische und flandrische Einflüsse beginnen die italienischen zu verdrängen. Besonders in der Skulptur spürt man eine Zeitlang viel flandrischen Einschlag. Jetzt hielt man sich in Prag ans Modernste. Ferdinand beauftragt den Niederländer Alexander Collin mit der Anfertigung eines Modells für sein Grabmal im Veitsdom. Dieser Collin (aus Mecheln) hatte am Denkmal Maximilians I. in Innsbruck gearbeitet. Andere Niederländer ziehen nach. Strömungen der Kunstrichtung, unter denen man oft auch Verschiebungen der Handelswege vermuten darf.
Prag war in sicherem Aufstieg. Die kluge Politik des Habsburgers gab ihm eine Stellung als Mitte, zumindest der Länder der böhmischen Krone zurück. Doch Rom stand dahinter und drohte.
Ein spätes populäres Ressentiment der Tschechen warf Germanisierung und Katholisierung, die beiden gehaßtesten, weil historisch gefährlichsten Elemente einer gefürchteten Entnationalisierung, zusammen. Man dachte an Habsburg, an Wien, woher der Katholizismus allerdings in deutscher Zunge eindrang. Man vergaß, daß damals und noch ein halbes Jahrhundert lang Germanisches weit stärker als Protestantismus vom Norden her eindrang, als Bündner also gegen Rom. Bewußte Einsicht muß die kulturelle Verknüpfung des damaligen Prag, ja Böhmens überhaupt, mit Wittenberg, mit dem protestantischen Norden sehen. Der protestantische Norden Deutschlands stand gegen Wien –; die neue ostmitteldeutsche Kultur gegen die altbayrische. Die Literaturgeschichte weist die Gegensätze deutlich auf. Was deutsch war in Böhmen –; und wir haben diese wichtigen deutschen Kulturzentren schon genannt –; und auch das deutsche Element in Prag selbst war nordher gespeist. Nur das Rosenbergsche Krumau tendierte südwärts. Jetzt streckte der Süden den Arm aus nach all diesen Gebieten des Nordens. Im religiösen Gegensatz gipfelte die Spannung. Und die politischen Lagerungen fügten es, daß sie sich über Böhmen, über Prag entladen sollte, zum Unheil des tschechischen Volkes und auch des deutschen. Germanisches –; das waren damals zwei geistige Welten, die über Böhmen sich trafen. Aber Habsburg siegte. Und Habsburg kämpfte für Rom.
Der erste Schlag Roms, zu dem Ferdinand, der Bedächtige, Romtreue, jetzt ausholen mußte, erst noch rein ideeller Art, und auch der furchtbar wirkliche zweite, den der andere Ferdinand, wie unter schwerem Bann handelnd, ausführen sollte, war nicht gegen die Tschechen als Volk gerichtet, sondern gegen die Ketzer. Und beide Male waren die protestantischen Deutschen in Böhmen mitgetroffen, beim zweitenmal blutig. Protestantenschicksal hat Deutsche und Tschechen dieses Landes so furchtbar geeint, daß man die später so tief wieder aufbrechende nationale Kluft nicht verstehen könnte, wüßte man nicht aus der Geschichte, wie tief verwurzelt Furcht und Haß waren, womit die Tschechen alles Deutsche betrachteten. Zum Urfeind Deutschtum trat nun der Urfeind Katholizismus. Habsburg zwang ihn auf. Als die Tschechen dann im Laufe der Jahrhunderte immer nachhaltiger wirklich katholisch wurden, sickerte naturgemäß der Haß vom Begriff des Katholischen ab. Um so stärker mußte er, sozial und wirtschaftlich genährt, allein auf das Deutsche drücken. Das ist die Situation, unter der Prag bis heute litt.
Ferdinands Ziel wird jetzt immer eindeutiger: Restauration der katholischen Kirche. Er denkt nicht daran, den Utraquismus auszurotten. Im Gegenteil: sein Beauftragter auf dem Tridentiner Konzil, der Ordensgroßmeister der »Kreuzherrenritter mit dem roten Stern«, Ferdinands neuer Bischof in Wien, Anton Brus von Müglitz, ein geborener Mährer, hat Weisung, die Anerkennung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt dort durchzusetzen. Aber Ferdinand verlangt diese Anerkennung nur, um mit ihrer Hilfe die Utraquisten unter Roms Oberhoheit zurückzubringen, sie den Lutheranern zu entreißen. Ihm liegt es daran, die Protestierenden zu trennen. Die Bewilligung des Konzils bleibt aus.
Jetzt packt Ferdinand an der Wurzel an: an Universität und Konsistorium. Der Universität hatte er im Jahre 1549 zwölf Artikel zur Stellungnahme vorlegen lassen. Die Universität hatte in lutherischfreundlichem Sinn geantwortet. Gegen ihre Stellungnahme protestiert das alt-utraquistisch gesinnte Konsistorium. Damit war die Kernmacht der Protestierenden gespalten: zum erstenmal seit seiner Aufrichtung durch Sigismund stand das Konsistorium gegen die Universität. Wie war das möglich? Die Universität war plötzlich zur fortschrittlichen, und das hieß damals zur neu-utraquistischen Sache übergegangen. Die Reformbewegung an der Universität datierte schon aus den Dreißigerjahren. Die alten Magister starben aus. Junge hatten die Führung an sich gebracht: Wittenberg-Jünger, die mit dem alten Schlendrian des Studiums gründlich aufzuräumen willens waren, die neue Bildungsstoffe hereinholten auf die Katheder, die das Schulwesen vollkommen zu erneuern sich bestrebten.
Die Schulen Böhmens waren ja seit Gründung des Generalstudiums den Magistern unterstellt. Seit 1500 waren die Klagen der Magister immer häufiger geworden, daß Privatschulen ihnen Konkurrenz machten. Seit nun das Luthertum die Melanchthonschen Schulideen im Lande, auch in Prag pflegte, drohte der Einfluß der Magister auf das Schulwesen ganz zu erlöschen. Hier setzte die Reform ein. Das Schulsystem der Universität wurde wieder gestrafft, feste Lehrpläne wurden ausgearbeitet. Außer den zahlreichen niederen Schulen gab es in Prag höhere Schulen beim Teyn, bei St. Ägidien, St. Heinrich, St. Stephan, St. Niklas auf der Kleinseite. Besonders St. Heinrich kam empor. Das Pensum dieser Schulen war auf fünf Klassen aufgeteilt: Prima, Sekunda, Tertia, Quarta und Infima. Ein Rektor stand der Anstalt vor, zwei Lehrer, ein Kantor, ein Insekutor besorgten Unterricht und Ordnung. Für den Religionsunterricht, den die Lehrer zu geben hatten, wurde eine »summa doctrinae religionis« eingeführt. In den höheren Klassen wurde nach dem Katechismus des David Chitraeus unterrichtet. So wurden aus diesen Schulen allmählich Pflanzstätten solider utraquistischer und auch schon lutheranischer Bildung. Die Übergänge waren im Fließen.
Die Universität selbst erstarkte über diesem Unterbau der vorbereitenden Schulen zu einem lebendigen Institut. Etwa sechshundert Immatrikulationen konnten damals jährlich vorgenommen werden. Waren theologische Vorlesungen später von der Regierung auch untersagt, so leistete man doch Ersprießliches in den Naturwissenschaften, wo ein Thaddäus von Hajek, ein Martin Bacháèek, der später mit Kepler befreundet war, lehrten. Die Naturwissenschaftler hatten die Verpflichtung zur Abfassung des Kalenders, die seit je das Monopol der Universität war. Damals schon begründete sich das große naturwissenschaftliche und naturphilosophische Interesse, das dann um die Jahrhundertwende unter Rudolf II. in seine Extreme vortreiben sollte. Die ganze geistige Entwicklung hatte es mit sich gebracht, daß auch Deutsche damals an der Universität nicht nur hörten, sondern wieder lehrten. Es waren wohl auch diese Deutschen, welche die neue Richtung stärkten. Und diese ganze akademische Geistesrepublik schwenkte nun immer deutlicher zur neuen Richtung hinüber. Das arge Jahr 1547 hatte all diesen Reformideen vorläufig ein Ende gesetzt. Die Einwirkung des Luthertums vermochte es nicht zu hindern. Die wuchs an der Universität nur um so stärker.
Dem sollte entgegengearbeitet werden. Da die Universität zu einem richtigen Bollwerk des am Luthertum gefestigten Neu-Utraquismus zu werden drohte, leistete man diese Gegenarbeit am wirksamsten durch eine katholische Gegenuniversität. Die mochte dann die Utraquisten anlocken, mußte dadurch die Kluft zwischen den Protestierenden vertiefen. Ferdinand bemühte sich beim Papste, erwirkte 1555 die Bewilligung, ein Jesuitenkolleg in Prag zu errichten. Auch Ignatius von Loyola, der Gründer dieser geistlichen Militärmacht des Papstes, hatte eingewilligt.
Jesuitismus –; das war damals eine klar formulierte Parole. Prag mochte erzittern. Das Kollegium sollte als Kern aller katholisierenden Bestrebungen in Prag und von Prag aus in ganz Böhmen kämpfen. Damit war der entscheidende Schritt getan: der Herrschaft der Jesuiten, das heißt Roms, war im Herzen Böhmens ein Bollwerk errichtet.
Dem Kollegium wurde das Clemenskloster an der Brücke zugewiesen. Die bisherigen Eigentümer wurden in das von den Franziskanern verlassene Agneskloster übergesiedelt. Eine Maßnahme, welche die in ihrer Geltung beim Volk durch den neuen Orden ohnedies stark zurückgesetzten Dominikaner, die Hüter der Inquisition alten Stils, nie vergessen wollten. Ihr Haß gegen die Jesuiten brach später des öfteren glühend aus.
Im Jahre 1556 zogen zwölf Jesuitenpatres in das Clemenskloster ein. Ein Rektor stand dem Kollegium vor: der große Peter Canisius selbst stellte sich an die jetzt umkämpfteste Front des Abendlandes. Schulen und Alumnate wurden ihm eingegliedert. Als Oberbau der Schulen wurde ein theologisches und ein philosophisches Studium gegründet. Die Gegenuniversität stand gerüstet. Der Papst verlieh das Promotionsrecht und sandte Subsidien. Alle Reklamationen des Karlskollegs, des »Carolinums«, verhallten, erstickten schließlich in der unangreifbaren und fast militärisch organisierten Stellung dieses »Clementinums«. Die ersten Jahre des Aufbaues waren durch materielle Schwierigkeiten arg gehemmt. Als Einkünfte waren dem Kolleg die Erträgnisse des aufgelassenen Klosters Oybin zugewiesen worden. Sie waren dürftig genug. Aber eine prächtige Bibliothek hatte man von dort doch übernommen. Sie war willkommene Grundlage des geistigen Aufbaus. Sie gehört noch heute zum Grundstock der Clementinumbibliothek, der jetzigen Universitätsbibliothek. Man hatte sie damals gleich nach Prag gebracht, aber in diesen mühsamen Anfangszeiten wirkte sie doch nur mehr als Dekoration. Peter Canisius berichtet ausführlich über alle Schwierigkeiten, auch über die üble Aufnahme, wie sie die ersten Jesuiten bei der Prager Bevölkerung gefunden hatten. Seine Briefe an Ignatius von Loyola lassen diese Gründungsarbeit genau verfolgen. Es mußte schon eine geistige Persönlichkeit vom Format dieses Canisius an der Spitze stehen, um hier durchzuhalten.

Der Vladislavsche Saal 1607
Unverdrossen geht man ans Werk. Allmählich werden Sympathien erweckt. Gönner erstehen. Papst, König, Adel und auch das katholische Bürgertum stifteten schon Geld und Güter. Im übrigen hatte man die ganze katholische Welt hinter sich als Speicher auch für die geistigen Kräfte. Man hatte ein unerreichbares System der Bekehrung, eine ausgeklügelte Methode des Lehrens. Man arbeitete volkstümlich –; in Rom waren junge tschechische Scholaren zur Mission in Böhmen ausgebildet worden. Man rechnete ebenso mit den Instinkten des gemeinen Volkes wie mit den Ansprüchen der gebildeten Humanisten: veranstaltete im Clementinumhof prächtige Schauspiele, traktierte in den Klassen Latein, auch etwas Griechisch. Unter dem Rektorat eines Canisius war noch kluge Pädagogik am Werk. Später wurde dieser Jesuitenunterricht mehr ein Abrichten als ein Bilden. Man erzog zu effektvoller Leistung, zu ausgezeichneter Haltung bei Prozessionen, in der Schule, überall. Die Prager Familien staunten, sandten ihre Kinder hin trotz aller Warnung der Wittenberger Synode. Die Jesuiten arbeiteten, predigten, unterrichteten, wühlten, untergruben den wankenden Ruf des verarmten Karlskollegs vollends und triumphierten.
Dieser Aufstieg des Jesuitenkollegs ging zuerst nur sehr langsam vor sich, aber doch mit unbeirrbarer Sicherheit. Man trumpfte mit ersten Kräften auf: aus Bonn stammte der berühmte Theologe Blissemius, der sogar bei St. Veit Vorlesungen für die höhere Geistlichkeit halten konnte. Er wurde der Hofprediger Ferdinands, des Statthalters. Man lockte den Adel mit einem Alumnat für junge Edelleute, man lockte den gemeinen Mann mit einem Alumnat für arme Studierende. Man predigte, dichtete, schauspielerte in der Volkssprache, schuf Überlieferungen, die auch durch den Wandel der Dinge, wie ihn die Schlacht am Weißen Berge im Gefolge hatte, keineswegs unterbrochen wurden. Man fügte sich überhaupt den örtlichen Gepflogenheiten bewundernswert ein. Auch der große Kirchenbau, der bald ins Werk gesetzt werden sollte, wurde in der Bauüberlieferung des Landes, für das gebaut wurde, begonnen (s. u.). Man gewann Boden und Macht und erfreute sich der hohen Gunst des inzwischen Kaiser gewordenen Ferdinand.
Der zweite Schritt des restaurierenden Herrschers war die Wiederbesetzung des seit 1421 verwaisten Erzbistums. Im Jahre 1561 konfirmierte der Papst Pius IV. den von Ferdinand vorgeschlagenen Anton Brus von Müglitz, den seinerzeitigen Sprecher auf dem Tridentiner Konzil. Sein Wiener Bistum sollte er neben dem Prager Erzbistum beibehalten –; Habsburg! –;, auch die Großmeisterwürde seines Ordens. Ein neuer erzbischöflicher Palast wurde gleich im nächsten Jahr in Angriff genommen. Bonifaz Wolmut, der königliche Baumeister, erhielt den Auftrag. Dieser Palast kam nun nicht wieder unten auf der Kleinseite zu stehen, sondern oben, dicht neben der Königsburg. Man sollte sehen: Königtum und Kirche sind nun verbündete Mächte.
Gegen die Utraquisten unten im Teyn, im Konsistorium? Nein! Der neue Erzbischof reist zum wiedereröffneten Tridentinum, um dort, nun von Bayern unterstützt, für die Gewährung des Laienkelches an die Utraquisten persönlich zu wirken, wie auch für die Erlaubnis, als Erzbischof von Prag die utraquistischen Priester Böhmens weihen zu dürfen. Erst von Rom aus, schon nach Auflösung des Konzils, wird die Erlaubnis gegeben (1564), wieder unter dem schon in den Kompaktaten erwähnten Vorbehalt. Zehn Jahre später baut der Erzbischof die Adalbertskapelle: die alten Kräfte werden heraufgeholt!
Der Kaiser glaubt seine Sache gewonnen. Er stirbt, ehe die Schwierigkeiten aufbrechen. Die zeigen, daß die Sache des Protestantismus schon zu weit gediehen war, um durch solche Zugeständnisse Roms an die Kalixtiner noch unterbunden werden zu können. Die Utraquisten wissen im Protestantismus –; auch der Calvinismus war eingedrungen in Böhmen, hatte besonders in den Brüdergemeinden Eingang gefunden –; eine starke Rückendeckung. Sie kehren sich nicht an die Gehorsamspflicht gegenüber dem Erzbischof. Sie wollen zwar dessen Weihe für ihre Priester, bestehen aber auf selbständiger Präsentation der Kandidaten. Der Erzbischof zögert. Am neuen König, dem frei denkenden Maximilian II., hat er nicht mehr den gleichen Halt wie am Vater.
Der weitblickende Maximilian war als Prinz den Lutheranern schon fast bis zum Übertritt nahegestanden –; welche Perspektiven: ein protestantisches Habsburg! Vielleicht war es nur Tradition gewesen, was ihn damals vom letzten Schritt zurückgehalten hatte. Immerhin: gegen die Protestanten konnte er sich nicht entscheiden. Der Anspruch des Erzbischofs auf Gehorsamsleistung trieb die Neu-Utraquisten in die entgegengesetzte Richtung. Auf dem Landtag des Jahres 1567 schafften sie die Kompaktate als ungenügend ab. Nur mehr das Wort Gottes sollte künftighin bindend sein. Und der König hatte zugestimmt. Acht Jahre später vereinigten sie sich gar mit den Lutheranern und den Böhmischen Brüdern zur »Böhmischen Konfession«. Die war im wesentlichen des Inhalts wie die »Augsburger« mit stark calvinischem Einschlag, den die »Brüder« verlangten. Durch möglichst engen Anschluß an die Augustana, die in den deutschen Ländern als rechtliche Grundlage freier Religionsübung anerkannt war, würden sie –; und diese Annahme bestimmte auch die »Brüder« zu manchem Zugeständnis, ja überhaupt zum Anschluß an den Bund –; die Sicherung einer von Grund aus eigenen Religion, deren dringlichster Punkt die eigene Priesterweihe war, erreichen. Der König versprach denn auch den also Verbundenen volle Religionsfreiheit, versprach auch Eintragung der neuen Verfassung in die Landtafel, was dem geistigen Bund noch das politische Gerüst gesichert hätte. Über seinem frühen Tod unterblieb es.
So fehlte diesem Protestantenbund die legitime Verankerung im staatlichen Gefüge. Die Universität, nun ganz neu-utraquistisch und lutherisch, bekam es zu fühlen. Niemand kümmerte sich um sie. Das Konsistorium, das bisher für sie gesorgt hatte, war abgespalten, wurde von der Regierung mit altgläubigen, romfreundlichen Kalixtinern besetzt. Es suchte den neu-utraquistischen Magistern der Universität die letzten Pfründen zu rauben. So sank das Carolinum durch materielle Not immer tiefer, gerade zu der Zeit, da das entschiedene Bündnis mit den Lutheranern und den »Brüdern« einen geistigen Aufschwung hätte bringen können. Die Macht der Jesuiten aber wuchs in dieser Situation.
Jetzt drangen also auch die »Brüder« in Prag ein. Sie hatten eine gefahrvolle, aber tiefschürfende Entwicklung hinter sich. Unter Ferdinands Regierungszeit war in ihren Reihen Johann Augusta einflußreich geworden, ein kluger, ehrgeiziger Mensch. Er betrieb den Anschluß der »Unität« an die lutherische Kirche Deutschlands. Er tat es aus Ehrgeiz: er wollte auf breiterer Grundlage herrschen. Die »Brüder« hatten sich an Luther gewandt, hatten ihm ihren Katechismus zur Begutachtung übergeben. Die Verfolgungen der Gemeinden, der Übertritt vieler Brüder auf deutsches Gebiet, wo sie neue Gemeinden gründeten, schien solchem Aufgehen der Unität in der deutschen lutherischen Kirche günstig. Im Jahre 1547 war Johann Augusta ob seiner Beteiligung am Prager Ständeaufstand von Ferdinand eingekerkert worden. Sechzehn Jahre lang lag er auf Schloß Pürglitz gefangen. Immer noch kämpfend für seine Ziele, für den Anschluß an die lutherischen Utraquisten. Als dann die Unität seinem Einfluß entwunden wurde durch die Einwirkung stärkerer geistiger Kräfte, da rief er, fanatisch, rachsüchtig, zum Kampf gegen alle geistige Bildung auf, die ihm nun gefährlich wurde –; um die Massen zu gewinnen. Ein neues Tabor wollte er beschwören. Aber er versank in seinen eigenen Fanatismen. Das Brüdertum hatte sich gerade an der Versuchung durch diese Persönlichkeit geläutert, war einer Gegenströmung zugereift.
Diese Gegenströmung war von einer großen geistigen Kraft, dem Mährer Johann Blahoslaw, ausgegangen. Der, ein humanistisch gebildeter Geist, hatte in Wort und Schrift für eine sehr selbständige Vertiefung der Brüderlehre gewirkt. Er schuf den in Böhmen verfolgten »Brüdern« ein neues Zentrum im mährischen Eibenschitz (Ivanèice), von wo aus eifrige Beziehungen nach Basel und Genf gepflegt wurden. Calvin wirkte nun bestimmend auf die Unität ein. Blahoslaw sicherte der Unität die geistige Begründung für die eigene Geschichte: »Über den Ursprung der Brüderunität.« Seine »Lieder zum Lobe Gottes«, das brüderliche Gesangbuch, wurden Grundlage der schönen Kanzionale, welche die Brüder in zahlreichen Drucken verbreiteten. Als ernster Sprachforscher schuf er den »Brüdern« in der tschechischen Sprache ein sinnlich starkes Instrument. Er riß die Gemeinden von Augustas verführerischen Hetzreden zurück, hinauf in die hohe Geistigkeit, der dann das großartige Werk der »Kralitzer Bibel« entkeimen sollte, jene bedeutende Übersetzung der Heiligen Schrift ins Tschechische, Arbeit von fünfzehn Jahren, vor der selbst die Gegner in Achtung schwiegen. Wenn dann die Unität nach Blahoslaws Tod (1571) doch den Bund mit den Lutheranern und Utraquisten schloß, so konnte sie das nun ohne Gefahr für ihre geistige Selbständigkeit wagen. Sie trug ein aufrichtig durchgelebtes Geistes- und Seelengut in die Atmosphäre des Bundes.
Die religiöse Lage in der Hauptstadt vergeistigte sich unter diesem Einfluß wieder. Im Jahre 1563 war Holbeins »Totentanz« mit tschechischen Versen in Prag erschienen. Im nächsten Jahre schon mußte das Buch, dem die Schrift des Erasmus »Wie man sich auf seinen Tod vorbereiten sollte« angefügt war, zum zweitenmal aufgelegt werden. Die religiöse Besinnung durchdrang allmählich alle kirchlichen Parteien. Die Kalixtiner verbreiteten damals ihre Kanzionale und Graduale meist handschriftlich, wobei die Kunst eines Johann Taborský, eines Johann Kantor zu schönster Entfaltung kam. Das Luthertum hatte in Tobias Zazworka einen bedeutenden Kanzionalisten gefunden, die Katholiken in Johann Rosenblut. Und Thomas Baworowský, ein edler Katholik, fand damals in seiner »Tschechischen Postille« ergreifende Töne der Ermahnung und Bekehrung. Die deutsche Kirchendichtung blühte damals hauptsächlich in den Städten der Provinz. Aber auch bei den deutschen Protestanten Prags wirkte die religiöse Vertiefung ein. Später, vor der Schlacht am »Weißen Berg« waren gerade die deutschen Protestanten Prags in der Herausgabe von Streitschriften und Predigten äußerst rührig.
Aber der Jesuit Wenzel Sturm eiferte in Wort und Schrift gegen die Brüder, gegen die Protestanten überhaupt. Leidenschaftliche Gegnerschaft fraß sich ein in die allgemeine religiöse Vertiefung. Auch die hohe Kulturwelle, die nun Prag unter einem sehr geistigen Herrscher überspülen sollte, vermochte den Ausbruch der Feindschaften, der Katastrophe nicht zu verhindern, vermochte nur um einige Dezennien sie zu verschieben.
Prag war kulturell gerüstet für eine große Zeit. Unter Ferdinands kluger, unter Maximilians toleranter Herrschaft hatten sich die Wirtschaft und über ihr die Bildung ansehnlich festigen können. Für ihre Vertiefung sorgte das unter protestantischem Einfluß zur Blüte gebrachte Schulwesen, für das die neuerwachte Karlsuniversität genaue Vorschriften ausgearbeitet hatte. Die nationalen Gegensätze hatten unter dem Einsickern humanistischer Weltbildung und unter gemeinsamen Zielen des Protestantismus ihre Schroffheit verloren. Renaissanceleben keimte überall auf, schuf Lebensfreude und weltoffene Stimmung. Nicht nur in Adelskreisen, auch in Bürgerwohnungen finden wir nun Bibliotheken und wertvolle Kleinkunst. Erklangen in dieser zweiten Jahrhunderthälfte auch immer häufiger Mahnrufe der Moralisten, sowohl von protestantischer wie von katholischer Seite, so brauchen wir doch keineswegs auf Leichtsinn und Völlerei als Grundstimmung in Prag zu schließen.
Religiöse Stimmung blieb tiefere Folie aller Lebenslust, wie die ausreifende Renaissance sie auftreiben ließ. Der kirchliche Dualismus wirkte diese kurze, glückliche Spanne lang eher aneifernd als zerstörend: die gegnerischen Parteien wurden zu schönster Kraftentfaltung gesteigert. Die Liederbücher der Protestanten, durch die Schätze der böhmischen Brüder um Edles bereichert, und die Kanzionale der Katholiken reden deutlich von dem vertieften Gemeindeleben dieser Jahre. Für Aufnahme der neuen künstlerischen Impulse, soweit sie in der Musik zum Ausdruck kamen, ins kirchliche Leben sorgten vor allem die Literatenchöre. Sie waren Vereinigungen sangeskundiger Männer, die sich aus Laienkreisen zusammenfanden, um den neuen Figuralgesang, der damals den homophonen Choralgesang verdrängte, im Dienste der Kirchen zu pflegen. Den deutschen Kalandbrüderschaften vergleichbar, vertraten sie hier, im kirchlichen Prag, den weltlichen Meistergesang deutscher Städte. Sie waren zunftmäßig privilegiert und von tüchtigen Kantoren geschult. Sowohl von Protestanten wie von Katholiken wurden sie gepflegt. Jene sangen tschechisch, diese lateinisch. Der Chor von St. Veit war vor allen andern berühmt. An diesen Chören konnte die Musikkultur einsetzen, die um die Jahrhundertwende dann die Stadt durchschwingt.
So bedurfte es nur einer politischen Konstellation, die diese Stadt europäischer Provinz ins Zentrum rückte, um das Eindringen einer Kultur von europäischem Format auf solch aufgelockertem Boden zu bewirken. Diese Konstellation schuf Rudolf II. Im Jahre 1572 –; zwanzigjährig –; wird er zum König von Ungarn gekrönt, im Jahre 1575 zum König von Böhmen und im gleichen Jahre wird er deutscher König. 1576 stirbt sein Vater Maximilian. Rudolf regiert. Er wählte Prag zu seiner ständigen Residenz. Unter dem Stern und Unstern dieser merkwürdigen Persönlichkeit steht die Blüte Prags um 1600.
Das Bild dieses Herrschers wird meist unter politischem Horizont gesehen. Da fallen nur Schatten auf das müde Antlitz. Die Geistesgeschichte muß ihn aus der ihm gemäßen Atmosphäre heraus begreifen. Die war nicht Politik und Tat –; sie war schwerblütige Besinnung und war Flucht. In Rudolf verkörpert sich schon die Reaktion der Zeit auf den tatenfreudigen Geistesfrühling der ersten Humanistengenerationen. Aber doch nicht bewußte Reaktion –; nur erst Schwebe auf dem Scheitel einer Zeitenwoge, die aus Renaissancezaubern anbrandet, prunkvoll und schwer, beladen mit neu entdecktem Wissen –; und doch verarmt um die volle Sicherheit der Religion, ja, der Instinkte. Diese Woge, die in dunklen Kräften sich aufbäumt, die aber jene Auflösung in den Taumel, ins herrliche Sichzerstürzen der Gefühle noch nicht wagt, wie es im Barock dann ein taumelndes Lebensgefälle zum Stil bannt. Auf solcher Schwebe packt den bewußten Geist ein plötzliches Schaudern. Er flieht in den Strudel der Gegensätze, eine Einheit sich vorzutäuschen, und kann sie doch nirgends mehr glauben. Das elisabethinische England, das mediceische Paris sind in manchem die Parallelen zum Prag Rudolfs II. Unterschiede ergaben sich einmal aus der gewitternden Atmosphäre Prags, dann aus der beladenen, ja belasteten Persönlichkeit des Kaisers.
Er war im philippinischen Spanien erzogen worden, in der Luft, die den Escorial hervortreiben sollte: in welcher der dumpfe Druck einer Weltmacht um wildernde Seelenkräfte die starren Mauern strengsten Zeremoniells, härtester Exerzitien –; fanatische Orthodoxien beide –; aufgerichtet hatte. Das mußte den jungen Geist umschatten. Wäre Schöpferisches in ihm gewesen, es hätte in glühenden Glaubensfanatismus ausschlagen müssen wie bei dem in seiner Art großen Philipp II. Oder aber in grausamen Despotismus. So aber verbrannte dieser Geist in sich selbst. Grausame Skepsis bohrte in dunkle Rätsel hinunter. Sinnlos war dieses verworrene Geschehen der Erde und ihrer Länder –; den Sternen muß sich ein Sinn entreißen lassen. Formlos, ungestaltet, chaotisch drängte das natürliche Dasein an –; die Kunst, das Gebilde, die Figur muß die Form bringen. Brutal, roh, gemein wälzte sich das Leben in seinen Trieben, in Auswüchsen und in Launen hin –; tatenlos sinnend mußte es sich bannen lassen. So hat sich dieser grüblerische und verzweifelte Geist eine geheimnisschwere Gegenwelt gebaut gegen alles Natürliche, eine düstre, schweigende Schemenwelt blutloser Begriffe. Aber seine Kraft reichte nicht aus, sie zu halten. Und das Leben rächte sich an diesem Empörer: es unterschob den klug errichteten Pfeilern dieser Geisteswelt seine Dämonien, bis jenes fanatische Streben nach Sinngebung in wüste Sinnlosigkeit umschlug. Raub der Abenteurer und Scharlatane –; bis jene Anbetung geklärter Form in jämmerliche Anhäufung von Idolen sich verkehrte, schon im Erwerb seiner Kunstschätze und später dann im Zerfall die Fratze der Unform lockte –; bis alle Besinnung in dumpfer Melancholie ertrank und die Wirklichkeit über sie zusammenstürzte.
Hätte er in privater Sphäre untersinken dürfen, dieser verzweifelte Geist –; er wäre ein Sonderling mehr gewesen in dieser an Sonderlingen reichen Zeit. So aber trieb die Last einer Krone seine Neigungen ins Gigantische, ins Absurde, an dem er zerbrach. Die Sterne hatten diesen Geist zum Herrscher über ein großes Reich bestellt, zum Täter. Er aber war Dulder, Erleider all jener dunklen Mächte, die gerade damals aus dem sich lockernden Geistesbau der Kirche hervordrangen, frei schweifend die wirkenden Kräfte der Renaissance allüberall teuflisch versuchten. In ihm rasten sie sich aus. So wurde er vielleicht, indem er Opfer ward, doch Retter dieser Renaissance. In seinem Untergang läuterte sich ein tieferes Ahnen, das dann in der Mystik des hohen Barock so eindrucksvoll wieder erstehen sollte.
Als Vierundzwanzigjähriger war Rudolf nach Prag gekommen, hatte gespürt, daß hier die Landschaft seiner Seele wartet. Die burgumhütete, strombedrängte Stadt des Mittelalters, der schwere Himmel darüber. Die stolze Form der karolinischen Epoche, die gegen dumpfe Unform des Ostens sich spannte. Die vielhundert Kirchen und Kapellen, unter denen noch immer die heimlichen Fanatismen lauerten –; Dunstkreis alchimistischer Spekulationen, der schon ein Jahrhundert hindurch hier in manchen Palästen, in einigen Bürgerhäusern schwelte. Dieses schicksalsträchtige Gemäuer, das die Nächte um Sinn fragte. Hier schlug der junge Herrscher seine Residenz auf. Und was er als seine Schicksalsstätte erkannt hatte, dem sollte er nun wieder zum Schicksal werden.
Nicht daß er aktiv wie der andere hier residierende Kaiser, der große Karl, auf Prag eingewirkt hätte. Er war weder Organisator noch auch nur ein Liebender. Er war passiv, er ließ geschehen. Nicht sein Wirken bildete um ihn die Schichten, es setzten sich Kreise an um sein Warten. Aber diese Kreise entsprachen seiner Art und Erscheinung so sehr, wie nur irgend welche Wirkungsschichten dem Geist eines Täters. So trägt diese Epoche doch mit Recht seinen Namen. Wir verstehen sie nur aus der Kenntnis des Pols heraus, um den sie sich dreht.
Was an Entschlußlosigkeit und Tatenscheu den Geist des Herrschers beschwerte, das staute sich als Erwartung vor den Portalen der Burg, in den Palästen der Kleinseite, in den Gassen Prags. Hier drängten sich die Gesandtschaften der ganzen Welt. Abenteurer strömten herbei, um bei dem neuen »Hermes trismegistos« Gehör und offene Hand zu finden; Müßige wollten Lust und Kurzweil des Hofes genießen, Kaufleute nutzten die neuen Möglichkeiten des stark anwachsenden Marktes.
In den ersten Jahren seiner Regierung versuchte Rudolf noch, seiner grausamen Skepsis mit wilden Illusionen zu antworten. Da wurden Feste voll Pracht und Groteske auf der Burg gefeiert, in denen der europäische Adel die Schauspiele der Hofkünstler bewunderte. Die Hofkapelle war die erlesenste der Welt: im klaren Maß der Musik winkte Vergessen den bohrenden Fragen des Geistes. Niederländische Tonkunst strahlte damals noch hieher aus. Berühmte Niederländer saßen in der Kapelle: Jakob Regnard, Wilhelm von Mülen, Hans Lemmens, Karl Luyton, Lambert de Sayve, Philipp de Monte. Daneben Italiener, vor allem aber Deutsche. Da waren die beiden Hasler aus Nürnberg, dem Joachimsthaler Geschlecht entsprossen, Hans Leo nicht ständig, wurde aber als der bedeutendste Tonsetzer seiner Zeit doch als Mitglied der Kapelle geführt. Da wurde in modernstem Stil komponiert, meist zu deutschen Texten. Die Offizin Nigrin druckte die Musikalien. Regnard gab: »Newe kurzweilige teutsche Lieder« heraus (1580), später Turini: »Neue liebliche deutsche Lieder« (1590).
Das Musikleben des Hofes wirkte in die Stadt hinein. Instrumentenbauer siedelten sich in Prag an. Der Krainer Jakob Gallus, der »Deutsche Palestrina«, war Kantor an der Kirche St. Johann an der Furt. Er ließ mehrere große geistliche Tonwerke mit kaiserlichem Privilegium drucken. Sänger, Geiger, Harfenschläger, viele Deutsche lassen sich in Prag nieder. Die Organisten Wenzel Rychnovsky und Valerius Otto (aus Leipzig) werden genannt. Musikkultur großen Stils bewegt die Zeit. Das »Collegium musicum«, welches später, erst nach Rudolfs Tod, hier gegründet wurde –; seine Statuten sind in deutscher Sprache abgefaßt –; ruht auf dieser durch Rudolf angelockten Bewegung.
Musik strahlt aus in die hohe Gesellschaft. Christoph Harant von Polžic setzte seine sechsstimmigen Motetten. Aus dem tschechischen Volk antworteten dieser hochgetriebenen Musikkultur die alten und neuen Weisen zum Dudelsack. Ein gewisser Wenzalek ist als Lautenspieler berühmt. Auf den Bällen wird nun die Galliarde gepflegt. Die Prager Judenkapelle gilt als die beste Tanzmusik. In all seinen Schichten ist das Prag dieser Tage durchpulst von Musik.
Der Prager Boden war für solche Musikkultur vorbestimmt gemäß den Anlagen des heimischen Volkes. Und doch möchte man die klare Entwicklung des musikalischen Lebens in diesen Jahrzehnten mit der Gestalt des Kaisers tiefer verflochten sehen. Musik löste sein Wesen. Noch in seinen letzten Jahren, als dieser Geist schon umdüstert war, konnte Musik ihn tief berühren. Sie war ihm Entspannung, war auch Berauschung, immer wohl außerhalb der Spannung von Natur und Kunst, von Form und Unform. Ruhig strömte sie aus ihm hinüber in sein Zeitalter.
Anders die bildende Kunst. Sie war ihm allzu bewußtes Erzwingen der Form, war ihm Bollwerk gegen das Chaos draußen. Bezeichnend, daß die Nachwelt in ihm gar nicht den Künstler, kaum den Mäzen sieht, der so viele Hofmaler anstellte, ihre Staffeleien nicht aus dem Auge läßt, sondern vor allem den Sammler, den fanatischen Häufer geformter Wirklichkeit. Mag sein, daß ihn in jungen Jahren ein echtes Verhältnis zur Malerei begeisterte. Bestimmte Vorlieben, wie die für Dürer und für den älteren Brueghel, scheinen dafür zu sprechen. Wenn auch gerade diese Vorliebe für Dürer mit »hermetischen« Spekulationen zusammenhängen konnte, die er bei dem Nürnberger Meister früh herausgespürt haben mag. Seine spätere Sammelwut scheint doch mehr dem Geformten als Selbstwert denn dem eigentlichen Kunstsinn nachgegangen zu sein. Dabei zersplittert diese Sehnsucht nach Form immer mehr in Begier nach Kuriositäten. Tribut an das Zeitalter hat zweifellos eingewirkt: Sammeln war Losung geworden in der bildungshungrigen Renaissance Europas, Sammeln von allem und jedem. Das »Wie« ist aber doch tiefer in der Wesensentwicklung des Kaisers zu begründen: der Formfanatismus überschlägt sich, wird Lust am Absurden. Und auf diesem fast diabolischen Weg über das Widernatürliche gelangt er zuletzt doch wieder zum Natürlichen zurück, zu einem Natürlichen allerdings von größtem Ausmaß. (Wobei unter Größe Quantität und Qualität als Wechselbegriffe gefaßt sind.) Und hier setzen dann die verschiedenartigsten naturwissenschaftlichen Spekulationen den weiteren Kreis an, den geheimnisvollsten, der in der Alchimie sich schließt.
Sehen wir uns diese berühmte Kunst- und Schatzkammer genauer an. Welche Grundsätze walteten bei der Zusammenbringung dieser Dürer, Tizian, Correggio, Brueghel, dieser prächtigen Antiken und der unzähligen Münzen, der Schweinslederbände und der köstlichen Schnitzereien? Keine! Häufung um jeden Preis. Die Kabinette, die Säle werden vollgehängt, vollgestellt. Nirgends Einordnung, nirgends Rücksicht auf besondere Werte. War ein Saal gefüllt, so wurde im nächsten weitergehängt. Zu Festlichkeiten wurden die Räume nicht mehr benötigt. Auch der spanische Saal nicht mehr, der doch eben erst –; im Jahre 1601 –; von Horatio Fontana de Brussato für große Feiern am Nordrand der Burg erbaut worden war. Die Überfülle des Geformten schlug schon wieder in Unform um. Ja, war es die Lust dieses unheimlichen Dialektikers, Form in ihr Übermaß zu treiben, bis sie wieder Unform wurde? Oder seine Tragik? Selbstauflösung aller Form –; satanische Lust. Wie er es ja umgekehrt liebte, aus Zufälligkeiten sinnvolle Formen zu erzwingen, wenn er zum Beispiel geschliffene Halbedelsteine entsprechend ihrer Maserung zusammensetzen ließ, daß auf glitzernden Tischplatten Landschaften, Figuren, harmonische Gebilde erstanden. Wenn er Savery, seinen Hofmaler, nach Tirol schickt, um groteske Bergformationen einzufangen. Wenn er von den Welser und Hochstetter in Augsburg seltsame Tiere und Pflanzen, die aus Venezuela herübergebracht worden waren, sich schicken läßt für seine Wundergärten im Hirschgraben.
Rausch der bezwungenen Masse –; das bietet sich zuletzt als Formel für die Sammlereinstellung dieses Monarchen an. So sehr in alldem auch immer Zeitgeschmack einwirkte, bei Rudolf kommt es zu fast schauerlicher Zuspitzung. Wenn andere so sammeln konnten –; er mußte so sammeln.
Ein Jahr nach seinem Regierungsantritt hatte er den unter Maximilian in Wien als Verwahrer der Kunstkammer angestellten Jacopo Strada, einen gebürtigen Mantuaner, nach Prag berufen (1577). Dieser Strada war ein großer Gelehrter in Münzenkunde, hatte verschiedene Bücher darüber veröffentlicht, hatte mit Münzen gehandelt, war aber auch schon als schaffender Künstler aufgetreten. An der neuen Residenz des bayrischen Herzogs hatte er gearbeitet. Jetzt ward er den gesamten Sammlungen des Kaisers vorgesetzt. Das Sammeln wird organisiert, nicht aber die Sammlung. In allen größeren Kunstorten Europas sitzen die Agenten des Kaisers, um Kunstwerke auszuspähen, nach Möglichkeit zu erwerben. Politik wird mit dem Sammeleifer verknüpft. Der Stadt Nürnberg wird nahegelegt, dem Kaiser das Allerheiligenbild Dürers zu überlassen. Lange gehen die Verhandlungen hin und her. Nürnberg will nicht, kann sich jedoch dem dringlich ausgesprochenen Wunsch des Kaisers nicht auf die Dauer verschließen. Vielleicht kann man für jetzt oder später hohe kaiserliche Gunst mit solcher Überlassung erkaufen! Im Jahre 1585 wanderte das Bild nach Prag. Rudolf empfängt es mit größter Anteilnahme. Noch einmal scheint Nürnberg Dürerbilder überlassen zu haben: die Tafeln mit Adam und Eva, vielleicht auch den St. Veiter Altar mit der »Kreuztragung«, die Carel van Mander erwähnt. Gegenüber den kaiserlichen Wünschen nach dem »Paumgärtneraltar« und den »Aposteltafeln« blieb es standhaft –; um beide später dem listigen bayrischen Maximilian überlassen zu müssen. Breslau sandte dem Kaiser die »Herodias« des älteren Cranach. Der Kurfürst Christian II. schenkte dem Kaiser die Dürersche »Anbetung der heiligen drei Könige« aus der Allerheiligenkirche in Wittenberg. (Dieses Prachtwerk ist dann später, 1792, auf dem Weg über Wien als Tauschobjekt gegen einen Fra Bartolomeo nach Florenz gekommen.)
Man kannte die Vorliebe des Kaisers für Dürers Werk. Wo man nicht schenken konnte, nicht schenken wollte, bot man zum Kauf an. Jahrelange Verhandlungen gingen um eine Kollektion von dreiunddreißig Bildern, unter denen die Dürersche »Marter der Zehntausend« war –; Nachlaßgut des Kardinals Granvelle, um das des Kaisers Gesandter Khevenhüller in Madrid mit dem Don Francisco de Granvela, Grafen von Contecroy, für 13.000 Taler handelseinig wurde. Die Fugger in Augsburg, die großen Bankiers des kaiserlichen Hofes, die in Prag ihre ständigen Agenten hatten, mußten den Scheck, zahlbar auf der Frankfurter Messe, ausschreiben. Die Staatskassen bluteten. Aus Granvelles Nachlaß waren auch die schönsten Dürerzeichnungen in kaiserlichen Besitz gelangt, auch solche, die der Imhoffschen Kunstkammer entstammen dürften. Und von dem geliebten Pieter Brueghel dem Älteren läßt er sich kopieren, was er nicht im Original erhalten kann. Pieter der Jüngere und Johann übernehmen das Kopiergeschäft. Johann Brueghel hält sich 1604 selbst in Prag auf. Es wird fieberhaft gesammelt, als gälte es, die ganze Welt im Abbild zu erbeuten.
Um das Dürersche »Rosenkranzfest«-Bild, das die deutschen Kaufleute in Venedig über ihren Altar in San Bartolomeo im Jahre 1506 gestiftet hatten, sei Hans von Aachen, der Hofmaler, nach Venedig geschickt worden. Nach anderer Annahme ist dem Maler Johann Rottenhammer die Erwerbung geglückt. Gegen hohe Summen und eine gute Kopie (Rottenhammer?) wurde das Bild dem Kaiser überlassen, wurde, an Stangen hängend, damit es nicht beschädigt würde, von starken Männern über die Alpen bis auf den Hradschin getragen (1601).
Carel van Mander, der niederländische Maler und Schriftsteller, sah all diese Schätze, als er zwischen 1601 und 1603 den Hradschin besuchte und vom Hofmaler Bartholomäus Spranger durch die verschlossenen Säle geführt wurde. Sah auch den »Ilioneus«, die Statue aus der Niobidengruppe, die Hans von Aachen, durch Zufall bei einem römischen Antiquar entdeckt, um 22.000 Dukaten für den Kaiser erstanden hatte. Sah die Tausende von geschnittenen Steinen, denen sich Rudolfs Vorliebe immer mehr zuwandte, sah Meisterwerke und Raritäten und Schwindel und abstoßende Kuriositäten bunt durcheinander gehängt, gelegt, gestaffelt. Unter italienischen Meistern an den Wänden verzeichnet ein Inventar dieser Jahre, das in der Handschriftensammlung der Wiener Nationalbibliothek verwahrt wird, »in der Almer Nr. 6 in den zwei oberen Fächern allerlei seltsame Meerfische, darunter eine Fledermaus, eine Schachtel mit vier Donnersteinen, zwei Schachteln mit Magnetsteinen, und zwei eiserne Nägel, sollen von der Arche Noah sein, ein Stein der da wächst, vom Herrn von Rosenberg, zwei Kugeln von einer siebenbürgischen Stute, eine Schachtel mit Alraunwurzel, ein Krokodil in einem Futteral, ein Monstrum mit zwei Köpfen usw.«. Dies Inventar war zu der Zeit gefertigt worden, da schon Miseroni, der »ökonomische Schatzverwalter«, der seit 1590 dort oben im Amte saß, die Oberaufsicht führte. Der alte Strada war gestorben. Als künstlerischer Verwalter war ihm sein Sohn Octavio nachgefolgt. Die Stradas und vor allem die Miseroni standen der Kunstkammer dann durch Generationen hindurch vor, auch noch als der Gründer schon längst gestorben war. Noch der schwedische General Königsmarck trifft bei seiner Plünderung der Burg im Jahre 1648 einen Miseroni als Verwalter an.
Doch zurück zur rudolfinischen Zeit. Kunstinteresse ging da mit Formenneugier verschiedenster Art ein merkwürdiges Bündnis ein. Monströses aller Gattungen drohte den schönen Kern fast zu überwuchern. Und einigermaßen monströs wirkte sich diese »Kunst- und Schatzkammer« auch auf Prag aus. Da kamen die Händler aus aller Welt, boten ihre Wunder an, feilschten, betrogen, wurden betrogen. Bestechung, Korruption sorgte für Zulassung bei Hofe. Berüchtigte Kammerdiener beginnen ihre gemeinen Rollen zu spielen. Schon setzte der Zerfall dieses unorganischen Konglomerats ein, in das kein Sterblicher außer dem Kaiser und seinen nächsten Vertrauten den Fuß setzen durfte. Drunten in der Stadt kreisten die Schauergerüchte über die geheimen, dort oben gehäuften Schätze. Ja, nur als ein solches Stimmungsmoment wirkte Rudolfs Sammeltätigkeit auf das Prager Leben ein. Und vielleicht als Vorbild, das von dem einen oder andern Adeligen, den Pernstein und Rosenberg und Lobkowitz und Neuhaus, auch von reichen Bürgern nachgeahmt wurde. Schöpferischen Kulturwert strahlte sie nicht aus.
Und die lebende Hofkunst? Da waren immer mehr Künstler vom Kaiser berufen worden, teils vom Wiener Hof her, wohin schon Maximilian II. sich Schüler des berühmten Giovanni da Bologna verschrieben hatte, teils aus München, aus Augsburg, aus den Niederlanden, aus Italien. Ein internationaler Kreis hatte sich so zusammengefunden, die Flamen überwogen.
Waren nicht alle Vorbedingungen gegeben, um hier in Prag eine europäische Richtung wo nicht zu begründen, so doch zu stärken und schöpferisch weiterzupflanzen? Dem aber widersprach die Zeit. Die gärte im Übergang. Die große Überlieferung der Michelangelo und Rafael bannte die Geister. Niederländer hatten den Romanismus ins kräftige flämische Erdreich verpflanzt. Während in Italien einem Tintoretto der gewaltige Durchbruch zur Ekstase gelang, wühlte im Norden der Kampf um die große menschliche Gestalt und zugleich um Sättigung der großen Form mit Leben und Erde. Einer aus dem Norden, Jan von Douai, hatte in Italien eine betörende Klarheit für seine Plastik gefunden, als Giovanni da Bologna begeisterte er die Zeit mit seinem Können, mit seiner so sicheren, virtuosen Form. Für ihn war der Bann der großen Toten gebrochen. Sein Schülerkreis kündete die neue Lehre in Europa. Ein Hans de Monte, gebürtig aus Gent, ein Bartholomäus Spranger aus Antwerpen kamen an den Wiener Hof, dann nach Prag. Um 1590 übt Spranger hier schon starke Wirkung. Später trifft ein weiterer Bolognaschüler zu ihnen, Adriaen de Vries, der Bildhauer. In der Bildhauerei setzt die neue Lehre glücklicher an als in der Malerei. Ein Spranger müht sich noch immer um die kraftvolle Menschenfigur. Seine Zeichnung holt immer neue Bewegungsmotive aus dem Körper heraus, verbindet und verknäult sie zu kunstreicher Komposition, bis aus dem Muskelwerk brodelnde Schnörkel werden, aus der heftigen Bewegung manchmal verrenkte Geste.
Man wollte die Einzelfigur, das große Vermächtnis der Renaissance, einflechten ins Universum, das man schon spürte. Aber diese Einbindung gelang noch nicht. Der übergreifende Wille war noch zu schwach, die Zeit –; in gleichen Problemen hangend –; speiste noch nicht mit der überschäumenden Kraft, die einen vollen Barock hätte gebären können. Wollte sich ihr auch noch gar nicht ergeben. Man liebte ja diese Durchdringungen von Gefühlen, die bei Schwächeren notwendig zu Halbgefühlen herabsinken mußten. Da zerfaserten die Leidenschaften zu erotischem Geplänkel. Man umgarnte sich mit schwebenden Gaukeleien, in die man gern ein Stückchen derbe Wirklichkeit mischte.
Ein Jahrzehnt später tauchte Hans von Aachen, in Köln geboren, aus München hieher berufen in Prag auf, der greift solche Szenen heraus, gibt Genre und kleinen Reiz, wagt sich daneben auch ans große Altarbild, wo er dann aber gleich wieder in mattes Epigonentum absinkt. Farbig ist Spranger der Interessantere, so wenig uns Heutigen seine oft recht süßlichen Zusammenstellungen bläulicher, grünlicher und rosa Halbtöne auch gefallen mögen. Er trägt doch vieles zusammen, worauf stärkere Generationen später aufbauen können. Und seiner Zeit, besonders der Prager Atmosphäre, verleiht er doch den sinnenfälligsten Ausdruck. Mußte im Prag dieser Tage, im Prag Rudolfs II. nicht solche überreizte Formkultur, ein »Manierismus« gedeihen?
Der Anregungen werden hier fast zu viele aufgenommen. Hans Hofman aus Nürnberg und Daniel Fröschle aus Augsburg versuchen sich in neuer Zusammenstellung Dürerscher Motive. Joseph Heinz, ein gebürtiger Schweizer, verlegt nun ebenfalls seine Tätigkeit von München und Augsburg hierher nach Prag. Später kommt Roelandt Savery aus Courtrai, versucht eine neue Landschaftskunst, in der Begriff und Anschauung so merkwürdig durcheinandergehen. Der Kaiser sendet ihn in die Schweiz auf Jagd nach pittoresken Motiven. Aber auch böhmische Landschaft, böhmische Schlösser begegnen auf seinen Bildern. Die Miniaturisten finden am Hofe und beim Adel reiche Beschäftigung. Jeremias Günther ist hochgeschätzt. Georg Huefnagel arbeitet im Sold des Kaisers. Sein Sohn Jakob läßt sich in Prag nieder. Als Gäste weilen Johann Brueghel, der Sammetbrueghel hier, der eigene Bilder und auch Kopien nach dem großen Bauernbrueghel hinterläßt. Aus Italien scheint Giacomo da Ponte eine Zeitlang an den Prager Hof gekommen zu sein. Vredeman de Vries, der architektonische Anreger und virtuose Perspektivenmaler findet mit seinem Sohn Paul bei der Ausschmückung der neuen Säle im Nordflügel einige Jahre hindurch Beschäftigung (1597-1599). Paulus van Vianen, Stevens, der Landschafter, und Ägidius Sadeler, der Stecher, gehören zum ständigen Kreis der Hofkünstler. Als letzter tritt noch Matthäus Gundelach aus Hessen-Kassel dazu.
Die Räume der Burg füllen sich auch mit ihren Werken. Der Kaiser verfolgt die Vollendung der Aufträge, wünscht, beeinflußt, ersetzt eigene Schöpferkraft durch Teilnahme am Schaffen der Künstler. Sie sind sein vertrautester Kreis auch noch nach 1600, da die zunehmende Schwermut ihn aus dem Getriebe des Hoflebens schon verscheucht. Wie sollte in solcher Luft eine freie, zukunftsträchtige Kunst gedeihen?
Uns fesseln die Stiche der Zeit. Da konnte die Vorliebe fürs Porträt ohne viel malerische Experimente sachlich wirken. Auch anderes gelang im Stich. Wir nannten den Ägidius Sadeler. Dessen Verlegertätigkeit haben wir die schöne, auf neun Platten gestochene Ansicht von Prag zu danken, in der die Kunst des Barocks, eine Vielheit zur Einheit zusammenzuschauen, schon anhebt. Die Stadt wird als ein Schaubares begriffen, und der Künstler stellt es dar. Ein im Rhythmus des Auf und Nieder atmendes Wesen, so liegt die Hügelstadt vor uns. Philipp van den Bosche hatte die Ansicht gezeichnet, F. Wechter war der Stecher. (Siehe die eingefaltete große Ansicht von Prag!)
Und gerade diese recht problematische Künstlergeneration trifft die soziale Rangerhöhung, wie die Zeit sie hatte reifen lassen. Damals wurden in Italien, in Flandern die Akademien gestiftet. Die Erneuerung der Satzungen der Prager Malerzeche durch den Kaiser deutet auf ähnliche Bestrebungen in Prag hin. Die Hofmaler waren hier hochgeachtet, sie waren nicht zum Eintritt in die alte Zunft verpflichtet. Jetzt wurde aber auch diese mitgehoben mit der Erhöhung der »Künstler«. Und manche Hofmaler traten wieder in sie ein. Der Majestätsbrief vom 27. April 1595 erteilt der Malerzeche eine neue Gnade: ihre Betätigung soll fortan nicht mehr als Handwerk gelten, weder »Handwerk« genannt noch geschrieben werden, sondern »Malkunst«. Und über dem Malerwappen wird die Göttin Pallas Athene angebracht. Die Errungenschaft der Renaissance wurde offiziell anerkannt. Aber es geschah allzu bewußt. Welch ein Unterschied zu Person und Zeit des Stifters dieser Malerzeche, des großen Karl IV.! Der war Mäzen, und seine Meister brauchten des offiziellen Künstlertitels nicht, um Künstler zu sein.
In der Bildhauerei war eine größere Persönlichkeit am Werk: seit 1601 ist Adriaen de Vries als Hofbildhauer angestellt. Er hatte schon früher am Hofe gearbeitet. Dann hatten ihm die großen Brunnen, die er für Augsburg geschaffen hatte, viel Ruhm eingetragen. Nun zeigte er sein großes Können wieder in Prag. Nichts konnte dieser klaren, fast zu klaren Form widerstehen. Giovanni da Bologna hatte die gangbaren Wege gewiesen. Der Landsmann nutzt sie in großer Könnerschaft. Das war die Kunst, die einen Rudolf II. begeistern mußte: unerbittlich packt die Form zu, reißt auch die zuckendsten Empfindungen mit sicherem Griff in ihr kluges System. Auch ein Wallenstein mußte an solchem Gefallen finden –; er hat später seinen Palast mit Vriesschen Bildwerken geschmückt. Aber es treibt doch auch kräftige Erde in diesen Gestalten –; der Niederländer vermag sich trotz allem Manierismus nicht zu verleugnen. Und eben das mag ihn, in Bückeburg und wieder in Prag, in die merkwürdig erweichten Formen seines Spätstils getrieben haben. Viele seiner Werke wurden im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden verschleppt. Sein lebendiger Einfluß war im damaligen Prag wesentlich geworden. Um so mehr, als er auf einer bildhauerischen Tradition weiterbauen konnte, die seit Collins Kaisergrabmal im Veitsdom nicht erloschen war. Das war im Jahre 1589, bereichert um die Gestalt Maximilians II., an den Seitenflächen um die Bildnisse Karls IV., seiner Gemahlinnen, Wenzels IV., des Ladislaus Posthumus und Georgs von Podìbrad, umgeben vom prunkvollen Gitter aus der Werkstatt des Hofschlossers Jörg Schmidthammer, endgültig aufgestellt worden.
Der Einfluß der Nürnberger Gießhütte ging mit der holländischen Kunstströmung eine Zeitlang parallel: in vielen kleineren Arbeiten, in den zahlreichen Grabsteinen und Epitaphien, in mancherlei erzählenden Reliefs schob sich die Freude der Zeit an skulpturalem Ausdruck weiter. Auch in Prag wurden damals größere Kunstbrunnen aufgestellt. Krocin hatte einen Figurenbrunnen für den Altstädter Ring gestiftet: schräg vor dem Krennhaus im Nordwesteck des Platzes kam er zur Aufstellung (1591-1593). Der Obersthofmeister Popel von Lobkowitz bestellt für seinen Garten vor dem Hradschinpalast bei Benedikt Wurzelbauer in Nürnberg eine Fontäne mit der Gruppe von Venus und Amor aus Bronze (1599). Der singende Brunnen vor dem Belvedereschloß blieb doch das schönste unter diesen Werken. Ein Italiener Francesco Terzio hatte das Wachsmodell geliefert, nach dem Hermann Peisser das Holzmodell für den Guß schnitzte. Der berühmte Prager Gießer Tomaš Jaroš besorgte den Guß und Antonio Brocco de Cambio und Anton Hofbrucker hatten das Werk ziseliert und aufgestellt (1567).

Rudolf II.
Kupferstich von P. van Sompel nach P. Southman 1602 (Prag, Städt. Museum)
Man erkennt aus den hier aufgeführten Namen, wie bunt die Meisterschar sich zusammensetzte, welche die Prager Kunst dieser Tage zum Werk vereinte. Erkennt, wie auch damals wieder die Einflüsse aus vielen Kunstzentren in Prag zusammenströmten. Aber all dies mußte Zierkunst bleiben, denn es fehlte die Architektur, die es wie in der karolinischen Zeit ins Monumentale hätte steigern können.
Wenig wurde damals gebaut. Auf der Burg entstand der Nordflügel am Hirschgrabenhang mit dem »Spanischen Saal«, einfach gehaltene Nutzbauten auf schwerem Rustikaquadersockel. Im Saal waren klare Proportionen verwendet worden (48 Meter lang, 24 Meter breit, 12 Meter hoch), was ihm einen reinen und festlichen Klang verleiht, auch noch heute, nachdem die ursprüngliche Ausstattung, prächtiges, wohl schweres Holzwerk der Spätrenaissance mit reichem Goldschmuck, längst neuen, recht flauen Dekorationen hat weichen müssen. Auf der Südseite war im östlichen Palastflügel die Landrechtsstube ausgebaut worden, auch am Ballhaus des Bonifaz Wolmut wurde neues Schmuckwerk angebracht. Sonst wissen wir nichts von kaiserlicher Bautätigkeit. Wie hätte dieser gehemmte Geist auch zu so positiver Äußerung wie Architektur ausholen können! Einige Bautätigkeit auf der Burg wurde von andern Bauherren angeregt. Maximilians II. Tochter Elisabeth war nach dem Tode ihres Gemahls, des französischen Königs Karl IX., auf dem Hradschin eingezogen. Sie führte endlich den Ausbau der Allerheiligenkapelle durch, die von der Parler-Hütte (Einwölbung des Chors 1386) offenbar nicht ganz vollendet worden war. Seit dem Burgbrand 1541, bei dem das Innere der Kirche völlig zerstört worden war, lag sie verödet. Jetzt wurden die Außenmauern des Schiffes hinausgerückt und das so verbreiterte Schiff bis zum Anschluß an den Wladislawschen Saalbau in gotisierenden Formen durchgeführt. Die sehr zerklüftete Burgsilhouette bekam durch diesen Ausbau hier eine gewisse Geschlossenheit. Die Königin sorgte für die prächtige Ausstattung des neuen Gotteshauses, setzte es dann durch, daß die Gebeine des heiligen Abtes und Landespatrons Prokopius aus dem alten Kloster Sasau (Sázava), das ganz in Verfall geraten war, hieher überführt wurden. An der Feier, die mit großem Gepränge begangen wurde, nahm auch der Kaiser mit dem ganzen Hofstaat teil (1585).
Die Grabstätte des hl. Adalbert vor der Westabschlußmauer des Veitschors hatte noch immer kein würdiges Gehäuse gefunden. Damals nun –; auf den Domausbau hatte man endgültig verzichtet –; ließ der Erzbischof, noch jener von Ferdinand wieder eingesetzte Anton Brus von Müglitz, eine Kapelle über ihr errichten, einen Zentralbau über ovalem, im Zehneck gebrochenem Grundriß, die Hochwände in stilgerechter Gliederung, etwas sehr akademisch. Ein italienischer Baumeister, der vorher am Belvederebau beschäftigt gewesen war, hatte ihn aufgeführt (Ulrich Austalis de Sala, 1575-1576). So stand nun das Renaissanceideal vor dem gotischen Dom, allerdings ein reichlich nüchtern ausgefallenes Ideal. Vor der großen leeren Hintergrundwand, der Abschlußwand des Chors, wirkte es doppelt nüchtern. (Beim Domausbau niedergerissen.) Wie hätte ein großer Renaissancekünstler solche Folie genutzt! In Prag war damals keiner am Werke. Man ahmte italienische Klassik nach oder –; was gesündere Instinkte verriet –;: man knüpfte an alte heimische Überlieferungen an. Beim Ausbau von Allerheiligen war das durch die Bauaufgabe geboten. Aber auch in der Aufgabenstellung ganz freie Bauten ließen nun die Gotik wieder aufleben. Dieser auch in Deutschland allgemeine Vorgang schuf in Prag einige bemerkenswerte Bauten.
Die Jesuiten bei St. Clemens (am Brückenkopf der Altstadt) waren dabei, ihr Aufbauwerk zu krönen durch einen gewaltigen Kirchenbau. Für den wachsenden Zustrom des Volkes war die überkommene Kirche zu klein geworden. 1578 schritten sie an die Errichtung ihrer Salvatorische. Sie sollte westlich der alten Kirche, vorgeschoben bis zum Gassenlauf vor der Brücke, zu stehen kommen, die über die Brücke Eintretenden gleich zu empfangen. Im Osten wurde mit dem Bau begonnen. Der große dreischiffige Chor, vier Joche tief, folgte in Konstruktion und Aufbau der gotischen Überlieferung. Nur in Einzelformen, in Fenstermaßwerk, Gesimsen, Profilen, auch im Gewölbe setzten sich »moderne« Formen durch. Die Hauptapsis im Fünf-Achtel-Schluß, über den Nebenapsiden Türme. Spitzbogige Arkaden im Innern, spitzbogige Fenster in den Seitenschiffen. In den Hochwänden aber Kreisfenster. Das breite Querhaus, das auch schon in dieser ersten Bauzeit (1578-1580) errichtet wurde, lud über die Seitenschiffe nicht aus. Im Formapparat folgte es dem Chor. Den Weiterbau unterbrach die Pest. Das Querhaus wird im Westen durch eine Notmauer abgeschlossen, das Ganze wird in Schwarz-Weiß-Malerei ausgeschmückt. Der Gottesdienst konnte hier schon abgehalten werden.
Das war also wieder eine Kirche fast wie in gotischen Zeiten, in den Proportionen nur unwesentlich verändert. Die abweichenden Einzelformen sprachen im Gesamteindruck kaum mit. Die Jesuiten wußten immer ans Gewohnte anzuknüpfen. Ihre gleichzeitigen Kirchenbauten in Deutschland folgen demselben Grundsatz.
Erst 20 Jahre später kann man am Bau weiterarbeiten. Jetzt wird das dreischiffige Langhaus angefügt, die Osttürme werden weiter hochgeführt. Die gotischen Spitzbogen der Arkaden im Innern weichen nun schon den Rundbogen, auch die Fenster werden rundbogig geschlossen und bleiben ohne Maßwerk. Man baut sehr schnell, 1601 stehen Mittelschiff und Seitenschiffe schon eingewölbt. Die Westfassade bleibt sehr einfach gegliedert, der hohe Mittelschiffabschluß wird durch segmentartige Ausladungen mit den niedrigen Seitenschiffabschlüssen zusammengefaßt. Das Innere wird ausgemalt, auch die alten Teile werden durch neue Bemalung einbezogen. In diesem Zustand finden wir die Kirche auf Sadelers Stich.
Östlich anschließend an diese Salvatorkirche entsteht ein kleiner Rundbau, der, eingeschmiegt zwischen die Ostteile der großen Jesuitenkirche und die in der Flucht etwas zurücktretende Clemenskirche, durch schöne Verhältnisse sich recht gut zu behaupten weiß. Die Italiener waren durch starke Zuwanderung –; vor allem von Bauleuten –; zu einer ansehnlichen Kolonie angewachsen. Jetzt bauten sie sich hier ihr eigenes Gotteshaus. Die Kapelle heißt noch heute die »wälsche«. Die Barockzeit hat sie durch ein prachtvoll geschwungenes Gitter noch schmiegsamer dem Gassenlauf angepaßt.
Und noch ein dritter Bau folgte damals dem beliebten Typus des Zentralbaus. Im Vorhof des Strahower Klosters wurde an der Rochuskapelle gebaut. Über ovalem, im Achteck gebrochenem Grundriß geht ein hoher schlanker Bau auf, den nordsüdlich orientierten Längsseiten sind im Vieleck gebrochene Konchen vorgesetzt, aufgehend bis zum Kranzgesims. Wieder siegt im Gerüst, in den Hauptformen der Fenster, der Gewölbe die Gotik. Nur in Einzelformen von Maßwerk, Profilen, Portalbekrönung zeigen sich auch hier die weichen Renaissanceformen. Solche Mischung der Stile, der Charaktere bringt seltene Reize in diese Bauten einer Zwischenzeit. Ein straffes und elastisches Empor wird hier mit erdkräftiger Festigkeit verbunden.
Mit dem Bau der Rochuskirche hatte man 1603 begonnen. Später folgen Umbauten älterer Kirchen: St. Thomas, Strahower Kirche (1609). Und die Protestanten errichteten ihre Gotteshäuser (s. u.). Aber auch ihnen gelingt kein entscheidender Durchbruch zum Eigenen, zu einer Form, die nordisch ausgesprochen hätte, was das Empfinden der Zeit verlangte. Und doch wäre bei den Protestanten der Antrieb gegeben gewesen: ihre ganz neuen Kultformen hätten zu neuen Bauformen treiben müssen. Es fehlte damals die ungebrochene Stoßkraft aus eigener Erde. Man war beunruhigt durch das Neue, nahm es nur erst in Teilen, ohne den Sinn im Tieferen zu verstehen. Und im eigenen Empfinden war man erschüttert. Wenn in Deutschland zu jener Zeit auch schon an einigen Orten jener Durchbruch zum ganz Eigenen gelang –; übrigens im Profanbau, kaum im Kirchenbau –;, so dank einer gesunden Kräftigung der bürgerlichen Kultur. Die fehlte im zerklüfteten Prag. Die Allerweltskultur des Kaiserhofes brachte keinen Ersatz.
Nirgends nahm wirklich große, lebendige Architektur die Werke der Bildhauerei auf. Im Gegenteil: von unten her fraßen kunstgewerbliche Zierlust und kleinlicher Bastelgeist das Schaffen an. Die Goldarbeiter waren wieder zu einer großen Zunft erstarkt. Schon Ferdinand hatte ihre Statuten erneuert. Jetzt fanden sie reichste Beschäftigung. Pokale, Kelche, Ziergeräte wurden in Massen auf den Markt gebracht. Aus Augsburg, aus Nürnberg kamen die Meister. Italien hatte in den Miseronis eine ganze Dynastie begabter Edelsteinschleifer gestellt, und der Kaiser wußte ihre Dienste zu belohnen. Aus Nordböhmen brachten die Glaskünstler ihre besten Stücke nach Prag. Die bekanntesten unter ihnen, die aus Deutschland zugewanderten Schürer, wurden von Rudolf geadelt. Bildschnitzer, Wachsbossierer, Medailleure –; sie alle nahm die jetzt hochgehende Freude an der Kleinkunst auf, sie alle hatten zu tun. Und von ihnen allen erwarb des Kaisers Schatzkammer die besten Stücke. Damals wurde der Wladislawsche Saal, der alte Prunksaal der Burg, zu einer Art Messe hergerichtet. Verkaufsstände wurden ringsum an den Wänden aufgestellt, und unter den herrlichen Gewölben –; wahrlich für andere Zwecke gefügt –; drängte sich die schau- und kauflustige Menge.
Wäre diese Lust am Kleinwerk in der Kunstsphäre geblieben, sie hätte eine Blüte des Kunstgewerbes zeitigen können, wie damals Augsburg und Nürnberg sie aufzuweisen hatten. Aber der Bastelgeist drängte sich hinein, die Freude am Mechanisieren und Komplizieren. Die kunstvollen Uhren, die Planetensysteme, die großen Globen waren die eine, die noch wissenschaftlich gehaltene Seite dieser Vorliebe.
Sie stand in Prag auf alten Traditionen. Am Altstädter Rathaus kündete von ihnen die kunstreiche astronomische Uhr. Die hatte im Jahre 1490 ein Magister Hanusch, berühmter Astronom, Magister an der Prager Universität, verfertigt. Sie zeigte die Stunden nach beiderlei Art: nach der alten böhmischen, die von Sonnenuntergang ab die Stunden zählte –; was umständliche Verschiebungen der Stundeneinteilung im Laufe des Jahres zur Folge hatte –;, und nach der neueren »deutschen« Art, die ihre Einteilung um Mittag und Mitternacht fixierte, die alte Vierundzwanzigzahl in zweimal zwölf teilte. Auch Tag und Monat und Jahr, selbst das Schaltjahr zeigte diese Uhr, dann Aufgang und Untergang der Sonne, des Mondes, dessen Ab- und Zunahme und die Finsternisse. Ja, auch den Lauf aller Planeten, die »goldene Zahl«, die Sonn- und Mondzirkel und alle größeren Festtage des Jahres. Vor jedem Stundenschlag tritt die Figur des Todes heraus und läutet. Solange der Verfertiger über sie wachte, lief der komplizierte Mechanismus vorzüglich. Unter sachunkundigen Wärtern hat sie später gelitten. Im Jahre 1552 mußte sie Johann Taborský, den wir oben als berühmten Kanzionaleschreiber kennenlernten (sein großes Kanzionale der Kleinseitner St.-Niklas-Kirche wird im Stadtarchiv verwahrt), wiederherstellen. Er war durch astronomische Studien, die er in seiner Jugend betrieben hatte, dazu befähigt. Nach ihm verfiel das Werk wieder. Im Jahre 1629 ließ es der Stadtrat nochmals reparieren. Dann aber verfiel es immer mehr. Im Jahre 1787 sollten die Räder der Uhr schon als altes Eisen verkauft werden. Ihre Erhaltung ist dem Eintreten zweier kulturbewußter Männer zu danken: des ehemaligen Ratsherrn Franz Fischer und des königlichen Astronomen Doktor Anton Strnad, unter dessen Anleitung der Uhrmacher Johann Landesberger das ganze Werk wieder instand setzte. Noch heute schaut das Volk dem läutenden Tod zu.
Die andere Seite dieser Lust am Mechanischen glitt ab ins Seltsam-Absonderliche, Skurrile. Und wir erkennen, daß wir diese ganze Lust am Handwerksmäßig-sich-Betätigen wieder auf eine Grundnote des kaiserlichen Charakters beziehen müssen: auf seine Sehnsucht, in peinlichster Handarbeit dem zersetzenden Bohren des Gedankens zu begegnen. Tagelang konnte er in verschlossenen Zimmern sitzen, sich an Schnitzwerk aller Art zu üben, an Steinschneiderei und wertloserem Gebastel, während draußen die Diplomaten Europas vergeblich auf Audienzen warteten.
Ja, diese ganze Bastelfreude der Zeit ist nur zu verstehen als Gegenpol jener Spekulierwut und Phantastik, die in oft zweckloser Betätigungssucht ans Konkrete sich zu binden suchte. Damit stoßen wir in den Kernpunkt des rudolfinischen Lebens hinunter, in den Abgrund dieser Seele und dieser Epoche. In den oberen Schichten treffen wir noch die höchste Wissenschaft der Zeit. Humanistischer Geist hatte in Prag schon Traditionen geschaffen, die Rudolf II. berühren mußten. Thomas Mitis hatte des Bohuslaw von Lobkowitz »Locubrationes« herausgegeben (1563) und den »Farrago poematum« (1570). Die dem Humanismus so teure Geschichtsschreibung betrieben, von Rudolf gefördert, Johann Pistorius und der Schweizer Franz Guillemann. Zur Dichtung erhob sich diese Zeit, die vom Kleinen gebannt war und im Schwulst ein Gegengewicht suchte, kaum.
Viel wesentlicher für den Wissenschaftsbetrieb in Prag wurde es, daß durch die Vorlieben des Kaisers das naturwissenschaftliche Interesse der Renaissance wirklich vertieft wurde. Der Boden für naturwissenschaftliche Spekulationen war in Prag durch bedeutende medizinische Traditionen gegeben, die eben jetzt wieder Thaddäus Hájek erneuerte. Er wurde auch des Kaisers Leibarzt. Er war es dann, der den berühmten Anatomen Jessenius aus Jena nach Prag holte. Dieser Jessenius, aus einer in der ungarischen Slowakei ansässigen Familie, war in Breslau aufgewachsen. Er hatte dann an deutschen Universitäten studiert, hatte dort schon seinen Ruhm begründet. Jetzt führte er in Prag seine berühmten Versuche aus. Im Rezekschen Kolleg sezierte er im Jahre 1601 einen männlichen Leichnam. Die große Gesellschaft Prags schaute bewundernd zu. Einige Jahre später konnte er auch die Sezierung einer weiblichen Leiche durchführen. Die Geistlichen schauten scheel. Der Bann war aber doch gebrochen: die Forschung triumphierte.
Schon vor ihm war ein anderer bedeutender Forscher nach Prag gekommen: Hájek hatte die Berufung Tycho de Brahes, des großen dänischen Astronomen, beim Kaiser veranlaßt. Tycho hatte, begünstigt vom Dänenkönig, auf seiner Insel Hveen in der großartigen Anlage seiner Sternwarte ein »Wunder Europas« errichtet. Intrigen hatten die Gnade des Königs untergraben, er mußte fort. Rudolf hatte ihm ein neues Asyl in Prag versprechen lassen. Aber hier hatte ihn eine schüttere Atmosphäre empfangen, schwankend zwischen Wissenschaftlichkeit und dumpfer Spekulation. Hofschranzen erschwerten entscheidende Taten. Die Persönlichkeit Tychos, die zwischen leidenschaftlicher Menschlichkeit und peinlicher wissenschaftlicher Beobachtung schwankte, mußte in solcher labilen Atmosphäre in ihre Pole auseinandergerissen werden. Was zur Katastrophe bestimmt war –; in dieser Schicksalsatmosphäre hatte es noch immer ausbrechen müssen. In lauter äußerlichen Schwierigkeiten reibt sich dieser große Geist auf. Aber er hatte doch dem größeren Erben den Boden bereitet: Johannes Kepler war auf seine Fürsprache hin vom Kaiser als Hofastronom angestellt worden. So wurde auch dessen Schicksal für ein Jahrzehnt in die verworrene Geschichte dieser Prager Geistigkeit verwoben, in astrologische Spekulationen hinuntergelockt. Das Horoskop, das er im Jahre 1608 seinem Gönner Albrecht von Waldstein stellte, stößt aus seinen objektiven Forschungen heraus wie ein Protestruf gegen all das unheimliche Treiben der Zeit, die in die klare Arbeit des Geistes dumpfe Ahnungen verborgener Weisheit gefährlich mischte.
Denn es war verborgene Weisheit, um was da in Laboratorien und Sternwarten, in Garküchen und dunklen Kellern gerungen wurde. Was wissen wir heute davon? Nur Auswüchse, Fehlschläge, Abenteurerschliche und Quacksalberei hat der unmittelbar nachfolgende Rationalismus davon überliefert. Was der oder jener an wirklichem Wissen um verborgene Naturzusammenhänge und um okkulte Erfahrungen, um mystische Transsubstantiationen hob, dem grübelnden Kaiser entdeckte, in dunkeln Andeutungen verwahrte, das hat das gesunde Vergessen der Jahrhunderte längst zu sagenumwobenem Humus des Geistes vermodern lassen. Und was alles die restaurierende Kirche im darauffolgenden Jahrhundert zurückgenommen hat in die verborgenen und verbotenen Kammern ihres Wissens –; wer kann das beurteilen? Das Volk bekam davon nur die Kehrseite zu sehen: den Scheiterhaufen. Hier muß genügen, der üblichen Meinung, all das dunkle Treiben am Hofe Rudolfs II. sei Unfug gewesen, entgegenzutreten, einen tieferen Kern in alldem zu achten, auch wo wir ihn nicht mehr fassen können.
Vor solcher grundsätzlichen Achtung weichen dann die zahlreichen Berichte über all die Adepten, die aus Deutschland und Polen und England und Italien und noch weiter her zuwanderten, ins Arabeske zurück, verflechten sich mit der Tradition, die das ganze 16. Jahrhundert mit alchimistischer Fabel überspinnt. Mit Ignaz von Münsterberg, dem Sohn des Volkskönigs, des Georg von Podìbrad, setzte sie ein. Er soll in Kuttenberg auch seinen alchimistischen Liebhabereien gefrönt haben. Herr Wilhelm von Rosenberg beschäftigt auf seinen Schlössern unter unglaublicher Verschwendung die fahrenden Abenteurer. Sein Bruder Peter Wok setzt das ganze ungeheure Vermögen der Rosenberg an diese Leidenschaft, bis er gezwungen ist, auf des Kaisers Ansinnen einzugehen, ihm einen Teil der Familiengüter zu überlassen (vgl. o. S. 135).
Rudolf II. also hatte in Prag den Fanatismus für derlei Spekulationen schon vorgefunden. Die Wahl seiner Residenz mag durch diese Tatsache auch mitbestimmt worden sein. Da trieb der bedeutende Johann von Hasenburg, der Präsident des Appellationsgerichts, neben ungeheurem Luxus auch die verschwenderische Alchimie. Baron Radowský von Hustiøan schrieb dicke Folianten über die hermetischen Wissenschaften, die nicht eben viel besagten. Immerhin hat er auch ein Kochbuch hinterlassen, in nahrhafter Personalunion der Autorschaft, ein Kochbuch, das von böhmischer Küche um 1600 das beste Zeugnis ablegt. So arg wirklichkeitsfern, wie sie gern gesehen werden, waren diese Alchimisten offenbar gar nicht. Der reiche Herr Wenzel Wøesowetz von Wøesowitz beschäftigte in seinem Haus auf der Kleinseite den Alchimisten Claudius Syrrus. Seine Bibliothek von fünfhundert Folianten hat er dem Kleinseitner Magistrat vermacht, mit der Bestimmung, daß sie zu »öffentlichem Gebrauche stets zugänglich« sein solle. Der Kleinseitner Magistrat hat sich dieser Schenkung wenig würdig erwiesen: in Kellern vermodert, wurde viel später diese herrliche Bibliothek entdeckt. Aber auch viele andere Bürger ließen sich hinreißen in diese Leidenschaften der Zeit, die sicher nicht bei allen nur als luxuriöser Sport bewertet werden dürfen. Korálek von Teschen, Johann Kaper von Kaperstein und der Arzt Nikolaus Löw von Löwenstein hatten damals ihr ganzes Hab und Gut dieser Leidenschaft geopfert. Sogar eine »Zeitschrift der Magier« konnte 1584 in Prag erscheinen.
Bei Hof wird das alles im großen Stil betrieben. Um unter den unzähligen Adepten, die der Ruf des neuen »Hermes trismegistos« anlockte, auszuwählen, wird Hájek als Examinator bestimmt. Daraus entsteht allmählich so etwas wie eine alchimistische Akademie. Bezeichnend, wie die ernste Wissenschaft immer tiefer hineingelockt wird in das gefährliche Treiben. Die phantastischen Figuren des Polen Sendivoy, der Engländer Dr. Dee und Kelley geistern durch die Gassen Prags, erscheinen bei Hof, werden Vertraute des Königs. Nur ihr abenteuerliches Wesen hat die Überlieferung erhalten, die äußeren Schicksale, die zwischen höchster Gunst –; Kelley wird Ritter –; und plötzlicher Katastrophe –; Verfolgung, bei einem gar Tod am Galgen, aber nicht unter Rudolf, sondern in Sachsen! –; gespannt sind. Wirkliche Leistung geht nur aus Andeutungen hervor. So, wenn wir von der Herausgabe des »Cosmopolitae novum lumen chymicum« des Setonius durch Sendivoy erfahren (Prag 1604). Oder von märchenhaften Berichten von Metallverwandlungen, die damals so wunderbar schienen und welche die heutige Chemie doch alles Märchenhaften entkleidet hat.
Goldmacherei als Leidenschaft spielt sicherlich bei all diese Figuren herein. Peitschten doch gerade damals die Gerüchte von ungeheuerlichen Goldfunden in der neuentdeckten Welt die Gemüter auf, stachelten vielleicht das alte Europa, durch geistiges Genie den Wettstreit aufzunehmen in der Herstellung lauteren Goldes. Man hat auch beim Kaiser Goldsucht als Anreiz vermutet. Die durch die Sammelwut und die Alchimistenleidenschaft dauernd geleerten Staatskassen hätten ihn auf solche Mittel sinnen lassen. Auf Oberflächen mag das gelten. Der Kern saß tiefer. Und die Gegenstellung der Kirche zu diesem ganzen Treiben, wie sie aus einigen Erwähnungen gegenseitiger Wühlereien zwischen Päpstlichen (Erzbischof und Lobkowitz) und Alchimisten (Dr. Dee) deutlich wird, läßt ihn ahnen. Die Mystik des Mittelalters knotet sich hier über die Renaissance hinüber in die Barockzeit hinein, dumpf und verworren, aber doch einer –; viel späteren –; Läuterung entgegen.
Aus solchen Zirkeln, wie sie sich unter den astrologischen Spekulationen gebildet hatten, laufen Fäden hinunter in die Judenstadt. Im Jahre 1592 hat der berühmte Rabbi Löw eine Audienz beim Kaiser. Nie hat er verraten, was in dieser Unterredung gesprochen wurde: der grübelnde Fürst Aug' in Aug' mit dem grübelnden Juden! Dieser Rabbi Löw, eigentlich Löwy (Juda) ben Bezalel (1525-1609), war zuerst mährischer Landesrabbiner in Nikolsburg gewesen, war im Jahre 1573 als Oberrabbiner nach Prag gekommen. Von dort aus war er nach Posen gegangen, war aber wieder nach Prag zurückgekehrt. Hier wuchs sein Ruhm. Er wurde als Denker und Prediger, Mathematiker und Astronom gepriesen. Er wurzelte aber durchaus im altjüdischen Wesen. Seine Schriften zur rabbinischen Literatur, zur Haggadah zeugen davon. Bei den Seinen galt er als Wundertäter, als Kabbalist. Als solcher lebte er weiter. Die Golemsage knüpft an seine Person an –; er soll aus Lehm einen künstlichen Menschen gefertigt haben, der als Spukgestalt wandelte –; und auch in Goethes »Zauberlehrling« treffen wir auf die Erinnerung an ihn. Seit den Psalmen spielt der Golembegriff eine Rolle im jüdischen Mystizismus. Jetzt wirkte dieser Mystizismus auf die Zirkel am Hofe ein, die sich mit Geheimwissenschaften beschäftigten, und weiterhin auf die Mystik des Barock.
Eine solche Figur tritt nicht allein auf: sie läßt auf ähnliche Erscheinungen in der damaligen Judenstadt schließen, die wohl die Überlieferungen der Gersoniden nicht verlassen hatten. Damals lebte auch David Gans im Prager Ghetto. Er stammte aus Lippstadt in Westfalen, kam in Berührung mit den Astronomen des Hofes, mit Tycho de Brahe und Kepler und schrieb in hebräischer Sprache eine Chronik, die für die jüdische Geschichte bis 1592 außerordentlich aufschlußreich ist.
In diesen Kreis der damaligen Judenstadt gehört vor allem auch Mordechai Meisl (1528-1601). Er ließ die nach ihm benannte Meislsynagoge errichten, kümmerte sich voll Eifer um das jüdische Schulwesen, errichtete ein Lehrhaus, die Klaussynagoge, konnte sich nicht genugtun in wohltätigen Stiftungen für die Prager und auch für auswärtige jüdische Gemeinden. Sein Wohlstand gedieh unter dem Wohlwollen des Kaisers, der ihm ganz außergewöhnliche Schutzbriefe voll Vergünstigungen ausstellte. Aber was er erwarb, kam im wesentlichen der jüdischen Gemeinde zugute. Er ließ das jüdische Rathaus erbauen, ein jüdisches Hospital einrichten, die ganze Judenstadt pflastern, kümmerte sich ebenso um das leibliche wie um das geistige Heil der Prager Judenschaft. Unmittelbar nach seinem Tode wurde gegen seine Erben der Prozeß angestrengt. Die Juden waren die »Knechte der kaiserlichen Kammer«, falls sie kinderlos starben, fiel ihr Vermögen an die Kammer. Dies war der offizielle Rechtsanspruch, auf Grund dessen das Verfahren gegen die Witwe eröffnet wurde. Die eigentlichen Triebfedern zu dem Vorgehen müssen aber tiefer gesessen haben und sicher hatte der begünstigte Judenkrösus auch persönliche Feinde. Ein abgefallener Jude, des Kaisers Kammerdiener Lang, soll alles inspiriert haben.
Auf der Burg wird die Verwilderung immer ärger: dem verworrenen Träumen wird die Wirklichkeit geopfert. Das Leben bei Hof gerät immer tiefer in die Klauen einiger Bösewichte. Kammerdiener schwingen sich zu despotischer Machtstellung auf, intrigieren, bestechen, lassen sich bestechen. Treiben Spionage wie jener Hieronymus Makowsky von Makow, ursprünglich Diener und Günstling des Peter Wok von Rosenberg, der ihn als Kammerdiener bei Rudolf II. unterbringt, in ihm nun den schlauen Zuträger aller Hofgeheimnisse gewonnen hat, deren er und seine Partei, der hohe Adel, zu politischem Ränkespiel bedurften. Mächtige Geheimräte werden plötzlich gestürzt, wie Wolf Freiherr von Rumpf und Paul Sixt Trautsohn von Falkensteyn im Jahre 1600. Unter der zunehmenden Lethargie des Herrschers verdüstert sich die Luft auf dem Hradschin. Jener Kammerdiener Philipp Lang, der aus dem Schwäbischen zugewandert sein soll, spielte damals die schlimmste Rolle. Auf Kosten des Kaisers hatte er sich schamlos bereichert, hatte Schätze aus der Kunstkammer weggeschleppt, hatte ungeheure Bestechungsgelder eingeheimst von allen, die ihre Sachen beim Kaiser anbringen wollten. Endlich gelang es, ihn zu stürzen. Noch unter Rudolf wurde ihm der Prozeß gemacht. Aber sein Nachfolger Johann Rusky trieb es nicht besser. Auch der ist eines elenden Todes gestorben –; zu spät. Man begreift, daß unter einem Charakter wie dem des Kaisers alle Arten von Kammerdienergeheimnissen eine ungeheure Macht bedeuten mußten. Und wahrlich: Rudolf wußte schlecht genug auszuwählen unter denen, die er seines Vertrauens würdigte.
Über all solchem Wirrwarr dringen die Päpstlichen vor. Sie hatten in dem massenhaft aus aller Welt zuströmenden Volk, den Händlern und Künstlern, den Politikern und den Vagabunden reichsten Zuwachs. Sie kamen aus Spanien, in dem Rudolfs Verwandte herrschten, aus Flandern, wo sie Statthalter waren, aus den Städten Italiens und vor allem aus Deutschland. Rom wußte zu werben. Die Protestanten drohen. Die wirre Atmosphäre läßt Ehrgeizige in zweideutige Abenteuer geraten. Über einen bricht die Katastrophe herein, über Georg Popel von Lobkowitz, kaiserlichen Rat, Kämmerer und Obersthofmeister. Er hatte 1593 den Landtag auf seine Seite gebracht gegen die Forderungen des Kaisers. Man beschuldigte ihn, er habe nach der Krone getrachtet, er, der »katholische König Böhmens«. Er will dem Prozeß ausweichen, unterwirft sich auf Gnade und Ungnade dem Kaiser. Aber er wird zu Kerker verurteilt, seine Besitzungen werden konfisziert, darunter sein Palast auf dem Hradschiner Platz (s. S. 136). Prag wäre schon jetzt im Strudel versunken, wenn nicht kraftvolle Persönlichkeiten unten in der Stadt Gegenkreise aufgerichtet hätten, die das turbulente Leben dieser Tage in feste wirklichkeitsstarke Formen zwangen.
Da erfrischt der Blick auf das Prag Krocins. Dieser Wenzel Krocin war seit 1584 Primator der Prager Altstadt. Er hat sein Gemeinwesen zu schöner Blüte geführt. Aus dem bunten Treiben, das die Residenz des abendländischen Kaisers hier anlockte, nutzte er den wirtschaftlichen Humus. Der Markt war überschwemmt von den Erzeugnissen der damaligen Welt. Prag dehnte sich aus. Krocin festigte es von innen.
Der Kaiser wußte seinen Primator zu schätzen. Vielleicht spürte er in ihm den Gegenpol des eigenen Charakters: die tätige, rüstige, praktische Vernunft. Der Adelsbrief, den er ihm ausstellen ließ (1594) –; er verlieh dem Krocin den Beinamen von Drahobeyl –;, anerkennt rückhaltlos die Leistung und die Treue des Primators. Der hat diese Anerkennung verdient. Das Prag der Jahrhundertwende war sein Werk. Er hatte zu allererst die Gemeindeeinkünfte verbessert. Rudolf hatte schon im Jahre 1577 der Gemeinde die Hälfte der Erbschaftsgefälle zugesprochen. Jetzt gestand er den Altstädtern auch noch das Fischmarktgefälle zu. Auch durften fremde Weine bei Mißernten der einheimischen Rebenzucht eingeführt werden. Vor allem: die Altstädter durften nun Häuser, die in der Landtafel eingetragen waren, erwerben, eine große, auch finanzwirtschaftlich bedeutsame Berechtigung. So konnte Alt-Prag um 1600 an die 3000 Schock böhmischer Groschen an Gemeindeeinkünften buchen.
Damit ließ sich etwas anfangen. Und Krocin wußte sie zu verwerten. Damals wurden die Steinmühlen von der Stadt angekauft, dann das Brauhaus zu Prazek, zuletzt noch das ganze Dorf Smichow, das eine gute Anlage bedeutete. Neben dem Gallikloster wurden städtische Garküchen errichtet. Gemeindehäuser wurden erneuert. Die Bruskastraße wurde angelegt mit einer Brücke über den Bach, ein Turm daneben sorgte für die Wehr. Eigene Spitäler wurden gegen die Pest eingerichtet, ein Seuchendienst wurde organisiert: St. Paul vorm Poøièer-Tor (Deutschherrenstraße) war der Altstadt zugeteilt, der Neustadt das Hradekhaus am Zderaz und St. Elisabeth am Botitschbach. Drüben das große St.-Johannis-Spital an der Brücke war für die Kleinseite bestimmt. Man sieht: die Befugnisse des Altstädter Primators erstrecken sich in wichtigen Fragen auch über die anderen Prager Städte.
Die soziale Seite von Krocins Tätigkeit wird noch durch die vielen Verordnungen beleuchtet, mit denen er das gesamte Gemeindeleben Prags neu regelt. Da ist die Feuerlöschordnung, die Marktordnung, die Taxordnung für die Rats- und Gerichtskanzleien, die dem Unfug willkürlicher Taxenerhebung steuerte. Da sind die genauen Vorschriften für die Prokuratoren, die Fixierung der Beamtengehälter, die Verordnungen gegen den Bettel, die Regelung der Zunftstatuten und vieles andere. Dies alles wurde zusammengefaßt und niedergelegt in den von Krocin gegründeten Gedenkbüchern, den »Libri rerum memorabilium consilii magni Veteris urbis Pragensis«, die von da ab bis zum Jahre 1784 –; als Josef II. sie aufhob –; weitergeführt wurden.
Krocins Leistung war es, daß Prag als Gemeinwesen unter all dem Tumult der Zeit ruhig und sicher atmete, daß es stark genug war, das Auf und Nieder der Hoflaunen kraftvoll zu tragen. Zu dem lebendigen Denkmal seines Wirkens hat sich Krocin noch ein künstlerisches gesetzt in dem schönen Marmorbrunnen, den er in den Jahren 1591-1593 auf dem Altstädter Ring hat aufstellen lassen. Der Belvederebrunnen mag die Anregung gegeben haben zu diesem schönen Werk. Lebensgroße Skulpturen trugen die weite Schale. Heinrich Prazak, genannt Beránek, dürfte der ausführende Künstler gewesen sein. In den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts ist der Brunnen niedergerissen worden, jämmerlicher Verkehrspolitik zuliebe –; jämmerlich, da der Brunnen dort im Nordteil des Platzes den damals noch recht geringen Verkehr gar nicht behinderte. Trümmer sind heute im Städtischen Museum zu sehen. Die Hauptteile sind verschwunden. Die Stelle, da er stand, klafft heute als ärgste Wunde in diesem einzigartigen Platz.
War durch Krocins Tätigkeit die wirtschaftliche Kultur der Stadt gesichert, recht im Gegensatz zu den Folgen der kaiserlichen Außenpolitik im Reich, so sorgte ein Stamm vorzüglicher Männer von Format für einen Kern geistiger Kultur inmitten des unruhigen Treibens der Hauptstadt. Sie hatten Ideen des Humanismus weitergetragen in eine tief angelegte Geistigkeit. Auf weiten Reisen hatten sie die Welt kennengelernt, hatten Fremdes aufgenommen, um das eigene klarer herauszuarbeiten. So hatten sie ein geistiges Europäertum in sich gestaltet, das als Überbau und als fester Kern in dem chaotischen internationalen Treiben des damaligen Prag eine Richtung nach vorwärts hätte weisen können. Denn was sich an großer Politik damals in Prag abspielte, das war in Kombinationen und Intrigen und Vermutungen und Planen die wirre Geburtsstunde des modernen Europa, dem die klare geistige Richtung noch fehlte. Es trieb einer Feuertaufe zu. Und jene Männer waren vom Schicksal dazu ausersehen, den ersten Anstoß zu dieser Feuertaufe zu geben.
Von der älteren Generation lebte noch Daniel Adam von Weleslawin, dessen Wort wie das eines Gesetzgebers auf die Zeitgenossen wirkte. Er hatte eine Schar tüchtiger Männer um sich versammelt, weniger schöpferisch, eher fruchtbar in Bearbeitungen und Übersetzungen. Tschechischer Patriotismus wurde gepflegt. Über der Sprachsäuberung war das Ziel die Klärung der heimischen geistigen Verhältnisse. Sein Freund Johann Kocín von Kocínet sah, wie er in der Türkengefahr die Gefahr Europas, warnte und riet zur Abwehr. Von den Reimereien Simon Lomnickys von Budetsch, des berühmtesten tschechischen »Dichters« seiner Zeit, ist heute nicht mehr viel zu sagen. Viel kerniger arbeitete der fast unbekannt gebliebene Nikolaus Daèický von Heslow, der trinkfeste Raufbold, an einer tschechischnationalen Dichtung.
Dieser Generation der frei ausholenden Humanisten folgen die jüngeren, die schon ein fortgeschritteneres Stadium des Humanismus vorfanden. Die Kluft zwischen Gebildeten und Volk hatte sich gefährlich vertieft. Die geistigen Führer wurden der Masse entzogen. Sie verfaßten ihre Reisebeschreibungen wie der aufrichtige Wenzel Wratislaw von Mitrowitz, der vier Jahre seiner Jugend in türkischer Gefangenschaft gesessen hatte. So auch der hochgebildete, aber etwas selbstgefällige Christoph Harant von Polžic, der bei Hof eine Rolle spielen wollte, eine Zeitlang auch spielte. Anders der vornehme Wenzel Budowetz von Budow. Der hatte in langem Aufenthalt im Orient Türkisch und Arabisch gelernt, um den Koran durch und durch studieren zu können. Die Frucht dieses Studiums wurde sein »Antialkoran« (1593), in dem er das Christentum dem Mohammedanismus entgegenstellt, mit geistigen Waffen das christliche Europa zum Kampf gegen die Türken auffordert.
Dieser Appell an Europa gegen die Türkengefahr eint alle diese mutigen und klarblickenden Geister, die damals in Prag einen Kulturkern schufen. Habsburg hätte an ihnen ein geistiges und politisches Bollwerk gegen den Osten haben können, hätte es sie nicht in ständisch-religiöse Protestation hineingetrieben, an der sie unter Habsburgs Romfanatismus zerschellen sollten. Karel der Ältere von Žerotin, auch weitgereist, auch hochgebildet, wittert voll Sorge den Konfliktstoff, warnt die Landsleute vor einem Aufstand gegen Habsburg. Vergebens. Als alles verloren, zieht er vor den gegenreformatorischen Folgen hinaus in die Verbannung (1628).
Dieser gebildete Adel neigt dem Calvinismus zu. Sein geistiges Streben entfernt ihn immer weiter vom Volk. Personale Verbindungen bringen einzelne der Karlsuniversität nahe. Die lebt in der Spannung zwischen zeitbewußten Reformideen und heillosen wirtschaftlichen Zuständen. Der Ersparnisse halber hausten damals alle Magister gemeinsam im Karlskolleg. Noch galt für alle das Zölibat, eine Beschränkung, die manchen verdienstvollen Gelehrten außerhalb der Magisterwürde hielt, so Jessenius. Sie wirkte sich denkbar ungünstig aus. Das enge Zusammenwohnen und die unerfreulichen wirtschaftlichen Zustände treiben die Magister in wüsten Trunk, der oft zu üblen Raufereien und Schlägereien ausartet. Die Famuli-Studenten sahen ein schlimmes Beispiel. Kein Wunder, daß sie es in ihrer studentischen Praxis draußen nur allzu eifrig befolgten, so daß die Bürger immer häufiger Klage zu führen hatten.
Gegen dieses verlotterte Kollegleben stand die geistige Anspannung einiger unter den Magistern. Der zielbewußteste unter ihnen war Martin Bacháèek. Er hatte sich mit allen Reformversuchen deutscher Schulmänner innig vertraut gemacht. Jetzt wollte er in Prag reformieren. 1597 gründete er eine Musterschule, die der Universität angegliedert war. Das Schulwesen war damals, unter lutherischem und jesuitischem Einfluß, Hauptsorge aller geistig Verantwortungsbewußten. Aber es fehlte an Mitteln, fehlte auch bald an Schülern für diese Musterschule. Nach zwei Jahren ging sie wieder ein. Der übliche Studienbetrieb der Universität schleppte sich mühsam genug weiter. In die Massen hinunter sickerte von all dieser Universitätsbildung nichts.
Die Massen, die damals Prag bevölkerten, begnügten sich mit einfachstem Unterhaltungsstoff. Chroniken und Volksbücher wurden gelesen. Mit dem Erstarken des deutschen Einflusses in Prag drangen wieder die deutschen Stoffe in die tschechische Volksliteratur. Biblische Spiele und vulgäre Possen wurden in der Landessprache aufgeführt. Die eigentliche Bildung hatte sich abgeschlossen vom Volk, lebte in eigenen Bibliotheken und kleinen Zirkeln ihr privates Leben. Nur die Jesuiten lockten mit ihren Schauspielen das Volk an, warfen derbe Bildungsbrocken in die Massen. Im übrigen verquickten sich immer mehr die Adelsinteressen mit den Bildungsinteressen. Die gesamte Historiographie wurde von der Ahneneitelkeit des Adels aufgesogen: die Geschlechter ließen ihre Genealogien verfassen. Ständische Wünsche nahmen religiöse Streitfragen auf. Ein Schicksal kommt ins Rollen, das eine ganze Generation, an ihrer Spitze die obgenannten Männer, zermalmen sollte.
Denn unter dem bewegten Leben dieser Tage bohrten die alten religiösen Gegensätze weiter. Die Jesuiten arbeiteten unverdrossen an der Zersetzung des utraquistischen Volkes. Rom hatte die Kapuziner ins Land geschickt. 1599 zogen sie oben in der Hradschinstadt ein. An der Stelle, neben der kurz darauf Loretto gegründet wurde, stand ihr erstes Kloster. Durch ihr ewiges Geläute soll sich der nahebei wohnende Tycho de Brahe, dem ein Quartier in der »Neuen Welt«, einer kleinen Siedlung am nördlichen Hradschinhang, zugewiesen worden war, belästigt gefühlt haben. Auf seine Bitte soll Rudolf die Kapuziner wieder ausgewiesen, auf die Vorzeigung eines herrlichen Dreikönigbildes, das ein Kapuzinermönch gemalt hatte, aber wieder zugelassen haben. Der sehr energische Erzbischof jener Jahre, Zbinko Berka von Dub, setzt es beim Kaiser durch, daß ihm die gesamte Bücherzensur übertragen wird (1599) –; eine tödliche Waffe gegen den im Buchdruck so starken Protestantismus.
Der Katholizismus kämpfte konsequent und mit unfehlbaren Mitteln. Schon der Vorgänger des Erzbischofs, Medek, hatte seinem Klerus den Gregorianischen Kalender publiziert. Rudolf führte ihn 1594 für ganz Böhmen ein. Das war wirtschaftlich eine höchst einschneidende Bestimmung: der 24. Juni wurde damals zum 4. Juli! Vor allem aber als geistige Machtsteigerung Roms war diese Einführung bedeutsam.
Das Erzbistum setzte seine Befugnisse über das utraquistische Konsistorium immer beharrlicher durch. Es lockt, es befiehlt. Es erteilt Priesterweihen oder es versagt sie. Der Nimbus des Legitimen wirkt Wunder: im Jahre 1593 war das gesamte utraquistische Konsistorium unter Fabian Rezek –; er war schon immer recht lau gewesen –; ganz offen zum Katholizismus übergetreten. Im Jahre 1602 fällt dann die entscheidende Verordnung des Kaisers: nur Katholiken und Utraquisten sollen im Lande geduldet sein. 1603 wird der Erzbischof wieder Reichsfürst.
Die Gegenreformation ist in vollem Gang. Die protestantischen Stände grollen. »Kaiserlich oder Ständisch« wird die Parole. Die Altstadt unter ihrem katholischen Rat –; der Kaiser hatte viele Katholiken eingesetzt –; und die Kleinseite halten es mit dem Kaiser. In der Neustadt haben die Ständischen ihren Stützpunkt. Das bunte Treiben der Prager Städte wird immer tiefer unterhöhlt. Es sammelt sich um zwei Kerne. Die Spannung wächst. Von außen kommt der Anlaß, der zu ihrem Ausbruch, zu ihrem furchtbaren Ausbruch treiben soll.
Während die Fäden der Regierung, die von Prag ausliefen, immer unheilvoller sich verwirrten, gärte es draußen im Reich. Die religiöse Spaltung riß immer tiefer, zwang mächtige Gruppen gegeneinander. Habsburg hielt zu Rom: Ferdinand, Regent in Steiermark, vertrieb alle Protestanten aus seinem Lande, restaurierte grausam die katholische Kirche. Aber die protestantischen Niederlande waren abgefallen vom habsburgischen Spanien und auch in Ungarn hatten sich die Protestanten empört, hatten Religionsfreiheit vom Kaiser sich erzwungen. Das Weltreich erbebte. Die religiösen Proteste hoben tiefere, politische mit herauf. Habsburg war bedroht. Der Schattenkaiser in Prag würde es nicht retten können.
Matthias, der Bruder des Kaisers, brach auf. Ließ sich huldigen von den Ständen Österreichs, von den Ständen Ungarns. Zog auf dem Landtag zu Preßburg Mähren, dann auch Schlesien auf seine Seite. Marschierte gegen Prag. Von Tschaslau aus drohte er dem Kaiser, rief die böhmischen Stände (1608).
Die ergriffen die Gunst der Stunde. Sie drangen in den Kaiser um ihre Privilegien, um Aufhebung des Religionsedikts von 1602, versprachen für die Gewährung sofortige Hilfe.
Der Kaiser, bedrängt vom Bruder, bedrängt von den Ständen, unterzeichnet die Zusicherung, auf dem nächsten Landtag das Religionsanliegen der Stände günstig zu entscheiden. Sofort stellen die Stände ein Heer auf: 34.000 Mann, darunter 1000 aus Prag. Vor Prag wird es in Bereitschaft gestellt. Matthias rückt von Tschaslau aus vor. Während die Heere sich gegenüberlagen, wurde in Lieben bei Prag verhandelt: Ungarn und Österreich, als Markgrafschaft auch Mähren, fielen an Matthias, Thronfolge in Böhmen und den übrigen Ländern wird ihm zugesichert. Er seinerseits verspricht den Ständen Böhmens Schutz ihrer religiösen Freiheiten, wenn er zur Regierung kommt. Rudolf hatte sich die Herrschaft über Böhmen teuer erkauft.
War er noch Herrscher? Längst schoben ihn die Gewalten, die er sein ganzes Leben lang verachtet hatte. Jetzt rächten sie sich, gebrauchten ihn als apathisches Werkzeug nach ihren Launen, trieben ihn ins Verderben. Kaum war die Gefahr vorüber, so wollte man bei Hofe die Zusagen schon hinausschieben, später annullieren. In der Altstadt wurde ein katholischer Rat eingesetzt: jetzt wurde Heidelius Primator. Auf dem Landtag, der das kaiserliche Wort einlösen sollte, wurde laviert und hingezogen, endlich ungnädiger Schluß gemacht. Man könne von den alten Gesetzen des Landes nicht abgehen. Die Kompaktate bestimmten, daß nur die katholische und die utraquistische Religion im Lande geduldet werden dürfen. Die von Maximilian erlangten Religionsfreiheiten wurden für ungültig erklärt.
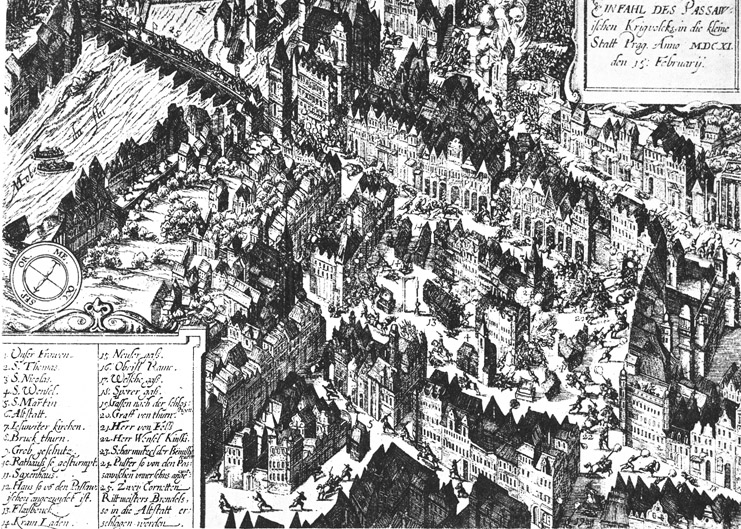
Einfall des Passauer Kriegsvolks auf der Kleinseite 1011
nach einem anonymen Stich 1611
Die Stände tobten. Sie setzten sich auf dem Neustädter Rathause fest, wählten 30 Direktoren, unterhielten ihre Heere. Der Altstädter Magistrat unter Heidelius hielt zum Kaiser, zürnte den Neustädtern ob ihres Abfalles, bat den Kaiser, der Erzbischof möge ihnen die Priester weihen dürfen. Aber die Ständischen pochten auf ihre Macht. Zuträger streuten aus, Heidelius rüste gegen das Neustädter Rathaus. Ein Haufen Bewaffneter fiel in die Altstadt ein, brach in das Rathaus und traf hier wirklich gegen 50 Söldner an. Auf dem Landtage darauf wurde Heidelius des Landes verwiesen. Schon waren die Ständischen die Herren im Lande.
Zwischen Neustädter Rathaus und Burg liefen die Delegationen. Man fordert, schlägt ab, droht, verklausuliert. Die Ständischen bleiben fest. Da arbeitet Graf Schlick, deutscher Adel, aus dem Egerländischen, alter Lutheraner, guter Politiker. Da beschwört Budowetz, tschechischer Adel, vornehmer Geist, im Brüdertum gereift. Da trumpfen Hitzköpfe auf: der Graf Thurn, auch er deutscher Adel, aus dem Alpenländischen, draufgängerischer Soldat. Er und sein Anhang pochen auf Macht und alte Rechte. Da argumentieren Gelehrte wie Jessenius, klug, beredt, weiten Horizonts. Geistliche wettern gegen Rom. Die Massen lungern. Das Land, das Heer, ja auch das gute Recht gehört den Ständischen. Droben auf der Burg wandelt ein Schatten, vergräbt sich im Wahn. Unter ihm zerbröckelt die Macht.
Endlich gibt Rudolf nach. Alle Parteigänger, sogar der Erzbischof, haben ihm dazu geraten. Am 9. Juli 1609 erteilt er den protestantischen Ständen den Majestätsbrief. Der billigt volle Religionsfreiheit zu (nach der Augsburgischen Konfession). Gestattet den Bau von Kirchen und Schulen, gibt Konsistorium und Akademie an die Stände. Defensoren, von den Ständen gewählt, sollen sie betreuen. Der Majestätsbrief wird sogleich der Landtafel und den Landesprivilegien einverleibt. Die Stände jubeln.
Es wird hin und her beraten, geplant, beschlossen. Die neue Kirchenverfassung wird ausgearbeitet: im Konsistorium sitzen künftig neun Geistliche und drei Professoren der Universität. Man geht an die Reform des Studiums. Adam Zalužanský, berühmter Arzt, ehemaliger Magister der Universität, hatte einen Reformplan ausgearbeitet. Der war den Professoren zu strikt. Die akademische Lehrfreiheit wäre durch ihn unterbunden, protestierten sie. Eine ständische Kommission wurde eingesetzt, die mit den Professoren gemeinsam die nötigen Neuerungen durchberaten sollte. Vier Punkte standen im Vordergrunde, lauter Fragen, die durch die Entkatholisierung der Universität aufgetreten waren: Klerikat der Magister, Kanzleramt, interne Streitigkeiten, Professorenberufung. Alle Einrichtungen, die mit den Bestimmungen des Majestätsbriefes im Widerspruch standen, sollten fallen: das Kanzleramt sollte mit dem Rektorat verbunden werden, das Rektorat sollte in Streitfällen zwischen Geistlichen und Universitätsangehörigen entscheiden. Über Berufungen sollten die Defensoren bestimmen. Die Säkularisation der Universität war durchgeführt.
Die Defensoren wurden gewählt, ihre Befugnis umrissen. Oberster Defensor war Graf Schlick. Rektor der Universität wurde Martin Bacháèek, der eifrige Schulreformer. Neues Leben keimte im alten »Studium«, freierer, frischerer Geist. Der zwölfjährige Johann Smíl von Michalowitz, Sohn des böhmischen Vizekanzlers Bohuslaw von Michalowitz, hielt damals im Carolinum bei feierlichem Anlaß eine schwungvolle Rede: eine seltsame Fügung sei es, daß gerade 200 Jahre nach Vertreibung der fremden Nationen, nach dem Untergang des alten Studiums also, die neue Epoche der Universität beginne, ihre glänzende Wiederherstellung. Man hatte das Unglück begriffen, das des Hus Nationalismus über die Prager Geistigkeit gebracht hatte. Man wollte neues Blut dem Studium zuleiten, dachte an die Berufung Keplers, des deutschen Arztes Borbonius und manch anderer Leuchte der Wissenschaft.
Doch die Defensoren dachten anders: Berufung der Ausländer sollte man vorerst noch unterlassen. Welch muffiger Geist viele dieser Defensoren beherrschte, erhellt aus einem grotesken Buchverbot. Magister Jakob Krupský, Rektor der Schule in Schlan, hatte Plutarchs Pädagogik übersetzt. Der Rektor überreichte den Defensoren ein Exemplar. Einige stießen sich an dem dort gebrauchten Wort »Päderastie«, in tschechischer Übersetzung »Samcoložnictví«. Das gefährde die Moral, sei verdammenswürdig: das Buch sollte verbrannt werden. Die Universität erhob Einspruch. Aber das Buch mußte doch im Karlskolleg hinterlegt, der Verfasser mit kurzem Arrest im Karlskolleg bestraft werden.
Nein, da oben saßen keine weitblickenden Geister. Die wenigen tatkräftigen Führer wurden von unten her gehemmt. Die geistige Bewegung, wie sie damals an der Universität ansetzte, mußte in sich ersticken, besonders da am Nötigsten, am wirtschaftlichen Unterbau, keine Hand angelegt wurde. Alle Vorstellungen der Magister wurden mit Vertröstungen beantwortet. Und während drüben im Clementinum, das von allen Steuern noch immer befreit war und noch immer reichliche Spenden genoß, prächtige Theateraufführungen das Volk verlockten, versank das Carolinum weiter unter der Last der Schulden. Kein Geld war da zur Anstellung neuer Professoren, kaum Geld für Bezahlung der alten Magister. Die Liegenschaften waren zu entfernt, um geordnete Wirtschaft zu garantieren, eine Wirtschaft, über deren Durchführung die Magister überdies noch unter sich uneins waren. Ideologie blieb der schöne Aufschwung dieser ersten Jahre unter der Religionsfreiheit. Der treffliche Bacháèek sank ins Grab, ohne seine Träume erfüllt zu sehen (1612).
Schließlich waren ja auch die Verhältnisse in Prag viel zu ungeklärt, als daß schon große Dinge hätten reifen können. Da droben auf der Burg schwelte Angst, Verbitterung, Intrige. Ein Fürstentag war einberufen worden (1610). Einige Getreue waren gekommen: die Kurfürsten von Mainz und Köln, der Herzog von Braunschweig, die Erzherzöge Ferdinand, Maximilian, Leopold –; um mit dem alten Kaiser zu beraten.
Man sah nicht klar. Die Jesuiten prunkten damals mit einer Aufführung. Sie hatten jede Überlieferung im Theater. Der Clementinumhof hatte schon große Tage erlebt. Die »Saulus«-Aufführungen aus den Jahren 1577 und 1580 waren unvergessen. Und jede Gelegenheit wurde von den eifrigen Patres benutzt, ihren Witz und ihre Macht über die Sinne spielen zu lassen. Da glänzten die Schüler in prachtvollem Latein, dann auch in der Volkssprache. Regiekunstwerke wurden ausgeführt von unerhörter Kühnheit. Da schossen die Flammen aus Drachenmäulern, und Wasserfluten ergossen sich über die hohe Bühne. Stundenlang, tagelang dauerten diese Dramen. Entzückt saß der Hof, saß der Adel, stand das Volk. Auch jetzt wieder, zum Fürstentage, wurde gespielt. Aufgeführt wurde das Drama »Elias«. Tosender Beifall rauschte im Clementinumhof. Alle Fürsten hatten der Vorstellung beigewohnt. Drängt Rom wieder vor?
Ja, zu Ende dieses Jahres stieg die Besorgnis. Leopold der Erzherzog, erwählter, doch nicht geweihter Bischof von Passau, hatte Truppen geworben, 6000 zu Fuß, 2000 zu Pferd –; hatte sie gegen Böhmen, gegen Prag in Marsch gesetzt. Wollte er dem Bruder zu Hilfe kommen? Wollte er nur die Thronfolge sich sichern? Seine Söldner nahmen die Städte im Süden, nahmen Písek, erschienen im Februar 1611 vor Prag. Hatte der Kaiser sie gerufen? Wollte er sich rächen, wieder sein Wort brechen? Man besetzte die Tore, rief die Heere zusammen. Da waren die Passauer schon eingedrungen: List hatte ihnen das Neusertor neben dem Kleinseitner Wasserturm am Aujezd geöffnet. Schon ergossen sie sich über die Kleinseite, mordeten, plünderten, besetzten die Burg. Fanden Parteigänger in manchem Haus, besonders bei den Wälschen, die hier wohnten. Einige Reitertrupps setzten schon über die Brücke, sprengten in die Stadt hinein. Der hitzige Graf Thurn hatte sie nicht mehr aufhalten können. Kaum aber waren sie durchs Brückentor hindurch, da fielen die eisernen Gitter herab. Sie waren abgesprengt von den Ihren, der Übermacht in der Altstadt preisgegeben. Flohen, hetzten zur Neustadt, wurden von den Pferden gerissen, erschlagen, wenige erreichten den Wyschehrad. Nur vier von ihnen entkamen über die Felsen, flohen bis Königsaal, setzten dort über die Moldau, stießen gehetzt wie Tiere zu den Ihrigen zurück.
Das Prager Volk schrie auf: »Sie sind in die Klöster geflohen.« Auf dem Wyschehrad wurde die Dechantei gestürmt, geplündert. Dann zurück. In der Neustadt fielen Emauskloster und Karlshof in ihre Hände. Dann Maria-Schnee. Einem Priester, der dort die Hostie reichte, wurden die Hände abgehackt. Andere wurden erschlagen. Weiter zu St. Jakob in der Altstadt. Da aber standen die Altstädter Fleischhauer bereit, »dieses ihr Kleinod« mit ihren Äxten zu beschützen. Sie vertrieben das Gesindel. Das stürmte zum Agneskloster, raubte, plünderte es aus. Warf sich noch auf St. Clemens, um die verhaßten Patres zu vertreiben. Aber einige Herren von den Ständen standen dort mit Bewaffneten bereit, zerstreuten den Pöbel. Und andern Tages erließen die Stände scharfe Maßregeln gegen weitere Ausschreitungen. Die setzten sich draußen im Lande fort.
Droben auf der Burg hatten die Passauer zwölf große Feldstücke aus der Rüstkammer geholt, hatten sie gegen die Altstadt aufgefahren. Doch der alte Kaiser verbot das Bombardement: er wolle seinen Nachkommen diesen Sitz erhalten. Er fühlte sich jetzt aber doch wieder mächtig genug, von den Ständischen in der Altstadt Unterwerfung zu fordern: Einlaß für die Passauer, Niederreißung der Schanzen.
Die Ständischen weigerten sich, sandten nach Wien zu Matthias um Hilfe, bestellten wieder ihr Direktorium von 30 Mitgliedern: 10 aus dem Herren-, 10 aus dem Ritter-, 10 aus dem Bürgerstande, setzten die Stadt, das Land in Verteidigungszustand. Sie konnten schon drohen. Den Passauern wurde es ungemütlich, sie baten um freien Abzug. Nein, wer sie in das Land geführt, solle sie wieder hinausführen. Des Matthias ungarische Hilfstruppen lagen schon vor Prag. Da flohen die Eindringlinge bei Nacht und Nebel aus den Toren, wurden von den nachdringenden Ständischen noch gründlich geschlagen, verdarben. Der Erzherzog Leopold war mit ihnen verschwunden. Er hatte dem Bruder und sich selbst nicht genützt, hatte die Krone endgültig dem Matthias in die Hände gespielt.
Und Matthias kam aus Wien. Die Ständischen, die unter Thurn die Burg besetzt hatten, baten ihn, die Regierung zu übernehmen, zwangen Rudolf zur Abdankung. Am 23. Mai 1611 wurde Matthias feierlich im Veitsdom gekrönt. Rudolf stirbt bald, verbittert, vergrämt, ein Narr der Geschichte. Und war doch nur vom Leben auf falschen Posten gestellt (1612). Unterm Veitsdom liegt er in prächtigem Zinnsarg begraben.
Nun herrscht Matthias. Oder herrschen die Stände? Die Bedingungen, die sie bei Matthias durchgesetzt hatten, waren selbstherrlich genug. Ein stummes Ringen der beiden Mächte hebt an, unterirdisch zuerst. Was nach oben dringt, scheint Günstiges zu versprechen.
Da erstehen jetzt die Protestantenkirchen. Auch die deutschen Gemeinden waren groß geworden. Unter dem Protestantismus war das deutsche Element in Prag wieder erstarkt. Nach dem Erlaß des Majestätsbriefs waren Prediger und Gelehrte berufen worden, Handelsleute und Gewerbler waren zugewandert, saßen sogar im Rat. Die deutschen Schulen waren berühmt: kraftvolle Entgegnung auf die Jesuitenschulen. Führend die bei St. Salvator. Dort ist jetzt Dr. Hoe Prediger. Es war zu Reibereien mit den Magistern des Carolinums gekommen. Die blickten scheel auf die blühende Schule der Deutschen, verklagten sie, daß sie die von der Universität vorgeschriebene Studienordnung nicht einhalte. Man vergleicht sich: die drei Hauptlehrer der deutschen Schule müssen sich an der Universität immatrikulieren lassen, müssen die Klassen entsprechend den geltenden Vorschriften führen. Die Schule gedeiht. Hoe kommt später als Hofprediger nach Dresden. Dort spielt er dann eine wenig eindeutige Rolle. Wir werden noch von ihm hören.
Jetzt also dürfen diese Gemeinden ihre eigenen Kirchen errichten. Die Altstädter Gemeinde erbaut sich unweit des Altstädter Rings die Salvatorkirche. Man griff, wie es damals auch in Deutschland üblich war, auf den gotischen Kirchenbau zurück. Die letzte Gotik hatte in der großen Halle den für die Predigt geeigneten Raum ausgebildet. Die Reduktion auf den einschiffigen Saalraum hatte in Prag schon der Umbau der Allerheiligenkapelle auf der Burg gebracht (s. o.): durch Hinausschiebung der Außenmauern um die Strebepfeilertiefe. Solch saalartiger Raumtypus kommt den Protestanten zustatten. Auch diese Salvatorkirche wird als hoher Predigtraum gebildet, den ein gotisch konstruiertes Gehäuse umhüllt. Hohe Maßwerkfenster, die Maßwerkformen aber dem Zeitstil angeglichen: halbrunde Bögen, weiche Profile. Diese Weichheit, wie sie die neuen Renaissanceformen gelehrt hatten, läßt auch den ganzen Baukörper jetzt schmiegsamer erscheinen, was den fremdreizvollen Ton in die gotische Grundanlage bringt. Bei der Grundsteinlegung wirken als Patrone Graf Schlick, Leonhard Colonna von Fels und Wilhelm Popel von Lokbowitz (5. Oktober 1611). Bei der Einweihung predigt Dr. Garth (5. Oktober 1614).
Von einem eigentümlich protestantischen Kirchenbau kann man angesichts dieser Lösung noch nicht sprechen. Hatten doch auch die Jesuiten in solchem Kompromißstil begonnen (St. Salvator), ihrem Kult entsprechend allerdings in basilikaler Form. Und auch die Rochuskapelle droben neben dem Strahowkloster gehört ihrer Formenwelt nach dieser Richtung an. Der neue Raumcharakter aber wird bei den Prager Protestantenkirchen üblich.
Auch die deutschen Protestanten auf der Kleinseite nehmen ihn auf. Sie beginnen ihre Kirche zur heiligen Dreifaltigkeit (in der späteren Karmelitergasse) zur gleichen Zeit. Dem Saalraum stellen sie eine Fassade vor, nach einem wohl aus Rom bezogenen Projekt, das die Fassade Domenico Fontanas für den Kirchenbau Trinità dei Monte zu Rom aus dem Jahre 1570 fast genau wiederholt. Bei der Ausführung sollten allerdings die Westtürme fortbleiben. Sie wären auch kaum zur Wirkung gekommen, jedenfalls nicht zu der in Rom durch die Lage –; der Stadt zu –; geforderten. Denn die Westfassade richtete sich ja –; man behielt die übliche Orientierung bei –; gegen den Laurenziberg. So blieb dieser Kirchenbau trotz des italienischen Vorbildes der nordischen Überlieferung doch treu: das Kunstwerk ein in sich geschlossenes Gebilde, ohne Rücksichten auf den Beschauer. Erst der Umbau durch die Karmeliter (siehe S. 208) vertauschte Chor und Fassade, so daß letztere gegen die Straße zu liegen kam. Erst damals also siegte der Geist der Renaissance auch in der inneren Haltung: das Kunstwerk bietet sich dem Blick des Beschauers, will von ihm gesehen werden. Auch die Böhmischen Brüder wählen den einschiffigen Saalraum bei ihrem Kirchenbau in der Altstadt, wo sie nahe der Moldau eine alte Kirchenstätte (St. Simon und Juda) neu ausbauen. Später haben die »Barmherzigen Brüder« ihre Kirche überkommen und ihrem barocken Spitalbau angeglichen; erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und 1617 hatte das »Wälsche Spital« auf der Kleinseite seine Kirche in dieser Raumform vollendet. Man muß diese Bauten zusammenschauen, um die Ansätze einer Entwicklung zu protestantischem Kirchenbau in Prag zu würdigen, die dann durch die Gegenreformation jäh abgebrochen wurden.
Die deutsche reformierte Gemeinde erhält die Fronleichnamskapelle auf dem Karlsplatz. Die Brüdergemeinde bekommt die Bethlehemskapelle zugewiesen, die immer noch die alte Hus-Tradition hält. Der Altstädter Magistrat verhandelt wegen ihrer Überlassung mit dem Carolinum, das ja von altersher am Protektorat über diese Kapelle teilhat. St. Niklas auf der Kleinseite gehört jetzt den tschechischen Lutheranern. Man scheint sich damals auch national vertragen zu haben. Das Luthertum ist bindendes Element.
Matthias läßt nun auf der Burg bauen. Ganz anderer Geist zieht da ein. Vincenzio Scamozzi, der Entwerfer des Doms in Salzburg, wird berufen. Er beginnt mit dem Torbau im Westen. Flügelbauten sollten folgen. Italienischer Barock zieht ein in Prag (1614): derb, etwas schwunglos, doch aus guter Schule, Sanmichele. Man hat diesen Torbau später in den neuen Ehrenhof-Trakt übernommen (unter Maria Theresia). In unseren Tagen hat man ihn neu fundamentiert. Er spricht vom Wunsch des Erbauers, hier Fuß zu fassen. Auch stolze Feste locken wieder auf die Burg: im Jahre 1616 wird die Kaiserin Anna zur böhmischen Königin gekrönt.
Doch unter der Oberfläche bohren die feindlichen Mächte. Stoßen blitzartig auf, verschwinden wieder. So in einem Landtagsbeschluß vom Jahre 1615: da muß der Kaiser den Ständen ein Defensivbündnis unter allen der Krone Böhmen einverleibten Ländern zugestehen, auch Truppenkontingente für den Fall der Gefahr. Die Stände sind stark. Stände –; das ist der Adel. Nationalismus regt sich. Nur Inländer sollen Ämter bekleiden dürfen, die tschechische Sprache soll obligatorisch sein. Wobei einige der Führer selbst, wie der deutsche Graf Thurn, doch kaum Tschechisch können! Ausländer sollen erst nach Erlernung der tschechischen Sprache das adlige Inkolat oder das städtische Bürgerrecht erhalten, aber nichtsdestoweniger samt ihren Nachkommen bis ins dritte Glied von den öffentlichen Ämtern ausgeschlossen bleiben.
Und zwei Jahre darauf zuckt die andere feindliche Macht empor: im Begehren des Kaisers, seinen Vetter Ferdinand, den Protestantenvertreiber aus Steiermark, als Nachfolger anzuerkennen. Er selbst war kinderlos, wollte für Habsburg sorgen. Die Stände erschraken. Der Hof arbeitete klug, gewann einflußreichen Adel. Viele aus den Ständen wichen aus. Die Wahl ging durch: Ferdinand unterschrieb Papiere, wird 1617 im Veitsdom gekrönt.
Der Riß klafft nicht zwischen den Nationen, nein: in den Nationen selbst. Die Czernin, die Lobkowitz, die Slawata stehen teils in den Reihen der Kaiserlichen, teils in denen der Ständischen. Alter tschechischer Adel dient dem Kaiser. Wilhelm Slawata war Statthalter mit Georg von Martinitz. Zdenko Adalbert von Lobkowitz war kaiserlicher Oberstkanzler. Deutscher Adel hält es mit den Ständischen: die Thurn, die Schlick, die Colonna von Fels. Von den Schlick stehen auch einige beim Kaiser. Religion trennt, aber auch persönliches Interesse trennt. Nicht nur ständisches Interesse, auch viel Standesinteresse. Die Prager, die böhmische Bewegung, geht ein in die große europäische Protestbewegung des Adels gegen die immer stärker werdende Fürstenmacht.
Prag, die Stadt, sträubt sich ja auch gegen den Anschluß. Wenn den katholischen und altutraquistischen Magistrat auch näherliegende Interessen geleitet haben mögen, so darf man das doch als tiefer bedingtes Symptom werten: die Stadt fühlt eben nicht mit dem Adel. Die Ständischen kalkulierten falsch. Religionsinteressen und Standesinteressen waren bei ihnen allzu unklar geschieden, ja waren wirr ineinander verflochten.
Man knüpfte Unterhandlungen an mit der protestantischen Union, mit den freien Niederlanden, mit Christian von Anhalt und über ihn mit Frankreich. Das verschob die ursprüngliche Politik. Denen allen, mit denen man unterhandelte, ging es neben der Religion um Aufrichtung neuer Fürstenmächte gegen Habsburg. So standen die böhmischen Stände im eigentlichen Sinn trotz aller Konspirationen doch isoliert. Die tragische Fügung muß reifen: gerade dieser Ständeaufstand sollte den Kampf entfesseln, in dem die Fürsten ihre Vormachtstellung dann endgültig befestigten.
Auch auf kaiserlicher Seite wurde nun unterirdisch gearbeitet. Von Wien her sickerte Einfluß des Kardinals Khlesl in die kaiserliche Politik. Wenn der Kaiser sein Patronatsrecht an den Erzbischof überträgt, so heißt das, daß künftig alle freien Pfarren im Lande von Katholischen besetzt würden. Und wenn im Jahre 1616 dem Clementinum so wichtige Privilegien und Befugniserweiterungen zugebilligt wurden, wie drei philosophische und vier theologische Kurse mit neu dotierten Einkünften für die hiezu notwendigen Professoren, so muß das im arg zurückgesetzten Carolinum auf die vertragsbrüchige Absicht der Kaiserlichen gedeutet werden, das Jesuitenkolleg zur vollen Universität auszubauen, das Carolinum aber zu erdrosseln.
Dumpfe Stimmung über Prag. Nachrichten vom Land, daß protestantische Kirchen eingerissen worden seien. Der Abt von Braunau habe dort die neuerbaute protestantische Kirche sperren, der Erzbischof jene von Klostergrab gar niederreißen lassen. Empörung bei den Ständen. Kirchengut ist Königsgut, ist also Landesgut. Der Majestätsbrief erlaubte freien Kirchenbau. Die kaiserlichen Statthalter aber werfen die Beschwerdeführer jener Gemeinden ins Gefängnis: der Majestätsbrief erlaube freien Kirchenbau nur den Ständen, nicht jeder beliebigen Gemeinde. Bei den Ständen galt: »freie Religionsübung für jedermann«, bei den Kaiserlichen galt schon: »cuius regio, eius religio.«
Aufgeregter Sonderlandtag der protestantischen Stände im Carolinum: Beschwerde an den Kaiser. Über die Statthalter kommt ungnädigste Antwort: alles sei der Wille des Kaisers, die Versammlung im Carolinum habe sich sofort aufzulösen, widrigenfalls man sie als Aufrührer behandeln werde.

Der Prager Fenstersturz 1618
Kupferstich. »Wahre Contrafactur wie die Kayserl. Räthe zum Fenster hinauss geworffen worden seind 1618« aus Graf Frantz Christoph Khevenhiller: Annales Ferdinandei, Leipzig, M. G. Weidmann 1724. Kopie eines Stiches aus Nikolaus Bellus: Österreichischer Lorbeerkranz, Frankfurt am Main 1627, der gleichzeitig als Flugblatt erschienen war, der aber auch wieder auf eine ältere Vorlage zurückgeht, auf einen nach Zeichnung des Georg Hufnagel (oder Hoefnagel), Hofmalers Rudolfs II., angefertigten Kupferstich von Franz Hogenberg (geb. zu Mecheln, gest. zu Köln 1590), der in einem von Georg Braun herausgegebenen sechsbändigen Sammelwerk, Bd. V: Urbium praecipuarum mundi theatrum, V, 1572-1618, erschienen war. Bellus hatte in den vorgefundenen Stich die Szene des Fenstersturzes einzeichnen lassen, offenbar von einem Ortsfremden, was die falsche Situierung erklärt: die Statthalterkanzlei, aus der die Statthalter herausgeworfen wurden, lag in dem Südvorbau des Wladislawschen Saalbaues (auf diesem Stück unter der rechten Vorderkante des Veitsturmes). Der noch immer nicht restlos geklärte Streitpunkt, ob der Fenstersturz aus dem 1. oder dem 2. Stockwerk heraus geschah, darf hier der größeren Wahrscheinlichkeit halber zugunsten der ersteren Annahme gedacht werden. (Vgl. hiezu Friedel Pick, Pragensia I, Prag 1918, S. 15 ff. Dort Literatur.)
Die Stände toben, organisieren sich. Schicken zur Altstadt, die sich an den Versammlungen nicht beteiligt hatte, um Abgesandte. Die verweigert die Beschickung: man werde in der Religion von niemand behindert, auch habe der Kaiser die Teilnahme an diesen Ständeversammlungen streng verboten.
Doch der Aufstand ist schon in vollem Gang. Die Ständischen besetzen die Burg (23. Mai 1618), debattieren in der Landtagsstube. Thurn wettert, man solle die verhaßten Statthalter, die Jesuitenknechte beseitigen. Die hätten von je gegen die Religionsfreiheit gearbeitet, hätten beim Kaiser gehetzt. Man dringt in die Kanzlei der Statthalter ein. »Werft sie nach alttschechischem Brauch (po staroèesku) aus dem Fenster«, soll einer geschrien haben. Schon packt man sie. Den alten Oberstburggraf von Sternberg und den Malteserprior Diepold von Lobkowitz, die gerade anwesend sind, führt man hinaus. Dann wirft man zuerst Martinitz, dann Slawata aus dem Fenster. Hinterher noch den Geheimschreiber Philipp Fabricius.
Sechzehneinhalb Meter tief war's hinunter in den Burggraben. Keiner der drei war tot, nur Slawata war ernstlich verletzt! Er war noch den Hang hinabgerollt. Martinitz konnte gleich aufstehen. Er wurde zwar von Soldaten noch beschossen, kam aber doch Slawata zu Hilfe, richtete ihn auf und übergab ihn den beispringenden Dienern. Die schleppten ihn, während Martinitz auf des Slawata Drängen entfloh, aus dem Graben bis zum Haus des Oberstkanzlers von Lobkowitz (am Schwarzen Turm). Dort nahm ihn dessen Gattin Polyxena auf, ließ ihn verbinden, verweigerte seine Herausgabe dem stürmisch andrängenden Grafen Thurn. Der Schreiber Fabricius hatte sich gleich davonmachen können, war in sein Haus in der Altstadt geflohen, dann weiter nach Wien.
Die Welt draußen erschrak, als die Kunde von diesem Prager Fenstersturz hinausdrang. Flugblätter mit detaillierter Schilderung tauchten überall auf. In Wien staute sich Wut. Ein Druckpunkt war gegeben, der furchtbare Auslösung suchte. Prag war im Aufruhr.
Jetzt war nicht Zeit, sich zu wundern, daß keiner der Statthalter zu Tode gefallen war. Erst später setzte katholischerseits Legendenbildung ein. Jetzt war Aufruhr, jetzt war Krieg! Jetzt galt es, das Land zu sammeln, die Stellung zu halten.
Der Altstädter Rat wurde nochmals zum Anschlusse aufgefordert: falls den Herren ihr Leben lieb wäre! Vor dem Rathaus drohte das Volk. So sandte man also Delegierte, verwahrte sich aber doch beim Oberstburggrafen: nur gezwungen habe man sich angeschlossen. Diese städtische Bourgeoisie, die im Rat herrschte, war nicht für Empörung. Die gärte nur hoch oben und ganz unten, wie je. Die Neustädter kamen von selbst, auch die andern Städte des Landes. Dreißig Direktoren wurden eingesetzt, Thurn zum Oberbefehlshaber der Armee bestimmt.
Prag war im Taumel. Und doch: man atmete nicht frei. Auf der einen Seite verjagte man den Erzbischof, die Äbte von Strahow und Braunau aus dem Land, dann die Jesuiten. Auf der andern Seite schrieb man an den Kaiser Entschuldigungsschreiben, die den Vorgang des Fenstersturzes als nur gegen die Statthalter gerichtet darstellten. Zuerst schrieb Martin Frubein von Podol (Frobenius), Mitglied der Direktorialregierung, eine Apologie. Schon zwei Tage nach dem Fenstersturze wurde sie der Ständeversammlung vorgelegt, sogleich dem Kaiser übersandt, auch in Druck gegeben. Drei Monate später wurde des Grafen Schlick »Andere Apologie«, deutsch verfaßt, nach Wien gesandt. Man war nur erst Empörer gegen örtliche Gewalten, wollte nicht gegen die Dynastie angehen.
Doch die Lawine rollte. Verständigungsversuche mußten fehlschlagen. Wien sandte Heere, die Ständischen sandten Heere. Thurn stieß gegen Österreich vor. Belagerte später sogar Wien. Harant befehligte die Artillerie, beschoß die Burg. Matthias war damals schon tot, Ferdinand II. zitterte um sein Leben. Erich von Mansfeld, den die Ständischen als Heerführer gewonnen hatten, lieferte den Österreichern Scharmützel, eroberte das kaisertreue Pilsen, wurde dann aber von Buquoy, dem kaiserlichen General, geschlagen. Thurn mußte aus seiner siegreichen Stellung zurückgerufen werden. Krieg!
In der Stadt tagten die Stände, herrschte das Direktorium. Man mußte sich sichern, nach innen, nach außen. Man verhandelte mit der protestantischen Union, mit Sachsen, mit Schlesien, mit Ungarn. Jessenius, jetzt Rektor der Universität, reiste nach Preßburg, um gegen die Wahl Ferdinands zum ungarischen König zu wirken. Wurde dort verhaftet, nach Wien gebracht, über ein halbes Jahr in modrigem Turm gefangengehalten. Graf Schlick, ehemals Prinzenerzieher am sächsischen Hof, wollte Sachsen für die böhmische Sache gewinnen. Entscheidende Bündnisse kamen nicht zustande.
Man setzte den Magistrat der Altstadt ab, ersetzte ihn durch ständische Leute. Zwar: Kirchmeier, der des Heidelius Nachfolger geworden war, blieb Primator, da man es mit den Altutraquisten nicht verderben wollte. Aber Kanzler wurde Nikolaus Troilus, Magister des Carolinums.
Das Carolinum stellte den Direktoren auch andere Kräfte zur Verfügung. Schien doch mit der Vertreibung der Jesuiten eine günstige Wendung für es gekommen. Vor allem der Rektor Jessenius wirkt für die Stände. Im Jahre 1617 war dieser berühmte Arzt zum Rektor des Studiums gewählt worden. Mit der Sitte, Söhne reicher Würdenträger zu Rektoren zu wählen, hatte man schlechte Erfahrungen gemacht. In Jessenius hatte man wieder –; zum erstenmal seit Bacháèek –; einen selbständigen Geist zum Führer, einen Mann, der auch in die Politik des Landes führend eingriff. Jetzt hatte er eine Denkschrift an den Generallandtag über die Erneuerung der Universität gerichtet. Lateinisch, tschechisch und deutsch ist sie im Druck erschienen (Pragae, typis Pauli Sessii typographi academici). Man ging im Carolinum mit allen Kräften an den geistigen Ausbau der Lage. Es steht jetzt wieder in hoher Geltung. Das Clementinum wird ihm zugesprochen, aber die Zusprechung bleibt auf dem Papier. Die Einkünfte des Clementinums fließen der königlichen Kammer, das heißt den Ständen zu, die Gebäude werden zu Soldateneinquartierungen gebraucht. Nur die Bibliothek wird Ende 1619 den Magistern des Carolinums übergeben und dadurch vor weiterer Beschädigung durch die Soldateska bewahrt. Wirklicher Aufschwung der Universität unter dem Direktorium gelang nicht: ihre geistigen Kräfte wurden durch die Politik aufgebraucht, ihre wirtschaftlichen Kräfte in nichts gestärkt.
Denn der Krieg fraß Geld. Kontributionen, Steuern reichten nicht aus. Man dachte daran, die Juden auszuweisen, zumindest ihren Handel, der den Christen das Geld entzöge, aufs Gebiet der Judenstadt, auf deren Tandelmarkt zu beschränken. Man war nicht allzu judenfreundlich gesinnt bei den Ständen. Man schröpfte die Juden nach Kräften, auch noch unter dem Winterkönig.
Man dachte sogar daran, die Kunstkammer auf der Burg oben zu Geld zu machen. Schon wurden Verzeichnisse angelegt. (Sie befinden sich jetzt im Skokkloster in Schweden.) Man kam nicht zum Verkauf. Die äußeren Ereignisse überstürzten sich. Matthias war gestorben, Ferdinand sollte König werden. Die Stände verwarfen ihn, debattierten um eigene Königswahl. Profile der Führerpersönlichkeiten umreißen sich schärfer vor der Folie dieser Wahldebatten. Schlick, der kulturfreundliche Hofmann, Jenenser Student, bewandert in der Diskussion, ein Mann kluger Verhandlung, ist für Dresden, wirbt für den Kurfürsten von Sachsen. Budowetz, der vornehme Brüderfreund, tiefnationaler Tscheche, aber ohne Haß, neigt zum Calvinismus, tritt für Friedrich von der Pfalz ein. Thurn, der Draufgänger, deutscher Alpenadel, schwer und hitzig, ist immer für Kampf. Jessenius, erzogen in Breslau, dann auf deutschen Universitäten, klarblickender Geist, wägt und spricht, reißt mit.
Der Pfälzer ist das Haupt der Union. Politische Berechnung treibt immer mehr zu des Pfälzers Gunsten. Seine Wahl geht durch. Johann Georg von Sachsen bekommt nur sechs Stimmen. Er beschuldigte insgeheim vielleicht, feig und nachträgerisch wie er war, den Grafen Schlick ob solcher Bloßstellung.
Friedrich nimmt an. Er bedarf eines Königsthrones, um den Ehrgeiz seiner Gattin, der englischen Elisabeth, zu befriedigen. Er zieht in Prag ein, wird mit der Gattin am 4. November im Veitsdom gekrönt. Die Prager Burg hat wieder einen König. Hat das Haupt der protestantischen Union zu ihrem König. Man vertraut und jubelt, feiert glänzende Feste. Rom-Habsburg rüstet.
Von Wien aus laufen die Boten in die katholische Welt. Maximilian, Herzog von Bayern, Haupt der Liga, leitet die Aktion. Auch Protestanten werden gewonnen. Johann Georg, sächsischer Kurfürst, Lutheraner, schließt sich an gegen die Calvinisten. Er will die Lausitz für sich.
Von Prag aus laufen die Boten in die protestantische Welt, auch nach England. Vertröstungen kommen. Und Heerführer ohne Heer und ohne Führertum. Hohenlohe und Christian von Anhalt. Die werden den eigenen tüchtigen Führern, dem Thurn, dem Harant vorangestellt. Das Königspaar sitzt auf der Burg, hält sich ein Königtum. Die Stände sitzen in der Stadt, halten sich ein Königspaar.
Viel Gerede in den Verhandlungen, viel Formenkampf. Mit Friedrich waren die Calvinisten nach Prag gekommen. Sie hausen im Veitsdom: werfen alle Altäre, alle Bilder und Statuen hinaus, reichen vom weißgedeckten Tisch das Brot. Die Katholiken grollen. Auch die Utraquisten, ja selbst die Protestanten sind verletzt. Der Wyschehrader Domdechant –; der Erzbischof war verbannt –; schrieb an Schlick, den man nach der Lausitz als Landvogt geschickt hatte, um Einspruch. Der versucht ihn: man solle das Volksempfinden schonen. Er wird kaum gehört. Ja, die Königin, die stolze, nimmt Anstoß am Kruzifixus auf der Brücke: der nackte Bader dort beleidige ihre Augen. Man solle ihn entfernen. Empörung im Volk. Der Altstädter Magistrat stellt eine Wache vor das Kruzifix. Einige Tage später ist es doch in die Moldau gestürzt worden. »Ist das unser König, der uns die Schönheit nimmt und unter Gastmählern und Schlemmereien das Land beschimpft?« Man hat bald genug von dem neuen Glanz auf der Burg, von der hohlen Fassade.
Es war nur Fassade. Die Stände wachten eifrig darüber, daß ihrer Machtbefugnis nichts entrissen werde. Als die Universität unter Jessenius in der königlichen Kanzlei vorspricht, ihr die Clementinumgüter auszuliefern, fährt Schlick sie hart an: Warum sie sich nicht an die Defensoren gewendet hätte? Den König gehe dies nichts an. Weist sie ab.
Man war keine einige Macht in Prag. Zuviel Teilmächte standen gegeneinander. Querrisse im politischen Aufbau: Königtum, Ständetum, Volkstum. Längsrisse zwischen den Religionen: Calvinisten, Lutheraner, Altutraquisten, Katholiken. Zuviel Direktoren, kein Führer. Zerrissene Verwaltung, flaues Heer. Maximilian, der über Südböhmen einbricht, hat leichtes Feld. Unter ihm befehligten Tilly, Buquoy. Auch Liechtenstein war beim Heer. Der Sachse fiel in der Lausitz ein, Kosaken bedrängen von Polen aus Schlesien. Vom Hradschin sprengen die Boten in alle Welt, auch nach Siebenbürgen, zu Bethlen Gabor. Noch weiter in die Türkei. Immer nur Versprechungen. Von Süden her droht die Hauptgefahr.
Maximilian rückt vor. Christian von Anhalt, böhmischer Oberbefehlshaber, zieht sich zurück, bezieht Stellung oberhalb von Prag auf dem Weißen Berg. Die Bayern und Österreicher drängen nach. Am 8. November stehen die Heere einander gegenüber. In Prag wird debattiert, der König aber tafelt. Im kaiserlichen Lager tagt Kriegsrat: Maximilian, auch Liechtenstein sind für sofortigen Angriff –; Buquoy zögert. Dominicus a Jesu, Karmelitermönch, entflammt das kaiserliche Heer zur Wut gegen die Ketzer. Drommeten blasen. Der Angriff beginnt. Wird rasch vorgetragen. Die Ständischen weichen. Am längsten hält sich Thurns Sohn auf den Scharkahöhen. Vergebens. Die Ordnung löst sich auf, flutet gegen Prag zurück. Die Kaiserlichen nach. In wenigen Stunden war die Schlacht entschieden.
Böhmens Schicksal entschied sich an der Verwirrung im Innern. Friedrich war in letzter Stunde zum Strahower Tor geeilt, »seinen Truppen Mut einzuflößen«. Die Flucht riß ihn mit. Gehetzter Aufbruch auf der Burg. Die Reichskleinodien werden auf Wagen gepackt, auf den Altstädter Ring gefahren. Der König, auch die Königin sollen beim Altstädter Primator Kirchmeier übernachtet haben. Bürger fragen: »Was tun?« »Sucht euer Heil in der Unterwerfung.« »Nein,« schreit der junge Thurn, »noch haben wir Truppen, noch haben wir die Stadt! Kämpfen wir!« Aber im Morgengrauen flieht der König. Mit ihm der ganze Troß, Breslau zu. Die Wagen mit den Schätzen lassen sie stehen. Das Königtum war an einem Feigling zerschellt. Die Führer zerstoben. Herrenlos lag Prag.
Maximilian von Bayern zieht ein. Die Kleinseitner huldigen zuerst. Die Altstadt bietet Bedingungen der Unterwerfung. »Nein, bedingungslos.« Man gehorcht. Die Universität schickt unterwürfige Gesandtschaft. Maximilian verspricht Pardon. Die Truppen hausen schon in den Städten.
Acht Tage vergehen. Viel Plünderung, viel Schrecken auf den Straßen. Maximilian rüstet zum Aufbruch. Läßt Wagen beladen mit Schätzen aus der Kunstkammer, aus den Palästen. Er selbst ist eifriger Sammler, übt Kriegsrecht zugunsten seiner Münchner Residenz. Bestellt den Fürsten von Liechtenstein zum »subdelegierten Kommissarius« und verläßt Prag. Der Beutezug von 500 Wagen folgt ihm polternd nach.
Noch immer hausen die Truppen in den Städten. Vor allen die Scharen des Buquoy treiben es arg und die des Obristen Albrecht von Waldstein. Ständische werden mißhandelt. Dem Frubein, ständischem Sekretarius, wird von Soldaten, die bei ihm plündern, mit Fackeln der Schoß verbrannt. Viele werden drangsaliert. Schrecken über Schrecken. Die Häuser der geflohenen Führer werden ausgeraubt. Volksmassen, im Innersten unbeteiligt an den Händeln der »Oberen«, lungern erschreckt herum: haben nichts zu verlieren, zittern doch vor dem neuen Feinde. Mit der Judenstadt wird glimpflich verfahren. Von Wien war der Befehl gekommen, die Juden zu schonen. Endlich wird Buquoy gegen Mähren beordert. Ruhe kehrt ein. Tödliche Ruhe.
Liechtenstein, der Kommissarius, residiert in seinem Hause am Wälschen Platz. Was wird geschehen? Maximilian hatte Schutzbriefe ausgestellt. Auch Johann Georg von Sachsen. Wird der Kaiser sie respektieren? Jetzt kommt der Erzbischof zurück, die Prälaten, die andern Geistlichen ziehen wieder in ihre Klöster. Die Jesuiten besetzen wieder ihr Clementinum. Alles verläuft so unheimlich ruhig. Führer der Ständischen, die geflohen waren, kehren schon zurück. Auch der alte Budowetz, der während der Schlacht von Prag abwesend war: er dürfe seine Heimat jetzt, wo sie in Not sei, nicht verlassen.
Thurn ist in Deutschland. Schlick wird aus der Lausitz vertrieben. Am 24. Dezember das Dekret aus Wien: Liechtenstein solle der »Prinzipalrebellen« sich versichern, solle auch mit General Tilly sich beraten, wie man der Flüchtigen habhaft werden könne. Erste Verhaftungen. Darunter Jessenius. Die Festgenommenen werden im Altstädter Rathaus gefangengesetzt.
In Wien unterdessen debattiert man über die Bestrafung der Empörer. Grausame Vorschläge, Milderungsvorschläge dagegen. Ferdinand begutachtet alle, lauscht auf Einflüsterungen der Mönche, schielt nach Rom. Er will nicht sich rächen, Gott will er rächen. Er ist Jesuitenzögling, ist im Jesuitenkolleg zu Ingolstadt aufgewachsen. Hauste dann drakonisch in Steiermark. Betet und kann doch nicht vergessen, daß ihn die Ständischen fast um den Thron gebracht hatten, damals, als sie ihn unter Thurn und Harant in seiner Burg in Wien bedrängten. Persönliche und göttliche Rache verschmilzt in seiner bigotten Seele. Er fragt Maximilian, den starken Helfer, um Rat. Der ist für Strenge, doch gegen Übermaß. Die Befehle laufen nach Prag: die Liste der Festzunehmenden.
Liechtenstein, der Kommissarius, amtet. Er ist Mährer, evangelisch erzogen. Vor zwanzig Jahren, als in Mähren die große Rekatholisierung einsetzte, war er zum Katholizismus übergetreten. Er hatte für Matthias sich eingesetzt, war dann durch Khlesls, des Kardinals, Einfluß in Wien zurückgedrängt worden. Nun kam er wieder zur Macht, ein Renegat. Er ist vorsichtig. Von Prag aus ergibt sich andere Prozeßführung als von Wien aus. Er gibt nach Wien zu bedenken, daß Maximilian Sicherheit des Lebens und des Gutes zugesagt habe, daß allzu große Strenge die übrigen noch nicht unterworfenen Kronländer abschrecken, daß man auf den protestantischen Bundesgenossen Rücksicht nehmen müsse, und noch manches andere. Wien antwortet mit strikten Befehlen.
Prag brütet in Ungewißheit. Die Magister des Carolinums geben den Jesuiten in offiziellem Besuch die Bücher zurück. Der Jesuitenrektor dankt für die Verwahrung der Schätze, bietet den Magistern die weitere Benützung an. Man ist sehr höflich gegenseitig. Aber Jessenius bittet aus dem Kerker um Geld, damit er sich verpflegen könne.
Und am 2. Februar wird ein zweiter Schub von Empörern verhaftet. Liechtenstein hatte sich mit Tilly, mit dem Obristen von Waldstein, mit dem Grafen Michna beraten. Das sind die Machthaber in Prag: Tilly, der General, Waldstein, der skrupellose Söldnerführer, Michna, der emporgekommene Sekretär. Man war übereingekommen, die vom Herren- und vom Ritterstand in Liechtensteins Haus, die vom Bürgerstand auf die Rathäuser der Städte zu laden, sie dort festzunehmen.
Harant war außerhalb. Ihn ergriff der Obrist von Waldstein auf seinen Gütern. Schlick trieb sich im Sächsischen herum. Hoffte auf Begnadigung durch den sächsischen Kurfürsten. Thurn war fern.
Neue Listen aus Wien, neue Verhaftungen in Prag. Die gefangenen Direktoren richten an den Kurfürsten von Sachsen ein Gesuch um Fürsprache beim Kaiser. Dresden rührt sich nicht. Im April tritt der Gerichtshof zusammen. Liechtenstein weigert sich, als Präsident zu fungieren: solch hochnotpeinliches Gericht, auf dem die Augen aller Welt ruhten, müsse vom Kaiser selbst geleitet werden. Falls Seine Majestät nicht herkommen könne, so wolle er nur deren Delegierter sein. Aus Wien ward abgekürztes Verfahren verlangt. Nun hatte man auch Schlick aufgetrieben. Ein sächsischer Offizier hatte ihn auf dem Schloß von Verwandten an der sächsisch-böhmischen Grenze aufgespürt, ihn nach Dresden eskortiert. Alle Bitten, die der Graf an den Kurfürsten, auch an den von Liechtenstein gerichtet hatte, frommten nichts. Traurig zu lesen, wie dieser tapfere Kämpfer von Angst und Verzweiflung gehetzt wird, wie er schwach wird, demütig fleht und zum Schluß doch von seinem ehemaligen Zögling Johann Georg ausgeliefert wird nach Prag. Am 27. Mai wird er hier eingebracht und in den Weißen Turm gesetzt. Das Verfahren ist in vollem Gange.
Der Gerichtshof verhört. Unter den Anwälten ein Dr. Melander, nicht ganz einwandfreier Vergangenheit. Auch unter den andern sind Kreaturen, die der Umsturz heraufgespült hatte. Deutsch und tschechisch wird fungiert. Einzelverhöre nach 236 Punkten. Fenstersturz, Absetzung Ferdinands, Verhandlungen mit andern Mächten sind Kernfragen der Untersuchung. Dem Jessenius wird vor allem die Reise nach Preßburg verargt. Aufruhr, Hochverrat ist die Anklage. Die Delinquenten ahnen ihr Schicksal. Ihre Frauen werfen sich dem Fürsten Liechtenstein zu Füßen. Vergebens. Urteile werden gefällt: Tod durch das Schwert, durch den Strang, Herausschneiden der Zunge, Vierteilung, Abhackung der Hände –; die Strafen immer in bezug auf das Vergehen. Bei allen Konfiskation der Güter.
Die ersten Urteile laufen nach Wien. Liechtenstein fügt bei verschiedenen Begnadigungsvorschläge hinzu. Der Kaiser unterschreibt, fordert in Eile die übrigen. Gier und Angst gleicherweise sprechen aus seinen Hetzbefehlen. Immer mehr Urteile werden gefällt. Die Stadt zittert. Der Katholizismus arbeitet an der Rückgewinnung der Ketzer. Der Altstädter Magistrat ist erneuert, mit katholischen Leuten besetzt. Die Calvinisten, auch alle »Böhmischen Brüder« müssen im März 1621 die Stadt, das Land verlassen. Lohelius, der Erzbischof, stellt im Veitsdom die neuen Altäre auf, restituiert die übrigen Kirchen, setzt im Lande die katholischen Geistlichen wieder ein. Waldstein hilft mit Soldateska nach, führt strenges Regiment in Prag, im Land. Protestanten fliehen. Alle Güter der Flüchtigen werden konfisziert. Es winkt reiche Beute.
Droben auf der Burg wird gerichtet. Über alle Eingekerkerten war das Urteil nun gesprochen. Siebenundzwanzig sollten sterben, viele andere zu lebenslänglicher oder vieljähriger Haft begnadigt, ihre Habe konfisziert werden. Wien drang auf Vollzug. Und während drunten auf dem Altstädter Ring der Platz mit Sand bestreut, vor dem Rathaus ein hohes Gerüst, 16 Meter im Quadrat, drei Meter hoch, aufgeschlagen, mit schwarzem Tuch bezogen wurde, rangen im Weißen Turm, in der Daliborka, auf den Rathäusern der drei Städte die Verurteilten mit ihren letzten Tagen. War dieser böhmische Aufstand auch nicht bis in seine letzten Tiefen lauterer Religionskampf gewesen –; wieviel Ständepolitik hatte hereingespielt! –;, die letzten Tage hatten alle diese Herren doch zu großer evangelischer Reinheit geläutert. Einer hielt es nicht aus: Martin Fruewein. Der stürzte sich aus dem Turmfenster auf den Hof und blieb tot liegen. Sogar am Toten wurde das Urteil noch vollstreckt: Enthauptung, Vierteilung (auf dem Weißen Berg). Die andern blieben aufrecht.

Die Prager Exekution 1621.
gleichzeitiger anonymer Kupferstich, Druckort unbekannt. Der unter der bildlichen Darstellung beigefügte Text, der die Exekution beschreibt, mußte aus buchtechnischen Gründen fortgelassen werden. Sofort nach der Hinrichtung erschienen in ganz Europa zahlreiche Flugblätter, die den Prozeß und die Hinrichtung in Wort und Bild teils vom protestantischen, teils vom katholischen Standpunkt aus schilderten. Die meisten Flugblätter gehen auf die gleiche Bildvorlage zurück, zu der nur der Text variiert wurde. Wir wählten ein Blatt, das die zahlreichen Vorgänge in zwei Bildern zusammendrängt, dabei topographisch ziemlich genau bleibt. Vgl. Fr. Pick, Pragensia V, Prag 1922, S. 203 ff.
Man hatte ihnen Mönche in die Zellen geschickt, sie zu bekehren: Jesuiten. Sie hatten sich standhaft gewehrt. Dann hatte man auch protestantische Geistliche zugelassen, darunter die Deutschen. Von Dr. Rosacius, Prediger bei der tschechischen Protestantengemeinde bei St. Niklas auf der Kleinseite, und von Pfarrer Lippach, Prediger der deutschen Salvatorgemeinde in der Altstadt, liegen Berichte über die letzten Stunden der Verurteilten vor.
Am 20. Juni abends um acht Uhr wurden die Verurteilten aus den verschiedenen Gewahrsamen heruntergebracht ins Altstädter Rathaus. Ein Detachement von 700 Reitern war in die Stadt beordert worden, um mit des Obristen Waldstein Soldaten zusammen die Ruhe in den Straßen zu sichern. Am 21. morgens um fünf Uhr dröhnten die Geschütze. Dumpfe Trommeln. Auf dem Rathausaltan sitzen die Behörden, die Magistrate der Städte. Einzeln werden die Delinquenten aus dem Rathaus herausgeführt, hinauf aufs Schafott. Streng nach der Ordnung ihres Ranges.
Als erster Graf Schlick, der Deutsche: in schwarzen Samt gekleidet, ein Buch in der Hand, »mit heiterem Gesicht«. Dann Wenzel Budowetz, Freiherr von Budow, 74 Jahre alt, der Böhmische Bruder. Er hatte die Begleitung der Geistlichen, der Nicht-Calvinisten, verschmäht, stieg ganz allein aufs Schafott. Dann Christof Harant, Freiherr von Polžic, die Künstlerseele, die die Welt gesehen und aufgesogen hatte. Als fünfter Kaspar Kaplíø, Ritter von Sulewitz, der Sechsundachtzigjährige. Man hatte ihm bedeutet, er solle den Fürsten um sein Leben bitten. Es werde ihm geschenkt werden. Nein, er wollte lieber für seinen Glauben sterben. Und Dionys von Czernin, der bis zum letzten Augenblick nicht glauben wollte, daß er sterben sollte, nur weil er den Ständischen nicht kraftvoll genug widerstanden habe, als sie zum Fenstersturz auf der Burg eindrangen. Sein Bruder Hermann saß droben auf dem Rathausaltan; als man den Bruder heraufführte, soll er die Tribüne verlassen haben, erst danach wieder erschienen sein. Jessenius ging, von allen vier deutschen Predigern begleitet. Man schnitt ihm die Zunge heraus –; mit ihr hatte er gesündigt –;, dann rollte sein Haupt. Und Sixt von Ottendorf und Otto von Loos und Friedrich Bila und der Ratsherr Kuttnauer, der an einem zum Rathaus herausragenden Balken aufgeknüpft wurde. Und Dr. Hauenschild, der Jurist, und alle die andern. Drei hingen am Galgen, alle andern wurden enthauptet. Um neun Uhr war die Exekution beendet.
Und während man die Leichname einiger auf dem Veits-Berg vierteilte und die Köpfe von zwölf Direktoren auf dem Altstädter Brückenturm an eisernen Haken befestigte, während das Volk von Prag in eitler Gafferlust und in tiefem Jammer, so wie es einen jeden berührte, von all den Greueln langsam abgestumpft ward, lag in Mariazell der Kaiser am Altar, betete für die Seelen derer, die er dem Henker überantwortet hatte.
Das war das Prager Blutgericht, das die Welt erschauern ließ: Antwort auf den Fenstersturz, Fanal für jahrzehntelange Greuel. Man hatte den Prozeß geflissentlich nur gegen »Rebellen« geführt, nicht gegen Protestanten: der sächsische Kurfürst war ja noch Bundesgenosse. Mußte Czernin nur bluten, damit auch ein Katholik unter den Gerichteten war? Aber man hatte den Protestantismus trotzdem an der Wurzel gepackt. Nicht gegen Tschechen ging es –; unter den 27 Toten auf dem Blutgerüst lagen fünf Deutsche. Es war kein Tschechenaufstand gewesen. Gegen die Ketzer wurde gekämpft, gegen deutsche und tschechische, gegen »Brüder« und Protestanten und Utraquisten. Rom hatte an Habsburg den treuen Sohn. Vor der Welt aber war nur die »Rebellion« gesühnt.
Unter dem Religionskampf wühlt die Zeit. Habsburg verficht den erstarkenden Gedanken des monarchischen Beamtenstaats gegen den veralteten Ständestaats-Gedanken. Die moderne Großstaatbildung wirft sich gegen den ständischen Partikularismus. Habsburg blüht auf.
Und in den Schrecken über die Vergeltung wächst die große Umschichtung, politisch, religiös, sozial. Es waren da noch die vielen zu Kerkerstrafen und Verlust des Vermögens Verurteilten. Die Konfiskationen schritten fort. Schwindelnde Summen wurden erbeutet. Der Kaiser nahm nichts. Schenkte seinen Getreuen, belehnte die Klöster, verkaufte zu Spottpreisen. Es wurde damals geraten, den Verurteilten nur die Hälfte der Güter abzunehmen, die andere Hälfte ihnen zum Rückkauf aufzuzwingen: sie sollten es zu Lehen erhalten, sollten reichliche Zinsen dafür zahlen. So war einmal einer katastrophalen Entwertung durch übergroßes Angebot gesteuert –; hatte man am Hussitensturz gelernt? –; zum andern waren laufende gute Einnahmequellen dadurch geschaffen.
Ein schwunghafter Güterhandel erstand. Da kaufte der kaiserliche Adel die herrenlosen Güter und der einheimische Adel wetteiferte mit ihm. Frauen wurden als Käufer vorgeschoben, damit die Männer, die Lobkowitz und Slawata und die andern, sich nicht bloßzustellen brauchten. Liechtenstein erwarb unermeßliche Güter, legte den Grund zu dem Riesenvermögen, mit dem dann der Sohn Karl Eusebius so kunstsinnig schalten konnte –; seine Galerie! –;, um das aber dieser Sohn viel später auch noch Prozesse zu führen hatte. Der Obrist Waldstein kaufte und ließ sich schenken. Der konnte fordern: er hatte an Kriegsrüstung horrende Summen vorgeschossen. Jetzt holte er sich's mit Zinsen zurück und erweiterte seinen böhmischen Besitz schrankenlos. Da war der rohe Michna, ursprünglich Sekretär bei der Kammer, dann bis in den Grafenstand emporgeschoben. Er nutzte die Zeit, prellte die geldbedürftige Altstadt brutal um das Dorf Smichow. Prellerei war dieser Gutshandel um die 700 Strich Hafer, welche die Stadt für Truppenlieferungen dringend benötigte, so daß sie ihr der »kaiserliche Proviantmeister« gnädigst abließ. Einträglich genug waren solche Geschäfte, um nachher großherzige Stiftungen zu ermöglichen, wie die des Michna, der bei den Jesuiten zwei Plätze für Literaturstudenten stiftete, die Gelder für den Kirchenausbau spendete, wie die der Lobkowitz, die Maria Loretto gründeten.
Und während die Witwen und Kinder der Verurteilten jämmerliche Eingaben machen mußten um Rückerstattung eines Heirats-, eines Erbguts, während der protestantische Bürgerstand durch Konfiskationen, Ausweisungen, Erpressungsmaßregeln aller Art drangsaliert wurde, beginnen die Schlachtfeldhyänen das Unglück des Landes offiziell auszubeuten. Wien brauchte Geld. Von den Konfiskationen hatte der Kaiser nicht profitiert. Nun verpachtete er die Prager Münze. Da war der Amsterdamer Bankier Hans de Witte. Er war Calvinist und durfte es bleiben. Er schuf ja die Reichtümer, dem Kaiser und sich selbst. Dann der Obrist Waldstein, der gierige Michna. Da war auch der kaiserliche Hofjude Jakob Bassewi (der dann geadelt wurde zum »von Treuenberg«). Die bildeten ein Konsortium. Liechtenstein tat ungenannt mit. Alles Silbergeld wurde umgeprägt. Auf eine alte Mark, die 19 Gulden wert war, kamen anfangs 27, dann 39, am Ende des Jahres 1621 schon 79 Gulden. Die Schmelztiegel fraßen alles Silber weg, das aufzutreiben war. Die feste Pachtsumme war auf diese Weise schnell aufgebracht. Alles übrige floß in die Taschen der Konsorten. Aufkäufer, meist Juden unter Bassewis Direktion, reisten im Lande umher, boten neues Geld in hohen Summen für altes und für Silbergerät. Silberausfuhr war strengstens verboten. Vom Ausland zog man durch hohes Angebot neues Silber herein. Die Exulanten vermittelten damals große Verkäufe der zurückgebliebenen Protestanten im Ausland, schmuggelten auch protestantische Literatur herein. Die Preise in Prag stiegen ins Ungemessene: alles flüssige Gut, der Markt, die Arbeit wurden entwertet. Es galt nur mehr Silber. Man raste um Geld. Und während das Volk immer mehr verdarb, während aller fester Boden ihm unter den Füßen weggezogen wurde in dieser grausamen Inflation, da stiegen die Herren.
Waldstein baute sich seinen neuen Palast. Auf der Kleinseite kaufte er Hütten, Häuser, ganze Straßenzüge zusammen. Läßt einreißen, baut auf. Andrea Speza fertigt den Entwurf. Ein gewaltiger Palast entsteht (ab 1623). Geschlossene Massen um einen Arkadenhof. An der Gasse wird die Bauflucht zurückgenommen, der Entwicklung einer Fassade zuliebe. Die bleibt zurückhaltend, fast derb: über niedrigem Sockelgeschoß gehen die beiden in Proportion und Schmuck ganz gleich gehaltenen Hauptgeschosse auf. Die Fenster laufen in gleichmäßiger Reihung durch, nur ihre reichen Bekrönungen bringen Leben in die Fassade, künden den Barock an. Die drei Portale werden zur Gliederung der Gesamtfront kaum genutzt, das mittlere bringt nur erst einen schwachen Mittelakzent. Aber großartig steigert sich die Pracht im Innern. Als Freskant arbeitet Baccio del Bianco. Der große Festsaal geht durch die beiden Hauptgeschosse durch, seine Spiegelgewölbe und Wände prangen in reichem Stukkoschmuck, beste italienische Arbeit. Der Bau war von den Pieronis und Hans Barthel ausgeführt worden (Marini war nur als Maurermeister tätig).
Hier feierte der Friedländer seine phantastischen Feste, zu denen der Adel Europas sich drängte. Gegen den Park zu dann die höchste architektonische Steigerung. Dort öffnet sich, hoch wie der Palast selbst, in drei großen Bogen die monumentale Gartenhalle. Über gekuppelten toskanischen Säulen gehen die Arkaden auf, in Proportion und Bildung prachtvoll ausgewogen zu dem großen Ausmaß. In Mantua standen solche Loggien, »Sala terrena« genannt, doch keine von ähnlicher äußerer und innerer Größe. Eine »Loggia dei Lanzi« war hier in neuen Formen wieder erstanden. Der Außenraum, von den strengen Achsensystemen des Parks schon vorbereitet, wird hier großartig geformt und eingeführt ins Innere des Gebäudes. Die feinen Stukkaturen an den Rück- und Seitenwänden setzen zarte Kontraste zu dem großen Klang der Halle.
Der Park, umgeben von Dienerschafts- und Stallgebäuden und hohen Mauern (heute ist er um weniges beschnitten), schafft durch kunstvolle Achsensysteme auf verhältnismäßig kleinem Raum in Perspektiven, Platzanlagen mit Fontänen, Vogel- und Pflanzenhäusern eine große Freiarchitektur. Adriaen de Vries schafft prächtige Bronzewerke als Umrahmung einer Springbrunnenanlage. Die Schweden haben sie verschleppt (heute im Park von Drottningholm, in der Gartenhalle zu Prag stehen Kopien).
Auch draußen auf seinen Besitzungen läßt Wallenstein bauen. In seinem Herzogtum Friedland ersteht die sinnvollste Planwirtschaft, aus der er in genial ersonnener Weise den Bedarf seiner Armeen, vom Getreide bis zum Erz für die Kanonen, zu decken vermag. Königlich baut dieser Waldstein, während der Statthalter drüben –; 1622 war er in diese Würde erhoben worden –; im alten Hause am Wälschen Platze wohnt. Doch der Emporkömmling Michna eifert dem Konkurrenten nach, äfft ihn nach. Baut seinen Palast am Ausläufer der Kleinseite, am Aujezd. Auch er holt Italiener, auch er setzt die prächtige Sala Terrena in den Park, auch er will Feste feiern. Auch Bassewi soll auf geschenktem Grund am Rande der Judenstadt ein stattliches Haus errichtet haben. Er ist nun Herr wie die andern. Sein Glanz strahlt aus auf die Judenstadt.
Die Judenstadt profitiert nun ebenfalls unter den Zeitläuften. Sie war ins enge Quartier zwischen Altstädter Ring, St. Valentin und St. Salvator gepreßt. Nun greift sie aus. Juden erwarben die angrenzenden Häuser bei St. Niklas, bei Heilig-Geist. Waren doch genug schöne Häuser frei geworden in diesen Jahren. War doch der Handel mit ihnen in vollem Schwung. Die Altstadt wehrt sich, die Pfarrsprengel wehren sich: Steuern, die auf den Häusern liegen, gingen ihnen durch den Verkauf verloren –; die Judenstadt ist eigene Gemeinde. Der Judenrat bietet Entschädigung. Die Altstädter klagen wieder. Tatsache bleibt, daß diese Jahre das Ghetto ansehnlich erweiterten. Geld rollte in der Judenstadt: es wurde so viel auf den Markt geworfen von den Auswanderern wie von den Siegern. Und tappte man auch mal daneben mit einem Kauf, wenn es gesperrtes Gut, Diebsgut aus des Statthalters Haus zum Beispiel betraf, wie einmal im Jahre 1623, so daß der Obrist Waldstein grausam einschreiten konnte, so hatte man doch meist Glück, bereicherte sich, lebte gut und wurde geschont von »oben«. Als hätte der Protestantenhaß allen Judenhaß aufgesogen. Lange sollte dies gute Leben in der Judenstadt nicht dauern. Die Zeiten wurden zu schwer.
In den Christenstädten rund herum unter der sozialen Erdrosselung die politische. 1622 werden Stadthauptleute eingesetzt in die Städte. In der Altstadt wird der Bürgermeister abgeschafft, seine Befugnisse gehen an den Primator über. Der und sein Rat sind aber nur mehr Vollzugsbeamte. Alle Gewalt liegt beim Stadthauptmann. Hermann von Czernin ist der erste. Die Stadt war kein Stand mehr. Aber die Geistlichen werden wieder zum ersten Stand erhöht.
Immer tiefer greift die Faust, die die Ketzerei ausrottet. Schon im Jahre 1621 war das Archiv des Carolinums versiegelt worden. Gegen Schluß des Jahres müssen alle tschechischen lutheranischen Prediger die Stadt verlassen. Nun waren nur noch die deutschen Lutheraner da. Das Volk lief zu ihnen. Zur Salvatorkirche auf der Altstadt, zur Dreifaltigkeitskirche auf der Kleinseite. Wie lange noch? Im Februar 1622 wird eine Kommission ernannt unterm Altstädter Stadthauptmann, die ein Inventar über alle im Carolinumarchiv befindlichen Privilegien und Dokumente aufstellen soll. Die Magister ahnten das Ende ihrer Universität. Sie hatten flehende Deputationen nach Wien gesandt, waren vom Oberstkanzler Wenzel von Lobkowitz –; Ferdinand hatte die Kanzlei dorthin verlegt –; höchst ungnädig beschieden worden. Hatten dann auf Wiener Ratschläge hin an den sächsischen Kurfürsten sich um Hilfe gewandt. Dr. Hoe hatte sie teilnehmend und nichtssagend vertröstet. Liechtenstein aber hatte die Magister ob dieser Aktion im Ausland bös bewillkommt. Jetzt nahte das Ende. Im August legten die Magister und der Rektor ihre Ämter nieder. Im November kommt der Befehl: Übergabe des Carolinums an die Jesuiten.
Bollwerk auf Bollwerk fällt. Ende Oktober 1622 bekommen die deutschen lutherischen Geistlichen Weisung, die Stadt, das Land zu verlassen. »Nicht als Strafe«, wird ihnen bedeutet. Die flehen um Aufschub: Pfarrer Lippach und Dr. Schererz und ihre beiden Kollegen. Es sei Winter. Wohin sollten sie ziehen? Reisegeld wird ihnen bewilligt, Wagen zur Verfügung gestellt. Abschiedspredigten dürfen sie nicht halten. Das Volk weint bei ihrem Auszug. Viele geben ihnen das Geleite. Sie ziehen zum Sandtor hinaus. Draußen eine halbe Meile von Prag auf freiem Feld sprechen sie noch einmal zu ihren Pfarrkindern. Lippach hatte dreizehn Jahre in Prag gewirkt. Jetzt sollte er die Verzweifelnden zum letztenmal trösten. Dann gings über Leitmeritz nach Dresden. Dort in der Striesener Erlösergemeinde werden noch jetzt die wichtigsten Schriftzeugnisse der Prager Salvatorgemeinde verwahrt.
Und der siegreiche Orden schmückt seine neue Kirche (St. Salvator) immer reicher aus. In den Jahren 1618-1620 hatten die Protestanten hier gehaust. Jetzt (1624) werden Stukkateure berufen (Italiener?). Im ganzen Kirchenbau werden stukkierte Pilaster eingezogen, auch die Plafonds werden plastisch ausgeschmückt. Die Musikempore wird neu errichtet. Die gotisierend begonnene Kirche fügt sich dem Renaissanceklang.
Damals bekamen nun auch die Franzosen ihr eigenes Gotteshaus in Prag. Die Verbindung Ferdinands II. mit Frankreich hatte die französische Kolonie gestärkt: 1623 wird ihr die kleine Huskapelle überwiesen, die im Jahre 1582 von den Neu-Utraquisten auf dem Aujezder Friedhof errichtet worden war. Sie wurde dem heiligen Ludwig geweiht.
Lohelius, der Erzbischof, und Caraffa, der päpstliche Nuntius, hetzen beim Kaiser. Die katholische Welt sehe auf Prag, werde dem Kaiser zürnen, wenn er noch irgend welche Ketzer hier dulde. Weitere Schläge folgen. Im Januar 1623 wird der Kelch, den Georg von Podìbrad zwischen den Teyntürmen hatte aufstellen lassen, herabgenommen. Ja, die Gräber des Rokyzana und des utraquistischen Bischofs Luciana im Kirchenschiff werden aufgerissen, die Gebeine auf dem Friedhof verbrannt. Auch die Toten muß man vernichten.
Die Lebenden aber wurden bekehrt. Wer sich weigerte, durfte auswandern. Das flebile beneficium emigrandi war ihnen gelassen. Die Stadthauptleute bekamen Befehl, Verzeichnisse aller Bürger anzulegen. In vier Rubriken sollte vermerkt werden: 1. wer katholisch geboren sei, 2. wer jetzt katholisch geworden sei, 3. wer Hoffnung auf Bekehrung gebe, 4. wer auf keine Weise katholisch werden wolle. Da stellte sich heraus, daß die meisten in die vierte Rubrik sich hatten eintragen lassen.
So begann man wieder mit Gewalt. Ausweisungen in Menge. Die Ausgewiesenen durften ihr Hab und Gut verkaufen, mußten aber von dem geringen Erlös Pardongelder und einen bestimmten Prozentsatz zur Begleichung der Staatsschuld abgeben. So zogen die Besten hinaus, suchten in protestantischen Grenzländern Zuflucht, wanderten weiter nach Brandenburg, Polen, Holland und Skandinavien, südwärts nach Siebenbürgen, der Türkei. Tschechisches und deutsches Bürgertum wurde wieder gleicherweise betroffen. Aber während die Deutschen in ihrem Muttervolk draußen aufgehen, neue Wurzeln schlagen konnten, in Prag übrigens durch neu zuwandernde deutsche Katholiken ersetzt wurden, waren die tschechischen Auswanderer in den völkischen Tod getrieben, verlor das tschechische Bürgertum in Prag seine besten Kräfte.
Wohl hielten die Exulanten draußen ihre Schulen, ihre Gemeinden, pflegten eine eifrige Literatur. Da gab der Böhmische Bruder Paul Stránský in Holland seine »Res publica bojema« heraus, arbeitete in Freiberg in Sachsen der Lutheraner Paul Skála von Zhoø an seinem Bericht über die Verfolgungsgeschichte. In Pirna schrieb und druckte der unduldsame Samuel Martini von Dražow. In der Fremde reifte auch das Werk eines der edelsten Geister, den das tschechische Volk hervorgebracht hat: des Johann Amos Comenius (Komenský). Die Verfolgungen hatten ihn aus seiner mährischen Heimat vertrieben. Nach Prag sickerte nur in eingeschmuggelten Briefen und Büchern der Vertriebenen Kraft herein. Und versickerte wieder. Der tschechische Adel, auch er dezimiert, lebte viel zu sehr dem augenblicklichen Vorteil, um solchen Trümmern eines Volkstums kraftvollen Schutz zu gewähren. Im Gegenteil: Slawata schrieb seine habsburgisch-katholisch gehaltenen Memoiren und auch die übrigen huldigten dem machtvoll reifenden Despotismus.
Als dann der Sieger endlich selbst nach Prag kam (1627), da lag ihm eine katholische Stadt zu Füßen. Die Herrschaft in Böhmen war erblich gesichert, der katholische Klerus, wieder erster Stand im Land, sicherte die Ergebenheit der Untertanen ( Vernewerte Landesordnung). Ferdinand konnte sein Werk mit der Krönung des Sohnes im Veitsdom besiegeln. Im Clementinum spielen die Jesuiten auf.
Die Prager Hauptakteure wechseln, verschwinden teils ganz, teils nur für Jahre von der Bühne: Liechtenstein stirbt, Waldstein-Wallenstein wird Oberbefehlshaber, operiert im Norden, Bassewi wird gestürzt.
Dieser Sturz des Judenbankiers verlockt, noch einmal in die Judenstadt zu schauen. Die wirtschaftlichen Zustände dort verraten manches über die Gesamtlage Prags in dieser Zeit. Und die Selbstbestimmung, die die Judengemeinde seit alters genoß, läßt manches Bezeichnende dieser Zeit, vor allem das Eindringen des Absolutismus, dort plastischer hervortreten als in der geknebelten Stadt Prag.
Die jüdische Bevölkerung Prags sprach Deutsch und Jiddisch, man hielt sich damals an die Deutschen, auffällig ist die Verwendung deutscher Sprichwörter in Briefen. Erst in späteren Jahren finden sich viele tschechische Eintragungen in den Büchern. Arge Parteiungen zersplitterten Jahrzehnte hindurch das Leben im Ghetto. Um Bassewi –; sein ursprünglicher Name war Smiles –; hatte sich eine große Zahl Anhänger geschart, die mit ihm profitierten. Gegen ihn stand die Partei der Unzufriedenen. Die untergruben Bassewis Stellung allmählich und brachten es schließlich bis zur Anklage vor der Kammer. In Wien hatte man die Prager Finanzmanöver mißtrauisch beobachtet. Jetzt wußte man die Riesengewinne der Konsorten zurückzuholen. Selbst Liechtensteins Witwe wurde in einen Prozeß verwickelt. Auch Michna mußte damals um seine brutal erworbenen Reichtümer kämpfen. Nur an den allmächtigen Wallenstein traute sich niemand heran. Für Bassewi lief die Sache ungünstig aus. Er wurde verhaftet. Hätte ihm sein Geschäftsgenosse Wallenstein nicht Zuflucht gewährt auf seinem Gute Jitschin, der Prozeß wäre ihn sicher noch teurer zu stehen gekommen. Von Jitschin aus gelang es ihm nicht mehr, zu größerer Wirkung zu kommen.

Wallenstein.
Anonymer Kupferstich (Prag, Städt. Museum).
Die Bassewisten stifteten derweil noch viel Unheil in der Judenstadt. Große Steuerlasten lagen auf der Gemeinde. Die Armen beschuldigten die reichen Machthaber, daß die alles auf sie ablüden. Die »beschwerte« Partei stand der »Ältesten«-Partei gegenüber. 40.000 Gulden mußten von den Juden Böhmens jährlich an die königliche Kammer abgeführt werden. Die Prager Gemeinde als Vorort hatte für die Eintreibung zu sorgen, hatte übrigens den Hauptanteil zu tragen: nur 8000 Gulden kamen von draußen herein. Zu diesen Steuern kamen noch zahlreiche Sonderabgaben. Um die Besteuerung der einzelnen wurde grimmig gekämpft. Bei den unübersichtlichen Besitzverhältnissen im Ghetto, unter denen ein Haus, ja selbst eine Wohnung oft unter viele Besitzer geteilt war, blieb die Zuweisung der Steuerlasten vielfach dem persönlichen Ermessen der Ältesten überlassen. Nur die Darlehenssteuern waren von der königlichen Kammer einheitlich geregelt. Sie betrugen zehn Prozent. Alles kam darauf an, wer als Zensor die Steuern zuschrieb. Ein äußerst verwickeltes Wahlsystem bestimmte die Zensoren. Dauernde innere Fehden veranlaßten den Kaiser, einen christlichen »Inspektor« einzusetzen, ein Parallelorgan zum Stadthauptmann der christlichen Städte, das nur, um die Judenstadt den Christenstädten nicht gleichzusetzen, einen andern Titel erhielt. Er wurde aus der Reihe der hohen Kammerbeamten bestimmt. Kurz darauf wurde auch noch ein kaiserlicher, also christlicher Rentmeister eingesetzt. Die Macht des absoluten Herrschers greift so mit zwei wichtigen Ämtern in die Selbstverwaltung der Judenstadt herein. Wie eine Groteske wirkt es: gleichzeitig erweitert sich auch das demokratische Prinzip innerhalb der Gemeinde, alle Angehörigen des Ghettos erlangen das Wahlrecht.
Zu den inneren Kämpfen traten die Zuständigkeitsansprüche von draußen. Die Tuchhändler der Prager Städte wollen beim Kaiser ein Verbot auf Tuchhandel durch Juden durchsetzen. Die Fleischhacker der Prager Städte beschweren sich bei der Kammer und beim Erzbischof, daß die jüdischen Fleischhacker an Fasttagen Fleisch an christliche Käufer abgeben. Die christlichen Musikanten beschweren sich beim Erzbischof, daß die jüdischen Banden bei christlichen Taufen, Hochzeiten usw. aufspielen. Die jüdischen Musikerbanden behaupteten also immer noch den Ruf, den sie unter Rudolfs Zeiten sich erworben hatten. Schwerwiegender: im Jahre 1630 werden auch wieder die berüchtigten Judenpredigten eingeführt. 80 bis 100 Juden sollten regelmäßig die Predigten in der Kirche Maria an der Lake (Marienplatz, heute verschwunden) besuchen. Diese Predigten wurden von Jesuitenpatres in hebräischer Sprache abgehalten, waren aber weder bei den Betreffenden noch bei den Betroffenen beliebt. Die Prediger erhielten für eine jede Predigt eine hübsche Sonderremuneration. Aber diese Methode rief nur erhöhten Glaubensfanatismus bei den Juden hervor. Zum Christentum Abgefallene wurden teils mit Gewalt zum jüdischen Glauben zurückgebracht, teils verschleppt. Grausame Strafen, mit denen die weltliche und die kirchliche Gewalt drohten, schreckten nicht ab. Man hielt nur zäher zusammen.
Drüben bei den Christen setzten unterdes in den führenden Schichten folgenschwere Streitigkeiten ein, nagten die gewaltsam aufgerichtete Einheit von innen an. Die Jesuiten waren durch immer neue Privilegien, durch Zuweisung fast aller angefallenen Pardongelder, durch große Rührigkeit im Bekehrungswerk beängstigend erstarkt. Beängstigend für die andern Orden, besonders für die alten Rivalen, die Dominikaner. Auch für die Augustiner, die um Einfluß rangen. Sogar der Erzbischof fühlte sich beunruhigt durch die Macht innerhalb, ja schon gegenüber der Kirche.
An der Universitätsfrage brachen die schwelenden Mißhelligkeiten aus. Die Jesuiten sollten dem Kaiser Vorschläge einreichen, wie das eingezogene Carolinum einer neuen Universitätsverfassung einzugliedern wäre. Diese Vorschläge des Clementinums waren unverhohlene Usurpation: natürlich soll das Carolinum zum Clementinum geschlagen werden, der gemeinsame Rektor soll ein Jesuit sein, ihm müsse der Kanzler unterstellt werden! Von den vier Fakultäten sollen die theologische und die philosophische ausschließlich von Jesuiten geführt werden. Die Einkünfte sollen sich zusammensetzen aus den Jesuitenpfründen, die teilweise recht einträglich waren –; das Kloster Oybin war seit langem an die Stadt Zittau um 1400 Taler verpachtet –; und aus den Einkünften der Carolinumgüter, welche die Jesuiten jetzt verwalteten. Alle in dieser neuen Carolo-Ferdinandea Graduierten sollten in Kirche und Staat bei Stellenbesetzungen bevorzugt werden. Die gesamte Zensur, das gesamte Schulwesen müsse dieser Universität, das heißt also: den Jesuiten unterstellt sein.
Die Dominikaner und die Augustiner, denen damit aller Einfluß auf Schul- und Zensurwesen genommen war, vor allem aber der Erzbischof, dem mit dem Kanzlerposten auch jede Oberhoheit über das Studium entzogen war, erhoben Einspruch. Dieser Erzbischof, Graf Ernst Adalbert von Harrach, war ein energischer Geist. Er war im Collegium Germanicum in Rom erzogen und hatte vierundzwanzigjährig den erzbischöflichen Stuhl bestiegen. In ihm arbeitete jener neue Katholizismus, wie er aus den Reformen des Tridentinums, aus der tiefen Rezeption des Humanismus gereift war. Arbeitete gegen den zu Kampfzwecken dogmatisch erhärteten der Jesuiten. Harrach nahm den Kampf auf gegen die Allgewalt des Ordens. Protestierte beim Kaiser, protestierte in Rom, ergriff Gegenmaßregeln. Er wollte sich das Aufsichtsrecht über die katholischen Schulen im Lande, die seit der Wendung der Universität zum Protestantismus ihm unterstellt waren –; jetzt waren es ja alle Schulen im Lande! –; nicht entreißen lassen. Da der in Rom angestrengte Prozeß sich hinzog, arbeitete er auf eigene Faust: gründete ein Kleriker-Seminar, für das er den schon seit langem in Privathände übergegangenen Königshof in der Altstadt (beim Pulverturm) erwarb. Setzte in Rom für dieses Seminarium sogar die Berechtigung durch, akademische Grade zu verteilen. Der Strahower Abt Kaspar von Questenberg hatte ebenfalls ein Alumnat für den Nachwuchs seines Klosters errichtet (bei St. Niklas in der Altstadt, das als aufgehobene Utraquistenpfarre Ferdinand den Prämonstratensern 1628 geschenkt hatte) und der Abt von Tepl hatte dort einige Stellen für sein Kloster gestiftet. Gemeinsame Front gegen die Jesuiten war offenbar, drängte denn auch zur Vereinigung des erzbischöflichen und des Prämonstratenser Seminars. Man kaufte nahe dem Pulverturm schon Häuser für einen Neubau, trat aber noch nicht offen als Gegenuniversität auf.
Wir eilen der chronologischen Schilderung der Prager Geschichte voran, wenn wir diese Entwicklung des Universitätsstreites bis zu ihrer Lösung schildern. Ferdinand II. war gestorben (1637), sein Sohn Ferdinand III. hatte das Erbe des Despotismus angetreten: weniger bigott als der Vater, in der Hauptlinie seiner Politik von gleicher Eindeutigkeit. Er wollte die Universitätsfrage zu klarer Entscheidung bringen. Harrach war Kardinal geworden, hatte persönlich in Rom gegen die Jesuiten gearbeitet. Die Jesuitenuniversität, welche sowohl die Fakultäten wie die Güter des Carolinums an sich gerissen hatte, durfte laut päpstlichen Verbots keinerlei akademische Grade mehr verteilen. Die Zustände waren allmählich unhaltbar geworden. Ferdinand entschloß sich, den Jesuiten das Objekt des Streites: die beiden weltlichen Fakultäten samt den Carolinumgütern wieder abzunehmen. Er machte diese weltlichen Fakultäten unter einem königlichen Protektor selbständig. Erster Protektor wurde der Präsident am Appellationsgericht Friedrich von Talmberg. Nun durften die Jesuiten an den ihnen gebliebenen Fakultäten wieder Grade verleihen. Und auch die weltliche Universität, das frühere Carolinum, promovierte. Die Dinge schleppten sich unentschieden weiter. Schwedengefahr nahm alle Kräfte in Anspruch (1638-1639). Sobald sie vorüber war, trat Harrach, der Erzbischof, mit seinem Seminarium offen als Gegenuniversität auf.
Diesen Schritt mußte der Kaiser als Empörung gegen sein Herrscherrecht aufnehmen. Er verbot alle Graduierungen durch das erzbischöfliche Seminar, befahl sogar dessen Schließung. Die Unhaltbarkeit der gespaltenen Universitätsverhältnisse in Prag war damit aber nur offenkundiger geworden. Der Gedanke einer endgültigen Vereinigung der beiden ursprünglichen Universitäten tauchte wieder auf. Aber unter andern als den jesuitischen Bedingungen sollte eine Union vollzogen werden. Man ging nun von kaiserlicher Seite aus ernstlich ans Werk. Man bestimmte: das Kanzleramt solle dem Erzbischof zugestanden werden. Damit sollte dieser gewonnen werden. Die Exemtion der Universitätsangehörigen von der geistlichen Gerichtsbarkeit war jetzt allerdings eine einschneidendere Beschränkung der erzbischöflichen Macht als zur Zeit der Gründung des Studiums. Immerhin war die Oberhoheit des Kanzlers über die Universität gewahrt. Harrach nahm an. Die Rektorwürde sollte unter den vier Fakultäten wechseln. Die theologische und die philosophische Fakultät blieben den Jesuiten vorbehalten. Die medizinische und die artistische sollten auch weiterhin weltlich besetzt werden. Als Lehrgebäude wurden die alten Kollegien des Carolinums und das Clementinum bestimmt. Universitätskirche wurde der Teyn. Daß ein königlicher Superintendent allen Sitzungen des akademischen Senates beizuwohnen hatte, mit vollem Einspruchsrecht, das war die Faust des Absolutismus, die jetzt in die alte akademische Freiheit hereingriff. Im Jahre 1645 wurde unter großem offiziellem Pomp die Vereinigung der Universität zur neuen Carolo-Ferdinandea vollzogen.
Doch zurück zu den äußeren Geschicken seit 1630. Wallenstein war gestürzt worden, war nach Prag zurückgekehrt. Dort hielt er Hof wie ein heimlicher, nein, wie ein wirklicher König. Sein Hofstaat zog den Adel an. Sein Palast beherbergte Künstler und Generale. Feste von unerhörter Pracht weckten phantastische Legendenbildung in der verarmten Stadt.
An was für Plänen schmiedete dieser hagere dunkle Mensch mit den stechenden Augen, der tagelang nicht aus seinen Kabinetten trat, dessen heimliche Boten an die europäischen Höfe liefen, der Gesandtschaften empfing aus aller Welt und Hunderte, Tausende in die Schlingen seines Reichtums, seines Geheimnisses zog. Drohend unterm Hradschin lag sein Palast. Man denkt zurück ans Horoskop, das Kepler ihm gestellt hatte: »… der Saturnus im Aufgang macht müßige, melancholische, allzeit wachende Gedanken, Alchymiam, Magiam, Zauberei, Gemeinschaft zu den Geistern, Verachtung und Nichtachtung menschlicher Gebote und Sitten, auch aller Religionen; macht alles argwöhnisch und verdächtig, was Gott oder die Menschen handeln, als wan es lauter Betrug und viel ein anderes dahinder wäre, dass man fürgiebet … Und weil Mercurius so genau in opposito Jovis stehet, will er das Ansehen gewinnen, als werde er einen besonderen Aberglauben haben und dadurch eine große Menge Volkes an sich ziehen, oder sich etwa einmahl von einer Rott, so malcontent, zu einem Haupt- und Rädelführer aufwerffen lassen …«
Bei Breitenfeld waren die Kaiserlichen unter Tilly vom Schwedenkönig Gustav Adolf vernichtend geschlagen worden. Die europäische Mächtegruppierung hatte gewechselt: Sachsen stand nun gegen den Kaiser, marschierte gegen Prag. Der habsburgische Adel, die Beamten, die Kleriker flohen. Aussig war gefallen, Leitmeritz war gefallen. Arnheim, früher in Wallensteins Armee, befehligte die Sachsen. Jetzt brach auch Wallenstein, Prags heimlicher König, auf. Verließ in prunkvollem Zug die Stadt, gab dem kaiserlichen Befehlshaber auf dessen Anfrage, ob er Prag halten solle, zweideutige Antwort. So floh auch die kleine Besatzung. Als des Arnheim Trompeter vorm Strahower Tor zur Übergabe blies, baten die Magistrate nur um Schutz ihrer Privilegien, um Schonung der Bürgerschaft und öffneten die Tore (15. November 1631). Arnheim zog ein: verwundert, daß er ohne allen Widerstand die starke Stadt genommen. Verwundert gaffte auch das Volk: sollte man einem Befreier zujubeln, sollte man vor neuer Drangsalierung zittern? Zu wem man eigentlich gehörte, wußte man nicht mehr: das vergangene Jahrzehnt hatte die Instinkte getötet. Man war nur noch Untertan.
Mannszucht nach Landsknechtart: leerstehende Paläste wurden geplündert, in bewohnten nach derbem Soldatenrecht Einquartierung geübt. Nur Wallensteins Palast wurde geschont; Arnheim hatte ihn mit Posten umstellen lassen: nichts sollte daraus genommen werden. Man war gut Freund mit dem Friedländer. Im übrigen schalteten die Sachsen behutsam genug, dachten nicht an gewaltsame Wiederherstellung des status quo. Nur die Jesuiten waren ausgewiesen worden. Sonst blieben die Katholiken im Besitz ihrer Pfarren, ihrer Kirchen. Vier Gotteshäuser nur wurden den Protestanten übergeben.
Die traten nun wieder ans Tageslicht. Zwangsbekehrte schworen den Katholizismus wieder ab, vereinigten sich mit den Scharen von Flüchtlingen, die, entscheidende Wendung erhoffend, mit den Sachsen zurückgekehrt waren. Sie restaurierten auf eigene Faust. Nahmen die Teynpfarre in Besitz. Samuel Martini von Dražow, der früher lutherischer Pfarrer an der Castuluskirche, dann am Teyn gewesen war, führte die protestantische Menge. Der Magistrat der Altstadt wollte ihnen die Schlüssel zur Teynkirche nicht ausfolgen. Sie drangen gewaltsam ein und holten im feierlichen Zug die Häupter der anno 1621 Hingerichteten, die sie vom Altstädter Brückenturm herabgenommen hatten, in die Kirche ein. Martini hielt die ergreifende Gedächtnisrede. Nie wurde erforscht, auch durch die hochnotpeinlichen Bemühungen der Kaiserlichen nicht, wohin diese Häupter gebracht worden sind. Dann bemächtigten sich die Protestanten des Carolinums, setzten ein neues Konsistorium ein, zu dessen vorläufigem Vorstand Martini bestimmt wurde. Schon glaubte man in Prag die alten Zeiten zurückgekehrt. Die Katholiken beschwerten sich beim General. Der »wußte von nichts«. Die Protestanten aber behaupteten: Heinrich Matthias Graf von Thurn, schwedischer Generalkommissär im Königreich Böhmen, habe sie ermächtigt.
Nun war auch Johann Georg, der sächsische Kurfürst, in die genommene Stadt gekommen. Er wohnte in des verstorbenen Liechtenstein Haus, da er »sich die kaiserliche Residenz nicht anmaßen wolle«. Feig und devot. Doch was ihm von den kaiserlichen Schätzen behagte, maßte er sich leichten Herzens an. Zum zweitenmal wurde die Kunstkammer geplündert: Gemälde, Skulpturen, Rüstungen, Steine –; kostbare Schätze wurden auf Wagen geladen, über Aussig befördert, auch in Schiffe verstaut, die Moldau, die Elbe abwärts nach Dresden gebracht. Noch walteten die Miseroni oben an der Kunstkammer. Der letzte mußte zusehen, wie derbe Soldatenfäuste die durch ein Jahrhundert gesammelten Schätze verschleppten.
Die Sachsenherrlichkeit, der Protestantentraum blieben Episode. Habsburg in Not hatte Wallenstein wieder gerufen. Unerhörte Forderungen des tollkühnen Friedländers hatte Ferdinand zugestehen müssen. Hatte im tiefsten Winkel seiner Seele Vorbehalte verschwiegen. Man wußte in Wien, wie man gemachte Zugeständnisse harmlos grausam zurücknehmen konnte. Jetzt warben die Trommeln und Friedlands Fahnen warfen sich auf. In Mähren flogen die Tausende zum Lager des Herzogs, brannten auf Ruhm, auf Krieg und Beute. Im schweigsamen Führer aber brannten tiefere Feuer. Die Sterne versprachen ein ungeheuerliches Schicksal.
Wer aber deutete die vielversprechenden Sterne: Gian Battista Zeno, der Florentiner, Seni genannt, ein Abenteurer, jung und gemein, ein Verräter. Wir wissen heute (durch Urkundenfunde): er war von den Feinden des Herzogs bestochen, stellte Horoskope in deren Sinn, die den Ahnungslosen auf Bahnen treiben mußten, wo die Schlingen lauerten. Nach der Katastrophe lebte er in Wien, bezog eine Pension und fiel schließlich im Zweikampf mit dem polnischen Residenten.
Jetzt zog der Friedländer gegen Prag, pflanzte auf den Höhen davor seine Feldstücke auf. Die Sachsen entwichen vor der ungeheuren Macht, entkamen mit knapper Not über die Gebirge. Mit ihnen die Protestanten. Rom-Habsburg zog wieder ein: die Jesuiten, die Priester, die Beamten. Neue Ausweisungen, neue Ängste. Aber der Protestanteneinfall hatte nicht tief gegriffen. Allzu gründlich war das Bekehrungswerk schon vollbracht, um ernstlich gefährdet zu werden.
Dumpfe Jahrzehnte über Prag. Kontributionen, Schanzarbeiten. Noch einmal die dumpfen Trommeln, die schwarzen Gerüste: Wallenstein läßt siebzehn seiner Offiziere hinrichten auf dem Altstädter Ring (1631). Wegen Feigheit vorm Feind zu Lützen hat er sie verurteilt.
Dann war er wieder den Blicken Prags entschwunden, operierte irgendwo im Reich. Er operierte zögernd. Man munkelte schon, er verhandle mit den Feinden. Ja, er trieb Politik. Verhandelte mit den Sachsen, mit den Schweden. Jagte dem herrlichen Traum nach, das Reich zu einen, die Feinde zu vertreiben. Nicht für Rom wollte er kämpfen, einem Herrscher über Deutschland, über eine befriedete Welt galt sein Dienst. Doch die Patres um Lamormain dachten anders: sie wühlten und hetzten.
Nun bezog der Friedländer Winterquartiere in Pilsen. Phantastische Gestalt, umrankt von Märchen, von Lügen. Wien sieht nur das drohende Lager. Wer führt zuerst den Schlag? Einsam wird es um den Wallenstein. Man treibt ihn zu Entschlüssen, die nicht seine eigenen sind. Spione, Verräter, wenig Getreue. Schon hat er die Abdankungsurkunde gefertigt. Was erfährt davon der Kaiser? Er ist umstellt von der Mauer der Jesuiten, der Hofkamarilla. Die treibt das grausige Spiel zu Ende. Im Februar 1634 die grausige Nachricht aus Eger: der »Empörer« ist ermordet.
Wer lüftet das Geheimnis ganz, das über dieser Seele brütete? Er war nicht der Empörer, den die nachträgliche Anklage Wiens aus ihm machte. Manche Maschen des Lügengewebes, die noch um den Toten gesponnen wurden, hat die Forschung jetzt zerrissen. Der Friedländer ist verstrickt in seine Zeit –; und ragt über sie hinaus. Seine wirtschaftliche Genialität spricht aus der Verwaltung seiner Güter, aus der Art, wie er den Unterbau für seine Armeen errichtet. Doch unbegreifliche Dämonien zerrten ihn zurück. Mag sein, daß die Zeit noch nicht reif war für seine Idee. Sicherlich war auch er nicht reif für seine Tat. Nun schlug die Rache des Schicksals über ihm zusammen.
Grausige Totenfahrt: man hatte die Leichen der zu Eger Ermordeten, auch die des Friedländers, in hölzerne Truhen und Kisten gezwängt, vom Tatorte weggefahren. In Mies traf den Zug der kaiserliche Befehl zur gemeinen Bestattung. So ward der Herzog dort in der Minoritenkirche vorläufig beigesetzt. Auf des Kardinals Harrach, des Herzogs Schwagers, Berufung gestattete die Majestät die stille Überführung ins Herzogtum. Auf grobem Feldwagen rollte des Friedländers Leiche bei Nacht durch Prag. In der Kartause zu Walditz wurde sie nun in die Gruft gesenkt. Doch keine Inschrift durfte den verhaßten Namen künden. Erst 1755 –; fast 150 Jahre nach der Ermordung –; wurden die Gebeine Wallensteins feierlich nach Münchengrätz überführt, in der Schloßkapelle St. Anna bestattet. Und erst vor kurzem ward dem Friedländer das würdige Epitaph gesetzt.
Dem Retter Habsburgs, dem eisern frommen Ferdinand, blieb nicht lange Zeit, über seinem neuen Opfer die Seelenmessen lesen zu lassen: drei Jahre später stürzte er in sich zusammen. Ein unheimlicher Mensch auch er, zerfressen von subalterner Dämonie, durch eine merkwürdige Fügung der Geschichte ins Gigantische hinaufgehoben. Mittels seiner war Habsburg, war auch Rom gerettet, ein neues Europa geschaffen. Viel Blut aber schrie noch nach Sühne.
In Prag kämpften die kirchlichen Parteien um die Macht. Die Jesuiten, von Hof und Adel reich bedacht, erwerben St. Niklas auf der Kleinseite, aus dem die Kelchner vertrieben waren. Später errichten sie dort ihr Profeßhaus. Erwarben St. Ignatius in der Neustadt, errichteten dort ihr Kollegium. Erwarben später (1660) St. Wenzel und St. Bartholomäus als Konvikte. Harrach, der Jesuitengegner, reformierte die Kirchenverfassung, straffte die erzbischöfliche Gewalt, zog Orden auf Orden nach Prag, nach Böhmen, um die kirchliche Macht noch zu stützen. Schon 1620 hatte Ferdinand seinem Leibarzt, dem Barmherzigen Bruder Gabriel Grafen von Ferrara die Kirche St. Simon und Juda, die Kirche der vertriebenen böhmischen Brüder, geschenkt, hatte dort die Erbauung des ersten Klosters und Spitals der Barmherzigen Brüder ermöglicht. Die Dreifaltigkeitskirche der deutschen Lutheraner auf der Kleinseite hatte er den unbeschuhten Karmelitern übergeben (1624), deren einer, Dominicus a Jesu, das kaiserliche Heer auf dem Weißen Berg zur Schlacht begeistert hatte. Wir sprachen oben vom Umbau, dem die Kirche unterzogen wurde: die Fassade kam an die Straßenfront zu stehen, der Chor gegen den Laurenziberg. Erst jetzt wird also die Wendung in der Kunstanschauung, wie Italien sie eingeleitet hatte, folgerichtig durchgeführt: der Bau soll gesehen werden, die Fassade wird dem Beschauer zugekehrt. Der Treppenaufstieg vor der Fassade von der Straße aus (die jetzt Karmelitergasse heißt) erinnert in Anklängen an den monumentalen Aufstieg zur Kirche in Rom, der die erste Fassade entlehnt war. Nun wird die Kirche der siegreichen Maria geweiht, als »Maria Victoria«. Und überall im katholischen Abendland entstehen nun diese der »Maria Victoria« geweihten Kirchen, überall erheben sie den Sieg vor Prag zum Sieg der Jungfrau.

Belagerung Prags durch die Schweden 1648.
Kupferstich nach Karl Skreta von Matthias Merian. O. J. Aus G. Schieders Theatrum Europäum, Band VI, Frankfurt a. M. 1663 (Prag, Städt. Museum).
Die ehemals deutsche Salvatorkirche beim Altstädter Ring hatte der Kaiser den Paulanern (fratres minimi) zugesprochen, ein geräumiges Ordenshaus, am Ring gelegen, dazu. Die beschuhten Karmeliter bekamen statt ihres von den Franziskanern besetzten Klosters Maria-Schnee das Gallikloster. Die Serviten, ehedem am Slupi, wurden nach St. Michael in der Altstadt übersiedelt. Schottische Franziskaner, die sogenannten Hiberner, durften sich im ehemaligen Ambrosiuskloster gegenüber dem Pulverturm niederlassen. Sie standen zum Erzbischof, übernahmen die Leitung an dessen Seminar im Königshof. Questenberg, der Prämonstratenserabt, stiftete den Kapuzinern eine Kirche bei St. Josef in der Altstadt. St. Nikolaus in der Altstadt erhielten die Breunauer Benediktiner. Die bekamen später eine zweite Abtei bei St. Johann am Felsen.
Längst erloschene Ordenshäuser erstanden neu: im Agneskloster zogen wieder Clarissinnen ein. Die Dominikaner, denen nach Entzug des Clemensklosters dieses Agneskloster zugewiesen worden war, erhielten nun St. Ägidien und das St.-Magdalenen-Kloster auf der Kleinseite. Auch die Cyriaken zogen wieder in Prag ein. Ferdinand III. brachte spanische Benediktiner vom Montserrat, die sogenannten Schwarzen Spanier, ins Emauskloster. An neuen weiblichen Orden kamen Ursulinerinnen aus Lüttich, unbeschuhte Karmeliterinnen erhielten ein Kloster bei St. Josef auf der Kleinseite. Als vorläufig letzte kamen die Theatiner (Cajetaner), von Gaetano di Tiene und Gian Pietro Caraffa, Bischof von Chieti (später Paul IV.), 1524 gestiftet, siedelten am Hradschin, bezogen 1684 ihr neu erbautes Kloster St. Cajetan auf der Kleinseite. Ein fast überlebendiges Ordensleben blühte auf, führte das gegenreformatorische Werk immer tiefer in die Schichten des Volkes, spaltete sich dabei in sich selbst, isolierte die Jesuiten.
Indessen zogen die Schatten des draußen wütenden Krieges hin über Prag. Bannér, der schwedische General, zog heran (1638), nahm Stellung auf dem Weißen Berge. Die Kaiserlichen nahten zum Entsatz, die Schweden zogen sich zurück. Die Kaiserlichen als Befreier plündern, erheben ungeheuerliche Entsetzungstaxen, neue Kontributionen. Von der Judenstadt aus verbreitet sich die Pest über alle drei Städte, rafft Tausende hin. Der Krieg greift von draußen, vom Lande, wo die Schwedenhorden hausten, in die Stadt, wirft Flüchtlinge herein, fordert immer wieder neue Leistungen. Jetzt wird eine Bürgermiliz formiert. Als Ferdinand III. im Jahre 1646 seinen Sohn zur Krönung nach Prag bringt, stehen die städtischen Kompagnien vom Wyschehrad bis zum Hradschin Spalier.
Zwei Jahre darauf sollten sie ihre Tüchtigkeit erproben. Johann Christoph Graf von Königsmarck, der schwedische General, nutzte Böhmens Entblößung von kaiserlichen Truppen, brach vor, nahm Klattau, Elbeteinitz, stand in der Nacht des 26. Juni mit 3000 Mann bei Kloster Breunau oberhalb Prag. Nichts ahnte die Stadt, nichts die kleine Besatzung unter dem Feldmarschall Colloredo, Grafen von Wallsee, Grandprior der Malteser. Verrat öffnete den Schweden die Kleinseite: ein ehemals kaiserlicher, jetzt zurückgewiesener Offizier hatte ihnen die schadhafte Stelle in der Mauer gezeigt, über die einzubrechen ein leichtes war. Als die Kleinseitner am Morgen erwachten, sahen sie die Musketen gegen ihre Fenster gerichtet. An die vierhundert nichts ahnender Einwohner wurden meuchlings niedergemacht.
Colloredo selbst, der in dem Grandprioratspalais auf der Kleinseite wohnte, entkam im Kahn über die Moldau. In der Altstadt war schon Alarm. Der Altstädter Primator Turek von Rosenthal, Oberstwachtmeister der städtischen Miliz, sammelte seine Scharen auf dem Ring, besetzte das Brückentor, formierte im Carolinum Studentenkompagnien, organisierte die Verteidigung.
Die Schweden hatten schon die Burg genommen, das Zeughaus erstürmt, alle Geschütze, die sie dort fanden, gegen die Altstadt aufgefahren. Das Bombardement der Stadt begann. Puchheim, kaiserlicher General, war mit 2000 Mann von seinem Zug gegen Glatz eiligst zurückgekehrt. Die Prager glaubten sich dem Feind gewachsen. Doch auch der erhielt Verstärkung. Der schwedische Feldzeugmeister Graf von Württemberg rückte an, bezog Stellung auf dem Veitsberg, bombardierte die Bastionen vom Neutor bis zum Roßtor. Angriffe von der Brücke her: die Studentenkompagnien hielten stand. Angriffe an der Poøiè-Seite: die Kaiserlichen samt den Bürgerwehren hielten stand. General Puchheim will Proviant für die Pferde holen, zieht heimlich beim Wyschehrad hinaus. Der Graf von Württemberg ihm nach, schlägt ihn bei Frauenberg, nimmt ihn gefangen. Prag ist um ein tapferes Regiment ärmer. Ist aber auch von dem Württemberger für eine Zeitlang befreit: der zieht gegen Tabor und nimmt es.
Die Prager führen starke Befestigungen auf, schanzen Tag und Nacht. Alles, was laufen kann, wird zu den Arbeiten herangezogen. Die Feuerwache am Altstädter Ring, hundert Mann bei Tag, dreihundert bei Nacht, mit Feuerhaken und nassen Ochsenhäuten ausgerüstet, muß rennen, wo immer die Pechkränze der Schweden fallen. Am Brückenturm, wo die Studenten kämpfen, kommt es zu gutnachbarlichem Verhältnis zwischen Jesuiten und Studenten. Unter den Studenten kämpften die vom Clementinum und die vom Carolinum gemeinsam. Das knüpfte Beziehungen, die der späteren Union der Kollegien von unten her vorarbeiteten. Reibereien mit der Soldateska sorgten außerdem für ein innigeres Zusammenstehen. Der Kaiser schrieb in seinen Ermutigungsbriefen an die Stadt und an die militärischen Kommandanten, man solle die Studenten gut verköstigen, entsprechend besolden.
Vierzehn Wochen Belagerung, am bedrohlichsten die letzten. Der Kaiser verspricht Sukkurs, genehmigt die Aufstellung von 600 Mann städtischer Soldaten. Aber die Schweden verstärken sich nochmal: der Graf von Württemberg war zurückgekehrt. Nun rückte noch Karl Gustav, Pfalzgraf am Rhein, heran, berannte mit den andern gemeinsam die Stadt. Die Angriffe konzentrieren sich auf den Mauerzug zwischen Bergtor und Roßtor (Neustadt). Starkes Bombardement legt ihn nieder. 4000 Schweden rücken an. Die Kaiserlichen lassen eine Mine springen, die 500 Schweden wegfegt (25. Oktober). 2000 Mann schwedischer Reserven springen ein. Fünf Stunden lang wird gekämpft, die Schweden werden zurückgeschlagen.
Ein kaiserliches Entsatzheer rückt an, Karl Gustav und der Graf von Württemberg ziehen ab. Königsmarck zieht sich auf die Kleinseite zurück. Raubt und packt zusammen, soviel die Schiffe, die Wagen nur fassen können. Miseroni muß wieder den Schlüssel zur Kunstkammer ausliefern: wieder schleppt die Soldateska weg. Diesmal wird gründlich geräumt. Königsmarck will seiner Königin, der kunst- und bücherbegeisterten Christine, reiche Beute schicken, braucht auch für sich selbst genug. Mit Bildern und Skulpturen, mit ganzen Brunnen und ungezähltem Mobiliar, mit Gläsern und Steinen und Gemmen wird jetzt auch die berühmte Rosenberg-Bibliothek verschleppt, die durch den letzten Rosenberger an den Kaiser Rudolf gekommen war. In schwedischen Bibliotheken zerstreut, und im Vatikan, wohin Christine manches gebracht hat, muß man heute suchen, was an Handschriften und prächtigen Drucken einst in Prag vereint war. Während die Friedensglocken in Prag erklingen, rumpeln zum Strahower Tor hinaus auf der Leipziger Straße die Beutewagen der Schweden. Sie hatten in letzter Stunde noch gründlich für den langen Krieg sich bezahlt gemacht.
Der Kaiser sparte nicht mit Huld und Dank für die tapfere Abwehr der Feinde, der protestantischen Feinde, durch das jetzt katholische Prag. Das Stadtwappen wurde verbessert, der Magistrat durfte fortan mit rotem Wachs siegeln, sollte mit »denen Ehrenfesten« tituliert werden. Der seit 1621 verhängte Erbbiergulden wurde erlassen, aus allerhand Taxgefällen 300.000 rheinische Gulden geschenkt zur Wiederherstellung der Gemeindegebäude, zur Unterstützung der Kriegsinvaliden. In die Stadtbücher eingetragener Besitz sollte nie aus der Hand der Bürger genommen werden dürfen. Und zu manch anderer Begnadigung trat noch die Erhebung sämtlicher Magistratspersonen in den Wladykenstand. Prag wurde wieder königlicher Stand.
Am 24. Juli 1650 wurde zu Prag mit kirchlich-militärischer Feier das Friedensfest gehalten. Und zwei Jahre darauf kam der Kaiser selbst mit großem Hofstaat nach Prag, geladene Reichsfürsten folgten. Prag wurde durch kaiserlichen Glanz so entschädigt für viele erlittene Unbill. Auf dem Altstädter Ring wurde am Geburtstag des Kaisers (13. Juli) das Denkmal aufgestellt, das Ferdinand zum Andenken an die Befreiung Prags gestiftet hatte: auf hoher Säule die Gestalt der Madonna, zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis Maria. Roms neuer Glaubenssatz sollte triumphieren. Sie war nach dem Vorbild jener geschaffen, die Maximilian zum Gedächtnis seines Sieges am Weißen Berge auf dem Münchner Marienplatz im Jahre 1638 aufgestellt hatte. Alle Samstage und alle Hauptfeste der Mutter Gottes sollte aus der Teynkirche eine feierliche Prozession mit Vokal- und Instrumentalmusik unter Begleitung eines Domherrn von St. Veit zu dieser Statue ziehen und dort die lauretanische Litanei absingen.
So stand nun die Mariensäule am Altstädter Ring, eine schönere Platzzier als der Galgen, der ehedem hier errichtet war (man hatte ihn ans Moldauufer unterhalb der Judenstadt übertragen). Und doch mit Blut befleckt. Mit kaiserlichem und kirchlichem Pomp löschte sie die Erinnerung aus an früher. War Schlußstein dieses ersten Jahrhunderts einer Gegenreformation, die mit grausamen Waffen gekämpft hatte. War Grundstein eines neuen Jahrhunderts dieser Gegenreformation, das nun mit Kunst und hohem Leben über die demütig gewordenen Prager Bürger hinwegfegen sollte: Markstein eines gebändigten Prag. Beim Umsturz im Jahre 1918 haben sie die Tschechen zerstört.
Jahrhundert des Friedens. Die religiöse, die soziale Umwälzung war beendet. Jetzt konnte der innere Ausbau der neuen Positionen beginnen. Ein imponierender Ausbau!
Der Kaiser hatte die Bürger der Städte reichlich begabt, mit weitreichenden Privilegien versehen. Ein Aufschwung des Bürgertums hätte folgen müssen. Aber dieses Bürgertum war zersetzt, im Mark zerrüttet. Zuviel gesunde Kraft hatte abwandern müssen. Die neuen Elemente, die in Massen zugezogen waren, waren noch nicht bodenständig. Der Markt, Quelle bürgerlichen Reichtums, war durch die inneren und äußeren Kriegsläufte zerstört, man mußte langsam wieder die Fäden knüpfen. Das einzige Handwerk, das blühte, das Bauhandwerk –; unter den jetzt eifrig begonnenen Befestigungsarbeiten benötigte es starken Zuzug von Kräften –;, war fast ausschließlich von italienischen Meistern und Gesellen besetzt. Diese, obwohl unter sich oft in Streit, waren peinlich darauf bedacht, die guten Erwerbsquellen für sich allein zu erhalten. Vor allem: die Bürger hatten kein Selbstbewußtsein mehr. Man war ängstlich geworden unter all den Eingriffen von oben. Man duckte sich. Duckte sich unter die immer noch wachsende Macht Wiens, duckte sich in lauter Devotion auch vor der näheren Macht, die in Prag nun die soziale Herrschaft antrat: vor dem Adel.
Der Barock brachte in ganz Europa die sozial so folgenreiche Bewegung: der Adel zieht in die Städte. Zuerst will man noch den Fürstenhöfen, die dort so prächtig sich aufgebaut hatten, trotzen: will seine Macht dagegenstellen. Dann ist es schon die Lockung dieser Höfe, der man sich beugt: Kurzweil, Geselligkeit, Ämter und Würden. Der Festungsbau in den Städten entwertet die Burgen draußen in fortifikatorischem Sinn. Der Glanz der Gesellschaft an den Höfen entwertet die einsame Machtallüre draußen auf den Gütern. Man liebt den Trubel, die rauschenden Feste, man ringt um Geltung der Persönlichkeit in der Gesellschaft. Sammelt sich, steigert sich gegenseitig hinauf in das brausende Lebensgefühl des Barock.
Da ist der alte Adel des Landes, soweit er sich über die Katastrophen des Jahrhunderts klug oder berechnend hinübergerettet hatte. Die gefürsteten Liechtenstein und Schwarzenberg, die Grafen Czernin und Kinsky und Lobkowitz, die Martinitz, die Sternberg, die Waldstein, Nostitz, Kolowrat, Wrtby, Hrzan und die andern. Sie alle hatten durch die große Umwälzung gewonnen: aus Latifundien strömte ihnen Reichtum zu, den sie in neuen Palästen, in großzügigen Stiftungen an die Kirche, in luxuriösem Leben nun nach außen kehrten. Da war aber auch der neu nach Böhmen gekommene Adel, Kriegsadel aus den habsburgischen Armeen, dem in Böhmen gute Beute zugefallen war: die Piccolomini und Buquoy und Trauttmansdorff und Sporck, die Colloredo und Gallas und Thun und Clary und andere. Aus königlichen Belohnungen errichteten sich diese teils erst im Krieg geadelten Geschlechter ihre Fideikommisse, wetteiferten mit dem alten Adel des Landes an Pracht und üppigem Leben, bauten in Prag ihre Paläste. Auch Heiraten hatten neue Geschlechter hereingebracht, so die fürstlichen Fürstenberg, die mit den reichen Waldstein sich verschwägert hatten. Eine trubelnde Gesellschaft machte sich breit unter dem Hradschin, richtete Hofhaltungen ein wie Könige. Schwelgte in Gastmählern und Soireen, verbrüderte sich in tollem Genuß. In herrlichen Karossen fuhr man aufs Land, huldigte der Jagd, veranstaltete im Winter Schlittenfahrten, für die an die tausend Dukaten hinausgeworfen wurden. Trumpfte auf mit der Zahl der in kostbare Livreen gesteckten Dienerschaft, überbot sich gegenseitig in schwindelndem Luxus. Die alten Geschlechter mußten ihre Vorherrschaft im Land, die neuen Geschlechter ihre Ebenbürtigkeit erweisen, mußten sie zumindest ersetzen durch noch größeren Aufwand.
In Prag galt nur noch der Adel. Die Bürgerstadt drunten wurde untertänig. Hatte man sie auch nicht unter der Fuchtel wie draußen die Bauern, die mit Robot und Abgabe unerhört gequält wurden, so hatte man sie doch in wirtschaftlicher Abhängigkeit, blendete durch Auftreten, zwang zur Devotion. Bürgerstand, das galt nichts mehr. Wer irgend sich aus ihm erheben wollte, strebte den Adel an. Und Habsburg war freigebig in der Erteilung der Matrikel: jedes Verdienst um den Staat, Verdienst überhaupt wurde mit Adel belohnt. Sogar der beste Prüfling der Universität sollte geadelt werden. Wollte man diese Adelsgesellschaft verwässern? So wurde, was kraftvoll war im Bürgertum, herübergeholt in die Reihen des genießenden Adels, wurde der Arbeit entzogen.
Das riß die Kluft auf zwischen hoch und niedrig, zwischen arm und reich. Während drüben auf der Kleinseite, später auch mitten in der Altstadt und Neustadt, die Paläste erstanden, gruben sich Menschen, zu Tieren verarmt, in Schutthügel ein, um vegetieren zu können. Neben der Judenstadt war eine Schuttablagerungsstelle zu einem Berg angewachsen. Da hatte sich armes Gesindel Höhlen als Unterschlupf gegraben. Durch die Feuer, die sie sich darin angezündet hatten, war der ganze Haufen in Brand geraten und mußte durch Abtragung gelöscht werden. Das war im Jahre 1732. Wir dürfen aber von hier aus zurückleuchten auf dieses ganze Jahrhundert: man brauchte da oben den Blick auf die Armut, auf elendeste Kreatur, um die Folie zu haben für sein erhabenes Leben.
Wir wollen hier nicht mit demokratischen Schlagwörtern gegen aristokratisches Leben wettern. Es hat sein Jahrhundert geformt und Prag vor allem. Wir können aber nicht umhin, nach seinem Geheimnis zu fragen, aus dem es die tiefere Berechtigung für seinen Anspruch hätte herleiten können. Wir finden es kaum. Da ragten all diese Paläste, die ein Leben bargen, prunkvoll und üppig wie jenes des Wallenstein zu Beginn des Jahrhunderts. Wo aber finden wir noch Wallensteins Dämonie? In den Gründern der neuen Hausdynastien mag noch das Abenteuer der Schlachten gewirkt haben: sie bogen es um zum Abenteuer des Erwerbs, in wirtschaftliche Haushaltung, in Mehrung des Besitzes. In den Erben lodert die wilde Gier, zu leben, sich zu verschwenden, geheimnislos auf. In einigen mag auch der Trotz gegen den Usurpator aus Wien gewirkt haben: vor dem Czernin-Palais über dem Hradschin spürt man es wie dunklen Aufruhr verschütteter Herrschgier. Der Sohn des Erbauers kennt nur mehr Prachtgelüste als Selbstwehr, vergeudet seinen unermeßlichen Reichtum bis zu unerhörter Schuldenlast. Was viele Jahrzehnte Krieg und Schicksalslaune an Betätigungsdrang geweckt, das schießt nun ins Leere, rankt sich um hochgeschraubte Geltungsfragen, bringt ins friedliche, tatenarme Leben dieser Menschen ein künstliches Gefälle durch Zuspitzung der Gegensätze.
Ja, die Lust am Gegensatz beflügelt dieses Leben des Barock: Gegensatz in der geistigen, in der seelischen, in der materiellen Sphäre, Gegensatz all dieser Sphären untereinander. Aus üppigen Festen stürzt man zur Beichte. Aus reinster musikalischer Unterhaltung wirft man sich in rohe Jagd. In tollen Spielnächten verliert man ein Vermögen, preßt anderntags den Verwaltern der Güter letzte Erträgnisse heraus. Sichert seine Linie durch günstige Heirat, erbaut sich neben dem Stammschloß die prunkvolle Gruft. Zieht als kaiserlicher Offizier gegen die Türken, entwirft in den Friedenswochen mit den berühmten Architekten Pläne zum neuen Lustschloß. Duelliert sich und genießt zu der Lust ungewissen Ausgangs noch die Bedrohung durch kaiserliche und kirchliche Bestrafung. Vergräbt sich in Bibliotheken, die man sich prunkvoll einrichtet, verschließt sich vor der Welt. Man agiert, macht das Leben zur Bühne, begeistert sich an der Illusion, die man doch durchschaut. Spielt im Parkett und auf den Rängen Theater, beklatscht die Koloratur. Träufelt Wollust in seine Frömmigkeit, spielt mit dem Totenschädel. Leben entzündet sich an seinen Gegensätzen. Aber nicht, um eine Einheit sich vorzutäuschen wie einst unter Rudolf, eine Einheit, die damals aus der Renaissance noch herüberwirkte als Ideal. Nein: jetzt liebte man die Spaltung um ihrer selbst willen, das Schwindeln überm Abgrund. Aber Funken glühten auf, kein tiefer Brand, wie er noch vor den Kriegen in Renaissancegeistern hier in Prag weite Horizonte erhellt hatte, wie er auch jetzt wieder in andern Ländern, in Paris, in Rom die Seelen erhitzte, treibt diese Prager Gesellschaft in ihre Ekstasen. Man hat kein Geheimnis. Erkünstelt es sich höchstens in Orden und geheimen Zirkeln, glaubt nicht daran. Alles treibt nach außen, schafft ein prunkvolles Gehäuse um diese Kultur, verzischt im Ornament.
Und doch war hier Gegenreformation am Werk, jene Bewegung, die man in andern Ländern mit Recht als Mitbegründer der Barockkultur anspricht. Hier in Prag erfüllte sie sich in äußerer Aktion. Da errichten die Orden, allen voran die Jesuiten, ihre Kirchen und Häuser. Eifern dem Adel nach im Palastbau, übertrumpfen ihn in ihren Kirchen. Mengen sich in die große Gesellschaft, werden Beichtväter und Grandseigneurs in einem. Das Reformationswerk hieß nun die »Religionserhaltung«. Ferdinand III. hatte Quellen für die materiellen Notdürfte geschaffen: in die »Salzkasse«, die dem Papste zugunsten der Kirche Böhmens zur Verfügung stand, flossen von jeder Kufe Salz, die in Böhmen gewonnen oder eingeführt wurde, 12 Kreuzer. Damit ließ sich schalten. Dotierung von Pfarren, neuen Orden, Ausschmückung von Kirchen, prächtige Kirchenfeste.
Harrach, der energische Erzbischof, war gestorben. Nachfolger war Matthias Ferdinand Sobek von Bilenberg. Er läßt die Wenzelskapelle neu herrichten, setzt in Rom die Bestimmung des Wenzelstages zum öffentlichen Feiertag durch. Greift sogar den Gedanken des Domausbaues wieder auf. In diesen Zeiten ausgreifender Baulust mußte dieser Wunsch wieder lebendig werden. Leopold, der jugendliche Kaiser, unterstützt den Plan. Im Jahre 1673 wird wieder einmal der Grundstein zum neuen Langhaus gelegt. Die Erneuerung des Katholizismus in Böhmen sollte ihren monumentalen Ausdruck finden. Nun folgt Johann Friedrich Graf von Waldstein auf dem erzbischöflichen Stuhl, ein begeisterter Bauherr. Die Bauten am Dom schlafen ein. Aber neben der Burg ersteht der erneuerte erzbischöfliche Palast. Drunten an der Brücke läßt der Erzbischof den Kreuzherren, deren Ordensgroßmeister er war, die neue Kirche erbauen. Ordenshäuser, andere Kirchen, Privatpaläste folgen.
Und schon ist die Kommission bestimmt, die den Prozeß um die Heiligsprechung des Johannes von Nepomuk betreiben soll (seit 1675). Ein halbes Jahrhundert zogen sich die Unterhandlungen hin, eine Zeit wachsenden Glanzes der Kirche. Unerhörten Glanzes nach außen: Schauspiele die gewaltigen Prozessionen, fürstliche Feste die Inthronisationen der Erzbischöfe. Repräsentation, Pomp, rauschendes Leben. Neue Laienbruderschaften werden gegründet: die Wenzelsbruderschaft vertreibt die tschechische Bibel, die erste katholische, im Volk. Erzbischof Graf Waldstein hatte sie drucken lassen: sie sollte die noch immer heimlich gelesenen protestantischen Bibeln verdrängen. Im Jahre 1706 wird die Johannesbruderschaft gegründet: die sollte die Heiligsprechung des Johannes von Nepomuk im Volke vorbereiten. Mit Festen und Feiertagen schmiedet man das Volk an die Botmäßigkeit Roms: 1709 wird die »Unbefleckte Empfängnis der Mutter Gottes«, der zu Ehren die Säule auf dem Ring stand, zum allgemeinen pflichtmäßigen Feiertag erhoben. Die Jesuiten hatten vorgearbeitet. Von unten her gräbt man noch immer den alten ketzerischen Boden ab: durch Verbrennung »ketzerischer« Schriften, durch härteste Zensur, durch sichere zwangsweise Bekehrung. Die Kaiser erlassen die erbetenen Ketzermandate (1717, 1721, 1723, 1724), grausame Waffen. Rom aber hat die Lockung in der Hand. Die Erhebung der Gebeine des Johannes von Nepomuk im Jahre 1721, acht Jahre darauf die Heiligsprechung durch die Bulle Benedikts XIII. waren pomphafte Schlußsteinlegung eines Werks, um dessen Vollendung die Kirche nun länger als drei Jahrhunderte gerungen hatte. Dem in verborgenen Zirkeln, vor allem auf dem Lande noch immer lebendigen Hus mußte ein wirkungsvoller Nationalheiliger entgegengestellt werden. Ein Heiliger, den man mit allem Prunk der Zeit umkleiden konnte. Man dichtete aus Historie und Legende ein Märtyrerleben zusammen. Mythos sollte den Mythos töten. Er tötete ihn. Rom hatte gesiegt. Das Prunkgrabmal in Silber, das im stillen Umgang von St. Veit den hohen Barock aufschäumen läßt, vom jüngeren Fischer von Erlach entworfen, ist Siegeszeichen der Kirche –; wie drunten auf dem Altstädter Ring die Mariensäule, zumindest gleichnisweise, Siegeszeichen Habsburgs war. Die Protestanten waren vernichtet.

Theaterarchitektur 1723.
Von Giuseppe Galli-Bibiena. Zur Aufführung der Krönungsoper im Prager Schloßgarten 1723. Kupferstich von Josef Heinrich Martin in Wien (Prag, Städt. Museum).
Prunkvollster Barock, diese Heiligsprechung des Johannes von Nepomuk im Jahre 1729. Eine ganze Woche wurde gefeiert. Bischöfe aus vielen Ländern assistierten. Ein prunkvolles Triumphgerüst in illusionistischer Barockarchitektur war aufgerichtet worden. Das Volk in all seinen Schichten wallfahrtete zum Grab. Der Glanz der Kirche entfaltete sich in noch nie gesehener Pracht. Wollte man damals ein Siegesfest übertrumpfen, das wenige Jahre vorher eine andere Macht gefeiert hatte?
Adel und Kirche, das waren die beiden Mächte, die in jenem Jahrhundert sich aneinander emporsteigerten zu dem überschwenglichen Lebensbild des barocken Prag. Und doch –; was nach außen hin in beiden wie ein unerhörter Aufstieg anmutete, es war Niedergang. Ein Niedergang, der sich verbrämen wollte mit lautem Prunk. Durch diese zwei Mächte hindurch stieg eine andere Macht empor: der Despotismus des Herrschers. Er gebrauchte nun nicht mehr die Faust wie in früheren Zeiten. Er zersetzte. Als Humprecht von Czernin dem jungen Kaiser Leopold den Rohbau seines gewaltigen Palastes droben über dem Hradschin zeigte, da stand noch Macht gegen Macht, zumindest Trotz gegen Ziele. Allmählich aber fraßen die Lockungen der legitimen Macht den Trotz an, wandelten ihn durch höchste Ämter, durch Offiziersdegen, durch Orden in Dienstwilligkeit, in Unterwürfigkeit, in Vasallentum. Während die Adelsfeste in Prag immer wilder rauschten, während draußen auf dem Land schon die Fäuste unterdrückter Bauern an die Pforten der Schlösser, der Städte pochten (in der Gegend von Leitmeritz, von Königgrätz und Tschaslau), da schob sich durch Risse und Spannungen der lebensfrohen Gesellschaft die kaiserliche Macht empor, verlangte Huldigung und Devotion, triumphierte. Triumphierte als Rechtsmacht in der Pragmatischen Sanktion, mit der sie die eiserne Spange des erblich herrschenden Habsburg auch um Böhmen schloß (1713). Triumphierte als Gesellschaftsmacht in der Krönung Karls VI., da Fürsten und ältester Adel sich in die Nähe des kaiserlichen Stuhles drängten, um dicht bei den Majestäten der hohen Lustbarkeit zu lauschen (1723). Das war das Siegesfest Habsburgs, Sieg über Ketzer und Adel. Ständischer Adel war kaiserlicher Adel geworden. Bluttaufe brachten die Türkenkriege, brachten dann vor allem die Kämpfe unter Maria Theresia. Böhmen wurde habsburgisches Land.
Und auch aus der römischen Kirche wurde allmählich die kaiserliche Kirche. Der Protestantismus war zwar verdrängt. Doch was er, wo er herrschte, dem Landesherrn an neuer Machtbefugnis gebracht hatte, das nahm auch der katholische Despot gern auf. So ragte er doch auch in die katholischen Länder herüber. Die protestantische Devise cuius regio, eius religio war schon allgemein europäische Parole geworden. Nun griffen die katholischen Herrscher auch noch nach dem andern protestantischen Prinzip, dem Oberepiskopat des Landesherrn. Dieses Barockjahrhundert hat es in Prag, in Böhmen wie im übrigen Österreich zur durchgreifenden Geltung gebracht. Das Verbot Ferdinands III. an Harrach, in seinem Seminar die akademischen Grade zu verleihen (s.o.), war schon ein erster Schritt gewesen. Personalunion zwischen kirchlichen und kaiserlichen Würdenträgern ebnete weiter die Wege für diese Politik. Bilenberg war, ehe er Erzbischof geworden war, Verwalter des Steuer- und Finanzwesens gewesen, er hatte damals den Titel Kaiserlicher Geheimer Rat erhalten. Jetzt rückt der despotische Staat immer konsequenter der kirchlichen Immunität zu Leibe. Die kirchliche Gerichtsbarkeit wird eingeschränkt. Die weltlichen Stände greifen die Bewegung auf. Sie verlangen auf dem Landtag (1693) die direkte Besteuerung der Geistlichkeit, sie nagen damit das Fundament des kirchlichen Reichtums an. Ja, auf dem Landtag von 1693 billigen sie dem geistlichen Stand keine Stimme mehr zu: die Bank des Erzbischofs wird aus dem Saal entfernt. Das blieb Episode, war aber bezeichnend. Ebenso der Vorfall im Jahre 1691: laut erzbischöflicher Verfügung sollten die Juden, die in den Anfangszeiten des Dreißigjährigen Krieges in den Pfarrsprengel von Heilig Geist eingedrungen waren, ihre neuen Häuser dort räumen, sollten zwangsweise rückübersiedelt werden ins alte Ghetto: »die alten Kirchengesetze duldeten es nicht, daß Juden mit Christen zusammenwohnen«. Aber die Statthalterei hob die Verfügung auf.
Immer weiter zerfällt die kirchliche Immunität unterm Eingriff des Staates, des Landesherrn. Bei Abts- und Prälatenwahlen hat ein kaiserlicher Kommissar zu fungieren. Ausländische Ordensobere dürfen nicht mehr ohne kaiserliche Genehmigung ihre in Böhmen gelegenen Provinzklöster visitieren. Die erzbischöflichen Synoden hören auf, werden durch erzbischöfliche Sendschreiben ersetzt. Sogar die eigentliche Arbeit der Kirche, die »Religionserhaltung«, wird immer mehr von kaiserlichen Verfügungen abhängig. (Marschierten doch damals [1708] sogar kaiserliche Heere im Kirchenstaat ein!) Und wie sogar den Jesuiten von oben her zugesetzt wurde, haben wir oben gelesen. Die Heiligsprechung des Johannes von Nepomuk war wie ein letzter Protest gegen solche Verstaatlichung –; sie verrauschte im Prunk.
Wir müssen die Aufpeitschung so vieler Lebenskräfte im Prager Barock, wie sie sein Bautum noch heute zum Ausdruck bringt, auch aus solchem Gegeneinander widerstrebender Mächte verstehen. Welch ein Gegensatz zu dem sicher gegründeten Bau des karolinischen Prag! Müssen sie auch verstehen aus dem allmählichen Übereinander dieser Mächte. Denn dies war ja die notwendige Folge des aristokratischen Prinzips, daß es eine überragende Spitze aus sich heraustrieb. Daß man in Trotz sich gegen solche Spitze auflehnen, in süßer Demütigung sich unterwerfen konnte, das mochte auch nur wieder zur Steigerung dieses Schwelgens in Gegensätzen dienen, das jener Zeit tiefste Verlockung war. Ja, auch die Demütigung der Kirche, der man anderseits doch das Heil seiner Seele anvertraute, die man mit Stiftungen immer noch überhäufte, mag eingegangen sein in dies ewig zwischen zwei Polen zuckende Spiel barocken Lebensgefühls.
Und wie dies Prinzip nach oben eine überragende Spitze aus sich heraustrieb, so drückte es nach unten die Menschen zur Masse herab. Der Bauer war kein Mensch mehr unter solchem Regime. In Böhmen ward es besonders grausam getrieben. Aber auch die Bürger verloren immer mehr an Würde. Wie würdelos sind oft die Zustände im Ratskollegium der Altstadt! Immer wieder gegenseitige Verdächtigungen wegen Unterschlagung, manchmal recht willkürliche Verwaltung, dabei krasse Liebedienerei nach oben, eitle Würdenjagd.
Der Kaiser setzt die Primatoren ein. Die Bewerber richten ihre Bittgesuche voll Anpreisung der eigenen Vorzüge und Leistungen an die Hofkanzlei, suchen die Konkurrenten auszustechen. Wurde dann der neu ernannte Primator eingesetzt, so gab es große Zeremonie im Altstädter Rathaus: das Theaterspielen wirkte auch hier. Von dem Aktus bei der Erneuerung der Magistrate der drei Städte im Jahre 1678 ist eine genaue Beschreibung erhalten. Große Auffahrt. Zuerst die sechsspännigen Karossen der Stadthauptleute, die des Neustädter und des Kleinseitner Hauptmanns leer: alle drei Hauptleute fahren in der Karosse des Altstädters. Dann die sechsspännige Karosse des Oberstburggrafen, mit dem der oberste Landhofmeister, der oberste Lehensrichter, der Vizepräsident des Appellationsgerichts und der oberste Landschreiber fuhren. Hintennach die leeren Karossen der mit dem obersten Statthalter fahrenden Funktionäre, sie alle übrigens Angehörige der höchsten Aristokratie. Vor dem Rathaus Empfang durch den Magistrat, der Primator geht den Würdenträgern bis zum Wagenschlag entgegen. Dann die Zeremonie der Neueinsetzung im großen Rathaussaal: Übergabe des Stadtsiegels an den neuen Primas, Vereidigung aller Ratsherren. Die Abfahrt der Statthalter wie die Anfahrt. Primas und Magistrat begeben sich dann in die Teynkirche zur feierlichen Messe. Darauf große Festtafel beim Primator, zu der die Herren Statthalter wieder erscheinen. All dies natürlich in damaliger Gala, die Allongeperücke als monumentales Requisit. In den Gassen hinterm Spalier der Stadtmiliz die gaffende Menge.
Das sind die Glanzlichter über dem armseligen Bürgerleben des damaligen Prag. Zuwanderung hatte das Deutschtum, das um 1600 schon ein Drittel der Bevölkerung ausmachte, noch gestärkt. Vor allem Kleinseite und Hradschinstadt waren deutsch. Die Altstadt war gemischt. Die Neustadt war in der Mehrheit tschechisch, meist kleinbürgerlich. Tschechisch sprach nur mehr der gemeine Mann, berichtet der tschechische Chronist Pessina (Tomáš Pešina von Èechorod) schon um 1660. Auch im Sprachlichen eiferte man dem Adel nach, der seinerseits wieder der Sprache des Hofes huldigte. Was nutzte es, daß Bohuslaw Baibin, der Jesuit, eine Verteidigung der tschechischen Sprache schrieb: er schrieb sie lateinisch.
Und doch ist es dieser Baibin, der nachdrücklichst an der Erhaltung und Weiterführung des tschechischen Nationalbewußtseins arbeitet. Er liebt sein Land, sein Volk, vertieft sich in Geschichte und Verfassung seiner Heimat. Seine Ansichten folgen denen Paul Stránskýs (S. 199): Unabhängigkeit Böhmens vom deutschen Reich, staatsrechtliche Einheit aller Länder der böhmischen Krone. Patriotische Überzeugung weist ihm in der Beurteilung der Reformation in Böhmen seinen Standpunkt. Gegen Hus stellt er Karl IV. und Ernst von Pardubice als nationale christliche Helden.
Er steht nicht allein. Im eigenen Orden hat er seine Mitkämpen um eine eigene tschechische Kultur, und zwar um eine Kultur auf dem Boden der katholischen Kirche. Da ist der große Friedrich Bridel (Brydelius, 1619 bis 1680). Die Forschung hatte ihn bis jüngst sehr falsch beurteilt, im Volksbewußtsein war er fast vergessen. Und doch muß man in ihm einen der größten tschechischen Dichter überhaupt sehen. Erst heute, da die Forschung ins Dickicht der »verworrenen und verschrobenen« Barockdichtung einzudringen beginnt, erkennt man die großen Schätze, die da ruhen.
Bridel hat eine Reihe französischer, lateinischer und deutscher religiöser Schriften übersetzt. Seine wesentliche Leistung sind die eigenen Werke. Da blüht »eine Fülle von frischen und zauberhaften Bildern«. Die Vorliebe für Antithesen, zwischen ihnen die ununterbrochene Bewegung der Sinnbilder, zeigt die eigentümliche Barockhaltung. Da treten auffallende Ähnlichkeiten mit den Gedichten der deutschen katholischen religiösen Dichter hervor, mit dem außerhalb des »Cherubinischen Wandersmanns« stehenden dichterischen Nachlaß von Angelus Silesius, mit den Gedichten von Friedrich von Spee, von Daniel Czepko. Für das großartige Gedicht »Co Bùh? Èlovìk?« (Was ist Gott, was der Mensch?) ist Bridels Autorschaft jetzt nachgewiesen. Die ganze Paradoxie des Göttlichen ist da in stürzenden, gleitenden, schwingenden Versen besungen. Der Reichtum auch an euphonischen Mitteln neben der sinnbildlichen Gestaltungskunst deutet auf die persönliche Einheit von Dichter und Komponist, der da im Prager Jesuitenkolleg –; er war eine Zeitlang Präses der Druckerei des Prager Clementinums –; eine hohe tschechische Dichtung pflegt.
Diese Tradition volkssprachlicher Kultur reißt im Orden nicht ab. Nach Bridel tritt Gottfried Joseph Bílovský (1659-1725) als großer Prediger hervor. Er ist der bezeichnende Vertreter der Barockpredigt. Die Forschung hat ihm Derbheit bis zur Geschmacklosigkeit vorgeworfen. Heute erkennt man die Herkunft seiner »geschmacklosen« Bilder aus der mystischen Tradition, die hier durch das Seelengut des Ordens mit sinnlichen Gluten (der Leidensschilderung zum Beispiel) neu gespeist wird. Volkstümlichere Art sprudelt in den Liedern dieser Barockdichtung, die auch schon gesammelt werden. Von Šteyers »Böhmischem Kanzional« (1697 und 1712) werden wir unten zu sprechen haben. Die jüngste Forschung entdeckt in dieser Kirchenkunst immer mehr tschechisches Eigengut, so daß man die im 19. Jahrhundert kulturpolitisch verwertete These von einer völligen Erstickung tschechischen Kulturlebens unter der Gegenreformation doch wohl wird einschränken müssen. Auch in diesem Hussitenvolk lebt –; vom klugen Orden gepflegt und wirksam gemacht –; eine starke Tradition katholischer Kräfte weiter. Wie sie von einer auf katholischem Standpunkt stehenden Geschichtsforschung gewertet wurde, werden wir später berühren.
In der Gesamtstimmung der Zeit steht diese hohe Dichtung einsam. Es kommt zu keiner breiten Schichtung, auf der sie bestimmend wirken könnte. Im Gegenteil: auf Nachbargebieten verengen sich die Gleise immer mehr. Ein Blick auf die Zustände an der Universität erschüttert. Die Union Ferdinands III. hatte nicht eine Anstalt mit einem klaren Lehrplan aus beiden Kollegien geschaffen: Jesuiten können nur herrschen, können sich nicht gleichordnen. Auch diese »Union« hatte sie nicht einzubinden vermocht in ein einheitliches umfassendes System. Unter Berufung auf ihre Ordensverfassung entzogen sie sich dem Universitätsgericht, der Universitätslehrordnung, der gemeinsamen Wirtschaftsverwaltung. Promovierten und erteilten Grade ohne Zuziehung des Kanzlers, gebärdeten sich in allem als autonome Universität. Sie bauten ihr Kollegiengebäude bei St. Clemens prachtvoll aus, errichteten ein Konviktsgebäude in der Bartholomäusgasse, außerdem noch das St.-Wenzels-Seminar in der Neustadt (das nun nicht mehr wie früher das »seminarium pauperum« genannt wurde!), erbauten auf der Kleinseite das große Profeßhaus neben der alten Niklaskirche, begannen in der Neustadt die Kirche zum hl. Ignatius. All dies innerhalb weniger Jahre.
Doch was entsprach in ihrem inneren Studienbetrieb dieser ungeheuren Expansion? Eine geistige Versumpfung ohnegleichen! Nach ältesten Rezepten wurde Philosophie traktiert: Scholastik, Logik, Physik, Metaphysik, immer in zweijährigen Kursen. Ethik und Mathematik kamen noch schlechter weg. Naturwissenschaften wurden kaum berührt –; Ende des 17. Jahrhunderts! –;, Geschichte und Geographie gar nicht. Die Lehrer mußten jährlich ihr Pensum wechseln, rückten mit den Klassen auf, wurden nach auswärts versetzt. So reiften sie nie zu einiger Vertiefung in ihren Stoff heran, lasen aus vererbten Heften vor, wehrten sich gegen Bücher. Im Buch stecke der Anfang aller Ketzerei. Und doch wußte man Studenten in Menge anzulocken. Gegen 600 besuchten damals das Clementinum und an die 40 Magister wurden jährlich graduiert. Zu groben Schematismen war an diesen Prager Jesuitenkollegien die Lehre Loyolas erstarrt.
An den weltlichen Fakultäten des Carolinums war es kaum besser. Die Juristen betrieben einzig kanonisches und römisches Recht. Vom Landesrecht nichts. Da die öffentlichen Vorlesungen nur geringes Gehalt einbrachten, ließ man sie verkümmern, strengte sich nur in den Privatvorlesungen an, die von den Studenten besonders honoriert wurden. Bei den Medizinern stand es noch schlimmer. Die liefen nur ihrer privaten Praxis nach, wetterten gegen die Wunderdoktoren, die auf dem Markt ihre Kunststücke aufführten und beim Volk, das den offiziellen Medizinern nicht mehr glaubte, starken Zulauf fanden. Je weniger man auf der Universität leistete, um so gefährlicher wurde diese Konkurrenz der Quacksalber. Wenige nur unter den Magistern der Medizin darf man ausnehmen: den berühmten Johann Löw von Erlsfeld vielleicht, der auch den Grafen Sporck behandelte. Das allgemeine Niveau war arg.
Klagen über die Zustände an der Universität gingen an den Kaiser. Josef I. verlangte 1710 vom Superintendenten ein Gutachten über die Verhältnisse am Studium. Der, Peter Theodor Birelli, deckte schonungslos die Schäden auf. Josef I. stirbt. Karl VI. läßt eine Kommission einsetzen, Birelli soll sie beraten. Der übliche Kommissionsbetrieb, durch Jahre hingeschleppt! Einziges Ergebnis: der Neubau des baufällig gewordenen Carolinums. Franz Maximilian Kanka führt ihn 1718 auf, nimmt den mittelalterlichen Erker mit herein in den Neubau. Interessant die Verteidigungsschrift der Jesuiten aus dem Jahre 1714: seit 158 Jahren hätten sie ihre weltberühmte Methode in Prag unverändert praktiziert (sie!). Warum solle sie heute wertlos sein? Warum sie Philosophie nicht auch für die weltlichen Berufe lehrten! (Man vernimmt in dem Vorwurf den ersten Angriff der Aufklärung, er war zurückhaltend genug im damaligen Prag.) Weil man die Jugend bewahren müsse vor den schädlichen Lehren des Descartes, der Jansenisten und der andern Ketzer im Westen. Unglaublicher Hochmut spricht aus dieser Verteidigungsschrift. Und Hohlheit. Nein, diese Prager Jesuiten entzündeten der Gegenreformation längst keine geistigen Feuer mehr. Sie trumpften nur mit äußerer Geste auf. Mit ihren Bauten! Und schließlich rief ja überhaupt aus dieser Prager Barockkultur kein elementarer Drang nach geistiger Bildung, nach ernster begrifflicher Durchleuchtung der Welt.
Ein Lebensgefühl, wie wir es oben schilderten, konnte ja gar nicht von klarer geistiger Haltung –; es mußte vom Sinnengenuß aus seine Vertiefung suchen. Denken und Forschen hätten es allzusehr belastet. Die Künste rief es auf, mit denen es sich schmücken, mit denen es die Abgründe zwischen seinem Auf und Nieder harmonisch füllen konnte. Hier in den Künsten war ja die Tradition in Prag nie abgebrochen, wie das in den begrifflichen Sphären geistiger Bildung der Fall war. Im Monumentalen, im Intimen trieb diese Tradition. Jetzt wurde sie lebendig.
Die Kunstkammer Rudolfs war trotz aller Plünderung noch wirkungsmächtig, zumal da Ferdinand II. und auch Ferdinand III. nach den Beraubungen durch die Bayern und Sachsen und Schweden einigen Ersatz gesandt hatten. Wirkliche Bereicherung brachte gleich nach Beendigung des Krieges die großherzige Stiftung des Olmützer Bischofs, des kunstsinnigen Erzherzogs Leopold Wilhelm. Der hatte in den Niederlanden bedeutende Kunstschätze gesammelt, war Kenner und Sammler von Format. Im Jahre 1649 übergab er viel davon der Galerie auf dem Hradschin. Da waren Tizians, Veroneses, Bilder von Palma Vecchio und Bassano und Guido Reni. Dann die alten Deutschen mit Lukas Cranach. Vor allem natürlich Rubens. So war da oben wieder eine ansehnliche Galerie entstanden, nicht so umfangreich wie die Rudolfinische, aber klarer in ihrer Zusammensetzung, eindeutig in ihrer Bestimmung als Bildergalerie. Karl Potin, ein berühmter Arzt, berichtet an den Herzog Anton Ulrich von Braunschweig von den vielen Tizians, von dem Raffael-Zimmer, von den zahlreichen erstrangigen Gemälden, die er 1673 in Prag gesehen hatte. Da war von Leonardo da Vinci »eine Jungfrau Maria mit dem Christkindlein«, auch ein Raffael gleichen Motivs, da waren von Tizian »ein Ecce homo«, von Guido Reni »ein Johannes tauft Christus«, da waren auch viele »Nuditäten« von Tizian, wie ein anderer Reisender, ein Schwede, im Jahre 1688 berichtet.
Joachim Graf von Slawata scheint damals der Malerei in Prag sich angenommen zu haben. Er hatte den Maler Christian Schröter nach Prag berufen, hatte dessen Ernennung zum k. k. Hofmaler und zum Inspektor der seit Miseronis Tod verwaisten Galerie durchgesetzt. Bei diesem Schröter lernt Johann Peter Brandl, ein Deutscher, in Prag geboren (1668). Der darf in der Galerie kopieren, lernt von den Meistern dort die große Form, gießt den Atem der eigenen Tage hinein, reift zum bedeutendsten böhmischen Maler dieser Zeit heran. Er wurzelt in der italienischen Tradition, erarbeitet sich eine prachtvolle Charakterisierungskunst, die ihm die vielbewunderten Typen gelingen läßt, in denen er die Menschen seiner Zeit schildert. Der Adel läßt sich porträtieren, so der Graf Sporck. Eine große lebendige Komposition adelt seine kirchlichen Darstellungen. Die Klöster bestellen große Altarbilder. In vielen Prager Kirchen hängen noch heute schönste Stücke (St. Jakob, S. Maria della Victoria, St. Margarethe in Breunau u. a.). Aber der Trubel der Zeit wirft auch den Künstler aus der Bahn: er verspekuliert sein Vermögen in der Beteiligung an einem Bergwerk, muß ein unstetes Wanderleben kreuz und quer durch Böhmen führen, den Aufträgen nach, die sich bieten.
Vor ihm hatte schon der Tscheche Karl Skreta die böhmische Malerei belebt. Er war in Kriegszeiten aufgewachsen (lebte von 1610-1674). So treibt in ihm noch die Schwere der frühbarocken Zeit, gegen die harte Gegensätze gestellt werden. Der nach dem Krieg einsetzende Kirchenbau bot auch ihm reiche Beschäftigung, Altarblätter, Apostelbilder, unterm Aufleben des Adels dann auch Porträts. Hier im Bildnis kommt seine Art dem Geschmack der Zeit entgegen: schwere, kernige Leibhaftigkeit, pompöse Haltung des Dargestellten, die Allongeperücke als monumentale Festigung. Das Ganze in dunkler volumenhaltiger Farbe hingesetzt. Das war typisch frühbarocke Malerei. In den gezeichneten Skizzen drängt frischeres Leben.
Auch ausländische Maler werden angelockt: Jean Claude Monet aus Burgund. Bemerkenswerter: Jean Valérien Callot. Später Abraham Godyn aus Antwerpen, der in Schloß Troja malte, Johann Hiebel aus Ottobeuren, der an der Kuppel in St. Niklas arbeitet, dann in der Clemenskirche Deckenfresken und Altäre malt. Sie brachten den einheimischen, die wir oben nannten, neue Antriebe.
So entstand wieder eine heimische Überlieferung, nun schon von einer breiten Gesellschaftsschicht getragen, die lebendiger anmutet, als jene kühl hochgezüchtete Malerei unter Rudolf II. Und doch stand Malerei jetzt viel weniger im Mittelpunkt des Interesses als damals, ja, die aufstrebende Architektur entzog ihr immer mehr die Selbständigkeit, baute sie ihrem Gesamtkunstwerk ein, ließ sie schließlich nur mehr als Freskomalerei in Kuppeln und an Plafonds gelten. Dafür goß sich aber immer tiefer der Rhythmus der Zeit in sie ein. Die Deckengemälde des Wenzel Lorenz Reiner, eines Deutschböhmen (Kuppel der Kreuzherrnkirche, in der Thomaskirche, in St. Kathrinen und St. Ägidien, in Maria-Loretto und im Palais Czernin), beste Beispiele des Barockfreskos, klingen und leuchten von innerer Musik, entzünden sich am Traum des Architekten, führen ihn, der sich einsenken muß in trotzende Wirklichkeit, hinüber in phantastische Illusion.
Denn wahrlich, die Künste dieser Zeit waren Musik und Architektur. In ihrer immer tieferen wechselseitigen Durchdringung erfüllt sich dies Jahrhundert. In ihnen strömte die Bewegung, die man liebte, in ihnen bot sich so stille Versunkenheit wie lautester Andrang des Gefühls, das volle Gegeneinander also, in dem man sich schrankenlos erlebte. Vom wilden Drang nach außen, der in der Architektur sich formte, schlug die Welle zurück in die Verwunschenheit der Klänge.
Und Prag erstand zu großem neuem Ausdruck. Es ist, als ob es jetzt erst seiner selbst sich bewußt würde in architektonischem Sinn. Was die Natur so prächtig hier angelegt, was das Mittelalter in sicherem Gefühl herausgeholt, erweitert hatte, das stattete der Barock nun aus mit seinen scharfen Akzenten. Jetzt plötzlich wird das heroische Gegenüber von Burg und Stadt lebendig, die große Rhythmisierung des Ganzen, die reiche Erwiderung von Hügel und Fluß. Als ob den Tönen nun die Sprache unterlegt würde, so mutet dieses Prager Architekturschaffen der Barockzeit an. Ein gewichtiger Schritt in der Bewußtwerdung des Menschen überhaupt wird darin getan: der Mensch wird zum erstenmal seiner Stadt als eines Organismus ansichtig, als eines Organismus, der seine Figur sucht. Er sieht sie als atmendes Wesen vor sich liegen, gestaltet sie nun auch im Bild (Sadeler, Wenzel Hollar, van Ouden-Allen).
Die Gesamtentwicklung von der Mitte des 17. bis zum 18. Jahrhundert gliedert sich in zwei Hauptphasen, die man in groben Umrissen als italienisches und als deutsches Schaffen einander gegenübersetzen kann. Spiegel des geistigen Verlaufs überhaupt, der aus romanischem Import die bodenständige deutsche Kultur herauswachsen läßt. Die eigentliche Architekturtat dieser Zeit, die schöpferische Leistung Prag-Böhmens, schiebt sich um die Jahrhundertwende zwischen beide Phasen ein, wird erst später außerhalb Böhmens aufgenommen und weitergeführt.
Seit der Renaissance saßen die italienischen Meister in Prag. Und nicht nur die Meister –; ganze Trupps von Werkleuten hatten sie mitgebracht, die ständigen Nachzug aus der Heimat erhielten. Die meisten stammten aus dem italienischen Alpengebiet, aus der Gegend um den Comosee, die seit der romanischen Zeit den Norden mit Bauhandwerkern versorgte und dadurch auch künstlerisch ausstrahlte. Für die Bevölkerungsschichtung Prags waren diese welschen Bauleute, denen sich auch viele Kaufleute angeschlossen hatten, von immer größerer Bedeutung geworden. Um 1600 waren sie schon eine wohlhabende Kolonie, unterstützten sich gegenseitig, gründeten die Wälsche Kapelle, das Wälsche Spital. Sie hatten sich zumeist auf der Kleinseite niedergelassen. Beim Einfall der Passauer scheinen sie mit diesen gemeinsame Sache gemacht zu haben. In den Kriegsjahren bekamen sie dann durch den damals einsetzenden Festungsbau reichliche Arbeit. Wallensteins, Michnas Paläste, die Jesuitenbauten lockten neue Scharen an. Sie hatten sich allmählich zu festen Genossenschaften zusammengeschlossen, die unter einem Unternehmer arbeiteten und unter sich in verpflichtender Kameradschaft verbunden waren. Wie sie tatsächlich ihre Stellung gegenüber dem einheimischen Handwerk behaupteten, haben wir oben erwähnt. Um die Jahrhundertmitte waren es vor allem die Gesellschaften des Carlo Lurago, des Santino de Bossi, des Silvestro Carlone und des Antonio della Porta, die den Baumarkt beherrschten. Der straff durchgeführte Unternehmerbetrieb schafft die gemeinschaftsmäßige Unterlage für die Leistung, ja er saugt die Persönlichkeit so stark auf, daß der Anteil der einzelnen Architekten an den Bauten jener Zeit schwer zu bestimmen ist.
In den Siebzigerjahren tauchen deutsche Bauunternehmer zwischen den italienischen auf. Als solche dürfen wir doch wohl einen Abraham Leuthner, einen Christoph Dientzenhofer ansprechen, die als Fortifikationsbaumeister große Aufträge bei den Festungsbauten in Prag und Eger übernehmen. Daß sie nicht nur Unternehmer oder, wie angenommen wurde, nur Baumeister, das heißt bessere Maurermeister waren, wird bei Leuthner deutlich aus seiner großen Veröffentlichung: »Grundtliche Darstellung der fünff Seüllen, wie solche von dem weitberümbten Vitruvio, Scamozzio und andern vornemben Baumeistren zuesamben getragen und in gewisze Ausztheillung verfasset worden u. s. w.«, eine Mustersammlung von Bauten und Denkmälern, wie sie damals vielfach verfertigt wurden. Daß eine solche in Prag herausgebracht wird, spricht von der architektonischen Regsamkeit des Ortes. Daß sie Leuthner verfaßt, spricht von dem theoretischen Interesse des Baumeisters. Er zeigt die großen Prager Bauten –; Clementinum, die Paläste Czernin und Vernier, die Kreuzherrnkirche, die Pest- und Mariensäulen, daneben die Trajanssäule in Rom und noch viel anderes mehr. Die Stiche stammen von dem Prager Stecher Kaspar Wussin. Daß auch Christoph Dientzenhofer mehr als Unternehmer und Maurermeister war, wird uns unten noch beschäftigen.
Die weitere Entwicklung wirft dann allerdings einen Architektentyp herein, der sich von diesem Kollektivtyp scharf abhebt: den Malerarchitekten. Unter seinem Wirken vollzieht sich die einschneidende Scheidung von entwerfendem und ausführendem Meister, bis dann der Ingenieurarchitekt, der seit dem Dreißigjährigen Krieg eine gewichtige Rolle spielt, im Hochbarock zum führenden Typ aufwächst.
Im Jahre 1641 waren die größeren Befestigungsarbeiten begonnen worden. Nach dem Westfälischen Frieden wurden sie systematisch in Angriff genommen. Die Denkschrift des Generals Raimund Montecuccoli hatte auf ihre Notwendigkeit hingewiesen. Italien war damals im Landfestungsbau führend. Oberst Graf Conti und Oberstleutnant Freiherr von Priami führen die Arbeiten mit dem kaiserlichen Ingenieur Johann Pieroni und den Baumeistern Carlo Lurago und Santino de Bossi durch. Im weiteren Verlauf erscheint dann auch Christoph Dientzenhofer als Festungsarchitekt (Bruska-Tor), im 18. Jahrhundert auch sein großer Sohn Kilian Ignaz. Teile der Fortifikation haben sich bis heute erhalten. Noch während des Krieges war auch auf der Burg wieder gebaut worden: Ferdinand III. soll die verschiedenen Burgtrakte, den Wladislawschen, den Rudolfinischen und den neuen des Matthias untereinander haben verbinden lassen: keine monumentale Bautätigkeit, immerhin bedeutungsvoll als Beschäftigungsquelle für die zahlreichen Bauleute.
Nach dem Krieg nun regt es sich überall. Die vielen Beschädigungen durch die Schwedenbelagerung müssen ausgebessert werden: die Befestigungen, die Wohnhäuser, die Brücke. Man wünscht auch mehr Komfort. Die Lobkowitz lassen ihren Palast auf dem Hradschin, den alten Pernsteinschen nahe am Schwarzen Turm, von Lurago gründlich erneuern. Die Hradschinwand ist monumental bis zum Hügelabbruch ausgezogen.
Drunten in der Altstadt an der Brücke nehmen die Jesuiten mit aller Energie den Ausbau von St. Salvator wieder auf. Noch prächtiger soll das Gotteshaus den Sieg des Ordens künden. Noch während der Kriegsjahre (1638) war der große Umbauplan entstanden: der Kirchenraum sollte jenem gleichen, der in Rom die Größe des Ordens prächtig ausdrückte, Il Gesù. Damals schon wurden zuerst im Presbyterium, dann auch im Langhaus gewölbte Emporen, in den Querhäusern Balkone eingefügt. Die gotisierenden Formen im Presbyterium wurden getilgt. Carlo Lurago wird als Meister(?) genannt. Jetzt denkt man an die Aufrichtung einer Kuppel über der Vierung. Wenzel Michna von Weizenhofen, der Gönner des Ordens, stiftet namhafte Summen. In den Jahren 1648 und 1649, vor und nach dem Schwedeneinfall, wird die Kuppel über der Vierung gewölbt. Man erkennt in Einzelformen Anklänge an solche in Michnas Palast auf der Kleinseite. So war St. Salvator nun im Aufbau zur stilgerechten Barockkirche geworden, während der Grundriß die gotische Herkunft festhielt.
Und wenige Jahre darauf reift dann das großartige Projekt dieser Jesuitenburg noch weiter aus: ein neues prächtiges Collegiengebäude soll der Kirche angebaut, soll um den ganzen Trakt in West und Nord herumgeführt werden. Auch die Kirche soll ins Ganze eingebunden werden: vor der Westfassade wird ein Portikus errichtet (1653) –; prunkvoller Empfang für den von der Karlsbrücke Kommenden –;, die Fassade selbst wird ihm schwungvoll angeglichen, wird so hinübergebunden an die prächtige Fassade des Collegienbaus, die in schneller Ausführung entlang der Kreuzherrngasse aufwächst. Zwischen Kirche und Collegiengebäude ein portalgeschmückter Eingang in die inneren Höfe. Der Figurenschmuck des Portikus und der Kirchenfassade wird um 1660 aufgestellt. Man mag in ihm eine Grundlage der späteren reichen Prager Barockplastik sehen, für die der hier tätige Meister Georg Pendel junge Kräfte (Jaeckel? u. a.) schulte. Der Collegienbau bringt plastisch bewegten Barock nach Prag.
Wieder, wie schon bei der Kirche, baut die Gesellschaft Lurago. Große Pilasterordnung, durch drei Stockwerke reichend, streng gereiht, in den Kapitellen reiche Spiellust von Girlanden und Maskarons. Das ist oberitalienische Art. Die Luragos dürften mit dem in Genua bauenden Rocco Lurago, der auch aus der Gegend bei Como stammt, verwandt sein. Vom zusammenreißenden Willen des hohen Barock ist hier noch keine Spur zu finden.
So baut auch Graf Nostitz, der um 1660 seinen Palast am Malteserplatz auf der Kleinseite beginnt: der geschlossene Block wird an der Fassade durch große Reihung gegliedert (hundert Jahre später setzte dann das Rokoko seinen reichen Zierat an dieser Fassade an). Ähnlich mag auch die erste Fassung des Palais Sylva-Tarouca gewesen sein, das als »Skuhrewskysches Schoßhaus« im Jahre 1670 begonnen wird. Daß es am Graben errichtet wird, deutet an, wie der Barock neues Baugelände zwischen den Städten erschließt. Damals standen ja noch die Mauern um die Altstadt.
Nach 1656 dürfte Graf Thun-Hohenstein, der Salzburger Bischof, sein einfach und schwer gehaltenes Palais am Hradschinabhang der Kleinseite errichtet haben: schwere Blockform, kaum untergeteilt. Auch die Baulust der reichen Kreuzherren wird nun gestachelt, als ihnen gegenüber die prächtige Clementinumsfassade höher wächst. Ihr Prior Pospichal läßt die alten Gebäude abreißen und beginnt an der Moldauseite neben Parlers Brückenturm mit einem neuen Konventsbau. Lurago ist für reichen Schmuck. Pospichal meint, dadurch würde nur das Gesindel angelockt, läßt die Fassade am Kreuzherrnplatz ganz einfach erstehen.
Und wieder bauen die Jesuiten. Drüben auf der Kleinseite war ihnen St. Niklas eingeräumt worden. Da errichten sie nun das große blockschwere Profeßhaus. Unter den Baumeistern wird Christoph Dientzenhofer genannt. Wegen Niederreißung der kleinen Wenzelskirche dort, wogegen die Kleinseitner Bürger protestieren, einigt man sich auf Errichtung einer Wenzelskapelle im neuen Profeßhaus. Auch für eine prächtige Niklaskirche wird schon der Grundstein gelegt. Große Feierlichkeit: der Kaiser ist anwesend, der Erzbischof Bilenberg weiht den Stein (1673). Der Graf Kolowrat-Libstejnsky hatte große Summen für den Neubau gespendet. Sein Wappen kam später an die Fassade. Von Giovanni Domenico Orsi soll ein erstes Fassadenprojekt stammen.
Man stellt den Baubeginn für die Kirche aber noch zurück. Zuerst soll das seit langem gewünschte Kolleg in der Neustadt gefördert werden. In jeder der drei Prager Städte sollte eine solche Jesuitenburg stehen. Ferdinand II. hatte schon in den Zwanzigerjahren Stiftungen für den Neubau gemacht. Jetzt (1655) geht man an die Durchgestaltung der Pläne. Das Projekt ist wieder sehr groß, auch in künstlerischer Beziehung: der langgestreckte Karlsplatz soll in halber Erstreckung von Kollegbau und Kirche gefaßt werden. Schon das Projekt verrät den Barock als schaffende Kraft. Jetzt soll diesem weiten Platz, den Rathaus und Fronleichnamskapelle nicht zu zwingen vermögen, die klärende Wand, das wirksam architektonische Gewicht gegeben werden. Und dieses Gewicht soll just der Fronleichnamskapelle gegenübergestellt werden, jener seltsamen Kirche inmitten des Platzes, in der ja –; wir hörten es –; der Hussitismus mit am ersten Fuß gefaßt hatte. Die beiden Türme, die der erste Entwurf vorsah, mußten die Kapelle ja erdrücken. Ein zweiter Entwurf brachte wieder den Gedanken von Il Gesù, jetzt in ziemlich reiner Ausprägung: große Kuppelkirche mit Dreikonchenschluß. Der dritte Entwurf –; die Pläne aller dieser Entwürfe sind erhalten –; zeigt schon so ziemlich die später ausgeführte Fassung: den Barocksaal mit polygonalem Schluß (ohne Kuppel), hinter breiten Arkadenpfeilern sind die Seitenschiffe zu Reihen in sich zentrierter Kapellen geworden, über ihnen die Emporen. Die Ausführung vereinfachte den Chorschluß zum Rechteck, faßte Kirchen- und Kollegfassade zu einer durchgehenden Wand zusammen (der Entwurf hatte ein trennendes Risalit eingeschoben), die dem Platzraum davor den monumentalen Halt und Abschluß sichert. Mit dem Kollegbau war 1659 begonnen worden. 1665 schritt man zum Kirchenbau. 1672 stand er schon eingewölbt und 1678 vollzog der Erzbischof Johann Friedrich von Waldstein die Weihe. Aber noch lange wurde weitergearbeitet. 1687 legt Paul Ignaz Beyer die Konstruktionen für den Turm vor, der an der Seitenfassade (zur Gerstengasse) zu stehen kommen soll. 1697 siegt Beyer im Wettbewerb für den großen Portikus, der wie bei St. Salvator die Westfassade gliedern soll. Den Statuenschmuck und die Fassadenstukkaturen liefert Antonio Soldat. 1702 sind Refektorium und Bibliothek im Bau. Die zweite Trutzburg der Jesuiten in Prag ist vollendet. Nun wollen auch die andern Orden erneuern. Die Karmeliter rufen Lurago und Orsiny zum Neubau ihres Galliklosters samt Kirche (letztere soll nur umgebaut werden). Auch dort folgt später Beyer in der Bauführung. Die Deutschen dringen ins Reservat der Italiener ein.
Diese gesamte Grundlegung der Barockarchitektur in Prag gipfelt in dem Palastbau, den Johann Humprecht Graf Czernin von Chudenice im Jahre 1669 beginnt. Der Bauherr ist Sproß eines reichen Geschlechtes. Aber die Kunstbegeisterung ist ihm nicht nur Tradition. Er packt sie höchst persönlich an. Auf Reisen hatte er sich gebildet. Als Gesandter in Venedig hatte er Gelegenheit, Schätze aus erster Hand zu erwerben. Er war auch für das Kaiserhaus als Einkäufer tätig. Seine Vorliebe galt der Architektur. In Rom gar hatte er selbst Architektur studiert. Unter Berninis Schülern sucht er den Architekten für seine Pläne. 1664 hatte er seine schöne Galerie nach Prag übersiedelt. Ein neuer Palast sollte sie bergen.
Auf beherrschendem Gelände hoch über dem Hradschin kauft er den Bauplatz. Francesco Caratti, ein Italiener, der am Schloß in Raudnitz gearbeitet hatte, zeichnet ihm die endgültigen Pläne. Erste Skizzen hatte Giovanni Battista Pozzo geliefert. Auch die Namen Galli und Roßbach kommen in einem Skizzenbuch vor. Der Graf selbst urteilt, ändert, entscheidet. Als Bauunternehmer erscheinen G. de Capauli und Abraham Leuthner. Über schwer rustiziertem Untergeschoß erheben sich mächtige Säulen, laufen in großer Ordnung durch drei Geschosse, nehmen über reich geschmückten korinthischen Kapitellen die Gesimsstücke auf. Das halbe Jahrhundert seit Wallensteins Palast hatte die plastische Belebung des Baukörpers voll herausentwickelt. Wo am Clementinum noch flache Pilaster die Reihung schufen, da treten hier massive Säulen vor den Mauerkern. Das läßt die großartige Reihung volltönend aufklingen. Der schwer zusammengehaltene Block, in sich noch ungegliedert, zeigt die heroische Fassade. Das ist höchste Steigerung jenes Willens, der seit dem Jahrhundertbeginn hier arbeitet. Der innere Organismus, mit dem durch drei Stockwerke durchgehenden Prachtsaal, mit den Galerien, Salons und Kabinetten, mit dem quer in den Hof gestellten prächtigen Treppenlauf, bleibt hinter der Fassade verborgen. Nur ein leiser Akzent, der die Mitte betont: der über einen kleinen Vorbau herausgeholte Balkon. Die Wirkung dieses stolzen Baus wird noch gesteigert durch das Gegenüber des intimen Kleinbaus von Maria-Loretto, an dessen Kreuzgang das ganze Jahrhundert hindurch Kapelle um Kapelle sich ansetzt.
In keinem der Prager Paläste scheint uns der Wille des Bauherrn so verkörpert wie in diesem. Mit welcher Leidenschaft wird hier Größe gesucht, erzwungen. Übermächtig die Fassade, übermächtig das Gesamtprojekt, das ein Vermögen verschlang, das nur zur Hälfte ausgebaut werden konnte. Der Bauherr erlebte es nicht, sein Sohn baute weiter. Ins Übermaß gereckt auch die Ausmaße der Innenräume, des Korridors, besonders des großen Saals. Da sind Proportionen in Höhe und Länge gedehnt, daß man –; wäre der Begriff nicht zeitlich festgelegt –; von Manierismus reden möchte. Aber die Bilder, die hier nun gehängt werden –; Johann Rudolf Biss aus Solothurn ist Galerieleiter –;: die Mantegna und Palma Vecchio und Tizian und Bassano und Caracci und Lukas von Leiden und Cranach und Teniers und Van Dyck und die Einheimischen Brandl und Reiner und die andern, sie alle halten sich leidlich im Zeitgeschmack.
Und während dieser Riesenbau in die Höhe wächst, während Reiner sein Gigantensturzfresko malt (1719) und Matthias Braun die Statuen meißelt –; Giovanni Battista Maderna und Domenico Egidio Rossi scheinen den Weiterbau geleitet zu haben, auch die Namen Mathey (s.u.) und Kanka (s.u.) tauchen in den betreffenden Archivalien auf –;, während in ihm eine Richtung sich so restlos erfüllt, daß eine Steigerung kaum mehr möglich ist, erneuert weiter unten auf dem Platz vor der Burg der Erzbischof seinen Palast. Dieser Reichsgraf Johann Friedrich von Waldstein hatte lange Jahre, bis zu seiner Berufung zum Bischof von Königgrätz, dann zum Erzbischof von Prag, in Rom gelebt. Dort hatte er im Kreise Claude Lorrains verkehrt, war auf einen französischen Maler gestoßen, der zur Architektur hinübergeschwenkt war. Ihn hatte er als seinen Leibarchitekten nach Prag gebracht: Jean Baptiste Mathey. Die Architektenpersönlichkeiten werden nun greifbar.
J. B. Mathey entwarf ihm den neuen Palast, in den der alte des Wolmut (S. 146) eingehen sollte: gereckter Block, in der Fassade ein dreiachsiger Mittelrisalit, durch Portalanlage und Belvedereaufbau hervorgehoben. Die Gliederung der Wand auf zurückhaltendes Rahmenwerk beschränkt. Vornehme Proportionen in Geschoßhöhen und Fenstern. Das war für Prag neu. Nach Oberitalien beginnt nun Rom einzuwirken. Und durch die römische Grundgestaltung hindurch der Geist der französischen Frühklassik. Der Block spricht wieder stärker als vorher, da die Wandgliederung zurücktritt. Dieser Block ist nun aber in sich gegliedert. Nicht nur an der Fassade weicht die Reihung dem Rhythmus –; der Kern selbst wird vom Rhythmus ergriffen. (Der Umbau im 18. Jahrhundert hat die ursprüngliche Form stark verändert.) Die Baugesellschaft Lurago führt den Bau aus (1674 bis 1689). Mathey darf als »nicht vom Handwerk« keine Bauhandwerker anstellen.
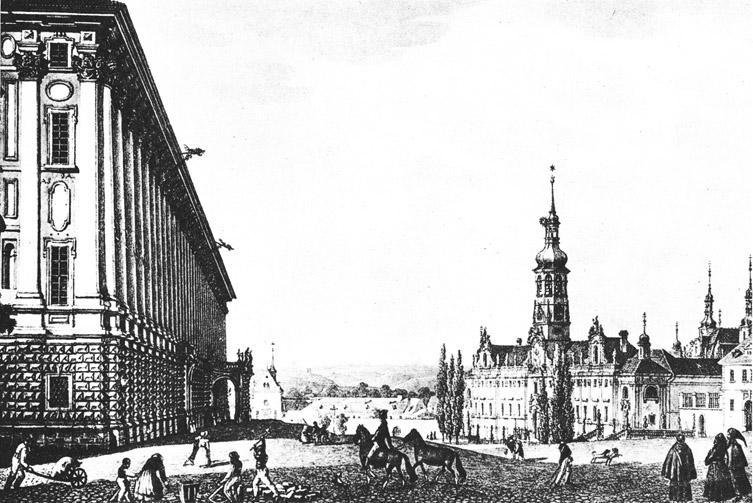
Czerninpalais und Lorettokirche um 1830.
Von Vinz. Morstadt. Lav. Sepiazeichnung (Verlag André, Prag).
Matheys Bau gefällt. Graf Wenzel Adalbert von Sternberg läßt sich von ihm die Pläne zu einem Lusthaus ausarbeiten, das er unten an der Moldau außerhalb Prags am Fuß der Moldauhöhen anlegen will: Schloß Troja. Dieser Graf von Sternberg, reichster Adel nach Czernin, war auf der üblichen Kavaliersreise weit in Europa herumgekommen. Er wünscht Modernstes. Mathey projektiert für ihn einen reich rhythmisierten Bau. Das »Lusthaus« gestattete die vollkommene Auflösung des Blocks zur offenen Dreiflügelanlage: der Grundriß drückt sich in die Massenverteilung durch, seitlich gerückte Treppensysteme stoßen zu kleinen Türmen auf. Vor dem Mitteltrakt eine schwingende Treppenanlage: ein Kabinettstück des Malerarchitekten, mit Skulpturen reich geschmückt. Der Prager Bildhauer Georg Herrmann schafft die in wildem Rausch niederbrechende Gigantomachie. Ein streng achsial angelegter Park nimmt das Ganze auf. Sylvester Carlone arbeitet als Bauunternehmer.
Matheys Ruhm wächst. Sein Gönner Waldstein, jetzt auch Großmeister der Kreuzherren, erteilt ihm den Auftrag, die Kirche dieses Ordens neben dem neuen Kloster am Altstädter Brückenkopf zu errichten. Gleichzeitig mit Schloß Troja beginnt Mathey den Bau. Die mittelalterliche Klosterkirche, die Agnes vielleicht in Anlehnung an den frühen Bau von St. Peter hatte errichten lassen, wird abgerissen: ein Zentralbau wächst auf. Schon dies ein Neues für das Prag dieser Jahre: seit dem Ausbau St. Salvators, des Jesuitenbaus, der an den Schöpfungsbau Vignolas in Rom, Il Gesù, sich anlehnt, war für Ordenskirchen aller Art das Schema des Langhauses mit Kuppel obligat: St. Maria Magdalena am Aujezd, das die Grafen Johann und Wenzel Michna von Weizenhofen den Dominikanern erbauen ließen, viele Ordenskirchen draußen im Land.
Nicht nur die Situation des Bauplatzes wird Mathey zum Zentralbau getrieben haben: sein starkes Gefühl für den Block mußte das Kernbetonende des Zentraltypus lieben. Gedrungen und voll kühler Zurückhaltung steht der Bau am Platze, den er beherrscht, der an seiner Moldauseite von Parlers Brückenturm, an der Stadtseite vom Salvatorportikus bezirkt ist. Wieder wird die Mitte betont: durch Giebelaufbau, durch Einnischung der Ecken. Über fast plumper Attika geht die Kuppel hoch. Die flache Pilasterordnung der Fassade wirkt wie Rahmenwerk. In Nischen sind einige Statuen eingelassen –; nicht aus dem Bau herausgetrieben wie beim echten Barockbau. Der Innenraum wird hinter gedrückt ovalem Mittelraum durch eine tiefe Apsis leise ins Longitudinale gezogen. Seitennischen bringen den Zentralcharakter zurück. Der Kuppelraum erhebt sich über ruhig geklärter Grundfigur. Man hat auf die Anklänge an Bauten Rainaldis hingewiesen (S. Maria de' Miracoli und S. Maria in Monte Santo in Rom), hat wieder die kühle französische Note betont, die gegen die scharf bewegte Atmosphäre Prags so sehr absticht. Vielleicht war es gerade diese Kühle, die man an Mathey schätzte, dieser Gegensatz zum eigenen Wesen. Sicher auch die Modernität dieser römischen Schulung für die Situation in Prag. Lurago, der das Kloster gebaut hatte und gewiß ursprünglich auch den Kirchenbau ausführen sollte, mußte die Pläne Matheys verwirklichen. Der Malerarchitekt hebt die Baumeisterarchitekten aus dem Sattel.
Noch einmal wurde Mathey Nachfolger des Lurago in der Ausführung eines Baues: bei St. Josef, der Kirche des Klosters der Karmeliterinnen auf der Kleinseite. Noch ehe Mathey nach Prag gekommen war, hatte man mit dem Klosterbau begonnen, unter viel Streitigkeiten mit den Nachbarn. Zuerst baute Lurago, dann Orsi de Orsiny und Canevale. 1673 hatte Kaiser Leopold, dem wir als emsigen Förderer der Prager Bautätigkeit immer wieder begegnen, den Grundstein zur Kirche gelegt, 1682 erst beginnt die Ausführung, und zwar nach den Plänen Matheys. Daß Mathey immer den verdrängten Konkurrenten zur Ausführung des Baues heranziehen mußte, mag tieferen Zerwürfnissen die Spitze abgebrochen haben. Allmählich dringt der »Nichtzünftler« dann doch ins Handwerk ein. In einem langwierigen Prozeß um die Berechtigung, Bauhandwerker einzustellen, entschied schließlich der Kaiser, dessen Hofarchitekt er geworden war, zu seinen Gunsten –; bedeutsam für die Kasse Matheys, vor allem aber für die soziale Wandlung in dieser Zeit.
Auch Mathey hat eine Wandlung durchgemacht: jetzt fügt er sich dem Bewegungsdrang des Nordens, Prags: er projektiert eine gereckte Giebelfassade mit übereinandergestellter Säulenordnung. Aber er nimmt nur die Stimmung von Prag –; die Form scheint aus weiter Ferne herüberzugreifen. In den südlichen Niederlanden, in Flandern, waren solche gereckten Giebelfassaden beliebt. Dorthin scheint auch die Anlage des Innenraums, wieder Zentralraum, zu weisen: sie lagert über gekuppelten Säulen schwere Architravstücke auf, durchnervt die Kuppelschale mit aufsteigenden Rippen. Der Vertikalzug ist also auch im Innern stark betont. Ein Nischenkranz schwingt um das Mittelrund, der tiefe Nonnenchor ist durch eine Mauerschale vom Kirchenraum abgetrennt, so daß hier das Zentralmotiv sich voll auswirken kann. Das reiche räumlich-plastische Ineinander, das jetzt erreicht ist, läßt aber doch auch hier wieder, vor allem angesichts des Grundrisses, an Rom denken. Dort darf man wohl auch die Quellen für jene flandrischen Bauten suchen. Mathey scheint frühere Motive aus seiner römischen Studienzeit aufgegriffen zu haben. In allem, auch in der Einzelform, spürt man an der Josefskirche mehr Wärme als an seinen früheren Bauten. Der warme Sandstein, in dem sie erbaut ist, tut ein übriges zu dem impulsiven Charakter des Werks.
Mathey hat viel zu tun. Die Prämonstratenser am Strahow lassen durch ihn den der Stadt zugewendeten Trakt ihres Konventsgebäudes umbauen. Silvestro Carlone ist Bauleiter. Der in der Mitte einziehende Rhythmus der Massenverteilung ist später durch Aufstockung verwischt worden. Der Erzbischof läßt auf seinen Besitzungen bauen. In Oberleutensdorf die Kirche, in Dux das Schloß. Im Kloster Plaß und wahrscheinlich auch im Kloster Waldsassen ist Mathey entwerfender Architekt, trifft hier mit Abraham Leuthner, mit Georg Dientzenhofer zusammen. Auch das prächtige Palais, das die toskanische Linie der Habsburger am Prager Hradschinplatz sich errichten ließ –; es schließt den großen Platz monumental ab, schließt ihn so eigentlich erst zum Platz zusammen –; wird dem Mathey zugeschrieben. Die Zurückhaltung in der plastischen Gliederung der Wände, die Belebung des Gesamtblocks durch leises Vorschieben von Risaliten, durch entsprechende Rhythmisierung der Dachzone ist ganz seines Geistes.
So wird man auch einige diesem »Toskanischen Palais« nahestehende Bauten in Beziehung zu Matheys Richtung bringen dürfen: das sogenannte Pøichowskysche Palais am Graben (heute »Deutsches Haus«) und das Kolowratpalais am Obstmarkt. Bei beiden noch ruhige Reihung der gliedernden Elemente, beim Pøichowskyschen Palais die wohlklingende Absetzung von Mittelrisalit, Seitenrisaliten –; mit Portaleinbauten –; und Flügelbauten, die einheitliche Dachzone auch im überragenden Mittelgeschoß, doch durch die –; figurenbelebte –; Attika durchgehalten. Ein Stich von Kaspar Wussin hat uns diese ursprüngliche Gestalt erhalten. Der Bauherr J. B. Vernier, einfacher Abkunft, wollte sich durch den stolzen Wohnbau den Reihen der Aristokratie eingliedern. Er hatte ein aus zwei alten Häusern bestehendes Anwesen am Graben gekauft (1695) und hatte den großen Neubau mit dem tiefziehenden Garten dahinter anspruchsvoll genug unternommen. Wir kennen den Architekten nicht, glauben aber Matheys Nachwirkung hier zu verspüren. Der Klassizismus hat den klingenden Bau in für ihn bezeichnender Weise gedämpft. Als G. Tuscani im Jahre 1797 das Palais (von den Pøichowskys, den damaligen Besitzern ankaufte), ließ er es durch Philipp Heger, der uns als Zeichner Prager Stadtansichten bekannt ist, im Zeitgeschmack umbauen und das heißt in diesem Fall: verflauen. Seitenrisalite und Flügelbauten wurden bis zur Dachzone des Mittelrisalits hochgezogen, die Dachzone also eintönig zusammengenommen, das Leben der Risalite gelähmt, die Verhältnisse verzerrt. Seit 1873 gehört das Haus dem »Deutschen Casino«.
Doch zurück zu Mathey. Nach 1682 baut er in Prag dem Erzbischof noch ein Familienpalais gegenüber dem Grandprioratshaus der Malteser; später wurde es umdekoriert, ist in den Besitz der Grafen Buquoy übergegangen, unter deren Namen es heute noch geht. Für das erzbischöfliche Seminar am Pulverturm baute Mathey die kleine Adalbertskirche, die im Jahre 1903 abgebrochen worden ist, zuletzt (1694) in kaiserlichem Auftrag die Reitschule im Burggarten. Auf einer Reise in die Heimat ist er dann im Jahre 1694 in Paris gestorben.
Er war kein genialer Architekt, für Prag war er wichtig. Er trug das Prinzip rhythmischer Gliederung in die Fassadengestaltung. Er begann den Baukörper zu kneten, vollplastisch zu durchsetzen. Brachte auch in den Innenraum Bewegung und rhythmische Gliederung. Sein Grundriß atmet. Er wußte schon Akzente zu setzen, nicht nur am Einzelbau, durch ihn schon im Stadtbild (Kreuzherrenkirche!). Der Barock begann unter ihm sich persönlicher zu regen. Die nächste Generation mochte das Fremde, das er für Prag bedeuten mußte, wieder ausscheiden: das Neue konnte sich zu freieren Leistungen ausbauen.
Um den Barock flüssig zu machen, bedurfte es der Durchorganisierung des Bauleibs von innen her. Mathey war schließlich doch Anhänger jener römischen Richtung, die sich gegen das subjektiv Durchpulste eines Borromini, eines Guarini wehrte. Gerade dieses subjektive Element aber mußte jetzt in die Prager Formensprache einfließen, um im Bau die Entsprechung erstehen zu lassen zum wildbewegten Leben der Epoche. Einmal, gerade zu der Zeit, als Mathey die kühl anmutende Kreuzherrenkirche begann, hatte es schon an das Kunstgewissen der Prager Bauherren gepocht: Guarini hatte einen Entwurf für die Kirche der Theatiner auf der Kleinseite geliefert, ja, er scheint damals persönlich nach Prag gekommen zu sein. Das war strömendes Leben, das von innen heraus den Bauleib formte: im Grundriß drei quer gestellte Ovale, die sich überschneiden. Das ergab im Raum groß buchtende Durchdringungen, ergab im Gewölbe komplizierte sphärische Gebilde. In der untern Zone noch einmal Raumkomplizierung: von den Seiten her dringen Nischenräume in den Ovalraum ein, aus dem Aneinander von Hauptraum und Nebenraum wird ein Ineinander. Die die Gewölbe tragenden Säulen fügen sich in ihrer Schrägstellung der Raumbewegung, betonen das Mitteloval. Das war eine reife Lösung des Guarinischen Ideals, war Fortführung der noch im Eck gebrochenen Raumdurchdringung von San Filippo Neri in Turin. Prag hätte damals eine Spitzenleistung europäischer Baukunst verwirklichen können. Wer aber hätte diese technisch so schwierigen Konstruktionsprobleme in der Praxis bezwungen? Die Baumeister, die Bauhandwerker Prags waren dem nicht gewachsen. Man lehnte ab, baute zwölf Jahre später eine höchst nüchterne, etwas schulmäßige Kuppelkirche in der Spornergasse (Nerudova).
Erst zwei Jahrzehnte später war Prag-Böhmen reif für derlei Ideen. Drangen sie über Wien ein? Dort zeigt die Piaristenkirche Guarinischen Einfluß (San Lorenzo in Turin). Deutsch-Gabel in Ostböhmen (1685-1692) hängt eng mit ihr zusammen: Reihung dreier Zentralräume zum Längsraum, ein zylindrischer zwischen zwei elliptoidischen. Die einheitliche Gewölbeführung wird durch Gurtsysteme vermittelt. Wir kennen den Architekten: der Bauherr, Graf von Berka, hatte den jungen Lukas von Hildebrandt mit dem Auftrag betraut (1699). Woborischt in Böhmen führt die Entwicklung weiter: über die beiden hintereinander gereihten elliptoidischen Räume werden nun errechenbare Gewölbe konstruiert, zwischen denen eine Tonne vermittelt. Von hier aus greift die Entwicklung nach Prag herein.
Im Jahre 1703 hatte man endlich mit dem Aufbau der Niklaskirche auf der Kleinseite begonnen. Schon 1673 war der Grundstein gelegt worden. 1711 konnte der westliche Teil der Kirche bis zur vierten Kapelle geweiht werden. Die Fassade war damals vollendet, das System des Innenraums durch die ersten Joche festgelegt. Dieses Innenraumsystem nun schließt an Woborischt an: die zum Längsraum gereihten Räume sind zylindrisch, also einfacher als in Woborischt. Die Weiterführung des Raumsytems ins Komplizierte beruht darin, daß diese in der Jochmitte zentrierten zylindrischen Räume die Jochteilung übergreifen, jeweils bis in die Mitte des Nachbarjoches hinüberragen. Die übereck gestellten, mit den Kanten in den Raum hereinragenden Pflaster deuten die Zylinderräume an. So entsteht im Grundriß eine alternierende Überschneidung, der Grundkreise, im Gewölbe eine in den Schnittkurven höchst komplizierte sphärische Durchdringung. Hier in der Gewölbekonstruktion hilft man sich wieder mit Tonnengewölben als Verbindungsstücken zwischen den elliptoidischen Hauptgewölben über den Jochmitten.
Führen wir diese Linie gleich weiter: die Benediktiner in Breunau, Prags ältestem Kloster, beschließen nun auch einen Kirchenneubau. In dieser St.-Margareten-Kirche wieder das komplizierte Innenraumsystem: diesmal im Grundriß quer gelagerte, ineinandergeschobene Ellipsen. Die Gewölbelösung ähnlich wie in St. Niklas mit den vermittelnden Tonnengewölben zwischen den elliptoidischen.
Das Ideal des hier bauenden Architekten ging auf restlose Errechnung der Gewölbekonstruktion. Der Barockbau, der in seiner Gesamthaltung so irrational anmutet, sollte in seiner Konstruktion völlig rational bezwungen sein. Solcher Einstellung gegenüber war die Tonne als Vermittlerin zwischen elliptoidischen Gewölben noch Kompromiß: die betreffenden Schnittkurven waren dem Zufall überlassen. Erst außerhalb Prags in Neu-Paka und in Eger (St. Klara) treibt die Form des Innenraums bis zur unmittelbaren Durchdringung der elliptoidischen Formationen auch im Gewölbe ohne jede Vermittlung der Tonne: die komplizierten Schnittkurven sind errechnet, die Gewölbe in den entsprechenden sphärischen Figuren darübergespannt.
Wir mußten diese Reihe, die durch die Prager Bauentwicklung wie ein Komet hindurchschießt, hier in ihrem ganzen Ablauf skizzieren. Einmal weil dadurch die erstaunliche Durchdringung von Rationalem und Irrationalem, wie sie in der gesamten Barockkultur (von Ignatius bis Bach) mitschwingt, in einem für Prag so bezeichnenden baulichen Ausdruck aufgewiesen wird. Dann aber, weil das unerhört folgerichtige Weitertreiben einer Idee, wie es sich in dieser Bautenreihe kundtut, auf eine persönliche Entwicklung hinweist, auf die Entwicklung eines genialen Architekten, der Guarinische Raumgedanken zum Ausgangspunkt nimmt und sie vorwärtstreibt bis zu ganz neuen Perspektiven.
Dürfen wir ihn unter den bisher uns bekannten Prager Architekten suchen? Mathey war tot; Lurago, Orsiny, auch Paul Ignaz Beyer, der jetzt mehr in den Vordergrund rückt, zeigen nirgends Ansätze zu solcher Raumkomplizierung. Seit den letzten Siebzigerjahren waren Mitglieder der fränkischen Baumeisterfamilie Dientzenhofer in Prag aufgetreten. Einem von ihnen, dem Christoph Dientzenhofer, der sich hier niedergelassen hatte, werden sowohl die Westteile der Niklaskirche wie die Margaretenkirche zugesprochen. Dann müßte er mit Hildebrandt (Deutsch-Gabel) und mit dem genialen Erbauer dieser ganzen Reihe bis St. Klara in Eger in engster Verbindung gestanden haben. Wie aber sind ihm die Guarinischen Anregungen zugegangen? Wir hören nicht, daß er gereist sei, daß er in Hütten berühmter auswärtiger Architekten gearbeitet habe. Man glaubte, ihn nach einer bestimmt ihm zuerkannten Leistung, dem Ausbau der Maria-Magdalenen-Kirche auf der Kleinseite, die recht übliche Handwerkerart verrät, beurteilen zu müssen. Es schien der Tradition, der er entstammt –; die Dientzenhofer kamen als einfache Bauhandwerker nach Prag –;, zu entsprechen. Neuerdings glaubt man aber urkundliche Belege für seine Autorschaft bei St. Margareten (Breunau) gefunden zu haben. War er der planende Architekt? Dann dürfte man also schon im Vater des berühmten Kilian Ignaz den genialen Neuerer sehen, der Böhmens und Prags Architektur in kühnem Wurf auf den Gipfel europäischer Leistung hob. Ehe die entsprechenden Einzelforschungen vorliegen, dürfen wir dies nur andeuten.
Damals griff auch der größte Wiener Meister persönlich in die Prager Entwicklung herein. Während die Prager Architekten an der Fassade von St. Niklas bauten: Abwandlung der Fassade von Il Gesù (in ihrer Gestaltung durch Giacomo della Porta), aber schon aus der geraden Flucht herausschwingend, die Seiten entsprechend den durch Emporen erhöhten Seitenschiffen höher hinaufgezogen, der schwer anhebende Schwung der Fronten noch gedämpft durch kräftige Horizontalbänder der Gesimse, während am Clementinum der Südtrakt (gegen den Marienplatz) aufwuchs, einfacher gehalten als die Westfront, während an St. Ignatius Paul Ignaz Beyer den Turm und den Portikus anbaute, ließ Johann Wenzel Graf von Gallas, der prunkliebende Diplomat, Enkel des Nachfolgers Wallensteins im Oberbefehl über die kaiserlichen Armeen, durch Johann Bernhard Fischer von Erlach in enger Gasse der Altstadt, nahe dem Clementinum, sein neues Palais errichten. Was Mathey nur im »Lusthaus« vor den Toren der Stadt gewagt hatte, dringt nun in den Stadtpalast ein: der Bauleib reckt sich im eigenen Rhythmus, das Treppenhaus wird Zelle des Innenorganismus, die Fassade darf zurücktreten in eine vornehme Ruhe. Nur die Giganten, welche die Balkone über den beiden Portalen tragen, Schöpfungen des in Böhmen arbeitenden Tirolers Matthias Braun, bringen die Unruhe des Barock in die zurückhaltende Fassade.
Wahrscheinlich erstand damals auch der Palast des Grafen Morczin in der Spornergasse (Nerudova) auf der Kleinseite: dreizehn gleichmäßig gereihte Fensterachsen, zwei Portale symmetrisch zueinander ausgewogen. Das Mittelrisalit noch betont durch den Balkon, der von Ferdinand Brokoffs Mohren getragen wird. Und schräg gegenüber läßt Franz Norbert Graf Kolovrat einen Palast erbauen, dem von den Slawatas überkommenen Palast an der neuen Schloßstiege über den Hof die Entsprechung an der Spornergasse bietend. An der Fassade, einer der großartigsten unter den Prager Palastfassaden, ist Johann Santin Aichls Faust zu spüren. So ragt dessen bedeutendes Schaffen, das draußen im Land die böhmische und mährische Barockkunst so eigentlich geschaffen hat (Sedletz 1703, Bøezan 1705-1707, Saar 1705, Schlüsselburg 1707, Plaß 1711, Marienteinitz 1711, Klattau 1712, Seelau 1713, Freudenthal 1714, Chlumetz, Schloß Karlskron 1721, Raigern 1721), in einem Hauptwerk (1716) doch auch nach Prag herein. (Die starken Einwirkungen auf den jungen Kilian Ignaz Dientzenhofer mögen in persönlichem Verkehr vermittelt worden sein.) Über dem herrlichen Portal recken sich die Adler des Matthias Braun. (Der Palast ging später an den Grafen Thun über. Bis 1939 italienische Gesandtschaft.)
Nun waren alle Elemente der Epoche in die Prager Bauentwicklung getragen: römische Monumentalität und französische Kühle, borrominesker Subjektivismus und zuletzt noch Wiener Klassizismus. Die neue Generation, die jetzt antritt, kann aus dem Vollen schaffen. Ihr Meister ist Kilian Ignaz Dientzenhofer, der aus Franken eingewanderten Familie entsprossen. Lehrzeit beim Vater, Wanderjahre zur Werkstatt Hildebrandts, nach Italien und vor allem nach Paris. Jetzt schafft er in Prag sein erstes Werk, die Villa Amerika: Johann Wenzel Graf Michna läßt sich das »Zwergenhaus« auf der Neustadthöhe unweit des Karlshofes erbauen (1720). Pavillonartig, dreiachsig durch zwei Geschosse, darüber Mansarddach. Feinst abgewogene Verhältnisse bringen Leben in den Block. Reicher Schmuck über Fenstern und Portal läßt ihn aufklingen. Nach diesem intimen Werk sein erster Kirchenbau: die kleine Johann-Nepomuk-Kirche der Ursulinerinnen auf dem Hradschin (1720-1729). Die Fassade trotz reizvoller Einzelmotive noch etwas schematisch und hart, der Innenraum aufschwingend im Kuppelgemälde Wenzel Lorenz Reiners. In St. Peter und Paul am Zderaz schafft er schon freier. In diesen Jahren dürfte er auch mit dem Ausbau der Fassade von Maria Loretto beschäftigt gewesen sein, deren Pläne er allerdings von Vorgängern (Christoph?) übernommen haben mag. Dann die schwierige Aufgabe, die mittelalterliche Kirche des Thomasklosters zu modernisieren (1723-1731). Raum und Körper waren gegeben. So mußte mit Überkleidungen in Stuck gearbeitet werden. Außen große Portalkompositionen: die an der Seitenfront wird als point de vue für eine dort einlaufende Gasse angesetzt. (Die Entsprechung am andern Straßenende schuf später das Palais Kaunitz in der Brückengasse, Mostecká).
Endlich im Jahre 1727 die erste große Aufgabe: die Benediktiner, denen nun auch St. Niklas in der Altstadt zugewiesen worden war, beschließen Neubau von Konventsgebäude und Kirche. Kilian Ignaz soll bauen. Zuerst wird der Konventsbau in Angriff genommen. Er erstreckt sich gegen die Judenstadt hin. Das Prälatenhaus zeigt kräftigen plastischen Schmuck über den Baugliedern, wird gehalten durch eine vornehme Gesamtproportion. Bernardo Spinetti stuckiert die Innenräume köstlich aus. (Ende des 19. Jahrhunderts, 1897-1898, wurde der Bau abgebrochen.)

Kreuzherrnplatz um 1830.
Vinz. Morstadt. Lav. Sepiazeichnung. Links: Kreuzherrn-Platz, rechts: Portikus von St. Salvator, anschließend Konvikthaus der Jesuiten (Clementinum). Im Hintergrund: Palais Pachta (Verlag André, Prag).
Kernaufgabe ist die Kirche. Auf kleinstem Gelände muß gebaut werden: zwischen Konventsbau und dem am Ring gelegenen Krennhaus. Vom Rathausblock (im Westen) kommt außerdem noch eine enge Gasse. Die Situation drängt zum Zentralbau. Pariser Einflüsse wirken sich aus. Für den Grundriß steht Jules Hardouin Mansarts Invalidendom Pate, wird allerdings aufgelockert: die Grundformen der Kapellenräume sind aus der Kreisform in die Ellipse gedrückt, der Mittelraum ins Oktogon gebrochen. Die Aneinanderfügung der Räume, die dort das Ensemble bildet, wird mehr ins Ineinander aufgeschmolzen. Im Schmuck der Säulen und Gesimse, der Balkone über den Eckkapellen und den Emporen ist sprudelndes Leben hinaufgehoben in die lichte Kuppel. Für die Fassadenkomposition blieb nur die enge Durchfahrtsgasse vom Ring zum Ghetto. So mußte alle Außenwirkung hier gesammelt, dabei doch der enge Wirkungsraum, die schmale Gasse berücksichtigt werden. Von zwei flankierenden Türmen fällt der Rhythmus steil auf zwei Seitenrisalite nieder, wird dann in prächtiger Steigerung in die von doppelter Säulenstellung hochgetriebene Portalanlage hinaufgehoben. Darüber die Kuppel. Welch plastischer Reichtum gegenüber der vor fünfzig Jahren erbauten Kreuzherrenkirche Matheys, welche Durchgeistigung der Masse!
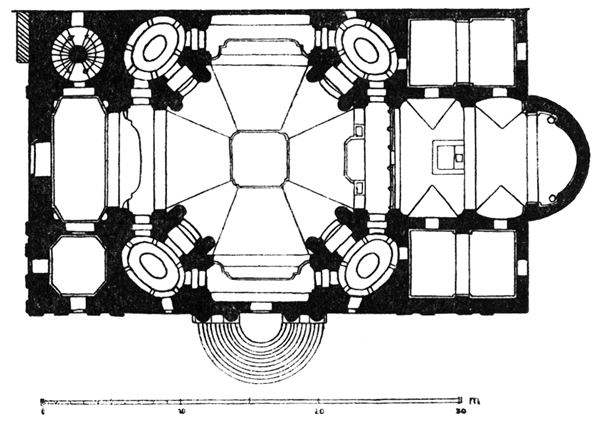
Grundriss von St. Nikolas
Gleichzeitig baut Dientzenhofer in Karlsbad die Maria-Magdalenen-Kirche. Hier in dem ganz irrational schwingenden Raum mit der komplizierten Gewölbeführung schließt er unmittelbar an jene oben erwähnte Reihe an. Mit diesen Gedanken tritt er nun auch in reizvollen Kleinbauten in Prag auf. Keine geraden Mauerflächen mehr: alles schwingt in Kurven, in komplizierten Figuren. In der Bartholomäuskirche war der Mittelraum im Grundriß noch quadratisch geblieben, aber in den Ecken schon tief eingenischt, so daß die geraden Flächen nur noch an den Außenseiten wirkten. Im Osten und Westen waren elliptoidische Räume angefügt. Die Aufsetzung der flachen Kuppelschale über der Mitte löst den Gesamtraum trotz der geraden Seitenbegrenzungen unten in eine schöne Bewegung auf. In dem kostbaren Kirchlein Johannes von Nepomuk (am Felsen) in der Neustadt (ab 1730) wird der Mittelraum dann vollends zu einem in Kurven schwingenden Oktogon, im Westen und Osten wieder die beiden elliptoidischen Räume. Über der Mitte die Flachkuppel, vom Fresko illusionistisch zur Hochkuppel erweitert. Zwei kleine Fassadentürme aus der geraden Flucht herausgerückt, übereck gestellt. Zu der hoch über dem Straßenniveau gelegenen Kirche führt die in zwei Arme gebrochene, schwingende Treppe. Raum und Körper regen sich im gleichen hochgehenden Atem. 1729 beginnt Dientzenhofer auf kaiserlichen Befehl das Invalidenhaus, einen großen anspruchslosen Zweckbau. In der Karl-Borromäus-Kirche in der Neustadt (1730-1736) gibt er dem Baukörper noch einmal die ganze vornehm zurückhaltende Modellierung westlicher Prägung, setzt aber doch in der Ecklösung (an der Straßenkreuzung) und an der daneben gestellten Portalanlage den lebhaften Akzent.
Und jetzt wird er zur Vollendung der Kleinseitner Niklaskirche berufen (1737). Das war der Hauptbau im damaligen Prag. Der Hauptmeister des Landes sollte die seit Jahrzehnten wenig gediehene Arbeit beenden. Kilian Ignaz findet das System und fast das ganze Langhaus fertig vor. Ein dem Stolz der jesuitischen Erbauer entsprechender Chor muß noch angefügt werden: ein Chorbau mit Kuppel, wie es das Jesuitenschema fordert. Die eineinhalb Jahrhunderte seit dem Schöpfungsbau von Il Gesù in Rom hatten den Kuppelraum immer mehr in den Chorraum, ja in den Gesamtkirchenraum verschränkt. Rom, dann auch Paris, zeigten großartige Lösungen dieser Bauaufgabe. Kilian Ignaz greift wieder auf seine Pariser Eindrücke zurück. François Mansard hatte in der Kirche Val-de-Grâce einen weiten Dreikonchenraum als Unterbau der Kuppel komponiert. Dientzenhofer greift den Gedanken auf, ersetzt im Grundriß das Halbrund der Konchen Mansards durch tiefe, in die Achsen hineingetriebene Halbellipsen, über deren kuppeligen Gewölben die Hauptkuppel aufgeht. Vor den tragenden Mauerkern sind je zwei Säulen gestellt. Die beiden Säulenpaare im Osten wirken als Hintergrundkulissen für die übereck gestellten Pilaster des Langhauses, deren Übereckstellung, den gereihten Raumzylindern entsprechend, ebenfalls kulissenhaft für die Gesamtdurchsicht wirkt. Der im Südwesteck angebaute Turm ist in interessanter Weise in den Chorgrundriß verschränkt (s.u. Grundrißzeichnung). Ein gewisser Zwiespalt zwischen französischem Akademismus und hochbarocker Gesinnung, wie er diese Schöpfung, fast möchte man sagen, reizvoll durchweht, klingt auch im Schmuckwerk an: das stellt teils einen leisen Klassizismus gegen das hochbarocke Gerüst, teils akzentuiert es in aufschäumender Plastik die Lichteffekte. Ignaz Platzers bewegte Skulpturen rücken den Gesamteindruck doch wieder in den lauten Sinnentrubel, in dem diese Zeit ihre religiöse Empfindung verwirklicht. Auch am Außenbau, an dem der scharf hochgehende Turm gegen die mächtige Kuppel gestellt ist, umziehen Platzers reich bewegte Plastiken (1747-1755) den gesamten Bauleib: von hoher Attika grüßten diese Figuren bis vor wenigen Jahrzehnten, wo sie wegen Verwitterung herabgenommen wurden. Wir können den schönen Bau hier nicht noch in seine vornehmen Details hinein beschreiben, dürfen aber noch auf den Wurf hindeuten, den seine Aufstellung im Stadtbild der Kleinseite, ja im Gesamtstadtbild im künstlerischen Sinne bedeutet (vgl. »Raumerlebnis«). Der barocke Kirchenbau Prags hatte hier seine Krönung gefunden.
Bei zwei großen Adelspalästen wird des Meisters Urheberschaft noch vermutet. Bei einem ist seine Mitwirkung sicher verbürgt: in dem Palais, das Oktavian Äneas Josef Reichsfürst Piccolomini von Arragon aus dem Skuhrewskyschen Schoßhaus am Graben sich umbauen ließ (später Sylva-Tarouca). Neunachsige Fassade, durch flache Pilaster durchlaufend gegliedert (ursprünglich?). In diese Fassade sind durch Balkonvorbau auf Säulen und Giebelaufbau ein Mittelrisalit, durch kleinere Segmentgiebelaufbauten zwei Seitenrisalite hineinkomponiert, so daß ein Dreierrhythmus das Ganze belebt. Im Innern ein prunkvolles Treppenhaus, das wieder Platzer mit Figuren geschmückt hat. Der andere Profanbau, das Palais, das der Graf Goltz am Altstädter Ring sich erbauen ließ –; später vom Grafen Kinsky erworben –;, rhythmisiert die Front durch zwei symmetrisch angeordnete übergiebelte Risalite. Die zu reichem Klang durchgeformte Masse, die vornehme Proportionierung der Stockwerke, die klare Plastik in der Schmuckaufteilung und viele Einzelheiten sprechen auch hier für Kilian Ignaz Dientzenhofers Autorschaft.
Von ihm sich bauen lassen, das hieß den eigenen Glanz vermehren. Groß war sein Ruhm, groß auch seine Leistung. In ihr band er die Anregungen von Rom und Paris mit der heimischen Überlieferung zusammen, die sich unter den Taten der böhmischen Meister schon kraftvoll entwickelt hatte. Die leise Spannung zwischen reicher Phantasie und vornehmer Selbstzucht bis zur Kühle sichert ihm den persönlichen Ausdruck. Ihm vor allem dankt Prag sein neues Antlitz. Er gehört zu den großen deutschen Meistern, die den Barock seiner Vollendung entgegenführten.
Am 18. Dezember 1751 ist Kilian Ignaz Dientzenhofer gestorben (geboren am 1. September 1689 in Prag). Zehn Jahre später richtet seine Witwe (zweite Ehe) »Anna Theresia Dintzenhofferin, verwittibte Böhmische Hof-Bau-Meisterin« an Maria Theresia ein Bittgesuch um Gewährung einer Pension oder doch um Aufnahme eines ihrer Söhne in eine Stiftung. Sie könne nun, da sie älter werde, sich und die Kinder nicht mehr mit eigener Hände Arbeit durchbringen. Sie erinnert an die Verdienste des verstorbenen Mannes um das kaiserliche Haus. Zwanzig Jahre habe er dem Kaiser Karl, dann der Kaiserin als Hof- und Fortifikationsbaumeister gedient, habe als solcher während der französischen Okkupation unter vielfältiger Bedrohung viele tausend Gulden aus Eigenem zugebüßt und Schulden machen müssen. Während des Bombardements durch die Franzosen habe er auf ausdrückliches Ersuchen des Kommandanten Ogilvy den gefährlichen, allen Kanonenschüssen preisgegebenen Posten mitten auf der Prager Brücke gehalten, was doch eigentlich einem Ingenieur oder sonst einem militärischen Offizier zugestanden habe. Beim Auszug der Preußen im Jahre 1744 habe er auf dem Laurenziberg durch schleunige Abnehmung der Lunte die von den Preußen angelegte Mine gehemmt, habe so die Residenz und ein gut Teil der Kleinseite gerettet, sei dafür auch zur Nobilitierung vorgeschlagen worden, sei aber wegen erlittenen vielen Schadens nicht imstande gewesen, dergleichen Prärogativen zu bewirken, so daß solche Begnadigung ohne Effekt geblieben. Als er dann 1743 als Fortifikationsbaumeister abgesetzt, so des Gehalts von 500 fr. jährlich verlustig gegangen sei, habe man »bey so gestaltig Ehrlich und von allen Eigennutz entfernten Diensten« und bei den vielen Kindern, »deren er in der ersten Ehe 6, in der zweyten Ehe mit mir 13 gezeiget«, zu einiger Erziehung und Versorgung derselben nichts vor sich bringen können. Sein mittelloser Zustand habe nicht von übermäßigem Leben hergerührt, sondern nur aus der Kleinigkeit der Einnahmen, indem er vor und nach dem Krieg alle Risse (Reisen [?]) nach Eger (Festungsbau) und auf die königlichen Cammeralherrschaften und Schlösser trotz namhafter Kosten ohne Entgelt verrichtet habe, ihm auch alle Risse für Kirchen, Schlösser und andere Bauten niemals entlohnt worden seien, wie er ja auch für den Bau (Neubau) des Spanischen Saals im hiesigen Schloß nichts empfangen habe, wie das Prager Bauamt bezeugen müsse. Zuletzt habe er sich bei der Bauführung zu Neuhof Fieber und die Wassersucht geholt, daß er durch eineinhalb Jahre keine gesunde Stunde mehr genossen.
Die Bitte um eine Witwenpension wird abgeschlagen unter Hinweis auf die sechs Jahre zuvor gewährte Abfertigungsgnade von 300 fr. Aber der Sohn soll baldmöglichst in einer Stiftung untergebracht werden. Als dann der Komotauer Jesuitenrektor sich bereit erklärt, den vierzehnjährigen Johann Joseph in seinem Seminar aufzunehmen, packt die Mutter doch die Angst und sie bittet inständig, den Sohn doch in einem Prager Collegio unterzubringen. Über den weiteren Verlauf fehlen Nachrichten. Das Vorliegende genügt, um in das private Leben des großen Baumeisters einen Blick zu tun, um auch in der privaten Sphäre den vornehmen Charakter achten zu dürfen, der aus seinen Meisterwerken spricht.
Um diese große Architektur, aus ihr heraus trieb eine reiche Plastik. Die innere Bewegtheit schoß aus dem Baukörper, mußte sich in der Figur, im Abbild des Menschen den beseelten Ausdruck schaffen. Da waren Portale zu schmücken, Treppenhäuser prächtig zu beleben. Die Kirchen wünschten die Prozessionen der Heiligen in ihren Räumen, wünschten auftrubelnde Altäre, wünschten die Standbilder ihrer Patrone draußen auf den Plätzen. Und Grabmäler sollten repräsentativ an die Toten erinnern. Das Jahrhundert erzog sich seine Bildhauer, überhäufte sie mit Arbeit und mit Ruhm. Skulptur war in dieser Zeit, der Bewegung und ihr leiblicher Ausdruck alles war, in ganz anderem Sinne noch als die Malerei Verlebendigung des Gefühls. Antriebe aus dem vorigen Jahrhundert, da die Renaissancebildhauer –; vor allem Flanderns –; die Prager Kirchen mit reichen Epitaphien und Grabmälern ausgeschmückt hatten, da ein Adriaen de Vries seine reiche Könnerschaft hier gezeigt hatte, mögen weiter gewirkt haben.
In Johann Georg Bendel (Pendel –; aus der Tiroler Schnitzerfamilie?) hatten sich viele Anregungen neu gesammelt, hatten wohl auch eine Schule entstehen lassen. Bendel war zu seiner Zeit ein begehrter Meister. Bei der Mitarbeit an der Mariensäule auf dem Altstädter Ring (s.o.) scheint er viel gelernt zu haben. 1659 lassen die Jesuiten von ihm die Kirchenväter auf dem Portikus vor St. Salvator fertigen. 1676 schuf er für den Altstädter Magistrat die Weinsäule, die vor dem ehemaligen Weinamt am Altstädter Brückenkopf der Karlsbrücke aufgestellt wurde (später an die heutige Stelle am Eck der Kreuzherrnkirche versetzt). 1678 war sein Wenzelsdenkmal, ein Reiterstandbild, das er im Auftrag des Neustädter Magistrats für den repräsentativen Platz der Stadt, den Roßmarkt (Wenzelsplatz), geschaffen hatte, aufgerichtet worden. (Es wurde 1875 auf den Wyschehrad übertragen.) 1670 hatte er dann noch den Herkulesbrunnen für den Hofgarten in Auftrag bekommen. All das macht deutlich: Prag begann damals bewußt sich zu schmücken. Und Prag verfügte über einen Meister, der solchen Aufgaben recht und schlecht gewachsen war, der eine Schule begründete.
Dieses bewußte Sich-Schmücken drängt nun in der hohen Barockzeit weiter. Die Karlsbrücke, die Hradschin und Altstadt so symbolisch verband, mußte vor allem zur skulpturalen Verlebendigung locken: trieb es auf ihr doch von reichen Kräften herüber, hinüber, stießen Körperkräfte doch aus den starken Pfeilern auf, die man nur abzufangen, zu vermenschlichen brauchte, um überschwengliche Skulptur zu erbeuten. Den Auftakt zu ihrer Ausschmückung hatte die Stiftung Kaiser Leopolds gegeben, der im Jahre 1657 an Stelle des arg beschädigten hölzernen Kruzifixes inmitten der Brücke ein aus Erz gegossenes hatte aufstellen lassen. Er hatte das aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts stammende Bildwerk bei den Hillingerschen Kaufleuten in Dresden für 500 Reichstaler erwerben lassen.
Als gegen Ende des Jahrhunderts die Bestrebungen zur Kanonisation des Johannes von Nepomuk sich regten, wurde zur sinnfälligeren Propaganda gleichsam dem Märtyrer eine Statue auf der Brücke errichtet, von der aus er in die Fluten gestoßen worden sein soll. Der kaiserliche Bildhauer Matthias Rauchmiller hatte den Entwurf geliefert, nach dem Johann Brokoff, ein Zipser, der vor kurzem zugewandert war –; er hatte in Regensburg gelernt –;, das Holzmodell schuf: keine überragende Leistung, doch als Urbild aller nun in ungezählten Exemplaren aufschießenden Nepomukstatuen bedeutungsvoll (1683).
Man bekam Freude an der Monumentalisierung der Brücke, wie der Statuenschmuck sie versprach. Im Jahre 1695 stiftet der Altstädter Bürger Michael Gabriel Matheides eine Pietà, deren Ausführung wieder dem Johann Brokoff übertragen wird. Und die beiden ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts lassen dann Adel und Bürger und Klöster und Fakultäten wetteifern in der Aufrichtung der Heiligenbilder. Alle namhaften Bildhauer, die in Prag beschäftigt sind, erhalten Aufträge.
Die Entwicklung der Prager Barockplastik läßt sich hier lückenlos verfolgen. Jetzt arbeitet Johann Brokoff gemeinsam mit seinem Sohn Ferdinand: noch etwas gestellt in der Künstlichkeit der Kontraposte und Faltenschwünge, die Gruppe (die Heiligen Barbara, Margarete und Elisabeth, gestiftet vom Ritter Obitrcký von Obitrè, 1707, zum Beispiel) noch in die Einzelgestalten aufgelöst. Aber ein neuer persönlicherer Zug läßt sich doch feststellen. Die Standmotive werden beweglicher. Die Formen werden weich, bewahren doch das Konstruktive. Hat der Sohn Ferdinand das neue Leben gebracht? (Vom älteren Sohne Michael Johann Joseph kennen wir nichts.) Wo hat er gelernt? Von 1711 an arbeitet Ferdinand allein –; der Vater war gestorben. Große Aktion verbindet nun seine Figuren untereinander zur Gruppe (der Heilige Franz Xaver, gestiftet von der theologisch-philosophischen Fakultät 1711), das »Drama« wird im Motivischen und im Formalen aufgenommen (St. Ignatius von Loyola, gestiftet von den Neustädter Jesuiten 1711), das Monument wird fast überladen mit formalen, allegorischen und historischen Attributen (Johannes von Matha, Felix und Iwan, gestiftet von Franz Graf von Thun 1714).
Aber neben Ferdinand Brokoff arbeitet schon der große Matthias Braun. Er kam aus Innsbruck. Graf Sporck hatte ihn auf einer seiner Reisen angetroffen und auf seine Güter gebracht. Dort durfte er ihm Palast und Park mit ungezählten Figuren schmücken. Jetzt bekommt er auch in Prag Aufträge. Er kennt den italienischen Barock aus eigener Anschauung. Er bringt die Berninische Art in die böhmische Plastik. Die Körper sind nun ganz durchschmolzen von der Bewegung, der Rhythmus gießt sich durch die Gruppe wie Musik hindurch (auf der Brücke die Gruppen der heiligen Luitgart und des heiligen Ivo, erstere von den Plasser Zisterziensern 1710, letztere von der juridischen Fakultät 1711 gestiftet). In Braun gipfelt die Prager Barockskulptur. Ein Weiter konnte es auf diesem Wege nicht geben. Die hochgetriebene Bewegung greift die plastische Substanz schon an. Ein Zuviel an Form droht in Unform umzuschlagen (St.-Clemens-Kirche). Das persönliche Pathos droht in unpersönlicher Könnerschaft zu ersticken. Braun hält noch die Schwebe. Epigonen versinken. Vorher kleinere Meister: Johann Friedrich Kohl, von dem die Augustiner ihre Heiligen Augustinus und Nikolaus von Tolentin 1708 verewigen ließen. Und Matthias Wenzel Jäckel, von dem die Dominikaner, die Kreuzherren, die Osseger Zisterzienser und der Graf von Lissau (1708, 1709 und 1707) arbeiten lassen: sehr bewegte, in der Art des jüngeren Brokoff gehäufte Motive. Seine schönsten Figuren in der Kreuzherrnkirche. Und Johann Friedrich Mayer in schwerer, gebundenerer Art. Von bedeutenderen Prager Bildhauern kamen nur Ignaz Platzer und Anton Quittainer, die am Ende der Barockentwicklung stehen, auf der Brücke nicht zur Arbeit. Die reizvolle Ludmilastatue hat erst das ausgehende Jahrhundert aufgerichtet an Stelle einer durch einen Eisgang gestürzten Wenzelstatue des Jahres 1708. Da sprudelt noch das Leben des Barock. Ernüchterung brachte erst das 19. Jahrhundert, das in den Brüdern Joseph und Emanuel Max die Vertreter seines Eklektizismus (Neugotik!) unter diese Meister reihte: sie durften die Plätze zerstörter und beschädigter Standbilder neu besetzen, taten es blutleer genug, um als Folie die hohe Kunst des Barock desto überzeugender zu heben.
Und während an Plätzen und Straßen des alten Prag die Kirchen, die Paläste wuchsen, während die Stadt immer tiefer durchformt, immer reifer wurde in ihrem Ausdruck, Brücke und Häuser sich belebten mit großbewegter Plastik und die Gärten am Moldauhang zu großartiger Architektur gediehen, da klang es im Innern der Kirchen, der Paläste von hoher Kunstmusik und auf den Gassen sangen Leute aus dem Volk, sangen Studenten ihre Lieder. Hier in der Musik war die Tradition seit Rudolfs Tagen nicht abgebrochen. Noch bestanden die Literatenchöre, jetzt ausschließlich katholisch. Noch klangen die alten Volksweisen, in ihren Melodien überkonfessionell, in ihren Texten von den Jesuiten zu katholisch-kirchlichem Inhalt »adaptiert«. Ein Jesuit war es: M. W. Šteyer, der in seinem großen »Böhmischen Kanzional« (Prag 1683) Melodien der Hussiten und der Böhmischen Brüder gerettet und sie für unsere Tage erhalten hat. Und draußen auf dem Land hatte der Pfarrer Božan sein Leben damit verbracht, geistliche Volksgesänge zu sammeln. 1719 beförderte sie der Graf Sporck in Königgrätz zum Druck. Einfache Harmonisierungen ließen daraus mehrstimmige Gesänge entstehen. Man sang sie in den Kirchen, eine Geige, eine Klarinette, eine Posaune wirkten mit. Musik hatte in Prag, in Böhmen die breiteste Grundlage.
Die Jesuiten als die ersten hatten hier angeknüpft. Sie wollten das Berauschende der Musik ihrem Gottesdienst, ihren Repräsentationsspielen einbauen. Italienische Orchestralmessen erklangen in ihren Kirchen. Schon bei der Aufführung der Tragödie »Maria Stuart« im Clementinum im Jahre 1664 war gesungen, der Gesang mit allerlei Instrumenten begleitet worden. Seit dem 18. Jahrhundert wurden alljährlich Oratorien italienischer Komponisten in den Jesuitengymnasien, später auch in den Piaristengymnasien aufgeführt. Mit einer Aufführung von Cesarinis »Tobias« (1714) hatte es begonnen. Lotti, Caldara, Roberti, Jomelli, Salvator Pinto folgten. Die Oper wirkt schon ein, »geistliche Melodramen« entstehen, in denen sich Einheimische versuchen: Zelenka, Josef Anton Sehling. Das alles war noch italienische Art. Schließlich tauchen auch deutsche Oratorien in der Prager Produktion auf. In der Lorettokapelle sitzt ein wunderlicher Regens chori: Robert M. Täuber. Er dichtet und komponiert Oratorien, deren Titel wie Ahnen Jean Paul'scher Skurrilität anmuten: »Der im bitteren cypristraubenreichen Weingebirge Engaddi verlassene Bräutigam«. Das war etwa gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts. Damals waren die deutschen Komponisten schon eingedrungen: die Bräunich und Neustadt und Wachsmuth, auch Stephan Hasse. Aber im Durchschnitt dieser kirchenmusikalischen Produktion herrscht doch noch der italienische Barockstil.
Freiere Strömungen in der geistlichen Musik schließen sich an Bohuslaw Èernohorskýs, des Organisten bei St. Jakob, Wirksamkeit an (1684-1740). Er hatte in Italien, wo er Tartinis Lehrer gewesen war, den sinnlichen Schmelz der italienischen Musik aufgenommen, hatte ihn dann mit der kontrapunktischen Kunst der Mitteldeutschen verbunden, er war groß in der Fuge. Als junge Studenten lernen Gluck und Tuma bei ihm. Gluck zog damals mit den Studentenbanden auf dem Land umher, vor den Türen der Schlösser und in den Dörfern aufzuspielen. Die Kinsky nahmen sich dann seiner mäzenatisch an. Ein großer Lehrer war auch der Organist Josef Seeger. Unter seinen Schülern setzt sich die Spaltung zwischen opernhafter und volkshafter Kirchenmusik durch. Franz Xaver Brixi nennt des Johann A. Koželuh Messen »Opernmusik«, und der schimpft Brixis Messen geradeheraus »Wirtshausmusik«. Der Zerfall der Kirchenmusik hebt an, sie wurde nicht mehr von starken inneren Strömungen gehalten.

Pulverturm mit Graben 1792.
Kolorierter Stich von Karl Pluth nach Ph. und F. Heger 1792 (Prag, Städt. Museum). Der Pulverturm (in der Gestalt vor der Restaurierung durch J. Mocker) in die Bildsicht gerückt (abweichend von der eigentlichen Stellung, die mit dem Grabenzug fluchtet). Gegenüber das Hiberner-Kloster mit der Barockfassade, die 1810 durch die heutige (nach dem Vorbild der Gentzschen »Neuen Münze« in Berlin durch Georg Fischer aus Wien) ersetzt wurde. Am Eck von Hibernergasse und Graben das ursprüngliche Gasthaus »Zum blauen Stern«. Der Graben mit der 1781 angelegten »Allee«.
Die weltliche Musik triumphiert. Der Adel pflegt sie. Diese verschwenderischen Herren, die sich da ihre Paläste bauten, waren leidenschaftliche Liebhaber einer intimen Musikliteratur, pflegten sie mit wirklicher Hingabe. Schließlich gehörte ja auch das mit zur Repräsentation. Man hielt sich sein Hausorchester. Wer die Livree eines solchen Herrn anziehen wollte, ob als Jagdgehilfe oder als Torhüter, der mußte sich zuerst auf irgendeinem Instrument als guter Musikant ausweisen. Die Buquoy und Kinsky und Lobkowitz und der Graf Sporck und alle die andern, sie hatten ihre wohlausgebildeten Kapellen, mit denen sie die modernste Musik eifrig pflegten. Ein tüchtiger Musikus ward Dirigent. Innerhalb dieser Tradition war ja dann auch noch Josef Haydn Dirigent der Morczinschen Hauskapelle auf Lukawetz (1759).
Das holte die Volksmusik, von der wir oben sprachen, herauf in die Kunstmusik und wirkte umgekehrt wieder hinunter ins Volk. Ja, die Musik war damals die einzige unter den Künsten, unter den geistigen Mächten überhaupt, die zwischen hoch und niedrig lebendige Verbindungen schuf. Die Dorfschulmeister draußen pflegten die Musikantenausbildung. Die böhmischen Musikanten zogen als Fiedler und Bläser und auch als große Virtuosen hinaus in alle Welt, kehrten bereichert und bereichernd nach Prag zurück. Auch unter dem Adel gab es ausübende Musiker in Menge. Da war der berühmte Graf Logi (Johann Anton Losy von Losimthal). Der hatte auf ausgedehnten Kunstreisen ganz Europa kennengelernt. Jetzt pflegte er in Prag die hohe Lautenkunst, wie er sie wohl in Paris, wo sie damals in höchster Blüte stand, angetroffen hatte. Wirkliche Lautenkultur erwuchs in Prag. Auch die Fürsten von Lobkowitz pflegten sie und viele andere. Von Wien her drang südliche Anregung ein, nördliche kam von Breslau, der berühmten Pflegestätte der Lautenkunst. Und mit der Laute kam die Gitarre in Mode, mit beiden wieder die Violine, die mancher unter dem Adel virtuos beherrschte. Die gesamte Kultur wurde mehr und mehr aufs Intime abgestimmt unter dieser Musikpflege: im zart eingerichteten Salon lauschte man den zarten Klängen des Orchesters, der Sänger, konversierte deutsch und französisch, sprach über Kunst. Am nächsten Tag aber locken wieder die Waldhörner hinaus zur Jagd. Graf Sporck hatte sie in Paris kennengelernt, hatte sie in Böhmen eingeführt, indem er zwei seiner Leute nach Paris sandte, die unbekannten, bald so beliebten Instrumente spielen zu lernen.
Auch im Bürgertum regt sich nun eifrige Musikpflege. 1713 machen drei Bürger: Kalliwoda, Prößl und Kreuzberger eine Eingabe an die Statthalterei: die Errichtung einer »Musikalischen Akademie« nach dem Vorbild von Breslau zur periodischen Aufführung von Instrumental- und Vokalwerken möge bewilligt werden. Freiherr von Hartig übernimmt das Protektorat –; ohne Adel ging es ja nicht. Und viele Adelige traten bei. Alle Donnerstage kommt man im »Haus zur eisernen Tür« in der Altstadt zusammen, dessen Saal »hierzu sehr bequemlich gefunden« worden war. Zuerst eine Ouvertüre, dann Konzerte, dazwischen Gesang, zum Schluß eine »starke Symphonie«, wie Stölzel 1715 berichtet. Über das Musikalische hinaus ist hier das soziale Moment interessant, daß zum erstenmal die Bürgerlichen in die adelige Gesellschaft eindringen, ja, daß bürgerliche Anregung das Werk begründet.
Aber vor der völligen Intimität rettet diese Musikkultur doch wieder die Lust am Repräsentativen. Diese freudige und innerlich so bewegte Musikpflege greift nun hinüber nach einem festen Stützpunkt: zwischen Musik und Architektur blüht das Theater auf. Auch hier bringt dieses Jahrhundert die Verweltlichung. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts war das Theater fast ganz in den Händen der Jesuiten geblieben. Wohl hatten die Carolinum-Studenten einige Male versucht, den Wettkampf aufzunehmen. Das war aber immer mißglückt. Schon im Jahre 1534 hatten sie den Versuch gemacht, im Rezekschen Kollegium ein Drama »Susanna« aufzuführen –; da war der Boden des Saals, in dem gespielt werden sollte, unter dem Andrang der Zuschauer durchgebrochen. Und als fünf Jahre später die Aufführung endlich zustande kam, war sie kein Erfolg. Im Jahre 1604 waren die Carolinum-Studenten dann noch einmal hervorgetreten, diesmal mit einem tschechisch-nationalen Stoff: »Entführung der Prinzessin Judith durch Bøetislav, den böhmischen Achilles«. Zdenko Popel von Lobkowitz, der damalige oberste Burggraf, hatte die Aufführung verboten. Das Stück sei Beleidigung der früheren Majestät.
Die Jesuiten hatten mit solchen nationalen Stoffen mehr Glück. Schon 1567 hatten sie das »Böhmische Trauerspiel von St. Wenzeslaus, dem Märtyrer« agiert. Nikolaus Salius hatte es in tschechischen Versen verfaßt. Andere nationale Stoffe folgten hin und wieder. Die evangelischen Volks- und Schulschauspiele, die das Volk vom Clementinum abziehen sollten, waren dagegen nicht aufgekommen. Im Jahre 1610 wirkt Hans Sachs nach Prag herein: im Verlag Nigrin erscheint »Eine böhmische Komödie von der edlen und tugendhaften Witwe Judith und von Holofernes, Hauptmann des Königs Nobuchodnesar, aus dem Deutschen übersetzt von Nikolaus Vransa, Baccalar«. Das war nun schon rein weltliches Theater, aber einstweilen noch auf dem Papier. Auch vom englischen Drama hatte man damals schon Kunde. Echo gaben jetzt die Jesuiten, indem sie englische Stoffe, in denen der Katholizismus verherrlicht werden konnte, dramatisierten, so im Jahre 1644 die oben schon erwähnte »Maria Stuart«, die noch höchst allegorisch aufgefaßt ist.
Von zwei Seiten her setzte die Verweltlichung des Theaters ein, einmal von der Musik her: die »Pastoralkomödien«, bei denen viel gesungen, viel instrumentale Begleitung beigefügt wurde, trieben der Oper zu. Auf der andern Seite wirkten schon die Komödiantentruppen: auf dem Markt, dann auch in Häusern eingenistet, lassen sich ausländische Banden sehen. Die englischen sind auch hier die ersten. Ihr Erscheinen im Jahre 1649 wurde von Ferdinand III. mit Auftrittsverbot beantwortet. Dann kommen Sachsen herüber (1671). Johannes Schilling, der »Springer«, produziert sich am Ring. Seiltänzerei und Komödie waren noch dasselbe. Jetzt ist der Erzbischof gegen die »moralgefährdenden« Darbietungen. Unterdessen führen die reformierten Franziskaner, die aus Italien gekommen waren und das Kloster Maria-Schnee zugewiesen erhalten hatten, die reformati, italienische Stücke auf. Und seit 1680 kommt der »Prinzipal« Kühlmann fast jedes Jahr mit seiner Truppe nach Prag. Der englische Clown, der deutsche Pickelhering, der italienische Arlecchino beherrschen die Szene. Gespielt wird entweder im »Schwarzen Löwen« auf der Kleinseite oder in der Altstadt im »Alten Gericht« oder im Haus »Bei den Kronen« in der Rittergasse. Auch das »Manhartsche Haus« in der Zeltnergasse war bei den Banden als Spielhaus beliebt. Der Prinzipal Leinhas hat jetzt viel Zulauf. Diese »Prinzipale«, wie die Bandenführer heißen, konkurrieren untereinander. Das Haus »Zum alten Gericht« und das »Bei den Kronen« werden Konkurrenzunternehmungen. Das erste gehört der Altstadt, das zweite ist in Privatbesitz. Die Stadt spürt Unternehmergelüste und verbietet die Aufführung im Kronenhaus.
1703 erscheint dann Johann Friedrich Sartorio in Prag: die weltliche Oper zieht ein. Die Musikkapellen des Adels, die Kinskysche und die Eggenbergische als die berühmtesten, hatten vorgearbeitet. Manche unter dem Adel standen in unmittelbarer Verbindung mit italienischen Direktoren und Komponisten. Mit der Aufführung der Sartorioschen Oper »La Reta di Vulcano« (dem Pfalzgrafen bei Rhein gewidmet) hatte die Kunstform der Zeit, die Oper rein weltlichen Charakters, zum erstenmal in Prag Fuß gefaßt. Der Beifall war groß.
Aber Sartorio konnte sich neben den deutschen Komödianten, die in ihrem Hanswurst einen wirksamen Volksköder hatten, doch nicht behaupten, trotz seiner Versuche mit nationalen Dramen, wie der Libuša-Oper von Bernardi. Das zeigt sein baldiger Auszug aus Prag (nach zwei Jahren). Aber die Oper blühte weiter: aus Dresden kam der kurfürstlich-sächsische und königlich-polnische Kapellmeister Antonio Lotti, der berühmte Komponist, mit seiner Truppe oft herüber, entzückte das adelige Publikum mit den Leistungen seiner Sterne, für die der Dresdner Hof schwindelnde Summen ausgab. Er führt seine eigenen Opern und Oratorien auf.
So wurde Prag doch entschädigt für das Fehlen einer Residenz, die in die Pflege einer ständigen Oper ihren Stolz gesetzt hätte. Ja, als im Jahre 1723 Karl VI. seine Krönung in Prag rüstet, da hatten die Prager die Genugtuung, das größte Musikereignis Europas in ihren Mauern zu wissen. Wir haben schon oben angedeutet, was dieses prunkvolle Krönungsfest im Gesamtgefüge damaliger Kultur bedeutete: es sollte, in Kunst verbrämt, die Welt entzücken.
Die Festoper war der Mittelpunkt aller Feierlichkeiten. Ferdinand Galli-Bibiena, der »erste Baumeister und Perspektivmaler des Kaisers«, hatte im Burggarten nach den Plänen seines Sohnes Josef eine prächtige Szene erbaut. Palladios Perspektivenbau, nun ganz aufgelöst in rauschende, züngelnde, trubelnde Formen des hohen Barock. Alles, was die Entwicklung der Architektur an überraschender Scheinwirkung herausgearbeitet hatte, jetzt wurde es in seltsamer Wendung, durch die Unterlegung einer entsprechenden Bestimmung, phantastische Wirklichkeit. Der Aspekt, von Türmen, verkröpften Säulenstellungen, Portiken und Attiken getrieben, rollte in die Tiefe ab, ein Musikerpodium schob sich schwungvoll vor. Schon der Bau war dramatisches Theater, noch ehe die Szene bevölkert war von den Spielern. Johann Josef Fux, der berühmte Wiener, hatte die Krönungsoper komponiert. Der Stoff war auf den Wahlspruch des Kaisers: »Costanza e fortezza« hin geschrieben worden. Die Musik bewegte sich in oratorienhaftem, fast kirchenmäßigem Stil, ein starker Kontrast also zu dem bewegten Bau. Und die Inszenierung schob von der andern Seite her den Kontrast herein: in feenhafter Beleuchtung, berückender Regie, großartigen Maschinerien, in den wirbelnden Tänzen, den prächtigen Kostümen, dem berückenden Gesang.
Fux, der Komponist, litt damals so stark an Podagra, daß er in einer Sänfte ins Theater getragen werden mußte und die Aufführung nicht selbst leiten konnte. Caldara sprang für ihn ein. An die hundert der bedeutendsten Sänger und Sängerinnen, meist italienische, an die zweihundert der berühmtesten Instrumentisten aus ganz Europa waren verpflichtet worden. Im amphitheatralischen Zuschauerraum, der 4000 Personen faßte, drängte sich der Adel, die Musikwelt Europas. Die Reichsfürsten, die höchsten Würdenträger waren alle gekommen und aus der Musikwelt die berühmtesten Namen. Tartini aus Italien und sein Freund, der Cellist Veracini, aus Berlin der Hofkammermusiker Quantz und Graun und Sylvius Leopold Weiß. England, Frankreich waren vertreten und natürlich ganz besonders Wien. Die Majestäten, umgeben von der hohen Welt, lauschten von acht Uhr abends bis ein Uhr in der Nacht dem herrlichen Spiel. Die Welt schaute wieder einmal nach Prag.
Die Festtage verrauschten. Doch die Sehnsucht nach solchen Genüssen blieb zurück. Die Hausmusik genügte nicht mehr. Man wollte das öffentliche Theater. Die Gastspiele der Truppen waren zu sehr dem Zufall überlassen. Graf Sporck, der impulsive, großzügige Mäzen, unternahm es, in seinem Haus in der Pflastergasse (der heutigen Hibernergasse) ein regelrechtes Operntheater einzurichten. Er hatte den italienischen Direktor Antonio Denzio mit seiner Truppe kommen lassen. Die Prager Gesellschaft lauschte entzückt dem »Orlando furioso«. Ja, Sporck ließ dann sogar für sein Theater ein eigenes Gebäude (Deutschherrenstraße) errichten. Aber mancherlei Anfeindungen, unter denen auch der Vorwurf der Feuergefährlichkeit dieses Theaters eine vorgeschobene Rolle spielte, ließen ihn später seinen Theaterträumen entsagen. Er übergab das Gebäude dem Denzio in eigene Regie. Der spielte mit wechselndem Erfolg, spekulierte glücklich auf nationale Gefühle in seiner »Libusa«-Oper, kam trotzdem aus seinen finanziellen Nöten nicht heraus. Im Jahre 1734 zog er ab, im gleichen Jahre, als die Altstadt nahe dem Gallikloster, am sogenannten Kotzenmarkt, ein eigenes Theatergebäude aufführte. Damit war das Ende des ausschließlich adeligen Theaters gekommen, das Bürgertum meldete seine Ansprüche auf Kulturpflege an.
Dies war das stolze Jahrhundert des Barocks, das Jahrhundert des Adels. Während vor den Toren Wiens die Türken drohten (1683), raste in Prag das Leben auf seinen Gipfel. Nicht ohne dunkle Schatten: zweimal hatte die Pest mit grausamer Faust hereingegriffen (1680 und 1715), hatte die Reichen vertrieben, in den Quartieren der Armen furchtbar gewütet. In Nachbardörfern waren damals »Kontumazhäuser« für die Kranken, in der Stadt selbst »Probierhäuser« für die der Ansteckung Verdächtigen eingerichtet worden. Zum Andenken an das Ende der ersten Seuche war auf dem Wälschen Platz vor dem Profeßhaus der Jesuiten eine Dreifaltigkeitssäule aufgestellt worden. Die Pläne hatte der Italiener Giovanni Battista Aliprandi geliefert. Die Ausführung der Bildwerke war deutschen Künstlern, Ferdinand Hinzer und Johann Ulrich Mayer, übertragen worden. Kurz darauf (1689) hatte dann ein schrecklicher Brand große Teile der Altstadt vernichtet. Frankreich, das damals mit Österreich im Krieg lag, hatte Brandstifter in die Städte der Monarchie gesandt, um den Feind im Innern zu packen. In Braunau, Trautenau, Klattau hatten die Mordbrenner schon gehaust. Jetzt trieben sie ihr Handwerk in Prag. Von der Judenstadt bis zur Deutschherrenstraße fraßen die Flammen. Viele Kirchen und Klöster, darunter St. Jakob, St. Agnes, St. Castulus, brannten aus. Aber die Freude am Bauen duldete nicht lange Ruinen. Das Leben warf sich nur um so heftiger in die geschlagenen Breschen.
Wir fassen diese Zeit und ihre innersten Probleme am bündigsten zusammen, wenn wir die Persönlichkeit eines ihrer charakteristischesten Vertreter hier kurz umreißen: die des Grafen Franz Anton von Sporck, dem wir auf diesen Seiten so manches Mal schon begegnet sind. Sein Lebensbild läßt die Umrisse der Zeit schärfer heraustreten, gerade indem es in so vielem sich gegen sie stellt. Vor allem: es treibt den innersten Impuls dieser Zeit kraß heraus, die gefährliche Lust am Gegensatz.
Kriegsadel Habsburgs: der Vater Johann war kaiserlicher Reitergeneral gewesen, einfachster Abkunft, aus Westfalen stammend. In den Türkenkriegen vor allem hatte der Draufgänger Ruhm geerntet, als Beute weite Besitzungen in Böhmen und großen Reichtum. Im Sohn Franz Anton treibt das Reiterblut weiter, versucht, sich ins Geistige zu sublimieren. Unbeherrschte Rauflust und vornehmste Geisteskultur stehen sich in diesem Charakter gegenüber. Als Jüngling hatte er auf der Kavalierreise Paris kennengelernt, war dem heiligen Zauber von Port-Royal verfallen. Was wirkliche katholische Reform sein kann: im Jansenismus hatte er es kennengelernt. Er will diesen Geist in die neue Heimat verpflanzen. Führt Bücher ein, läßt sie von seinen Töchtern übersetzen. Errichtet in Kukus, seinem Besitz in Nordböhmen, eine Druckerei, versendet seine Bücher in alle Welt. Er pflegt edelste Kultur. Aber in lauter persönlichen Händeln bricht das alte Reiterblut immer wieder durch: dies ganze Leben ist von Prozessen erfüllt, gegen die Nachbarn, gegen das Ärar, gegen Schuldner, gegen ungerechte Forderungen. Sporck gibt nie nach. Wettert, verfaßt umfangreiche Verteidigungsschriften, predigt sein Recht. Läßt sich lieber in den Schuldturm sperren, als daß er nachgeben würde. In der Daliborka empfängt er die Besuche des adeligen Prag –; sein Gegner, der berüchtigte Advokat Neumann, fängt den polternden Grafen in den Schlingen spitzfindiger Rechtsklügeleien. Man lacht ein wenig, hat doch Achtung vor dem Herrn auf Lissa, der die größten Jagden abhält, der den »Hubertus-Orden« stiftet, in den er sogar gekrönte Häupter, den sächsischen Kurfürsten und polnischen König, später gar Kaiser Karl VI. aufnehmen konnte. Sporck liebt den Kult, aber er gibt ihm das aufklärerische Gewand. Wütet gegen die Jesuiten. Geißelt das Treiben seiner Zeit: den prunksüchtigen Adel, die geldgierigen Orden. Läßt von seinem Bildhauer Matthias Braun, den er aus Tirol berufen hatte, seine Güter mit Standbildern voll Anspielungen schmücken. Gibt in der »Herkommanus«-Statue die satirische Allegorie auf das verhaßte Herkommen, dem alle Menschen verfallen seien. Wird infolge seiner Drucke freisinniger Bücher, infolge seiner Reibereien mit den Jesuiten in einen langwierigen Ketzerprozeß verwickelt, beruft sich auf seine Stiftungen an die Klöster, auf die Errichtung eines Cölestinerinnenkonvents auf seinem Gut, in das seine Tochter als Äbtissin eintritt. Später verlegt er es nach Prag, kauft Grund und Boden neben dem alten »angelischen Garten« in der Heinrichsgasse, läßt von Kilian Ignaz Dientzenhofer bauen. (Heute ist es verschwunden, wie auch das Nachbarhaus, an dessen Stelle das Gebäude der Hauptpost trat.)
Sporck ist fromm, ist Freigeist in einem. Er liebt die Kunst, pflegt sie. Er läßt sich von Brandl porträtieren, von Hancke in Breslau besingen. Beschäftigt gute Stecher für seine Drucke: Renz aus Nürnberg und andere, pflegt ausgezeichnete Typographie. Ein modern gerichteter Gutsherr, richtet er sein Kukus zum europäischen Badeort ein, sorgt für Unterhaltung der Gäste durch Kurkapelle und Theater. In seinem Theater in Prag, dem er Riesensummen opfert, empfängt er als Hausherr den Adel Böhmens, die höchsten Würdenträger –; er, den doch immer der Stachel der niederen Herkunft heimlich quält. Er empfindet sozial: beschenkt seine Leibeigenen, erleichtert ihre Robot. Wettert gegen die schamlose Ausbeutung der Armen durch seine Standesgenossen. Auf einem großen Prager Ball findet ihn seine Tochter einmal um halb vier Uhr morgens in ein tiefes Gespräch über die Mißstände in Böhmen versunken.
Aber er ist kein Heiliger: er spielt und trinkt und jagt; pocht auf seine Herrenrechte. Gibt die alten deutschen Rechtsgebräuche in Druck. Sinkt doch vor der gekrönten Majestät ins Knie, ist glücklich über ihre Huldbeweise. Die Gegensätze seiner Zeit schütteln auch ihn, ja schütteln diesen kernigen Charakter heftiger als alle andern. Aber er ist ein Kerl. Wo er auftritt, wirft er sein ganzes Leben in die Schranken. In seiner Bibliothek vergräbt er sich wieder in die Tiefen jansenistischer Gedanken, sucht Freunde für diese Welt zu gewinnen. Was er anpackt, was er treibt, ist mit persönlicher Note gefärbt –; wie unpersönlich kühl muten dagegen die Bibliotheken der Kinsky, der Nostitz an. Sein Blut muß immer wieder anrennen gegen die Welt und muß sich doch vor lauter Widerständen ducken. Die Nachwelt hat ihm den Beinamen »der edle Graf« geschenkt, wohl als Abbitte dafür, daß ihn die Mitwelt zermürbt hat. Diese Prachtnatur stemmt sich gegen Verbitterung an. Aber ihr Schicksal war doch Niederlage. Niederlage gegen die Zeit und auch Niederlage der Zeit selbst. Mit seinem Tod stürzt auch die Adelswelt in Prag zusammen. Eine neue Epoche, der er nur halb angehören durfte und die er auch nur mit halbem Herzen ersehnen konnte, zieht herauf: die Aufklärung, die im Bürgertum ihre Stütze findet.
Prag war österreichisch geworden. Aber nicht durch eigene Entscheidung –; die Macht von oben hatte es gezwungen. Diese Macht ging weniger von persönlicher Kraft der Herrscher aus, die damals Habsburg repräsentierten, als vielmehr von der allgemein europäischen Geisteslage: die drängte zum Despotismus, der in dem großen Ludwig von Frankreich seinen stärksten Ausdruck gefunden hatte. Habsburgs Autokraten wurden getragen vom System.
Da war Leopold I., der fast ein halbes Jahrhundert regierte (1657-1705): Jesuitenzögling, klerusfreundlich, gutmütig, im Innersten träge, nach außen aber fest und willenseifrig, auf Studien bedacht und den Künsten verpflichtet. Prag hat ihm manches zu danken. Die Habsburgerlippe im melancholischen Gesicht, zum einfachen schwarzen Anzug die roten Strümpfe, die rote Feder am Barett –; so waltete er bei den Festen und zeremoniellen Akten, trug die Bürde des von Türken und Franzosen bedrängten Habsburgerreichs. Ganz anders Josef I., sein Sohn (1705-1711): energisch und klug, ein reger Geist, freimütig und voll großer Ziele, dabei prunkliebend, durch und durch Aristokrat. Man hatte große Hoffnungen auf ihn gesetzt für Österreichs Aufschwung. Er durfte nur beginnen –; in Prag hatte er die Reform der Universität angeregt –;, da starb er. Sein Bruder Karl VI. (1711-1740) hatte das Werk des Jahrhunderts vollendet: in der Pragmatischen Sanktion war die Nachfolge auch für die weibliche Linie gesichert. Die Erbländer hatten sie angenommen, die meisten europäischen Staaten hatten sie verbürgt. Doch als Karl starb, als seine Tochter Maria Theresia die Herrschaft antrat, erhoben sich Feinde von allen Seiten, bedrohten Habsburg. Krieg über Böhmen. Prag seine Mitte. Dreimal wird es belagert. Dreimal wird es zur Entscheidung aufgerufen. Von Mal zu Mal antwortet es eindeutiger. Die letzte Belagerung bringt auch die klare Entscheidung: für Osterreich.
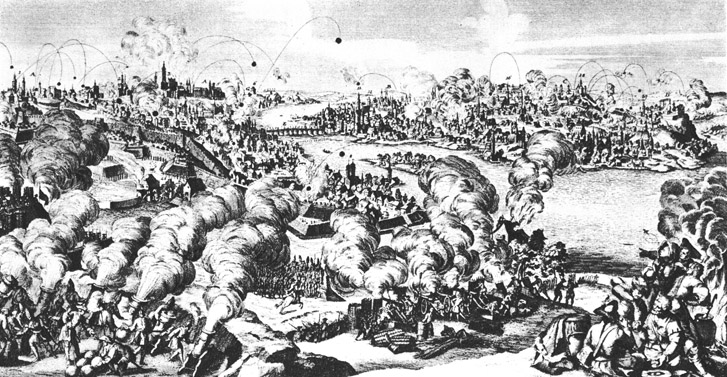
Bombardement von Prag durch Friedrich den Großen 1757.
Anonymer Kupferstich
Im Jahre 1741 bricht Europa gegen Maria Theresia los. Gegen sie stand Preußen: Friedrich II. wollte Schlesien. Gegen sie stand Sachsen: Friedrich August II. wollte Mähren. Gegen sie stand Bayern: Karl Albrecht wollte Böhmen, Oberösterreich, Tirol und den Breisgau. Gegen sie stand Sardinien: es wollte Mailand. Gegen sie stand Spanien: es wollte das übrige Italien. Und Frankreich nutzte die Stunde gegen den Erbfeind.
Friedrich II. hatte schnellen Griffs Schlesien genommen (1741). Sachsen, Bayern, Frankreich verbanden sich zu gemeinsamem Vorgehen. Franzosen und Bayern marschierten über Budweis und Pilsen bis Königsaal unweit Prag, die Sachsen über Leitmeritz bis Schloß Troja. 54.000 Mann liegen vor Prag. In der Stadt nur 3000 Österreicher und einige Tausend Miliz. Graf Moriz von Sachsen führt die Belagerer. Am 15. November 1741 fordert er den Kommandanten Prags, den General Ogilvy, zur Übergabe auf. Der lehnt ab. In der Nacht vom 25. auf den 26. wird gestürmt: ein Scheinsturm beim Strahower Tor lockt die Hauptkräfte der Verteidiger an. Währenddessen nehmen Sachsen das Sandtor, das wie die benachbarte Mariahilf-Schanze von der Prager Studentenlegion tapfer verteidigt worden war, Bayern und Franzosen das Neutor. Prag ist in den Händen der Feinde. Die Besatzung muß sich ergeben. Die Franzosen besetzen Alt- und Neustadt, die Sachsen Kleinseite und Burg. Die Bayern beziehen draußen ihre Lager. Der Großherzog von Toskana war mit einer Entsatzarmee von 60.000 Mann auf dem Anmarsch gewesen, war aber nur bis Beneschau gekommen, als Prag fiel. Jetzt zog er sich zurück gegen Süden, um Österreich zu schützen.
Noch am Tag der Einnahme zieht Karl Albrecht von Bayern in der eroberten Stadt ein. Am 6. Dezember läßt er in den drei Städten durch Herolde seine Proklamation zum König von Böhmen ausrufen. Am 19. Dezember findet die feierliche Krönung im Veitsdom statt: der Prager Erzbischof Graf von Manderscheid setzt ihm die Krone Böhmens auf. Im Wladislawschen Saal huldigen die Großen, die Abgesandten der Bürgerschaft, der Universität. Der Marschall Belleisle vertritt Frankreich. Der neue König reist ab nach Frankfurt, um sich zum deutschen Kaiser wählen zu lassen. Sachsen und Bayern ziehen ab. Die Franzosen unter Belleisle halten Prag.
Man war noch nicht eindeutig österreichisch gesinnt in Prag. Die Huldigung vor Karl Albrecht hatte es erwiesen. Viele vom Adel standen zu Bayern, vor allem jene, deren Güter in den Händen der Feinde waren. Aber auch freie Wahl trieb zum Feinde Österreichs. Damals »traten einige hier anwesende Brüder (Freimaurer) öfters zu den geheiligten Arbeiten zusammen, ohne unter einem besonderen Logennamen verbunden zu sein. Diese Zusammentretung aber hat den Grundstein zur Konstituierung dieser ältesten Loge Böhmens und fast aller österreichischen Staaten gebildet. In weiterer Zeitfolge ward die Loge unter dem Namen ›Zu drei Kronen‹ nach englischem System förmlich bestellet, nahm in weiterer Folge der Zeit den Namen ›Zu drei Sternen‹ an, den sie sodann im Jahre 1763 in jenen, den sie jetzt (1791) führt, verwandelte (›Vollkommene und gerechte Loge zu den drei gekrönten Sternen und Redlichkeit im Orient von Prag‹) und sich zu dem Bunde der vereinigten Logen Deutschlands gesellte.« So lesen wir in einer Zuschrift der Prager Loge an die Regensburger vom Jahre 1791.
Unter diesen Prager Freimaurern also wird gekämpft: der Großmeister Graf von Paradis ist für Karl Albrecht. Vor allem Karl Dawid, ein Kleinseitner Metzgerssohn, der es über Sekretärstellen beim Adel zu Ansehen und Einfluß gebracht hatte, agitierte für Bayern. Es kam zur Spaltung: die österreichisch Gesinnten gründeten eigene Logen. Darf man solche Zerwürfnisse in der Freimaurerloge als Ausdruck der allgemeinen Stimmung in Prag deuten?
Unterdessen richteten sich die Franzosen für lange Besatzung ein. Die Städte müssen große Summen an monatlichen Kontributionen aufbringen: 150.000 bis 200.000 Gulden. Das Altstädter Rathaus wird teils Militärspital –; im Land wird ja gekämpft! –;, teils Kaserne. Die drei Getreidemagazine, die man kurz vor dem Kriege angelegt hatte, werden beschlagnahmt. Systematisch werden die Festungswerke ausgebaut, vor allem auf dem Wyschehrad. Dort ersteht jetzt das große Tor mit den Emblemen der Franzosen an der Front. In den Moldaufelsen gegenüber –; Straße nach Kuchelbad und Königsaal –; wird ein Fahrweg eingesprengt. Man »baut vor«. Hält im übrigen gute Disziplin.
Aber Österreichs Heere rücken an. Der Breslauer Frieden mit Friedrich hatte im Norden freie Hand gegeben. Jetzt zieht Karl von Lothringen mit großer Entsatzarmee gegen Prag (Juni 1742). Man verhandelt mit Belleisle, der in Prag kommandiert. Vergeblich. Die Belagerung beginnt. Vorm Strahower Tor fahren die Österreicher ihre Batterien auf: 100 Kanonen, 36 Bombenwerfer. Die Franzosen brechen ihr Lager bei Bubna ab, legen alle Villen dort nieder, auch das schöne Gartenhaus, das der Graf Czernin sich hatte erbauen lassen (von dessen Namen Belvedere das ganze Plateau seine Benennung bis heute trägt). Richten ihre Batterien auf der Brandstätte (Pohoøelec) ein: im Palais des Grafen Schlick (heute verschwunden) und im großen Palais Czernin. Gegenseitiges Bombardement beginnt. Jetzt wird von der Bevölkerung Auslieferung aller Waffen aus Sicherheitsgründen für die Besatzung, Auslieferung aller Pretiosen als Kaution verlangt. Jede Zusammenkunft wird verboten. Niemand darf sich des Nachts am Fenster zeigen.
Wilde Ausfälle, große Verluste. Die Belagerung dauert. Grausamer als die Geschosse der Belagerer wütet bald die Hungersnot in der umzingelten Stadt. Mangel an Fourage für die Tiere stellt sich zuerst ein. Alle Privaten müssen ihre Pferde abliefern: am Neutor und am Spitteltor werden sie aus der Stadt gejagt. Die Teuerung steigt. Im September kostet ein Pfund Rindfleisch schon 2 bis 3 Gulden, ein Pfund Butter 2 Gulden 30. Die Not steigt. Jetzt müssen Franzosenpferde geschlachtet werden. Auf dem Tummelplatz (heute Rudolfinum) ist die große Pferdeschlächterei. Von Juli bis September werden dort an die 8000 Pferde niedergemacht, das Fleisch an die Bewohner verkauft, an die Soldaten ausgegeben. Der Marschall Belleisle selbst hat nur Pferdefleisch auf der kärglich bestellten Tafel. Nun soll auch alles Silber der Münze eingeliefert werden. Bis Oktober waren schon 7 Millionen Gulden an Kontributionen entrichtet worden. Und alle nähere Umgebung Prags war ausgeplündert.
Am 14. September heben die Österreicher die Belagerung plötzlich auf. Ein französisches Entsatzheer ist im Anzug. Aber am 2. November kehren sie schon zurück. Wieder droht Einschließung. Belleisles Lage ist unhaltbar: die Truppen dezimiert, entkräftet, an allem unterlegen. Aus Paris trifft Befehl zum Abzug ein. Heimlich rüstet Belleisle, in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember zieht er mit 15.000 Mann aus. Nimmt vierzig Geiseln aus Adel, Klerus und Bürgerschaft mit zur Sicherung der zurückgelassenen kleinen Besatzung und der Kranken. Zieht auf abgelegenen Wegen, um den Österreichern zu entgehen, durch Wälder und über Äcker, in Sturm und Schnee gegen Westen. Verliert auf dem Marsch an die 1200 Mann, stößt endlich in Eger zur eigenen Truppe. Den Österreichern war er entschlüpft.
Die lassen den Kommandanten der zurückgelassenen Franzosen, Mr. Chevert, der sich nicht ergeben will, mit all seinen Truppen freien Geleites abziehen. Am 2. Jänner 1743 besetzen sie Prag.
Die bayrisch Gesinnten fliehen. Johann Ernst Graf Schaffgotsch wird mit der Leitung der Landesangelegenheiten betraut. Die Magistrate der Städte werden zunächst suspendiert. Kommissionen werden eingesetzt zur Untersuchung aller Konspirationen gegen Habsburg, aller Huldigungen für Karl Albrecht. Die Schuldigen werden verhaftet. Will Maria Theresia sich rächen?
Im April 1743 kommt sie selbst, läßt sich im Veitsdom zur Königin von Böhmen krönen (12. Mai 1743). Erzbischof Graf von Manderscheid wird nicht vorgelassen, wird auf seine Güter verbannt. Der Olmützer Bischof vollzieht die Krönung. Die Stände schwören den Eid. Und Maria Theresia übt Milde. Alle vom Adel, die dem Bayernfürsten gehuldigt hatten, werden entweder begnadigt oder zu geringen Geldstrafen verurteilt. Sieben Bürgerliche werden des Landes verwiesen. Nur einer: Karl Dawid, der Hauptagitator, wird zum Abhacken der Hand und zum Tod durchs Beil verurteilt. Doch am Schafott wird auch er begnadigt: zu lebenslänglichem Kerker auf dem Spielberg. Graf Paradis war entflohen, auch die andern stark Kompromittierten aus dem Adel.
Maria Theresia konnte sich Milde leisten: ihre Heere siegen. Erobern Bayern. Kämpfen innerhalb der Grenzen Frankreichs. Der zum Kaiser gekrönte Karl Albrecht machtlos und hilflos in Frankfurt. Die Österreicher in seiner Residenz. Österreichs Macht wächst.
Friedrich von Preußen will den Gefahren, die aus solcher Machterweiterung des Hauses Habsburg drohen, zuvorkommen. Bricht Mitte August des Jahres 1744 mit 80.000 Mann in Böhmen ein. Er marschiert in drei Armeen: von Nord, von Nordwest und von Nordost. Am 31. August plänkeln schon die Husaren Schwerins auf den Höhen vor Lieben, vertreiben die in höchster Eile dort aufgestellten Schanzarbeiter. Auch der Dessauer rückt schon an, zieht vor Wissotschan. Am 2. September erscheint der König selbst mit seiner Armee.
In Prag herrscht Verzweiflung über den neuen Kriegssturm, Empörung über den wortbrüchigen König. Nur 1400 Mann Besatzung stehen zur Verfügung unter dem Ingenieurgeneral Graf Ferdinand von Harsch. General Ogilvy führt in Eilmärschen noch 3000 Mann heran. 10.000 an Landmiliz werden in aller Hast aufgetrieben. Wieder formiert sich die Studentenlegion. Alles, was sich rühren kann, muß schanzen. Die Juden bitten, sich am Sabbat ablösen lassen zu dürfen. Das weckt Mißtrauen.
Die Preußen verschanzen sich gegen Neu- und Altstadt, fahren auf der Bubnahöhe, auf dem Veitsberg, den sie im Sturm genommen hatten, und am Neutor ihre Batterien auf: 100 Kanonen und Mörser (11. September). Starkes Bombardement beginnt. Brände in der Altstadt, Brände in der Neustadt. Die Verteidiger beschließen, einen Bogen der Karlsbrücke niederzulegen, um sich auf der Kleinseite halten zu können, falls die Altstadt fällt. Aber das Quaderwerk spottet allen Anstrengungen der Spitzhacke. Man gibt die Demolierung auf. Der Poøiè leidet am meisten. Die Judenstadt bleibt vom Bombardement verhältnismäßig verschont. Man beobachtet es in den Christenstädten mit wachsendem Mißtrauen. Sind die Juden im Bunde mit den Preußen? In der allgemeinen Aufregung tauchen allerlei Gerüchte über Verschwörungen im Ghetto auf. Und schon macht sich der Hunger wieder bemerkbar. Prags Lage ist verzweifelt. Breite Breschen klaffen in den Mauern. Die Preußen werden stürmen, werden plündern, ganz Prag einäschern. Der Kommandant entschließt sich, die Kapitulation von Alt- und Neustadt anzubieten. Aber Friedrich verlangt Übergabe von ganz Prag. Das Bombardement dauert an. Graf Harsch muß die preußischen Bedingungen annehmen (17. September).
Die Kanonen schweigen. Die Einwohner trauen sich wieder auf die Gassen. Man hat die Juden im Verdacht, mit den Preußen konspiriert zu haben und fällt über die Judenstadt her. Der alte Haß bricht wieder aus. Die Preußen haben schon den Wyschehrad besetzt. Juden holen ein preußisches Kontingent zu Hilfe. »Ah, seht ihr, die Preußenfreunde!«, heißt es in den Christenstädten. Aber die Preußen schaffen Ordnung. Generalleutnant Kurt Christoph Graf von Einsiedel wird Gouverneur der genommenen Stadt. Am 18. September zieht Friedrich selbst ein, bleibt nur eine Nacht in der Stadt, bricht schon am Morgen wieder auf zu seinen Armeen, die im Lande gegen die Österreicher operieren.
Der Sieger hält Mannszucht. Aber die verlassenen Paläste werden doch geplündert: die der geflohenen österreichisch gesinnten Gallas, Kolowrat, Czernin, Nostitz, Thun, Martinitz. Viel Beutegut wird in der Judenstadt losgeschlagen. Ein »Unterhaltungskontingent für das zu Seiner Kaiserlichen Majestät Diensten überlassene Kgl. preußische Auxiliarkorps« wird den Städten auferlegt: 1,292.000 fl. Bemerkenswert die Aufteilung: die Personen vom Magistrat müssen 30.000 fl. aufbringen, die reicheren Kaufleute, Geldwechsler und Zünfte 100.000, der Adel 150.000, die Statthalter 25.000, die Jesuiten 250.000, die Kreuzherrenritter und das Stift Strahow je 25.000, der Veitsdom 55.000, St. Anna 25.000 usw. Die Juden 55.000. Außerdem eine Glockenablösungssumme von 18.000 fl. (von der die Juden befreit werden, »da sie keine Glocken haben«). Der Generalfeldkriegskommissarius von Deutsch hält unerbittlich auf die Eintreibung. Er ist der gehaßteste Mann in diesen Tagen. Verordnung über Verordnung ergeht über die Bewohner. Sie müssen den Unterhalt der Garnison tragen, müssen schanzen. Man vermißt bei den Preußen die Humanität, wie sie die Franzosen doch geübt hätten. Man haßt die Eroberer. Der Gouverneur muß harte Verordnungen erlassen gegen Konspirationen und Spionage. Es waren im Grunde die gleichen, wie sie die Franzosen vor zwei Jahren gegeben hatten. Und doch empfand man sie von den Preußen so viel härter. Dabei munkelte man immer vom Einverständnis der Juden mit dem Feind.
Der Krieg draußen stand schlecht für die Preußen. Friedrich wurde nach Schlesien abgedrängt. Am 20. November traf beim General Einsiedel der Räumungsbefehl ein. Heimlich wird der Abmarsch vorbereitet, die Fortifikationen geschleift, Minen gelegt, vier Geiseln ausgehoben. In der Nacht vom 25. auf den 26. zog die Bagage aus. Am frühen Morgen folgte die Hauptmacht, zum Teil durchs Spitteltor, zum größeren Teil über die Brücke und Kleinseite beim Sandtor hinaus. Aber Ungarn und Dalmatiner, die seit Wochen vor den Mauern streiften, waren schon durch die entblößten Tore eingedrungen. Jetzt machten sie sich über die abziehenden Preußen her. Schon in der Jesuitengasse (Karlsgasse) fielen sie die durch die Enge behinderten Preußen an, in der Kleinseite brachen die Dalmatiner los. Bürger beteiligten sich aus den Häusern an dem Gemetzel. Es war ein wüstes und gemeines Hetzen durch die engen Gassen, durch die Burg, zum Sandtor hinaus.
Die Wut war nicht gestillt. »Auf die Juden!« erscholl es. Während in die Freudenschüsse des Befreiungstaumels noch die von den Preußen gelegten Minen krachten –; von der auf dem Laurenziberg gelegten hatte K. I. Dientzenhofer im letzten Moment noch die Lunte weggerissen –;, ergossen sich die Massen und die wilden Dalmatiner wieder in die Judenstadt und hausten fürchterlich. Nachschub vom Land wälzte sich heran. Erst nach Tagen gelang es der inzwischen eingerückten österreichischen Besatzung, der Volkswut Einhalt zu tun.
Und doch war diese Plünderung nur Auftakt viel strengeren Strafgerichts. Die Gerüchte vom Einverständnis der Juden mit den Preußen waren nach Wien gedrungen. Maria Theresia hatte aus ihrer Abneigung gegen die Juden nie ein Hehl gemacht. Jetzt holte sie zum vernichtenden Schlag aus. Drei Wochen nach dem Preußenabzug erschien das Dekret aus Wien, das alle Juden aus dem Königreich Böhmen auswies (18. Dezember 1744). Bis zum 31. Januar 1745 sollten sie die Stadt, später das Land verlassen haben.
Die Habsburger hatten der Judenfrage von je ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Karl VI. hatte im Jahre 1711 eine Kommission unter dem Grafen Johann von Waldstein ernannt, welche die Judenfrage studieren, den Bestand der jüdischen Bevölkerung im Lande feststellen sollte. Im Jahre 1740 hatte man 14.000 Juden in Prag gezählt. Die Juden bewarben sich bei jeder Gelegenheit um das Wohlwollen der Herrscher. Zu der Krönungsgabe für Maria Theresia hatten sie 450.000 fl. beigesteuert. Schon vorher, zur Feier der Geburt des Thronfolgers, hatte der reiche Judenprimas Simon Wolf Frankl einen prächtigen Umzug der Judenschaft durch die Gassen der Stadt veranstaltet, hatte ein Vermögen an die Feier gewandt. Persönliche Eitelkeit wird mitgespielt haben. Diese »Aufdringlichkeiten« rächten sich jetzt.
Verzweiflung im Ghetto. Die Gemeindeältesten verfaßten eine Bittschrift an die Statthalterschaft, legten die Unmöglichkeit eines solch plötzlichen Auszugs dar. Die Statthalterei übte Nachsicht. Auch die zur Ausweisung ernannte Kommission unter dem Grafen Kolowrat anerkannte die vorgebrachten Gründe der Judenschaft. Man sandte das Bittgesuch befürwortend nach Wien. Dort sprach auch der böhmische Oberstkanzler Philipp Graf Kinsky gegen das Dekret. Diese Ausweisung sei eine Katastrophe für die Gesamtwirtschaft. Das ganze Kreditsystem werde zerschlagen. Maria Theresia blieb hart. Nur eine Prolongierung ließ sie zu: bis zum letzten Februar. Die Kommission sollte die Schulden der Juden an das Ärar festsetzen, sollte für deren Einbringung sorgen. Eine besondere Privatschuldenkommission hatte die sehr verwickelten Privatkreditverhältnisse zwischen Juden und Christen zu regeln. Die Eigentümer von Liegenschaften sollten sich nach dem 1. März in der Nähe Prags aufhalten, des öfteren unter Tags zur Besorgung ihrer Geschäfte die Stadt betreten dürfen. Die Hauptmasse der Armen sollte sofort über die Grenzen abgeschoben werden.
Der Winter war sehr streng. Die Juden verzweifelten. Verkauften, verschleppten, wickelten in Hast letzte Geschäfte ab. Ließen sich Pässe ausstellen: nach Dresden, nach Amsterdam, nach Bamberg, nach Berlin. In alle Winde sollte sich die Gemeinde zerstreuen. Die Kommissionen arbeiteten musterhaft. Erbaten von Wien Erleichterungen. Maria Theresia, die sonst so gutherzige Frau, blieb hart. Drängte auf Vollzug, ließ die Kommissionen ob Verschleppungen hart an. Bis zum 26. Februar hatten schon an die 6000 Juden die Stadttore passiert, auf Karren und Wagen mitschleppend, was sich schleppen ließ. Die Frauen in der Hoffnung und die Kranken sollten zunächst zurückbleiben dürfen. Ende Februar hatten an die 14.000 die Stadt verlassen.
Da brachte aus Wien ein reitender Eilkurier die Verlängerung des Ausweisungstermins bis zum 31. März. So kamen viele nun noch einmal zurück. Ende März sollen wieder an die 2000 Juden in Prag gewesen sein. Schwierige Abwicklungsgeschäfte waren noch zu erledigen. Die Gemeindeschulden in Höhe von 160.000 Gulden, Kontributionsschulden bis zurück ins Jahr 1702 in Höhe von 245.798 Gulden sollten aufgebracht werden. Manches wurde den Juden nachgelassen, so die Rückdatierung der Kontributionsschulden. Die Steuerschulden waren alle beglichen worden. So lieferten die Vorsteher der Gemeinde am 31. Marz dem Ausweisungskommissär die Schlüssel der Synagogen und Schulen, des Rathauses ab und zogen hinaus.
Wenige Jahre später durften sie zurückkehren. England, Holland hatten interveniert, die Statthalterschaft hatte wiederholt auf die Schwierigkeit der Lage –; man brauche die Juden in der Wirtschaft –; hingewiesen. Im Jahre 1748 wurde das Dekret zurückgenommen.
Prag hat der Gesamtkulturleistung Maria Theresias viel zu danken. Diese große Frau richtet den Staat imponierend auf, auch Böhmen. Der Dresdner Friede hatte Muße gegeben für innere Wiederherstellung nach den Kriegen. Das Dringlichste war die Gesundung der Gemeindefinanzen, die durch die hohen Kontributionsleistungen unerhört gelitten hatten. Maria Theresia ordnete in Prag die emphyteutische Verpachtung (Erbverpachtung) aller Gemeindegefälle an, der Brücken- und Mühlenmauten, der Insel- und Überfahrtsgefälle, der Brauhaustaxen usw., wodurch die sehr kostspielige und von den Gemeinden wohl nicht recht praktisch gehandhabte Regie vermieden, sichere Einnahmen garantiert werden sollten. Auch die teueren Stadtsoldaten wurden abgeschafft, da jetzt ja die Miliz zur Genüge ausgebildet sei. Maria Theresias umfangreiche und bedeutende merkantile Neuerungen, in denen sie erste Versuche und Absichten ihres Vaters aufnahm und systematisch durchführte, wirkten nur erst mittelbar nach Prag herein. Das deutsche Nordböhmen wußte die neuen Anregungen viel fruchtbarer zu nützen. Aber der Adel, der draußen Industrien anlegte, brachte den Gewinn doch auch nach Prag; ebenso wuchs im Bürgerstand durch den einziehenden Handel der Wohlstand.
Darüber die Sorge um die geistige Hebung des Landes. An der Universität wurde begonnen. 1743 hatten sich die Untersuchungen wegen Verschwörungen gegen das Haus Habsburg auch auf Professoren der Universität erstreckt, die dem Bayernfürsten gehuldigt hatten. Die Bestrafungen waren glimpflich. 1746 wurde eine neue Kommission für die Reorganisation des Studiums eingesetzt. Birellis Vorschläge (1710) sollten in die Praxis übergeführt werden. Am medizinischen Studium wurden damals nur 30 Studenten gezählt, nur 100 Vorlesungen waren in einem ganzen Jahre gehalten worden. Die Einwände der Professoren wurden ad acta gelegt. Strikte Verordnungen regelten den Studienbetrieb. Die überlangen Ferien wurden kurzerhand abgeschafft. Als Aufsichtsorgan über die Universität sollte hinfort der Erzbischof als »Protector studiorum« fungieren. Aber die Kommission arbeitet lässig und die Professoren, die vom Clementinum und die vom Carolinum, sabotieren die neuen Verordnungen.

Einzug Maria Theresias auf dem Wälschen Platz 1743.
Der Krönungszug überquert den Wälschen Platz. Kupferstich von Martin Dyroff (Nürnberg) nach J. J. Dietzler. Rechts St. Niklas (Kleinseite), links altes Liechtensteinsches Palais, oben Hradschin vor dem Theresianischen Umbau.
Da wird im Jahre 1752 ein moderner Studienplan verfügt. In der Philosophie hat das Traktieren nach Aristoteles zu entfallen. Die Erfahrungswissenschaften, vor allem die Physik, bis jetzt ganz vernachlässigt, werden in den Vordergrund des Studienbetriebs gerückt. Jede Fakultät erhält ihren Direktor, einen gelehrten Beamten oder Geistlichen, der alle Prüfungen zu überwachen hat, dabei vor dem Dekan rangiert. Die Königlich-Böhmische Repräsentation, wie die Statthalterei jetzt heißt, setzt die Direktoren ein. Vor allem die Jesuiten laufen Sturm gegen diesen Einbruch in ihre Rechte. Ihre Verteidigung erinnert in Ton und Inhalt wieder an jene vor 38 Jahren. Vergebens. Die Kaiserin befiehlt. Und alle Befehle richten sich immer eindeutiger gegen die Gesellschaft Jesu. Weltgeistliche sind Direktoren ihrer Fakultäten, das philosophische Studium wird geteilt. Sogar die Rektoren werden aus Beamten und Weltgeistlichen bestimmt. Die Augustiner und die Dominikaner, die alten Widersacher der Jesuiten, dringen als Professoren der Dogmatik in das Reservat der Jesuiten ein.
Auch die Unterlagen der Universität werden verbessert. Die Bibliothek, die im Carolinum untergebracht ist, wird aus Wien ansehnlich vermehrt. Die alten Kollegien, das Wenzelskolleg und das Allerheiligenkolleg, werden verkauft, neben dem Carolinum werden zweckdienliche Häuser neu erworben. Vor allem: in der ganzen Monarchie wird nun eine neue einheitliche Schulordnung eingeführt, durch welche die niederen Schulen nicht mehr der Universität unterstellt sind. Die Hofkommission in Wien steht an der Spitze des gesamten Unterrichtswesens. Provinzialstudienkommissionen in den Ländern regeln die Sonderbelange. Die Zentralisierung greift nach Böhmen herein, packt am Kern des geistigen Lebens, jedenfalls an der zum Kern bestimmten Organisation an, holt Böhmen herein in die Einheit der Habsburgermonarchie. Die Widerstrebenden, die Jesuiten, deren Organisation einer solchen weltlichen Zentralisation widerstreben muß, werden hinausgedrückt. Die weltliche Macht bestimmt über das geistige Wohl der Untertanen, richtet den Apparat auf, in den ein selbstsicheres Bürgertum hineinwachsen kann.
Dessen Erwachen hatten wir schon anläßlich der Zerwürfnisse innerhalb der Freimaurerloge beobachtet. Für das damalige Prag ist die Freimaurerbewegung bezeichnend: in ihr sammelten sich Angehörige der verschiedensten Schichten. Auch freisinnige Geistliche wie die Äbte von Stift Strahow, die Augustinermönche von St. Thomas und verschiedene Weltgeistliche gehörten der Loge an. Trotz des Verbotes durch Maria Theresia (1764, im gleichen Jahre, als die »Rosenkreuzer« aufgehoben wurden) hielt sich ein eifriges Freimaurertum in Prag. Die Jesuiten hetzten. Im Jahre 1766 läuft gar das Gerücht um, die Freimaurer wollten ein selbständiges Königreich Böhmen ausrufen. Aber die Auflösung des Jesuitenordens macht den Gerüchten ein Ende.
Unter all dem kräftigt sich das tschechische Element in Prag. Die Freizügigkeit der Bauern läßt viele Tschechen einwandern. Ausländern aber –; und als Ausländer gelten auch die »Reichsdeutschen« –; durfte das Bürgerrecht nur nach ausdrücklicher kaiserlicher Genehmigung erteilt werden. Prag wird bevölkerungspolitisch abgeschnürt vom Reich. Die Verösterreicherung der Stadt setzt ein. Und das hieß hier: ihre Provinzialisierung.
Jetzt wird der Geist des größten Sohnes des tschechischen Volkes, des im Jahre 1628 aus Mähren vertriebenen Johann Amos Komenský, aufgenommen in die geistige Entwicklung Prags. Sein Werk war den Pragern durch die Gegenreformation verschlossen worden. In der Fremde hatte Comenius seinen Geist geläutert zu jener großen Menschenliebe, die alle Kämpfe der Kirchen und Nationalitäten übergreift, die den Samen der Liebe einpflanzt ins menschliche Herz und ihn in kluger Erziehung hegt bis zum Aufblühen in einem rein geistigen Reich. Jetzt kam dieser vornehme Geist zu seinem Volk zurück, dem er als letzter Bischof der Brüdergemeinde ergreifende Trost- und Abschiedsworte zugerufen hatte (1668).
Wir müssen noch das Theaterleben dieser Tage auf seine Kulturleistung hin betrachten. Auch hier wie in den musikalischen Akademien, wie in allen geistigen Bestrebungen, regt sich neben dem Adel das Bürgertum. Wir hatten von der Erbauung des Kotzentheaters durch den Altstädter Magistrat berichtet. Die Mönche vom Gallikloster, die beschuhten Karmeliter, hatten bei der Statthalterei gegen den Theaterbau Einspruch erhoben. Das Spektakel störe ihren Gottesdienst. Als der Einspruch nichts fruchtete, verwahrten sie sich gegen die Nachbarschaft der »unsittlichen ketzerischen Komödianten«. Auch das war vergebens. Und auch die Einwendungen der Nachbarbewohner am Kotzenmarkt, die wegen Feuersgefahr gegen die Errichtung des Theaters sich verwahrten, wurden zurückgewiesen. Der bescheidene Theaterbau stand da. Prag hatte seine feste Bühne.
Zunächst zog die italienische Oper ein. Der Prinzipal Santo Lapis lud zu großartig angekündigten Darbietungen. Auf dem Theaterzettel wurden die Sängerinnen als »Jungfrauen« geführt. Geldschwierigkeiten und der hohe Pachtzins vertrieben ihn. Unter Kurtz und Deppe zog die deutsche Komödie ein, noch recht derb und reichlich im Argen. Auf den Ankündigungen stand vermerkt, daß nur »katholische und verheyrathe Aktores« auftreten werden. In Johannes Schröder, dem nächsten Pächter in diesen theaterunfreundlichen Kriegsjahren, übernimmt zum erstenmal ein Anhänger der Neuberin, der großen deutschen Reformerin, die Prager Bühne. Aber auch er kann sich nicht halten. Im Jahre 1746 hat wieder ein Italiener, Angelo Mingotti, das Theater inne, pflegt die italienische Oper. Da wird »La finta schiava« gespielt, ein sogenanntes Pasticcio von Leonardo Vinci, Lampugnani und Cluch. Dieser zuletzt genannte Cluch ist kein anderer als der Meister Gluck, der vor einigen 15 Jahren in Prag studiert hatte. Jetzt schrieb er mit an italienischen Opern, hatte schon Erfolge. Viel Beifall fand die Aufführung von »La Semiramide riconosciuta« des Dresdner Hofkapellmeisters Johann Ad. Hasse, die natürlich am italienischen Stil festhielt.
Aber auch Mingotti hatte ziehen müssen. Die Verträge mit der Altstadt scheinen recht »unternehmerisch« gehalten gewesen zu sein. Erst Giovanni Battista Locatelli erzielt einen günstigeren Vertrag mit den auf ihre Pachtgelder erpichten Stadtvätern. Locatelli bringt nun die erste wirklich deutsche Oper nach Prag. Ihr Meister ist Gluck. Der ersetzt den tändelnden Ton der italienischen Oper durch ernstes Pathos, gibt den Helden große, auch musikalisch große Rollen, reformiert später die Oper von Grund aus. Schon wächst sein Ruhm. Im Fasching des Jahres 1750 wird sein »Ezio« in Prag aufgeführt. Angiolo Carboni aus Bologna hatte prächtige Dekorationen geschaffen. Das Publikum war begeistert. Im Herbst dieses Jahres folgte dann seine »Ipermnestra«, im Jahre 1752 »Issipile«. Er hatte, wie überall, so auch in Prag die Opernbühne erobert.
Aber dies auf ansehnlicher Höhe stehende Schaffen wurde wieder durch Geldschwierigkeiten unterbrochen. Locatelli mußte einen Untermieter aufnehmen, da er mit seinen Aufführungen allein die Pacht und das Ensemble nicht bestreiten konnte. Joseph von Kurtz zieht wieder ein mit seiner leichten Schar. Die Epoche des »Bernardon« beginnt, mit welchem dies komische Talent, dies »Mittelding zwischen Schelmerei und Tölpelei«, wie ein Kritiker den Typus des Joseph von Kurtz nennt, seine Triumphe feiert. Das Publikum jubelt über die gröbsten Späße. Das Schauspielerpersonal verderbt immer mehr, die Hanswurstiade herrscht. Das war recht grobe Kost und man merkt am Gebotenen, daß sich das Publikum gegen früher recht verändert hat. Das Bürgertum tauchte herauf. Und es wollte am Anfang die roheren Freuden des Volkslebens auf seiner Bühne genießen. Der Adel hatte an der italienischen Oper festgehalten. Der Wechsel zwischen Oper und Volksstück auf der Prager Bühne zeigt zugleich das Schwanken zwischen abtretendem Adel und auftretendem Bürgertum als Publikum.
Aber wir wollen diese Leistungen nicht als Eintritt des Bürgertums in der Kulturwelt gelten lassen. Es wies sich drüben in Deutschland, wo Gottscheds Theaterreform wirkte, wo die Neuberin ein echtes Schauspiel pflegte, in wahrlich besserer Form. Bald sollte es auch in Prag so auftreten. Einstweilen unterbanden neue Kriege noch jede höhere Kulturleistung. Locatelli hatte das Theater gerade zu einem Tanzsaal umgestalten lassen, da drohte wiederum Preußengefahr. Das ganze Gebäude mußte zu Depotzwecken benutzt werden. Zum Spielen war ohnedies jetzt nicht die Zeit.
An dem Streitfall zwischen England und Frankreich um Besitzungen in Amerika hatte sich wieder ganz Europa entzündet. Maria Theresia stand jetzt zu Frankreich. Friedrich von Preußen hielt es mit England. Marschierte auch gleich gegen den alten Feind, schlug ihn bei Lobositz (1756), brach im Jahr darauf wieder in Böhmen ein, diesmal mit 100.000 Mann. Karl von Lothringen hatte die österreichischen Truppen bei Prag konzentriert. Am 1. Mai erscheint der Preußenkönig auf den Höhen vor Prag. Die Österreicher lassen ihr Lager auf dem Weißen Berg auf, ziehen sich durch die Stadt gegen Nusl zurück, nehmen dort Stellung. Die Preußen befestigen sich im ehemaligen österreichischen Lager auf dem Weißen Berg und in der Nähe von Podbaba. Beschießung von den Bastionen aus richtet wenig Schaden an. Am 4. und 5. manövrieren die Preußen über Troja und Prosek dem feindlichen Lager entgegen. Am 6. kommt es zur Schlacht, die stundenlang hin und her wogt. Endlich müssen die an Zahl unterlegenen Österreicher (60.000 Mann) doch weichen, überlassen dem siegreichen König das Schlachtfeld und ziehen sich in die Stadt zurück. Auf preußischer Seite war der General von Schwerin gefallen –; später wurde ihm auf dem Schlachtfeld ein Denkmal gesetzt –;, auf österreichischer Seite der Marschall Browne tödlich verwundet worden.
Am 9. erstürmen die Preußen in zweimaligem Anlauf unter ungeheuren Verlusten den Veitsberg. Der war ja schon bei der ersten Belagerung ihre Operationsbasis gewesen. Batterien werden in Stellung gebracht, die Bastionen werden beschossen. Ausfälle der Kroaten, Scharmützel um einige Batterien. Die Stadt selbst blieb noch verschont. Aber in der Nacht des Pfingstsonntags (30. Mai) beginnt das furchtbare Bombardement aus allen Batterien. In Neustadt und Kleinseite wütet es schrecklich. Bei St. Heinrich brennt es, auf der Burg brennt es, die Reitschule ist arg gefährdet. Tagelang wütet der Kugelregen. Am 8. steckt eine Karkasse das Prachttheater im Burggarten, das zu Karls VI. Krönung errichtet worden war, in Brand. Es wird vollständig vernichtet. Die Nervosität in der Stadt wächst. Teuerung bricht aus. Die Spitäler sind überfüllt. Und immer noch brüllen die Kanonen. Der Veitsdom wird stark beschädigt. Eine Bombe zündet im Westen: die schöne Orgel schmilzt unter den Flammen. In den Spanischen Saal sollen allein an die 300 Kugeln gefallen sein. In der Neustadt wird vor allem der alte Karlshof bös mitgenommen. Die Chronisten wollen an die 25.000 Bomben und an die 80.000 glühende Kugeln gezählt haben, mit denen in den Tagen des Bombardements die Stadt belegt worden sei. Man hat es in Prag dem Preußenkönig nie vergessen. Noch lange zeigte man Spuren seiner schonungslosen Kriegführung.
Friedrich stand in diesen Tagen aber schon draußen im Feld, operierte gegen die anrückende österreichische Armee. Operiert unglücklich. Wird bei Kolin von Daun geschlagen (18. Juni). Muß zurück. Am 19. wird in Prag das Feuer plötzlich eingestellt. Die Preußen ziehen sich gegen den Weißen Berg zurück, brechen ihre Schiffsbrücke über die Moldau (bei Troja) ab, ziehen gegen Breunau. Die Österreicher aus der Stadt ihnen nach, verfolgen sie bis zum Schloß Stern. Viele Deserteure! Prag ist frei. Das Volk jubelt.
Am 22. Juni wird der Sieg gefeiert. Ehrensalven aus den Batterien, Lauffeuer um die ganze Stadt. Feierliches Tedeum bei St. Adalbert vor dem Veitsdom (der Dom selbst war arg zugerichtet). Karl von Lothringen empfängt Prags Huldigung für Österreich. Die Entscheidung ist gefallen.
Prag atmet auf, von jahrzehntelangem Druck befreit. Die Erleichterung findet sofort ihren äußeren Ausdruck: die durch die Kriege so jäh unterbrochene Bautätigkeit setzt wieder ein. Zerstörtes war wieder aufzubauen, Versäumtes nachzuholen. Vor allem: es war zu »modernisieren«. Die Kriege hatten eine ruhige architektonische Weiterentwicklung verwehrt. Draußen in der Welt war man fortgeschritten, Empfindungen hatten sich gewandelt, waren unter den Kriegsläuften auch in das private Leben der Prager eingedrungen. Jetzt sollten die Bauten ihnen angeglichen werden. Und darüber verlangte der siegreiche Despotismus seinen monumentalen Ausdruck: Habsburg wünschte auch in Prag die europäische Residenz.
Schon vor dem zweiten Preußeneinfall hatte man begonnen, den Westflügel der Burg im neuen von Paris diktierten Schema auszubauen. Nicolò Paccassi hatte Pläne geliefert: großer Ehrenhof, der sich gegen die mittelalterliche Platzanlage zu öffnete, Scamozzis Torbau als wirkungsvolle Mitte einbezog. Ruhige Flügelbauten an der Stadtseite und an der Hirschgrabenseite. Unter den ausführenden Architekten treffen wir den letzten Vertreter der großen italienischen Baumeisterfamilie des Barock: Anselmo Lurago, neben ihm zwei Deutsche: Anton Hafenecker und Anton Guntz. Die vornehme Kühle der Franzosen wird hier zur Nüchternheit. Zurückhaltende, in die Wagrechte gezogene Wände legen sich vor den Aufschwung des Veitsturms, flaue Kulissen verdrängen nun die reiche Bewegung, die hier an den Hradschinbauten aus Jahrhunderten emporgewachsen war.
Auch östlich des Wladislawschen Baus wurde die stille Raumbegrenzung weitergeführt. Maria Theresia hatte ein adeliges Fräuleinstift in Prag gegründet. Es sollte im alten Rosenberg-Palast untergebracht werden. Der erwies sich nicht ausreichend für die Anforderungen (wohnliches Heim für 30 Stiftsdamen). So mußte er nach der einzig zur Verfügung stehenden Seite, nach Westen hin, erweitert werden. Der Hofbaumeister Paccassi wurde mit der Ausarbeitung der Pläne beauftragt –; er führt den Anbau über den alten Rosenberg-Garten und über einige alte, dort anschließende Häuser, die niedergerissen werden, bis zum Chor der Allerheiligenkirche. Alt- und Neubau werden hinter einer durchlaufenden, sehr zurückhaltend gegliederten Fassade zusammengenommen: ein wenig hervorgehobener Mitteltrakt, zwei symmetrische Seitentrakte. Von den Erkerstümpfen mit Balkonbekrönung, einzige Belebung der langen Fassade, dürften die östlichen über Fundamenten der alten Palasttürme, die 1623 bis 1633 wegen Baufälligkeit wohl nur in ihrem oberen Teil hatten abgetragen werden müssen, errichtet worden sein. Die durchlaufende Dachzone stuft sich gegen den Wladislaw-Trakt leise ab (1753-1755). Wie dieser Umbau der Hradschinfronten auf das Stadtbild einwirkte, werden wir im nächsten Teil betrachten.
Das war nicht mehr die reiche Fülle des Barock, war blutloser Eklektizismus, der solchen Monumentalaufgaben schon nicht mehr gewachsen war: »im Geschmack des Antiken« sei die Mariahilfkirche gehalten gewesen, die Palliardi in Wiener Auftrag bei der Mariaschanze am Sandtor errichtete (1757-1762). Man war stolz auf das »Neue«. Der Erzbischof ließ sein Palais umbauen: es stand ja zu Seiten der neuen Hofburg (1764/65). Johann Wirch ist der ausführende Architekt. Dem Kernbau Matheys werden Seitenrisalite angefügt, die die Breitenentwicklung bringen. Derbe Säulenattika drückt noch mehr in die Waagrechte. Mit kleinlichem Zierat wird die Fassade verschnörkelt. Ähnlich war es einige Jahre früher (1760) schon dem Palais des Grafen Nostitz-Rhineck am Malteserplatz ergangen.
Zu diesen Umbauten treten nun überall Neubauten. Nachrückender Adel, teils schon aus dem Bürgertum heraufgewachsen, auch reiche Bürger selbst beanspruchen eigene kleine Palais, stattliche Häuser. Joseph Jäger errichtet aus einem älteren Gebäude für den Herrn von Montag ein großes Haus am Kleinseitner Ring: der Typus der mittelalterlichen Stadtburg klingt in dem eckturmartig mit Erkern besetzten Bau noch nach 1763. Am Malteserplatz errichtet der Ritter Franz Xaver von Turba sein kleines Palais (von Jäger). An der Brückengasse baut Graf Kaunitz. Hier treibt noch einmal die alte Dekorationslust auf. Sprudelnd überzieht sie die Fassade, die dem Dientzenhoferschen Seitenportalbau an der Kirche des Thomasklosters antwortet. Ein Malerarchitekt hat hier gebaut: Karl Schmidt. Wie aufgemalt mutet diese Dekoration auch an.
Die andern Baumeister bannen das Üppige in der Dekoration immer mehr. Die Fensterparapete werden glatt und gerade, die Rocaille zieht sich an den Fries und in den Dachgiebel zurück, verschwindet später ganz. Die Festons zeigen jetzt geschlossene Kelche, zopfartige Gehänge treten auf, Medaillons werden beliebt, um mit Ideenanklängen begrifflicher Werte also den Baukörper zu »beleben« (Palais Mac-Neven von Palliardi, Umbau des alten Palais Buquoy in der Zeltnergasse für die Universität). Die Großformen werden trocken und leer (Bibliotheksgebäude des Stiftes Strahow von Ignaz Palliardi 1782-1792). Man behilft sich mit »Antikischem«, ohne es aber, wie in Berlin, neu zu durchleben (Piaristenkolleg Herrengasse, 1766). Der Typus des Adelspalastes des hohen Barock klingt noch einmal auf im Palais Sweerts-Sporck in der Hibernergasse (Palliardi 1790-1792), ebbt aus in einem Adelspalais am Graben, dem heutigen »Deutschen Haus«.
Der Theaterbau, den Graf Nostitz nach Entwürfen des Grafen von Künigl durch Anton Hafenecker zwischen Rittergasse und (damaligem) Carolinplatz ausführen läßt (1781-1783), greift auf Palladio zurück, schafft für die durch die Platzenge behinderte Raumentfaltung Ersatz durch den säulengetragenen Giebelvorbau mit eingenischten Ecken. Immer kahler und »vernünftiger« werden die Fassaden, aller Schmuck des Barock schmilzt ab, aber seine edle Proportion bleibt, »Antikisches« wirkt nun in diese Beruhigung herein, die Attika, die Tropfen und Triglyphen dürfen nie fehlen. So halten diese Häuser, die sich der Straßenflucht immer mehr einordnen, ruhige Straßenwände bilden, doch schöne architektonische Wirkung.
Die Hauptwirkung zieht sich ins Innere zurück: Bibliothekssaal in Stift Strahow mit der schönen Einrichtung aus dem aufgehobenen Prämonstratenserstift Klosterbruck bei Znaim, über die 1794 Maulpertsch die reiche Deckenmalerei wölbte. Sachlich gehaltene Miethäuser reihen sich an frühere Paläste. Am Wenzelsplatz konnte man bis vor kurzem schöne Beispiele dieser Art sehen. Man mag die neue Form Verarmung nennen –; vom Barock aus gesehen muß sie so wirken. Als anspruchslose Formung eines neuen Lebensgefühls, das ein inneres Maß wahrt, muß man ihr Beifall zollen.
Rohstoff für eine neue Monumentalität war gegeben. Daß Prag ihn nicht zu gestalten wußte, lag an den mittelmäßigen Architekten. Monumentalität holte man sich später aus Berlin (Zollamtsfassade 1810). Aber man war aufrichtig. Und so mag man die Begeisterung, mit der die damaligen Prager ihre neue Baukunst loben, verstehen. In der in den Jahren 1777 und 1778 erscheinenden »Moden, Fabriken und Gewerbezeitung« liest man ganz heutig klingende Aufrufe für die neue Kunst, und in einer anonymen »Beschreibung der königl. Haupt- und Residenzstadt Prag« (aus dem Jahre 1788 oder 1789) wird über die »Sitten der prager Einwohner insgemein« so bezeichnend geurteilt, daß wir einiges hiehersetzen wollen.
»Man muß gestehen, daß die heutige Art der Aufführung der Gebäude, derselben inwendige Auszierung, und der Geschmack in den Kleidungen der vormaligen an der Kostbarkeit weichen müsse; doch hat solche dabey den Vorzug in der Bequemlichkeit und Niedlichkeit, welches die Alten nicht so sehr beobachteten. Dieser Regel zufolge werden die heut zu Tage aufgeführten Häuser mehr zu einer bequemen Wohnung dargestellt …
… Jene Gebäude, so nach der Prager Belagerung von 1757 aufgeführt wurden, hatten nicht mehr das kroteske Ansehen, sondern es herrschte darinn Niedlichkeit, Bequemlichkeit und ächter Geschmack, so schaffte man auch das Ungeheuer in den Meubeln ab, und führte dagegen eine Art bequemer, zierlicher und netter Einrichtung ein … Diese Meubeln sind auch so verfertigt, dass sie in viele Stücke zerlegt, und auf solche Weise vom einen Orte zum andern bequem und ohne Beschädigung mögen übertragen werden … Nichts wird gefunden, was nur einigermassen die freie Passage, oder das Auf- und Abgehen in Zimmern verhindern könnte. Einen großen Tisch in die Mitte des Zimmers aufzustellen ist kleinstädtisch, und verräth einen schlechten Geschmack … Die Verschwendung bey den Festins an Pracht und Mahlzeiten ist von der guten Haushaltung verdrängt worden. Man fängt an bey freundschaftlichen Zusammenkünften die lächerlichen Formalitäten des gezwungenen Zeremoniels auszulegen und sich an eine freye und wohlanständige Lebensart anzugewöhnen (nach dem Vorbild des Hofes!) … Vom Minister bis zum Küchenjungen, und der Dame bis zum Zuchtmädchen beschäftigt sich alles mit Bücherlesen … Allgemein betrachtet nimmt man wahr, wie Vorurtheile, Aberglauben, Hartnäckigkeit und Unempfindlichkeit den Schönen und Rührenden, der Aufklärung nützlichen Kenntnissen, der Leutseligkeit und dem guten Geschmack gewichen. Es ist wahr, dass unter diesen schönen Nationalkarakteren auch die Weichlichkeit sich eingeschlichen, allein wie schwer ist in allen menschlichen Dingen die Mittelstrasse zu beobachten …«

Krönung Maria Theresias im Veitsdom 1743.
Kupferstich von M. H. Rentz aus Nürnberg nach J. J. Dietzler.
Man staunt über die Bewußtheit, mit der hier die eigene Zeit von der vorhergehenden abgehoben wird. Ein Selbstbewußtsein, das tiefer wurzelt als in der neuen Bau- und Wohnkultur. Die sind selbst nur Folge. Wir kennen diese Töne: typischer Nachbarock, der mit seinen beiden Ästen, der Aufklärung und der Empfindsamkeit, nach Prag hereingreift. Hier erfährt er aber durch die örtliche Gestimmtheit eine interessante Brechung. Nicht so sehr, daß das Bürgertum jetzt in die vorher nur dem Adel zugerichtete Kultur hineinwächst, ist das für Prag Bezeichnende. Nirgends spielt ja auch jener Anonymus den Bürger gegen den Adel aus. Die Aristokraten sind noch immer die großen Mäzene, die obersten Beamten, die Erteiler repräsentativer Aufträge, wenn auch nicht mehr die allein Bestimmenden im Geschmack. Der Bürger schielt jetzt nicht mehr nach oben, im Gegenteil: der Aristokrat beugt sich, wenn auch gönnerhaft und fördernd, herunter zur bürgerlichen Leistung. Gerade im Geschmacklichen verspürt man nun überall die Intimität des Bürgerlebens, das sich auf Grund des von Maria Theresia geförderten Merkantilismus auch wirtschaftlich stark entfaltet. Doch diese Wandlung der geistigen und sozialen Situation spielt sich um diese Zeit im gesamten deutschen Kulturbereich ab. Seine Prager Sonderfärbung erhält dieser Vorgang wieder von einer hier stattfindenden Überschneidung zweier Kulturkreise, die aus ihrer Begegnung eine ideenkräftige Bewegung auftreiben lassen.
Ihr Ausgangspunkt ist die Literatur. Der Barock mit seiner internationalen Adelsgesellschaft hatte die Einflüsse der französischen Literatur gestärkt. Die französische Aufklärung hatte sie zur Weltliteratur werden lassen. Da war ihr in Deutschland die große Gegenströmung erstanden. Man besann sich auf Eigenes. Gottsched war der Beginner. Die Neuberin als eifrige Kämpferin für seine Ideen auf dem Theater haben wir erwähnt. Das erwachende Bürgertum trug die Bewegung. Eine Nationalliteratur regte die Flügel. In Gellert fand Gottsched den Fortsetzer und Überwinder. Leipzig blieb landschaftlicher Mittelpunkt. Von Leipzig aus –; Ostmitteldeutschland! –; wirkt die Bewegung jetzt nach Prag.
Im Verlauf der Universitätsreform unter Maria Theresia war Carl Heinrich Seibt als außerordentlicher Professor für die schönen oder galanten Wissenschaften, die Moral und die Erziehungskunst an die Prager Universität berufen worden (1763). Ein Nicht-Jesuit auf dem philosophischen Katheder! Seibt war ein Bauernsohn aus der sächsischen Lausitz. Seine große Begabung hatte ihm die Wege zum Universitätsstudium geebnet. Er hatte zuerst in Prag, dann in Leipzig studiert, hatte dort den Kampf Gottsched-Gellert mitgelebt. Jetzt trug er die neuen Ideen von seinem Prager Katheder aus einem großen Hörerkreise vor. Mit ihm beginnt eine neue Epoche in der Kulturgeschichte Böhmens. Seine Vorlesungen wurden Mittelpunkt des geistigen Prag. Er brachte die Gellert, Geßner, Gleim, Wieland, Uz, die ganze moderne deutsche Dichtung. Er brachte das Ideal der Sprachreinigung, führte die »teutsche Schreibweise« ein. In kurzer Zeit war die französische Literatur verdrängt. Nicht französische Geistigkeit überhaupt: er brachte auch Voltaire, Montesquieu, brachte auch den Engländer Hume. Aber sein Enthusiasmus galt dem Deutschen. Er las über deutsche Geschichte, Pädagogik auf volkstümlicher Grundlage, trieb weiteste Volksbildung. Er brauchte das Theater.
Wir hatten das Prager Theater zur Zeit seiner größten Verwilderung unter »Bernardon« verlassen. Inzwischen war dem Kotzentheater ein Konkurrenzunternehmen auf der Kleinseite erwachsen: dort in der Reitschule des Waldsteinschen Hauses spielte Gaetano Molinari. Die Altstadt klagt. Ein Vergleich kommt zustande: Molinari wird Untermieter bei Kurtz im Kotzentheater. Aber beide geraten in Geldschwierigkeiten, müssen abziehen. Nun nimmt ein Kaufmann aus Brünn, der Italiener Josef Bustelli, das Theater in Pacht, pflegt die Buffo-Oper, hält deutsche und italienische Komödianten. Skandale zwischen den Nationalitäten auf offener Bühne. Das Interesse des großen Publikums an der italienischen Oper flaut ab. Man will die deutsche Komödie. Schon wirkt Seibt an der Universität. Der Adel bleibt dem deutschen Schauspiel gegenüber noch zurückhaltend. Sogar der ausgezeichneten Komödie Josef von Brunians gegenüber, der das Volk zuläuft. Brunian hatte mit Bustelli wegen Vorstellungen im Kotzentheater verhandelt, hatte sich, als sich diese Verhandlungen zerschlugen, im Haus des Grafen von Thun auf der Kleinseite eingerichtet. Er nimmt es ernst mit dem Schauspiel, hat Erfolg, Bustelli muß ihn schließlich doch im Kotzentheater aufnehmen (1768). Aber die Zurückhaltung des Adels gegenüber dem Schauspiel hat finanzielle Bedrängnis der Direktoren zur Folge.
Da kommt wirtschaftliche und geistige Hilfe. In Wien war die Begeisterung für das »Nationalschauspiel« erwacht. Der Prager Oberstburggraf Fürst von Fürstenberg eifert ihm nach, fördert Brunian. Für die innere Haltung des Theaters wichtiger: Seibt hatte seine »Neue Literatur« gegründet (1771), hatte dort eine ständige Theaterkritik eröffnet. Er bietet seine geistige Kraft, sein hohes Ansehen dem Schauspieldirektor. Er hat größten Einfluß: die Theaterzensur wird ihm übertragen. Jetzt wird der Kampf gegen die Burleske mit aller Kraft aufgenommen. Der Spielplan soll strengsten Ansprüchen entsprechen: Goldoni, Molière, Voltaire, Diderot, Shakespeare, Weiße, Brandes. Im Jahre 1772 wird Lessings Jugendwerk »Der Schatz« gegeben. Als Operette wird das deutsche Singspiel zugelassen. Das Ensemble vervollkommnet sich. Bergopzoom ist ein genialer Regisseur. Unter den Akteuren ist Senefelder, der Vater des Erfinders der Lithographie, einer der bedeutungsvollsten. Bustellis Oper tritt ganz in den Hintergrund unter dieser Schauspielblüte. Und doch muß man wieder mit Geldschwierigkeiten kämpfen. Graf Prokop Czernin wird »Oberaufseher« des deutschen Theaters, hilft auch geldlich weiter. Im Sommer wird in einer Bude auf dem Carolinplatz, dem heutigen Obstmarkt, gespielt. Das Kotzengebäude ist eng und allzu schlecht gelüftet. Die Theaterreform geht weiter. Warum hat sie doch keinen durchschlagenden Erfolg? Vielleicht liegt der Grund im Träger der Reform selbst, in Brunian. Er will die hohe Tragödie. Im Herzen ist er aber nur Burleskenspieler. Hatten ihn die Prager doch schon unter Kurtzens Bernardon-Rummel als Darsteller komischer Rollen gesehen. Eigentlich gehörte er dorthin ins Reich der Burleske. Er war ein glänzender Komiker. Trat er in tragischen Rollen auf, so reizte dies manchmal zum Lachen. Und so geht es wieder bergab nach dem hoffnungsvollen Beginnen. Das Publikum bleibt allmählich aus.
Man versucht es noch mit einer tschechischen Aufführung. Ein Lustspiel »Herzog Michel« wird als »Kníže Honzík« in eindressiertem Tschechisch herausgebracht. Es ist die erste tschechische Aufführung auf dieser Bühne, die erste tschechische seit den Jesuitenspielen im Clementinum. Die Schauspieler, meist Deutsche, verstümmeln das Tschechische dermaßen, daß das Publikum davonläuft. 1779 verschwindet Brunian aus Prag. Einige aus dem Publikum und vor allem seine Gläubiger weinen ihm nach. Bustelli sucht eifrig nach einem neuen Schauspielpächter, findet einen solchen endlich in Carl Wahr, dem Direktor des Schauspiels in Preßburg. Der beginnt mutig, gerät aber auch bald wieder in Schulden. Er wäre verloren gewesen wie Brunian, hätte ihm nicht Franz Anton Graf von Nostitz geholfen. Diese Hilfe hat tiefere Motive, die in der von Seibt angefachten Bewegung wurzeln.
Gegen Seibt und seine Schüler, die sich in der »Neuen Literatur« ihr Organ geschaffen hatten, hatte sich ein Kreis von Männern gesammelt, die sich um den aus Wien gekommenen Ignaz von Born, einen siebenbürgischen Deutschen, scharten. Born, eifriger Freimaurer, hatte in Wien die Sonnenfelssche Bewegung aufgenommen, jene aufrichtige Bewegung, die eine österreichische Kultur gegen die »überhebliche« Kulturexpansion des Reiches stellen wollte. Dieser Kreis hatte in den »Prager gelehrten Nachrichten« sein Organ geschaffen. Hier nahm man sich besonders der heimischen Geschichtsforschung an. Dobner, der große Begründer der böhmischen Geschichtsschreibung, hatte seine »Monumenta historica Bohemiae« herausgebracht. Der Kreis von Klotz in Halle spielt gegen dieses große Geschichtswerk die deutsch eingestellte »Chronologische Geschichte Böhmens« von Pubitschka aus. In den »Prager gelehrten Nachrichten« wird Dobner energisch verteidigt. Voigt, wie Dobner Piarist, polemisiert gegen Seibt, der mit der Hallenser Strömung, wenn nicht sympathisiert, so doch seiner Herkunft nach zusammenhängt. Aus der ursprünglich Wiener Strömung im Kreise der Bornianer wird allmählich eine heimatlich böhmische. Franz Martin Pelzl tritt als Historiker in die Fußstapfen Dobners. Die Bornianer bevorzugen überhaupt die exakten Wissenschaften, während die Seibtianer durch ihre Volksbildungsbestrebungen ins Schöngeistige hinübergetrieben werden. Die eigentliche Gegnerschaft wurzelt aber doch in der Auflehnung heimischer Kräfte gegen die ausländischen. Und ein geheimer Widerstand gegen die josefinischen Zentralisierungsbestrebungen unterstreicht diese heimatliche Note.
War es hier zunächst österreichisch gestimmter Patriotismus, der gegen das »Reichsdeutsche« (um diesen Ausdruck hier vorwegzunehmen) protestierte, so wandelte sich die Bewegung allmählich zu einem landschaftlich engeren, dafür aber wesentlich bestimmter begründeten böhmischen Landespatriotismus. Auch im Born-Kreis fühlt man sich als Deutscher, aber als böhmischer Deutscher, der die Bevormundung durch die Leipziger und ihre Schulen nicht braucht. Man nimmt deren Sprachreinigung auf, betont aber, daß man schon vorher, ja schon zu der Pøemysliden Zeiten, ein gutes Deutsch gesprochen habe. Die Aristokraten, im ganzen Lande die Häupter der Ständeschaften, neigen sich der ihre wirtschaftlichen Interessen geistig unterbauenden Bewegung zu. Sie waren Grundbesitzer, waren auf ihren böhmischen Grund und Boden angewiesen. Und auf das Heimatgefühl ihrer Untertanen. Kunst und Wissenschaft sind für sie schmückende Liebhaberei. So sehr aller Adelsstolz jetzt auch verachtet wird von den Adeligen selbst –; man ist doch durch alte Überlieferungen gebunden. Franz Graf Kinsky schreibt seine pädagogischen Werke »Zur Erziehung von Standespersonen«. Das Bürgertum jubelt aus viel lebensverwurzelterer Teilnahme einer Aufrufung der heimischen Kräfte zu. Der bürgerliche Gelehrte und Künstler sieht in seiner geistigen Beschäftigung die einzige Lebensaufgabe. Er gründet darauf seine Existenz. Auch wird durch die Ethisierung des Religiösen ein starker Trieb ins Irrationale frei, der sich, von ästhetischen Interessen gestärkt, auf die Suche nach altem Volkstum begibt. Man fühlt sich wohl als zur »teutschen Nation« gehörig, aber man betont, auch in den Kreisen der böhmischen Deutschen, die »slawische Abstammung«.
Man fängt an, alten Volksbräuchen nachzuspüren und sich der tschechischen Sprache anzunehmen. Der Abbé Dobrovský beginnt seine Grundlegung der slawischen Philologie, ein Bemühen, das im 19. Jahrhundert von bedeutender Tragweite werden sollte. Ja, jetzt werden Fälle immer häufiger, daß Deutsche zum Tschechentum übergehen. So Dobner und Voigt, die Piaristen, und Ungar und der Ritter von Neuberg. Besonders bezeichnend der Fall des schon erwähnten Historikers Pelzl. Erst unter dem Vater war die deutschstämmige Familie tschechisiert worden. Der Sohn hatte sich als Student noch an Klopstocks Oden begeistert. Jetzt aber bekennt er sich entschieden zu der vermeintlichen, der tschechischen Abstammung. Im Verlust der eigenen Sprache sieht er die Gefahren völliger Germanisierung für »sein Volk« wachsen. Man schwankt noch zwischen Vernunft und Gemüt. Im Sinne der Aufklärung hält man das Aufgehen der slawischen Sprache in der germanischen für begrüßenswert. Vom Gemütsstandpunkt –; und der verbindet sich hier in vielfacher Weise mit dem wissenschaftlichen –; wird dieser Vorgang bedauert. Aufklärung und Empfindsamkeit stehen gegeneinander. Dies alles natürlich innerhalb der selbstverständlichen Überzeugung, daß man der teutschen Nationalität zugehört, aber eben als Böhme. Dieser von den Tschechen nur in einer Teilbedeutung gefaßte Begriff –; wir erwähnten schon, daß die Tschechen für böhmisch und tschechisch nur einen Ausdruck haben –; war damals nicht rassemäßig, sondern landschaftlich bestimmt, also Deutsche wie Tschechen gleicherweise umfassend. Böhmischer Patriotismus war die Parole.
Seibts Wirkung war unter all dem nicht abgeschwächt. Er hatte ja die aus Leipzig mitgebrachten Kulturgaben der böhmischen Situation klug angepaßt, hatte vor allem die Schulreform großzügig ins Werk geleitet. Einer seiner Schüler, der k. k. Schulrat Kindermann, führte sie in Böhmen durch. Im Dezember 1774 hatte ein Hofdekret eine allgemeine Schulordnung für deutsche Haupt- und Trivialschulen veröffentlicht. Deren Verwaltung war der Universität vor kurzer Zeit abgenommen worden. Diese kaiserliche Sorge um den Jugendunterricht fügte sich den vielen andern Erlässen ein, die alle auf die Zentralisierung innerhalb der Monarchie hinarbeiteten. Schon im Jahre 1764 waren die Prager Maße und Gewichte abgeschafft, durch Einheitsnormierungen ersetzt worden. Zentralisierung und Rationalisierung spielen bei all dem immer ineinander. 1770 war die Bezeichnung aller Häuser und Gebäude mit Nummern angeordnet worden. Die sinnfällige Bezeichnung mit den Jahrhunderte alten Namen, die so viel Poesie und Legende in sich trugen, war damit entwertet, die Individualisierung wich der Numerierung (innerhalb der architektonischen Entwicklung hatten wir die Einordnung der Häuser in die Straßenflucht wahrgenommen). Bei der damals durchgeführten Zählung der Häuser und Einwohner stellte man insgesamt 2986 Häuser und 77.567 Einwohner ausschließlich der Juden fest (in der Altstadt 936 Häuser, in der Neustadt 1244, am Wyschehrad 66, auf der Kleinseite 541, am Hradschin 199).
Solche statistische Maßnahmen waren Unterlagen für geistige Reformen. Die Prager Normalschulkommission unter Kindermann ließ die Teynschule zu einer böhmischen Normalschule einrichten. Auch die übrigen Schulen, lauter Pfarrschulen, wurden nun auf dem Verordnungswege zu Normalschulen umgewandelt: St. Valentin (Kreuzherren mit dem roten Stern), St. Agnes (Clarissinnen), St. Castulus, St. Martin, St. Maria an der Lake (Magistratsschulen). Die Pfarreien, denen keine Schulen unterstanden, darunter St. Jakob, St. Ägidien, St. Galli, wurden zur Einrichtung von Schulen oder zu Kostenbeiträgen an andern bestehenden Schulen verpflichtet. Das Lateinische des höheren, das Tschechische des niederen Unterrichts wurden durch die deutsche Unterrichtssprache ersetzt. Seibts Bemühungen um die Errichtung und Hebung deutscher Volksschulen erhielten also die breiteste Unterlage. Das niedere Schulwesen wurde veredelt. Der neue, in den Schulen gebotene Bildungsstoff hob das allgemeine Niveau. Innerhalb von zehn Jahren zählte man in Böhmen die zehnfache Schülerzahl. Pelzl polemisierte gegen die dadurch betriebene Germanisation. Die Nationalisierung einer internationalen Kultur mußte zunächst den Deutschen zugute kommen.
So war es ja auch schon unter Sporck gewesen, dessen man als des Ahnherrn solcher Bestrebungen auf Verbodenständigung fremder Kultur an dieser Stelle gedenken muß. Seine Bemühungen um Verlebendigung alter deutscher Rechtsbräuche, seine Übersetzer- und Verlegertätigkeit hatten wir beschrieben. In Seibt trat nun der geistig disziplinierte Fortsetzer der Arbeit auf. Auch in der religiösen Sphäre treibt die Linie von Sporck zu Seibt. Sporck war der impulsive Verfechter einer subjektiven Religiosität in Böhmen gewesen. Seibt bezog das Religiöse ins Ästhetische ein, bewies z. B. das Dasein Gottes aus den Künsten, forderte auch verstärkten Einfluß des weiblichen Elements auf die Erziehung, auf die Sitten überhaupt, verherrlichte das »Ewigweibliche«. Dunkelmänner denunzierten ihn in Wien: ein Gottesleugner, ein unmoralischer Frauenschwärmer, der das dem Klerus verbotene weibliche Element über die kirchliche Zucht setze. So bleibt auch ihm der Prozeß nicht erspart. Eine Hofkommission hat ihn zu führen. Seibt verantwortet sich glänzend. Der Prager Erzbischof Pøichowsky von Pøichowitz urteilt in seinem Gutachten über die Tätigkeit Seibts durchaus sachlich, ohne zu verurteilen. Aber die Kaiserin ist streng kirchlich gesinnt, entzieht ihm die Moralvorlesung, fügt der Entscheidung aber begütigend hinzu, daß »vielen gelehrten und würdigen Männern eine Behebung oder Einstellung dieser oder jener anstößiger Sätze geschehen und dies eine unglückliche, aber keine entehrende Sache sei« (1797). Seibts Einfluß bleibt ungemindert. Einige Jahre später liest er wieder Moral. Die allgemeine religiöse Anschauung stand auf seiner Seite. Die Religion war ethisiert, war der Kirche immer mehr entglitten.
Die staatlichen Eingriffe in die kirchliche Autonomie sind nur Folge der allgemeinen geistigen Entwicklung. Die Febronianischen Ideen, die, um den Protestanten den Rückzug zur katholischen Kirche zu ermöglichen, die Stellung des römischen Papstes zum bloßen Ehrenvorrang unter den Bischöfen gemindert hatten, untergruben den kirchlichen Bau von innen her. Von außen werden die kirchlichen Behörden zu Staatsbehörden umgewandelt. Theologische Prüfungen werden von Wien aus geregelt. Alle theologischen Werke werden der kaiserlichen Zensur unterworfen (1772). Man spürt neben der kirchengläubigen Maria Theresia schon die Mitregentschaft des begeistert aufklärerischen Josef. Die Aufhebung des Jesuitenordens (1773) fügte sich dem allgemeinen Zug ganz gleichläufig ein. Sie war zwar vom Papst befohlen worden, Maria Theresia vollzog sie nur auf ausdrückliches römisches Gebot, wie sie auch in einer Verlautbarung betonte. Aber die dogmatisch-dialektische Lehre der Jesuiten war ja schon abgelöst durch die allgemeine Glückseligkeitslehre. So stand der Orden damals bereits im luftleeren Raum, seine Wirksamkeit war eigentlich nur mehr auf Protestieren und Intrigieren beschränkt. Für die Prager Geistesgeschichte aber war seine Aufhebung ein epochales Ereignis.
Alle Güter des Jesuitenordens wurden zu dem sogenannten »Studienfonds« eingezogen, die Klöster zu Kasernenzwecken verwendet. Das Clementinum entging dieser drakonischen Bestimmung; hieher wurde das nun erzbischöfliche Seminar verlegt, das dann von Josef II. zum Generalseminarium für den Weltklerus umgewandelt wurde. Die Clementinum-Bibliothek wurde mit der Carolinum-Bibliothek vereinigt. Seibt wurde Direktor der philosophischen Studien. Bei all dem vollstreckte der Staat nur die Wünsche des aufgeklärten Publikums. Das befriedigte seine seelischen Bedürfnisse in der Schöngeisterei. Das Theater sollte die nationale Bildung vermitteln.
Dieses Theater finden wir jetzt ganz anders unterbaut durch einen tragenden Willen des Publikums als noch vor zehn Jahren. Eine neue Generation tritt an, nicht nur im Herrscherhaus: der Einschnitt um 1780 ist in allen Kulturgeschichten jener Tage von der Architektur bis zum Büchermarkt deutlich. Diese neue Generation verlangt ihr Nationaltheater. Das Kotzentheater frettete sich unter Carl Wahr, der es übernommen hatte, armselig genug hin. Drüben auf der Kleinseite spielte seit 1781 im Thunschen Hause eine Dresdner Truppe. Der vom Dresdner Hof vertraglich verpflichtete Pasquale Bondini gab, vom opernhungrigen Adel gerufen, dort seine vielbesuchten Aufführungen von italienischen Opern. Die musikalischen Akademien im Kotzentheater waren keineswegs imstande, das Publikum zurückzuholen.
Da trat ein begeisterter Aristokrat mit großen Theaterplänen auf: Franz Anton Graf Nostitz-Rhineck. Er wollte das deutsche Theater von Grund aus reformieren. Er pachtete von der Stadt das Kotzentheater, nahm Wahr in seine Dienste, bezahlte seine Schulden. Das war aber nur der erste Schritt. Er dachte an ein neues Theatergebäude. Nahm den Plan auch gleich in Angriff. Der Neubau soll am Carolinplatz als Abschluß zur Rittergasse hin zu stehen kommen. Der Altstädter Rat, besorgt ob der dadurch drohenden Konkurrenz, protestiert. Das Carolinum protestiert. Die Anwohner protestieren: zu eng! Er nehme das Licht weg! Feuergefahr! Aber Josef II. unterstützt den Plan, Nostitz setzt den Bau durch. Von seiner Architektur haben wir oben gesprochen: ein Monumentalbau, der platzgestaltend in die Altstadt sich eindrängt. Die durch ihn verbaute »Promenade« wird durch den jetzt bis zur Moldau eingeebneten »Graben« ersetzt, auf dem statt stickiger Wassertümpel eine schöne Allee entsteht (1781). Der Teil vom Pulverturm bis zum Brückl war schon früher zur Spazierstraße eingerichtet worden.

Ständetheater (Landestheater) um 1830.
(Landestheater) von Vinz. Morstadt, ehemals Nationaltheater des Grafen Nostitz. Links: Carolinum, rechts: im Hintergrund Obstmarkt. Um 1830. Lav. Sepiazeichnung (Prag, Städt. Museum).
Während an dem neuen Theater gebaut wurde, wird noch im Kotzentheater gespielt. Madame Körner ist Liebling der Zuschauer. Wichtigste Aufführung: Schillers »Räuber« (1783), die beim Prager Publikum begeisterte Aufnahme finden. In der Oper brachte Bondini Mozarts »Entführung aus dem Serail« (1782), die die Prager zum erstenmal aufhorchen ließ auf die Klänge, die einen Genius ankündigten.
Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich. Graf Nostitz, jetzt Oberstburggraf, vertröstet die Prager in einem Aufruf: »… Sollen wir Böhmen allein eine Ausnahme machen und weniger deutsches Blut in unsern Adern fühlen? Diesen Vorwurf zu vermeiden, wird das Nationalspectakel in unserer Muttersprache mein Hauptanliegen sein …!« Muttersprache, das war das Deutsche. Wir dürfen in diesem Aufruf den Ausdruck der nationalpatriotischen Bewegung, wie sie seit dem vergangenen Jahrzehnt in Prag aufwuchs, sehen. Am Frontispiz sollte die Widmung stehen: »Dem Vaterlande«. Als »Patriae et musis« kam sie zur Ausführung.
Am 21. April 1783 kann das neue Haus feierlich eröffnet werden. Der Vertrag über das Kotzentheater läuft zunächst weiter, um Konkurrenz auszuschalten. Als Eröffnungsvorstellung wird Lessings »Emilia Galotti« festlich aufgeführt. Ein Glanztag im Theater- und Gesellschaftsleben Prags. Die »Oberpostamts-Zeitung« rühmt die großartige Beleuchtung des Hauses, den prächtigen Aufzug der Gäste. Der Direktionsausschuß besteht aus Wahr, dem uns schon bekannten, jetzt wiedergekehrten Bergopzoom, aus Hempel und Räder. Im Repertoire folgen: »Minna von Barnhelm«, »Philotas«, »Miß Sarah Sampson«, »Richard III.«, »Kaufmann von Venedig«. In »Julius von Tarent« von Leisewitz treten gar schon Erzbischof und Nonnen in kirchlichen Gewändern auf der Bühne auf.
Aber die Güte der Aufführungen entsprach nicht dem Niveau des Programms. Auch kaum dem Geschmack des Publikums. Das wurde nach den ersten Sensationen bald wieder hinübergelockt ins Thunsche Theater, wo Bondini nun auch mit einer glänzenden Schauspieltruppe aufwartete. Sein Regisseur war zuerst Brandes, dann Reineke, der genialste Theatermann der Zeit. Als Josef II. im Jahre 1783 zu Manövern nach Prag kam, äußerte er sich ungnädig über den neuen Theaterbau des Grafen Nostitz: er hätte an den Altstädter Ring gehört. Josef bevorzugt ostentativ das Bondinische Theater. Graf Nostitz zieht die Konsequenzen: er entläßt Wahr, engagiert Bondini für sein Haus. Der nimmt zu seinen Verpflichtungen in Dresden und Leipzig und im Thunschen Theater auch diese neue Verpflichtung noch an. Am Sonntag, Dienstag und Donnerstag spielt sein Schauspiel im Nostitz-Theater. Am Montag, Mittwoch und Samstag seine Oper abwechselnd im Thunschen und im Nostitzschen Theater. Freitag ist Normaltag. Bondini ist Italiener. Die italienische Oper blüht unter ihm noch einmal auf: Cimarosa, Traetta, Zanetti. Im Ensemble italienische Größen, neben ihnen auch schon einheimische Sänger wie Franz Hurka. Aber im »Nationaltheater« ist die Akustik schlecht. Das Publikum beklagt sich. Der Raum ist zum Ballsaal besser geeignet.
Bondini sucht um die Konzession für die Einrichtung eines solchen nach. Der Primator Wenzel Friedrich von Friedenberg protestiert: seit 1752 war seinem »Wussinischen« Haus die alleinige Abhaltung der Faschingsbälle gestattet. Dort vergnügte sich die große Gesellschaft, in der sich nun Adel und Bürgertum immer mehr mischten. Aber Bondini setzt die Bewilligung der Konzession durch. Dem Theaterbetrieb war dadurch nicht geholfen. Das Engagement der Schauspieltruppe Bulla war ein Mißgriff. Bulla muß abziehen. Man versucht es jetzt auch mit tschechischen Aufführungen. Tschechische Patrioten, die »Vlastenci«, bringen Übersetzungen aus dem Deutschen. Am 20. Januar 1785 findet die erste tschechische Aufführung statt. Im nächsten Jahr wird das von Wenzel Tham verfaßte tschechische Drama »Bøetislav und Jutta« gespielt. Im Personal finden sich Schauspieler, die beider Landessprachen mächtig sind. So ist die Aussprache gesichert. Aber das Publikum findet wenig Geschmack an der Neuerung. Als diese Bondinische Truppe aufgelöst wird, schließen sich einige dieser »utraquistischen« Schauspieler –; welche für die Zeit bezeichnende Begriffswandlung dieses ursprünglich religiös geprägten Wortes! –; zu einer Wandertruppe zusammen, die um die Aufführungskonzession für deutsche und tschechische Stücke in einigen Städten Böhmens nachsucht. Im Sommer 1786 errichtet dieser Kreis auf dem Roßmarkt (Wenzelsplatz) das »Vaterländische Theater« (»Vlastenské divadlo«), in dem man dem einfachen Volke neben den deutschen auch tschechische Aufführungen bietet. Professor Zlobický, der die damals in Wien gegründete Lehrkanzel für tschechische Sprache innehat, ist rührigster Vorkämpfer für diese Ideen. Wir müssen sie mit den oben umrissenen der »Bornianer« zusammen sehen, ohne doch unmittelbare Zusammenhänge festhalten zu können.
Wichtig, wie das offizielle deutsche Publikum diese Bestrebungen um eine tschechische Bühne aufnimmt. Mit größtem Wohlwollen! Die offizielle und immer liebenswürdige »Oberpostamts-Zeitung« schrieb damals: »… Aufklärung eines großen Teils des Publikums, das bisher unglücklich genug war, wenig gedruckte Bücher in seiner Sprache zu lesen …«, und Josef II. besucht in Begleitung seiner Generale eine Aufführung im Vaterländischen Theater, zahlt 30 Dukaten für die Karten. Allerhöchstes Interesse und das allgemeine Wohlwollen des Bürgertums sind der Volksbewegung sicher. Bondini wirbt neue Mitglieder für sein Schauspiel im Nostitz-Theater. Madame Sophie Albrecht wird als Darstellerin gefeiert. Aber das Schauspiel blüht nicht auf. Es ist die Oper, die das neue Theater zu einer Glanzzeit hinaufführt.
Musik hatte in Prag noch immer breitesten Boden. Als »Patriarch der Prager Tonkunst« wirkte Johann Anton Koželuh, Kapellmeister bei St. Veit, einer der gründlichsten Kenner des Kontrapunkts, Komponist von Oratorien, Messen und auch Opern. Ein bedeutender Klavierspieler und guter Komponist war Vinzenz Maschek, Chorregens bei St. Niklas auf der Kleinseite. In Johann Baptist Kuchaø besaß man einen berühmten Orgelspieler. Operndirigent im Nostitz-Theater war der geistreiche und hochgebildete Josef Strobach. In Domenico Guardasoni hatte Bondini einen ausgezeichneten Regisseur für seine Opern gefunden. Gesellschaftlicher Mittelpunkt dieser reichen Musikkultur war das Haus Duschek, das draußen in der »Bertramka« vor den Toren Smichows allen Kunstbegeisterten die schönste Idylle bot.
Franz Duschek war Pianist. Johann Karl Graf von Sporck war auf den talentierten Bauernjungen aufmerksam geworden, hatte ihn ausbilden lassen. Jetzt spielte er im Prager Musikleben eine führende Rolle, half jungen Talenten, lud gesicherte in sein Haus. Seine Frau Josepha, geborene Hambacher, glänzte als Sängerin, wurde auf ihren Konzertreisen viel umjubelt. Mozarts Vater, der sie in Salzburg, und Schiller, der sie in Weimar gehört hatte, urteilten allerdings recht abfällig über die »posierende« Pragerin. Aber sie war es doch, die den Ton geistig beschwingter Geselligkeit in jenes reizende Landhaus mitten im Vorstadtpark brachte. Ihre musikalischen Gesellschaften, zu denen Adel und Bürgertum sich drängten, waren beliebte Feste.
Die Duscheks hatten den jungen Mozart in Salzburg kennengelernt und drängten nun auf sein Kommen. Im Dezember 1786 führte Bondini »Figaros Hochzeit« auf. Der Beifallsjubel war unbeschreiblich. Kuchaø lieferte sogleich einen guten Klavierauszug. »Figaros Gesänge widerhallten auf den Gassen, in Gärten, ja, selbst der Harfenist bei der Bierbank mußte sein ›Non più andrai‹ ertönen lassen …« Allgemeine Begeisterung schlug dem Komponisten entgegen, als er auf Johann Josef Graf Thuns Einladung im Frühjahr 1787 nach Prag kam. Der Baron Breitfeld gab einen seiner berühmten Bälle. Die Gesellschaft huldigt ihm, die Musiker verehrten ihren Meister. Bondini schließt mit Mozart einen Vertrag auf 100 Dukaten für die Überlassung einer neuen Oper, die schon im kommenden Herbst aufgeführt werden soll.
Mozart reist ab, kehrt im Herbst mit dem unvollendeten »Don Giovanni« wieder. Auch der Textdichter, der Abbate Lorenzo da Ponte, kommt mit ihm nach Prag. Mozart wird bei den »Drei Löwen« am Kohlmarkt einquartiert, da Ponte gegenüber im Hotel Platteis. Von Fenster zu Fenster sollen Komponist und Dichter sich unterhalten haben. Auch Casanova, der alternde Abenteurer, der auf Schloß Dux beim Grafen von Waldstein ein Asyl gefunden hatte, soll damals nach Prag gekommen sein, seinen Landsmann da Ponte zu grüßen. Aber die schönsten Tage, die reichsten Arbeitsstunden –; die Oper muß noch beendet werden –; verlebt man draußen auf der »Bertramka«, wo liebende Menschen die Atmosphäre läutern. Ein Triumph die Uraufführung im Nationaltheater am 29. Oktober. Die Prager jubeln. Und Mozart dankt mit den Worten: »Meine Prager verstehen mich.« Wien hat ihn nicht verstanden.
Begegnung der Genien auf der Prager Bühne: das gleiche Jahr bringt Schillers »Don Carlos« nach Prag. Und wieder erkennt das Prager Publikum die wahre Größe, jubelt dem deutschen Heros zu.
Aber das »Vaterländische Theater« drüben auf dem Roßmarkt, an dem deutsch und tschechisch gespielt wird, setzt zu immer stärkerem Wettstreit an. Es braucht nun ein größeres Gebäude, die alte Bude genügt nicht mehr. Vor dem Spitteltor (Deutschherrenstraße), im sogenannten Rosenthal, wird das »Neue Vaterländische Theater« eingerichtet. Eine deutsch-tschechische Truppe spielt. Das Wohlwollen auch der Deutschen begleitet lebhaft diese Neugründung. Die »Oberpostamts-Zeitung« läßt sich am 24. April 1787 wieder vernehmen: »… Unseren böhmischen Landsleuten, die leider ohnedies genug unglücklich sind, jetzt wenig bildende und aufklärende Bücher in ihrer Muttersprache lesen zu können, einige Dienste zu erweisen …« Und die Roßmarktbude, in der auch noch gespielt wird, bringt in diesem Sommer gar ein sensationelles Zugstück heraus: das tschechische Drama »Žižka von Trocnov« von Tandler.
Graf Nostitz hat viel Mühe und Sorge um sein Theater. Jetzt holt er den vor Jahren verabschiedeten Carl Wahr als Schauspielleiter an seine Bühne zurück. Bergopzoom ist wieder Regisseur. Die neue Spielzeit wird mit Ifflands »Jägern« eröffnet (1788). Guardasoni hält mit verbissener Energie an der italienischen Oper fest. Er studiert sie gründlich ein. Aber das Publikum bleibt lau. Auch das Schauspielensemble zieht nicht. Nostitz will den Kampf schon aufgeben, will sein Theater verkaufen, bietet es den Ständen an. Die lehnen ab. Man lebt in den Jahren der josefinischen Reformen, ist auf der einen Seite begeistert, auf der andern verärgert. Suchen wir die Gründe!
Mit Josef II. war die junge Generation aufgerückt. Man spürte es in allen Zweigen des kulturellen Lebens. Die Aufklärung, bisher geistige Besinnung, wird nun politisch aktiv, organisiert die Welt um, zentralisiert und befreit in einem, erweitert und engt ein. Für den Erfolg der Bewegung um Verlebendigung der tschechischen Sprache ist der Erlaß bezeichnend, der die Stunden regelt, wann in der Teynkirche deutsch, wann tschechisch gepredigt werden soll. Und die Aufhebung der Leibeigenschaft, im Jahre 1781 bereitet durch Befreiung der Bauernmassen einer Volksbewegung den Boden.
Im gleichen Jahre das Toleranzpatent. Fanal geistiger Freiheit, wie der Rationalismus sie auffaßte –; Sterbegeläut aller Gegenreformation. Die Protestanten regten sich, tauchten aus der Verborgenheit auf, gründeten ihre Kirchen. Deutsche und Tschechen halten zuerst gemeinsamen Gottesdienst (in der Tischlergasse). 1791 lösen sich die Deutschen unter der Augsburger Konfession ab und kaufen die St.-Michaels-Kirche in der Neustadt –; Josef II. hatte diese alte Kirche 1787 aufgehoben, 1789 war sie um 800 Gulden verkauft worden –;, sie durften sie aber nur als Bethaus benutzen, ohne Glockengeläute. Die Tschechen erwarben später die ehemals deutsche, dann dem Paulanerorden übergebene Salvatorkirche in der Altstadt.
Überall wird religiöse Freiheit gepredigt. Das Glaubensbekenntnis wird bei der Anstellung der Beamten beseitigt. Das wirkt vor allem im Universitätsbetrieb, wo die Professoren ja nur auf das katholische Bekenntnis hin angestellt wurden. Auch der Schwur auf die Unbefleckte Empfängnis Maria fällt. Juden werden zugelassen. Die erste Bresche in die Ghettomauern ist geschlagen. Die neue Studienordnung rückt die Naturrechte in die Mitte des Studienbetriebes. Die deutsche Sprache wird an die Stelle der lateinischen als Vortragssprache gesetzt. Ausgezeichnete Lehrer wirken jetzt an der Prager Universität. Noch lehrt Seibt, begeistert die Jugend. Neben ihm Josef Ignaz Buèek, Sonnenfelsianer, Lehrer der politischen Wissenschaften. Aus dem Jesuitenorden, der seine feinsten Geister an die Wissenschaft abgab (Dobrovský!), war Ignaz Cornova als Lehrer der Weltgeschichte an der weltlichen Universität geblieben. Kaspar Royko dozierte eine moderne Theologie. Eine seiner Thesen: Hus sei zu Konstanz unschuldig verbrannt worden. Aus Dresden wird nun gar ein Protestant berufen: August Meißner wird Professor für Ästhetik und klassische Literatur. Begeisterte Jugend lauscht der neuen Weisheit. Es war eine hohe Zeit für das Prager Studium.
Aber unter der neuen Freiheit doch überall merkliche Beschränkung der Universität an Selbständigkeit. 1783 waren sämtliche Universitätsgüter der Staatsgüteradministration unterstellt, waren sowohl der Judizialsenat der Universität wie die Provinzialstudienkommission aufgelöst worden. Die Universitätsangehörigen waren fortan der Gerichtsbarkeit des einen Magistrats unterstellt, unter dem die vier Städte neuerdings vereinigt worden waren.
Die Zentralisierung der Magistrate (1783/84) beendet eine vielhundertjährige Sonderentwicklung der vier Gemeinden. Aber nicht zu größerer Machtstellung der Gesamtstadt gegenüber dem Herrscher wie unter Pašek (vgl. oben S. 130), sondern im Gegenteil zu schärferer Einordnung unter das von Wien ausgehende System. Statt Primatoren und vierwöchentlich wechselnden Bürgermeistern sollte nun ein einziger Bürgermeister auf vier Jahre gewählt werden, dem der Titel k. k. Rat verliehen wurde. Die verschiedenen Obliegenheiten der städtischen Verwaltung wurden unter den 24 Räten des Magistrats genau aufgeteilt. Ein Bürgerausschuß von 40 Mitgliedern (Altstadt 13, Neustadt 12, Kleinseite 10, Hradschin 5) hatte die Wahlen vorzunehmen. Sitz des neuen Magistrats wird das Altstädter Rathaus, das entsprechend erweitert wird. Mit wehmütigen Gefühlen nahm man von der alten Ordnung Abschied, just in dem Winter, als ein starker Eisgang die alte Brücke fast zum Einsturz gebracht hätte (1784).
Was der weltlichen Organisation, der freien Wissenschaft zugute kam, das wurde der Kirche genommen. Die Ethisierung der Religion wurde schonungslos durchgeführt, alles Paradoxe mit unerbittlicher Hand ausgerottet. Nur Seelsorge und allenfalls noch Erziehung, diese aber auf staatlich rationalistischer Grundlage, berechtigen die Kirche zum Dasein. So griff nun Verordnung auf Verordnung in das Kirchenleben ein. Die Prozessionen werden eingeschränkt, das Küssen der Reliquien verboten, Ablässe für Unsinn erklärt. Vor allem: auf dem ganzen kirchlichen Gebiet wird Rom zurückgedrängt. Für alle päpstlichen Erlässe wird das Placetum Regium gefordert, Konsistorialerlässe und Direktorien unterliegen der Approbation durch die Landesbehörde. Nur mehr die kaiserliche Zensur hat jetzt Geltung auch für die religiösen Schriften. Unter der neuen Pressefreiheit und dem Vordringen der Illuminaten drängt sich manch oberflächliche Aufklärung in die religiöse Literatur herein. Erziehung und Anstellung der Seelsorger werden kaiserlich geregelt. Das Priesterseminarium im Clementinum, ehedem erzbischöflich, wird kaiserliches Generalseminarium. Der Pfarrkonkurs findet nur mehr unter staatlicher Aufsicht statt.
Und es sanken die Klöster. Wo nicht Seelsorge, Schule oder Krankenpflege das Bestehen rechtfertigten, mußten die Mönche, die Nonnen, diese »Fakirs«, ausziehen, ihre Häuser und Besitzungen dem Religionsfonds überlassen, der zu philantropischen Einrichtungen verwendet wurde. Es wurden aufgehoben: die Carmeliterinnen bei St. Josef, die Benediktinerinnen bei St. Georg –; Böhmens ältestes Kloster! –;, die Dominikanerinnen bei St. Anna, die Cölestinerinnen in der Neustadt. 1783 verschwanden die Cajetaner, die Trinitarier, die Dominikaner bei St. Maria Magdalena, die Serviten in Slup, dann auch die Paulaner in der Altstadt, die Augustiner bei St. Wenzel, die am Karlshof, die Kreuzherren am Zderaz, die Benediktiner bei St. Niklas in der Altstadt und bei St. Johann am Felsen. Mehr als 60 Kirchen wurden profaniert, zu Lagerhäusern oder Kasernen umgewandelt, an Private verkauft und so dem späteren Abbruch preisgegeben.
Viel alte Kultur sank mit dem »Aberglauben« dahin. Und die Kasernenkultur der neuen Ära, wie die Generale des Kaisers sie durchsetzten, brachte das neue Licht oft in recht anderm Sinn, als der großdenkende Herrscher geträumt hatte. Er gab die Befehle aus seinem großzügigen geistigen System heraus, einseitig rationalistisch, immerhin voll hoher Ziele für die Menschheit. Die jedoch diese Befehle ausführten, waren nur zu oft ärmliche Subalterne, die den Geist der Verfügung vielfach zur Fratze herunterrissen. Nicht nur auf dem Gebiet des Kirchlichen. Auch in Kunstdingen kamen mitunter arge Mißgriffe vor. Trauriges Exempel das Ende der Rudolfinischen Kunstkammer.
Wir haben sie seit der Wiederaufrichtung unter Leopold aus dem Auge verloren. Karl VI. hatte einiges nach Wien geführt. Unter Maria Theresia war manches verkauft worden. Österreich brauchte Geld für seine Kriege. Diese Galerie stellte ein gut verwendbares Kapital dar. Vor allem ein Verkauf nach Sachsen, bei dem ein Italiener und ein Jesuit eine etwas dunkle Rolle gespielt haben, entführte reiche Schätze nach Dresden: 69 Bilder, darunter Rubens' »Wildschweinjagd« und van Dycks »Karl I. mit seiner Gemahlin« wanderten um den Preis von 50.000 Talern in die Galerie an der Elbe (1749). Kurz darauf wird wieder verkauft, diesmal auch nach Petersburg. Correggio, Tizian, Rembrandt, Velázquez sollen darunter gewesen sein. Und anderes kam nach Wien. Was übrig blieb –; es war noch genug –;, wurde beim zweiten Einfall der Preußen »geborgen«. Man befürchtete von Friedrich ähnliche Räubereien wie von Königsmarck. Unterm Donner der preußischen Kanonen wurden in aller Hast Bilder und Statuen, Waffen und Porzellan, Münzen und Kameen in die in den Felsen gesprengten Gewölbe unter der Burg geschafft, wüst aufeinandergeschichtet, ihrem Schicksal überlassen. Als die Kriegsläufte vorüber waren, hatte man sie vergessen. Im Jahre 1781 soll die Galerie immerhin noch einige Stücke von van Dyck, Rubens, Teniers d. J., Giulio Romano, Paolo Veronese, Caravaggio, Tintoretto, Champaigne, Brandl u. a. enthalten haben. Josef II. ließ das meiste nach Wien überführen.
Zur Farce wurde dieser Zerfall der »Kunstkammer Europas«, als in diesem Jahr 1781 die vor den Preußen versteckten Schätze ans Tageslicht kamen: die Burg sollte zur Artilleriekaserne umgewandelt, die Felsenkeller als bombensichere Pulvermagazine verwendet werden. Eine Kommission von Artillerieoffizieren untersuchte die Gewölbe. Da stieß man auf jene klafterhoch aufgeschichteten, zum größten Teil zertrümmerten Schätze Rudolfs II. Da lagen Büsten, Statuen, Vasen, Götzenbilder, Schnitzereien von Elfenbein und Holz, Skulpturen von Stein und gebranntem Ton, altertümliche Musikinstrumente, Rüstungen roh und sinnlos aufgeschüttet, wüst durcheinander. Man staunte und lachte, ließ das Gerumpel in Körben nach oben schaffen, sandte das »Brauchbare« nach Wien, warf alles übrige zusammen und bot es in öffentlicher Versteigerung aus. Diese Versteigerung am 13. und 14. Mai 1782 muß das Groteskeste gewesen sein, was im »Kunsthandel« je sich abgespielt hat. Höchst summarisch wurde verfahren. »Die in Fäßchen zusammengepreßten Steine wurden bloß nach der Farbe inventiert, z. B. die Lapislazuli als blaue, die Chrysoprase als grüne, die Topase als gelbe Steine. Die goldenen und silbernen Bullen und Wachssigille wurden von den Diplomen gerissen und bildeten eigene buchhalterische Empfangsposten, während die Urkunden und Majestätsbriefe bloß als Pergament und altes Papier mit in den Kauf gegeben wurden … Die Ilioneusstatue, die im Keller Kopf und Arme verloren und daher im Staube zu einem unscheinbaren Torso wurde, figurierte da als eine ›kniende Mannsperson von weißem Marmel, der Kopf abgebrochen‹, ja nach einem andern Berichte sogar als ›Eckstein von Marmor‹, während Heintzens Kopie nach Correggios ›Leda‹ als ›ein nacktes Weibsbild, von einer bösen Gans gebissen‹ … verzeichnet erschien …«
Für Spottpreise wurden Meisterwerke abgegeben. Die Käufer mußten sofort das erstandene »Gerümpel« abführen. Der ständische Buchdrucker Johann Ferdinand Ritter von Schönfeld brachte auf diese Weise seine nachmals berühmte Sammlung zustande, die später um hohen Preis in den Besitz des steirischen Barons Dietrich überging. Höhepunkt des Spektakels war die Ausbietung des Ilioneus-Torsos. Der Ausrufer setzte ihn mit 50 Kreuzern an. Alles lachte. Ein bekannter Antiquar, namens Helfer, ein getaufter Jude, hatte viel ersteigert. Nun redeten ihm die Umstehenden zu, doch auch diesen Marmorblock zu kaufen, er nehme doch allen Quark. Und Helfer, nach seinem Lieblingswort »Laudon« genannt, bot 51 Kreuzer. Niemand machte ihm den Block streitig. Er wurde ihm für diese 51 Kreuzer zugeschlagen. Hans von Aachen hatte vor 200 Jahren in Rom 34.000 Dukaten dafür erlegt. So schob der alte Jude mit der Antike auf dem Karren ab, war aber froh, als ihm der Kleinseitner Steinmetz Malinsky kurz darauf vier Gulden dafür bot: der Stein ließ sich vielleicht anderweitig verwerten, zum Beispiel als Material für Stockknöpfe, wie sie damals beliebt waren. In dessen Werkstatt bemerkte ihn der Prager Universitätsprofessor Ehemant, erzählte davon dem eben in Prag weilenden Wiener Antikensammler Barth. Der eilte hin. Malinsky war unterdes gestorben, seine Witwe hatte aus dem Kopf, den die Versteigerungskommission dem Käufer nachgesandt hatte, schon die Knopffabrikation beginnen lassen. Empört und froh zugleich, erstand Barth den Torso für sechs Siebzehner, schaffte ihn nach Wien und stellte ihn in seiner Kunstsammlung auf. Dort sah ihn zur Zeit des Wiener Kongresses der Kronprinz von Bayern, der nachmalige Ludwig I., er bot sofort 6000 Dukaten. So gelangte der berühmte Ilioneus-Torso in die Münchner Glyptothek.
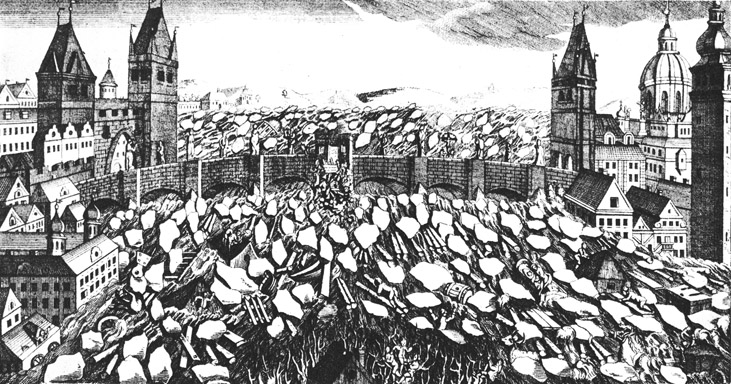
Eisgang auf der Moldau 1784
Dies war das Ende der glorreichen Rudolfinischen Sammlung: eine Schande für Prag, eine Schande für die Zeit. Die hatte für bildende Kunst wenig Interesse. Wie auch die Architektur unter ihr verdorrte, haben wir oben gesehen. Josefs Maßnahmen gegen Kirchen und Klöster beraubten die Künstler der großzügigen Auftraggeber. Der Bildhauer Ignaz Platzer, dessen großer Betrieb plötzlich beschäftigungslos wurde, mußte Insolvenz anmelden. Aber die äußere Situation entsprach eben nur einer inneren. Die gestalterischen Leidenschaften gingen damals nicht in die freie Bildnerei, sondern in den Begriff. So gediehen Literatur und ihr mimischer Ausdruck, das Theater. Was hier an Irrationalem sich nicht binden konnte, trieb in die Musik oder aber in die Spekulationen der Illuminaten und in die philanthropischen Bestrebungen.
Die schufen damals viel Gutes. Schon im Jahre 1773 hatte die Hauptloge der Freimaurer ein Waisenhaus in der Clemensgasse gegründet. Seibt wurde der erste Vorsteher. 1786 folgte die Loge »Zu den neun Säulen« mit der Gründung der Taubstummenanstalt (gegenüber dem Neustädter Rathaus). 1790 wurde das allgemeine Krankenhaus gegründet. Wissenschaftliche Bestrebungen verflochten sich ins Philanthropische. Joseph Emanuel Graf Canal von Malabaila hatte in den Weinbergen einen großen öffentlichen Garten mit einer botanischen Lehranstalt angelegt. Man bewunderte die »zierliche« Ausschmückung. Auch das Naturgefühl wird auf dem Wege über die Empfindsamkeit vom Begrifflichen umklammert.
Aber nur aus einem freien Naturgefühl hätte eine neue Bildkunst, die von der Architektur nicht mehr gehalten wurde, erblühen können. Ein Norbert Grund war mit seinem Schaffen recht im Verborgenen geblieben. Verwunderlich –; war doch gerade er ein bezeichnender Künder damaliger Lebensstimmung. Er war in der Lehre seines Vaters in die heimische barocke Tradition der Reiner, Brandl, Balko und anderer hineingewachsen. Dann hatte er Wien und Venedig kennengelernt. Die italienische (barocke) Komposition wirkt in ihm nach. Aber er zwingt sie auf kleinstes Format, mischt ihr aufs Monumentale zielendes Wesen mit neuen, ganz intimen Zügen. Die großen Vorwürfe werden ins »Niedliche« zurückübersetzt. Gedanke und Empfinden arbeiten in merkwürdiger, oft sehr reizvoller Durchdringung. Die farbige Behandlung ist immer voll zarter »Empfindung«. (Die »Galerie patriotischer Kunstfreunde«, jetzt Staatsgalerie, birgt einen reichen Bestand seiner heute geschätzten Bilder.)
Aber die Zeit, die er doch so treffend ausdrückte, war ihm nicht gnädig. Die hielt noch an der überkommenen soziologischen Schichtung fest, in der Adel und Kirche den Künstler versorgten. Grund aber war schon der ausgesprochen bürgerliche Maler, das Bürgertum erkannte ihn noch nicht. Und für die großen kirchlichen Aufträge, die damals ja ohnedies immer seltener wurden, war Grund nun ja wirklich nicht der gegebene Künstler. So lebte er in großer Not, mußte seine Bilder in Wirtshäusern auf der Kleinseite –; wo er wohnte –; und auf dem Kohlmarkt verkaufen. Mühevoll schleppte er sich durch bis zum ruhmlosen Untergang.
Ansporn zu neuer Schätzung eines bildhaften Ausdrucks mußte schließlich doch von jenem in der Literatur erwachten Ideal des »Patriotismus« ausgehen. Im Jahre 1796 fanden sich einige Aristokraten und Bürger zusammen zur Gründung einer »Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde«, die zunächst einmal sammeln wollte, was aus Böhmens glänzenden Kunstzeiten an Werken der Malerei und Skulptur noch vorhanden war. Denkt man an die oben berichtete Versteigerung, muß man sagen, daß sie um wenige Jahre zu spät gegründet worden ist. Immerhin kam durch Stiftungen von Adligen und aus den Schätzen der aufgehobenen Klöster doch ein Grundstock zusammen, an den sich im Laufe des nächsten Jahrhunderts eine ansehnliche Galerie ansetzen konnte.
Für die Zeitkultur waren andere Verwirklichungen dieses Patriotismus wichtiger. Aus den »Abhandlungen einer privaten Gesellschaft«, die aus dem Kreise der Bornianer erwachsen war, hatte sich eine gefestigte Organisation von Gelehrten entwickelt, welche Ergebnisse ihrer Forschungen aus der vaterländischen Geschichte herausgaben. Im Jahre 1785 hatte sie Josef II. als »Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften« bestätigt. Dobner, Pelzl, Dobrovský waren die Führer. Wie sich diese Gesellschaft immer eindeutiger tschechisch ausrichtete, werden wir in den nächsten Kapiteln zu verfolgen haben. Sie wurde Keimzelle für die starke Bewegung, die das geistige Bild Prags entscheidend verändern sollte. So war es doch Josef II., der »Zentralist und Germanisator«, der »Despot«, der mit seiner Kulturpolitik gerade für die Erweckung des tschechischen Volkstums die ersten Wege ebnete.
Als er starb (1790), wankte sein Werk. Seine Reformen waren zu plötzlich gekommen und auch –; obwohl ein großes Herz dahinter stand –; zu sehr aus dem Verstand, als daß eine unberechenbare Wirklichkeit krisenlos hätte hineinwachsen können. Erste Reaktion noch im Todesjahr des großen Kaisers: die Bitte der Stände, alle josefinischen Reformen zurückzunehmen. Dies zu tun, mußte Josefs Bruder Leopold II. nach den Erfahrungen, die er in Toskana mit seinen radikalen Reformen gemacht hatte, nur allzu sehr geneigt sein. In den Reihen des Adels, der Freimaurer war ja immer ein stiller Widerstand gegen Josefs Reformen lebendig gewesen. Er kam der tschechischen Sprache zugute: bei Leopolds Königskrönung soll der böhmische Adel, auch wenn er kaum darin bewandert war, ostentativ tschechisch gesprochen haben.
Schatten solcher Reaktion umdüsterten Mozarts letzten Aufenthalt in Prag. Im Jahre 1791 sollte die Krönung Leopolds mit großem Prunk in Prag gefeiert werden. Bedeutende Vorbereitungen wurden getroffen: Triumphbögen, Fahnenmaste, große Tribünen, auch ein großer, von den Ständen errichteter Vorbau vorm Nationaltheater. Das alles verlieh der Stadt ein festliches Ansehen. So erblickte sie Schiller, als er von Karlsbad aus mit Frau und Schwägerin und dem begleitenden jungen Arzte Doktor Eicke die Stadt Wallensteins besuchte. Graf Prokop Lažanský war dem Dichter damals der liebenswürdigste Führer.
Nun kam die Krönung. Ein ungeheuerliches Programm von Feierlichkeiten war abzuwickeln. Im Mittelpunkt sollte die Aufführung der Krönungsoper im Nationaltheater stehen. Die Komposition war Mozart anvertraut worden. Er war hergereist, um in der so geliebten Stadt die erst begonnene Oper zu vollenden. »La Clemenza di Tito« sollte auf die Milde des Herrschers anspielen. Das konnte nicht eben aus des Genius tiefstem Herzen kommen. Auch mußte gehetzt, teils im Reisewagen, teils in den Prager trubelnden Festtagen, komponiert werden. Dazwischen hatte er den »Don Giovanni« im Nationaltheater zu dirigieren. Die kaiserlichen Herrschaften waren anwesend. Aber die laute Atmosphäre dieser Tage war echter Kunst nicht günstig. Da hatten Salieri, der mit der kaiserlichen Hofkapelle aus Wien gekommen war, mit seiner italienischen Musik und der gern intrigierende Leopold Koželuh, ebenfalls aus Wien, der Prager Musikpatriarch, mit seiner etwas schwülstigen Zeremonienmusik bei der Hoftafel viel mehr Beifall. Ja, die Aufführung der Krönungsoper war denn auch wirklich ein Mißerfolg, zumindest angesichts der großen Erwartungen, die der Komponist und die ehrliche Kunstgemeinde darauf gesetzt hatten. Die kaiserlichen Herrschaften verhielten sich reserviert, das Publikum blieb kühl. Enttäuscht und müde reiste der damals schon kranke Mozart zurück nach Wien.
In Prag aber rauschten in großer Aufmachung die Feste weiter. An der Marienschanze lockte der »Persianische Jahrmarkt«. Auf den Bubentscher Höhen führte Blanchard seinen 42. Aufstieg im Ballon vor. Des Abends erglühte Prag in prächtiger Illumination. Auch das Vaterländische Theater wurde damals von den Majestäten besucht, eine tschechische und eine deutsche Aufführung wurden dort angehört. Ebenso wurde Secondas Theater im Thunschen Hause beehrt. Rauschende Wochen über einer schleichenden Reaktion.
Man spürte von dieser Reaktion äußerlich noch wenig –; wenn man nicht solch lautes Nach-außen-Treten einer Feier schon Reaktion gegenüber wirklicher Kultur nennen will. Mozarts Prag-Traum war darunter erloschen. Jetzt erlag er in Wien seinem Leiden, einsam, fast unbeweint (5. Dezember 1791). Aber seine Prager rüsteten ihm die Totenfeiern. Am 14. Dezember fand zu St. Niklas auf der Kleinseite die Totenmesse (unter Strobach) statt, ein ergreifender Abschied, und am 13. Januar ward im Nationaltheater in würdig feierlicher Akademie des toten Meisters gedacht.
Doch das Leben fließt weiter. Drei Theater spielten in Prag. Das Vaterländische Theater im Rosental war trotz der zugkräftigen Possen zugrunde gegangen. Von 1790 ab wurde es im Bibliothekssaal des aufgelassenen Hibernerklosters von Mihule weitergeführt und merklich gehoben. Die Brüder Tham lieferten Übersetzungen von Molière, Kleist und Schiller. Auch deutsch wurde gespielt, ja, die besseren Aufführungen waren zweifellos die deutschen. So konnte Mihule nun gar das Schauspiel des Nationaltheaters pachten. In seiner Oper brachte er 1792 sogar die »Zauberflöte«. Dann löst ihn Vasbach in der Theaterleitung ab. Am Nationaltheater war Spengler Unterpächter des alten Guardasoni geworden. Die Konkurrenz zwischen den drei Theatern wird immer schärfer. Da brach im Thunschen Theater ein arger Brand aus und erledigte diese Bühne für immer. Im gleichen Jahr starb der edle Theaterenthusiast Franz Anton Graf von Nostitz. Seine Erben knüpfen die Verhandlungen mit den Ständen zwecks Übernahme des Theaters wieder an. Sie führen zum Erfolg. Im Jahre 1798 geht das Nationaltheater um den Preis von 60.000 Gulden, die zum Teil in Obligationen gegeben werden, an die Stände über. Bald darauf wird auch das »Vaterländische Theater«, das nach Räumung des Hibernergebäudes im Refektorium des Maria-Magdalenenklosters auf der Kleinseite weitergespielt hatte, mit dem »Ständischen Nationaltheater« vereinigt. Guardasoni verhätschelt noch immer seine italienische Oper, vernachlässigt das Schauspiel. Aber mit Carl Liebich als neuem Oberregisseur hebt es sich zu neuer Glanzzeit empor. Die wird uns später beschäftigen.
Überblicken wir noch einmal die geistige Gesamtlage des ausgehenden Jahrhunderts. Die stärkste Kraft, die es gebracht hatte: der böhmische Patriotismus, trieb weiter. An der Universität hatte er die feste Stütze. Leopold hatte die Studienangelegenheiten, die Josef zentralistisch von oben geregelt hatte, wiederum den Professoren übergeben. Studienkonferenzen wurden eingeführt und durch alle Schulen durchgehend Lehrerversammlungen. (Erst Franz II. hob diese Freiheiten wieder auf [1802].) Im Jahre 1793 war dann –; schon unter Franz II. –; ein Lehrstuhl für die tschechische Sprache errichtet worden. Pelzl wurde als Professor berufen. Aber die ganze patriotische Bewegung sollte doch ins Österreichische wieder abgefangen, sollte vor allem vor den Einflüssen der französischen Revolution, die bei den Ästheten zündete, behütet werden. Joseph Anton von Rieggers »Lieferungen für Böhmen aus Böhmen« (1793) bahnten die neuen Gleise, und wirklich trafen sich beide Parteien der patriotischen Bewegung, sowohl Seibtianer wie Bornianer, in der neuen Richtung. Man stand treu zu Österreich.
Die beiden Theater spiegeln die damalige Stimmung. Erzherzog Karl hatte Österreich aus großen Kriegsgefahren gerettet (1796). Alles jubelte ihm zu. Auf dem Nationaltheater wurde als Festspiel gegeben »So denken gute Österreicher«, und das damals noch selbständige Vaterländische Theater beeilte sich, seine Ergebenheit in dem tschechischen Festspiel: »Die Tschechen sind wahre Patrioten« oder »Blut und Leben für Franz, Carl und Vaterland« zum Ausdruck zu bringen.
Auf Grund solcher Einigkeit konnte dann ein Jahrzehnt später die deutsche Freiheitsbewegung nach Prag hereinzünden. Um die Jahrhundertwende hatte man in Prag den Krieg auf die verschiedenartigste Weise zu fühlen bekommen. 1796 waren die ersten gefangenen Franzosen eingebracht worden. Damals kam auch die unglückliche Tochter der Marie Antoinette nach Prag. Und Admiral Nelson war mit Lord und Lady Hamilton durchgereist. 1800 hält der russische General Suworow in Prag Stabsquartier, seine Soldaten lagern draußen. Der Aufruf Kaiser Franz' zur Landesverteidigung hatte 600 Studenten in die »Böhmische Legion« getrieben. Der Friede von Lunéville bringt zunächst Ruhe.
Aber 1805 bricht der Krieg wieder los. Feindliche Scharen streifen schon bis Klattau und Tabor. In Prag bringt man eiligst die kostbaren Kirchengeräte und die Gebeine des heiligen Johannes von Nepomuk in Sicherheit. Die Teuerung nimmt zu. Da beruhigt noch einmal der Preßburger Friede. Französische Flüchtlinge waren nach Prag gekommen: Prinz Henry Rohan, Marquis Favres, der alte Fürst von Ligne. Kaiser Franz hatte die Kaiserwürde des heiligen römischen Reiches deutscher Nation niedergelegt. Böhmen war kein deutsches Kurland mehr. Und doch sollte es nun tief in die deutsche Sache hineingezogen werden. Es kamen die Flüchtlinge aus Deutschland. Friedrich Gentz, der von Napoleon geächtete »misérable scribe«, als erster. Er läßt sich hier nieder, verwickelt sich in Romane, glüht für Deutschlands Befreiung und schreibt seinen »Prager Brief« gegen Johannes von Müller, der so »politisch« zum Napoleonkurs hinübergeschwenkt war. Und Gneisenau taucht auf, will hier in Prag seine »Preußische Legion« aufstellen.
In Scharen kommen die deutschen Flüchtlinge nun über die Grenze, finden in Prag ein Asyl. Karl von Nostitz will aus ihnen seine »Fränkische Legion« bilden. Sogar der erbärmliche Kurfürst Wilhelm von Hessen, den Napoleon aus seinem Land vertrieben hatte, erscheint in Prag, um hier sein bezopftes Hilfskontingent zusammenzubringen. Im Mai 1809 kommen Friedrich Christoph Dahlmann und Heinrich von Kleist. In seinem Quartier in der Kleinseitner Brückengasse liest der Dichter dem Freunde die »Hermannschlacht« vor. Bei dem gastfreundlichen Grafen Kolowrat liest er seine Aufsätze, die in der »Germania« –; in Prag will er die Zeitschrift herausgeben –; erscheinen sollen. Aspern weckt Hoffnung, Wagram stürzt in Verzweiflung. Der Schönbrunner Friede besiegelt die grausame Lage. Und Nostitz wandert in Untersuchungshaft. Österreich ist schon Vasall des Korsen. Aber in der Armee lebt Empörergeist. Alle Flüchtlinge werden jetzt österreichische Offiziere, auch Ernst Pfuel, der spätere preußische Ministerpräsident, und Varnhagen von Ense, der zwischen Kampfrufen und Garnisondienst das Prag jener Tage beschreibt.
Im Jahre 1810 kommt Karl Freiherr vom Stein. Er hatte 1808 der Napoleon-Politik in Berlin weichen müssen. In Prag fand er in den Grafen Sternberg treue Freunde, lebte im Sommer auf deren Schloß Troja, im Winter in der Brentegasse. Er sammelt die Häupter der deutschen Bewegung um sich. Auch der böhmische Hochadel ist auf seiner Seite: die Thun, Nostitz, Czernin, Wrtby, Kolowrat. Alle hassen den großen Franzosen. In ihrem Kreis liest Stein Arndts »Geist der Zeit« vor. Er befaßt sich mit dem Land, in dem er Asyl gefunden hat, arbeitet »Grundzüge einer österreichischen Unterrichts- und Bildungspolitik« aus, verfaßt die »Geschichte des Zeitraumes von 1789 bis 1799«, macht der Wiener Regierung Finanzreformvorschläge. Seine Stellung zu Prag, zu Böhmen: »Ich werde dies Land der Gutmütigkeit und Rechtlichkeit nie verlassen.«
Er verließ es aber schon nach zwei Jahren. Die Heirat zwischen Napoleon und der österreichischen Kaisertochter hatte alle Patrioten empört. Als Kaiser Franz mit Gemahlin und Tochter aus Dresden, wohin ihn der Diktator Europas befohlen hatte, zurückkam, vermochte die Patriotenpartei ihren Ingrimm kaum zu verhehlen. Nur Rußland konnte noch helfen. Stein wurde vom Zaren Alexander eingeladen, nach Petersburg zu kommen. Er reiste hin, von dort aus nachdrücklicher gegen Napoleon, für Deutschland zu wirken. In Prag versucht der aus Berlin vertriebene ehemalige Polizeichef Justus Gruner eine über ganz Deutschland verzweigte Agentur zugunsten einer Volkserhebung einzurichten, spinnt seine Fäden zu allen verborgenen Zirkeln in Deutschland, konspiriert mit Rußland. Die Chefs der Calveschen und der Widmannschen Buchhandlung scheinen Gruners Pläne gefördert zu haben. Arndt kommt auf der Reise nach Rußland durch Prag. Auch Scharnhorst. Die Atmosphäre hier gab Zutrauen. Nicht nur die Kolonie der Flüchtlinge trug die Befreiungsidee, nicht nur der Adel, die deutschen Bürger sympathisierten mit ihr. Auch die Tschechen sind gegen den Bedrücker Europas: der sanftmütige Dobrovský wünscht ihm den alten Žižka mit seinen Scharen an den Hals und auch Jungmann, dieser aber vielleicht mehr aus slawophilen Beweggründen, die damals erste Nahrung erhielten, er träumt von Rußlands Siegen. Nur Goethe bleibt dem Prager Freiheitstreiben fern, weilt in Teplitz.
Aber Metternich macht kühle Politik, läßt Gruner verhaften und schickt ihn nach Peterwardein. Der Freiheitsruf des Preußenkönigs ist ihm denkbar unsympathisch: da würden nur demokratische Umtriebe beschworen. Aber Napoleons unglücklicher Rußlandzug hatte die Situation doch merklich gewendet. Stein kehrt nach Prag zurück (Mai 1813). Scharnhorst, bei Groß-Görschen verwundet, reist, vom Wundfieber geschüttelt, nach Wien, um Österreich zum Anschluß zu bewegen. Metternich weist ihn an den Generalissimus Schwarzenberg, der in Prag steht. Dort trifft der Sterbende den Generalstabschef Radetzky: der untergehende Reformator der preußischen Armee den aufgehenden Stern der österreichischen. Am 28. Juni erliegt Scharnhorst in Prag seinen Wunden.
Am 5. Juli beginnt die Farce des »Prager Kongresses«, die Metternich »für das Publikum« aufgezogen hat. Als Preußens Vertreter ist Wilhelm von Humboldt delegiert. Unter leeren Formalitäten verstreicht die Frist. Am 10. August um Mitternacht flammen die Feuerzeichen von den Bergen: Krieg. Die drei verbündeten Monarchen treffen zusammen. Moreau, der von Napoleon vertriebene General, eilt zu ihren Fahnen. Die Freiheitskämpfer ziehen durch Prag: Schenkendorf, Fouqué, Eichendorff, Brentano, Tieck, Zacharias Werner.
An Liebichs Theater schafft schon Carl Maria von Weber, der die Lieder der Sänger vertont. Eine Führerschicht deutscher Geistigkeit trifft sich in den Prager Salons. Trifft sich im Salon des geistreichen Metternich, der im Palais Lobkowitz wohnt. Varnhagen berichtet voll Begeisterung von diesen Abenden. Trifft sich im Salon des Theaterdirektors Liebich, der in seiner Villa in Lieben einen Mittelpunkt des geistigen Prag dieser Tage geschaffen hat. Da verkehrt Tieck, der in seinen Berichten das Nationaltheater unter Liebich eine der besten deutschen Bühnen nennt. Da wird Carl Maria von Weber sein Freund. Romantisches Leben verdichtet sich in seinen Trägern zu romantischer Kunst. Da verkehren die Theaterleute, die Musiker, die Diplomaten, der Adel. »Papa Liebichs« warme Menschlichkeit bindet alle zusammen. Der erste feurige Hauch der großdeutschen Bewegung strömt nach Böhmen herein. Prag erlebt die schönen Jugendzeiten der deutschen Romantik. Der Prager Boden empfängt wesentliche Anregungen für die spätere Entwicklung.
Die Begeisterung wird geweiht durch den Ernst der Stunde. Von Norden rückt Bernadotte an, in Schlesien kämpft Blücher, Schwarzenberg steht mit der Hauptmacht unterm Erzgebirge. Sieg bei Großbeeren, Sieg an der Katzbach. Niederlage bei Dresden. Verwundete stehen im Regen auf den Prager Straßen, Lazarette werden in Eile errichtet. Gentz leitet mit feurigen Aufrufen die »Prager Zeitung«. Endlich die Jubelpost: Leipzig! Prag erstrahlt in prächtiger Illumination. Es war damals hineingebunden in die deutsche Sache. Der böhmische Patriotismus hatte seine Feuertaufe durchgemacht. Es sollte die letzte große Stunde einer böhmischen Einigkeit sein.

Der Karlsplatz um 1800.
Nach einem Aquatintablatt des Grafen L. E. Buquoy um 1800 (Prag, Städt. Museum). Der Abbruch der Fronleichnamskapelle hat den Platz seines zentrierenden Halts beraubt. Die Ignatiuskirche des Barocks vermag der weiten Platzerstreckung keinen Ersatz solcher Dominante zu geben, auch nicht in ihrer Beziehung zu dem Neustädter Rathaus. Die heutige »Auszierung« mit Anlagen beraubt den Platz seines räumlichen Charakters vollends.
Die Begeisterung der Freiheitskriege verrauschte. Die Reaktion stieg herauf. Unter ihrem Druck wurde, was die josefinische Zeit an böhmischem Patriotismus geboren, was die Herbsttage von 1813 zur schönen Gemeinschaft geweiht hatten, in Nationalismen auseinandergedrängt. Der Druck lastete auf Deutschen und Tschechen gleich, doch er wurde in deutscher Amtssprache ausgeübt. Und so mußten ihn die Tschechen als gegen ihre eben erwachenden Sprach- und Nationalbestrebungen gerichtet auffassen. Der europäische Demokratismus, der sich in den Jahrzehnten bis 1848 überall regte, spitzt sich im Lager der »Vlastenci« zum nationalen Demokratismus zu, löst sich aus der »böhmischen« Einheitsfront. Die Pfingsttage des Jahres 1848 enthüllen die Spaltung. Die übliche Formel, dieses Sturmjahr habe noch einmal und zum letztenmal Tschechen und Deutsche auf dieselben Barrikaden geführt, trifft nur in einer äußerlichen Wirklichkeit zu. Den Tschechen ging es anno 1848 nicht mehr um eine »böhmische«, sondern um die tschechische Freiheit. Die Vermengung der Begriffe böhmisch und tschechisch im tschechischen Sprachgebrauch, und ihm vielfach folgend auch im älteren deutschen, verunklärt den Blick auf die tatsächliche Situation. Die Ziele, für die man kämpfte, waren schon verschieden.
Es taucht die Frage auf, ob eine kluge Regierungspolitik den in den Siebziger- und Achtzigerjahren des 18. Jahrhunderts so hoffnungsvoll begonnenen böhmischen Patriotismus zu harmonischer politischer Reife hätte kommen lassen können. Sind derlei gegen das tatsächliche Bestehen gerichtete Fragen schon von sich aus wenig fruchtbar, so wird sich auch sofort die Einsicht regen, daß einer Befriedung nationaler Fragen die Sättigung der nationalen Ideologie vorhergegangen sein muß. Das Bedauern der ersten »Vlastenci« um zugrunde gehendes Volkstum mußte sich bald in politisches Ressentiment um verlorene Selbstbestimmung verkehren. Der Kampf um das tschechische Staatsrecht wurde so dessen Ausdruck. Ehe dies Ressentiment nicht durch restlose Erfüllung gestillt war, konnte eine Einigung im Ideal eines »böhmischen« Ausgleichs nicht gelingen. Hinzu kommen die Einflüsse der Weltströmungen. Die Aufklärung hätte vielleicht in der zweckmäßigen Konstruktion eines Nationalgebildes, das jenem Patriotismus entspräche, ihr Ideal gesehen. Die Romantik, die jetzt einwirkte, setzte das Ideal organischen Wachstums dagegen. Das drängte zur Erfüllung der Nationalidee. Daß ein Autonomwerden der nationalen Forderung die Gefahr der Hypertrophie in sich birgt, muß angesichts der späteren Lage immerhin bedacht werden.
In den Anfang der Reaktionsepoche stieß jener menschlich vertiefte, geläuterte Patriotismus in mancher kraftvollen Regung vor. Da war in den ersten Jahren nach 1813 noch die Ära Liebich im Theater. Das Schauspiel blühte. Liebich wußte junge Talente zu entdecken, –; er hatte seine Beziehungen in ganz Deutschland. So den jungen Ludwig Löwe, aus dem ein prachtvoller Darsteller erwuchs, und die große Sophie Schröder. Aber was frommte die berühmte Musterbühne: der Besuch ließ doch immer mehr zu wünschen übrig. Das theatertragende Publikum war durch den Staatsbankerott von 1811 verarmt. Der Adel verzog vielfach nach Wien, um dem Hofe, der jetzt alles bedeutete, näher zu sein. Liebich beantragte und setzte durch, daß die tschechischen Sonntagnachmittag-Aufführungen, die im Magdalenentheater auf der Kleinseite jetzt ebenfalls unter seiner Regie standen, ins ständische Nationaltheater verlegt wurden. Das brachte aber mehr Nachteile als Gewinn.
Die Oper war unter der Vorherrschaft des Dramas zurückgegangen. Es war in jenen Jahren ein rechter Ausfall an öffentlich gebotener guter Musik zu verzeichnen. Der Adel behalf sich mit guter Hausmusik. Im Jahre 1810 war eine »Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen« gegründet worden. Ihre Leistung war vor allem die Errichtung eines Konservatoriums, dem als erster Direktor Friedrich Dionys Weber vorstand, als Sekretär der uns schon bekannte Franz Strobach. Dieses Konservatorium wurde später eine wichtige Kraftquelle für die Oper. Zunächst aber mußte ein resoluter Opernchef gefunden werden. Ein genialer Griff Liebichs: er hatte den auf einer Konzertreise durch Prag kommenden Carl Maria von Weber engagiert (1813). Einheimische Größen waren dadurch verstimmt: Tomaschek, dessen Bedeutung als ein Vorläufer Smetanas erst heute gebührend erkannt wird, grollte dem neuen Dirigenten während dessen ganzer Wirksamkeit.
Zuerst, als die geistigen Wellen noch hochgingen, hatte Weber gute Zeiten in Prag. Seine Freundschaft mit Tieck, sein Roman mit der Sängerin Brunetti, dann mit der reizenden Schauspielerin Karoline Brandt schufen Jubel und Kummer, also Leben. Seine Konzerte wurden begeistert aufgenommen, seine Aufführungen viel gelobt. Aber der Enthusiasmus um den jungen Komponisten verrauschte. Das Publikum erfüllte die hohen Ansprüche nicht, die Weber stellte. Es läßt seine »Fidelio«-Aufführung (1814) durchfallen. Weber ist wütend. Er fühlt sich überhaupt nicht wohl in dieser Stadt. »Der Geist des Prager Publikums«, schrieb er an Rochlitz, »den Sie so treffend einen matten, unruhig ins Blaue hinaus wünschenden nennen, ist so niederschlagend für den Künstler, daß er ganz dem entsagt, auf selbes zu wirken und sich wieder von ihm begeistern zu lassen. Nichts erregt eigentlichen Enthusiasmus. Alles kommt und geht mit Todeskälte. Der Haufe fühlt nicht als Haufe, weil er überhaupt keinen Gemeingeist besitzt, keine Geselligkeit existiert, und jeder Stand und jede Familie isoliert für sich vegetiert.« Er sucht trotz der Freundschaft, die ihn mit Liebich verbindet, nach Veränderung, findet sie in dem Angebot des Dresdner Intendanten und geht 1816 von Prag fort. Bald darauf stirbt »Papa Liebich«, von der ganzen Stadt aufrichtig betrauert.
An der Universität wirkt Bernard Bolzano. Dieser vornehme Geist, von Vaterseite her Italiener, von Mutter und Erziehung her Deutscher, wirkte als Mathematiker und Philosoph auf dem im Jahre 1809 errichteten Lehrstuhl für Religionswissenschaft. Er war ein Philantrop im edelsten Sinne, ein Sproß der katholischen Aufklärung. Der deutsche Idealismus blieb ihm zeitlebens fremd. Er sprach für das Ideal eines böhmischen Vaterlandes, dem beide Stämme ihr Bestes geben sollten. Sprach gegen die Bedrückung des schwächeren Stammes durch den überlegenen. Hielt seinen deutschen Landsleuten die Förderung des tschechischen Volkstums als menschliche Pflicht vor. Begeisterte Schüler lauschten. Dies alles war durchdrungen von einer echten, tief religiösen Christlichkeit, die in ihren edlen Äußerungen der mißtrauischen Hierarchie verdächtig werden mußte. Wieder, wie einem Sporck, wie einem Seibt, wird auch Bolzano der Prozeß gemacht: 1820 wird er seines Amtes enthoben. (Er war Freimaurer. 1814 waren die Jesuiten restituiert worden!) Später sollte er widerrufen (1824). Seine Rechtfertigung wurde vom Erzbischof angenommen. Auch der Abbé Dobrovský hatte sich für ihn eingesetzt. Aber der Erzbischof wurde wegen seines zu nachsichtigen Vorgehens gegen Bolzano gerügt. Bolzano blieb pensioniert. Der freie Geist der Universität war gebrochen. Die katholische Restauration hatte über die Aufklärung gesiegt. Die von Leopold II. einst gegebenen Freiheiten in der Lehrordnung waren schon 1802 von Franz II. aufgehoben worden. Staatsdressur wurde verlangt, auch gegeben.
Aber immer noch war der alte böhmische Patriotismus lebendig. Aus vaterländischen Kreisen hatte er neue Energien geschöpft. Im Jahre 1822 trieb er zur Gründung des »Vaterländischen Museums«, das der »Nationalliteratur und der Nationalproduktion« gewidmet war. Das Projekt war schon 1817 von einem nationalen Kreis von tschechischen Gelehrten aufgenommen worden. Die Initiative zur Ausführung hatte man dem patriotisch denkenden Adel überlassen müssen. Kaspar Graf von Sternberg hatte rührigsten Anteil an der Gründung. Er war ein bedeutender Naturforscher. In der Mineralogie lebt sein Name in dem von ihm bestimmten »Sternbergi« fort. Sein Briefwechsel mit Goethe, mit dem ihn die in kühler Forschung geklärte Liebe zur Natur verband, seine Freundschaft mit Alexander von Humboldt, seine ausgedehnten Beziehungen über ganz Europa hin holten in das schon verspießende Prager Leben dieser Tage den großen Atem herein. Seinen mit Goethe gemeinsam betriebenen Forschungen entstammt der »Versuch einer geognostisch-botanischen Flora der Vorwelt«, 1820. Sein Vetter Franz von Sternberg war mit gleicher Begeisterung am Werk. Der hatte sich viel mit der Geschichte seines Landes beschäftigt, er stand unter dem einheimischen Adel der vaterländischen Bewegung am nächsten. Jetzt sollten also alle Forschungen, die Böhmen betrafen, die museale Heimstätte erhalten. Adel und Geistlichkeit brachten große Opfer für die Gründung. Eine Bibliothek von Bohemica und exakten Wissenschaften, Sammlungen einheimischer Natur- und Kunstprodukte, historischer und ethnographischer Objekte und ein vaterländisches Archiv sollen geschaffen, eine böhmische Literaturgeschichte und die »Monumenta Bohemiae« sofort in Angriff genommen werden.
Graf Kaspar von Sternberg wurde erster Präsident. Der brachte die starke Berücksichtigung der Naturwissenschaften in den Gesellschaftsbetrieb, allerdings in dem allumfassenden Sinne des Jenenser Naturphilosophen Oken. Goethe bekundet stärkstes Interesse, war gründendes Mitglied, wurde gleich nach Erzherzog Johann (1822) zum Ehrenmitglied erhoben. Doch auch damals kam Goethe, der so oft (sechzehnmal) in Böhmen und immer so nahe (Marienbad, Teplitz, Karlsbad) weilte, nicht nach Prag, so dringend ihn dortige Freunde und die Erwartung der Jugend auch eingeladen hatten. Er sandte dem Museum ganze Suiten von Steinen und mineralogischen Funden. Das Institut verfügt gleich zu Beginn über gute Kräfte. Diese Naturwissenschaftler waren allseitig gebildete Geister, kämpften neben ihrer Spezialforschung für die heimische Sprache und Literatur. Der bedeutende Physiologe Purkynì übersetzte Schiller ins Tschechische, arbeitete gleichzeitig das Projekt für ein »Institut zur Pflege der tschechischen Sprache und Literatur« aus.
All dies hielt sich im ideellen Rahmen jenes aufklärerischen Patriotismus, jetzt mit starkem Einschuß der Romantik, der Deutsche und Tschechen gemeinsam als Böhmen erkannte. Böhmisch innerhalb der großen teutschen Nation dachte ja auch Kaspar von Sternberg. Als eine der auf seine Idee hin begründeten »Tagungen der deutschen Naturforscher und Ärzte« in Prag stattfand (1837), kam dieses sein Streben, Böhmen in den großen deutschen Kulturverband einzubeziehen, eindeutig zum Ausdruck. »… die kalte polarische Teilung ist verschwunden, Nord und Süd, Ost und West sind ineinander verschmolzen: es gibt nur ein Deutschland, wie nur eine Naturforschung, wenngleich sie den ganzen Erdball umfängt –; und mir ist gegönnt, noch vor meinem Ende die Erfüllung eines langgehegten Wunsches zu schauen …«
Um die Anstalt lebendig zu erhalten, wurden Zeitschriften gegründet: eine deutsche Wochenschrift und eine tschechische Vierteljahresschrift. An der Universität hielt Anton Müller, Professor für Ästhetik, seine wichtigen Vorlesungen. Eine lebendige Publizistik griff ins deutsche Kulturleben ein, die kluge Theaterkritik der »Bohemia« zum Beispiel, die das Bühnenleben stärkte. Nach der Direktion Franz von Holbeins war ein Direktionskomitee eingesetzt worden, in dem der tatkräftige Štìpánek saß. Auch an der Oper gab es manche Festtage, so die fünfzigste Aufführung des »Freischütz«, zu dessen Leitung der Komponist aus Dresden gekommen war, oder das Auftreten der Henriette Sontag, die auf dem Prager Konservatorium ihre Ausbildung erfahren und auf der Prager Bühne ihre ersten Lorbeeren errungen hatte.
Die Romantik blühte auf der Bühne, wollte auch ihre bildende Kunst. Im Jahre 1800 hatte die »Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde« eine Kunstschule errichtet. Als erster Direktor waltete dort Johann Bergler seines Amtes, von dem Emanuel Max in gefährlicher Harmlosigkeit berichtet, daß er »in der Art Caraccis, Dominichinos und Guido Renis gemalt« habe. Bei ihm lernte Josef Führich, der Sohn eines kleinen Landmalers aus Kratzau im Bunzlauer Kreise, als er einige Jahre an der Kunstschule studierte (von 1817 an). Unter verschiedenen Nachfolgern Berglers blieb diese Provinzakademie recht tot. Belebungen der Kunstatmosphäre gingen von privaten, kunstsinnigen Förderern aus, wie von dem Professor Alois Klar aus Auscha, der ein Stipendium für Romreisen böhmischer Kunstschüler stiftete. Er hatte ein Werk herausgegeben, in dem er hervorragende Stellen aus deutschen Klassikern zusammengetragen hatte. Der Ertrag dieses Werkes sollte für die Stiftung verwendet werden. Das erste Stipendium erhielt der in Prag studierende Emanuel Max, der Bildhauer. Klars Name lebt heute noch in seiner Schöpfung, dem Klarsehen Blindeninstitut, weiter.
Einen kunstsinnigen Kreis sammelte in den Dreißigerjahren der aus Hamburg stammende Architekt Stamann. Auf seinen Gesellschaftsabenden am Samstag traf sich alles, was für Kunst Interesse hatte. Da kamen die Grafen Erwin und Hugo Nostitz, die Grafen Franz und Leo Thun, regelmäßig auch Graf Kaspar Sternberg. Da kamen Professor Müller, der Ästhet, der Architekt Kranner, der später den Dom renovieren sollte, die Bildhauer Josef und Emanuel Max. Der nimmermüde Kanonikus bei St. Veit, Pessina, warb für seine Idee, den Veitsdom auszubauen. Da wurde das Projekt des Rathausanbaues besprochen, der Beschluß des Wiener Hofbaurates Pietro Nobile auf Abtragung des alten Rathausturmes bekämpft. Eine Deputation von Adeligen und Künstlern wandte sich damals an Graf Kaspar Sternberg, der sich bei dem ihm befreundeten Minister Kolowrat, der vorher Statthalter in Prag gewesen war, für Erhaltung des historischen Bauwerkes einsetzte. Der Neubau, der dann in den Jahren 1847 und 1848 nach Plänen des Wiener Hofbaurates Sprenger durch den Architekten Hermann von Bergmann ausgeführt wurde, schonte denn auch den ältesten Teil und setzte nördlich des Turmes den heute stehenden neugotischen Bau an. Vom Stamannschen Salon war auch die Anregung zur Gründung des »Kunst-Aktien-Vereins« ausgegangen (1836), der als »Kunstverein für Böhmen« in Prag noch heute lebendig ist. Vom Stamannschen Kreise aus wurden auch die großen Ausstellungen projektiert, die hin und wieder einen Überblick über die zeitgenössische Kunst vermittelten.
Damals erinnerte man sich auch eines alten Schatzes deutscher Malerei, den das Stift Strahow verwahrte. Das Dürersche Rosenkranzfest-Bild war im Jahre 1782 ganz plötzlich, nach langem Verschollensein, wieder aufgetaucht, übrigens unabhängig von den in den Kellergewölben gefundenen und dann versteigerten Schätzen. Das schon damals arg ruinierte Bild wurde, offenbar »unter der Hand«, einem Oberpostdirektor Fillbaum verkauft. Von dessen Erben erwarb es im Jahre 1793 der Abt des Prämonstratenserstiftes Strahow, P. Wenzel Mayer, um hundert Gulden. Im Stift Strahow scheint man sich des Wertes der Erwerbung bewußt gewesen zu sein, besonders als jetzt Angebote aus Berlin einliefen. G. F. Waagen war 1837 nach Prag gekommen, um mit dem Stift wegen der Erwerbung des Bildes zu verhandeln, scheint aber durch den schlimmen Zustand, in dem sich das Bild befand, vom Kauf abgeschreckt worden zu sein. Auch mag man im Stifte gar nicht allzu sehr für einen Verkauf gewesen sein: der damalige Prälat Hieronymus von Zeidler dachte schon an die Errichtung einer eigenen Gemäldegalerie im Stift, in der dann das Rosenkranzfest-Bild natürlich das Prachtstück abgeben sollte. Wegen der so notwendigen Restaurierung des Bildes wurde im Kloster selbst viel debattiert. Die einen waren dafür, die andern befürchteten eine völlige Zerstörung. Zeidler entschloß sich für das Wagnis. Er vertraute seinem Jugendfreund Johann Gruß, einem Landschaftsmaler in Leitmeritz, die schwierige Aufgabe an. Der ging mit Scheu und Vorsicht ans Werk. Was aber einem geübten Restaurator kaum gelungen wäre –; die Farben hatten sich schon an vielen Stellen vom Kreidegrund ganz losgelöst, ein Graf Sternberg, der das Bild zu Kopierzwecken sich ausgeliehen hatte, soll es an einer feuchten Mauer aufgestellt haben, was die Beschädigungen aufs schlimmste vermehrt habe –;, wie sollte das ein Provinzmaler ohne Restauratorenpraxis zuwege bringen! Trotz allem: das Bild blieb doch das berühmteste Stück in der inzwischen schön angewachsenen Sammlung des Stiftes. Vor einigen Jahren hat es der Staat für seine Galerie erworben.
Während sich diese von der Romantik angeregte Kunstpflege in privaten Zirkeln äußerte, arbeitete der damalige Statthalter Graf Karl Chotek eifrig an seinen städtebaulichen Zielen. Wir werden sie im Teil »Gestalt« auf ihre architektonische Bedeutung hin betrachten. Hier das für die Zeit Interessante, daß dieser weitblickende Mann (Verehrer altdeutscher Meister, böhmischer Barockmaler) die wichtigsten Neuerungen im Stadtbau gegen den kleinbürgerlichen Widerstand und oft sogar mit Anwendung von List durchführen mußte. Um die Verlängerung der Spornergasse (später Nerudova) zum Stift Strahow hin, die in argem Zustand lag, neu ausbauen zu können, mußte er verlautbaren, daß dort die große Prozession anläßlich der Nepomuk-Jahrhundertfeier gehen solle. Als der Prozessionstag herannahte, wurde ausgegeben, daß der alte Erzbischof diesen weiten Weg nicht machen könne. »Aber die Straße war doch gebaut«, lachte Chotek. Und für die Errichtung der Kettenbrücke über die Moldau, die auch durch das Anwachsen Smichows nötig wurde, mußte Chotek den Beistand des Kaisers Franz erzwingen (1833), mußte die Aktien zum Brückenbau den Reichen fast mit Gewalt aufdrängen. »Nachher« war man dann immer stolz auf die Neuerungen, erging sich auf dem gepflasterten Graben, der nach dem früheren Statthalter Kolowratstraße genannt wurde, promenierte am neuen Franzenskai, der die Proportion von Straßen-, Platz- und Hausraum so harmonisch wahrt. Fuhr in der Equipage die neue Serpentine zu den Chotek-Gärten auf der Belvederehöhe empor und freute sich des schönen Rundblicks. Manche dieser glücklichen Ideen dürfte Graf Chotek dem damaligen Oberstlandschreiber Joseph Freiherrn von Prochazka zu danken haben. In dem Zeichner Sandmann hatte die Romantik als Stimmung für die alte Stadt einen freundlichen Interpreten gefunden. Und Morstadt, ein biederer, aber begabter Dilettant –; er war Gerichtsrat –;, konnte sich nicht genug tun in Abkonterfeiung des schönen, romantisch genossenen Prag.
Man hatte auch seine Königskrönung. Der Hof kam nach Prag und wohnte auf der Burg. Der vor kurzem hieher geflohene Karl X. von Frankreich hatte sein Asyl in ihr deswegen aufgeben müssen, war bald darauf, wohl gekränkt, aus Prag fortgezogen. Am 7. September 1836 wurden der neue Kaiser Ferdinand, am nächsten Tage seine Gattin Maria Anna Pia im Veitsdom mit der böhmischen Königskrone geschmückt. Im Wladislawschen Saale hatte der König die Antwort auf die Huldigung der Stände teils tschechisch, teils deutsch abgelesen. Bei dem großen Volksfest am Invalidenplatz waren den kaiserlichen Herrschaften und dem versammelten Adel die sechzehn Kreise in ihren Nationaltrachten vorgeführt worden.
Überall verspürte man Wirkungen einer Volksbewegung, die jetzt auch in den unteren Kreisen der Bevölkerung Wurzel gefaßt hatte, die in einigen geistigen Vertretern schon hinaufgriff in die Salons des Adels, des reichen Bürgertums. Der Abbé Dobrovský war ja von je der beliebte Gast des Adels. Er beschied sich mit emsiger Forschung auf dem Gebiet der slawischen Sprachen, mit sachlicher Kritik einiger Auswüchse der jungen »vaterländischen« Richtung, wie sie die »Grünberger Handschrift« darstellte, die der Bibliothekar am »Vaterländischen Museum«, Wenzel Hanka, gefunden haben wollte. Dobrovskýs Schüler, der elegante und geistreiche Franz Palacký, wirkte viel aktiver als Sprecher des Kulturanspruchs seines tschechischen Volkes, fand rege Teilnahme bei der Gesellschaft, bei den Deutschen. Egon Ebert, der deutsche Dichter der böhmischen Geschichte, war noch sein bester Freund. Um Jungmann, der in Leitmeritz als Gymnasialprofessor wirkte, hatte sich ein ganzer Kreis junger tschechischer Schriftsteller gesammelt. Kollár und Šafaøik arbeiteten an der Bewußtmachung einer slawischen Idee durch Herausgabe von großen sprachkundlichen Werken, von Volksliedersammlungen. 1831 hatten die tschechischen Patrioten die Errichtung der »Matice Èeská« (Mutterlade) »zur wissenschaftlichen Pflege der Muttersprache« durchgesetzt. Es war jenes Institut, für das Purkynì schon vor Jahren ein Projekt ausgearbeitet hatte. 1845 trat dann die »Beseda« ins Leben. Die Zensur schaltete zwar scharf. Einmal wurde sogar das Wort slawisch verboten. Aber die Bewegung um ein tschechisches Volkstum lebte kräftig auf.
Sie wurde auch auf dem Theater wieder aufgegriffen. Im Jahre 1842 hatte es den Anschein, als ob ein tschechisches Nationaltheater erstehen sollte. Der damalige Direktor am Ständetheater, August Stöger, ein Deutscher, ein unruhiger Kopf, hatte in der Rosengasse ein großes Redoutengebäude errichten lassen, um seinen arg darniederliegenden Finanzen aufzuhelfen. Da war zuerst großes Faschingsleben eingezogen. Die Theaterredouten im alten Haus sollten wegen Feuergefährlichkeit entfallen. Als der Reiz der Neuheit nicht mehr zog, hatte Stöger den Saal zu einem Theater umwandeln lassen, um hier das tschechische Schauspiel und die deutsche Farce, mit der Wien reichlich versorgte, zu spielen. Aber trotz allen Bemühungen der tschechischen Dichter-Schauspieler Kolár und Tyl reichte das Publikum nicht aus zur Aufrechterhaltung eines eigenen tschechischen Theaters. Auch fehlte es an einem tatkräftigen Regisseur. Der Traum eines tschechischen Nationaltheaters konnte noch nicht in Erfüllung gehen. Stögers Hoffnungen hatten getrogen. Das Theater in der Rosengasse schadete nur dem Ständetheater, ohne selbst Nutzen zu bringen. Es wurde wieder aufgelassen. (Später wurde das Leihhaus hineingelegt.) Die Stände mußten das eigene Haus sanieren. An die Stelle der vielgliedrigen Theateraufsichtskommission trat nun eine feste Intendanz (Graf Nostitz der erste Intendant). Johann Hoffmann wurde an Stögers Statt Direktor, führte Schauspiel und Oper in die unruhige Zeit von 1846 hinein.

Die erste Eisenbahn in Prag 1845.
Lithographie von F. X. Sandmann. Einfahrt in den Staatsbahnhof (später Masaryk-Bahnhof).
Blickt man auf das behäbige »gesellschaftliche« Prag dieser Jahre, so wird man die Vorgänge des Jahres 1848 kaum begreifen können. Dieses »gesellschaftliche« Prag war deutsch, war höchst gesittet und etwas spießig, es war untertänig. Wohl tauchten in diesen Kreisen mitunter freiheitliche Ideen auf, doch sie zündeten kaum. Wie echolos war die Pariser Revolution des Jahres 1830 in Prag verhallt! Doch das Bild der Oberflächen trügt. Die freiheitlichen Kräfte des Deutschtums wirkten damals außer Landes, um dem »System« Metternichs auszuweichen.
Und der Unterbau dieser Gesellschaft hatte sich stark verändert. Industrien waren nun auch nach Prag eingedrungen –; in den deutschen Randgebieten Böhmens waren sie seit hundert Jahren fest verwurzelt und gediehen –;, hatten Vorstädte geschaffen, hatten die Bevölkerung zum Teil umgeschichtet. Tschechisches Landvolk strömte herein, wurde Arbeitermasse. Das Kleingewerbe Prags organisierte sich schon gegen die Industrie. Der Prager Gewerbeverein wurde ins Leben gerufen. Die moderne Technik hatte im »Polytechnischen Institut«, das von den Ständen im Jahre 1806 gegründet worden war, einen regen Stützpunkt. Das neue Institut konnte in Prag schon auf eine gewisse Tradition zurückblicken: im Jahre 1717 war Ch. von Willenberg zum »Professor der Ingenieurkunst« ernannt worden. Organisator des neuen Polytechnikums wurde der Professor für höhere Mathematik an der Universität, Franz Joseph Ritter von Gerstner, dessen kluge Studieneinteilung im Kern geblieben ist. Für Prags technische Entwicklung war das neue Institut wichtig. Jetzt mußten auch neue Verkehrswege geschaffen werden. 1841 erstand die Moldau-Elbe-Dampfschiffahrt. Bald darauf wird die erste Eisenbahn von Wien hergeleitet, noch über Olmütz. Der Einlauf des ersten Zuges in den Staatsbahnhof war eine feierliche, von allen Pragern bestaunte Angelegenheit. Die Weiterführung der Strecke nach Bodenbach, wo sie die Dresdner Strecke treffen sollte, war schon im Bau. Staatsverträge zwischen Österreich und Sachsen hatten den Verkehrsweg ermöglicht. Aber im Jahre 1844 waren auch schon Arbeiterunruhen in Prag ausgebrochen. In den unteren Schichten gärte es.
Wichtig, zu begreifen, welche Färbung solche Gärung in Prag notwendig annehmen mußte. Die Tschechen rangen um ein Volkstum, mußten alle Reformen also bei den niederen Klassen ansetzen, in denen die letzten Überreste jenes Volkstums geborgen waren, auf die ihr Volk ja auch in der Hauptsache zurückgebildet war. Das brachte in diese soziale Gärung von Anbeginn an die nationale. Und umgekehrt: der Wille zu einschneidenden Änderungen stieg von den einfacheren Klassen zunächst in die »gebildeten« Klassen der eigenen Landsleute auf, ließ die Deutschen verhältnismäßig unberührt. So kam es, daß der Fortschrittsgedanke, das Ideal der Demokratie, vor allem im tschechischen Lager auftrieb und daß fortschrittlich gesinnte Deutsche vielfach dorthinein gelockt wurden. Daß umgekehrt bei den Deutschen mehr der Konservativismus, die »Besonnenheit«, wie man sich ausdrückte, herrschte.
Auf solchen veränderten sozialen Grundlagen mußte die Pariser Februarrevolution des Jahres 1848 ganz anders zünden als jene vor achtzehn Jahren. Man forderte, drohte. Die Zensur ließ nach. Im Ständetheater konnten schon »Die Franzosen vor Nizza« gegeben werden, eine Revolutionsoper, deren Text von dem jungen Richard Wagner, deren Musik von Johann Friedrich Knittl, dem Direktor des Prager Konservatoriums, stammte. 15. März: Konstitution! Der neue Statthalter Graf Stadion verkündet die frohe Botschaft im Theater von seiner Loge aus. Allgemeiner Jubel. Man drängt auf die Straßen. Das Volk ist in Bewegung. Pereat Metternich!
Aufgeregte Tage. Der Erzbischof liest auf dem Roßmarkt (Wenzelsplatz) eine Messe, kann sich durch die aufgeregte Menge kaum den Rückweg bahnen. Es bildet sich die »Akademische Legion« der Studenten. Der Künstlerverein Concordia, in dem Deutsche und Tschechen bisher einträchtiglich zusammen gehaust und gewirkt hatten, wandelt sich jetzt zum »Künstlerkorps« um. Die Konstituierung dieser martialischen Neuerung erfolgte im Domnitzerschen Hause am Graben. Aber schon beginnt im neuen Korps die Spaltung: einigen wird die Haltung der Tschechen zu laut, zu kriegerisch. Sie trennen sich, bilden im Salmschen Haus (Palais Kaunitz) ein eigenes Korps mit dem Akademiedirektor Ruben als Hauptmann. Es waren meist Deutsche. Die zurückgebliebenen gründen nun die »Svornost« (Eintracht), ziehen in Nationaltracht zur Übung und auf Wache. Unruhe, Aufregung, Tumulte auf den Straßen. Alles ist plötzlich bewaffnet. Die Zensur ist gefallen. Die Zeitungen dürfen feurige Artikel für die Freiheit schreiben. Vom großdeutschen Parlament in Frankfurt kommt die Einladung, Abgesandte zu schicken. Die Einladung ist an Palacký, den die Stände zum »böhmischen Historiographen« ernannt hatten, gerichtet. Palacký ist der Führer der Tschechen im Nationalausschuß. Er lehnt die Frankfurter Einladung ab. Man fühlt slawisch, will sein Slawentum aber im Rahmen des österreichischen Kaiserstaates ausbauen.
Die seit Jahrzehnten gepflegten allslawischen Ideen rufen nun nach Verwirklichung. Nach dem Muster des großdeutschen Parlaments in Frankfurt soll ein Slawenkongreß alle in Österreich lebenden Slawen vereinen. Die andern Slawen (Russen, Bulgaren) sollen daran nur als Gäste teilnehmen. Der Kongreß tritt am 2. Juni in Prag zusammen, tagt im Museumsgebäude. Man fordert Gleichberechtigung aller Nationalitäten, stellt die Humanitätsidee, wie Herder sie gewiesen, in den Vordergrund. Die Souveränität Österreichs dürfe in keinem Fall untergraben werden. Man protestiert gegen die Beschickung des Frankfurter Parlaments. Das Slawentum bringe als neuen Standpunkt die Idee der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aller Völker nach Europa (so der polnische Fürst Lubomirski). Die Slawen wollten sich zu ihrer großen Familie bekennen (so Palacký). »Entweder bringen wir es dahin, daß wir mit Stolz sagen können: ›Ich bin ein Slawe‹ oder wir hören auf, Slawen zu sein.« Dieses Wort des schlichten Šafaøík darf das klassische Wort des Kongresses, ja überhaupt der ein halbes Jahrhundert alten Bewegung genannt werden. Messen im römisch-katholischen, unierten und orthodoxen Ritus schlossen das religiöse Band um die begeisterten Kongreßteilnehmer. Bakunins Radikalisierungsbestrebungen finden kaum Gehör.
Der Kongreß tagte auf unruhigstem Boden. In den Massen war man gegen den Fürsten Windischgrätz erbost, der gerade jetzt wieder den Oberbefehl über das in Prag stationierte Armeekorps übernommen hatte. In den Pfingsttagen hieß es, der General rüste gegen das Volk, er habe Kanonen in die Stadt bringen lassen. Als am Pfingstmontag morgens die Menge, die auf dem Roßmarkt die »slawische Messe« gehört hatte, in großen Zügen durch die Stadt zog, sollen die Wachen von radikalen Elementen, die sich in den Umzug gemischt hatten, provoziert worden sein. Schüsse fielen. Das Volk schreit »Verrat!«, »Baut Barrikaden!«. Prag ist in Aufruhr.
Barrikaden wachsen aus der Erde. Am Graben, in der Bergmannsgasse, am Ring, in der Neuen Allee (heute Volksstraße). Straßenkämpfe am Graben, am Ring, in der Zeltnergasse. Hier in der Zeltnergasse wird die Fürstin Windischgrätz von einer Kugel durchs Fenster tödlich getroffen. Der neue Statthalter Graf Leo Thun –; Stadion war vor Ausbruch der Revolution zurückgetreten –; wird auf dem Weg zum Magistrat von Studenten gefangengenommen, ins Clementinum geführt und dort als Geisel in Haft gehalten. Das Carolinum wird von den Grenadieren erstürmt. Unheimliche Nächte. Am Dienstag und Mittwoch wieder Straßenkämpfe. Am schärfsten geht es in der »Neuen Allee« (Volksstraße) zu, wo eine starke Barrikade (vor dem Schlickschen Haus) unter viel Verlusten gestürmt werden muß. Allgemeine Verwirrung. Die Nationalgarden rufen vergeblich nach einheitlicher Leitung, kämpfen zum Teil auf der Seite der Revolutionäre, zum Teil auf Seiten des Militärs. Man revolutioniert ins Blaue hinein. Palacký ist niedergeschlagen. Die Entwicklung ist ihm aus der Hand geglitten. Viele Bürger fliehen. Vom Lande kommt Verstärkung der Nationalgarden, viel unruhige Elemente. Peter Faster, ein Gastwirt, hetzt am wildesten. Wer Ruhe predigt, wird des Verrats bezichtigt, bedroht. Das Militär ist erbost, hat in den Straßenkämpfen, wo aus Fenstern, von Dächern geschossen wird, starke Verluste. In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag zieht Fürst Windischgrätz alle Truppen aus Alt- und Neustadt heraus, konzentriert sie auf der Kleinseite. Demoliert die Kettenbrücke, besetzt die Karlsbrücke, pflanzt Kanonen gegen die Stadt auf. Die Aufständischen toben. Verlangen Absetzung Windischgrätz', Zurückziehung allen Militärs aus den Prager Städten. Windischgrätz gibt das Kommando an General Graf von Mensdorff ab, verlangt aber Abtragung aller Barrikaden. Besonnene unter der Bürgerschaft raten zum Frieden. Radikale schreien: Zuerst alles Militär fort!
Auf dem Hradschin ist eine Hofkommission aus Wien eingetroffen, verhandelt mit den Revolutionären. Deputationen gehen über die Karlsbrücke. Am Donnerstag letzte Aufforderung von seiten der Hofkommission: das Militär lasse sich nicht mehr halten, sei über die Verletzung des Waffenstillstandes durch Schützen auf der Altstadtseite und besonders am Podskal erbost, fordere Wiedereinsetzung des Fürsten Windischgrätz und Bombardement der Stadt. Seien bis Freitag abend nicht bindende Zusagen betreffs Übergabe der Stadt und Abbau der Barrikaden eingetroffen, so erfolge Samstag früh ab sechs Uhr das Bombardement.
Parteiungen bei den Aufständischen. Freitag gegen Abend beginnt man doch, die Barrikaden abzutragen. Aber einzelne Schüsse vom Podskal und von den Altstädter Mühlen –; der Magistrat hatte die verstreuten Schützen nicht unter seiner Befehlsgewalt halten können –; reizen das Militär. Nachts fallen die ersten Bomben auf die Mühlen. Die lodern auf. Auch der Wasserturm daneben brennt. Die Radikalen brüllen: Verrat! Schon wachsen wieder Barrikaden auf. Die Bevölkerung aber ist zurückgeschreckt. Die Flammen lodern furchteinjagend in den Nachthimmel. Man bietet bedingungslose Übergabe, reißt die letzten Barrikaden nieder, schickt die Garden, die vom Lande gekommen waren, wieder zurück. Auf der Station Biechowitz (Strecke Prag-Kolin) noch ein Zusammenstoß: aus dem Zug der Abfahrenden war ein Schuß auf das im dortigen Bahnhof stationierte Militär gefallen. Die Husaren stürmen den Zug, verwunden, hauen nieder, verfolgen die Fliehenden. Blutiges Finale der Prager Revolutionstage. Waffenablieferung im Rathaus, Kriegsgericht auf dem Hradschin, Belagerungszustand über Prag. Die Anstrengungen vieler Jahrzehnte ersticken in der Reaktion.