
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Im Forsthaus herrscht, wie überall auf dem Land, mancher Aberglauben, und Huberta hat einen Teil desselben mit ererbt und hält mit Liebe daran fest.
Zum Beispiel beschneidet sie sich in jedem Monat bei zunehmendem Mond ihr schönes blondes Haar um ein weniges, weil sie überzeugt ist, daß es davon bisher so stark und kräftig wuchs. Sie hat als Kind sogar einmal ihrer einzigen, geliebten Puppe zur Zeit des ersten Mondviertels die Locken beschnitten, als die anfingen, auszugehn.
Wenn sich eine Katze im Hause emsig putzt, freut sie sich und schaut, ob noch Kuchenvorrat vorhanden ist, sonst bäckt sie neuen, denn so gut wie sicher kommen dann Gäste.
Nie füllt sie den Hauskatzen ihre Schüsseln mit Milch ohne ein vorahnendes, wunderseliges Glücksgefühl: sie weiß, wenn ein Mädchen die Katzen gut füttert, scheint einst an seinem Hochzeitstag die Sonne.
An die glückbringende Kraft von vierblättrigem Klee, von gefundenen Hufeisen, von Spinnen am Abend glaubt sie fest. Sie freut sich, wenn sie einem Menschen begegnet, der Brot in der Hand trägt, denn auch das, weiß sie, bringt Glück. Sie hält darauf, daß ja niemand den Nestfrieden der Schwalben stört; Schwalben schaffen dem Hause, an dem sie bauen, Wohlstand, Frieden, Gedeihen. Wenn die Schwalben recht zahlreich unter dem Dachfirst und über der Haustür nisten, recht viel Junge haben, ist's gut, Schwalben verscheuchen und verjagen darf man beileibe nicht.
Und das Brot darf man nicht mit der Mehlseite nach oben legen! Das gibt Zank. Schön und in der Ordnung wäre das ja auch sowieso nicht, meint sie. In den Zwölfnächten, zwischen Weihnachten und Epiphanias, darf kein Spinnrad im Hause gehn, überhaupt nichts »umgehn«, nichts sich drehn, da geistern die heidnischen Mächte noch durch die Lande (vielmehr durch die Köpfe der bäuerlichen Christenmenschen!). Die Zenzl verdeckt dann ihr altes schönes Spinnrad, das sie sonst an Winterabenden gern noch ein Stündchen schnurren läßt, mit einem großen Tuch. Böse Geister verwirren sonst das Gespinst und des Hauses Glück.
»Ein Jurament ablegen« auf alles das, wie die Zenz und der Waldheger aus dem Waldhäusel an der Trift, das möchte die Huberts nicht, aber sie kennt und liebt all diesen Glauben. Ein Stück traulicher Heimatlichkeit, teurer Urvätersitte steckt für sie darin.
Daß man den Jägern nicht Glück wünschen darf, ist natürlich auch fest in ihr eingewurzelt.
»Brecht Hals und Beine!« heißt der statt des Glückwunsches übliche Jagdwunsch, den Huberta und Babettl laut wie die Jochgeier den Weidmannen immer nachschreien.
Hals und Beine – dem Wilde! bedeutet dieses verdächtig klingenden Wunsches geheimer Sinn.
Ein über den Weg laufender Hase oder eine dito Katze weissagen dem Weidmann nichts Gutes. Davon ist sie fest überzeugt. Auf Unglücksaberglauben hält sie sonst weiter nicht.
Einen Aberglauben will sie auf keinen Fall dulden, den haßt sie, gegen den wütet sie im Innern, – den möchte sie ausrotten, extra noch, weil ihre beiden Ideale, ihr Vater und der Sollacher, ihn teilen.
Das ist der uralte Jägeraberglaube: ein altes Weib brächte dem Weidmann Unglück, verhindere ihn am rechten Schuß. Der Vater läßt sich nichts merken, aber kehrt still um, wenn ihm auf einem Pirschgang eine Alte begegnet.
In was für Ausdrücken hat aber der Sollacher sich schon gegen die armseligen Beeren- und Schwammerlweiber, wenn sie ihm im Wald grad vor die Augen kamen, ergangen!
Sogar die Zenzl ist vor seinem zornwütigen Stirnrunzeln nicht sicher, wenn sie ihm vor einem Waldgange die Schritte kreuzt. Ein paarmal hat sich das alte Wesen schon in aller Geschwindigkeit unter den Tisch verkrochen oder hinter Vaters Lodenmantel am Kleidergestell versteckt. Wenn die Huberta sie dann wieder ans Tageslicht herausschliefen und ängstlich um sich äugen sah, hatte sie zugleich lachen und zornig mit dem Fuß aufstampfen müssen!
Ein Trumm von Jagersmann wie der Maxl, – sich vor einem alten Weib fürchten und die wieder in Furcht jagen vor ihm, – das gefällt ihr nicht!
»So ein arms, alts Weibl«, denkt sie, »hat's eh nicht gut!«
Wenn Jugend und Kraft dahin sind, haben's die Leute auf dem Lande fast alle hart, hat sie gefunden. Sie arbeiten ihr Leben lang schwer, haben ihre Rüstigkeit früh vertan; die meisten müssen sich dann demütig ducken vor den Starken, Jungen – im Gnadenbrot, möchten sich am liebsten in die Mauslöcher verkriechen! Kaum im Traum mehr kann man's glauben, daß solch ein gebücktes, mühseliges Runzelweibchen einst jung war, vielleicht ein hübsches, lachendes, keckfrohes Dirndl!
Den Alten sollte man nichts Böses nachsagen und nachdenken, was sie nicht verdienen; man sollte ihnen eher gut tun, meint sie, und sie kann sich daher recht aufregen über die unverständigen Mannen.
Dem Max hat sie schon ein paarmal bescheiden ihre Meinung gesagt. Der meint alsdann hart: »Das verstehst nicht, Hubertl! Sei still davon! Bist halt eben doch kei Jager!«
Unverbesserlich bleibt er.
Neulich hat er die Büchse unter Wetterflüchen wieder an den Nagel gehangen, sich wütend ans Schreibwerk begeben statt in den Wald. Wegen eines Zusammenpralls auf der Hausschwelle mit der Hablerin, die sich ohnehin so schwer dahergetraut! Huberta hatte ihr mit aller Macht zugeredet, sie solle einmal mit ihren Wurzelbürsten und Birkenbesen ins Forsthaus kommen. Dort glaube man den Unsinn, der über sie umgehe, nicht.
Die Hablerin ist eine Märtyrerin in der Huberta Augen.
Huberta will die Bauersleute von einem dickköpfigen Vorurteil und Aberglauben gegen die Alte kurieren.
Das ist ein großes Unterfangen!
Der Maxl sollte ihr dabei doch lieber helfen! In ihr ist großer Aufruhr, seit sie erfahren hat, wie's mit dem ärmsten aller alten Weibeln, des verstorbenen Totengräbers Wittib, steht.
Von der Zenzl hatte sie schon einmal munkeln hören, daß die Hablerin allerlei unheimliche Kunst treibe.
Aber letzthin hatte sie mit eigenen Augen und Ohren bemerkt, daß eine ganze Rotte kleiner, frecher Dorfbuben dem humpelnden Weibe nachlief, ihr Steine nachwarf, ihr nachhöhnte wie Teufelchen, während andere jüngere Kinder mit lautem Geheul und Geschrei vor ihr das Weite suchten.
»Alte Hex! Alte Drud! Druckst die Leut tot im Schlaf!« schrien die Verfolger.
Vor dieser Bubenrotte hatte die Alte bald Ruh. Huberta ist unter sie gefahren mit sehr verständlichen Worten und handgreiflichen Unterweisungen.
Aber in Huberta selbst ist's voll Unruh.
Sie hat mit tiefem Erschrecken ein Riesenfeld voll wucherndem Unkraut entdeckt, hartes, zähes, festwurzelndes.
Das Unkraut heißt Aberglauben. Aber kein unschuldiger, frommer ist's.
Sie hat die zitternde, abgeängstigte Alte damals bis in ihr abseits vom Orte gelegenes Häusl heimgeleitet.
So etwas Gebrochenes, Müdes hatte sie noch nicht gesehn!
Tief gebückt saß die Alte da, mit hängendem Kopf, die mageren, harten Hände, auf die die Tränen kullerten, im Schoß gefaltet.
Die zitternde Stimme sprach immer wieder im treuherzig versichernden Ton:
»I bin kei Hex! I bin kei Drud! I tu kei'm Menschen was! Bei meiner armen Seelen Seligkeit! I weiß net, was d' Leit wollen! Bei der Buchrainerin hat's ang'fangen jetz vor ei'm Jahr! Wie i amal zu der kemma bin, hat s'mi vor d' Tür setzen lassen. Sie wüßt's jetzt ganz g'nau, i sei's, die sie immer halb z' Tod drucken tät in der Nacht, als Alb, wissen S', als Drud. I war's aber g'wiß net! Sie wüßt's, hat s' g'sagt. I sollt mi net mehr blicken lassen! Dann haben bald alle Leut ang'fangen mit ihrem Geschmach. Wohin i kimm, da bekreuzen s' sich. Jetzt wissen's schon alle bösen Buben im Ort: I wär' a Hex! O du mei lieber Herrgott im Himmel, du weißt's, i hab nix unrechts tan! I lieg' auf meim Strohbett z' nachts, und's war mir viel z' unkommod, daß i aufstehn und d' Leit im Schlaf drucken sollt! Mögen tat i's a net, – – i wüßt net, was i da sollt! – – –«
Huberta hat der Alten freundlich und tröstend versichert, das glaube sie ihr.
Am selben Nachmittag war Huberta bei der Buchrainerin, der stattlichen Witfrau in dem stolzen, bunt bemalten Bauernhaus am See drunten, mit der sie von Kindheit an einen lebhaften Nelkensenkertausch betrieb, zu Besuch. Die ließ sich nach vielen langsamen, breiten Umschweifen über Wetter und Ergehn, wie's die Bauern lieben, auch endlich herbei, das Gespräch übers Hablerweiblein aufzunehmen.
Huberta sagte, sie habe von dem Gerücht gehört; sie wolle doch gern die gescheite Buchrainerin fragen, wie das Mißverständnis aufgekommen sei und wie es mit der Sache stehe.
Da tat die Buchrainerin würdig und ernst dar: Es sei kein Mißverständnis, es sei so, die Hablerin sei eine Zauberin.
»I will's Ihna sagen, Fräuln Sollacher,« erklärte sie darauf entschlossen, »von oaner Zigeunerin hab i die Zauberbezeugung! Die Leut wissen's! So war's: I hab' Albdrucken g'habt in der Nacht, daß i denkt hab', um mi ist's g'schehn. Wie derschlagn bin i g'wesen am ganzen Vormittag, ganz dasig bin i in der Kuchl g'sessen, da ist a jungs Zigeunerweib zu mir reinkommen von einer Bande, die um die Zeit grad im Ort war. Der hab' i's klagt, und da hat's mir's erklärt: A teuflischer Mensch, a Hex, müßt zu mir kommen sein, als Feder durchs Schlüsselloch in der Nacht, und hab' mi nacher gar so druckt in ihrer wahren Hexeng'stalt. Für viel Geld, das i ihr hab' geben g'mußt, hat die Zigeunerin mir's auch offenbart, wer's is: die Nächst' halt, die kommen werd und was von mir entlehnen! –
»Und net a halbe Stund hat's dann dauert, kommt die Hablerin. A Töpferl voll Milch wollt s' kaufen, hat s' g'jammert in ihrer Falschheit; 's Töpferl aber sei ihr unterwegs zerbrochen. I sollt ihr eins leihn. Der hab' i die Tür gewiesen! O mei! Die grad! Die is oft bei uns ein-und ausganga! I bin ihr Guttäterin g'wesen! Alle meine Besen und Wurzelbürsten hab i von der kauft, weil's mi derbarmt hat. Jetzt sind mir d' Augen auf'gangen! Die war a Drud! A Hex! Jetzt hab' i g'wußt, wer mir meine Kalberln versegn't hat! Zwei waren mir eingangen in der vorherigen Zeit. Und im Rührfaß hat oft durchaus koa Butter werden wollen, und der Rahm ist mir von der Milch wegg'hext g'wesen. Mei Schwester, die selige Albertl, hat mir schon vor drei Jahr g'sagt, i sollt a Hufeisen unters Butterfaß legen, weil d' Butter so oft si nit hat rühren wollen. A Hex hätt' d' Händ im Spiel! Jetzt bin i g'scheit worden. Auf alle Türschwellen sein jetzt bei mir Drudenfüß mit Kreiden g'malt worden zum Schutz gegen Hexenzauber. Und die Buchstabn von die heiligen drei Könige mit die drei Kreuz stehn an alle Türen g'schrieben. Man kann si net genug vorsehn. So a Hex kann einem schaden in Zeit und Seligkeit.
»Mei Mann selig, der Buchrainer, ist so hart verstorben, hat sich drei Tag quälen müssen, eh er hat den letzten Schnaufer tan, nachdem er vom Doktor aufgeben war. I denk' jetzt manchmal: ob die alt Hablerin da auch schon ihren Zauber im Spiel g'habt hat?« – –
Huberta sagt festen Tones: »Nein, g'wiß net!«
Ihr kam's heiß und kalt ans Herz vor Entrüstung.
Sie dachte des hinfälligen, abgehetzten Geschöpfes mit den gefalteten Händen, auf die die Tränen tropften.
Sie hat lange in die Buchrainerin hineingeredet. Überzeugt hat sie sie nicht, aber die Frau hat sie immer verwunderter angesehn ob ihres heißen Eifers. Wenigstens hat sie ihr mit Handschlag versprochen, daß sie das Gered jetzt einmal nicht weitertragen wolle.
Wie tief das aber schon überall eingewurzelt war, hat Huberta mit Erschrecken bemerkt.
Sie hat vorsichtig herumgelauscht bei den Leuten. Da gewahrte sie, daß es alle wußten und zwar ganz genau: Die Hablerin sei eine Zauberin.
Beinahe jeden im Ort hatte sie laut seiner Aussage schon einmal nachts »druckt.«
Was früher einfach der Wirkung zu vieler Knödel zugeschrieben wurde, das sollte jetzt ihr Werk sein.
Die Magd der Bäckersleute, bei der Huberta ihre Einkäufe machte, Hatte einmal einen einzigen »tropfetnassen« Strumpf bei der Hex auf der Leine am Ofen hängen sehn. Aus dem sollte sie zauberisch Milch gemolken haben, die sie der Bäckerskuh weggehext hätte. Diese wollte ihren Eigentümern nämlich auf einmal keine mehr geben.
Eine Nachbarin behauptete für gewiß, sie habe die Hex in einem dampfenden Kessel rühren sehn, in dem doch nichts gewesen sei, als Wasser. Da habe sie die zauberische Sudkunst betrieben, habe für sie und ihre armen Kinder Unglück und Krankheit gebraut. Verkommen genug sah es bei der Frau aus, Huberta sah aber sofort: nur durch deren eigene Unsauberkeit.
Daß die alte Hablerin sich zur Erwärmung einfach Wasser mit ein bißchen Salz gekocht hatte, weil sie keine Milch bekam, wollte die Nachbarin der Huberta durchaus nicht glauben.
Schwer, recht schwer war's überhaupt, das Unkrautjäten!
Aber Huberta sparte bei der Arbeit keine Mühe.
Wo es anging, ließ sie sich im Ort mit der Hablerin sehn, ließ sich etwas von ihr tragen oder trug ihr selbst ihren Besenpack.
Die Kinder, die sich vor der Alten gefürchtet hatten, lockte Huberta mit freundlichen Worten heran, ihr »Grüß Gott!« zu sagen und die Hand zu geben. Die Kinder des Orts, die hatte sie ja alle am Bandel! Ihr liebes Roserl tat's aus Liebe zum Sollacherfräuln bald mit wahrer Begeisterung allen zuvor, raste schon von weitem auf die Hablerin zu und schrie überlaut: »Grüß Gott! grüß Gott!« Das Reserl blieb da natürlich nicht zurück, und so hatte die Hex jetzt manchmal ein kleines Gefolg, nicht wie von jungen Teufeln, sondern wie von leibhaften Engelein.
Die Postwirtin mußte ihr auf Hubertus dringliches Bitten versprechen, der Alten manchmal eine Suppe in der Küche zu geben vor der Leute Augen. (An wem das freilich beinahe scheiterte, das war die Wabi! Die hatte eine wahre Totenangst, die Hex könnte ihr ihr Glück verhexen! Nur aus Sorge um Hubertas Freundschaft hat sie schließlich auch »Ja« gesagt.) Auch bei ihren lieben Pastors war Huberta und bat um Hilfe und Teilnahme für die Verfolgte.
Die Pastorsleute waren zu jeder persönlichen Wohltat mit warmen Herzen bereit.
Nur – sich der Verfolgten öffentlich anzunehmen, – diese gegen ihre Feinde zu verteidigen, – sie sagten es der Huberta mit Trauer offen und ehrlich, – das unternähmen sie zum Besten der Hablerin lieber nicht! Die andern Leute würden der Alten das schrecklich entgelten lassen.
In schmerzlichem Ton legten sie ihre Gründe dar.
Es war das alte Lied der Klage: sie waren zu unbeliebt bei der katholischen Gemeinde, etwas Fremdes, Gehaßtes, hatten es trotz aller Bemühungen nicht verstanden, die Kluft der Seelen zu überbrücken.
»Es mag daran liegen, daß wir Oberfranken Sprache, Sitte und Eigenart hier in Oberbayern zu wenig kannten,« sagte die alte Pfarrerin, wie sich entschuldigend, schmerzlich leise, »daß unsre norddeutsche Sprache ihnen mißfällt, oder daß ich für eine Pfarrfrau überhaupt stets viel zu schüchtern und zurückhaltend war, den Eingang in die Herzen nicht fand. Ich bewundre Sie, Fräulein Huberta, wie gut Sie das können.«
Der Herr Pastor behauptete: »Daran liegt's nicht allein! An mir liegt's vielmehr; ich habe mir Vertrauen und Bruderschaft meines katholischen Amtsbruders von Anfang an verscherzt. Sie sind alt genug, ich kann's Ihnen ja sagen, Fräulein Huberta. Ich habe mich leider, als ich kurze Zeit hier war, im Übereifer über eine theologische Streitfrage arg mit ihm entzweit. Eine rechte Aussöhnung zwischen uns ist bis heute noch nicht gelungen! Statt Frieden und gutes Einverständnis zu halten, Frieden zu bringen, sind wir beinahe Gegner, wir zwei Seelenhirten. Sie glauben wohl, wie bitter mich das schon geschmerzt hat, wie nah es mir geht!«
Huberta nickte tiefernst. Ja, das verstand und glaubte sie wohl!
Sie schrieb an ihren Freund, den Kandidaten Ruffel, dem sie auf eine schöne interessante Büchersendung noch eine Antwort schuldig war, am selben Tag noch einen erregten Brief über die ganze Sache. Was ihre alten Pastors schmerzte, schmerzte sie mit. Und sie trauerte, daß gerade die Hilfe dieser zwei Freunde ihr bei ihrem schweren Werke versagt war.
Sie mußte eben selber weiter kämpfen durch Bearbeiten der Leute, heitres Auslachen, sonnenhelles Beweisführen und Überzeugen!
So gelang es ihr, der Bäckersfrau nachzuweisen, der eine tropfendnasse Strumpf auf der Ofenleine der Hexe habe deshalb so einzeln dagehangen, weil eine Guttäterin ihr halt nur diesen einzelnen geschenkt hatte, ohne den zweiten. Die alte Frau habe die Guttat nicht verachten wollen und sich also den einzelnen schön sauber ausgewaschen.
Und dem dicken Bäcker selbst bewies Huberta auch einen Irrtum. Der brüstete sich damit, er habe der Hex Pein gemacht durch einen alten Gegenzauber, eine furchtbare, allgemein bekannte Strafe fürs Albdrücken und Butterweghexen.
Er habe am Kreuzweg drei Knoten in einen Sack geknüpft und habe dann den Sack nach Kräften durchgebläut, wobei er den Namen der Hex genannt; die sollte diese Prügel an ihrem Leibe verspüren!
Die Hexe Hablerin aber sagte in Gegenwart des Bäckers, zu dem Huberta sie persönlich berief, ehrlich und ernst aus, sie habe nichts gespürt, habe jene ganze Nacht friedlich geschlafen!
Ganz langsam haben die Bäckersleute da angefangen, den Kopf zu schütteln über den Unsinn, den andre ihnen hineingesetzt hatten.
Die Frau gab der Hablerin jetzt zuweilen einen Wecken, und in der Huberta Beisein kauften sie ihr dann einmal ein paar Besen ab.
Andre taten's ihr nach. Das Sollacherfräuln, das sie alle schätzten, dankte ihnen so fröhlich dafür, das mochten die sich gern verdienen.
Und immer ward's besser.
Die Hablerin berichtete der Huberta, von Dankesglück erfüllt, sie könne jetzt schon ruhig durch die Straßen des Orts gehn, werde fast gar nicht mehr von den Leuten geschmäht und geplagt.
Da jauchzte und sang etwas im Sollacherfräuln.
Wie sie der Mutter gliche! sagte der Vater jetzt zuweilen und klopfte ihr liebevoll die Wangen.
* * *
Und da tat der Sollacher ihr diesen Kummer an, scheuchte die Hablerin beinahe weg von ihres Heimatshauses Schwelle!
Es war ein paar Tage lang zum erstenmal in ihrem Leben selbst wie verhext zwischen ihr und ihm.
Dann machte der Sollacher seine Sünde aber nach Kräften wieder gut.
Es lag ihm etwas an seiner Schwester Achtung und Liebe, wie sie sah!
Er machte der alten Hablerin einen schwarzwollenen Schurz und ein klatschrosenrotes wollenes Kopftuch zum Geschenk, brachte ihr's höchst eigen ins Häusel, aß ein Stück Brot von ihrem, trank sogar einen Zug Wasser aus ihrem alten, reingewaschenen Krug.
Und die Grüße, die sie ihm für seine Schwester auftrug, richtete er ihr pünktlich daheim aus.
Da war ohne Aussprache und Auseinandersetzung der Frieden zwischen den Geschwistern wieder geschlossen.
* * *
Es war an einem strahlenden Frühlingsmorgen um jene Zeit.
Am Rande eines taublitzenden Kleeackers, zwischen dem Forsthaus und dem Seeort, schlichen die Geschwister mit der Schweißhündin Thora in frischer Morgenfrühe dahin in ihren derben, wasserfesten Schuhen, dem vertragenen, verwitterten, graugrünen Jagdzeug, ihren gleichfarbigen Jägerhüten, die Büchsen um die Schultern.
Weit drüben über der Fläche, die sie übersahen, dem Kleefeld, ein paar jungen Kornfeldern und der Schonung, die daran grenzt, wechselte jetzt manchmal einer der eingebildetsten Herren des Waldes, ein alter Rehbock, dem wegen wilder Streitsucht und Alleinherrschaftsgelüsten das Dasein nicht mehr gegönnt werden sollte, aus dem Holze heraus. Ein fürsichtiger, mißtrauischer Gesell war es. Der Sollacher hatte ihn schon einmal verfehlt, in unvorhergesehenem, raschem, wildem Flüchten war er der Kugel des treffsicheren Jägersmannes zu dessen wütendem Ärger entkommen. Sollte die Begleitung Hubertas, des jungen Madels, dem abergläubischen Herrn vielleicht heut extra Glück bringen?
Das Gesicht des Weidmanns war ein einziges Spannen, Schauen, Erwarten. –
Lautlos, wortlos hintereinander her schlichen die beiden Genossen, von dem prächtigen Hunde gefolgt, auf ein Gebüsch zu, das ihnen Deckung bieten soll.
Da, ein Schrei ärgerlicher Wut aus dem Munde des Sollacher, der der Huberta durch Mark und Bein dringt! Er läßt die Büchse sinken, die er schußbereit gehalten, stampft zornig mit dem Fuß auf, zeigt knirschend alle seine weißen Zähne und deutet verachtungsvoll nach dem weitentfernten Waldrand hinüber.
Hinter einer weißblühenden Schlehdornhecke ist dort eine menschliche Gestalt, ein mohnroter, leuchtender Tupf sichtbar geworden.
»Die Hex!« flüstert wütend der Sollacher. Huberta hat mit heftigem Erschrecken die Veränderung, die mit dem jagdglückhungrigen Weidmann vorging, mit angesehn. –
Auch ihre Blicke richten sich nun scharf, ängstlich auf die verdächtige Erscheinung hin.
Da wird sie plötzlich schneeweiß im Gesicht, dann rosenrot: »Das ist gar keine Alte! Das ist ja eine Junge!« schießt's ihr beseligend durch den Kopf.
»Bitt' schön! Schnell! Dei Perspektiv!« ruft sie den Bruder ungeduldig an.
Ein rascher Blick dann hindurch – –
Ein jauchzender Aufschrei! – – –
»Agnes! Agnes!« tönt's glockenhell, voll höchster, süßester Herzensfreude über Klee- und Kornfelder hinüber.
»Meine Agnes – Ag – – nes!«
Und »Hu – ber – ta!« ruft's in hallendem Freudenklange dagegen.
Zwei schlanke, lange Mädchengestalten fliegen dann in federndem, kräftigem Lauf, wie von einer inneren Flugkraft getragen, aufeinander zu, liegen einander in den Armen, lachen, vergießen ein paar glitzernde Freudentropfen, küssen, umarmen sich.
»Du da! Du da! Mei Lieb! Mei Lieb!«
»O du mei Herzensfreud'! Ist's denn wahr? Hab ich dich denn? Bist so groß geworden! So – – So – –!«
»Und du! Mei Agnes, mei liebe, liebe Freundin, ich küß di tot. Seit wann bist denn da? Wie bist denn da hergekommen in aller Herrgottsfrüh aus deiner französischen Schweiz?« –
»Zu dir hab' ich gewollt, dich überraschen, du mei Liebs! Hab' dir ja acht Tage nicht geschrieben, daß ich dir nichts Genaues zu sagen brauch' über meine Abreise! Und so früh ist's auch gar nicht mehr! Mir scheint, der Herrgott war doch schon noch länger auf, als wir heut morgen, daß er euch dahergeführt hat!«
»Du, o du, o du! So eine Freud'! So eine unmenschliche Freud', wie ich dein Gesicht erkannt hab' unter der roten Schleife auf deinem Hut!' – –
Sie hatten sich umschlungen, geben einander nicht gleich wieder her, achten nicht der Welt, nicht einmal des Sollachers.
Der muß sich an sie heranpirschen mit seinen neugierig windenden, vierbeinigen Jagdbegleiter in seinem endlich wiedergefundenen seelischen Gleichgewicht.
Freudig überrascht schaut er die Agnes an und begrüßt sie.
Huberta sieht mit leuchtenden Augen von einem zum andern.
Ein Rieseln wie von Frühlingsbächen fühlt sie da über ihre Seele gehn.
Die Agnes – jetzt sieht sie's erst genau, was sie vorhin nur so im allgemeinen, von ungefähr wahrgenommen hat, – – die Agnes, – die ist – – – herrlich ist sie!
Sie findet kein andres Wort!
Und ihr Bruder, ihr Sollacher! Was ist denn mit dem? Hat der sich auch verändert? Seit gestern? Vielmehr seit vorhin, wo der Zorn über die Hex ihm so grauslich stand?
So schmuck, so prächtig, so männlich schön, mit so gewinnendem Ausdruck hat sie ihn nie gesehn!
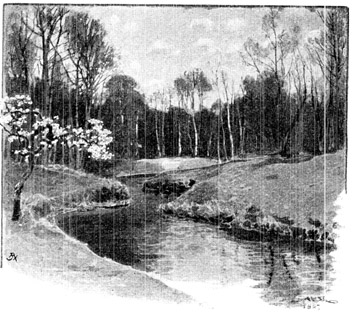
Was an ihm anders geworden ist, kann sie nicht sagen.
Er und die Agnes messen einander immer wieder erstaunt mit leuchtenden Blicken.
In heiterem Gespräch, lachender Wiedersehensfreude gehen die drei jungen Leute dann miteinander zwischen dem Kleefeld und dem stark und würzig duftenden Frühlingswalde dem Forsthaus zu, die Mädchen bald Arm in Arm, bald fest umschlungen.
Mit der Jagerei ist's heut morgen nichts.
Auf dem Weg bückt sich der Sollacher einmal zum Kleeacker nieder und hält ein wohlgeformtes, großes, mit Taufeuchtigkeit silberhell betropftes Vierkleeblatt in der Hand.
Am Abend desselben Tages hat er denn auch noch den alten vorsichtigen Rehbock geschossen.
