
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Am obersten Palcázu, eine Tagesreise flußaufwärts von seinem Zusammenfluß mit dem Chuchurras und ebensoweit vom letzten Siedler entfernt, in einer Gegend, in der man Jahr und Tag keinen Menschen sieht, stellte ich meine Hütte auf. Die zwei Flüsse sind mit zahlreichen anderen mittelbare Nebenflüsse des Ucayali und zählen zum südlichen Quellengebiet des Amazonas. War der Weg bis dahin eine mit fantastischer Vegetation ausgeschmückte Hülle gewesen, so paßte auf meinen Platz, eine winzige Oase in unbegrenzter Waldwildnis, und auf den ganzen Landstrich, einem der fruchtbarsten von ganz Peru und frei von Fieber und Stechmücken, ohne Übertreibung die viel mißbrauchte Bezeichnung Paradies.
Ich machte mir keine Gedanken darüber, daß ich ein Eindringling in indianisches Gebiet war. Weder hatten mich wissenschaftliche noch literarische Absichten hingeführt, noch wollte ich unbekannte Stämme entdecken – die fühlen sich auch ganz wohl, wenn sie nicht entdeckt werden –, ich war gekommen, um im Wald zu siedeln und zu leben: eine reine Existenzfrage also. Aber ich nahm niemand etwas weg und verjagte niemand. Ich hätte tausend oder auch zehntausend Hektar Wald in Besitz nehmen können, nicht nur ohne einen Pfennig dafür zahlen zu müssen, sondern auch ohne einen einzigen Indianer zu schädigen oder zu stören. Ich beabsichtigte ja nicht, Ölbohrtürme und Bergwerke oder auch nur eine Kaffeeplantage zu errichten und einige hundert Tagelöhner zu beschäftigen, um den Kaffee dann verbrennen zu müssen, weil ihn niemand kaufen kann. Mir genügte ein Platz, den man mit einem Stein überwerfen kann, denn ich konnte nicht einmal das, was da wuchs, allein aufessen.
Emilio Boettger, ein alter deutscher Kolonist zwischen Huancabamba und Oxapampa, erzählte mir, als ich bei ihm einkehrte, wie er angefangen hatte.
»Mit meinem Bruder Enrique kam ich nach unseren Kautschukfahrten hierher. Zuerst wurde uns das Vieh mit Pfeilen weggeschossen. Ich ging nach der Küste und kaufte Spielsachen. Die Sachen habe ich im Gebüsch aufgehängt. Am anderen Tag waren sie weggenommen und andere Sachen dafür hingehängt, Waffen, Schmuck und so weiter. Wieder habe ich allerlei Sachen unter einer kleinen Hütte im Freien aufgehängt. Da sind fünfzehn Mann gekommen und haben die Sachen heruntergenommen. Mein Bruder wollte das Gewehr nehmen. Du rührst mir kein Gewehr an! sagte ich. Die Wilden umringten uns und machten uns Zeichen, wir sollten mit ihnen kommen. Das wollte ich nicht, ich sagte, sie sollen zu uns kommen. Dann zählten sie an den Fingern: in fünf Monden, fünf Tagen, kommen wir wieder. Am fünften Tag kamen sie den Berg herunter. Ich hatte alles vorbereitet, ein großes Essen richten lassen und extra einen Stier geschlachtet; auch eine Arroba Schnaps fehlte nicht. Das gefiel ihnen, sie waren sehr zufrieden, und wir gingen mit in das Indianerdorf. Es waren viele Wilde, sie behandelten uns wie Brüder. So haben wir angefangen, und heute haben wir eine große Siedlung hier. Genau so haben wir es am Amazonas gemacht. Wir haben einige von unseren indianischen Freunden mitgenommen, die gingen voraus und sprachen mit den anderen, und wir warteten solange am Fluß. Dann holten sie uns, und wir wurden freundlich aufgenommen.«
Selbst wenn diese Geschichte nicht in allen Einzelheiten wahr sein sollte (unter den Farmern gibt es auch Märchenerzähler), so enthält sie doch die lehrreiche Moral, daß man mit den sogenannten Wilden, und besonders, wenn man etwas von ihnen haben will, zu seinem eigenen Besten auch menschlich umgehen kann.
Die ersten, die an meiner anfänglich recht kleinen Hütte zögernd vorbeischlenderten, waren zwei Campamädchen. Sie schienen eine Anrede zu erwarten, und ich forderte sie auf, hereinzukommen und meine gebratenen Bananen zu versuchen. Sie ließen sich das nicht zweimal sagen und waren auf ihre wildschämige Art fast kokett, dabei aber ganz unbefangen. Wären auch die Männer, die sich aus Neugier oder Zufall mit der Zeit nach und nach einfanden, so freundlich gewesen, dann wäre ich vielleicht stutzig geworden, denn mit Männern, die von Anfang an ungemein freundlich zu mir waren, habe ich noch nie gute Erfahrungen gemacht. Die Indianer waren in erster Linie schweigsam und, wenn man sie noch nicht länger kannte, von stolzem, finsterem oder auch sturem Ernst. Und eigentlich uninteressiert daran, was da vor sich ging. Platz gibt es ja im Überfluß, und solange einer nicht direkt von seinem bewohnten Boden vertrieben wird, berührt es ihn persönlich nicht, daß ein neuer Mensch da ist, sei es auch ein weißer. (Trotzdem fragte mich später einer, aus Neugier, weil er nicht verstand, warum ich mich ausgerechnet hier niederließ: »Warum machst du nicht auf deiner Erde Pflanzung?« Er meinte in meinem Vaterland.) Zu fürchten waren diese sanften, zahmen und friedfertigen braunen Leute nicht. Auch empfand ich ihnen gegenüber keine Machtgelüste, noch hatte ich eine versteckte Absicht, sie auf irgendeine Weise zu schädigen. Sicher haben sie das instinktiv auch gleich gespürt. Was mich am stärksten berührte, war, daß man mit ihnen, weil sie vollkommen arglos waren, auch gänzlich arglos verkehren konnte, ohne Sorge, Vorsicht oder Furcht vor Übervorteilung oder Boshaftigkeit und ohne die tausend mißtrauischen und unsicheren Empfindungen, die man unter zivilisierten Menschen fortwährend beachten und hegen und pflegen muß.
Die Amoishe, ein kleiner Stamm, der auf nur noch zweihundert Köpfe geschätzt wird, leben am Chuchurras und oberen Palcázu und deren Nebenflüssen. Die Campa, ihr Nachbarstamm, sind zahlreicher, vielleicht fünftausend. Ein Farmer sagte, es gäbe zwanzig- bis dreißigtausend Campa, doch das halte ich für übertrieben. Sie bewohnen das ausgedehnte, Gran Pajonal genannte Gebiet östlich des Pachitéa und Pichis bis über den Urubamba hinaus, doch heute vermischen sich die Wohnhütten der beiden Stämme schon zuweilen. (Der den Campas verwandte Stamm der Machigenga lebt südlich von ihnen am Urubamba und Paucartambo.) Die Campa sollen die Amoishe in früherer Zeit durch Überfälle stark dezimiert haben. Die kriegerische Feindschaft scheint erloschen zu sein, die Stammesabneigung in gemilderter Form noch zu bestehen, obwohl gegenseitig geheiratet wird.
Ihre ehemaligen Kämpfe waren Gefechte und Überfälle, doch kaum Schlachten, geschweige Kriege, zu nennen, mit Ausnahme vielleicht des Verteidigungskrieges der nordamerikanischen Indianer gegen die eingedrungenen Weißen. Der Krieg großer Massen und Völker unterscheidet sich von dem Kleinkrieg dieser einzelnen Volksgruppen – sichtbar an seiner technischen Vervollkommnung und Organisation – dadurch, daß die menschliche Intelligenz ihn ersinnt und ausführt, während jene nur triebmäßig kämpften.
Die Amoishe erschienen mir nachgiebiger und verbindlicher, aber auch versteckter, schlauer und weniger tatkräftig, die Campa dagegen freier und selbstbewußter, kampflustig, offen und ehrlich, eindeutig, grob und robust, allem Anschein nach der lebenskräftigere Stamm. Ein Campa geht z. B. nur höchst selten zu einem Weißen arbeiten, ein Amoishe jedoch schon eher, wenn auch nicht grade mit Begeisterung. Ursprünglich kann der Charakterunterschied der beiden Stämme jedoch kein bedeutender gewesen sein, da sie sich in vieler Beziehung sehr ähnlich sind. Nur ist das Wohngebiet der Amoishe ein Randgebiet, das an besiedeltere und zivilisierte Andengegenden angrenzt, und so leben sie dem zivilisierten Einfluß und der Gefahr der Blutvermischung und Ansteckung durch eingeschleppte Krankheiten näher. Die Campa sind von Gestalt meist etwas größer als die Amoishe, beide jedoch gleich stark, muskulös, sehnig und ausdauernd, die Gesichtszüge kräftig, kantig und intelligent. Fettleibigkeit (die das Bild der europäischen Badeorte beherrscht) habe ich bei Indianern nirgends angetroffen. Auch kennen die weitaus meisten Stämme keinen Bart und halten Haare im Gesicht für häßlich, aus welchem Grund ich mich auch bemühte, öfters rasiert zu sein und meine Visage mit den verrostetsten Rasierklingen mißhandelte. Entdeckt ein alter Indianer ein oder zwei fusselige Haare an seinem Kinn, dann sieht man ihn eitel damit beschäftigt, sie sorgfältig auszuzupfen.
Dem gleichmäßigen Klima, das weder die Spannung der wechselnden Phasen unserer vier Jahreszeiten, noch Unbeständigkeit der Witterung kennt, sind auch das ausgeglichenere Temperament und die spezifisch indianischen Charaktereigenschaften, Ruhe, stoische Gelassenheit, unendliche Geduld und Heiterkeit zuzuschreiben. Denn so ernst sie sind oder scheinen – während Melancholie nur den über das Schicksal ihres versklavten Volkes trauernden und durch die jahrhundertelange Unterdrückung verdüsterten Bergindianern eignet –, so tun sie doch unter sich und wenn die Scheu und Zurückhaltung vor dem Fremden überwunden ist, nichts lieber als lachen, scherzen, witzeln, spötteln und den kindischsten Unsinn treiben. Dabei lernt man sie als gutmütig, naiv, gläubig und verlässig kennen; nur darf man von ihnen dabei keine Pünktlichkeit erwarten, weil sie kaum einen Zeit-, geschweige einen Stundenbegriff kennen. Nicht zu vergessen ist ihr natürlicher Stolz, der Ausdruck ihrer persönlichen Freiheit und eines gesunden Kraftbewußtseins. Ihre Wortkargheit erscheint uns als Denkfaulheit, zutreffender aber wird sein, daß sie des Denkens ungewohnt sind, weil es in ihrem Dasein nichts zu denken gibt. Daß Schweigen beredsamer sein kann als Disputieren und Schreien, habe ich wie anderswo so auch bei ihnen bestätigt gefunden, und das sagt ja auch schon ein altes Sprichwort bei uns. Wer viel redet, der will meistens etwas zu seinem Vorteil, seltener etwas zum Vorteil anderer.
Zuerst ist jeder Indianer scheu, mißtrauisch, abwartend und zurückhaltend, oder sogar furchtsam. Auf dem Grunde seiner Scheu ruht das instinktive Wissen, daß ihm der weiße Eindringling seinen uralten Frieden rauben wird. Er kennt, sei es durch eigene Erfahrung oder aus Erzählungen anderer, in der Hauptsache drei Gattungen von Weißen, den Cauchero, den Missionar und den Farmer, und hat mit allen dreien keine guten Erfahrungen gemacht. Die bösesten mit den Gummisuchern, die in den entlegensten Busch eindrangen, und unter denen es Typen gegeben hat, die die Braunen zur Arbeit preßten und über den Haufen knallten, ihre Weiber vergewaltigten und ihre Kinder raubten und verkauften. Der Missionar, der zwar immer auch Händler, aber kein gewalttätiger Mensch ist, tut dem Indianer, von Ausnahmen abgesehen, sogar manchmal Gutes; aber der sieht in ihm meist nur einen komischen Kauz, der es sich in den Kopf gesetzt hat, ihm einen fremden Gott aufzureden, eine unerbetene Störung. Und der Farmer, der immer Arbeiter braucht, ist ebenfalls immer Händler, und nicht immer ein ehrlicher. (Wer, außer dem Soldaten, ist eigentlich kein Händler?) Was sich sonst noch in den Urwald verirrt, sind auch nicht die ersten Repräsentanten der weißen Menschheit, Goldsucher, Abenteurer, ausgerissene Sträflinge und Buschklepper aller Art, nur zuweilen, unter Orchideen-, Schmetterlings- und Felljägern, auch ordentliche Leute, und schließlich die harmlosesten, Naturforscher und Wissenschaftler. So sieht in der Vorstellung des Waldindianers die weiße Rasse aus; wir sind nicht grade außerordentlich beliebt bei ihm, so daß er in Verzückung geriete, wenn er uns sieht, noch fühlt er sich veranlaßt, einen ehrfurchtsvollen Kniefall vor unsereinem zu machen. Schließlich sind mir ja die Eindringlinge in sein Land, und die erlittenen Gewalttaten, Grausamkeiten und Mißhandlungen, von denen die Alten erzählen, mahnen sie zur Vorsicht.
Auf meinen Flußfahrten habe ich oft, wenn ich mich nach der Richtung erkundigen wollte und eine am Ufer liegende Canoa eine Hütte verriet, diese Hütte leer gefunden, oder es hockten uralte Weiber unbeweglich wie Statuen da und beachteten mich kaum mit einem flüchtigen Blick. Die Männer mögen auf der Jagd oder beim Fischen gewesen sein. Da ich aber meist auch weder junge Frauen noch Kinder sah, bin ich sicher, daß sie ebensooft vor dem längst erspähten Boot des Weißen ausgerückt waren und sich versteckt hatten.
Der allererste, dem ich begegnete, stand plötzlich vor mir wie aus dem Boden gewachsen. Er hatte mich sicher gesehen und gehört, ich ihn nicht. Unbeweglich stand er da, Pfeil und Bogen in schußbereiter Haltung, lauschend und gespannt. Mich beachtete er nicht, die Jagd war wichtiger. Vielleicht habe ich ihm das Wild vergrämt, doch nichts in seiner Miene verriet irgendeine Regung.
Die nächsten waren drei junge Burschen, die, splitternackt, beisammenstanden. Als ich vorbeiging, verloren sie keinen Blick nach meiner Wenigkeit.
Nie sieht oder hört man einen Indianer kommen, er geht, wie das Tier, lautlos und unsichtbar.
Kam einer bei meiner Hütte an, dann brachte er entweder etwas oder er wollte etwas. Davon zu reden, fällt ihm jedoch nicht ein. Er legt seine Pfeile auf die Erde, dann bleibt er stehen oder hockt sich nieder und sagt gar nichts oder erzählt seine letzten Jagderlebnisse. Ist er fort und schon verschwunden, dann schreit er von weitem, als würde es ihm erst jetzt einfallen, was übrigens auch möglich ist: »Señor! No tienes un poco polvero?« (Hast nicht ein bißchen Schießpulver?)
Oder er wartet ab, ob man es nicht errät, was er will, oder ob die Rede zufällig darauf kommt. Ist das nicht der Fall, dann geht er auch wieder, ohne seinen Wunsch geäußert zu haben.
Der Indianer berührt kein fremdes Eigentum. War ich mehrere Tage von meiner Hütte weg, ließ ich alles liegen, wie es war; meine Uhr lag auf dem Tisch, Malsachen, Papiere, Werkzeug, vielerlei Dinge, die wir brauchen. Wenn ich zurückkam, lag alles so unberührt da wie vorher. Auch er läßt sein offenes Haus, wenn er jagen geht, mit allem Eigentum, Geschirr und Körben, Vorräten, Waffen und Geräten, tage- und wochenlang allein. Das Haus hat keine Tür und kein Schloß, doch niemand, wer auch vorbeikommt, betritt es, und noch weniger würde ein Indianer auf den Gedanken kommen, einen Gegenstand, der ihm nicht gehört, anzurühren oder gar wegzunehmen.
Bei einem heftigen Gewitterregen, der auf dem spritzenden Wasser die Sicht versperrte, lenkte ich mein Boot ans Ufer, um den Regen abzuwarten, und kam an eine leerstehende Hütte. An den herumliegenden Gegenständen sah ich, daß sie bewohnt war. Obwohl es der Sitte gemäß ungehörig ist, glaubte ich es doch wagen zu dürfen, einige Bogen und Pfeile mitzunehmen, wenn ich dafür Glasketten und billigen Schmuck hinlegte. Während ich mir ein paar Pfeile aussuchte, kam der Indio zurück. Er hatte Flußenten geschossen, legte sein durchnäßtes Hemd aus Rindenfaserstoff ab und zog ein trockenes an. Er war prachtvoll gebaut. Ich sah aber auch, daß es ihm nicht sonderlich gefiel, seine Waffen in meiner Hand zu sehen. Ich hatte einige Glasketten auf das Geländer gelegt, zeigte sie ihm und machte ihm deutlich, daß ich seine Pfeile nur gegen Hinterlegung dieser Sachen mitgenommen hätte. »Für deine Frau!« sagte ich und gab ihm noch eine Handvoll dazu, Blechbroschen und Messingringe mit falschen Steinen. Sie lieben diesen für uns wertlosen Schund, weil er glitzert und weil es etwas ist, das es bei ihnen nicht gibt und das sie sich weder verschaffen noch selbst anfertigen können. Darin besteht für sie der Wert solcher Sachen, und nicht etwa im Metall wert. Der zuerst so finstere Indianer war jetzt wie umgewandelt, freute sich kindlich, drängte mir mehr Bogen und Pfeile auf, als ich haben wollte, und suchte die schönsten aus.
Wenn man nun annimmt, daß Ehrlichkeit und Uneigennützigkeit indianische Charaktereigenschaften sind, was allerdings zutrifft, so ist damit nicht gesagt, daß sie diese Ehrlichkeit auch unbedingt beibehalten würden, wenn sie unter Verhältnissen leben müßten, die vom Geld regiert werden. Sie kennen eben das Geld noch nicht, das, eine Geißel der Menschheit, nicht nur dem Sorgen bereitet, der es nicht hat, sondern auch dem, der es hat, und haben darum keine Gelegenheit, sich in Versuchung führen zu lassen oder Standhaftigkeit zu beweisen. Ihre Existenzumstände sind so, daß jeder das hat, was er braucht, weil es die Natur keinem verwehrt. Die Wildnis hat alles und gehört allen, und so gibt es in ihr weder Arme noch Reiche, keiner ist weder um seine Ernährung noch um sein Eigentum besorgt, da er genug von beidem besitzt und es jeden Augenblick ergänzen und erneuern kann; und seinem Nachbarn etwas zu stehlen, lohnt sich nicht und wäre sinnlos, da keiner etwas hat, das nicht jeder besitzt oder sich ohne Schwierigkeit verschaffen kann.

Ein Dynamitschuß – siebzig Fische.
Der Mann mit dem Hut ist ein Deutschrusse, der einen Weg bauen sollte. Die Indianer sind Amoishe. Der Mann mit dem Gewehr ist ein Mischling

Das festliche Barbasco-Fischen in San Antonio
Unter meinen Nachbarn war ein einziger junger Indianer, der sich für Geld interessierte und einen gewissen Sammeleifer für Geldmünzen an den Tag legte. Da er aber die einzelnen Münzen und ihren Wert nicht kannte und nur bis fünf zählen, aber auch mit diesen wenigen Zahlen nicht rechnen konnte, vermochte ihm seine Sammelleidenschaft keine großen Vorteile zu bringen, im Gegenteil hätte man ihn, wenn man wollte, dabei nach Strich und Faden betrügen können.
Aus diesen Eigentumsverhältnissen der Indianer, die Geld, Kauf und Verkauf und Anhäufung von Vermögen nicht kannten, war auf ganz organische Weise der sozialistische Incastaat entstanden.
Genau so unbekannt wie der Diebstahl ist dem Indianer die Lüge, wenn er auch gerne fantastisch ausgeschmückte Erlebnisse erzählt und erfindet, harmlose Aufschneidereien, die wir Jägerlatein nennen, oder von Aberglauben und Geisterfurcht erzeugte Gruselgeschichten, die es auch bei unseren Bauern gibt. Lügen um eines Vorteiles willen aber hat unter ihnen keinen Zweck, weil nichts dabei herausspringt, und einen anderen zu übervorteilen ist nicht möglich, weil es keine Geschäfte zu machen gibt.
So wenig wie das Geld existiert für den Waldindianer der Begriff Arbeit, wie wir ihn verstehen. Das Wort Arbeit gibt es in keiner Indianersprache; schon daraus ergibt sich, daß dieses Jäger- und Fischervolk keine Leistung kennt, die für andere, für den Stamm oder die Gemeinde, getan wird – es sei denn eine Hilfeleistung –, sondern nur die Beschäftigung, die der Familie dient. Schon die weißen Eroberer der südamerikanischen Küstenstriche haben die Erfahrung machen müssen, daß der Indianer als Arbeiter und Lohnverdiener wenig brauchbar ist, und darauf ist die Einwanderung der arbeitswilligeren Neger, die mit dem Sklavenhandel begann, nach Brasilien, Westindien und in die Staaten zurückzuführen.
Dabei ist der Indianer keineswegs träge oder leistungsunfähig. Er geht auf der Jagd acht und zehn Stunden durch den Wald, und das mehrere Tage hintereinander, und rudert ebensolange, ohne einmal zu ermüden oder zu rasten. Er kann vom Morgen bis zum Abend neben einem trabenden Pferd herlaufen, ohne außer Atem zu kommen, und acht Tage lang durch pfadlose Wildnis und knietiefen Schlamm eine Zentnerlast schleppen, bei jedem Wetter, mit einfachster Nahrung und ohne Unterkunft und größere Rastpausen. Einen Weg, zu dem ich sieben Tage gebraucht hatte, ging ein Indianer hin und zurück in vier Tagen.
Aber wenn der Indianer auch faul wäre wie ein Faultier, würde es ihm trotzdem schwerlich gelingen, zu verhungern, es sei denn, er wäre auch zum Essen zu träge.
Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mit meinen indianischen Nachbarn in ein nicht nur scheinbares, sondern wirkliches Freundschaftsverhältnis kam. Ausschlaggebend dabei war – was sich unschwer beobachten ließ –, daß sie schließlich nach einiger Zeit rausgehabt haben, daß ich kein Händler und nicht darauf aus war, sie auszunützen, denn das merkt auch der primitivste Mensch, und ohne daß er in seinem Leben jemals etwas vom Sozialismus gehört hat. Ich zeigte mich im Gegenteil, im Rahmen meiner bescheidenen Verhältnisse natürlich, als freigebig, und mit Geschenken, auch den kleinsten, sind sie zu gewinnen wie Kinder. Im übrigen begegnete ich ihnen nie mit dem überheblichen Hochmut, den manche Weiße für angebracht oder klug halten, sondern war unter ihnen und gegen sie genau so leger und kameradschaftlich, wie ich das unter meinen Landsleuten auch bin. Auch scheute ich mich nicht, für einen einzutreten, wenn es irgendein Farmer gar zu stark trieb und einen unerfahrenen, gutgläubigen und unwissenden Indianer auf allzu plumpe Weise zu betrügen versuchte.
Hat der Indianer einmal mit einem Weißen Freundschaft geschlossen, dann läßt er ihn in unwandelbarer Anhänglichkeit niemals im Stich.
Etwa ein Jahr oder anderthalb hat es gedauert, bis sich die Indianer, die ich kannte, ohne ihre anfängliche verschlossene Fremdheit so offen und rückhaltlos mit mir unterhielten wie mit ihresgleichen. Und wenn mein Ausflug in die Wildnis belohnt wurde durch die Einkehr in die unversehrte Urwelt von Pflanze und Tier, so erlebte ich jetzt die Begegnung mit Menschen, die sich seit der Zeit ihres Urzustandes bis heute kaum verändert haben.
Da sie nicht mehr kennen als den Ort ihrer Geburt und seine nähere Umgebung, und über diese Erfahrung hinaus nichts wissen, so ist ihre Vorstellung von fremden Ländern, Menschen und Einrichtungen – die zunächst nicht vorhanden ist, sondern erst entsteht, wenn man die Rede auf dergleichen bringt – so naiv wie komisch und dabei doch auch wieder aufschlußreich.
Oft mußte ich mich verteidigen, wenn ich auf ihre Art ungeschickt war, und darauf hinweisen, daß auch sie, auf andere Weise, ungeschickt sind. So wollten mich einmal zwei Weiber auf einem Abkürzungsweg an den Fluß führen. Sie rannten voraus, und ich konnte ihnen, barfuß auf dem dornigen, kaum sichtbaren Wirrpfad, nicht rasch genug folgen, sah sie nicht mehr und verirrte mich in dem grünen Labyrinth. Ich schrie und sie antworteten, ganz nah, aber es nützte nichts, ich war gefangen im Dickicht.
»Hier! Hier!« schrien sie in einem fort.
»Es ist kein Weg!« rief ich. Schließlich fluchte ich aus Leibeskräften, und nun kam eine zurück.
»Da ist doch der Weg!«
Sie zeigte ihn mir, indem sie auf allen Vieren unter dem Geäst durchkroch, auf einer Spur von Weg, die sich sogleich wieder verlor. (Und das spielte sich noch keine fünf Minuten von meiner Hütte entfernt ab.)
Noch in der Nacht lachten und scherzten sie darüber, daß der weiße Señor den Weg nicht gefunden habe.
»Wer nicht im Wald geboren ist«, sagte ich daraufhin, »der lernt es nie, durch den Wald zu gehen. In dem großen Dorf, wo ich geboren bin (ich mußte Dorf sagen, Stadt hätten sie nicht verstanden), würdet ihr den Weg auch nicht finden!«
»So?«
Sie staunten, und die Männer bestätigten ganz ernst die Richtigkeit meiner Worte, als wüßten sie, wie so ein »Dorf« aussieht.
»Wachsen auf deiner Erde auch Bananen?« wurde ich öfters gefragt. Ich mußte ihnen dann sagen, daß bei uns Bananen nicht wachsen, weil es zu kalt ist, aber von heißen Ländern mit großen Canoas über das Meer gebracht werden und dann mit Geld gekauft werden können.
Die Unterhaltung über ein einziges solches Thema dauerte nicht nur Stunden und Tage, sondern wurde oft nach Wochen und Monaten wieder aufgegriffen und fortgesetzt.
»Warum ist es bei euch kalt? Was ist ein Meer?« und ähnliche Fragen waren nicht leicht zu beantworten und beschäftigten die Wißbegier der Männer, solange ich unter ihnen lebte.
Da sie das Rad nicht kennen, zeigte ich es ihnen praktisch, um dann erklären zu können, was ein Wagen, ein Auto, eine Eisenbahn ist. Ich schnitt aus einem Stück Karton zwei runde Scheiben, durchlöcherte sie und steckte ein Holz durch. »Wenn ihr darauf eine Canoa legt, dann kann sie auf dem Land fahren«, sagte ich. Dann erzählte ich ihnen, daß solche Wagen, »fahrende Canoas«, bei uns nicht nur auf der Erde fahren, sondern auch unter der Erde und sogar über die Dächer der Häuser hinweg. Von da an hielten sie mich für einen solchen Lügenbold, daß ich nichts Derartiges mehr erzählen konnte, ohne daß sie in schallendes Gelächter ausbrachen.
Daß es Pferde gibt, hatten sie gehört, gesehen aber hatte nur irgendein einzelner eines, oder wenigstens ein Maultier. Selbstverständlich hielten sie meine Versicherung, daß unsere Wagen ohne Pferde und Mulas ganz allein fahren können, für eine ganz ungeheuerliche Lüge. Die Tatsache, daß es so etwas geben kann, interessierte sie nicht, weil sie es nicht glaubten, daß mir aber solche »verrückte Sachen« einfielen, belustigte sie, und mein vermeintliches erfinderisches Talent imponierte ihnen; dieser Zug an mir war ihnen auch kein fremder, weil sie selbst auch gerne ungewöhnliche Erlebnisse erzählen, wie etwa die Begegnung mit einem Fisch, der einen Totenkopf hat, und ähnliches, aber freilich bei weitem nicht so tolle Sachen, wie sie mir in den Sinn kamen.
»Bei uns gibt es ein Telephon«, sagte ich einmal. »Ihr wißt nicht, was das ist – ich werde es euch zeigen.« Ich nahm eine Schnur, band sie an einen Pfosten der Hütte und ging mit dem anderen Ende einige Schritte weg. »Die Schnur kann viel länger sein«, erklärte ich, »so lang, daß ich mit ihr über den Fluß gehen kann, oder bis zum Pichis, nach Cahuapanas (ein Missionshaus), oder auch nach Iquitos, ganz gleich wohin; am anderen Ende der Schnur ist eine Muschel, und wenn ich da hineinrede, dann gehen meine Worte auf der Schnur bis zu euch und ihr könnt alles hören, wenn ihr mich auch nicht seht!«
Schmunzeln, Grinsen, Lachen, Kopfschütteln – das war wieder ein »ganz verflixter Witz«. Einer wandte ein: »Worte können nicht gehen, weil sie keine Beine haben.«
(Als das Telephon bei uns noch neu war, glaubte ein einfältiger Bauer, da stecke einer im Kasten drin.) Fehlte nur noch, daß ich ihnen auch noch den Film und das Fernsehtelephon erklärt hätte. Schon Telegraph und Radio zu schildern, wäre auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen. Sie kennen zwar selbst eine Art »Telegraphie«, die aus einem hohlen Baumstamm gefertigte Signaltrommel, aber diese ihre Nachrichtenübermittlung ist eine rein akustische. Stämme, die diese Trommel nicht kennen oder nicht benützen, müssen einen sehr schnellen mündlichen Nachrichtendienst haben. So war die Neuigkeit von meiner Ankunft bei den Amoishe, wie bei allen Indianern, die ich traf, stets schon einige Tage vor mir da, ohne daß ich ein Boot, das mir vorausgefahren wäre, zu Gesicht bekommen hätte. Übrigens muß ich gestehen, daß das Radio, wenn es mir einer noch so ausführlich erklärt, sogar mir trotzdem ein unbegreifliches Rätsel bleibt, obwohl es, wie alles Technische, rein technisch höchst einfach zu verstehen ist.
Ich habe nicht etwa die Absicht gehabt, die Indianer mit allen technischen Errungenschaften der Zivilisation bekanntzumachen – wozu vermutlich ein ganzes Leben nicht ausreichen würde –; es fielen mir nur manchmal diese und jene Dinge aus Europa ein, vielleicht deswegen, weil sie so weit weg waren. Und öfter, als ich absichtlich etwas zur Unterhaltung beisteuerte, geschah dies ganz unabsichtlich.
Als ich eines Tages einem jungen Indianer sagte, daß ich sie bald verlassen werde, weil ich wieder nach Deutschland gehe, nach »meiner Erde«, sagte er: »Ich geh' mit!«
Ich sagte, das ginge nicht, weil es zu weit sei.
»Wie weit? Drei Tage? Oder vier Tage?«
Er meinte, man brauche nur einige Tage durch den Wald zu wandern und dann wäre man in Deutschland. Meine weitläufige Schilderung der etliche tausend Kilometer langen Reisestrecke hielt er für eine schlaue Ausrede, und obwohl er dabei lachte und scherzte, entging mir nicht seine Resignation, in der er bei sich festgestellt haben mag, daß eben alle Weißen untreue Burschen sind, die eine wirkliche und dauernde Kameradschaft nicht kennen.
Nein, nein, wir unterhielten uns nicht nur über technische Dinge! Ihr beifallsfreudiges und dankbares Lachen regte meine Fantasie zu allen erdenklichen, wenn auch keineswegs immer geistvollen Einfällen an. Wenngleich ich mir immerhin etwas dabei dachte, wenn ich ihnen erzählte, daß es bei uns Menschen ohne Kopf gibt, während sie das wörtlich nahmen und dabei nicht etwa an »kopflose« Menschen dachten, sondern sich solche vorstellten, die keinen Kopf auf den Schultern haben. Wie sie an Dinge, die es wirklich gibt, um keinen Preis glauben wollten, so nahmen sie dann wieder das Unmöglichste ganz ernst für bare Münze.
Dann wurden Fragen gestellt.
»Der keinen Kopf hat, wie kann der gehen?«
»Der wird geschoben, von seinen Freunden!« zog ich mich aus der Schlinge.
»Hat er keine Augen? Wie ißt er?«
Ich geriet nicht in Verlegenheit und ließ ihm ein Auge auf dem Buckel wachsen und einen Mund auf dem Bauch. Bis dann alle Fragen beantwortet waren, hatte ich eine derartige anatomische Abnormität zusammengestoppelt, daß ich wollte, ich hätte so eine, um sie an einen Schaubudenbesitzer verkaufen zu können.
In der Skala in Berlin sah ich einmal einen armlosen Artisten, der alles, was Arme und Hände tun, mit den Füßen verrichtete. Aber das machte ihnen keinen großen Eindruck, es war ihnen nichts Ungewöhnliches, weil sie selbst bei verschiedenen Hantierungen die Füße und Zehen zu Hilfe nehmen. Wenn ich ihnen erzählt hätte, was in Romanen über Tigerjagden, Orchideenjäger, Giftpfeile, Menschenfresser und Piranhas usw. steht, dann hätten sie mich ausgelacht. Ich mußte zu kühneren Erfindungen greifen, zum richtigen Märchen. Ich konnte ihnen wohl sagen, z. B. daß es Leute gibt, die mit den Händen reden, wobei sie dann meinten, daß diese den oder die Munde in den Händen haben und das sehr lustig und komisch fanden, oder auch solche, denen beim Husten die Zähne herausfallen; doch dies verursachte ihnen mehr (abergläubischen) Schrecken als Belustigung, wie uns auch; aber ihnen zu erzählen, daß wieder andere Bäuche haben wie Fässer und keine Haare auf dem Kopf, und daß ihre Schädel so glatt sind wie der Mond, solche billige naturalistische Beschreibungen sagten ihnen weniger als meine technischen Schilderungen, die sie immerhin für märchenhafte Lügen hielten. Ich mußte alles ins Unglaubliche, Unmögliche und Unfaßbare steigern, wenn ich Glauben finden wollte, und welcher Erzähler möchte das nicht. Diese zwar kindlichen, aber bei ihren täglichen Verrichtungen ganz nüchtern und praktisch denkenden und handelnden Menschen wollten nur fantastische Märchengeschichten hören und glauben.
»Es gibt auch Menschen mit zwei Köpfen und mit drei Beinen, eins in der Mitte und zwei an der Seite!« log ich.
Herzzerreißendes Gelächter verriet, daß sie trotz ihrer sonst so eindimensionalen Anschauungsweise das unwillkürlich Doppelsinnige dieser Figur sofort begriffen hatten, obwohl sie Zweideutigkeiten nicht verstehen, dagegen die freie, gerade Eindeutigkeit mit harmloser Lustigkeit quittieren. Ihr Vergnügen an derben Erwähnungen unaussprechlicher Körperteile und erotischer Vorgänge ist kindlich und natürlich, genau so wie im noch unverfälschten Oberbayern; und so beruhte es wieder nur auf ihrer herausfordernden Befruchtung meiner Lügenerfindungsgabe, wenn ich ihnen zum Zeitvertreib oft nicht nur obszöne, sondern auch möglichst komische und fantastische Münchhausiaden auftischte, die bestimmt noch nirgends gedruckt sind und es auch nicht werden. Sie wollten sich dann kaputt lachen, während die Weiber, wenn sie in der Nähe waren, so taten, als ob sie nichts hörten oder verstünden, dabei aber insgeheim unter sich kicherten.
Da ich mein beschriebenes Manuskriptpapier verrauchte, wollten sie wissen, was auf »diesen Zigarren steht«. Ich las dann irgendeinen Blödsinn ab – der vielleicht auch nicht viel dümmer war als das, was wirklich auf dem Papier stand:
»Es war einmal ein Häuptling bei den Machigenga, der hatte ein himmelblaues Hinterteil und einen fünf Meter langen Schwanz. Er hieß Hupfender Floh und seine Tochter, die sehr schön war, aber nur ein Bein hatte, hupfte mit einem Bein im Wald spazieren.«
»Mit einem? Was machte sie im Wald? Warum war der Häuptling hinten blau?«
»Das weiß ich nicht« (ich wollte mich drücken), »das steht nicht mehr auf der Zigarre.«
»Du hast noch mehr Papierchen, lies uns, wie es weitergeht!«
War ihre Neugierde entbrannt, dann mußte ich, ob ich wollte oder nicht, die »Geschichte« zu Ende bringen.
Solchen Kohl erzählte ich ihnen und sie nahmen alles für wahre Begebenheiten. Und wenn sie sich anfänglich etwas geringschätzig über meine Papierwirtschaft gewundert hatten, so merkte ich später, daß sich dahinter doch auch ein gewisser Respekt verbarg, denn Buchstabenzeichen auf Papier machen und entziffern können, ist eine Zauberei, eine geheimnisvolle Fähigkeit, mit der man Gutes wie Böses bewirken kann.
Aber es bedurfte keineswegs immer Geschichten, sie lachten über die geringsten Kleinigkeiten und wunderten sich oft über etwas, so daß ich mich wieder über sie wundern mußte.
Ein junger Indianer, der sah, wie ich mich rasierte, lachte furchtbar. Ich fragte ihn, was es da zu lachen gäbe.
»Du siehst aus wie ein Carpintero!« antwortete er und krümmte sich vor Lachen.
Der Carpintero ist ein Äffchen, das um das Kinn einen weißen Fleck hat, genau so, als hätte es sich eingeseift.
Eine Canoa war wackelig, so daß man achtgeben mußte, nicht ins Wasser zu fallen.
»Kannst du schwimmen?« fragte mich der mich begleitende Indianer.
»Wie ein Fisch!« war meine Antwort.
Warum ihn das so zum Lachen brachte, daß wir beinahe umgekippt wären, war mir zunächst unverständlich. Bis ich dahinterkam: der Indianer weiß nur zu genau, wie ein Fisch schwimmt, nämlich blitzschnell und ohne Arme und Beine; darum muß ihm der Vergleich, daß ein Mensch wie ein Fisch schwimmen kann, äußerst komisch vorkommen.
Ein Peon sagte einmal zu mir, als wir nachts am Feuer hockten: »Bei euch ist Krieg gewesen?«
Er war ein Bergindianer, lebte in einer einsamen Hütte, kam aber wohl ein wenig herum und da und dort auch in ein Städtchen, in dem es vielleicht sogar eine Zeitung gab, die er zwar nicht lesen konnte, aber man wußte und hörte da einiges von der Welt draußen. Und so hatte er auch von dem großen Krieg in Europa gehört.
»Wie viele habt ihr totgemacht?«
Ich konnte ihm keine Zahl nennen, denn wenn ich gesagt hätte, soundso viele Millionen, dann hätte er damit ebensowenig anzufangen gewußt, wie wenn ich etwas Chinesisches gesagt hätte. Ich deutete nach dem Nachthimmel und sagte: »Mehr, als du dort oben Sterne siehst.«
Er schwieg eine Zeitlang. »Warum?« sagte er dann.
Was konnte ich ihm antworten. Daß die Aktionäre der Waffenindustrie verdienen wollten?
»Sie wollten Deutschland kaputt machen«, sagte ich.
»Die Feinde?«
»Ja, die Feinde.«
»Warst du auch dabei?«
»Ja, ich war auch dabei. Vier Jahre hat es gedauert.«
»Habt ihr verloren?«
»Nein.«
Der Indianer schwieg. Im Schein des Feuers sah ich, daß über sein faltiges Kupfergesicht ein beglücktes Lächeln huschte, als wäre er der Sieger gewesen.
Was schon unter uns zutrifft, daß niemand etwas versteht, das nicht in ihm selbst ist, das gilt noch mehr in einem fremden Land und Klima. Niemand kann aus seiner Haut heraus und noch weniger in eine andere hinein. Man kann auch mit dem besten Einfühlungsvermögen nicht mehr sehen, fassen und aufnehmen, als was man kraft seiner Abstammung schon kennt, und das einem dann von anderer Seite als gleichartig und verwandt entgegenkommt.
Amoishe wie Campa bauen ziemlich das gleiche rechteckige Haus, das verschieden groß ist, je nach der Kopfzahl der Bewohner eine winzige Hütte oder ein geräumiges Haus. Die Konstruktion ist pfahlbauartig, der Fußboden, der zugleich Sitz- und Schlafplatz ist, befindet sich einen halben bis einen Meter über der Erde. Diese Bauart sorgt für Durchlüftung; auf den Erdboden gelegtes Holz würde faulen und Insekten ansammeln. Die Stützsäulen, die das Dachgerüst tragen, sind sehr harte, runde Palmstämme, die in die Erde eingegraben werden. Das Dachgebälk – Satteldach – besteht aus Harthölzern, die nicht von Ameisen oder Holzwürmern angegriffen werden. Es wird von unten nach oben mit großen, ineinander verflochtenen Palmwedeln, meist der Yarinapalme, bedeckt. Dieses regendichte Dach hält zehn bis zwölf Jahre. Alle Hölzer des Hauses sind mit gespaltenen zähen Lianen oder mit Rindenbast verbunden, eine sehr haltbare und gleichzeitig elastische Befestigung. Der Boden – Barbacoa – besteht aus den Stämmen der Ponapalme, die mit weichem Mark gefüllt ist. Der Stamm wird gespalten und aufgerollt und ergibt ein jalousieartiges Brett. Massive, aus dem Baum geschnittene Bretter sind unbekannt. Hütten ohne Barbacoa begnügen sich mit dem festgetretenen Erdboden. Zur Barbacoa führt zuweilen eine Stiege hinauf, entweder ein Baumstamm, in den Stufen gehauen sind, oder eine aus Ästen zusammengebundene Art Leiter. Die Amoishe bringen gerne an einer Seite der Hütte ein Geländer an, vielleicht die Veranda der Farmerhäuser nachahmend. Wände und Abteilungen werden nur selten errichtet. In größeren Häusern bestehen häufig zwei nicht sichtbar gemachte Abteilungen für Männer und Frauen. Das Haus, das immer auf einem größeren oder kleineren, freien, vom Unkraut gesäuberten Platz steht, ist ein Dach auf Säulen; und so lebt der Indianer (es ist hier immer von den gleichen zwei Stämmen die Rede) nicht eingeschlossen und eingewandet, sondern unter einem Dach im hellen, luftigen Freien. Das weit überhängende Dach verhindert das Eindringen des Regens, zuweilen werden auf der Windseite auch Matten aufgehängt. (Mein auf die gleiche Art errichtetes Haus enthielt eine Rück- und zwei Seitenwände, die Vorderseite schloß ein Geländer ab.) Alles zum Hausbau Nötige liefert der Wald. Da die Waldungen verschieden sind, ist dieses Material nicht immer das gleiche; nicht überall gibt es die gleichen Palmen- und anderen Hölzer. So richtet sich die Bauart auch nach den in der Umgebung vorkommenden Hölzern, die oft aus weiter Entfernung hergeholt werden müssen. Am Ucayali sah ich, daß Hütten und Häuser statt aus Palmenholz, das dort selten ist, aus cañia brava errichtet sind, dem wilden Zuckerrohr. Dieses bambusähnliche, fünf, sechs Meter lange, starke und naturpolierte Rohr ist ein sehr gefälliges und sauberes Material.
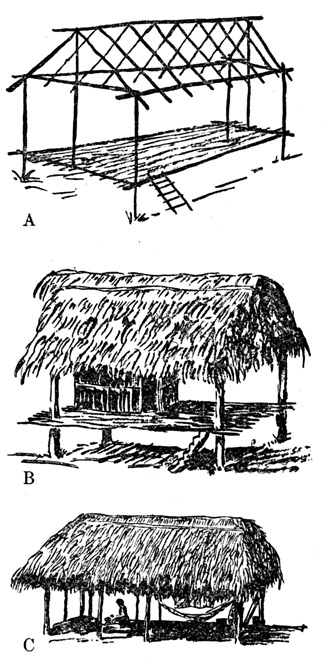
Amoishe-Haus.
A Konstruktion
B mit hochliegendem Fußboden (Barbacoa) und Schlafabteilung,
C ohne Fußboden
Einen Küchenraum gibt es nicht. Die Feuerstelle befindet sich entweder neben dem Haus auf der Erde, oder, seltener, im Haus auf einer Lehmunterlage. Das Feuer wird mit Feuersteinen und getrocknetem Baumschwamm, zuweilen auch mit Hilfe eines Stückes von einem alten Eisen angezündet, doch nur selten, da es nie ausgeht und Hölzer verwendet werden, die Wochen, ja selbst Monate lang glimmen. Die ganzen, nicht zerkleinerten Stämme werden sternförmig auf die Erde gelegt und da, wo sie zusammenstoßen und brennen, der Kochtopf daraufgestellt. Die Indianerin ist gewöhnt, vor dem Feuer zu kauern und würde ein Herdfeuer, vor dem sie stehen müßte, ablehnen.
Die Häuser beider Stämme stehen nie in Gruppen, sondern stets einzeln in Entfernungen von einem Tagemarsch und mehr voneinander.
Der Hausbau ist Männerarbeit, nur das Flechten der Dachblätter besorgen die Weiber.
Bei anderen Stämmen sah ich bienenkorbartige Rundhütten, ein auf die Erde gesetztes Haubenblätterdach, das nur eine einzige Öffnung zum Hineinschlüpfen besaß. Andere nomadisierende Stämme errichten nur Windschutzdächer oder spannen Hängematten zwischen den Bäumen. Am Ucayali sah ich hochstelzige, taubenschlagartige Sommerhütten, die von dem betreffenden Stamm nur während der trockenen, zum Fischen günstigen Zeit bewohnt wurden, und die sie beim Eintritt der Regenzeit, wenn sie sich auf höherliegendes Gebiet zurückzogen, dem Hochwasser überließen.
Mein Haus auf andere als Indianerart zu errichten, ist mir nicht in den Sinn gekommen, da ich ja das den klimatischen und vegetativen Verhältnissen entsprungene und angepaßte Beispiel deutlich genug vor Augen hatte. Der Bau eines Steinhauses hätte Ziegelsteine, Kalk und Zement und geschnittene Balken und Bretter erfordert, deren Herantransport, wenn er überhaupt möglich war, teurer gewesen wäre als diese Materialien selbst.
Einrichtung haben die Häuser keine. Es gibt weder Tisch, noch Stuhl oder Kästen (oder einen Waschtisch mit zu niedrigem Spiegelaufsatz, in dem man sich nur bis zum Hals sieht), höchstens einmal ein niedriges Stück Holz als Schemel. Als Schlafstätten dienen von den Weibern geflochtene Matten. Hängematten waren beiden Stämmen unbekannt. (Die Yaguas am Amazonas verfertigen kunstvoll geknüpfte und sehr haltbare Hängematten aus Bastschnüren.) Ein junger Indianer sah einen Tisch bei mir und wollte sich auch einen anfertigen; er brachte ihn auch zustande, aber nicht zum Stehen. Kochgeschirre und Wasserbehälter sind (wenn ihnen nicht ein Farmer oder Missionar als Arbeitslohn Aluminiumtöpfe und dergleichen aufhalst) von den Frauen in Wulsttechnik angefertigte Tontöpfe und Krüge, ebenso auch Trink- und Eßschalen. Von einigen wurden Flußmuscheln als Löffel benützt, meist aber die Suppe getrunken. Gabeln sind unbekannt. (Wer etwas vom Essen versteht, der weiß, daß manche Speisen mit den Fingern gegessen besser schmecken als mit unseren dabei barbarisch wirkenden künstlichen Eßwerkzeugen.) Auch ausgehöhlte Kürbisse dienen als Eßgeschirre, und die in allen Größen vorkommenden Hüllen der Flaschenkürbisse als Wasser- und Massatobehälter, die kleinen für gestoßenen Kalk, der beim Kokakauen gelutscht wird. Diese Flaschen werden mit den Spitzen der entkörnten Maiskolben verschlossen. So wachsen nicht allein Früchte, sondern auch Geschirre, Schalen, Flaschen und Teller auf den Bäumen. Fast in keiner Hütte fehlt ein Stück eines an der Stirnseite gehöhlten Baumstammes, ein Mörser, in dem mit einem hölzernen Stampfer Mais gestampft oder Reis geschält wird. Entkörnt werden die Maiskolben mit der Hand. Astgabeln finden als Aufhänger Verwendung (wie auch noch bei unseren Bauern). Der Besen wird aus belaubtem Reisig gebunden, oder aus Maisilla, der Feuerfächer entweder aus großen Vogelfedern oder aus Palmwedeln geflochten, ebenso Tragkörbe aus Bast, Schilf und Palmwedeln (Frauenarbeit). Stricke und Schnüre drehen die Männer aus Lianen und Bast. Bei besonderen Anlässen wird mit Copal, einem Baumharz, aus dem auch Fackeln bereitet werden, Licht gemacht, in der Regel genügt der Schein des Holzfeuers. Zur Befestigung von Kleidungsstücken dienen, wo die Näh- und Sicherheitsnadel noch nicht Eingang gefunden hat, Knochennadeln und Dornen, die es in allen Größen und Arten gibt, und die sich sogar, wie ich bei einem Farmer sah, als Ersatzgrammophonnadeln verwenden lassen.

Das Haus, an dem ich eineinhalb Jahre baute
Nichts ist verfehlter, als diese Menschen deswegen, weil sie nur ein paar Kochtöpfe besitzen, die ihren ganzen Haushalt darstellen, für arm zu halten. Arm war zum Beispiel der europäische Arbeiter, der jahrzehntelang die unvergeßlich scheußlichen »Möbel« aus schlechtem Holz um sündteures Geld von Abzahlungsgeschäften kaufen mußte und für die ihm, wenn er mit den Raten im Rückstand war, sein Wochenlohn gepfändet wurde. Arm zu werden beginnt der Indianer erst von dem Augenblick an, da er sich an Industriewaren gewöhnt, die er mit Geld oder Arbeit bezahlen muß, während ihn seine selbst hergestellten Geräte nichts gekostet haben. Ihre »primitive« Lebensweise ist nur die natürliche, ländliche, einfache und gesunde, die ungefähr der Lebensführung unserer Großväter entspricht, sofern sie Landbewohner waren und keine Großstädter. Es ist noch nicht lange her, daß z. B. meine Großeltern statt des elektrischen Lichtes einen Kienspan an ihrer Stubenwand gebrannt haben, und ob sie deswegen schlechter gelebt haben als ihre heutigen Nachkommen, möchte ich bezweifeln. Ich glaube, daß die »primitive« Einrichtung des menschlichen Haushalts die eigentliche, und die komplizierte die uneigentliche ist.
Amoishe wie Campa sind seßhaft und bebauen eine kleine Pflanzung, verändern aber innerhalb ihres Gebietes den Wohnplatz sehr oft. Angebaut werden in der Hauptsache die kartoffelähnlichen Yuccas, Mais, verschiedene Bananen und die dem Indianer unentbehrliche Koka. Da sie keine Raucher sind, bauen sie Tabak nur selten, wenig und in schlechter Qualität, weil sie die Behandlung nicht verstehen. Daß der Indianer nur wenige Produkte und davon nur so viel anbaut, als er für seine Familie braucht, also nicht über seinen Bedarf sät und erntet, ist damit zu erklären, daß er keinen Handel treibt. Das Urbarmachen des Waldes ist Männerarbeit, das Pflanzen, Unkraut ausschlagen und Ernten besorgen die Frauen. Das öftere Wechseln des Wohnplatzes, das der Indianer liebt, beruht vor allem auch darauf, daß es genug Raum und Boden gibt. Er kann es sich leisten, eine länger bewohnte Gegend, in der das Wild seltener geworden ist, zu verlassen und sich in einer weniger ausgebeuteten neu anzubauen, um vielleicht später, wenn sich der Wild- und Fischbestand in der alten Gegend wieder erholt hat, entweder in diese zurückzukehren oder wieder eine andere aufzusuchen. Manche Stämme betreiben die Fischerei nur in der trockenen und die Jagd in der Regenzeit und wechseln dementsprechend den Wohnplatz. Auch ein Todesfall ist ein Grund zum Umzug, da der Indianer nicht in der Nähe eines Begrabenen hausen will, ebenso Unglück und Krankheit, die er mit der örtlichen Umgebung in Zusammenhang bringt, oder wenn eine Schlange im Haus gefunden wird (kommt sehr selten vor), oder wenn es von Ameisen überfallen wird, oder schwer zu vertreibende Ameisen sich in der Nähe einnisten. In allen diesen Fällen verläßt er sein Haus, errichtet sich andernorts ein neues und holt das in seiner alten Pflanzung Angebaute solange von dort, bis er in der neuangelegten ernten kann.
Nomadisierende Stämme sind, da sie kein Feld bebauen, von Naturbeschaffenheiten und ‑vorgängen noch abhängiger, weil gezwungen, sich wandernd ihre Nahrung zu verschaffen.
Wie das Incavolk als einziges Tischlerwerkzeug die kupferne Axt kannte, so ist der stählerne Machete, ein vom Ausland eingeführtes modernes Erzeugnis, das einzige und Universalwerkzeug des Waldindianers. Er ist Messer, Axt, Spaten, Sichel usw., und auch Jagdwaffe.
Die Baumaxt ist nur selten anzutreffen, dann, wenn ein Indianer sich eine eingebildet und durch Arbeit auf einer Pflanzung erworben hat. Die vor einigen Jahrzehnten noch gebräuchlich gewesenen Steinbeile werden nicht mehr benutzt. (Sie wurden auch ehedem nicht etwa deshalb benützt, weil die Indianer von den Germanen der Steinzeit abstammen, sondern weil ihre Erfahrung kein Eisen kannte.)
Pfeil und Bogen sind die Hauptwaffe. Der Indianer schnitzt sie in verschiedenen Formen und Größen für verschiedenes Getier, Fische, Vögel und Wild. Die Spitzen werden aus Hartholz oder Knochen aufgesetzt und mit Baumharz und Baumwollfaden befestigt, wie ebenso die Flugfedern. Die Pfeile sind nicht vergiftet. (Aber auch vergiftete Pfeile können keine sehr gefährlichen Waffen sein, da man mit einem Pfeil höchstens einen Menschen treffen kann.) Die Bogen aus hartem, elastischem Chontaholz sind übermannsgroß, werden auf den Boden aufgesetzt und zwischen der großen und der zweiten Zehe eingestemmt. Auch Vorderladerflinten, die sie erworben oder eingetauscht haben, sind manchmal anzutreffen, doch mangelt es meistens an Pulver, Zündhütchen und Patronen. Die Campa sollen auch rohe Knüppelkeulen verwenden und Fallgruben anlegen. Jagdhütten zum Anstand werden aus in den Boden gesteckten Palmwedeln errichtet.

Bananenpalmen

Papayabaum in meiner Pflanzung.
Die schwarzen Baumstümpfe sind beim Abbrennen des Waldes verkohlt
Die Waffen dürfen von den Frauen nicht berührt werden.
Als Waffe sind auch die verschiedenen Gifte, die jeder Indianer zu bereiten versteht, anzusehen. Sie verwenden sie auch gegeneinander, meist aus Eifersucht. Das Geheimnis der Gift- und Arzneienbereitung, das der Indianer nie verrät, ist sein Verbündeter.
Als ich zum erstenmal im Lande war, schleppte ich Gewehr und Revolver und Munition wie ein korsischer Räuberhauptmann. Dabei dachte ich allerdings nur an die Jagd und vielleicht auch an die Verteidigung gegen Tiere, wie z. B. Schlangen. Als ich keinen Centavo mehr besaß, war ich froh, daß ich etwas zum Verklopfen hatte, und das war das Ende dieser etwas übertriebenen und nicht ganz praktischen Ausrüstung; denn die landesüblichen, einfachen Vorderladerflinten sind im Urwald viel brauchbarer als unsere empfindlichen und komplizierten.
Das zweite Mal besaß ich nichts dergleichen und nicht einmal ein Messer, nur einen Machete, und den hatte ich mitgebracht, weil man ohne Säbel nicht durch den Busch kommt. (Bei meiner letzten Rückreise aus Brasilien erzählte mir ein Auslandsdeutscher diesen Witz: Es ist noch nicht sehr lange her, da näherte sich ein Schiff der brasilianischen Küste. Als die Reisenden die Küste erblickten, fingen sie an, ihre Waffen zu putzen . . .)
Mit einer Schießwaffe zu Indianern zu gehen ist immer entweder eine Bedrohung oder ein Zeichen von Unsicherheit.
Gefischt wird mit Pfeil und Lanze, auf große Fische und Seekuh mit der Harpune, des Nachts mit Feuer an der Spitze der Canoa. Angeln, aus Knochen oder Holz, und Netze sind an den Gebirgsflüssen weniger, dagegen im breiten Unterlauf der Ströme häufiger gebräuchlich, eiserne Angelhaken sehr geschätzt. (Angel und Netz stammen aus Europa.)
Das Fischen mit Dynamit wurde von den Farmern eingeführt. Es ist zwar als Raubbau verboten, aber das Gesetz ist weit weg und steht auf dem Papier, und bei dem unerschöpflichen Fischreichtum der fast unbewohnten Amazonasflüsse richtet es, mit Maß und Ziel betrieben, kaum nennenswerten Schaden an. Die Farmer müssen das Dynamit selbst vom weit entfernten Händler holen und bezahlen, und ein Indianer bekommt es zum eigenen Gebrauch noch seltener in die Hand. Ein Stückchen des Sprengstoffes wird mit einer kleinen Zündschnur in einen Stoffetzen eingewickelt, das Päckchen mit einem glimmenden Span oder mit der Zigarette angezündet und ins Wasser geworfen. Die Explosion schleudert eine mächtige Woge in die Luft und das Wasser wimmelt von betäubten Fischen. Die Indianer, gute Schwimmer und Taucher, werfen sich unter übermütigem Schreien, Jauchzen und Johlen ins Wasser und schleudern die Fische klatschend ans Ufer, wo sie die Weiber und Kinder in die Tragkörbe sammeln. Prachtvoll anzusehen sind die braunen Burschen, wenn von ihren sehnigen Bronzekörpern das glitzernde Wasser abtropft. Ein Schuß bringt siebzig bis achtzig karpfengroße Fische.
Mancher Indianer, der mit dem Dynamit allzu sorglos umgegangen ist, hat einen oder mehrere Finger eingebüßt. Einen traf ich, dem die rechte Hand fehlte. Auch mit der Flinte, die ihnen noch zu neu ist, gehen sie oft unvorsichtig um und stützen sich zum Beispiel mit beiden Händen auf die Laufmündung des geladenen Gewehrs.
Das Fischen mit giftigen Kräutern ist wohl bei allen Stämmen gebräuchlich. Auch meine Nachbarsleute kannten das betäubende Giftkraut Barbasco, das in der Sonne getrocknet, zerrieben oder gestampft und in den Fluß gestreut wird, worauf sich das Wasser milchig weiß färbt. Die Fische treiben kraftlos eingeschläfert dahin, werden an aufgerichteten Steinwehren angeschwemmt und aufgespießt, oder mit der Hand genommen und herausgeworfen. Meine Indianerin ging manchmal zum Zeitvertreib nachmittags mit diesem Zeug fischen und brachte dann ihre Beute in einem kleinen Korb heim, genug für ein reichhaltiges Abendbrot. In dem Dorf San Antonio am Marañon ist das Barbasco-Fischen ein fröhliches, jahrmarktähnliches Fest, das nur einmal oder zweimal im Jahr stattfindet. Ich war am Vorabend eines solchen Festtages dort angekommen und alles war darüber in Aufregung, es gab keinen anderen Gesprächsstoff. Lange vor Tagesanbruch brach die ganze Einwohnerschaft, Männer, Weiber und Kinder, auf nach dem Fluß, bewaffnet mit Körben, Macheten und Dreizacks. Der Fischfang dauerte den ganzen Tag und auch noch den nächsten und dritten. Jeden Abend kam alles mit vollgepfropften Körben zurück.
Die Amoishe sind geschickt im Aufstellen von Fischreusen und aus Baumstämmen raffiniert gebauten Fischtennen; ebenso machen sie Fischwehre, die Nebenbäche absperren und wo sie den zappelnden Fang, nachdem das Wasser abgelassen wurde, einfach zusammensammeln.
An Beschäftigung fehlt es also dem Indianer nicht. Hausbau, Hauswesen, Pflanzung, Anfertigung von Geräten, Waffen und Instrumenten, Jagd und Fischerei füllen seine Zeit aus. Dazu kommt noch das Ausbrennen oder Aushauen von Canoas, das Schnitzen der Ruder, das Herholen von Brennholz und Kalk- und Salzsteinen und noch manches andere. Es ist klar, daß er, wenn er fremde Arbeit verrichtet, seine eigene versäumt. Und daß er nicht mehr anbaut, als er für die Köpfe seiner Familie braucht, ist kein Mangel an Fleiß oder Intelligenz, sondern die ihm von der Natur gebotene Lebensweise, ein weises Verharren in der natürlichen Schranke seines bodenständigen und urwüchsigen Daseins.
Nicht umsonst zeigt das Wappen Perus die Embleme des Reichtums, ein Vicuña, den Cascarillabaum und des Goldhorn. Aber auch der beredteste Dichtermund würde nicht imstande sein, zu veranschaulichen, was die subtropischen und tropischen und selbst noch die ariden Gebiete der Amazonasländer hervorbringen – da hilft nur eine trockene Aufzählung.
Pflanzen und Früchte
Achote, eine Farbfrucht, die zur Gesichtsbemalung verwendet wird.
Aji, sehr scharfe, paprikaähnliche Pfefferfrucht. Es gibt auch Aji dulce, süßen, d. h. weniger scharfen. Zuerst treibt dieser Pfeffer einem das Wasser aus den Augen und die Augen aus dem Kopf; später will man keine Speise mehr ohne ihn genießen.
Ananas, gedeihen in jedem Gebiet. Urwaldfarmer bezeichneten sie als Unkraut und verwendeten sie als Viehfutter. Die Indianer schätzten sie nicht. In meiner Pflanzung wuchsen so viele, daß ich sie nicht aufessen konnte.
Anona, der Ananas ähnliche, kinderkopfgroße, süße Baumfrucht.
Aprikosen.
Aguaje, eßbare Zapfenfrucht einer Palme.
Bambus.
Bananen, das »Brot des Landes«. Es gibt zahlreiche Sorten in verschiedensten Größen und Farben, Eß- und Kochbananen, zuckersüße, herbe und mehlige, die mit der Schale ins Feuer gelegt werden, die ingires genannte, die in der Suppe gekocht wird, usw. Die bei uns bekannte Sorte, die einzige, die sich, im grünen Zustand, zum Export eignet, ist die gewöhnlichste. Die Farmer verwenden sie als Viehfutter.
Barbasco, aus der Wurzel Yacquinina gerieben, narkotisch, wird zum Fischen verwendet.
Baumwolle, die peruanische Baumwolle ist als erste Qualität bekannt.
Bohnen (frejoles).
Brotfrucht.
Cacaville, wohlriechende Fettfrucht.
Cacavita, kastanienartige Arzneifrucht.
Cachu, eine Art rote Birne.
Caynito, weiche, apfelähnliche Frucht.
Chirimoya, kühle Honigfrucht. Wird mit dem Löffel aus der Schale gegessen und schmeckt wie eine von einem raffinierten Konditor kombinierte, kühle Süßigkeit.
Chonta, Palme, deren Mark als Salat und Gemüse gegessen wird.
Ciruela, Pflaumenart.
Cumalá, Cumarilla (stearinhaltige Früchte).
Erdbeeren.
Feigen.
Granadilla, die Frucht der Passionsblume.
Honig, wilder.
Huaba, Hülsenfrucht.
Huaracha, narkotische Giftpflanze, wird zum Fischen verwendet.
Hungarabi, Ölfrucht.
Johannisbrot.
Kaffee.
Kakao.
Kakteen.
Kapok (flor de Balsa).
Kartoffeln (batates). Peru gilt als die Heimat der Kartoffel. Sie gedeiht von einer gewissen Höhe ab bis 4000 Meter. Doch auch in den tiefsten Niederungen gibt es Kartoffelarten, so die violetten, pfeffersüßen camottes, die sacha papa (falsche Kartoffel) und andere. (Auch die riesengroße Pituca und die Yucca sind verwandte Arten.)
Kemi (Campa, spanisch: Chope), süße Gurke.
Klee, nur über 1600 Meter.
Koka, der Kokastrauch gedeiht auch in den niedrigsten tropischen Lagen. Die Wissenschaft behauptet fälschlich, die Pflanze gedeihe nur in Höhen von 1200 Metern aufwärts. Dort wächst sie allerdings auch, aber ich selbst pflanzte sie in der Niederung, wie auch alle Indianer meiner Gegend.
Kokosnuß, außer der bekannten noch verschiedene Arten.
Kürbisse, verschiedene Arten, eßbare, wie Gefäßfrüchte, darunter die tutumá. Auch Kürbisbäume.
Mais.
Maisilla, falscher Mais.
Mandarinen.
Mandeln.
Mayambo, Mango (Nüsse).
Manille, Erdnuß.
Marañon.
Mate, Tee.
Melonen.
Orangen.
Palta, eine Fleischpastete in Fruchtgestalt, die mit Salz gegessen wird.
Papaya.
Paránuß, Frucht des Juviabaumes.
Pfirsiche.
Pitota.
Pituca (siehe Kartoffel).
Reis, der Reis von Chuchurras wird dem indischen Carolinenreis gleichgestellt. Gedeiht ohne künstliche Bewässerung in der Regenzeit, was eine bessere Qualität ergibt als die bewässerte.
Rizinus.
Rocota, schwarzer Pfeffer.
Rüben.
Safran.
Tabak, sehr schwere, vollhaltige, beste Sorten.
Tagua, elfenbeinartige Steinfrucht.
Taperida, Birnenart.
Tintoma.
Vacrapona, Steinfrucht.
Vanille.
Yuccas, das Hauptnahrungsmittel sowohl der Indianer wie aller anderen Bewohner der Urwaldgebiete. Die Manioka Brasiliens und des nördlichen Südamerika ist der Yucca sehr ähnlich, nur daß Manioka vor der Zubereitung entgiftet werden muß. Die Fruchtbarkeit und Ergiebigkeit der Yuccapflanze grenzt ans Unheimliche, die Frucht ist vielseitig verwendbar.
Wein, nur in Höhenlagen.
Weizen, wie jedes andere Getreide, nur in Höhen über 1600 Meter. (Man hat in den Tiefen günstige Versuche mit einer chinesischen Getreideart angestellt.)
Zapote, kinderkopfgroß, süß schmeckend.
Zitronen (limones), verschiedenste Sorten und Größen, auch süße, limas genannt.
Zuckerrohr.
Wild wachsen in geringerwertigen Sorten: Ananas, Bomba (wilde Baumwolle), Kakao, Kürbisse, Mate, Parfümpflanzen usw. Alte Farmer behaupteten, europäische Produkte würden nicht wachsen, sie seien lange genug da, um das zu wissen. Es wuchsen aber, wie ich sah, genau so wie bei uns, nur schneller und üppiger, z. B. Tomaten, Petersilie, Schnittlauch, Weißkohl, Knoblauch, Zwiebeln, Spargel; kurz, fast alle nicht einheimischen Früchte würden ebenso wachsen wie die einheimischen, nämlich auch im Übermaß, vorausgesetzt allerdings, daß sie gepflanzt werden! Nicht immer stimmt alles, was der Großvater behauptet hat. Wie die Verpflanzung des Kautschuks von Südamerika nach Indien möglich war, genau so sind auch Übertragungen von Pflanzen aus anderen Erdteilen nach Südamerika möglich. So hat ein Deutscher, den ich am Rio Itaya traf, eine afrikanische Ölpalme, deren Samen er sich kommen ließ, gepflanzt, und sie gedieh vortrefflich.
Andere Produkte
Erze: Gold, Silber, Kupfer, Zink, Eisen, Vanadium.
Hölzer: Mahagoni (verschiedene Sorten), Ceder, roten, weißen und wohlriechenden Kampfer, Blutholz, Eisenholz, Aquena (amerikanisches Nußbaumholz), Balsa (leichtes Schwimmholz für Flöße), Tacuna, Caracamata, Churuvaco, Estoraqui (Rosenholz), Eukalyptus, Gummibaum, Brotfruchtbaum, Korkbaum, zahlreiche harte Palmen, wie Assay, Chonta, Pona usw.; die Ponapalme z. B. wird 15 Meter hoch; ganz alte Stämme sind im unteren Teil eisenhart und sehr schwer zu fällen.
Das sind nur einige wenige Hölzer von hunderten. Von vielen Hölzern, die ich sah, wußte ich den Namen nicht. Die Schindeln meines Daches waren aus Cedernholz, Tische und Stühle, die ich mir anfertigte, Mahagoni. In der Kolonie Oxapampa sind sämtliche Häuser aus Mahagoniholz. Ein Zaun, den ein Farmer um seinen Schweinekorral zog, war aus einem sehr harten, marmorähnlichen Edelholz, das er selbst nicht kannte. Ein großer Baum, den ich in meiner Pflanzung fällte, brannte dickqualmig, als wäre sein Holz mit Öl oder Petroleum getränkt.
Die peruanische Cellulose soll an Qualität die kanadische übertreffen.
Das ausgelaugte, harte Treibholz der Flüsse, größtenteils Edelsorten, wird nur als Brennholz verwendet.
Ein peruanisches Gesetz bestimmt, daß für jeden gefällten Baum zwei junge gesetzt werden müssen. Da es aber kein Forstwesen gibt, steht auch dieses Gesetz, wie so viele, nur auf dem Papier.
Rinden; die bekanntesten: Chinarinde und Zimtrinde.
Harze und Öle, aus Bäumen gewonnen: Terpentin, Copayba (terpentinähnlich), Perubalsam, Eukalyptusöl, Kampfer.
Ferner: Häute, Felle, Pelze, Wollpelze, Echsen- und Krokodilleder. Schildpatt, Reiher, Guanodünger, Erdfarben. Salz wird aus Felsen gebrochen und erfordert oft weite Flußreisen.
Im großen gepflanzt und gehandelt wurden in der Hauptsache in Küstengebieten und von ausländischen Unternehmern: Baumwolle, Kaffee und Zuckerrohr; im großen ausgebeutet, auch vornehmlich von Ausländern, Kupfer und Silber, und vor allem Kautschuk (darunter Balatá und Shiringa, Feingummi), dessen Konjunktur in Südamerika durch die Entwendung von Samenpflanzen und die Überpflanzung nach Indien von den Engländern ein katastrophales Ende fand.
Erdöl, dessen größte Ausbeutestelle, neben Mexiko, Venezuela ist, wurde in Peru bis jetzt in geringerem Maße gebohrt. Auf einer Landkarte, die im Büro der Standard Oil Company in Iquitos hing, waren in quadratierter Einteilung sämtliche Vorkommen des Amazonasgebietes, darunter auch das des Erdöls, genauestens angegeben.
Diese Aufzählung ist weit davon entfernt, vollständig zu sein. Sie enthält nur die allgemein bekannten Produkte und einige wenige, die ich selbst kennenlernte. Auch war es nicht immer möglich, von jeder Frucht, Pflanze oder Holzart, die ich sah, den Namen zu erfahren. Vor allem birgt der Urwald noch eine unerschöpfliche Fülle von pflanzlichen und anderen Produkten, deren Bedeutung bis jetzt nur der Eingeborene kennt, wie Arzneipflanzen, Öl- und Seifenfrüchte usw.
Die Vorkommen der pflanzlichen Produkte verteilen sich naturgemäß auf die durch verschiedene Höhenlagen verschieden fruchtbaren Gebiete. Zuweilen sind bestimmte Gegenden arm an Produkten, von denen andere im Überfluß haben. Vor allem die tieferliegenden Gebiete bringen beinahe alles zugleich hervor. Ein Austausch kann jedoch nicht stattfinden, weil es keine Verbindungswege gibt. Die ertragreichsten Lagen sind 100 bis 300 Meter über dem Meere in tropischen oder fast tropischen Breitegraden, wo fünfzig Meter hohe Bäume die Regel sind und der Kaffee so reich gedeiht, daß die Sträucher sich zu Boden biegen. Die bekannte Redensart: Stecke einen Stock in den Boden und er wächst, ist hier keine Übertreibung, wie ich selbst beobachtet habe, wenn ich achtlos Äste und Zweige wegwarf, die in kurzer Zeit wieder Wurzel faßten. Dementsprechend wird auch mit Holz wie mit Produkten Verschwendung getrieben. Um z. B. die kirschenähnliche Frucht eines Baumes zu gewinnen, werden diese Bäume von den Indianern nicht abgeerntet, sondern einfach umgehauen. Einen Farmer sah ich seinen herrlichen Tabak in den Hühnerstall einstreuen zur Desinfektion gegen Hühnerflöhe.
Ergiebigkeit
Düngen und Pflügen ist unbekannt. Dagegen ist die Überschwemmung, die zugleich reinigt und mit Flußschlamm düngt, gewissen Pflanzen nützlich, so den Bananen, dem Mais und dem Reis. Auf der Hacienda eines Deutschen wurde dreißig Jahre lang auf demselben Boden Zuckerrohr gepflanzt und immer noch in der gleichen Qualität geerntet.
In subtropischer Höhe bringt ein Hektar Kaffeeland nach der ersten Ernte 60 Pfund. Nach drei Jahren verdoppelt sich der Ertrag.
In tropischen Lagen gibt ein Hektar Kaffeeland 1000 Pflanzen, eine mittelmäßige Pflanze ein Kilo geschälten Kaffee. Ein Hektar Mais bringt 10 000 Kolben. Eine Yuccafrucht wiegt etwa 12 Kilogramm. Die Yuccas können 16 bis 18 Monate in der Erde bleiben, ohne zu verderben. Die Bananenstaude gibt im ersten Jahr einen Kopf von etwa 50 Kilogramm, während des zweiten Jahres pro Staude 3 bis 4 Köpfe. Reis und Mais reifen in drei Monaten, können also, weil es keine Überwinterung gibt, viermal im Jahr geerntet werden. Bananen, Mais und Erdnüsse werden hier immerwährend geerntet, und zwar alle hundert Tage. Meine Bohnen, die ich in die Erde steckte, waren in vier Wochen drei Meter hoch und erntereif.
Allerdings wächst das Unkraut ebenso schnell, denn da die Natur kein Kunstgärtner ist, bringt der Urboden naturgemäß ebensoviel Unkraut hervor wie Produkte.
Wo so viel wächst und so rasch, ist Viehzucht kein anstrengendes Unternehmen, wie ebenso die Aufzucht von Schweinen, Schafen und Geflügel. Da das Vieh sich das ganze Jahr auf der Weide befindet, gibt es nur Grünfutter und kein Heu (das ja nur konserviertes Gras ist), und Stallungen sind überflüssig. Auch die Winterfütterung der Bienen entfällt.
Erzeugnisse und Verarbeitungen
Aus Zuckerrohr: honigähnlicher Rohzucker, flüssig miel, fest chancaca genannt. Ferner Zuckerrohrschnaps (Cachassa, Aquardiente, Pisco, Aquardiente de Caña, oder, wie das Zuckerrohr, kurz Caña genannt), und reiner Alkohol für medizinische und andere Zwecke.
Der Caña, wasserklarer, reiner, feurigster Schnaps, ersetzt im Urwald, und besonders auf der Wanderung, auf illusionäre und tatsächliche Weise alles, was es da nicht gibt, wie Bier, Wein, Eisgetränke, Milch und Tee. Dem Neuling im Lande verbrennt der erste Schluck Zunge und Kehle und treibt ihm das Wasser aus Augen und Nase. Aber mehr noch als ein Genuß für die Zunge des Kenners ist er vor allem ein medizinisches Mittel gegen Leiden des Körpers wie der Seele, sowohl pur, wie mit verschiedenen Kräutern und Wurzeln versetzt, gegen Übelkeit, Übermüdung, überanstrengte Muskeln, Mückenstiche und Fleischwunden und gegen Fieber und Schlangenbiß.
Leba, der halbgegorene Zuckerrohrsaft, ist ein süßes, stark berauschendes Getränk.
Aus Ananas und Bananen kann Wein bereitet werden. Aus Bananen auch Chapo, ein süßes Getränk; ebenso Essig und Mehl.
Aus Mais: Mehl, Brot und tortillas (gebackene Fladen).
Maisweine: Chicha und Sora.
Speiseöl wird gewonnen aus verschiedenen Nüssen. Die aus der Frucht Hungarabi und aus Schildkröteneiern gewonnenen Öle werden dem Olivenöl gleichgeschätzt.
Öle und Fette zur Seifenbereitung aus Cacaville, Cumalá, Cumarilla u. a.; das Rosenholz Estoraqui wird zur Parfümbereitung verwendet.
Aus Yuccas wird Farinha bereitet, ein grießartiges Mehl, das trocken, angefeuchtet, mit Rohzucker vermischt oder mit Fett gebraten gegessen wird. Bei den Indianern ein Leckerbissen, den sie jedoch, wegen des umständlichen Apparates, der zur Herstellung nötig ist, nicht selbst bereiten. Auch ich fand die Farinha sehr schmackhaft und als Proviant fast unentbehrlich.
Hingegen verarbeiten die Indianer einen großen Teil der angepflanzten Yuccas zu ihrem Lieblingsgetränk, dem Massato.
Decken, Tücher, Kleider und Teppiche werden im Landesinnern gewebt aus Schafwolle, Lama- und Vicuñawolle, Baumwolle, Bast- und Rindenfasern; Matten, Körbe und Hüte aus Schilfstroh.
Verschiedene Erden, Wurzeln und Früchte liefern Farben, auch solche zum Färben und Batiken von Stoffen. Eine gewisse Sorte Flußlehm ist brauchbares Material für Töpfereien.
Kautschuk wird heute fast nur noch in kleinen Hausindustrien der Farmer verarbeitet. Die Verarbeitung der Steinfrüchte zu Knöpfen usw., der Kokablätter zu Kokain, der Chinarinde zu Chinin, des Zuckerrohrs zu Feinzucker, der Zimtrinde, der Vanille, des Kakaos usw. erfolgen, wie alle industriellen Verarbeitungen von Rohstoffen und Rohprodukten, so gut wie ausschließlich im Ausland. Allerdings wurde die Chinarinde schon unter den Incas als Heilmittel verwendet und erst hundert Jahre nach der Eroberung des Incareiches nach Europa gebracht. Auch die Schokolade stammt von den Indianern Mexikos, die noch heute raffinierte Schokoladengerichte zu bereiten verstehen.
Einige Preise
| Im Landesinnern | An der Küste | |
| Ananas | 50 kg: 10 bis 20 Centav. | 1 Stück: 10 Centav. |
| Bananen | 50 kg: 10 bis 20 Centav. | – |
| Baumwolle mit Kern | 1 kg: 24 bis 30 Centav. | – |
| Kaffee roh, geschält | 1 kg: 30 bis 50 Centav. | – |
| Orangen und Zitronen | 50 bis 100 Stück: 10 Centav. | – |
| Paltas | 100 Stück: 1 Sol. | 1 Stück: 80 Centav. |
| Vanille | 1 kg: 20 bis 22 Soles | – |
(1 Sol = 100 Centavos = etwa 60 Pf.).
Es gibt Gegenden, in denen sich die Farmer Bananen nicht zahlen lassen, sondern froh sind, wenn jemand einen Zentner davon mitnimmt, und wieder andere, wo kaum eine auf dem Markt zu bekommen ist.
Schließlich, wenn man von Preisen spricht, muß auch erwähnt werden, daß der Boden im Innern nichts kostet.
Der italienische Gelehrte Raymondy hat das Land Peru einen Bettler auf einem goldenen Thron genannt, und so kann man getrost alle Amazonasländer nennen. Der dieses Wort prägte, wollte damit sagen, daß diese Länder alles haben und nichts damit anfangen können. Nun, die Ureinwohner des dünn bevölkerten Innern können schon etwas damit anfangen: sie leben ohne Nahrungs- und Existenzsorgen, und auch den Einsiedlerfarmern geht es, als Selbstversorgern, bestimmt nicht schlecht – sofern einer nicht zu faul ist, den Boden zu bepflanzen. Ich war nur ein ganz kleiner Farmer, aber mir fehlte nichts.
Die Tage meines Waldlebens waren ein Märchen. Im Schatten des Dachgebälkes trocknete der Tabak in langen Reihen von goldgelben Blättern, ein paar Griffe, und die Zigarre ist fertig. Schwer hingen die üppigen Trauben der Bananen, rings um das Haus wuchs, was die Küche braucht, standen die strotzend hohen Sträucher der Yuccas, und die Ananas dicht wie Kohlköpfe. Im Dickicht des Flusses, in dem ich badete, murrten die Lachtauben, kreischten die zanklustigen Vacamayos, der Windhauch wehte einen süßen Zitronenduft aus dem Wald, und das ewig sorglose Geplapper der Frösche verschlang das gefährliche Donnern der Weltmaschine. Und es gab keinen Kolonialbeamten und keinen Steuereinheber, nur ein paar langweilige Farmer, die ich nicht sah, wenn ich nicht wollte, weil sie weit genug weg waren, und wenn ich zu ihnen reiste, dann sah ich mir lieber ihre Kühe an, die bis zum Bauch im saftigen Gras weideten.
Und wie war es derweil in den wimmelnden Menschenzentralen, den Städten, die keine Landstädte mehr sind – sie waren nicht einmal in der Lage, die Landesprodukte unter sich zu tauschen und zu verteilen. So wurden in Peru z. B. zahlreiche Produkte und Materialien, die das Land im Überfluß besitzt, trotzdem vom Ausland eingeführt, wie Weizen, Reis, Kartoffeln, Farinha, Obst, Pfeffer, Salz, Seife, Leder, Petroleum, ja sogar, im Land der Urwälder, das Grubenholz, und noch vieles andere. Und das geschieht in Ländern, die einst die höchstentwickelte Ackerbaukultur und die vollkommenste Verpflegungsorganisation der Erde besaßen.
Kann man sich das in dem produktearmen, autarken Europa vorstellen, daß es Riesenländer gibt, die im Überfluß hocken und nicht einmal imstande sind, sich aus ihrer eigenen Fülle zu ernähren? Ist es nicht beinahe so, als ob die skrupellose Ausbeutung eines Teiles ihrer Naturschätze durch die ausländische Großindustrie wie eine verdiente Strafe für ihre Unfähigkeit über diese Länder hereingebrochen wäre, die freilich nicht die verantwortlichen Regierungen, sondern immer nur ihre betrogenen Völker traf. Das Öl, das auf dem Maracaibosee in Venezuela schwamm, ließ tausend Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen, allerdings braune Arbeiter und keine Grubendirektoren. Das Öl führte in Mexiko zur bolschewistischen Politik und zur gewaltsamen Politisierung des simplen Buschindianers, Öl, Gummi, Kupfer und Baumwolle reißen Länder in Kriege und Revolutionen, und das Schicksal von 20 zentral- und südamerikanischen Republiken wird nicht mehr in ihren Hauptstädten, sondern in den Wolkenkratzern von New York entschieden.
Reichtum der Erde ist Segen und Unsegen, je nachdem, wer ihn verwaltet.
Fangen wir mit denen an, die, außer Fröschen und Grillen, den meisten Radau machen, den Vögeln und den Insekten. Ich will keine Liste von ihnen aufstellen und könnte es auch nicht, denn die würde einen dicken Band, oder mehrere, vielleicht auch eine ganze Bibliothek ausfüllen; ich will nur von denen erzählen, die ich gesehen und gehört habe, vor allem gehört, denn es geht, wie ich schon sagte, in der Region des ewigen Waldes zu bestimmten Stunden ziemlich geräuschvoll zu, sowohl am Tag wie bei Nacht, und irgendein Schreien, Pfeifen und Tuten ist immer, außer in der schläfrigen Hitzestunde der Tagesmitte. Nur Grillen und Zikaden scheint selbst diese tödliche Hitze nicht im mindesten zu stören, ihr tolles Geklingel, ein grelles Rasseln von einer Million Schulglocken, klirrt dann erst recht und noch toller, aber auch im Regen genau so – sie müssen hervorragende Zirpinstrumente besitzen. Die Frösche dagegen beginnen ihr Hauptkonzert – das Orchester besteht aus mehreren tausend Köpfen – erst am Abend, um die ganze Nacht bis zum grauenden Morgen nicht müde zu werden. Aber diese sangeslustigen Gesellen zählen weder zu den Vögeln noch zu den Insekten, von denen sie leben, sie überlärmen nur beide, wenn auch nur da, wo Wasser ist, zumeist an den Flußufern.
Zuerst hielt ich alles, was ich im Wald hörte, für Vogellaute, bis ich erfuhr und lernte, daß die meisten davon Insekten waren, die allerdings unmögliche Töne von sich gaben. So bläst die Chiriambo auf einer Kindertrompete und rasselt dann, zur Abwechslung, wie ein Schleifstein. Ein Wurm – der auf Bäumen lebt, um mit Insekten verwechselt zu werden – pfeift genau so wie eine Fabrikpfeife und sogar ebenso pünktlich, nämlich jeden Tag um sechs Uhr abends, so daß man die Uhr nach ihm richten kann, wenn man eine hat. Seinen Namen habe ich vergessen. Ich war überhaupt ein schlechter Wissenschaftler und habe mir leider viel zu wenig Mühe gegeben, um die Namen, oder gar noch die lateinischen, dieser tonangebenden Luftbewohner zu erfahren. Viele von ihnen besuchten mich des Abends, wenn sie in das blakende, für sie sicherlich sehr blendende Licht meiner kleinen Öllampe taumelten, ohne sich mir vorzustellen, und am Morgen waren sie wieder verschwunden. Ich taufte einige einfach nach den Geräuschen, die sie von sich gaben, so z. B. den Schlittenklingler, den Sensendengler, den Nähmaschinensurrer und den elektrischen Rasiermesserschleifer. Der Uraponga ist ein Vogel – hoffentlich irre ich da nicht –, jedenfalls gibt er einen Glockenschlag von sich, als spiele er mit einem feinen Hämmerchen auf einem silbernen Amboß. Kleine Fliegen summen ein leises Sprechen wie in einem schwach eingestellten Radio, dann schießt wieder ein Riesenkäfer mit blutdürstigem Gebrumm daher, als sei er hier ganz allein der Herr, und dröhnend wie ein Zeppelin; Glühkäfer schwirren, manche mit drei Lichtern, wie ein Flugzeug, und da kriecht, ohne in diese Kategorien zu passen, eine illuminierte Raupe, der Kopf glüht rot und der Leib grün. Doch bleiben wir bei den Geräuschen. Der Pfiff des Gummibaumvogels ist scharf wie ein Peitschenhieb, der Pirol oder Webervogel, der sein Nest wie der fliegende Hund in die höchsten Äste hängt, schluchzt verliebt und unermüdlich die ganze Nacht, und der blau und gelb gefiederte Quecho ahmt täuschend ähnlich alle anderen Vogel- und sonstigen Stimmen nach, bis es ihm auf einmal einfällt, seine eigene, in der Tat sehr eigenartige Melodie zum besten zu geben, eine Tonfolge, die ein armer Bettelmusikant auf seinem schon längere Zeit nicht mehr geölten Leierkasten auch nicht schöner hervorbringen kann. Das Gekicher der Lachtauben hört sich an, als ob hinter dem Ufergesträuch am frühen Vormittag schon eine übermütige Schar badender Mädchen versammelt wäre, die Waldtaube aber, der Kuckuck des Urwalds, ruft immer ferne, einsam und klagend.
Nicht jeden Tag singen die gleichen Vögel, ihre Gemütsverfassung richtet sich wohl auch nach dem Wetter, und dann hat jeder auch seine bestimmte Gesangsstunde. Der Ruf des Perdis kündet Regen an, und die Bibichus, grüne Zwergpapageien – vielleicht gehören sie in die Klasse der Sittiche –, bringen Glück, wenn man sie im Hause hält, und wenn sie am Morgen schon zwitschern, dann kommt Besuch; tatsächlich konnte ich mich von ihrer Zuverlässigkeit einige Male überzeugen – wenn es nicht Zufall war. Nicht nur singende, pfeifende oder sonstwie musizierende Vögel sind da, sondern auch – ich wette es sind Vögel, aber schwören kann ich es nicht in jedem Fall, ob alle diese grunzenden, brüllenden, schreienden, oder wie furchtsame kleine Kinder weinenden Stimmen nur Vögeln gehören, oder auch Insekten, Kriechtieren und Vierfüßlern, denn die wollen auch alle mitreden! Das alma perdida, verlorene Seele, genannte Tier hat noch kein Indianer gesehen, nur gehört hat es jeder schon. Sie sagen, wenn man sie hört, dann stirbt jemand in der Nähe, und auch mir kam diese unheimlich klagende Leier in der nächtlichen Finsternis ein bißchen schaurig vor und recht dazu angetan, abergläubische Vorstellungen zu erwecken, wenn man dazu Neigung besitzt. Was für ein Tier es eigentlich ist, wußte keiner. Es hat einen Berufskollegen, den Totenvogel, der nur am Tag ruft, und den ich auch gehört, aber auch nicht gesehen habe. Der Paujil wieder brummt genau so wie ein zorniger Truthahn – in diese Familie scheint er zu gehören, wie noch viele andere Waldhühner, die ich nicht alle kenne –, und das Gebrüll des fasanenartigen Trompetero von dem des Jaguars zu unterscheiden, vermag nur ein geübtes Ohr. Wilde Flußgänse und ‑enten und auch die verwilderten, die den Farmern davonschwimmen und, einmal in der Freiheit, nie mehr zurückkommen, verhalten sich ruhiger, und noch stiller und scheuer ist der schwer zu jagende, langbeinig und nachdenklich wie ein Gelehrter am Ufer stolzierende Fischreiher, der weiße und der rosafarbene.

Kein Steinhaufen, sondern Paranüsse

Lamaherde im Minengebiet der Anden
Die Papageien haben es nicht nötig, schön zu singen, weil sie dafür schöner und bunter und manchmal auch protzig farbenprächtig angezogen sind (wie ja auch der Pfau das prächtigste Gefieder und den häßlichsten Schrei hat), doch der Papagei besitzt Sprach- und Imitationstalent, seine persönliche Sprache aber ist ein rauhes Gekrähe. Ich fuhr einmal im Boot auf eine steile Felswand zu, die weithin dunkelrot leuchtete. Als ich näherkam, schwirrten Tausende von Papageien mit häßlich entrüstetem Gekrächze auf, eine purpurne Wolke, die buchstäblich die Sonne verfinsterte. Die Wand war ein Salzfelsen, an dem sie sich gütlich getan hatten. Auch der Tucan zählt nicht zu den Sängern, obwohl sein Schnabel noch einmal so groß ist wie er selbst, aber darauf kommt es beim Singen nicht an, und er begnügt sich auch mit einem in zarten Aquarellfarben gehaltenen, wirklich aparten Federkleid. Einmal sah ich, nur einen kurzen Augenblick, einen golden gefiederten Vogel, der sich kostbar blinkend rasch ins dichte Gebüsch zurückzog, vornehme Leute zeigen sich nicht gerne öffentlich; vielleicht war es der Paradiesvogel. Vom Paucar weiß ich nur, daß seine Lieblingsspeise Bananen sind, sonst scheint er nichts zu können und zu sein, die Indianer nennen ihn ganz vulgär Bananenfresser. Völlig das Gegenteil von diesem plumpen Materialisten ist der Kolibri (picaflor, Blumenpicker), eine winzige Komposition von leuchtenden Seidenfarben, die in einer Hand zweimal Platz hat, und, wenn er vor einer schillernden Blüte schwirrend in der Luft stillsteht, selbst eine Blüte. Allerdings kann man, wenn man so dasitzt und an nichts denkt, erschrocken zusammenfahren, wenn einem dieser winzige Propeller plötzlich über dem Kopf schwirrt; man sagt, daß dieses bunte, blitzwendige Kerlchen nicht ungefährlich sei, wenn es seine Jungen verteidigt, und daß es mit seinem nadelspitzen Schnabel der Schlange die Augen aussticht. Shunshus sind Stinkhühner, die aufgeregt schnarrend die Ufergebüsche bevölkern, obwohl ihnen niemand etwas tut. Ihr Fleisch ist ungenießbar und ihr Daseinszweck einigermaßen rätselhaft, möglicherweise haben sie eben gar keinen, im Gegensatz zum Aasgeier, der in ganz Südamerika das Amt der Reinlichkeitspolizei versieht und außerdem jeden Kadaver meldet, auf der Jagd das angeschossene Tier und auf der Weide ein krankes Vieh. Die philosophischen Pelikane gibt es in großen Mengen an der pazifischen Küste, und den Kondor, den König der Lüfte, sah ich nur von weitem erhaben hoch im tadellosen Blau des Andenhimmels schweben.
Nun wieder zu den Insekten. In meiner Pflanzung gab es Grashüpfer, die so lang waren wie eine Hand und in den grellsten Farben gezeichnet, nicht etwa nur grün; einer aber sah genau so aus wie ein Blatt, ein vorzüglicher Mimikrikünstler. Auf die Spitze getrieben fand ich die Anpassung beim Naro: an meinem Ärmel hing ein Zweig, ich streifte ihn ab, da lief er davon. Die Hühner waren auf alles kriechende und hüpfende Insektengetier scharf, wie auch auf Cucarachas, die tropischen Hausschwaben. Ein Farmer leerte einmal einen Korb Erdnüsse, der lange auf dem Boden gestanden hatte, vor dem Haus auf die Erde mit ebensoviel Cucarachas wie Nüssen, und gleich war das ganze Hühnervolk zur Stelle und nicht eine von den Schwaben kam lebend davon. Daß Ameisen ein sehr geschätztes Hühnerfutter, besonders zum Aufziehen von Kücken sind, habe ich auch erst erfahren, als ich sah, wie die Pflanzer, und auch Indianer, die ein paar Hühner besaßen, aus dem Wald große, mit Ameisen gefüllte Wabentrauben brachten, die von den Hühnern mit großem Appetit säuberlichst geleert wurden. (Auch daß ein Huhn ganz keck eine kleine Schlange angeht und tötet, war mir neu.) So haben auch die viel verleumdeten Ameisen – über die allein man ein Buch schreiben könnte – auch manchen praktischen Nutzen; gewisse Arten von ihnen werden in geröstetem Zustande ja auch von den Indianern gegessen. Man denke nur an die Wanderameisen (Vacanaos), die eines Tages plötzlich in langen, geordneten Zügen anmarschiert kommen und das Haus richtig überfallen, nicht wie Räuber, sondern als Reinigungskommando. Sie vertilgen alles, was sich an Insekten und Ungeziefer im Haus verbirgt, und marschieren, nachdem dieses Werk vollbracht ist, ebenso ordentlich wieder davon. Daß selten ein Schaden ist, wo nicht auch ein Nutzen wäre, ist auch auf die Insektenwelt anzuwenden, wenn auch der Vorteil nicht immer gleich sichtbar ist. In der Natur ist wohl selten etwas ganz nutzlos, und wenn man beispielsweise die tropischen Insekten ausrotten würde, so würde jedenfalls auch die von ihnen lebende Tierwelt absterben. Der Mensch aber kann sich in den meisten Fällen schützen und wehren, und wo er es noch nicht kann, da wird er es lernen.
Daß die Insekten die größte und gefährlichste Macht des Tierreiches sind, soll nicht geleugnet werden. Die Trajineros (Blattschneiderameisen), vor denen nichts Schneidbares sicher ist und die eine ganze Pflanzung kahl fressen, eigentlich kahl schneiden können, nur, um in ihrem Bau Vorräte anzuhäufen, als beabsichtigten sie, Krieg zu führen, zu vertreiben, ist äußerst schwierig; der Indianer zieht jedenfalls vor, wenn er solchen Besuch bekommt, lieber selbst auszuziehen. Auch die Comejenes sind Papier- und Stoff-Fresser und also solche im Hause nicht gerne gesehen. Doch kann man sich vor ihnen schützen. Wer nicht in der Lage ist, die Tragsäulen des Hauses in zementierte Bassins zu stellen, in denen mit einer Schicht Petroleum bedecktes Wasser ist, der kann das gleiche Verfahren wenigstens auf seine Möbel anwenden, wenn er ihre Füße in Konservenbüchsen oder andere Behälter stellt. Das Ausstreuen von Arsen vertreibt übrigens die unwillkommenen Besucher auf Nimmerwiedersehen. Die Indianer fürchten am meisten die großen, blauschwarzen Calenturas (caliente = heiß), die nichts vertilgen, aber jedes Lebewesen angreifen, das ihnen ins Gehege kommt. Wenn man in ihren Bau siedend heißes Wasser hineingießt, sind sie erledigt. Sie leben indes meistens im Busch. Wer durch das Dickicht kraucht, muß selbstverständlich auf allerlei gefaßt sein. Plötzlich regnet es die so winzigen wie bissigen Amaches, rote Baumameisen, auf ihn nieder, und dann ist nicht viel mehr zu tun, als die Zähne zusammenzubeißen. Ein Indianer zeigte mir eine fast maikäfergroße Ameise, deren Biß achtundvierzigstündiges Fieber hervorrufen soll, sicher eine interessante Art. Der Stich der moosartigen Uta verursacht syphilisartige Geschwüre. Der Indio behauptete, »wenn sie einen in die Nase sticht, fällt sie ab«, und ich griff unwillkürlich an meinen Zinken, um zu spüren, ob er noch vorhanden ist. Im Wald, wenn man durch dick und dünn geht, macht man eben Bekanntschaft mit manchem ausgesprochen unsympathischen Gesellen der Insektenwelt. So mit den Garapatos, blutsaugenden, sehr hartnäckigen Waldzecken, die eine juckende Entzündung hervorrufen. Man muß sie mit der Nadel oder mit dem Messer aus der Haut entfernen, da sonst, besonders durch Kratzen, ein eitriges Geschwür entsteht. Einmal spürte ich mehrere Tage lang einen stechenden Schmerz an der Hüfte und konnte weiter nichts sehen als ein kleines rundes Loch, nicht größer als ein Stecknadelkopf. Ein Farmer sah sich die Geschichte an. »Das werden wir gleich haben!« Er blies Zigarettenrauch in die Wunde, und da kam ein wohlgenährter, weißer Wurm herausspaziert. Es war ein Stich des Bacacuro, der beim Stich ein Ei in die Wunde legt. Auch von Wespen und Hornissen kann man überfallen werden, wenn man unvorsichtig ist. Einer Vogelspinne, die ein jedenfalls beträchtlich häßliches und auch nicht ungefährliches Biest sein soll, bin ich nicht begegnet, und von den Niguas, den Sandflöhen, blieb ich lange Zeit verschont, bis sie eines Tages durch Hunde eingeschleppt wurden. Sie nisten sich unter den Zehennägeln ein und ziehen freiwillig nicht wieder aus – das Entfernen lernt man.
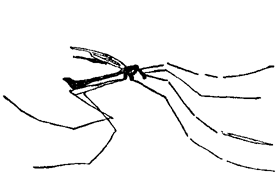 Die berüchtigten Moskiten habe ich nur einmal während der Flußreise auf einer Sandinsel richtig genossen. Ich hatte an diesem Abend nicht nur die Nase, sondern auch die Augen, Mund und Ohren voll von ihnen, verzichtete auf das Essen und verkroch mich, eine Zigarre qualmend, unter das Mückennetz. Wir waren in eine richtige Stechmückenzone geraten. Auf meinen Fahrten und Wanderungen bin ich, auf riesigen Strecken allerdings, durch eine Anzahl von Mückenzonen gekommen, die fast immer am Wasser lagen; im Wald, wenn es kein Sumpfwald ist, bleibt man verschont von ihnen. Auf viel größeren Strecken und Flächen aber gab es weniger Mücken, als an irgendeinem deutschen See im Hochsommer, und außer dem erwähnten einen Mal bin ich nicht in Südamerika am meisten von Mücken zerstochen worden, sondern in Italien, in der schönen Stadt Verona. Im Amazonasgebiet habe ich nur zwei Sorten von Moskitos kennengelernt – natürlich gibt es viele –, die Zancudos, große Schnaken, deren schmerzhafte Stiche beim Indianer, der schon immun dagegen ist, keine Geschwulste hervorrufen, und die kleinen mata blancas, die erst in später Nachtstunde auftauchen und den am Fluß Fischenden belästigen. Man sagt auch, daß die Stechmücken dem Weißhäutigen stärker zusetzen, jedenfalls wegen des ihnen fremden Blutgeschmacks. Schutzmittel sind außer dem Netz Feuerrauch und das Einreiben mit Copaypa oder Petroleum.
Die berüchtigten Moskiten habe ich nur einmal während der Flußreise auf einer Sandinsel richtig genossen. Ich hatte an diesem Abend nicht nur die Nase, sondern auch die Augen, Mund und Ohren voll von ihnen, verzichtete auf das Essen und verkroch mich, eine Zigarre qualmend, unter das Mückennetz. Wir waren in eine richtige Stechmückenzone geraten. Auf meinen Fahrten und Wanderungen bin ich, auf riesigen Strecken allerdings, durch eine Anzahl von Mückenzonen gekommen, die fast immer am Wasser lagen; im Wald, wenn es kein Sumpfwald ist, bleibt man verschont von ihnen. Auf viel größeren Strecken und Flächen aber gab es weniger Mücken, als an irgendeinem deutschen See im Hochsommer, und außer dem erwähnten einen Mal bin ich nicht in Südamerika am meisten von Mücken zerstochen worden, sondern in Italien, in der schönen Stadt Verona. Im Amazonasgebiet habe ich nur zwei Sorten von Moskitos kennengelernt – natürlich gibt es viele –, die Zancudos, große Schnaken, deren schmerzhafte Stiche beim Indianer, der schon immun dagegen ist, keine Geschwulste hervorrufen, und die kleinen mata blancas, die erst in später Nachtstunde auftauchen und den am Fluß Fischenden belästigen. Man sagt auch, daß die Stechmücken dem Weißhäutigen stärker zusetzen, jedenfalls wegen des ihnen fremden Blutgeschmacks. Schutzmittel sind außer dem Netz Feuerrauch und das Einreiben mit Copaypa oder Petroleum.
Ich habe manchmal Leute getroffen, die in Mückengegenden lebten und deren Tätigkeit gegen die Plage sich in Schelten und Klagen erschöpfte, anstatt etwas dagegen zu tun. Wenn ich mich umsah, dann entdeckte ich an solchen Orten regelmäßig eine Anzahl von Altwassern, Pfützen und Sumpftümpeln. Niemand nahm sich die Mühe, diese Brutstätten zuzuschütten, ein so einfaches wie radikales Mittel, um die Mückenplage stark zu verringern oder überhaupt loszuwerden. Kostspieliger und nicht überall möglich ist das Bedecken der Tümpel mit Petroleum; in Brasilien gibt es zu diesem Zweck staatliche Petroleumkommandos.
Die Raupe gehört wahrscheinlich zu den Kriechtieren. Es gibt die sonderbarsten Arten in vielfältigsten Farbenmustern und allen Größen. An eine erinnere ich mich besonders gut, weil sie einen, wenn man sie aus Versehen berührt, brennt wie Feuer. Gewisse Sorten werden von den Indianern geröstet und verspeist.
Nun zu den vierbeinigen Herrschaften.
Im Andengebirge leben: Puma, Silberlöwe, Guanaco und Vicuña, letztere wildlebende Schafkamele, deren weichhaariger Pelz sehr geschätzt ist. Zu sehen sind diese Bergbewohner so selten wie bei uns die Gemse. Lama und Alpaca sind Haustiere des Bergindianers. Diese Bergtiere leben nur über dreitausend Meter, in der Tiefe würden sie eingehen.
Der Herr der tiefen Wälder ist der Jaguar (ozelote), von den Spaniern fälschlich Tiger, el tigre, genannt. Der Tiger hat ein gestreiftes Fell, der Jaguar ein geflecktes, doch der Europäer nennt alles, was Damen tragen, Tiger, obwohl es meistens Jaguar- oder Leopardenfelle sind oder sein sollen; wie soll er da die Tiere unterscheiden können, noch dazu, da auch die Schriftsteller in diesem Punkt meist unzuverlässig sind. Ich habe während der ganzen Jahre niemals einen Jaguar gesehen, seine Spuren an sandigen Ufern, wo er zur Tränke ging, dagegen oft. Die Jagd auf diese große Katze ist ein anstrengendes Vergnügen, wenigstens für einen Weißen. Der Indianer macht sich nichts daraus, mehrere Tage lang seine Spur und Losung zu verfolgen, wobei er kaum etwas zu essen bei sich hat und im Walde nächtigt.
Die Katzen, auch die kleineren Wildkatzen, sind wohl die scheuesten und vorsichtigsten aller Waldtiere. Wenig daran interessiert, als Titelbild illustrierter Zeitschriften oder als Bettvorleger in Pelzgeschäften zu enden, reißen sie aus, wenn sie den Menschen nur von weitem riechen. Das Tier ist weder so unschuldig und zutraulich, wie es im Fabelparadies der Urzeit war, noch so tollkühn wie in der Zeit vor den Feuerwaffen, es kennt die Verfolgung des menschlichen Feindes und ist scheu und furchtsam geworden. Manchmal ist seine Furcht auch mit einer Portion Verachtung gepaart, denn viele Vögel lachen und spotten, wenn sie das zweibeinige Wesen in ihren Bereich eindringen sehen. Der Jaguar aber ist ein Viehräuber. Hunde, Schafe, Schweine, Kälber und selbst Großvieh sind vor ihm nie sicher, und ihn dabei abzufangen ist noch selten einem noch so wachsamen Farmer gelungen. Man erwischt die schlaue Katze dabei nur mit Fallen, oder dadurch, daß man den Kadaver des geraubten Tieres, zu dem sie immer wieder zurückkehrt, vergiftet.
Der Größe, nicht der Kühnheit oder Schlauheit nach, kommt nach dem Jaguar der Tapir (sacha vaca, falsche Kuh genannt), der so scheu und furchtsam ist, als wüßte er, daß sein Fleisch dem Indianer ein Festschmaus ist. Ich sah einmal einen, der stillvergnügt im Bach badete, und wollte ihn knipsen. Ich muß ein minimales Geräusch verursacht haben, das Tier streckte witternd den Rüssel in die Luft und ergriff im Nu in panischem Schrecken die Flucht. Krachend, als ob es alles niederrannte und zersplitterte, verschwand es im Dickicht. Das Wildschwein, dessen Fleisch, am offenen Feuer gebraten, nicht minder schmackhaft ist, ist jedoch eher angriffslustig, und wenn sie in Rudeln kommen, mit einem Gepolter, das sich hinter der grünen Buschwand anhört wie ein Erdbeben, nicht ganz ungefährlich. Der gleichen Gattung angehörend scheint das Wasserschwein zu sein, ein rätselhaftes Tier, das die Pflanzungen am Fluß verwüstet und nicht den geringsten Wert zu besitzen scheint. Die Indianer verschmähen sein ungenießbares Fleisch. Vom Waldhund habe ich nur erzählen hören, gesehen habe ich nur einmal einen auf einen Huscher. Hirsche und Rehe ähneln den unseren und auch die Hasen sind den unseren nicht unähnlich. Die rothaarigen Brüllaffen veranstalten am frühen Morgen einen Radau wie eine Horde Betrunkener, doch scheinen sie nur von Tagesanbruch und Sonnenlicht trunken zu sein. Die Nachtaffen haben ein menschenähnliches Gelächter. Besonders aufgefallen ist mir das ängstlich entsetzte Kindergeschrei der Affen, wenn man durch den Wald geht und sie einen, von Baum zu Baum turnend, immer beobachten. Manchmal hört es sich auch so an, als ob sie herunterschimpften. Affenfleisch muß vierundzwanzig Stunden gekocht werden und ist dann immer noch so zäh wie Leder. Gebraten wird es weicher und schmeckt gar nicht so übel, wenn man sich nicht daran stößt, daß die armen Tiere abgezogen über dem Feuer hängend aussehen wie kleine Kinder. Das gepanzerte Gürteltier lebt in Baumhöhlen, sein weißes Fleisch schmeckt wie Kaninchen. Das Chamäleon läßt sich stets einige Meter vor dem nahenden Boot in die lauwarme Flut plumpsen. Das Faultier schließlich macht seinem Namen alle Ehre. Ein Tropentier vom Kopf bis zur Zehe, würde es in Europa vermutlich in ein Arbeitslager gesteckt werden, aber das würde es auch nicht aus seiner Ruhe bringen. Die Indianer fangen es, indem sie den Baum, auf dem es hängt, fällen. Der Baum stürzt um, aber das Faultier bleibt an seinen Ast gekrallt, als ob nichts geschehen wäre; auch wenn es geschossen wurde, rührt es sich nicht; der Ast wird abgehackt und geschultert und das Tier nach Hause getragen.
Der größte Fisch der oberen Amazonasnebenflüsse ist der Shungharo, ein Raubfisch, der bis zu zwei Zentner schwer wird. Er wird mit starken, handgroßen eisernen Angelhaken vorwiegend nachts gefischt. Alte Tiere sind so stark, daß sie entweder den Angelhaken geradebiegen und ausreißen, oder das mit zwei oder drei Männern besetzte Boot sogar stromaufwärts nach sich ziehen, so lange, bis sie endlich ermattet sind. Doch kann man ihn auch auf andere Weise kriegen und über Nacht an einem starken Angelhaken einen mehrpfündigen Fisch auslegen. Hat der Shungharo angebissen, dann haben mehrere Mann zu tun, das wütend um sich schlagende Tier aufs Trockene zu bringen. Ein anderer, am mittleren und oberen Amazonas sehr beliebter großer Fisch ist der Paiche. Man gewöhnt sich nicht nur nach einiger Zeit an seinen zuerst befremdenden Geschmack, sondern lernt ihn immer mehr schätzen, weniger jedoch den penetranten Geruch der oft in großen Haufen auf dem Deck der kleinen Flußdampfer aufgeschichteten, getrockneten Vorräte. Der bekannteste und sehr geschätzte brasilianische Amazonasfisch ist der Pirarucú, der bis zu vier Meter lang werden soll.
Die aus Romanen gut bekannten und berüchtigten fleischfressenden Piranhas (in Venezuela Kariben) habe ich nirgends gesehen, obwohl ich ein ganzes Jahr lang jeden Tag in einem anderen Wasser badete. Ihr Vorkommen beschränkt sich auf einzelne bekannte Stellen, und an solchen Stellen badet man eben nicht, man setzt sich ja auch nicht auf den Potsdamer Platz hin, um Zeitung zu lesen. Dieser Raubfisch soll nur angreifen, wenn er Blut wittert. Die meisten gibt es an der Insel Marajao vor der Amazonasmündung. Dagegen sah ich den armdicken, zwei Meter langen, gelbgefleckten Zitteraal, der schlangenartig auf dem Wasser schwimmt. Wer mit ihm zu tun bekommt, tut gut, den Griff des Machete mit einem Tuch zu umwickeln, denn schon der Hieb mit dem Säbel kann genügen, um durch die Berührung einen elektrischen Schlag zu bekommen, der den Arm tagelang lähmt. Die Raya ist ein Stechrochen, der sich in seichten Gewässern aufhält. Die Wunde, die er dem Unvorsichtigen ins Bein schlägt, heilt nur langsam, die Indianer sagen, sein Stachel sei giftig. Viele Namen von Fischen habe ich vergessen, es wäre aber auch nicht viel gewonnen, wenn ich sie noch wüßte, wenn man bedenkt, daß der berühmte Schweizer Forscher Agassiz von seiner Amazonasexpedition nicht weniger als 80 000 verschiedene Fische mitgebracht hat, alle wohl konserviert in Alkohol.
Die Süßwasserdelphine sah ich vergnügt spielend aus den Wellen springen und lustig schnauben und prusten. Die Seekuh, vaca marina, kenne ich nur vom Hörensagen, und ebenso ein ganz kleines Wassertier, die Carneros, Polypen, die, wie die Indianer sagen, in den Körper eindringen und den Menschen durch innere Verblutung töten. Die Wasserschildkröte erreicht eine erstaunliche Größe und weiß sich dann auch zu wehren, man muß wissen, wo und wie man sie anpackt. Die Alligatoren, auch Kaiman, Lagarto und Yacaré genannt, ziehen vor, wenn sie es überhaupt der Mühe wert finden, aus ihrem Verdauungsschlaf aufzuwachen, beim geringsten Geräusch zu verschwinden. Sie haben kleine, graue, bös stechende Augen und sind sicher feige und hinterhältig. Mit einem großen Prügel, den man ihm in den Rachen stößt, kann man auch mit einem ausgewachsenen Tier fertig werden, ausgenommen mit einem seine Eier behütenden Weibchen, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Das Fleisch wird gegessen; wie es schmeckt, weiß ich nicht, bin aber, nebenbei bemerkt, überzeugt, daß die Tiroler auch daraus Knödel machen würden.
Der Leser ist schon begierig, endlich auch etwas von Schlangen zu hören, doch leider muß ich ihn dabei enttäuschen. Ich bin in fünf Jahren im Urwald ungefähr einem Dutzend Schlangen begegnet; wenn ich fünf Jahre in der Lüneburger Heide oder im Bayrischen Wald spazierengegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich ebenso viele gesehen, wenn nicht mehr. Allerdings soll es in Brasilien mehr Schlangen geben als in anderen südamerikanischen Ländern; Brasilien ist aber auch das größte und auch wasserreichste dieser Länder und sein Urwald in großen Gebieten sumpfig und flach. Schlangengeschichten aber gibt es überall viele, in der Literatur, wie in der Wirklichkeit, es ist ein Tier, das es versteht, sich mit einem furchterregenden Nimbus zu umgeben und Märchenerzähler zu spannenden Erfindungen anzuregen. Trotzdem bin ich die paarmal, da ich Schlangen sah, nie vor einer erschrocken, sondern habe sie ganz ruhig erschlagen, nicht aus Haß oder besonderer Abneigung gegen das Tier, sondern weil sie mir, wahrscheinlich um sich zu sonnen oder um zu schlafen, im Wege waren und ich nicht vorbeikonnte. Erschrocken bin ich nur, wenn ich eine nicht rechtzeitig bemerkt habe, also weniger vor dem Tier als vor der Überraschung – erschrecken kann man auch vor einem aufspringenden Hasen. Ich fand, daß Schlangen sehr scheu sind, immer, wenn sie ein Geräusch hören, ausweichen und fliehen und wahrscheinlich nur dann angreifen, wenn sie getreten oder berührt wurden und sich bedroht glaubten. Es wurde mir gesagt, daß es auch angreifende Schlangen gäbe, und sogar solche, die den Menschen verfolgen; ob es wahr ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht erlebt habe. Von Riesenschlangen hörte ich gar manches erzählen, habe aber nie eine gesehen, und auch die ältesten Indianer hatten noch keine gesehen, behaupteten aber, da und dort »wohne« eine. Ein Farmer schilderte anschaulich, wie er in seiner Canoa einen Bach hinauffuhr, über dem ein dicker, moosiger Baumstamm lag, so daß er mit seinem Indianer beratschlagte, wie sie das Boot über den Baum schaffen werden. Als sie hinkamen, bewegte sich der Baum – es war eine Riesenschlange. Gut erzählt jedenfalls, wenn er es nicht irgendwo gelesen hat. Wahrscheinlich kommt es auch immer darauf an, ob eine Schlange satt oder hungrig ist, wie bei jedem Tier, und auch beim Menschen, der sich in beiden Fällen auch sehr verschieden benimmt. Einer hungrigen Riesenschlange möchte ich, so neugierig ich auf ein solches Tier wäre, doch lieber nicht begegnen, ich müßte denn ein so gutes und nie versagendes Gewehr haben wie eine Romanfigur bei Karl May. Die Riesenschlange macht es mit der Riesenkraft, und das sieht vielleicht gefährlicher aus, als es ist, denn schließlich muß sie einen erst mal zu fassen kriegen, um ihre Kraft anwenden zu können. Ein kleines, unscheinbares, aber giftiges Reptil dagegen, nur fingerdick und einen halben Arm lang, braucht nur zuzuschnappen und man ist unter Umständen erledigt. Nun hat man ja heute gegen jeden Biß auch ein wirksames Gegengift; eine in Südamerika allgemein gebräuchliche Medizin gegen Schlangenbiß ist Curarina, und außerdem gibt es noch volkstümliche Gegenmittel. Der vorsichtige Urwaldwanderer kann sich also entsprechend ausrüsten. Ich hatte nur einen Stock und vielleicht auch Glück.
Als ich einmal bei einem Pflanzer einkehrte, kamen die Kinder gelaufen und schrien: Eine Schlange! Eine Schlange! Wir gingen hin und der Mann erschlug sie. Es war eine schwarzweißrot gezeichnete Giftschlange; wie sie hieß, habe ich vergessen. Solange ich im Wald war, habe ich nicht erlebt, daß jemand gebissen wurde. Von Begegnungen mit tödlich giftigen Schlangen wurde freilich viel erzählt, meist mit allen Zeichen ausgestandenen Schreckens, seltener mit Gelassenheit – der Indianer scheint im allgemeinen Schlangen sehr zu fürchten. Da er äußerst vorsichtig und geschickt geht und seine scharfen Augen nur auf seine Umgebung eingestellt sind, begegnet ihm höchst selten ein Unfall. Sicher ist, nach meinen Erfahrungen, daß die Zahl der im südamerikanischen Urwald durch Schlangenbiß Getöteten eine ganz minimale, nur in Promille ausdrückbare ist, verglichen z. B. mit der Zahl der bei uns durch Verkehrsunfälle Umkommenden.
Auch die Klapperschlange habe ich nicht gesehen. Es soll zwei Arten geben, eine auf dem Boden und eine auf dem Baum lebende, die vom Geäst schwer zu unterscheiden ist.
Von denen, die ich kannte, habe ich mir gemerkt: die loro machago, eine grüne Baumschlange, die cuspiringha und die vacamayo, alle sehr giftig.
Auf den Flußfahrten sah ich viele Boas, große, schachbrettartig goldgelb und kupferbraun gezeichnete Tiere, die beim leisesten Rudergeräusch scheu ins schützende Wasser glitten. Die Boa ist weder giftig noch sonst gefährlich, der Indianer nennt sie ehrfürchtig yacu mama, Mutter des Stromes, und manche sollen sie sogar als Haustier, um nicht zu sagen Hausgenosse, halten, da sie z. B. alleingelassene Kinder gegen andere Tiere beschützen soll.
Wer Schlangenfleisch ißt, soll alt werden – ich habe es trotzdem nicht probiert.
Eine kleine Menagerie ist fast in jedem Indianerhaus anzutreffen, Papageien und andere Vögel, die jung aus dem Nest genommen und ans Haus gewöhnt werden, Hunde, die auch mit zur Jagd gehen, Meerschweinchen und Affen, dagegen keine Hauskatzen. Die Mädchen haben häufig ganz winzige Äffchen als Spielzeug, ebenso rührend zutrauliche wie gegen Fremde furchtsame Tierchen. In einem Haus lebte ein jung gefangener Tapir, der sich, nun schon ausgewachsen, ganz so benahm, als gehöre er zur Familie. Die meiste Zeit schlief er auf dem Hausboden, wobei man ihm ruhig einen Tritt versetzen konnte, der ihn nicht weiter störte. Er ging ganz ordentlich hinaus, um sein Bedürfnis zu verrichten oder im Fluß zu baden, kam dann zurück und schlief wieder weiter. So war er einerseits gebildet und andererseits durch die Zivilisation verdorben, denn er wurde gefüttert und wußte nicht, was es heißt, sich im Wald unter Gefahr und Anstrengung seine Nahrung suchen zu müssen.
Hausschweine hielten sich die Indianer nicht, obwohl sie sie manchmal bekommen konnten, sie sagten, sie seien zu schmutzig; noch weniger haben sie Kühe, die sie nicht zu behandeln verstehen, und selten ein paar Hühner, die ihnen ein Farmer als Bezahlung angedreht hat. Sie verstehen sie nicht zu halten und so erfreuen sie sich meist keines langen Daseins und werden bald aufgegessen. Pferd und Rind sind im Urwald unbekannt und auch das Maultier nur im Gebirge zu gebrauchen und dort allerdings heute aus der Landschaft nicht mehr wegzudenken, obwohl es, wie die ersten beiden, aus der Alten Welt stammt.
Der Indianer betrachtet und behandelt Tiere, die er von jeher kennt, nicht als geringere Lebewesen, sondern als Brüder und redet mit ihnen, ob im Haus oder im Wald, wie mit seinesgleichen, mit allen so, wie wir mit einem verständigen Hund oder Pferd reden. Nach seiner Auffassung sind nicht nur alle Tiere miteinander verwandt und verschwägert, auch er selbst fühlt sich als Verwandter von ihnen, im buchstäblichen, nicht im übertragenen Sinne. Zur Schlange sagt er, sie soll ihm aus dem Weg gehen, und zum Jaguar, wenn er ihn auch nicht sieht, er soll sich sein Fleisch im Wald holen und die Menschen und Hühner in Ruhe lassen. Vom Aasgeier sagt er, daß er, wenn er einen Kadaver findet, »es seinen Brüdern erzählt, und die erzählen es wieder anderen; und so kommt alles auf«. Tiere, die er nicht des Fleisches wegen oder aus anderer Notwendigkeit braucht, läßt der Indianer ungeschoren. Man denkt an die Indier, denen Tiere heilig und Götter sind. Hier wie dort ist die unterscheidende Distanz, die der zivilisierte Mensch zwischen sich und das Tier legt, noch nicht vorhanden.
Bei uns werden sie hinter Gittern gezeigt und der Mensch steht abgesondert davor, füttert oder fotografiert sie, aber er ist nicht mehr eins mit ihnen. Immerhin wäre es zutreffender, statt von wilden von freien Tieren und von gezähmten und Haustieren zu sprechen.
Auch das Tier hat sein Paradies verloren.
Wer bis hierher gelesen hat, wird zugeben müssen, daß sich der Indianer nicht von gerösteten Ameisen und ähnlichen Urwaldleckereien zu ernähren braucht. Daß er trotz des überreichen Tisches, den ihm die fruchtbare Natur bereitet, einen sehr gleichmäßigen, wenig abwechslungsreichen Speisezettel hat, und daß seine Speisen nicht kompliziert und langwierig zubereitet werden, hat die Vorteile der noch natürlichen Ernährungsweise. Starkes Erhitzen und langes Kochen vermindert oder vernichtet bekanntlich den Nährgehalt unserer Speisen, ganz abgesehen von der ebenso bekannten Tatsache, daß sich die Ernährung des Großstädters immer weiter von den natürlichen Grundlagen entfernt.
Nicht jeden Tag gibt es Jagdbeute, der Indianer ist in der Hauptsache Pflanzen- und Fischesser.
Fleisch und Fische werden am offenen Holzfeuer gebraten, ohne anderes Fett als dem eigenen; Fett als Zutat zum Kochen und Braten ist unbekannt. Was übrigbleibt, wird geräuchert, entweder in der Sonne oder auf Zweigrosten über dem Feuer. So geräucherte Fische bleiben sehr lange haltbar. Nicht alle werden auf die gleiche Art zubereitet, sondern je nach den Arten unterschiedlich. Manche werden auf Gewürzblättern »serviert«, deren Duft und Geschmack sich dem Fisch mitteilt. Ein bestimmter Fisch wird mit den breiten Blättern eines gewissen Baumes umwickelt, mit Bast verschnürt, auf Stöcke gespießt in die Nähe des Feuers gestellt und so in seinem eigenen Saft gedünstet. Ich habe schon manchen guten Fisch gegessen, aber noch keinen, der auf solche, sogenannte primitive Art zubereitet, so delikat geschmeckt hätte. Eine ausgezeichnete Sache ist auch die Fischkopfsuppe, die ich auch erst im Urwald kennenlernte.
Fleisch wird, da es nicht alltäglich ist, in der Regel auf einmal aufgegessen, doch ist es selten allzuviel, da das Fleisch, das der Jäger bringt, stets an mehrere Familien verteilt wird. Getrocknetes, hartgedörrtes Fleisch ist als Reiseproviant dem Büchsenfleisch vorzuziehen.
Die Mahlzeiten werden nicht zu bestimmten pünktlichen Stunden gehalten, sondern bei Wild und Fisch unregelmäßig, nämlich dann, wenn etwas da ist. Bringt der Mann die Fische mitten in der Nacht, so werden sie sofort zubereitet und die frischen verzehrt.
Männer und Frauen essen getrennt.
Die Stelle des Brotes vertreten Mehlbanane und Brotfrucht und am meisten die Yucca.
Milch und Hühnereier sind unbekannt, Schildkröten- und Leguaneier beliebt.
Salz wurde unter meinen Leuten wenig gebraucht. Es gibt auch Stämme, die ganz ohne Salz leben, wie die Cachibo, die aber wahrscheinlich salzhaltige Wurzeln oder Kräuter kennen. Indianer, die kein Salz kennen, essen es, wenn man es ihnen gibt, sogleich auf, wie die Kinder die Süßigkeiten.
Die Lebensmittelverteilung und gegenseitige Aushilfe war stammesüblich und ein Eigennutz nicht zu beobachten. Auch mir brachten meine Nachbarn stets einen Teil ihrer Fisch- und Jagdbeute. Besuchte ich einen in seiner Hütte, so war das erste, daß ich aufgefordert wurde, zu essen und zu trinken. Ihrerseits waren sie bescheiden. Ließ ich einen mit Dynamit fischen und bekam achtzig oder hundert Fische, dann wollte ich ihm die Hälfte überlassen. Stets aber begnügte sich der Indianer mit nur wenigen, mit der Ausrede, er könne nicht mehr tragen.
Das Hauptgetränk beider Stämme ist der Massato. Er wird aus gekochten und zerstampften Yuccas bereitet, die dadurch in Gärung geraten, daß das Weib des Indianers einige Male einen Mundvoll kaut und das Gekaute hineinspuckt. Diese säuerlich alkoholische Milch, eine Art kühle, flüssige Hefe, wird in einem ausgehöhlten Baumstamm aufbewahrt und mit Bananenblättern bedeckt. Der Indianer bietet seinem Gast Massato an, und ihn zurückzuweisen würde als eine Verletzung der Gastfreundschaft empfunden, wie die Darreichung ein Zeichen des Willkomms und der Freundschaft ist. Dieses sehr beliebte Getränk ist zugleich Nahrungsmittel; wenn der Indianer bei der Rodung und in der Pflanzung hart arbeitet, nimmt er nichts anderes zu sich und verschmäht jede feste Nahrung. Für Festlichkeiten werden besonders große Vorräte von Massato bereitgestellt.
(Die aus einer Agave gewonnene Pulque ist nur in Mexiko und Zentralamerika gebräuchlich.)
Dem Massato verwandt ist die aus Mais bereitete, sehr süße und schnell berauschende Chicha, die schon das Getränk der Incas war und beim Sonnenfest dem im Osten aufsteigenden Tagesgestirn in goldenem Pokal als feierliches Trankopfer gespendet wurde.
Aus gekochten Bananen wird Chapo bereitet, eine violett-braune, dicke, süße, kühlende Limonade.
Den Saft des Zuckerrohrs preßten die Indianer aus, indem sie es mit einem Prügel in einem Loch, das in einen Baumstumpf geschnitten wird, quetschten. Auch ich benützte diese einfache Vorrichtung. Noch öfter wird das Zuckerrohr einfach gekaut, doch nur von Weibern und Kindern. Es gehören gute Zähne dazu.
Kaffee, der in ihrem Land wächst, wurde nirgends von Indianern getrunken. Meine Freunde sagten, das sei Gift.
Aus Kokablättern gekochten Tee fand ich wohlschmeckend und bekömmlich. Die Wirkung dieses heißen Getränkes war aufmunternd und beruhigend zugleich. Einen anderen aus einem schilfartigen Gras bereiteten Tee nannten sie Hierba-Luise. Dieser Tee soll auch ein Heilmittel sein. Er schmeckte wie heißes Zitronenwasser mit Soda.

Amoishe-Familie vor ihrem Haus
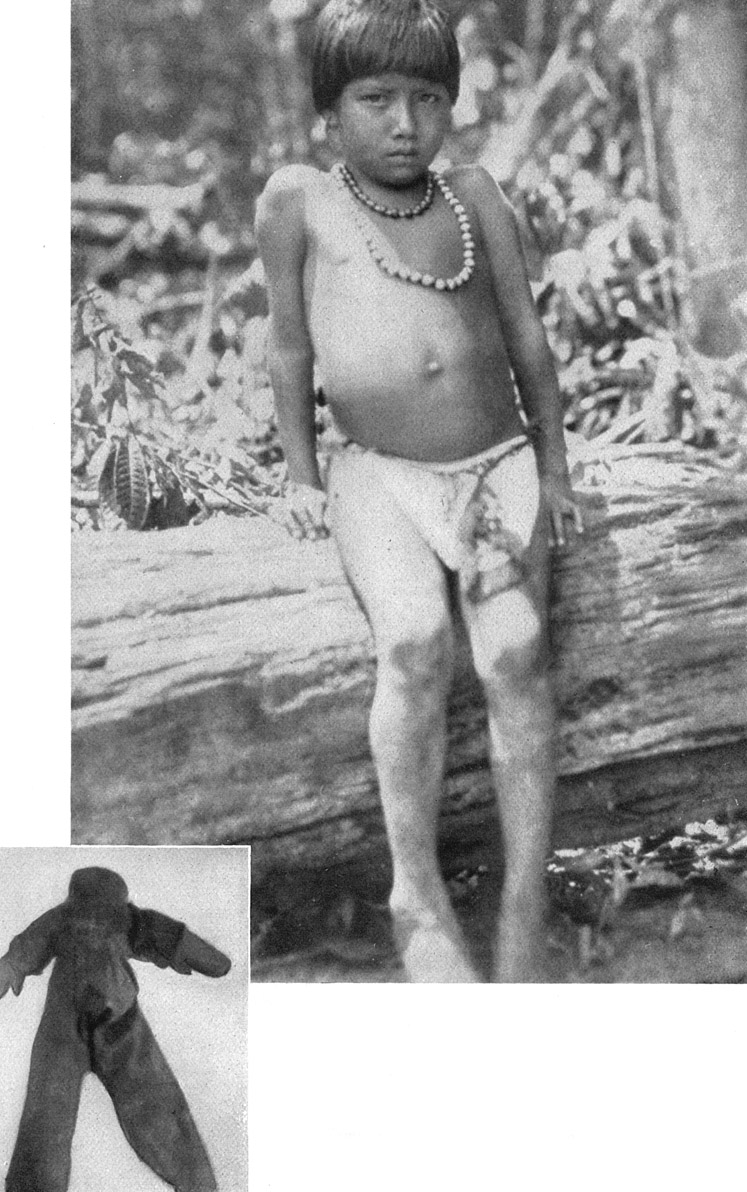
Campa-Mädchen und Kinderpuppe.
Die Halsketten bestehen aus getrockneten Beerenfrüchten
Diese einheimischen Getränke entsprechen dem Klima und sind darum den ausländischen – wenn solche überhaupt zu haben sind –, wie Bier, Wein und anderen Alkoholen unbedingt vorzuziehen. Besonders eisgekühlte Getränke sind in heißen Zonen wenig bekömmlich und verursachen Magenerkältungen und Dysenterie.
Der Schnaps endlich, eines der Haupterzeugnisse aus dem Zuckerrohr, ist in den Urwald noch nicht eingedrungen. Zuckerrohrpressen und Schnapsbrennereien traf ich noch in einzelnen größeren Ansiedlungen am Amazonas und eine letzte am mittleren Ucayali. Wenn ich unterwegs war, versäumte ich keine der seltenen Gelegenheiten, mir wenigstens eine Flasche voll dieser wertvollen Montaña-Medizin zu verschaffen. Die Waldindianer, die diesen reinen und scharfen Schnaps noch nicht kennen, würden ihn auch nicht vertragen, zumal sie ihn aus Unerfahrenheit trinken würden wie ihren alkoholarmen Massato. Aus diesem Grund werden in den Schnapsbrennereien, wo Indianer beschäftigt sind, die Behälter mit Schlössern versperrt und der Schnapsverkauf auf ein Mindestmaß beschränkt. Ich traf mehr als einen Indianer, der auch den geringsten Schluck, den ich ihm anbot, standhaft verweigerte. Bei zahlreichen Stämmen verbieten die Häuptlinge den Genuß des »Alkohols der Weißen«. In den Städten, auch den kleinen, habe ich mehr als eine Schnapsleiche gesehen. Der Mischling säuft so lange, bis er wie tot auf der Straße liegenbleibt, von Polizisten aufgelesen und auf die Wache geschleift wird wie ein Stück Holz. Der Betrunkene, der Geld und Gesundheit einbüßt, wird auch noch von Amts wegen bestraft; Fabrikant und Händler, die ihm das Gift verkaufen und den Gewinn davon einstecken, werden nicht bestraft – eine Narrenhauswelt.
Dem Weißen schadet der Caña weniger. In der Hacienda eines Deutschen an einem Nebenfluß des Amazonas, in der ich einkehrte, stand stets ein mit Cachassa gefüllter Waschkrug auf dem Tisch, aus dem sich jeder bediente, und der, wenn er leer war, aus einer Korbflasche wieder gefüllt wurde. Der Besitzer fabrizierte außerdem auch etwa achtzigprozentigen Alkohol, mit dem er seine Lampen speiste.
Eines Morgens kam ein Mann zu Besuch, ein gewisser Don Carlos, ein mächtiger, breitschultriger Kerl, gut in den Sechzig, rotbackig und blauäugig, ein Mann, der so gesund und stark war, wie jeder sich wünscht, in diesem Alter noch zu sein, und wie es in den nervenzerfressenden Städten Europas nur wenige werden. Er plagte sich aber auch nicht, fuhr in seinem Boot spazieren, besuchte die tagereisenweit auseinander wohnenden Nachbarn und ließ den Herrgott einen guten Mann sein. Wie jeder Gast, und er war einer der ältesten, bediente er sich des Kruges auf dem Tisch, füllte ihn aus dem Carafon und hatte den Krug bis zum Mittag ziemlich leergemacht. Der Besitzer, Don Enrique, kam nach Hause.
»Heut hast du den Schnaps aber ziemlich scharf eingebraut!« sagte Don Carlos.
»Ist ja gar keiner da«, erwiderte der Patron, »wir müssen erst einen machen am Nachmittag.«
»Keiner da, ich hab doch eingefüllt aus dem Carafon da!«
»Aus dem? Mensch, das ist ja der Alkohol für die Lampen!«
Als einziges Genußmittel fand ich bei allen Indianern von der Sierra bis hinunter in die tiefste Amazonasniederung statt des nicht üblichen Rauchens die Kokablätter. Die Koka ist der Kautabak des Indianers. Daß das Kokakauen schädlich sei, wie man zuweilen hört, kann ich nicht finden, ich halte es für unschädlicher als das Rauchen. Aus den Blättern des Kokastrauches wird das Kokain gewonnen, aber um ein Gramm Kokain zu gewinnen, ist eine Tonne Blätter erforderlich, woraus hervorgeht, daß die Blätter nur sehr minimale Dosen des Rauschgiftes und diese in natürlichem, unverarbeitetem Zustand enthalten. Das Kauen vermehrt auf anstrengender Wanderung die Ausdauer, es kräftigt, beruhigt, tröstet, vertreibt den Hunger, glättet jede Art von Erregung, Ärger, Kummer und Schlaflosigkeit; glaubt man wegen irgendeiner unerfüllbaren Sehnsucht oder Leidenschaft, Hoffnung oder Enttäuschung aus der Haut fahren und verzweifeln zu müssen, das Kauen der Koka verleiht sogleich Zufriedenheit, seelische Ruhe, körperliches Wohlbefinden und eine beglückende Wurschtigkeit, Dinge, die alle zusammen zu erreichen ein Philosoph eine ganze Menge Weisheit aufwenden muß. Und das alles bewirkt die Koka ohne die schlechten Nachwirkungen, die Alkohol- und Nikotingenuß zur Folge haben. Kein Wunder also, daß der Indianer leidenschaftlich kaut und das bittere, tröstende Kraut, versüßt mit gestoßenem Kalk und dem Süßholz Chamayro, dem Essen sogleich folgen läßt und, unter Umständen, es ihm vorzieht. Und wenn dieses Kauen ein Laster ist, wie von manchen behauptet wird, sicherlich von Leuten, die es nie versucht haben, dann sind auch Rauchen, Schnupfen, Priemen und das ewige Kaffeetrinken der alten Weiber Laster, nur keine von so angenehmen Wirkungen begleiteten.
Das Kokakauen war ursprünglich, unter den Incas, ein Privilegium der Adels- und Fürstenkaste. Erst nach der Vernichtung des Incareiches wurde es jedem erlaubt und allgemein gebräuchlich, nicht anders, als hätten die Incas ihrem trauernden Volk dieses süß und leicht betäubende Trostmittel testamentarisch hinterlassen.
Ein sehr geschickter jüdischer Reiseschriftsteller schrieb ein Buch über Peru und betitelte es »Schnaps, Kokain und Lamas«. Selbst sonst ganz vernünftige Menschen fanden allein schon diesen Titel prächtig. Was hilft oder wem nützt aber die geschickteste Geschicklichkeit eines Schreibers, der von Land und Leuten keine Ahnung hat und all seine Weisheit dem Portier seines zweifellos erstklassigen Hotels verdankt.
Auch die Kleidung des Indianers ist kein Problem, am wenigsten für die, die nackt gehen, wie mehrere Unterstämme der Campa (Männer wie Frauen) und zahlreiche andere Stämme.
Das Nacktgehen ist nicht, wie oft geglaubt wird, die Folge eines Bildungs- und Kulturmangels, sondern eine Folge der Hitze. Besonders in den »höheren« Gesellschaftsschichten, deren Höhe heute leider nur vorzugsweise eine materielle ist, glaubt man, diese nackten Menschen gering schätzen zu müssen, womit freilich nur die eigene Unbildung verraten wird. Daraus, daß einer in einem Stoffutteral steckt, läßt sich noch kein Schluß ziehen auf seine besondere Bildung oder Kultur, sondern nur einer auf kaltes und schlechtes Wetter, das in seinem Geburtsland herrscht, wenn er nicht aus kälteren Zonen stammende Bräuche nachahmt. In diesen Zonen ist man ja sogar trotz der schützenden Kleidung der Kälte und den Erkältungskrankheiten ausgesetzt, ohne diese Kleidung aber wäre man einfach dem Tode ausgeliefert; woraus zu ersehen ist, daß Kleidung kein moralisches oder geistiges, sondern ein klimatisches Erfordernis ist. Es ist darum unverständlich, wenn sich einer deswegen für einen besseren Menschen hält, weil er gezwungen ist, sich mehr zu bedecken und wärmer zu kleiden als andere, die das nicht nötig haben.
Daß die aus mäßigen und kalten Zonen stammende und diesen angepaßte Kleidung auf den an Nacktheit gewöhnten Körper gesundheitlich den schädlichsten Einfluß ausübt, liegt auf der Hand.
Ich selbst habe an mir folgendes beobachtet. In der Canoa fährt man durch einen Gewitterregen. Der prasselnde Schauer dauert eine halbe, mitunter auch eine Stunde. Der Regen ist warm, aber in patschnassen Hosen und Hemd, die auf dem Leib kleben, und im Luftzug der Fahrt oder einem leichten Wind friert man, auch wenn längst wieder die Sonne scheint. Um eine Erkältung zu vermeiden, zieht man also die nassen Kleidungsstücke aus, und die Haut trocknet und wird sofort warm. Legt man die Kleidungsstücke aber schon vor dem Regen ab, dann spürt der Körper weder im noch nach dem Regen eine Kühle.
Was die ästhetische Seite betrifft, so kann kein Zweifel darüber bestehen, daß auch die schönste und kostbarste Kleidung einen schlechten, degenerierten, verfetteten oder verkrüppelten Körper nicht schöner machen kann, wie andererseits die Schönheit des nackten, gesunden Körpers ohne jede verdeckende Zutat die vollkommenste ist. Nackt, wie er geboren wird, ist der Mensch seinem Wesen am nächsten, von der Kleidung aber, die den Körper verdeckt und versteckt, stammt eine Unfreiheit, die nur zu leicht in Heuchelei ausartet. Die Geschwister Nacktheit und Wahrheit erfreuen sich, bei uns Zivilisierten wenigstens, keiner allgemeinen Beliebtheit, und nicht zufällig sind Heuchelei und Verstellung in dem Lande zu Hause, das die meiste Zeit des Jahres von dichtem Nebel verdeckt wird.
Es ist zu absurd: der Zivilisierte treibt Sport und Körperpflege, um sich körperlich abzuhärten und zu ertüchtigen, während er gleichzeitig den letzten körperlich noch unverwüsteten Menschen eine aus fremdem Klima stammende, unbequeme, ungesunde und verweichlichende Kleidung aufdrängt. Und statt von dem Vorbild edler und gesunder Nacktheit, das Südamerika in seinen eigenen Ländern vor Augen hat, zu lernen, ist im Gegenteil nirgends in der Welt eine größere Prüderie anzutreffen als in diesem Erdteil.
Der nackte Körper, dort, wo ihn das Klima erlaubt oder gebietet, das Ursprüngliche und Selbstverständliche, wird immer seltener; Missionare und Händler sind seine Gegner und Feinde, und wenn die Revolution des Menschen die Einrichtungen des Unmenschen, die der Natur jene der Unnatur, nicht beseitigt, dann ist der Tag nicht mehr ferne, da der nackte Mensch gänzlich von der Erde verschwunden sein wird. Und dann wird das Leben wieder um eine wunderbare Erscheinung der Natur ärmer sein.
Die Haut des nacktgehenden Menschen hat stets die von Luft und Licht getönte Farbe, und die würde sie auch beim weißen Menschen haben, dessen weiße Bleichheit nicht seine natürliche Hautfarbe ist, sondern eine durch den Mangel von Luft und Licht gebleichte, was an dem Unterschied der Gesichts- und der Körperfarbe deutlich zu sehen ist. Wenn auf einer Grasfläche einige Zeit ein Brett liegt und man hebt es auf, dann ist das davon bedeckt gewesene Gras kürzer als das ringsherum wachsende, und auch bleicher, und nicht grün, sondern blaßgelb. Wie alle Farben in der Natur entsteht auch das Grün der Pflanzen durch die Einwirkung von Luft und Licht. Wäre der Europäer nicht gezwungen, in Kleidern zu gehen, so würde sich bald zeigen, daß seine Haut gar nicht weiß und, wenn überhaupt, nur wenig heller ist als die der Indianer, unter denen ich manchen kannte, der hellhäutiger war als ein sonnengebräunter Sportsmensch (dessen Haut im Winter unter den Kleidern sogleich wieder verblaßt). Und zwischen der Gesichtsfarbe eines Jägers oder Bauern, die das ganze Jahr im Freien sind, und der eines Indianers besteht nicht der geringste Unterschied.
Der Vorgang ist der, daß die Verbrennung der Haut durch die Sonnenstrahlen, die die Bräunung bewirken, zugleich einen Schutz gegen die weitere Verbrennung der Haut bildet. Und dem Wissenschaftler muß eigentlich bekannt sein, daß die braune Haut nichts weiter ist als ein Pigmentschutz gegen die Sonnenstrahlen. (Und das dichte schwarze Haar ersetzt die Kopfbedeckung.) Schon der Bewohner sonniger Südländer hat einen dunkleren Teint als der nördlich der Alpen Wohnende; wären die Europäer nur tausend Jahre nackt gegangen, so würde ihre Hautfarbe rot und braun sein; und wenn der Indianer tausend Jahre in Kleidern steckt, wird er hellhäutiger sein als heute.
Daß man unter verschiedenen Indianerstämmen nackten, wie halbnackten und bekleideten begegnet, hat mit verschiedenen Sitten oder Anschauungen nichts zu tun, sondern ist eine rein praktische Angelegenheit, die verschiedenen Witterungsverhältnissen entspringt. So trägt der Bergindianer, in regenreichen, kühlen Gebieten wohnend, Wollmütze und Wollponcho, der Indianer der tropischen Tiefe aber braucht keinen Regenmantel; der warme Regen ist für ihn nur eine Badedusche.
Bei den Amoishe und Campa, von den letzteren nur ein Teil, tragen Männer und Frauen die Cushma, ein ärmelloses Hemd, aus Baumwollfaden selbst gewebt und mit dem gekochten Saft einer Wurzel rostbraun gefärbt. Die aus zwei Stöcken bestehende Webevorrichtung, die mit Hand und Fuß bedient wird, ist höchst einfach. Daß der Mensch ursprünglich die Füße zur Betätigung mitbeanspruchte, genau so wie die Hand, sah ich bei verschiedenen Beschäftigungen der Indianer. Auch bei uns, an der Nähmaschine, am Autosteuer usw. geschieht das gleiche, wenn auch in verkümmerter Form, da der Schuh die Beweglichkeit des Fußes beschränkt.
Bei den Chama sah ich die gleichen Hemdkittel aus weißem Baumwollstoff mit gebatikter ornamentaler Zeichnung.
Geht ein Indianerweib im Rock oder ein Mann in alten Hosen mit oder ohne Hemd, dann haben sie diese Kleidungsstücke als Arbeitslohn von einem Farmer oder Missionar bekommen.
Die eigene, hergebrachte Kleidung wird bei den Männern ergänzt durch die Corona, dem aus Bast geflochtenen und mit Papageienschwanzfedern geschmückten Kopfputz, die Banda, eine Schärpe aus schwarzen und weißen Beerenfrüchten, und dem Bushac, dem selbstgewebten Jagdbeutel, durch Schmuck aus Vogelbälgen und Tierzähnen und straffe baumwollene Bänder, die um Hand-, Arm- und Fußgelenke geschnürt werden; bei den Frauen durch Halsketten aus Beeren. Die vollständige Tracht ist sehr malerisch und geschmackvoll. Bei den Yagua sah ich eine »Bekleidung«, die nur aus Bastbüscheln um die Lenden und um Hand- und Fußgelenke bestand, eine besonders geschmackvolle Dekoration, die die Körperformen nicht verdeckt, sondern dekorativ betont.
Nackt gehende Frauen tragen zur Zeit der Menstruation einen Faserschurz, oder eine Binde oder Quaste aus Bast vor dem Geschlecht, die keine Kleidungsstücke sein wollen, sondern Schutzvorrichtungen und Anzeichen der Zeiten der Enthaltsamkeit sind. Manchmal ist der Lendenumhang auch nur von rein dekorativer Bedeutung. Die Männer tragen zu gewissen Zeiten das Glied hochgebunden, womit ausgedrückt wird, daß sie zu dieser Zeit beim Weibe schlafen; es wurde mir gesagt, daß es zu dieser Zeit »nicht ratsam sei, mit ihren Weibern anzubinden«. Das Glied ist durch eine Holz- oder Fruchtkapsel vor Unreinlichkeit, Insekten und Verletzungen geschützt.
Das Cushmahemd wird nicht immer auf dem Leib getragen, sondern unterwegs, beim Passieren von Bächen und Flüssen und im Regen als Bündel auf dem Kopf; auch wird es als Schlafdecke benützt. Es ist ein sehr praktisches Kleidungsstück, das Gewebe stark und haltbar und doch weder dick noch schwer. Und schließlich und endlich kostet es nichts, denn Baumwolle wächst wie Unkraut und den Faden spinnt das Weib und den Stoff webt es auch.
Als die Farmer kein Geld hatten und den Indianern keine Stoffe für Hemden und Hosen geben konnten, fingen die Weiber wieder zu spinnen und zu weben an und die Männer gingen wieder in der Cushma wie von alters her. Auch ich ließ mir eine weben, als mein letztes Paar Hosen nur mehr aus Löchern bestand. Die Indianer sollten dabei bleiben, denn wenn die Baumwolle nicht mehr wächst, dann muß schon zuvor die Erde untergehen. Katastrophen aber, die das Geld und die Dinge, die man für Geld bekommt, plötzlich entwerten oder unerreichbar machen, geschehen heute jeden Tag.
Wie der Indianer nicht gemeinsam mit seinem Weib ißt, so führt er auch Unterhaltungen nur mit Männern, wobei das Weib bestenfalls geduldete Zuhörerin ist. Ein junger, eben verheirateter Indianer lebt mit seinem Weib in einem Raum, seine Hütte ist noch eine kleine. Bei den älteren, wenn Familie und Haus größer und oft Mehrfamilienhäuser sind, sah ich getrennte Abteilungen, die eine für die Männer, die andere für die Weiber, die nicht überschritten wurden. Ich hörte nie ein böses Wort von seiten des Mannes gegen sein Weib fallen, wenn auch manchmal ein kurz angebundenes. Es hieß, daß sie ihre Weiber prügeln und daß dies von keinem Teil als Strafe aufgefaßt wird, sondern als ein dem Manne zustehendes Recht, um nicht zu sagen eine Pflicht, und es wurde mir gesagt, daß das Indianerweib, das der Mann längere Zeit nicht geschlagen hat, sich vernachlässigt glaubt, wir würden sagen: nicht geliebt. Erlebt habe ich eine solche Prügelei nicht; sie wird also, wenn überhaupt, als ein intimer Familienvorgang jedenfalls nicht im Beisein eines Fremden ausgeübt.
Das Verhältnis des Weibes zum Mann zu schildern ist außerordentlich schwierig, da der Europäer sich seiner vorgefaßten Meinungen und Gewohnheiten nicht entäußern, oder mit anderen Worten sich nicht in eine Welt hineinversetzen kann, die nicht die seine ist. Was man ihm aus dieser Welt berichtet, wird er immer mit seinen Augen, seinem Verstand, seiner Moral- und Sittenanschauung, mit einem Wort durch seine Brille anschauen, und das ist falsch, weil diese Brille dort nicht existiert. Auch ich mußte mich bei solchen Betrachtungen von allen ererbten, überlieferten und mir anerzogenen Anschauungen freimachen, soweit das überhaupt möglich ist, um solche Dinge nicht falsch zu sehen, sondern möglichst so, wie sie sind.
Sicher scheint mir zu sein, daß der Indianer das weibliche Geschöpf als ein nicht ganz vollkommenes betrachtet und behandelt; alles in seiner Haltung und Lebensweise deutet darauf hin, daß er einen starken Unterschied zwischen Mann und Weib macht. Das soll ja auch bei uns zuweilen noch vorkommen, und unsere gescheiten Frauen sind von dieser Art und Weise dann nicht sehr erbaut. Ich persönlich bin der Meinung, daß das Weib um so mehr gewinnt, je weniger es nötig hat, sich mit männlichen Eigenschaften zu vergleichen oder auszustatten; ich halte jede Bemühung in dieser Richtung für genau so verfehlt, wie es die umgekehrte wäre. Man soll die von Gott und der Natur gegebenen Unterschiede achten und beachten und respektieren.
Das Weib des Indianers ist noch nicht auf die Idee gekommen, gegen den Platz, den es einnimmt, Einspruch zu erheben, ebensowenig wie ihm einfallen würde, etwas zu verrichten, das Sache des Mannes ist, oder diesen etwas tun zu lassen, das nicht seine Sache und daher seiner »unwürdig« ist. Mit anderen Worten, die Gegensätze der Geschlechter sind stark ausgeprägt. Der weibliche Charakter ist, im allgemeinen gesehen, fügsam, geduldig, bescheiden, schweigsam und sanft zu nennen. Das Weib klagt niemals und kennt keine Widerrede, schnippische Antwort, Zuschlagen von Türen (die es allerdings nicht gibt), oder gar die lächerliche Komödie einer Gardinenpredigt. Es fragt seinen Mann nicht, wohin er geht und wie lange er ausbleiben wird, und wenn er zurückkommt, nicht, wo er gewesen ist. Das alles ist nicht Gleichgültigkeit noch Leidenschaftslosigkeit, es entspringt wohl eher dem Stoizismus der Rasse. Eine Indianerin in meiner Nachbarschaft hatte sich mit dem Machete einen Finger abgehackt und mehrere Tage nichts davon erwähnt, bis der Verband an ihrer Hand auffiel, währenddem die Wunde schon fast geheilt war.
Dabei erwarten diese Weiber vom Mann, daß er in seinen Tätigkeiten das Beste leistet und schätzen ihn darnach ein.
Wenn ich von diesen Frauen erzählte, hörte ich von weiblicher Seite öfters den Einwand, daß ein solches Weib sehr bequem sei. Es mag vielleicht auch bequem sein, aber es ist auch noch etwas anderes: die sichere Ruhe und die geheimnisvoll passive Art solchen Charakters verpflichtet vor allem.
Man findet unter den jungen Mädchen und Frauen auch solche, die nach unserem Geschmack hübsche Gesichtszüge haben. Bei anderen ist der stark ausgeprägte Typ der Rasse und des besonderen Stammes schön zu nennen. Auffallend ist, daß Knaben meist hübscher sind als gleichaltrige Mädchen. Der überfeinerte Typus »schöne Frau« existiert noch nicht und oft kann man beobachten, daß, ähnlich wie in der Tierwelt, wo das Männchen stets prächtiger und schöner geschmückt ist als das Weibchen, die Männer schöner sind als die Frauen. Das bezieht sich jedoch mehr auf die Gesichtszüge; der Körperbau selbst älterer Frauen ist immer noch schlank und sehnig durchgebildet, was davon herrührt, daß die Weiber in der Pflanzung arbeiten und damit ein immerwährendes Training haben. Der weibliche Körper ist unbehaart, behaarte Stellen gelten als häßlich, die Haare werden schon von klein auf beseitigt. Auch ein Mann mit einem Bart erscheint ihnen komisch, wenn nicht unsympathisch und häßlich. Spiegel und Kamm sind noch vielfach unbekannt. Das Haar wird naß gemacht und mit den Fingern geglättet. Bei einigen Stämmen verwenden die Frauen zum Anfeuchten des Haares Urin, möglicherweise wegen der Wirkung des Ammoniaks.
Öfters sah ich Weiber rauchen, fast nie aber eine kauen.
Auch das Weib des Indianers ist alles eher als faul. Ihm obliegt die Hausarbeit, das Unkrautjäten und Abernten der Pflanzung, die Betreuung der Kinder, das Flechten von Körben und Matten und das Formen und Brennen und, wo es üblich ist, auch das Bemalen der Töpfereien. Die fadenspinnende Spindel legt es selten aus der Hand.
Der Staat des Indianers, sein Lebensinhalt und Daseinszweck, wenn man einen solchen unbedingt haben muß und sehen will, ist die Familie. Der beste Jäger und Fischer hat einen guten Ruf bei den Frauen und das erste Recht auf ein Eheweib. Zwei und drei Ehefrauen sind nicht selten. Die Heirat erfolgt ohne besondere Zeremonien, doch wird zu ihrer Feier ein Trinkfest abgehalten.
Indianer sind kindernärrisch, die Männer fast noch mehr als die Frauen. Ein Medizinmann, dem sonst die Krankenheilung oblag, schickte, wenn einem seiner Kinder etwas fehlte, zu mir um Hilfeleistung. Mitten in einer stockdunklen Nacht kam ein Indianer, der einen guten Tagemarsch weit im Walde lebte, wegen eines kranken Kindes zu mir. Wie er den Weg durch den Wald gefunden hat, ist für unsereinen vollständig rätselhaft.
Eine ernste Verwarnung der Kinder von seiten des Vaters habe ich manchmal gehört, aber nie eine körperliche Züchtigung gesehen.
Die Indianerin schleppt das Kleine in einem um die Schulter gebundenen Tuch, buchstäblich auf den Leib gebunden, mit sich, wo sie geht und steht. Etwas größer geworden, reitet das Kleine auf der Hüfte der Mutter. Doch schon bald müssen die Kleinen, wenn sie kaum krabbeln können, die Härten und Anstrengungen des Waldlebens kennenlernen. Einmal ging ich mit einer Indianerin, die vier Kinder bei sich hatte, in der gleichen Richtung. Es wurde dämmerig und die Nacht drohte hereinzubrechen, ehe wir unser Ziel erreichten. Wir beeilten uns und rannten, so gut es ging, die Dämmerung veränderte den Weg und machte ihn unkenntlich, mehrere Male liefen wir Gefahr, uns zu verirren. Die Kinder weinten, das Weib schalt; das kleinste Mädchen, ein dreijähriges Zwackerl, kletterte tapfer wie ein Äffchen die steilen Hänge hinauf und hinunter. Als wir einen Schluchtenbach durchquerten, nahm die Mutter es auf den Arm und das nächstgrößere huckepack. Die übrigen mußten durchwaten und ich, am Schluß des Zuges, paßte auf, daß nichts passierte.
Eine Gebärhilfe ist unbekannt. Die Frau geht, wenn ihre Stunde naht, in den Busch, hält sich an einem Baum fest und bringt das Kind zur Welt, ohne jemandens Hilfe zu beanspruchen. In einer Hütte, in der ich abends eingekehrt war, kauerte die Indianerin vor dem Feuer und kochte Fische. Dann stand sie auf und ging hinaus; eine Viertelstunde später kam sie zurück mit einem Neugeborenen, das im Fluß gewaschen war, bettete es in eine Ecke und kochte weiter.
Ein andermal kam ich an eine Hütte und wollte eine Schale Wasser verlangen. In einem durch Bastmatten abgeteilten Ställchen lag eine Frau. Ich fragte die Alte, die bei ihr war, was der Frau fehle, und hörte, daß sie ein Kleines geboren hatte. Ein vorsichtiger kurzer Blick über die Matte ließ mich den winzigen ziegelroten Indianerburschen sehen, der auf einem Lager von frischen Gräsern strampelte. Aber diese Neugier war unangebracht, wie mich ein strenger und furchtsamer Blick der Alten belehrte. Ich begriff, daß ich als weißer Mann bei dieser Gelegenheit unerwünscht war – da nach ihrem Glauben der Blick eines Fremden dem Kleinen schaden kann – und verabschiedete mich schleunigst, indem ich alles Gute wünschte.
Viele Kinder zu haben ist ein Glück. Ich kam auf der Reise zu Indianern, deren erste Frage, nachdem sie mich genugsam bestaunt hatten, war: »Wieviel Kinder hast du?« Ich sagte zwei und sah, daß sie mich bedauerten. Später erfuhr ich, daß man um so angesehener und beneideter ist, je mehr Kinder man hat, und so sagte ich künftig bei ähnlichen Gelegenheiten, ich hätte fünfzehn Kinder, achtzehn oder zwanzig, und wurde daraufhin von allen beglückwünscht. Ein alter Deutscher im Chanchamayogebiet, er starb hoch in den Achtzigern, hatte, wie man sagte, fünfundachtzig Kinder hinterlassen – er war ein König gewesen.
Wie mir schien, wurden Eltern mit zahlreichen Kindern nicht nur als gesund und stammerhaltend betrachtet, sondern auch als reich im Hinblick auf die helfenden Arme.
Der voreheliche Geschlechtsverkehr ist üblich, die Jungfrauschaft als Eheerfordernis nicht bekannt. Bei anderen Stämmen, wie z. B. den Huitoto, werden die Mädchen beschnitten, d. h. durch einen Eingriff der älteren Frauen kurze Zeit vor der Heirat der jungfräuliche Zustand entfernt.
Wie ich bei den Männern keinen großen Geschlechtstrieb beobachtete, so erschienen mir auch die Weiber in erotischer Beziehung mehr oder minder das zu sein, was wir frigid nennen. Es handelt sich dabei wohl meist um einen noch ungeweckten Zustand, der noch nicht weiß, was Erotik ist und den Geschlechtsverkehr lediglich als Fortpflanzungsakt betrachtet. Meinen allgemeinen Beobachtungen nach sind ihnen sowohl die sinnlichen wie die Aufregungen des Herzens und des Gemütes und Geistes und aller Impulse, wie sie das Erleben unserer beiden Geschlechter kennzeichnen, noch unbekannt, da sie sich auch hierin noch in einem Vorentwicklungsstadium befinden. Trotzdem gibt es Eifersucht auf beiden Seiten, bei den Männern Raufereien der Weiber wegen und bei Männern wie Frauen Giftmorde aus Eifersucht.
Dennoch ist der Umgang zwischen Mann und Weib, der keine Zärtlichkeiten kennt, bei aller uns unverständlichen Kälte nicht ohne Feinheit. So z. B. hütet sich ein Mann, einem Weibe, dem er ein Geschenk gemacht hat, am gleichen Tage beizuschlafen. Das Weib würde darin einen Zusammenhang zwischen dem Geschenk und ihrer Gunst erblicken, womit ihr die schwerste Beleidigung zugefügt wäre. Insbesondere ein Weißer, der diese Unachtsamkeit beginge, würde sich dadurch alle Sympathie für immer verscherzen.
Ich sah nur ein einziges Mal einen jungen Campa weinen, weil ihm sein Mädchen nicht treu blieb, das ihn deswegen auslachte. Doch dieser junge Indianer war schon bei Weißen im Chanchamayotal gewesen und hatte sich dort vielleicht Empfindungen angeeignet, die bei seinem Stamm sonst, wenigstens im allgemeinen, nicht üblich sind. Ein anderer junger Indianer, der mich öfters besuchte, sang gerne kleine Liebeslieder, besaß aber weder eine Frau noch ein Liebchen. Wieder ein junger, schon verheirateter Amoishe fragte mich, ob die weißen Frauen »liebe Gesichtchen« haben.
Der Verkehr oder das Zusammenleben eines Weißen mit einer reinblütigen Indianerin stößt auf Schwierigkeiten in bezug auf den Rassenstolz. Die älteren Frauen warnen die jüngeren, sich mit einem Weißen einzulassen und sagen ihnen, daß sie ein krankes oder ein totes Kind gebären werden. Bei einem Unterstamm der Campa mußte eine Indianerin, die von einem Missionar ein Kind bekam, fliehen, da ihre Stammesgenossen sie umbringen wollten.
Ich war im Laufe der Zeit mit zahlreichen Familien so bekannt und befreundet geworden, daß mir einige Familienväter den compadre anboten, das ist soviel wie Patenschaft, oder so, wie wenn wir Brüderschaft trinken.
Wer das Wort Tropen sagt, der sagt auch Fieber. Auch an dieser Mode sind Übertreibungen und Verallgemeinerungen liebende Romanschriftsteller nicht unschuldig. Sie scheinen untereinander ausgemacht zu haben, daß die Tropen immer und in jedem Fall lebensgefährlich sein müssen. In Wirklichkeit verhält es sich so, daß die Malaria und andere Fieberarten in den Riesengebieten der tropischen Regionen auch nicht häufiger vorkommen als in anderen, wie z. B. auch in zahlreichen Gegenden Europas. Es sind, in Ländern von übermächtiger Ausdehnung, immer nur gewisse begrenzte und bekannte Gegenden, in denen Fieber herrscht, man kann ihnen also ausweichen. Wer freilich, wie ich bei meiner ersten Durchquerung des Amazonasgebietes, durch dick und dünn geht und den Krankheitsherden sozusagen nachläuft, der hat sich die Folgen davon selbst zuzuschreiben. (Das zweitemal war ich klüger und ging in gesunde Gegenden.) Übrigens wandert das Fieber, wird verschleppt, kommt und verschwindet, tritt in Gegenden auf, in denen es früher nicht gewesen ist, oder ist jetzt da nicht mehr, wo es früher war.
Wenn der Europäer vor Schreck erschauern soll, so braucht man ihm nur das Wort »tropisches Klima« zu sagen, ein Schlagwort, das nichts sagt und nichts heißt. Ich sah, daß der weiße Mann in den südamerikanischen Tropen auf jeder, auch der niedrigsten Meereshöhe, auf, neben, unter und über dem Äquator (wenn es sich nicht direkt um einen besonders benachteiligten Platz handelt) seine normalen fünfundsiebzig und achtzig Jahre alt wird, nur mit geschonteren Nerven und gesünderem Humor als an den meisten übrigen Orten der Erde. Ein deutscher Kolonist in Peru klagte mir, daß er geschwollene Füße habe. »Da muß ich sechsundsiebzig Jahre alt werden, um krank zu werden!« sagte er entrüstet. Und ich traf noch ältere, die, nach einem abenteuerlichen, arbeitsreichen und harten Leben, nie krank gewesen sind. Heute hat sich auch der nördliche Europäer in den Tropen längst eingelebt.
Daß man mit der terziana genannten Form der Malaria (dreitägiges Wechselfieber) alt werden kann, wie es heißt, bewies mir die Tiroler Kolonie am Rio Pozuzo. Sie liegt in einem engen, durchzuglosen Tal, das die Siedler wegen seiner Gebirgigkeit lieben, so daß sie lieber das dort, und nur dort herrschende Fieber mit in Kauf nehmen, als es zu verlassen. Sie haben sich daran gewöhnt als an ein unvermeidliches Übel und machen nicht viel Aufhebens davon.
Die einheimischen Vorbeugungs- und Gegenmittel sind gute Ernährung und regelmäßige Verdauung, Purgative, Aquardiente und Chinin in Pulver- oder Pillenform. Ein nie versagendes Heilmittel ist Ortsveränderung, d. h. das Aufsuchen einer höherliegenden, kühleren Gegend.
Vom Fieber befallene Indianer begehen die Unklugheit, im Fluß zu baden, weil »die Strömung das Fieber wegnimmt«. Das tut sie natürlich nicht, sondern die Abkühlung führt nicht selten den fast sofortigen Tod des Unvorsichtigen herbei. Ich klärte meine braunen Freunde darüber auf und ordnete bei Fiebererkrankungen (meist von Kindern, die sich überessen und alle möglichen Früchte in sich hineingestopft hatten) nicht Abkühlung, sondern Schwitzen an, unterstützt von einer Tablette Aspirin oder dergleichen, und verbot ihnen, zu baden; und in der Regel war die Erkrankung über Nacht behoben. (Auch das Essen von in der Sonne erhitzten Früchten führt leicht zu Fieber.)
Die moderne Medizin verfügt heute über so wirksame Arzneien, daß das Fieber, rechtzeitig behandelt, kein Problem mehr zu nennen ist. Auch Fiebergegenden haben gegenüber heutigen Bekämpfungsmethoden ihre Schrecken verloren. Das überragendste Beispiel ist die Panamakanalzone, die aus einem für Weiße wie Eingeborene infolge Massenverseuchung tödlichen Landstrich in einen gesunden, um nicht zu sagen in einen wahren Erholungsaufenthalt verwandelt wurde. Und in der Urwaldstadt Manaos, ehemals eine der ungesundesten Stellen Brasiliens, ist das Tropenhygienische Institut dem Gelben Fieber so zu Leibe gerückt, daß in den letzten zwanzig Jahren nicht ein einziger Gelbfieberfall mehr vorgekommen ist.
Für die heutige medizinische und hygienische Wissenschaft gibt es kein »ungesundes tropisches Klima«, das ja übrigens auch Veränderungen unterliegt, die durch die Änderung der Landschaft bewirkt werden, wie durch Rodung und Trockenlegung größerer Flächen.
Die Zurückhaltung und Furcht des Waldindianers vor den Weißen enthält auch die Angst vor Krankheiten, die von ihnen eingeschleppt werden, denn solchen »weißen Krankheiten« erliegen sie aus Mangel an Widerstandskraft und Erfahrung und infolge Unwissenheit und falscher Behandlung rettungslos. Je neuer eine Krankheit, um so verheerender ihre Wirkung, während die lange Gewöhnung ihre Wirkung abschwächt bis zur Immunität.
Der Indianer ist der Sohn einer gesunden und starken Rasse. Von magerer, sehniger Figur, entfallen für ihn schon alle Krankheiten, die Fettleibigkeit mit sich bringt; und Hunderte von Krankheiten, die bei uns Weißen gang und gäbe sind, kennt er ebensowenig. Was weiß ein Indianer, um nur eines zu nennen, zum Beispiel davon, was nervös ist, oder was Nerven sind. Auch Geschlechtskrankheiten waren bei meinen beiden Stämmen unbekannt.

Altspanische Kirche in Huáchon, Anden. Das Dach strohgedeckt
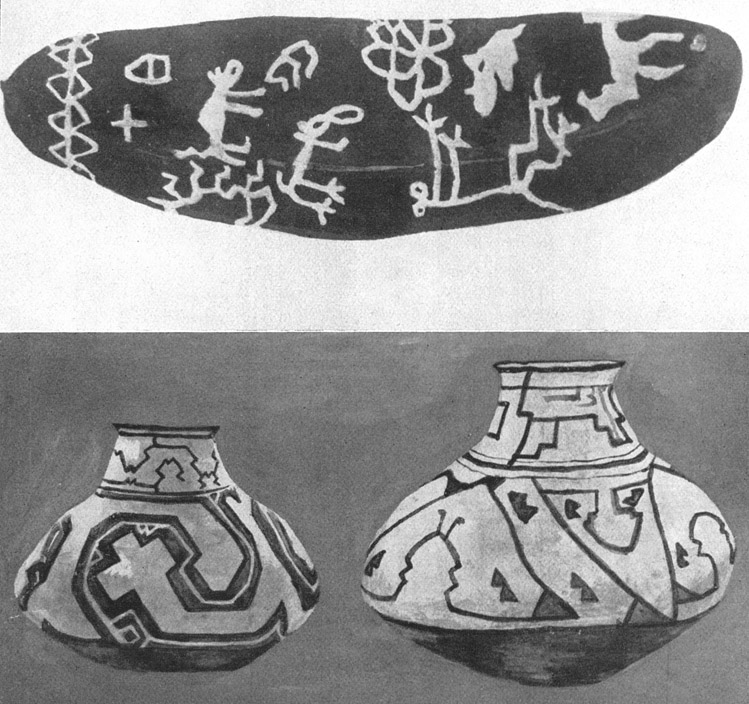
Oben: Die verzierte Frucht der Chama-lndianerin
Unten: Tinajas, bemalte Tongefäße vom Ucayali

Gebatikte Tanzkostüme am oberen Ucayali
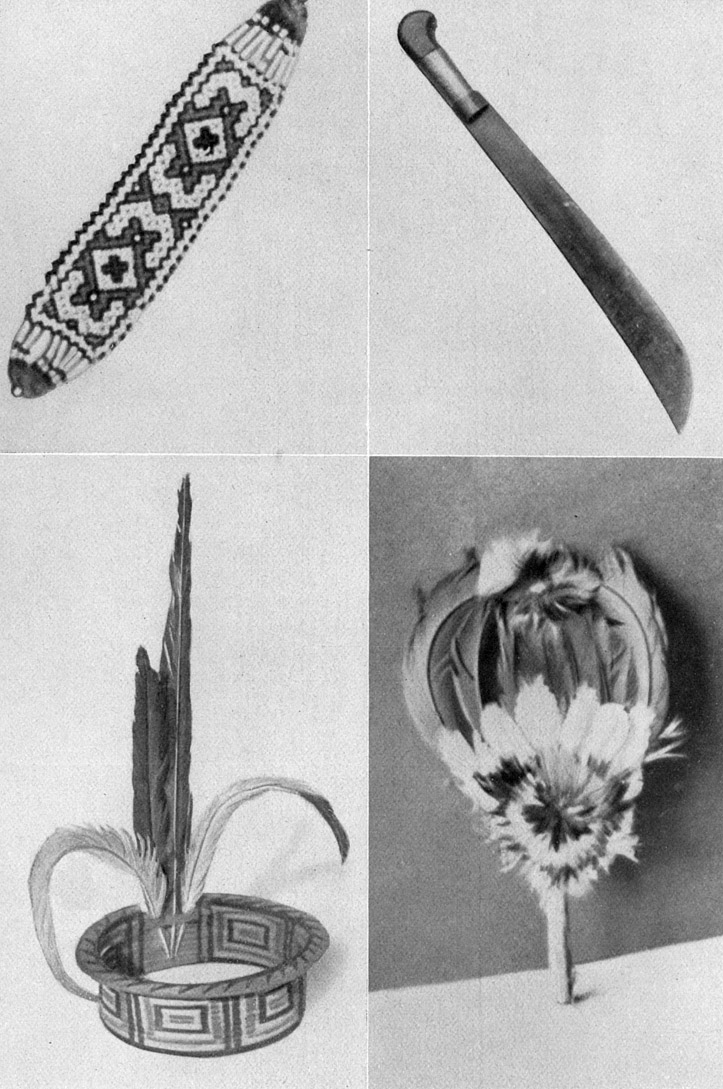
1. Armband der Chama.
2. Das vielgenannte und bekannte Buschmesser, der Machete (sprich Matschéte), das Universalwerkzeug, ohne das kein Urwaldmensch auskommen kann – aber auch kein Tropenschriftsteller.
3. Corona, Kopfputz, den mir der scheue und gebildete Indianer verehrte.
4. Feuerwedel aus Papageien- und Kolibrifedern
Das Gewöhntsein des nackten oder kaum bekleideten Körpers an Hitze und Kühle, Luft und Wasser und Wind und Regen und das Fehlen jeglicher Verweichlichung machen ihn hart und widerstandsfähig. Auffallend ist, da sie keine Fußbekleidung kennen, die Unempfindlichkeit ihrer Füße, die eine an den Fersen fingerdicke, blau-braune Elefantenhaut vor Verletzungen schützt.
Gebadet wird jeden Tag, im Fluß oder im Duschbad des lauwarmen Regens. Bei manchen Stämmen baden Männer, Weiber und Kinder täglich dreimal. Auch die Indios, die ich als Ruderer, Führer und Träger gemietet hatte, versäumten nie, obgleich es jeden Tag ein dutzendmal durchs Wasser ging, abends noch einmal zu baden, wenn Gelegenheit dazu war.
Die Bedürfnisse werden an unsichtbarer, abseitiger Stelle verrichtet.
Krüppel und Mißgeburten habe ich nie gesehen. Ich konnte nicht erfahren, ob Mißgeburten überhaupt nicht vorkommen, was bei der Robustheit der Frauen denkbar wäre, oder ob sie sie beseitigen, was ihnen auch zuzutrauen ist. Bei einigen Stämmen wird von Zwillingen, die als Unglück gelten, einer ausgesetzt. Die Kindersterblichkeit scheint meist groß zu sein, eine Folge der Unerfahrenheit in der Behandlung von Kinderkrankheiten, aber die Nachkommenschaft ist trotzdem zahlreich. Vielleicht geht durch die Kindersterblichkeit auch eine Auswahl der Widerstandsfähigsten vor sich.
Bei den Amoishe gab es eine Krankheit, die sie Lepra nannten, die aber nicht die richtige, echte Lepra ist. Sie beginnt damit, daß sich in den Handflächen und auf den Fußsohlen Risse zeigen. Diese Krankheit heilen sie durch Fasten. Der von ihr betroffene Indianer geht in den Wald und errichtet sich eine kleine Laubhütte, in der er mehrere Wochen lang allein lebt, wobei er sich nur von trockenen, im Feuer gerösteten Yuccas ernährt. Würde er in dieser Diätzeit einen einzigen Bissen Fleisch zu sich nehmen, so wäre die Kur vergeblich gewesen und müßte wieder von vorne begonnen werden. Nach Ablauf einer gewissen Zeit kommt der Indianer zurück, zum Skelett abgemagert und geheilt.
Geschwüre am Arm oder Bein, entstanden durch Insektenstiche oder andere Verletzungen, und verschlimmert durch Nichtbeachtung und Vernachlässigung der Wunde, waren leicht heilbar.
Die Ursache eines starken Nasenkatarrhs, der von Zeit zu Zeit epidemisch auftrat (ich blieb von ihm verschont), konnte ich mir nicht recht erklären.
Eine nicht seltene »Krankheit« war Bauchweh, das davon herkam, daß sie sich an Fleisch überfressen hatten. Sie stopften es so lange in sich hinein, bis nichts mehr hineinging, blieben dann mit aufgeschwollenem Bauch liegen und meinten, sie müßten sterben. (Unsereiner würde auf solche Weise vielleicht wirklich eingehen.)
Von ihren Arzneien lernte ich einige kennen dadurch, daß sie sie mir als Gegenleistung für meine »ärztlichen« Dienste brachten. Im allgemeinen verrät ein Indianer die ihm bekannten Heilmittel einem Fremden nicht, sondern hütet sie als sein Geheimnis.
Als ich das Land noch nicht kannte, wollte und mußte ich durch alle Zonen und Klimen und machte auf diese Weise auch höchst persönliche Bekanntschaft mit einigen Krankheiten, an denen die Tropenärzte ihre Studien vervollkommnen könnten.
Nach einem halsbrecherischen Ritt in den eiskalten Höhen der Anden hatte ich an einem Finger eine Frostwunde, die trotz Jodpinseln, Salben und Verband nicht heilen wollte, so daß ich schon fürchtete, den Finger verlieren zu müssen. Eine Indianerin legte mir Blätter von einem bestimmten Baum um den Finger. Noch am gleichen Tag wurde die Wunde rein und schloß sich, und tags darauf war sie geheilt.
Bei einem Sturz vom Pferd hatte ich mir eine Schulter ausgerenkt. Ein Bergindianer, den sie Arzt nannten, heilte sie auch durch Auflegen eines großen Blattes.
Einmal waren meine Füße elefantisch geschwollen. Eine alte Indianerin wickelte sie in große, brennesselartige Blätter ein, die wie Feuer brannten. Die Geschwulst ging zurück.
In der gleichen Zeit war ich am ganzen Körper gelähmt und konnte weder Hand noch Fuß, noch einen Finger bewegen. Die alte Indianerin massierte mich mit Schlangenfett und gab mir den Saft von der Bananenstaude und einen Tee, der aus blattlosen Zweigen bereitet war, zu trinken. Nach drei Monaten genas ich und konnte wieder die ersten Gehversuche anstellen.
Einmal hatte ich längere Zeit ohne Fleisch gelebt. Als ich dann eines Tages Fleisch bekam, ließ ich es mir vielleicht zu gut schmecken. Die Folge davon war, da der Magen nicht mehr an Fett gewöhnt war, ein starker Durchfall. Ein Indianer brachte mir eine der Roßkastanie ähnliche Frucht, die zerschabt und in warmem Wasser aufgelöst eine blaue Flüssigkeit ergibt. Wenige Stunden, nachdem ich das blaue, fad schmeckende Wasser getrunken, war ich wieder in Ordnung. Die gleiche Frucht soll auch gegen Verstopfung helfen. Gegen Zahnschmerzen brachten sie mir eine scharfe Wurzel, die den Schmerz vorübergehend betäubte.
Noch eifersüchtiger als Arzneien hütet der Indianer das Geheimnis der Bereitung von Giften, von denen es eine ganze Anzahl und darunter, was ihre Wirkung anlangt, die erstaunlichsten gibt. So die Pfeilgifte, die nur Tiere töten, deren Fleisch genießbar ist, und andere, die in Speisen und Getränke gemischt werden und entweder augenblicklich, oder später zu einem gewünschten Zeitpunkt, oder erst nach sehr langer Zeit nach und nach wirken und ein langsames Hinsiechen verursachen. Andere wieder bewirken Erblindung, Wahnsinn, oder, wie das Curare, eine Lähmung aller Glieder. Da diese Gifte uns größtenteils nicht bekannt sind, sind sie auch nicht oder nur schwer nachweisbar. Von einem bestimmten Gift wird die Haut des Toten am ganzen Körper kohlschwarz. Ich erfuhr das dadurch, daß sie eines Tages einen plötzlich gestorbenen Indianer wieder ausgruben, um nachzusehen, ob er schwarz sei.
Außer vom Medizinmann wird die Giftbereitung vielfach von Weibern betrieben, unter denen es richtige erfahrene Wurzelweiber und Kräuterlisl gibt. Solch ein Weib, in der Regel ist es ein unfruchtbares und kinderloses, nennen sie bruja, d. h. Hexe oder Zauberin.
Aber auch alle anderen Weiber wie Männer verstehen aus Pflanzensäften, Wurzeln, Zwiebeln, Samen, Käfern und Teilen von verschiedenen Tieren berauschende und narkotische Pulver und Tränke zu bereiten, die erotisch und antierotisch wirken.
In der Nähe von Iquitos entspringt eine, wahrscheinlich mineralische Quelle, die sie das Zauberwasser nennen; wer davon trinkt, sagen sie, der kommt nicht mehr aus dem Lande. Am unteren Amazonas wird aus der Frucht der Assaypalme ein blutrotes Getränk bereitet, das verrückt machen, d. h. leidenschaftlich erhitzend wirken soll.
Nicht der Zivilisierte, sondern der Naturmensch ist der Erfinder der Rauschgifte und Stimulans, des Nikotins, Opiums und Morphiums, der Bethel, Koka u. a.
Da es im Urwald keinen weißen Arzt gibt, geht der Indianer immer noch zu seinem Medizinmann. Zur Medizinkunst eines weißen Mannes hat er allerdings das gleiche Vertrauen, wenn nicht sogar mehr. Der Medizinmann der Amoishe, der mich gut leiden mochte (und mir eine seiner Töchter aufhängen wollte), holte sich bei mir mehr als einmal Arzneien für Frau und Kind, oder ließ mich selbst holen, wenn ein Kind erkrankt war. Ein intelligenter und schlauer Kerl, wenn auch wieder naiv und treuherzig, war er Arzt und Advokat, Giftmischer und Apotheker, Wahrsager und Hellseher. Seine Hauptzeremonie war Tabakschlucken, d. h. er trank konzentriertes Nikotin, gewonnen aus Tabakblättern, die achtundvierzig Stunden gekocht wurden. Wir nannten ihn darum auch »tabacero«. Der visionäre Zustand, in den er sich dadurch versetzte und aus dem er weissagte, wurde sicherlich sehr unterstützt durch einen ganz gesunden Verstand, gute Menschenkenntnis und vielerlei Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Naturarzneien, die sein Geheimwissen waren. Er ließ sich alles von allen Seiten zutragen und war hellhörig und immer vorzüglich über alle Vorkommnisse innerhalb des Stammes unterrichtet. Hatte ihm einer eine Nachricht überbracht, dann teilte er sie bei passender Gelegenheit mit und sagte, er habe es geträumt.
Wenn so ein Mann seine suggestive Kraft, die auf dem Zauber- und Wunderglauben seiner Patienten beruht, zum Guten anwendet, dann ist es wohlgetan. Natürlich kann er mit dem gleichen Mittel auch rein egoistische Zwecke verfolgen.
Bei den Campa kam es vor, daß der Medizinmann die Schuld an der Erkrankung eines Erwachsenen einem Kind zuschob, das sie dann umbringen wollten. Farmer, die von einem solchen Fall hörten, haben ein solches Kind dann aufgenommen und es damit vom Tod errettet und gleichzeitig eine billige Haushilfe gewonnen.
Der Indianer ist ein guter Patient, weil ein gläubiger. Er glaubt so sehr an die Wirkung jeder Medizin, daß man ihm pures Wasser in einem Fläschchen nicht nur als Arznei verabreichen kann, sondern daß es ihm unter Umständen sogar auch hilft – ein guter Teil der Wirksamkeit jeder Medizin ist wahrscheinlich doch der Glaube.
Medizin ist für den Indianer gleichbedeutend mit Zauber. Das will sagen, daß er keine wissenschaftliche Betrachtung des Heilwesens kennt, die sich sagt, dieses Präparat übt auf dieses Organ diese Wirkung aus, sondern die ganze Heilerei ist für ihn ein geheimnisvolles Wunder, das man nicht verstehen, an das man aber glauben kann, eine Zauberei eben. Er nennt auch nicht nur Arzneien, sondern alles Geheimnisvolle und verblüffend Unbegreifliche Medizin. Eine sehr gut schießende Flinte ist »gute Medizin« für die Jagd, ein Brennglas »gute Medizin« zum Feuermachen.
Den Schmerz bezeichneten sie als »Wurm«, wohl in der Meinung, daß an der Stelle des Körpers, an welcher der Schmerz sitzt, ein Wurm stecken muß.
Während die von den Incas unterworfenen Stämme ausnahmslos die Reichssprache, das Quechua, annehmen mußten und noch heute sprechen, haben die Urwaldstämme (Hauptstämme) jeder seine eigene Sprache, die mit anderen nicht verwandt ist, wenn sich auch in den einzelnen Sprachen Anklänge finden, die Verwandtschaften und Vermischungen andeuten.
Man schätzt die Zahl der Indianersprachen in Südamerika auf etwa hundertfünfzig.
Ich war im Urwald nur ein kleiner Farmer und weder ein Forscher noch Sprachforscher. Nur aus praktischen Gründen habe ich mir einige hauptsächliche Worte der beiden Stämme gemerkt, da manch einer auch das bei ihnen teilweise gebräuchliche Buschspanisch nicht verstand und oft ein Gemisch von Spanisch und Amoishe oder Campa gekauderwelscht wurde.
Campa-Namen
| Männliche | weibliche |
| Tampinári | Tampiámi |
| Kintschiga | Gomuéva |
| Ponéro | Tschungári |
| Kintschúnga | Ualáma |
| Tawántschi | Kutschámis |
| Guáki | Pintánas |
| Hupánki | – |
| Kintschúlla | – |
Die Namen werden dem Neugeborenen gegeben nach bezeichnenden Umständen oder Vorfällen, die mit der Geburt zusammenfallen. Beispielsweise: es regnet, oder es weht ein ungewöhnlicher Wind, so heißt das Kind Regen oder Sturm; ein bestimmter Vogel singt und das Kind erhält seinen Namen, ein Insekt kriecht vorbei, oder ein erlegtes Tier wird ins Haus gebracht usf.
| Quechua | Dialekt-Variation: | |
| eins | uka | us |
| zwei | ischkai | iskai |
| drei | kimsa | – |
| vier | tschusku | tanwa |
| fünf | bitschrach | piska |
| sechs | sogtu | sockta |
| sieben | gantsches | kanchis |
| acht | buach | pusack |
| neun | isru | iskon |
| zehn | tschunka | – |
Bei einem Marsch über die Berghöhen zwischen Oxapampa und Chuchurras verbrachte ich eine Nacht mit indianischen Wegarbeitern, die von einem jungen Deutschen beaufsichtigt wurden, in ihrem Tambo. Als wir unsere Frejoles vertilgt hatten, im Kreis um das Feuer hockten und der eine nach der Pfeife, die anderen nach ihren Kokasäckchen griffen, sang einer der Indios, ein junger Bursche, ein kleines Lied aus dem Stegreif nach einer selbsterdachten Melodie. Es war ein Chechuavers (mit einer spanischen Zeile dazwischen), ein Spottgedicht nach Art der bayrischen Schnadahüpfl. Die Indianersprachen sind wortarm, weil für viele Dinge wie Begriffe, die ihnen unbekannt sind, naturgemäß auch kein Wort existiert. Die Satzkonstruktion scheint, ähnlich wie im Lateinischen (mit dem sie sonst freilich nicht die geringste Ähnlichkeit haben), sehr knapp und gedrängt zu sein. Der Deutsche übersetzte mir das Lied, das ich mir aufschrieb, und wir lachten. Die Melodie habe ich behalten. Es war eine unsagbar monotone Trauer, aber auch ein feiner, resignierter Humor in ihr, trotz einiger derber Ausdrücke. Es war auf meiner ersten Wanderung in die Wildnis, und die Quechualieder, die ich bis dahin gehört hatte, zum erstenmal in meinem Leben, lösten ein eigenartiges melancholisches Entzücken, ein Ineinanderfließen von aufwühlenden Empfindungen in mir aus, wie ich es vorher nur einmal erlebt hatte, als ich, blutjung und weltfremd und schüchtern und sarkastisch zugleich, zum erstenmal in einen Tanzsaal kam. Und doch waren diese unscheinbaren musikalischen Erlebnisse noch stärkere als das einstige.
Erst viel später habe ich ihren eigentlichen Sinn verstanden. Ich hatte eine Wanderschaft angetreten, die nichts anderes war als ein Suchen nach einer menschlichen Heimat. In Europa war ich letzten Endes unverstanden und ein Fremdling geblieben, ein lange Herumgeirrter und nicht Gewollter – in diesen Melodien aber, so schien es mir, hatte ich eine Art Heimat gefunden.
Hier das kleine Lied:
| Chancata, apamuy, huaohuata, rurachun, ishcaita, quimsata, cojudo limeño churyi ni nampa . . . |
(Schatz, meiniger schau die Kinderl! Zwei, drei Stück – der limenische Schuft liebtStatt »liebt« ist ein vulgärer Ausdruck gebraucht. mein Weib.) |
Als Papst Pius der Elfte den Ausspruch tat: »Das menschliche Geschlecht ist eine einzige universale katholische Rasse«, hat er vierhundert Millionen Islamiten und ich weiß nicht wie viele Millionen Buddhisten, Hindus, Konfuzianer, Japaner, Chinesen, Neger, Australier und unzählige andere Andersgläubige und Nichtgläubige, und darunter auch immerhin etwa vierzig Millionen reinblütige Indianer, großzügig übersehen, von denen nur ein geringer Teil »zum Christentum bekehrte« Indianer sind. Aber auch dieser kleinere Teil kann weder als katholisch, noch überhaupt als christlich gelten. Außer katholischen Mönchen gibt es ebenso viele evangelische wie anderen, jüngeren Sekten angehörende »Missionare«, und der von ihnen getaufte oder bekehrte Indio der Randgebiete, der sich selbst »cristiano« nennt, hat vom Sinn und Wesen des Christentums so wenig eine Ahnung wie sein unbekehrter Landsmann im tiefsten Urwald. Er faßt die Christianisierung ganz im Ernst als eine Rangangelegenheit, wir würden sagen als Beförderung auf, und glaubt, er sei nun (gesellschaftlich) etwas Besseres und Feineres als vorher. Und, was das wesentlichste ist, seine Religion hat zwar die Namen gewechselt, ist aber im Grunde die gleiche geblieben. Er sagt Jesus und Santa Maria und verehrt dabei nach wie vor die Götter Sonne und Mond und das nützliche, wärmende und schützende Feuer, und glaubt unverändert an die Dämonen und die guten und bösen Geister der Natur und ihrer Erscheinungen. Selbst da, wo es schon eine Kirche und einen Priester gibt, in kleinen Orten und Dörfern der Randmontaña – solche Kirche ist, da die Kirchen der Spanier nur in den größeren Städten erbaut wurden und nicht weit ins Landesinnere eindrangen, immer nur eine strohgedeckte Scheune –, spielt sich der Gottesdienst der Indianer und Halbindianer in Formen ab, die nichts weniger als katholisch zu nennen sind. Vor einer (in gräßlicher Geschmacklosigkeit mit Papierblumen und Flitterkram behängten) gipsernen Heiligenfigur wird bei kirchlichen Festen getanzt und getrunken, Chicha und Schnaps, und in nicht geringen Mengen; der Rausch der Tänzer und Tänzerinnen ist nicht nur ein religiöser, sondern auch ein alkoholischer, und die ganze Veranstaltung mit ihrer dumpf monotonen und aufreizenden Trommel- und Flötenmusik keine christlich-asketische, sondern heidnisch-sinnlich, mit einem Wort eben indianisch und nicht allzu absonderlich, denn der religiöse Tanz der Naturvölker ist die älteste Form des Gebets. Und die katholische Kirche ist tolerant und läßt jede Form gelten, in der ihrem Gott gedient wird, aber daß es sich hier nur um einen dünnen christlichen Umhang handelt, der außen herum um eine uralt heilige Naturreligion hängt, sieht und spürt jeder, der solchen Gottesdienst einmal erlebt hat.
Im Urwald gibt es auch nicht die primitivste Kirche mehr, dort hält der Missionar sein Cruzifixus in der Hand oder hängt es an einen Ast, oder, wenn er amerikanischer Adventist oder dergleichen ist, d. h. von seinem Religionsverein in Chicago, der ihn angestellt und ausgesandt hat, genügend Dollars bekommt, dann verfügt er unter Umständen sogar über ein Bretter- oder Blockhaus. In einem solchen Missionshaus wohnte ich einmal – unfreiwillig – einer Religionsstunde mit Campas bei, die, natürlich nur aus Neugierde und vor allem in der kindlichen Meinung, daß sie zu essen und zu trinken kriegen würden, angekommen waren, aber nur geistig abgespeist wurden. Der unentwegte Missionar erzählte ihnen zwar nicht, daß der zweite Hauptaktionär des Rüstungskonzerns Armstrong Whitworth der Referend Cyril Argentine Alington, der Dekan der Kathedrale von Durham, ist, und das hätten sie auch nicht verstanden, sondern er sang ihnen mit Harmoniumbegleitung fromme Lieder vor, die sie, keines Wortes Spanisch mächtig, auch nicht verstanden. Ihrem Geplapper und Geschwätz nach zu schließen, schien die wild bemalte Gesellschaft diese musikalischen Genüsse immerhin recht unterhaltsam zu finden. Bevor das Theater losging, hatte ich mich mit einem jungen Campa, der in der Pflanzung des Missionars arbeitete und ganz geläufig spanisch sprach, unterhalten. Als der Amerikaner vor seiner Bude mit einer tönenden Schelle das Zeichen zum Beginn gab, meinte der Campa mit vielsagendem Augenzwinkern: »Jetzt machen sie da unten wieder ihren Blödsinn!«
Als ich mich von ihm verabschiedete, fragte er erstaunt: »Gehst du auch hin?«
»Ja, ich muß, der Missionar hat mich eingeladen.«
»Geh nur«, meinte er, »da kriegst du ein gutes Mittagessen!«
Ein älterer Indianer kam eines Tages mit seinem Weib und einem Neugeborenen zu mir und wollte, daß ich den Kleinen taufe. Es war ihm sehr ernst mit der Sache, von der er wohl auf Umwegen gehört haben mochte, und er war überzeugt, daß ich, als ein Mann mit einer weißen Haut, das ohne weiteres kann. Ich konnte es ihm darum auch nicht abschlagen, nur machte ich es, da ich kein Missionar bin, auf eine mehr indianische Art, und nahm, um die kindliche Wundergläubigkeit der guten Leute nicht zu verletzen, den Ritus auch dementsprechend ernst. Den Mann selbst zu fragen, was er sich von dieser Handlung versprach, oder was er davon verstand, war nicht gut möglich und hätte nicht viel Zweck gehabt, da sie über dergleichen nicht reden. Ich konnte es mir auch so ungefähr denken, und was ich hernach durch vorsichtiges Fragen von anderen erfuhr, deckte sich ungefähr damit. Er, wie ebenso sein Weib, hielt die Zeremonie für einen Zauber, der die bösen Geister und Krankheiten von seinem Kind abhielt.
Wenn man diesen Indianer auch für einen Katholiken hält, dann gibt es allerdings ziemlich viele unter ihnen.
Als ich in der ersten Zeit einmal unvorsichtig nach etwas fragte (dabei handelte es sich nicht einmal um etwas Religiöses, sondern um den Sinn einer familiären Zeremonie), antwortete mir betretenes Schweigen. Ich hatte den Eindruck, daß man mir nicht ausweichend antworten und mich auch nicht anlügen wollte, und daher schwieg, und ließ mir das gemerkt sein. Ich glaube auch nicht, daß Auskünfte, die ein Wissenschaftler auf direktes Befragen von Indianern erhält, zuverlässig sind, denn in religiösen und kultischen Dingen ist die Scheu und Verschlossenheit des Indianers besonders groß, und ich hätte wohl noch weniger darüber erfahren, wenn ich nicht eine Indianerin als Gehilfin eine Zeit im Haus gehabt hätte, aus der ich hin und wieder etwas herauslockte. Andere Mitteilungen verdanke ich einem Deutschen, der länger als ich unter Indianern lebte und, ohne ein Gelehrter zu sein, auf solche Dinge achtete.
Wenn eine Indianerin mit einem Kind einen kleinen Bach überschreitet, dann wendet sie sich um und legt einen Ast über das Wasser. Das bedeutet, daß »die Seele des Kindes hinübergehen kann«.
Ein Indianer unterhielt sich in meiner Gegenwart laut mit jemand, der nicht anwesend war. Als ich ihn fragte, mit wem er gesprochen habe, da doch niemand da sei, sagte er »mit meiner Seele«.
Der Medizinmann sagte von sich, seine Seele wohne in einem Tiger (Jaguar) und darum töte er keinen Tiger, weil er sich dabei selbst umbringen würde. Auch von anderen Indianern hieß es, daß ihre Seele in einem Tier wohne.
Die Welt des Indianers, der die Natur nicht betrachtet, sondern eins mit ihr ist und ein Teil von ihr, ist von Geistern und Gespenstern bevölkert. Nichts ist nur Materie oder physikalischer, chemischer usw. Vorgang, alle Pflanzen und Tiere, Wald und Wasser, Erde und Luft sind von Fabelwesen und guten und bösen Geistern bewohnt, alles ist lebendig und beseelt wirkend.
Die Urnatur, die der Zivilisierte nicht mehr oder kaum noch kennt, ist in ihrer Großartigkeit, Gewalt, Monotonie und Einsamkeit schwer zu ertragen, unsere Nerven sind ihr einige Zeit gewachsen, aber nicht dauernd und immer. Der Indio kapselt Verehrung und Furcht vor ihr in Geisterglauben ein. In den reißenden Stromschnellen wohnen böse Flußgeister, in den kreisenden Strudeln, die Fahrzeug und Mensch hinunterziehen, haust der Dämon des Abgrunds. Nachts soll man nicht im Boot fahren, weil »der Fluß schläft«.
Einige Stunden flußabwärts von mir wohnte ein Amoishe. Der Fluß teilt sich hier in zwei Arme, von denen der linke eine reißende Schnelle und gleich darauf einen Strudel bildet, eine Stelle, an der schwer vorbeizukommen und noch schwieriger zu landen ist. Genau an dieser Stelle, auf dem steilen Waldufer darüber, hatte sich der Indianer seine Hütte gebaut, damit »die Geister, die vom Fluß kommen«, ihn nicht besuchen können.
In seiner Nähe wohnte ein anderer, der seine Hütte und Pflanzung eines Tages im Stich ließ, weil »die Seele nachts im Fluß Wäsche klopft«.
Ein anderer Indianer stellte, als ihm ein Kind gestorben war, in seiner Pflanzung nach verschiedenen Himmelsrichtungen in Kreuzform gebundene Hölzer auf, um die Geister abzuwehren.
Auch das Feuer, das der Indianer auf der Rast im Wald die ganze Nacht durch brennt, hält die Tiere und Geister ab.
Wo ein Toter begraben ist, geht sein Geist um. Deshalb verläßt der Indianer, wenn er einen Gestorbenen begraben hat, seinen Wohnplatz und errichtet Hütte und Pflanzung von neuem an einem anderen Ort. (In übervölkerten Ländern ist es umgekehrt: stirbt einer, so ist ein Platz frei, den sofort ein anderer besetzt.) Andere binden den Toten auf ein kleines Floß und lassen es den Fluß hinabschwimmen.
Ich beobachtete, daß der Bergindianer den Kokapriem niemals ausspuckt, sondern aus dem Mund nimmt und ihn sorgfältig im Gebüsch auf die Erde legt und erfuhr, daß dieser Brauch den Sinn hat, die Geister Verstorbener zu versöhnen.
Geisterglaube und Erkenntnis wohnen nahe beieinander. Und nicht alles ist sinnloser Aberglaube, was als solcher erscheint.
Die Ursache von Erkrankungen sucht der Indianer in Zaubereien, die von Pflanzen, Tieren und feindlichen Menschen, oder von einem Fluß oder Bach ausgehen. Ein »böser Baum« wird gefällt und selbst das Wasser, ein »schlechtes Wasser«, verbrannt. Sie bauen einen Steg in einen solchen Bach, errichten einen Scheiterhaufen darauf und zünden ihn an. Ameisen, die eine Krankheit verursacht haben, werden vernichtet.
Der Sinn in solchen Auffassungen ist uns, da wir die durch uralte Erfahrung gewonnene und immer wieder überlieferte Naturkenntnis des Indianers nicht besitzen, nicht immer sichtbar. Daß hinter scheinbarem Aberglauben meist auch irgend etwas Reales steckt, ist naheliegend. Gibt es doch in der tropischen Flora wie Heilpflanzen so auch zahlreiche uns unbekannte schädliche und giftige – von denen ich einige erwähnt habe –, deren Berührung, ja deren Nähe schon genügt, um ein Übelbefinden hervorzurufen; und das gleiche gilt von verschiedenen Insekten und Kriechtieren.
Ein Indianer hatte sich beim Jagen erhitzt, unter einen Baum hingesetzt und starke Kopfschmerzen bekommen. Am anderen Tag war der Baum umgehauen. Als ich ihn betrachtete, fiel mir ein penetranter Geruch des Holzes auf, den ich nicht lange aushielt.
Daß auch der Mensch dem Menschen durch böse Wünsche, Absichten und Beeinflussungen gesundheitlichen Schaden zufügen kann, ist nichts Ungewöhnliches; Zauberei, böser Blick, Verwünschung und Verhexung sind nur ursprünglichere Ausdrücke für Vorgänge, die die intellektuelle Sprache psychologische, hypnotische, magnetische usw. Beeinflussungen nennt.
Auch seltsame Weissagungen und Voraussagen sind, namentlich wenn sie von alten Indianern herrühren, häufig eingetroffen.
In diese Welt voller Geheimnis und fühlsamer Naturverbundenheit, unter diese unverdorbenen und unverbildeten Menschen (die freilich so leichtgläubig sind, daß man mit einem Taschenspielertrick, wie sie bei uns Kinder und junge Menschen zum Scherz machen, einen ganzen Stamm in Staunen und Furcht versetzen könnte) tappt der Missionar mit seinem religiösen Fanatismus und Bekehrungseifer hinein wie ein frommer Wolf unter die Schafe, der kühnste und unerschrockenste Pionier der weißen Zivilisation, der gefährlichste Gegner und Feind der unschuldigen Wildnis und Natur.
Vier Tagemärsche durch ungangbare Wildnis von meinem Platz in östlicher Richtung, am Rio Pichis, hatte sich so ein amerikanischer Sektenmann niedergelassen, und jenseits des Flusses war auf einem noch weiter vorgeschobenen Posten einer, dem die Campa Hütte und Warenlager niederbrannten. Er selbst kam mit knapper Not mit dem Leben davon.
Diese furchtlosen und entschlossenen Bannerträger der Zivilisation sind mitunter auch ordentliche und brave, helfende und selbstlose Männer, die in einzelnen Fällen sicherlich manches Gute tun. Wie unter den Kolonialbeamten, so gibt es auch unter den Missionaren einzelne, die ernst und bieder überzeugt sind, die Wilden glücklicher machen zu können und zu müssen, und die sich für diese Aufgabe aufopfern, dem Fieber oder einer rätselhaften, unerforschten Krankheit erliegen oder als Beamte in unerträglicher Einsamkeit sich langsam zu Tode saufen. Aber was können solche einzelne weiße Raben schon ausrichten, da sie doch auch nur Bedienstete einer größeren Macht sind, der Macht Zivilisation, Fortschritt, Wirtschaft und Geld. Und, ganz im Gegensatz zur wirklich selbstlosen Arbeit des Arztes, die »Barmherzigkeit« ärztlicher Hilfeleistungen eines Missionars ist doch eine Art religiöse Erpressung. »Wenn du an meinen Gott glaubst, dann helfe ich dir!«
Auch das wird mit ein Grund sein, warum ein Missionar, mag er auch eine ganze Anzahl junger Leute eine Zeitlang um sich haben, oder indianische Arbeiter beschäftigen, die auf seine Waren lüstern sind, die wirkliche Freundschaft eines Indianers nur höchst selten und wenn, dann nicht durch geistliche, sondern nur durch menschliche Eigenschaften gewinnt. Der Wert seiner religiösen Erziehung bleibt ein fragwürdiger. Sie steht in allem und jedem in krassem Widerspruch zur gänzlich anderen Seelenverfassung des Naturmenschen und läuft auf eine völlige Umkehrung und Verkrüppelung dieses Wesens hinaus. Nur in Mexiko, wo die kirchliche Einwirkung schon Jahrhunderte alt ist und dem Indianer von Kindheit an eingeimpft wurde, und zwar zu Zeiten mit rücksichtsloser Gewalt, entstand ein, freilich indianisch gefärbter, Katholizismus.
Der erwähnte amerikanische Missionar hatte einen kleinen Indianerjungen, dem seine Eltern gestorben waren, adoptiert. Der Bub durfte alles tun und wurde nicht getadelt. Er hatte stechende schwarze Augen und einen bösen Ausdruck, ein kleiner boshafter Affe, der alles herumwarf und alles zerschlug, was ihm paßte.
Der scheueste von allen Amoishe, der in einem unauffindbaren Winkel im tiefsten Wald hauste, war als Junge bei einem Missionar aufgewachsen und später davongelaufen. Er machte einen verstörten Eindruck und wollte nichts von Weißen wissen und fürchtete sich auch vor mir; es dauerte lange Zeit, bis ich ihn davon überzeugen konnte, daß ich ihn, wie er meinte, nicht umbringen will.
Mehr als einmal hörte ich, daß die bei Missionaren aufgewachsenen Indianerkinder, die später regelmäßig davonlaufen, ausnahmslos Lügner und Diebe oder noch schlimmere Verbrecher wurden. Es rächt sich an ihnen der Versuch einer Wesensverfälschung, die einem robust gesunden Naturgeschöpf den spintisierenden Geist und die wehleidige Sentimentalität einer utopischen Humanitätsreligion aufoktroyieren will, die anmutet wie ein bohrender Wurm in einer einst runden, gesunden und schönen Frucht.
Entweder sehen diese Religionseiferer nicht, daß der Wilde seine eigene Religion hat und keine neue braucht, weil ihm die alte genügt und entspricht, oder sie verstehen sie nicht. Ein vernunftbegabter Mensch, der eine Spur von Taktgefühl hat, will einem anderen seine Weltanschauung und Religion nicht aufdrängen. Tut er es aber, dann will er ihn beherrschen, zu seinem eigenen und zum Vorteil seiner Auftraggeber. In der Tat handelt es sich in den meisten Fällen einfach um das Geschäft, und die englische und amerikanische Mission läuft nur darauf hinaus, den Eingeborenen mit Handvoll-Reis-Löhnen auszubeuten, um hundert- und tausendprozentige Gewinne einzuheimsen.
»Die armen Heiden« ist der gleiche Schwindel wie »die Wilden«. Man scheint nicht zu wissen oder nicht sehen zu wollen, daß diese Menschen freie Herrenmenschen sind, oder man will sie eben deshalb versklaven, beginnend mit dem rassenfremden, rassenfeindlichen und volksschädlichen Einfluß des Missionars.
Sind die seelischen Verwüstungen, die an diesen Kindern der Menschheit verübt werden, obgleich offensichtlich genug, doch nur dem sichtbar, der sich die Zeit und Mühe nimmt, sie zu sehen, so sind die körperlichen Schäden, die die Einführung einer volksfremden Kleidung bewirkt, für jeden klar und auf der Hand liegend. Diese Kleidung, die nicht in die Länder der Sonne gehört, die Dutzende von gesund gewesenen Rassen degenerierte und verweichlichte und damit die Grundlage zu allen erdenklichen Krankheiten legte (ob sie nun aus den merkantilen Gründen des Händlers oder aus den moralisch-sittlichen der Kirche, der Erfinderin des Feigenblattes, oder in schöner Harmonie aus beiden Gründen erfolgt), ist ein unverzeihliches Attentat auf die Volksgesundheit der indianischen Rasse.

Bemalung zum Tanzfest. (Huitotos.).
Die Ornamente zinnoberrot mit weißen Konturen. Abwaschbare Erdfarben.
(Aquarell d. Verf.)
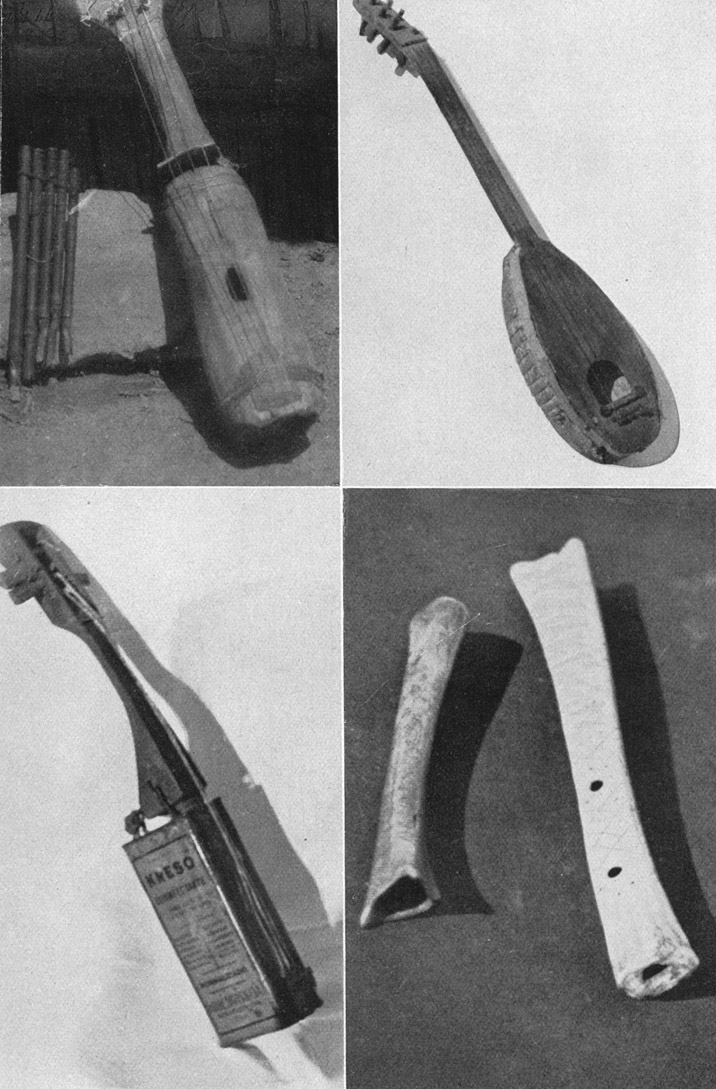
1. Carisa, Flöte und »Gitarre« eines Amoishe. 2. Mein Erzeugnis, eine Gürteltiergitarre (mit dem Machete angefertigt). 3. Einfluß der Zivilisation: ein von einem Farmer weggeworfener Blechkanister, von einem Indianer mit Nägeln, Affenhaut, Baumwollfäden und Zedernholz zu einem Instrument verarbeitet. 4. Indianische Knochenflöten
Wenn ich wieder einen Missionar im Urwald treffe, werde ich ihn fragen, was für Anzüge eigentlich die Leute im Himmel tragen und wer die Stoffe dazu liefert.
Bei meiner ersten Wanderung durch Peru mußte ich berichten, fotografieren und filmen. Ich hatte mich dazu verpflichtet, aber ich tat es ungern, denn nie in meinem Leben habe ich weniger Zeit zum Schauen gehabt als in diesen zwölf Monaten, da ich Tag und Nacht an jeder Seite einen Apparat baumeln hatte und kaum noch an etwas anderes denken durfte als an das fortwährende und ewige Aufnehmen, das auch nicht immer so leicht und einfach war wie in unseren Breitengraden und Licht- und Terrainverhältnissen. Mehr als die Hälfte aller Aufnahmen sind entweder mißlungen oder durch die Hitze und das warme Wasser, das die Gelatineschicht der Platten und Filme auflöst, verdorben, und auch der Apparat hielt trotz seiner Tropenausstattung dem Einfluß des feuchtheißen Siededunstes des Waldes nicht stand. Ich verkaufte ihn eines Tages, ohne daß er je bezahlt wurde, den Kinokasten mußte ich, als ich des Fiebers wegen mein Gepäck auf das Allernotwendigste verringerte, bei einem Urwald-Deutschen zurücklassen und habe ihn nie wiedergesehen, und der aufgenommene Film, den ich einem Treuhänder übergab, ist und blieb, samt diesem, spurlos und unauffindbar verschwunden.
Ich habe von der Fotografie noch nie viel gehalten, denn sie ist keine Kunst – manchmal jedoch ist die Kunst Fotografie. In diesem Jahr aber lernte ich sie – die sich inzwischen zur Massenepidemie entwickelt hatte – gründlich verabscheuen.
Auch die Abneigung der Indianer gegen das Fotografiertwerden verstehe ich recht gut. Selbst in den Anden, im Minengebiet, wo der Weiße keine fremde Erscheinung mehr ist, war das Aufnehmen nicht immer einfach. Als ich z. B. einige hübsche Cholas knipsen wollte und sie um die Erlaubnis dazu ersuchte – unklugerweise, statt einfach drauflos zu knallen –, sagten sie, sie hätten kein Geld. Ich sagte, das koste nichts, aber sie schüttelten nur ungläubig den Kopf und zogen sich furchtsam zurück. Bei anderen Gelegenheiten mußte ich jedesmal eine ziemliche Überredungskunst entfalten, bis es mir gelang, das Mißtrauen der oder des Fotoscheuen zu besiegen. Und die eigentlichen Gründe hinter diesem Mißtrauen waren ganz andere, als nur die Angst, vielleicht von einem Händler hereingelegt zu werden.
Die Urwaldindianer hielten meinen Fotokasten stets für eine schädliche Zauberkiste. Am oberen Ucayali habe ich einmal lange auf einen alten Indianer, der ein paar Brocken Spanisch verstand, einreden müssen, bis es ihm gelang, ein paar Chamaweiber, für die ich ihm einige Halsketten gab, zu bewegen, näher herzukommen. Sie waren, als sie mich von weitem sahen, wie gescheuchtes Wild davongerannt. Endlich kamen sie langsam, ungern und von Gebüsch zu Gebüsch sich versteckend, näher. Ich tat möglichst uninteressiert, lag im Gras und kurbelte mit dem Fernobjektiv. Es waren junge, kräftig gebaute Mädchen oder Frauen. Die jüngste war nackt, die anderen hatten sich ein Tuch um die Lenden gewickelt. Trotzdem hielten sie noch die Hand schützend vor, als fürchteten sie, der schwarze Kasten könne auch durch den Stoff schauen. Der Ort war nahe einem Dampferanlegeplatz, und so hatten sie jedenfalls schon öfters Fremde gesehen; das ihnen ursprünglich fremde Schamgefühl konnte nur von diesen übernommen sein.
Solche und ähnliche Beispiele wären zahlreiche anzuführen. Übrigens ist diese Abneigung nicht nur eine indianische. In dem Eingeborenenviertel einer marokkanischen Stadt sah ich eine weiße Touristin, die ihre Leica vor der Brust hängend stolz zur Schau trug. Als sie den Apparat zückte, sagte ein Muselmann, französisch, zu ihr: »Gehen Sie weiter, ich liebe das nicht!« Als ich aber in dem gleichen Viertel malte, wurde das nicht übelgenommen. Eine Schar von neugierigen Kindern umringte mich und verstopfte den Verkehr, und würdige, weißbärtige Männer schalten auf die zudringliche Jugend und wollten sie mit dem Stock verjagen.
Man muß sich unter fremden Völkern immer auch ein bißchen Gedanken machen. Der Mohammedaner, dessen Religion ihm übrigens Bildnisse verbietet, verabscheut am Fotografieren vor allem das Mechanische und Maschinelle des Vorgangs, während ihm das handwerkliche Malen, da es auch jedem sichtbar ist, weit weniger fremd und störend ist.
Die Indianer fürchten jedes Bild, das von ihnen gemacht wird; wie ich während meiner Farmerzeit herausbrachte aus dem Grund, weil der weiße Mann mit dem Bild eine Zauberei verüben, d. h. etwas Böses anstellen kann, und das würde dann auf das Modell zurückwirken. Beispielsweise: ich zerreiße das Bild, so würde, nach ihrer Meinung, der Dargestellte sterben.
Als ich das zweitemal in den Urwald ging, nahm ich nur mein Malzeug mit. Nicht um zu berichten, da ich ja kein Journalist mehr war, sondern zu meinem Zeitvertreib. Natürlich war auch das Malen den Indianern befremdlich, weil sie es noch nie gesehen hatten. Als ich es das erstemal probierte, lachten mich die Weiber aus. Die Männer aber verwiesen sie wegen ihrer Dummheit. Nicht weil sie mehr vom Malen verstanden, sondern weil sie sich jedenfalls sagten, daß mit einer solchen Geheimkunst letzten Endes nicht zu spaßen und daß es, was es immer auch sein möge, sicherlich nichts zum Lachen sei. Es dauerte immerhin ein gutes Jahr, bis ich mit meiner Pflanzerarbeit soweit fertig war, daß ich Zeit zum Müßiggang und zu künstlerischen Liebhabereien fand. Während dieser Zeit hatten mich die Indianer kennengelernt, und zudem hatte sie jener zuerst so scheue Amoishe, der bei einem Missionar aufgewachsen war, höchstwahrscheinlich auch darüber aufgeklärt, was meine Fummelei mit Pinsel und Farben bedeutete. Sicher hatte er, zum Unterschied von seinen Stammesgenossen, bei dem Missionar auch einmal das eine oder andere Bild gesehen; er war überhaupt, verglichen mit ihnen, weit herumgekommen und aufgeklärt und gebildet. Dennoch konnte auch er nicht »sehen« und nahm, wie alle, das Bild zuerst einmal verkehrt herum in die Hand. Erst wenn ich es ihm zurechtrückte, erkannte er nach genauerem Betrachten den Gegenstand und, wenn es ähnlich war, auch den Dargestellten, worauf er dann den Umstehenden erklärte: »Das ist der und der, das hier ist die Nase und das sind die Augen, seht ihr's jetzt, ihr Hornochsen!« Doch die wurden davon nicht klüger, sondern sagten, bei einem Bildnis befragt, was das sei, kühn irgend etwas, wie »das ist ein Aasgeier«, oder »ein Jaguar«, usw. Da ihre Augen nie Bilder, Spiegelbilder der Wirklichkeit, gesehen haben, so sind sie zuerst auch nicht auf das Bildsehen eingestellt. Auch meinem Freund, dem gebildeten, war dieses Sehen ungewohnt. Als ich ihn malte, drehte er das Blatt um und fragte: »Und wo ist meine Rückseite?« Er war gewöhnt, nur plastisch, nicht aber flächig zu sehen. Das Bild wollte er unbedingt haben, natürlich nicht, um einen Kunstgegenstand, ein Andenken und dergleichen zu haben, sondern nur wegen der »Zauberei«, die ich damit treiben könnte. Ich mußte alle möglichen Finten anstellen, damit ich es behalten konnte. Anders ging es mir mit seinem Sohn, den ich malen wollte und dem der Vater befahl, mir zu sitzen. Es gelang ganz gut, oder wenigstens ähnlich, und der Junge wollte das Bild haben. Ich sagte, es sei schlecht geworden und ich würde ihn ein andermal besser machen. Aber das half nichts, meine Weigerung zog mir die Feindschaft des Jungen zu, der mir von da an nur mit finsterer Miene begegnete. Der Grund davon war, wie ich hintenrum erfuhr, daß er glaubte und sagte, ich hätte ihm seine Seele genommen.
Die Frauen hatten sich den Verweis der Männer gemerkt, und als einmal ein Mädchen meinen Farbenkasten holte, trug es ihn so ehrfürchtig herbei, als hätte es eine Monstranz oder ein Neugeborenes auf den Armen, so daß ich fast das Lachen verbeißen mußte, das freilich mehr als ungeschickt gewesen wäre. In Europa werden nicht einmal meine Bilder so respektvoll behandelt, geschweige mein Malkasten. Einmal gab es ein großes Gelächter. Ich malte eine Gruppe, die beim Trinken war, und da die Kerle gar nicht auf den Gedanken kamen, dabei auch ein bißchen stillzusitzen, sondern sich fortwährend umdrehten, hin und her gingen und die Plätze wechselten, wurde es eine flüchtige, unfertige Skizze, auf der dem einen das Gesicht und dem anderen gar der Kopf fehlte; und die so Benachteiligten ernteten das schadenfrohe Gelächter der anderen. Die Skizze verehrte ich dem Häuptling, und er nahm sie sehr befriedigt an und steckte sie ganz klein zusammengefaltet in den Brustausschnitt seiner Cushma. Vielleicht hat er sie, da ich sie nie wieder sah, Zaubersprüche und Beschwörungsformeln murmelnd, verbrannt.
Bei den Campa malte ich einmal zwei Papageien. Einer war gelb und blau, der andere rot, rot in allen Abstufungen, die es gibt, vom blassesten Rosa, grellen Zinnober, blauen Karmin und satten Weinrot bis zum leuchtendsten Purpur. Ein Campa stand mit seinem Weib etwa zehn Meter entfernt hinter mir und schaute neugierig und schüchtern her. Ich sagte: »Komm, darfst ihn schon sehen!« Nun erst wagte er sich näher. Als er das Bild lange betrachtet hatte, sagte er zu seinem Weib: »Wunderbar! Sogar die Augen sind drauf!«
So ähnlich sagen sie auch bei uns. Denn wer außer Malern und solchen Menschen, die den Umgang mit Bildern gewöhnt sind, kann ein Bild sehen. »Schau, alles ist drauf, der Zaun vom Hubermichl, da der Hund, und da ist der Heurechen!« Sie sehen nur die Gegenstände, aber kein Bild. Doch das ist immerhin ehrlich. Seltsam aber sind die Halbgebildeten. Ein Fräulein in Masisea schaute mir beim Aquarellieren zu. »Ach, wie hübsch!« rief sie aus, und dabei hatte ich noch gar nicht angefangen, sondern nur das Papier angefeuchtet.
In einem anderen Pueblo hatte ich, um meine Finanzen etwas aufzubessern, bekanntgemacht, daß ich Personen fotografiere. Eine der jungen Damen, die sich aufnehmen ließen, beanstandete, daß ihre Nase zu groß sei, was sie ja auch war. »Señorita«, sagte ich, »ich habe Ihre Nase nicht gemacht, ich habe sie nur fotografiert!«
Eine ausgezeichnete Bildbetrachtung war die einer einfachen Frau eines deutschen Wirtes in Pernambuco. Sie sagte: »Dieses Bild möchte ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, sehen, und darin spazieren gehn.«
Wunderbar ist, daß dem Indianer der nackte Körper etwas Selbstverständliches ist, daß er nicht – wie jeder katholische Bauer – auf die Idee kommt, sich bei seinem Anblick sittlich zu entrüsten, und daß ihm das Geschlecht des nackten Menschen ebensowenig auffällt, wie wir es bei einem Tier bemerken.
Den Amoishe wie den Campa waren außer Halsketten, Gesichtsbemalung und bescheidenen, unauffälligen Webmustern keine künstlerischen oder kunstgewerblichen Arbeiten bekannt.
Was mir, der ich Zeit genug zum Betrachten hatte, auffiel, waren Kunstformen in der Natur, die beweisen, daß ihr das Zweckmäßige und Technische allein nicht genügt, sondern daß sie auch immer Künstlerin ist. (Sonst könnten ja auch formlose Schneeklumpen aus der Luft fallen und nicht die wunderbarsten und verschiedenartigsten geometrisch ornamentalen Schneekristalle.)
Die Haut von zahlreichen Schlangen ist ein wie von der Hand eines genialen Künstlers ausgeführtes ornamentales und farbiges Muster.
Bei der Betrachtung einer Schlingpflanze, die einen riesigen Baum völlig erstickte (bestimmt ein herzloses Vorgehen), fiel mir auf, daß die Tausende von Blättern der schmarotzenden Liane nicht nur die vollkommen regelmäßige Herzform besaßen, sondern auch alle ohne Ausnahme in der gleichen, genau senkrechten Stellung hingen.
Die Innenseite von abgefallenen Baumrinden zeigte die erstaunlichsten Muster der Arbeit von Borkenkäfern, nur noch reicher und damaszierter als wir sie kennen.
Besonders groß war der Reichtum an vom Wasser geformten Flußsteinen, unter denen sich alle erdenklichen Arten handwerksmäßiger Formen fanden, wie Mörser, Stößel, Hammer, Messer, Beile, Gewichte und Schalen, die ganz so aussahen, als wären sie in mühseliger Geduldsarbeit von Menschenhand geformt und geschliffen worden. So oft ich über die sommerlich ausgetrockneten Geröllufer des Flusses ging, über denen eine mörderische schattenlose Hitze lag, fand ich solche Steinformen, von denen die von Strudeln (in wieviel tausend Jahren?) gehöhlten und geschliffenen Mahlsteine die auffallendsten waren. Als die Indianer sahen, daß mich solche Steine interessierten, brachte mir der eine und andere manchmal einen, meist solche, in ihrer naiven Freude an dergleichen, die einen männlichen oder weiblichen Geschlechtsteil darstellten.
Interessant war, zu verfolgen, ob die ornamentalen Arbeiten benachbarter und anderer Stämme auf in der Natur vorhandene Vorbilder zurückgingen. Mit Ausnahme der Arm- und Halsbänder der Chama-Indianer, die das Muster von Schlangenhäuten wiederholen, war das nicht der Fall. Die abstrakt geometrischen Ornamente der – in Form und Farbe unübertrefflichen – Töpfereien, die gleichen und ähnlichen von bemalten Stoffen und die Körperbemalungen der Indianer des oberen Amazonasgebietes haben weder ein Vorbild in der Natur, noch einen Zusammenhang mit der Inca-Ornamentik. Sie sind eigene Erfindung, ganz aus dem naiven Spieltrieb der zeichnenden Hand und aus den in Erd- und Pflanzenfarben gegebenen Farbtönen entstanden. Der damit ausgedrückte Geschmack und Schönheitssinn ist allerdings kein individuell willkürlicher, sondern ein gemeinschaftlicher und traditioneller, von Generation zu Generation vererbter. Hier handelt es sich um eine Stilreinheit, die wohl mehrere tausend Jahre unverändert und unverbildet geblieben ist, ebenso wie ihre Erzeuger selbst. Statt Zerrissenheit herrscht Einheitlichkeit, statt der Vielfalt Einfalt. Die einzelne Ornamentierung ist bei verschiedenen Stämmen verschieden, geradlinig, eckig, in geschwungenen Kurven, einfacher oder reicher, das dekorative Grundgesetz aber bei allen Stämmen das gleiche und nie eine Abweichung zu entdecken.
Bei einem Besuch in der Hütte eines Chama schenkte mir das junge Weib des Indianers eine Serana, eine gurkenförmige, rote Frucht, in deren Schale sie mit dem Fingernagel naive Tierfiguren einritzte, die wie ein hübsches Ornament wirkten. Befragt, was die einzelnen Zeichnungen vorstellen, nannte sie mir die verschiedenen Tiere. Die Schlange ist mit kurzen Beinen gezeichnet. Als ich sagte, daß die Schlange keine Beine habe, erwiderte sie: »Doch, sie kann ja gehen!«
Künstlerische Beschäftigungen sind mit Ausnahme der Musik ausschließlich Sache der Frauen. Sie bemalen die von ihnen ohne Drehscheibe geformten und gebrannten Tonkrüge, flechten Matten und Fächer und weben Decken, batiken Umhänge und Tanzkostüme, fertigen Schmuckstücke und Ketten aus Tierzähnen, Muscheln, Federn und Früchten und bemalen die Körper der Tänzerinnen.
Während die Körper der jungen Mädchen nur für Festlichkeiten bemalt werden, hat die Gesichtsbemalung nicht nur dekorativen Sinn, sondern auch verschiedene Bedeutungen je nach dem Anlaß und schützt außerdem auch vor Insektenstichen. Eine breite rote Untermalung der Augen hat den praktischen Zweck, das vom Fluß aufstrahlende Reflexlicht zu brechen, so daß die Augen weniger geblendet werden.
Amoishe und Campa bemalten sich mit dem aus der Achotefrucht gekochten Saft zinnoberrot, die Chama, die auch die Arme anstrichen, mit dem Saft einer anderen Frucht schwarz.
Die Primitivität der indianischen Ornamentik ist zugleich ihre Vollkommenheit, die keine Geschmacklosigkeiten und keinen Kitsch zuläßt. Die gegenständliche Kultur alter Völker ist nie mehr erreicht worden, weil sie aus naiver Unbewußtheit entsprang.
Der Indianer feiert gerne Feste und jeder, auch der geringste Umstand ist ihm ein Anlaß dazu, nicht nur Familienereignisse oder die Ernte, sondern auch eine gute Jagd, oder Beginn und Abschluß einer Reise, oder auch nichts anderes, als daß er eben Zeit dazu hat. Die Feste der Amoishe und Campa waren Trinkgelage und Tänze und dauerten stets drei, vier Tage und Nächte und auch noch länger. Die durch die nächtliche Stille der Wälder weithin dumpf dröhnende Trommel benachrichtigt jeden und ruft ihn, zu kommen, und der leichter erreichbar in der Nähe Wohnende wird durch Übersendung eines Burungo voll Massato eingeladen, den er austrinkt und damit die Einladung annimmt. Der Geladene, ob Stammesangehöriger oder Fremder, steht unter dem Schutz des Häuptlings oder Hausherrn. Von zwei, drei Litern Massato kann man einen ganz ordentlichen Rausch haben, und der macht auch den Indianer redselig und übermütig oder kühn und streitlustig. Raufereien sind daher nicht selten, doch ist der Patron bemüht, derartige Zwischenfälle auszuschalten, indem er mit wohlgesetzten zeremoniellen Reden hervorhebt, daß man zusammengekommen sei, nicht um sich gegenseitig zu stören, sondern um sich zu erfreuen. Es kam wohl vor, daß, wenn ich dabei war, ein sonst sehr friedfertiger Indianer voll des Yuccabieres Bemerkungen fallen ließ, wie, daß die Weißen hier nichts zu suchen haben und daß man sie zum Teufel jagen oder umbringen soll. Aber solche »Meckerer« wurden nicht ernst genommen und fanden keinen Anhang, und so blieb es bei gegenseitigen Hänseleien und harmlosen Belustigungen.
Gegessen wird während der Trinkerei kaum etwas, und besonders die älteren Indianer bezeugen eine erstaunliche Trinkfestigkeit. Sie trinken so lange, bis sie umsinken und einschlafen, wachen dann wieder auf und trinken weiter. Auch mir ging es auf diese Weise so, daß ich oft nicht wußte, ob ich zwei oder drei Tage dabei war.
Das Fest wird mit Vorliebe in die Tage des Vollmonds gelegt. Die Männer tanzten in der Dunkelheit auf dem ebenen Platz vor dem Haus, schwach beleuchtet von dem flackernden Schein des Feuers, einer hinter dem anderen einen schwerfällig stampfenden und wackelnden Reigen zum Rhythmus der Trommel und einer klagenden Melodie, die jeder Tänzer auf der Flöte spielte. War der Mond aufgegangen, dann tanzten die Weiber, angefeuert vom Rausch, einen flatternden Reigen unter einem bald leise summenden, bald mövenartig aufkreischenden Gesang. Zuletzt, nahe dem Morgengrauen, tanzten Männer und Weiber zugleich, aber in getrennten Kreisen.
Ist die Tanzmusik der Quechua in den Anden bei ihren uralten Tänzen, wie dem Huaynito und der Chunginada, eine reizvolle Vermischung und gegenseitige Ergänzung von Inca- und spanischen Elementen, so waren die Melodien der Waldindianer noch viel einfacher und bestanden nur aus drei, höchstens vier Tönen, deren monotone Wiederholung eher an einen tierhaft traurigen Urlaut der Natur erinnerte als an Menschenlaute. Eigentümlich war, daß diese primitiven Melodien nachzusingen keineswegs immer leicht war.
Die Instrumente waren die mit Affenhaut überzogene Trommel, die aus Schilfröhren geschnittene Panflöte und die nur zweilöcherige Knochenflöte. Gitarrenähnliche Instrumente, die sie entweder aus einem gehöhlten Stück Baumstamm oder aus dem Panzerschild des Gürteltieres verfertigten, dürften der in den Anden gebräuchlichen Incageige oder auch der spanischen Gitarre nachgebildet sein.
Einige der Lieder der Cordilleren – Melodie Inca, Text verstümmeltes Spanisch, oft gemischt mit Quechua – waren auch bis zu meinen Indianern gedrungen. Eines davon, das Lieblingslied meines bei einem Missionar aufgewachsenen scheuen Freundes (das er allerdings nur krähte, wenn er einen sitzen hatte), mag hier stehen, wenn freilich die nicht minder reizvolle Melodie in Dur, die mit dem letzten Wort in einem Mollton endet, fehlen muß.
Amorcito negro que pudiera tener,
pero no lo tengo por no padecer.
Pintitay morada no pierdes color,
asi yo contigo no perderé amor.
Ay mi palomita por quererme se fui,
ya no volvera se, ya no volvera.
Um die Worte nachdichten zu können, müßte ich ein Walter von der Vogelweide sein. Eine bloße Wortübersetzung aber würde die naive Wehmut des Textes nicht wiedergeben können.
Die wenigsten aber konnten Spanisch und ahmten, wenn sie sangen, meist die Tonfolge eines Vogelschreies oder andere Tierstimmen nach. Manchmal war es mir, als ob auch ich Pan auf seiner Flöte spielen hörte, diese ewige Musik der Natur, die nicht nur akustisch aus dem Rauschen der Bäume, dem Geklirr der Grillen und dem melodischen Murmeln der Wasser tönt, sondern auch aus der sonnigen, schweigenden Stille.
Eines Morgens nach einer Trinkerei hockte ich neben dem Indianer Sebastiano. Wir allein waren noch oder schon wieder wach. Ich schätzte Sebastiano für einen guten Siebziger. Er war ein breiter, schwerer, gutmütiger und zu jeder Gefälligkeit bereiter Mann und ebenso stark an Körperkraft wie unverwüstlich im Trinken. Es war noch sehr früh und fast ein wenig frisch, aber die Sonne vor dem Haus wurde von Minute zu Minute wärmer. Alle anderen schliefen noch, nur die Weiber auf der anderen Seite der Hütte waren schon munter. Schließlich kam Tomasa, die nicht mehr ganz junge aber noch recht hübsche Frau des Medizinmannes, zu uns herüber. Nicht zu mir, denn mich konnte sie nicht leiden, sondern zu Sebastiano. Sie blieb vor ihm stehen und schaute ihn an. Daß Tomasa manchmal einen Seitensprung riskierte, war so gut wie bekannt, und da ihr Herr Gemahl, der Zauberer, trocken, d. h. unfruchtbar war, regte sich außer vielleicht ihm selbst erst recht niemand darüber auf. Was bedeutete dieser Besuch in der Männerabteilung, der dem Alten galt?
Sebastiano, der unter ihr auf der Erde hockte, sah zu ihr auf und sang. Sang irgend etwas aus dem Stegreif, das ihm eben einfiel. Die Worte verstand ich natürlich nicht, und die Melodie bestand aus einer kleinen Tonfolge, die sich immer und immer wiederholte, innig, wehmütig und zugleich kindlich heiter. Eine Liebeserklärung war es nicht, Sebastiano war nicht mehr in dem Alter. Er selbst hatte mir einmal gesagt, daß er sich für Weibersachen nicht mehr interessiere. Sang er die Erinnerung? Sicherlich war es eine Huldigung für sie. Tomasa hörte zu und lächelte geschmeichelt und hoffärtig. Daß er ihr vorsang, war ein Kompliment an die immer noch Begehrenswerte, und sicher sang er ihr Schmeicheleien. Ihre eitle Aufmerksamkeit und daß sie mich vollständig ignorierte, wurmte mich. Ich wußte ja, daß sie mich nicht gerne sah, warum, das weiß der Kuckuck. Einmal hatte sie sogar ein kleines Spottlied auf mich angestimmt. Aber was lag mir daran, ich hatte unter den Jungen Sympathien genug.
Ich sah sie nicht mehr und vergaß sie, hörte nur noch die immer wiederkehrende Melodie. Und die trug mir ein so eigenes Gefühl zu, daß der stille, sonnige Morgen, der Platz vor dem Haus mit dem Gebüsch am Rand, die Wälder und weiten Berge dahinter und der kühle, blitzende Bach am Fuß des Hanges, daß dies alles mir so erschien, als wäre ich schon seit meiner Kindheit da zu Hause und nie in meinem Leben woanders gewesen.
Wort und Begriff Kultur sind dem Indianer so unbekannt wie die Worte Takt, Geschmack, Stilgefühl oder wie Dieselmotor. Ihm fehlt die Begriffswelt, aber er besitzt die wirkliche. Und er beachtet auch bewußt die ungeschrieben überlieferten Gesetze der Höflichkeit, Umgangssitte usw. Dazu gehört z. B., daß er ein leeres Haus nicht betritt und ein bewohntes nicht unaufgefordert, daß er die Waffen außerhalb des Hauses ablegt, dem Gast Speise und Trank anbietet, als Gast ohne Aufforderung nicht zugreift und dergleichen mehr.
Viele unserer Entgleisungen fallen schon deshalb weg, weil der Anlaß dazu fehlt. Er kann nicht mit dem Messer essen, weil er keines hat, kann keine scheußlichen Tapeten an die Wände kleistern oder fürchterliche Ornamente hinschablonieren, oder geschmacklos bauen, sich geschmacklos kleiden und Schundromane lesen. Zu alledem fehlt ihm praktisch die Möglichkeit. Auch die Eigenschaften Ehrlichkeit und Uneigennutz gehören hierher, denn wo Geld, Handel und Geschäft fehlen, können auch Geldgier und Raffsucht nicht existieren. Man kann, wenn man will, in ihrer Verteilung der Jagd- und Fischbeute, wie der gegenseitigen Aushilfe mit Früchten und Produkten eine Art Ursozialismus sehen, doch das ist er nur für uns; wir tragen damit einen intellektuellen Begriff dorthin, wo er noch nicht existiert. An seiner Stelle ist »nur« ein hergebrachter Brauch vorhanden.
Nicht nur sind auf solche Weise sie selbst von manchen unserer Verirrungen bewahrt, sie sehen auch keinen anderen, der sie begeht. Nie haben ihre Augen von dem Irrenhaus entsprungenen Architekten hingepflanzte Bauten gesehen und werden sie nie sehen. Die Augen sind der Spiegel der Seele. In ihren Augen ist das lebendige Blitzen ihrer Bäche und Flüsse, das unveränderliche Grün ihrer Riesenwälder und die heiteren und glühenden Farben ihres Himmels – in den unseren die schillernden Abwässer und rauchenden Schlote der Fabriken, der stinkende Qualm der Lokale, der Schmutz des vom Massenverkehr zerstampften Schnees, die Plakatschreie der Reklame und die verrostete Trauer der Großstadtränder.
Der Indianer weiß nichts von anderen Menschen als denen seines Stammes und seiner Nachbarn und nichts von einem anderen Teil der Erde, als dem kleinen, den er bewohnt. Er hat kein Bewußtsein für Zeit und zählt sie nicht. Nur die Tageszeit liest er am Stand der Sonne. Eine Wochen- oder Monatseinteilung gibt es nicht, noch Werktage und Feiertage. Auch der Europäer, der lange unter ihnen lebt und keine Verbindung mit der zivilisierten Welt hat, verliert nach und nach seine gewohnte Zeiteinteilung und vermißt keinen Kalender, wenn er sich dem gleichgeschwungenen Rhythmus von Tag und Nacht einfügt und die Tage keinen Namen mehr haben.
Der Indio kennt die Zahlen der Finger beider Hände, zuweilen nur die von einer Hand. Meine Indianerin konnte meine Hühner nicht zählen, kannte aber jedes einzelne an seinem Aussehen und wußte es sofort, wenn eines fehlte. Was über zehn ist, nennen sie »viel«, was noch mehr ist, »sehr viel«. Um einen bestimmten Zeitraum für etwas feststellen zu können, das ihnen wichtig erscheint, werden manchmal die Jahresringe oder andere Wachstumsmerkmale von Bäumen und Pflanzen benutzt; arbeitet einer bei einem Pflanzer, dann notiert er die Arbeitstage, die nicht über eine Woche hinausgehen, durch Kerben eines Holzes und braucht so, kaum mit dem äußersten Ende der Zivilisation in Berührung gekommen, bereits eine Buchführung. Auch ihr Alter wissen sie nicht. Ein älterer Indianer, nach seinem Alter befragt, antwortet gerne – wenn er so viel Spanisch kann, daß er diese Zahl kennt – hundert Jahre. Solche Hundertjährige sind, soweit man sie schätzen kann, meist ungefähr Achtzigjährige. (Weißes Haar ist übrigens auch bei den ältesten selten, Kahlköpfigkeit unbekannt.)
Auch das Bewußtsein für gestern und morgen und Vergangenheit und Zukunft fehlt dem Indianer. Er kennt nur das Heute, lebt stets nur dem gegenwärtigen Augenblick hingegeben, entbehrend oder genießend, wie es der Augenblick bringt.
Von uns aus gesehen lebt er nicht in unserer Zeit, dem zwanzigsten Jahrhundert, sondern etwa 2000 vor der Zeitwende. Der einzige Unterschied zwischen dem Damals und dem Heute ist für ihn, daß er statt des Steinbeils oder einer Goldaxt eine eiserne besitzt oder kennt, und daß er, nahe an einem Fluß lebend, schon ein Dampfboot gesehen hat, oder in der Lichtung über dem Fluß ein Flugzeug am Himmel. Er befindet sich in einem Kindheitsstadium der menschlichen Entwicklung und ist auch als Erwachsener noch Kind, unwissend, naiv, heiter, gelassen und stark im Instinkt und in allen Sinnen; weniger in der Sinnlichkeit. Ich will nicht sagen, daß er ein besserer Mensch ist als wir, denn um das zu beweisen, müßte er zuerst unser Leben leben, sondern er befindet sich noch »vor dem Sündenfall«.
Dabei fehlt ihm nicht das Bewußtsein seiner Persönlichkeit und Stammeszugehörigkeit. Etwa befragt, was er ist, würde er nicht einen Beruf angeben und sich mit einer Tätigkeit identifizieren, sondern seinen Stamm nennen.
Der Zivilisierte kämpft den Kampf um seine Existenz, der Indianer lebt. Manchmal lebt er sehr bescheiden oder auch kümmerlich; dann begnügt er sich mit weniger und verliert darum nicht seine Ruhe. Der Unterschied zwischen wenig und viel ist in seinem Dasein nicht sehr groß, da ihm ja das meiste, man kann sagen fast alles, das wir besitzen müssen, nicht nur fehlt, sondern auch unbekannt ist, so daß er es auch nicht begehren kann. Um sich seine Zufriedenheit vorstellen zu können, ist notwendig, sich zu vergegenwärtigen, was alles er nicht weiß, nicht kennt und nicht hat. Dagegen besitzt er allerdings etwas, das wir nur vom Hörensagen kennen: seinen Frieden; und der einzige, der ihn gefährdet, ist der Weiße.
Da der Indianer nicht lesen und schreiben kann, ist er ein um so besserer Erzähler; denn alles geschriebene Erzählen stammt vom mündlichen her und ist um so besser, je näher es diesem kommt. Wenn zwei Indianer nach langer Trennung, sei es nach einem Jahr oder nach mehreren Jahren, sich begegnen, dann breitet der Gastgeber eine Bastmatte oder große Blätter auf den Boden, denn der Indianer setzt sich nie auf die nackte Erde. Hierauf hocken sie sich einander gegenüber und beginnen zu erzählen, was sich alles ereignet hat, seit sie sich zum letztenmal gesehen haben. Tag um Tag des gelebten Lebens wird erzählt, homerisch breit, farbig und plastisch, und mit scharfem Gedächtnis nicht das Geringste vergessen. Jedes Tier, das der Freund erlegt hat, und alle Umstände und Besonderheiten der Jagd schildert er, alle Vorkommnisse in der Familie und unter Verwandten und Nachbarn; Krankheit und Heilung, Todesfälle, Knappheit und Schmausereien, Fest und Tanz, Naturereignisse und Witterung, Geistererscheinungen und Zaubereien, Feindschaft und Freundschaft, Streit und Versöhnung werden dargestellt, lyrisch oder dramatisch, und ausgemalt, und Wirklichkeit und Fantasie vermischt und aneinander gesteigert. Der Zuhörende unterbricht den Erzähler niemals mit einem Wort oder Zuruf oder einer Frage. Er hört zu und wartet, bis der erste mit seiner Erzählung zu Ende ist. Erst dann beginnt der zweite, der genau so verfährt und nun sein Leben und Erleben schildert und nichts vergißt noch verschweigt. So sitzen sie sich oft einen ganzen Tag und die Nacht dazu gegenüber und erheben sich nicht eher, als bis ihre Berichte zu Ende sind.
Ein junger Amoishe erzählte mir die folgende Sage:
»Das Salz ist früher ein Mensch gewesen, und da ihn niemand gekannt hat, wurde er überall verachtet. Da ist es in die Berge hinaufgegangen, oben, wo jetzt das Salz ist, und da hat es einer aufgenommen. Das Salz sagte: Laß mich deinen Teil essen! Und da gab er ihm zu essen und zu trinken. Und da hat es dem Salz geschmeckt und zum Dank dafür ist es oben geblieben. Und darum ist das Salz oben in den Bergen und nicht hier unten.«
Wenn die Indianer Salz holen und aus dem Felsen schlagen, sagen sie zu dem Felsen eine Bitte, daß sie das Salz nehmen dürfen, und als Dank lassen sie eine Prise Koka und ein Stück Chamayro, oder, wenn sie Wild geschossen haben, das beste Stück davon auf dem Felsen liegen.
Mit dem Sterbenden und dem Toten will der Indianer nichts zu tun haben. Der Sterbende wird in seinen letzten Stunden sich selbst überlassen, der Tote begraben und hierauf der Wohnplatz gewechselt. Tot ist tot und vergangen ist vergangen. Bei einigen Stämmen herrscht die Sitte, daß, wenn die Frau eines Mannes stirbt, ein Freund ihm sein Weib leiht, um ihn über den Verlust hinwegzutrösten. Seinem eigenen Tode aber steht der Indio furchtlos und gelassen gegenüber. Alte Leute, die im Sterben lagen und allein gelassen waren, habe ich mehr als einmal angetroffen. Einmal kam ich an eine Hütte, in der ein alter Indianer im Schatten des Daches auf einem flachen Stamm lag, lang ausgestreckt und reglos. Niemand war bei ihm, ringsum Stille und Schweigen der brütenden Hitze. Ich fragte ihn, was ihm fehle. Ohne mich anzusehen, sagte er: »Danke, Señor, mir fehlt nichts, ich gehe sterben.«
Die meisten von uns würden das Leben der Indianer und unter ihnen von vornherein oder schon nach kurzer Zeit inhaltslos und langweilig finden und als primitiv abtun. Wenn man unter primitiv das versteht, was es wirklich heißt, nämlich nicht schlecht oder mangelhaft, sondern erstlich, einfach und anfänglich, dann mag es ruhig bei dieser Bezeichnung bleiben, die ja auch in diesem Sinn auf die Kunst der Naturvölker angewendet wird. Das Einfachste ist immer das Größte und das Komplizierte nur schwierig. Und der Besitzer eines Luxusautomobils kann ein ganz kulturloser Mensch sein.
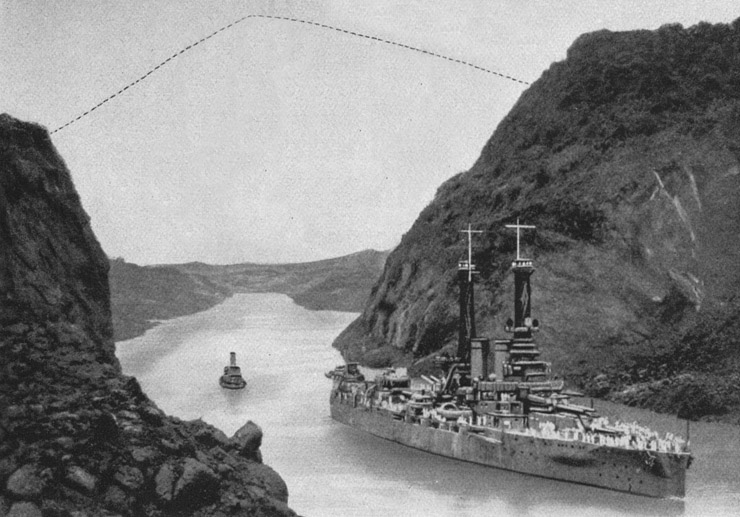
Panamakanal. Die durchstochene Corte de Culebra (Schlangenberg).
Die punktierte Linie bezeichnet die Form des Berges vor dem Durchbruch

Der illuminierte Regierungspalast in Manáos