
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wenn ein solcher angesagt ist, so finden sich die Musikanten am bestimmten Sonntage um 1 Uhr nachmittags in der Dorfschenke ein. Die Burschen in schönen, weißen Strümpfen, schwarzledernen Kniehosen, rot- oder grünseidenen Westen und karminroten Halstüchern, ziehen haufenweis über Wiesen und Felder von fern und nahe herbei und sammeln sich in der Wirtsstube. Geschämiger und ängstlicher gelangen die Mädchen auf Umwegen und hinter den Häusern heran. Vor der Stubentüre im Vorhaus bleiben sie stehen, und keine will den Anfang machen, einzutreten. Während sie nun kichernd sich hier zusammendrängen, lassen die Burschen Musik von innen ertönen, weil sie die Gegenwart der Tänzerinnen merken. Die Aufregung der Musik belebt die Mädchen mit Mut. Es wagt die Kühnste ihre Hand auf die Klinke zu legen – patsch, schlägt eine zweite ihr die Hand nieder, und der Andrang schleudert nun die Türe weit auf, dass die vordersten bis in die Mitte des Zimmers vorgestoßen werden, die sich verlegen wieder zurückzudrängen suchen. Allein schon hat dem verlegenen Gekicher und Gewirr der tanzlustige Bursche abgeholfen, indem jeder einer Gewissen winkt oder pfeift oder sie bei Namen ruft. Die Gemeinte springt frisch zum Tänzer hin, und sogleich geht es voll Leben in der holprigen Stube herum. – Der beliebteste Tanz ist der Ländler. Er wird auf steirische Weise getanzt von denen, die im Rondeau sich bewegen, allein innerhalb des Kreises stellen sich zugleich so viele Paare auf als neben einander Platz finden, um sich herumdrehen zu können. Dieses Herumdrehen geschieht taktmäßig so, dass ein Takt zu einer ganzen Wendung hinreicht, und der Schluss jedes Taktes wird durch einen Stampf und gleichzeitiges Senken des Paares markiert. Mit diesem eigentümlichen Tanze ist ein häufiges Aufschwingen der Tänzerinnen verbunden, und man nennt das: »äf oan Eartl« tanzen. – Originell ist der musikalische Vortrag des Ländlers. Der erste Teil wird zweimal gespielt, wobei Klarinette das Hauptinstrument ist; eine Flöte sekundiert harmonisch, und zwei Violinen, ein Zimbal und Bass akkompagnieren piano dazu. Ist der erste Teil zweimal gespielt, so wird er gleichsam umgekehrt und wieder zweimal vorgetragen. Hierauf wird die Geige das Hauptinstrument und verändert denselben ersten Teil des Ländlers in ein willkürliches Gefiedel, aber in veränderter Tonart (z.B. aus C-Dur in G-Dur übergehend). Mit dem Vorgeiger klimpert nun auch das Zimbal die gleiche Partie, die Sekundgeige und der Bass arbeiten lebhaft mit, wozu sich das Schmettern einer Trompete gesellt. Klarinette und Flöte rasten. Während der zweite Teil des Ländlers abermals vierfach abgefiedelt wird, gehen die Tänzerpaare, im Rondeau wenig angeregt, nur langsam herum oder stehen, ein Gespräch unterhaltend, zur Seite. Die Tänzer »af oan Eartl« (oder auch »af oan Platzl«) treten nur von einem Fuß taktmäßig auf den andern, ziehen abwechselnd eine Hand der Tänzerin nach der andern ebenso taktmäßig an sich und stoßen sie wieder ab, so dass die Tänzerin in einer Halbdrehung erhalten wird. Wie man aber die Schlusskadenz des zweiten Teiles merkt, und das Klarinett-Flötensolo mit leisem, harmonischem Akkompagnement der übrigen Instrumente beginnt, da scheint eine entzückende Raserei in Tänzer und Tänzerinnen zu fahren; es entsteht ein Jauchzen und Springen, viele brechen vor Entzücken in ein durchdringendes, grelles Pfeifen aus, andere singen den Ländler mit. Je wilder sich da der Bursche äußern kann, desto willkommener ist es ihm. Bei stark gefüllter Stube ist dann der Tanz eine wahre Schlacht. Einer sucht den andern aus Reih' und Glied zu schleudern. Mancher bleibt im Rondeau voll seligen Übermuts stehen und beginnt »af oan Eartl« zu drehen. Die Nachtänzer schwellen hinter ihm an und sind gezwungen, um das schöne Solo nicht unbenutzt zu lassen, ebenfalls »af oan Platzl« anzufangen, so dass auf einmal im ganzen Zimmer ein Heben und Senken sichtbar wird. Die Tänzerinnen schweben häufig über den Köpfen, und die Szene gleicht einem Wasser-Wirbel, auf den ein heftiger Platzregen fällt, wo die stark aufschlagenden Wassertropfen über der drehenden Masse hüpfende Figürchen bilden. – Vier Ländler machen eine Tour, während welcher kein Bursch seine Tänzerin wechselt oder aufhört. Beim letzten Klang der Musik fasst jeder Bursch seine Tänzerin, führt sie in die Kammer, wo die Tische von den eigentlichen Trinkgästen besetzt sind, reicht ihr sein Glas zum Trinken und lässt sie dann laufen, wenn sie ihm gleichgültig ist, oder setzt sie zu sich an einen Tisch, wenn sie so glücklich ist, seine Dulcinea zu sein. In der Tanzstube aber gruppieren sich mehrere Burschen um die Musikanten, indem sie sich gegenseitig die Arme um den Hals schlingen, und singen verschiedene Volksmelodien, denen sie stets neue Texte unterlegen. Nach abgesungenem Text spielt ihnen die Musik die Melodie nach, welche gesungen wurde, und die Burschen springen und jauchzen dazu oder schnalzen mit der Zunge nach dem Takt. Die Mädchen aber hangen sich zwei und zwei zusammen mitten in der Stube, tanzend nach der gesungenen und gespielten Melodie. Verliebte Paare sitzen die meisten schäkernd an den Wandbänken herum. Beispiel solcher Liedertexte:
Deanal gei hea zon Zau,
Lauma dö rächt oschau,
Wos du füa Augerln host:
Schwoarz oda brau?
Als Antwort darauf folgt diesem immer folgender Text:
Augerl mai is nöd schwoarz,
Augerl mai is nöd brau,
Augerl mai is o krod,
Di onzuschau! –
Gegen die Tanzlust der übrigen Anwesenden darf der Gesang nicht sündigen, und man endet ihn, nachdem alle Sänger die Musik gezahlt haben, mit folgendem Texte:
Spielläd spielts ummat um,
Doß i za man Deandla kum,
Sitzt af da r Ofabonk,
D' Zät is ia long!
Bei einbrechendem Abend wird es etwas leer in der Tanzstube; die Knechte gehen füttern, die Mägde melken. Bauernsöhne und Töchter sind von der Arbeit dispensiert und bleiben, wenn sie auf das Nachtessen verzichten wollen, beim Tanz. Aber sie wissen recht wohl ihrem Hunger abzuhelfen durch heimlich mittelst jüngerer Geschwister herbeigeschafften Proviant von Mehlgebäck. Hartnäckig behaupten auch die alten Weiber ihren Platz auf der Ofenbank. Ihr Amt ist scharfe Kritik. Nachts übergeben die Hausfrauen ihre Kinder und das Haus der Wache und Aufsicht einer alten Magd oder Inwohnerin und erscheinen dann, ihren Männern folgend, gleichfalls im Wirtshause, wo jede am Tisch ihres Mannes Platz nimmt und sich mit Eifer und Kühnheit in das Gespräch mischt, auch dem Glase gehörig zuzusprechen nicht unterlässt. Geht ein reicherer Bursch oder Mann nach Hause, so nimmt er das halbe Orchester mit und lässt sich auf dem ganzen Weg vorspielen.
Streit zwischen den Burschen und Männern ist regelmäßig bei einem Tanze, Schlägereien, die mit bedenklichen Folgen enden, sind nicht selten. Als Repräsentanten solcher Auftritte stelle ich folgenden her, dessen Augenzeuge ich war. An einem Ecktische in der Tanzstube saß ein Schmied, groß und knochig, dessen ein Auge stark schielte. Ihm gegenüber hatte ein breitschulteriger, stämmiger Wirt Platz genommen. Beiden drückte sich im Gesichte die Wirkung bereits übermäßig genossenen Getränkes ab. Ein kleiner Wortwechsel hatte sie schon früher gespannt gemacht, weshalb sie sich nicht ansahen und weder zu einander noch zu den Umsitzenden ein Wort redeten, sondern dumpf vor sich auf den Tisch hinstarrten und sich aufrichteten, wenn sie tranken. Ihr Bewusstsein erlosch mehr, ihr Groll aber nährte sich tief-geheim und wuchs. Ein hagerer Freund des Wirtes, der gerne die beiden tätlich an einander gebracht hätte, winkte einem zweiten seines Gelichters mit den Augen, und beide gingen schweigend hinaus. Als sie zurückkamen, nahmen sie schweigend ihre Plätze wieder ein. Der Hagere fing nach Kurzem an, hetzende Worte fallen zu lassen. Das merkte des Schmiedes Weib, das neben seinem Manne saß und bereits über den früher geschlichteten Streit froh war. Sie sprang also jetzt zornig auf, und sprach zu dem hageren Anstifter: »Wos host du im Sinn, Halunk! Is da nöd rächt, dass da Lärm an End hod? Lump! Mochst du mia dö zwai Mona do wild, so heng' a dö af, du Nochtgöid, du ninxnutzös, du!« (Was hast du im Sinn, Halunk! Ist's dir nicht recht, dass der Lärm ein Ende hat? Lump! Machst du mir die zwei Männer da wild, so häng' ich dich auf, du Gespenst, du nichtsnutziges, du!) – Dabei schlug sie mit der flachen Hand auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. – Der Wirt hatte drei Söhne beim Tanz, die ihn von ferne sorgfältig bewachten. Der älteste, ein lieber Bursch, kam jetzt hinzu, lehnte sich seinem Vater über die Schulter, sprach mild und besänftigend, aber allen hörbar, und trug sich an, mit ihm nach Hause zu gehen. Der Wirt ward davon so ergriffen, dass ihm zwei große Tränen über die Wangen liefen. Er erhob sich aus seinem Hinbrüten, stand auf und sagte mit verweisendem Blick auf den hageren Aufwiegler: »Na, na, na! Fronz, haind nimma!« – Dann reichte er die Hand über den Tisch dem Schmied und sagte: »Schmied – gi ma d'Händ – 's is ninx – sa ma guat!« Der Schmied stand also auch auf, indem mehre Stimmen riefen: »So is rar – kemts zom!« – Wie sich die Versöhnenden aber die Hände halten, tut der Wirt die arglose Frage: »Schmied, weiviel Finga höst du?« Der Schmied, welcher sich in der Jugend den Mittelfinger verstümmelt hatte, meinte das als Spott. »Himmelsakrment!« donnerte er, riss seine Hand zurück, ergriff ein Glas, und schleuderte es dem Wirte nach dem Kopf, der sich aber bückte, dass es an der Wand in tausend und tausend Scherben zersplitterte. Man tanzte eben. Die Burschen ließen ihre Tänzerinnen los, im Augenblicke waren alle Stühle zerschmettert und die Stuhlfüße zu Waffen geworden. Wie durch langes Verständnis bildeten sich schnell zwei Parteien. Der Schmied und seine Anhänger wurden in die Flucht getrieben.
Dazu wird immer eine Nacht bestimmt. Gegen Abend begibt sich der Bursch, welcher daran ist, Bräutigam zu werden, mit drei oder mehren verwandten Männern zuerst in – das Nachbarhaus der künftigen Braut und schickt einen der letzteren an den Vater der zu verlobenden Tochter, dass er anfrage, ob man kommen dürfe? ob es nun eben recht wäre, wenn man käme? wie man dächte? Der wohl vorbereitete Vater ladet natürlich sogleich freundlichst ein, man möchte nur kommen; sei ihm ja immer lieb, den Burschen und die Männer zu sehen; und wenn man in Freundschaft und guter Absicht komme, ehre man ja immer sein Haus. Auf diesen Bescheid hin kommen die Angemeldeten. Die Begleiter des Burschen heißen Beistände. Solche Beistände aber treffen nun auch von Seite des Brautvaters ein. Nach wechselseitiger Begrüßung setzen sich beide Parteien um zwei getrennt stehende Tische. Weder die Mutter noch die Tochter lassen sich blicken; aber um die Fenster von außen drängen sich neugierige Zuschauer in Menge, und in die Fensterrahmen drücken sich so viele Köpfe, als nur Platz finden. Nachdem die beiden Verlobungsparteien sich abgesondert im Geheimen verabredet haben, beginnt der Vater der Braut von seinem Tische hinüber zu reden nach dem Tische der Bräutigams-Partei, nun, und wie es denn stünde mit des Burschen Habe und Mitgift. Einer der Beistände zergliedert die Habe und Mitgift des Bräutigams. Überlegen der Brautpartei; dann Debatten, bis man einig ist. Hierauf erhebt ein Bräutigamsbeistand die Frage an den Brautvater, nun, wie es denn stünde mit der Habe und Mitgift seiner Tochter. Ein Beistand zergliedert die Habe und Mitgift der Braut. Überlegen der Bräutigams-Partei; dann Debatten, bis man einig ist. Jetzt werden beide Tische zusammengerückt, und die Hausfrau, welche bis jetzt in der Küche sich umgetan hat, erscheint, geschäftig grüßend und den Tisch deckend. Die Musikanten treten herein und spielen auf; (starkes Boxen der Köpfe in den Fensterrahmen, die alten Weiber müssen sich zurückziehen). Ein Fass Bier, welches der Bräutigam bereits einen Tag früher in das Haus der Braut bringen ließ, wird nun gezapft, und die Verlobungs-Parteien sprechen voll hoher Fröhlichkeit zu. Sobald die Speisen aufgetragen werden sollen, wird nach der Braut gefragt, die nun vorgeführt werden muss. Musik ertönt, und aus der Kammer wird ein Mütterlein geführt und dem Bräutigam vorgestellt mit der Frage, ob die wohl die rechte sei, oder ob er auf eine andere warte. Der Bräutigam meint, dass die Vorgestellte zwar kein übles »Trutscherl« sei, und dass er sie wohl heiraten würde, wenn er nicht schon eine andere im Herzen hätte. Das Mütterlein stellt sich beleidigt und fordert Genugtuung. Ein Versprechen des Bräutigams beruhigt es. Nun ertönt wieder Musik und die wirkliche Braut wird aus der Kammer geführt; sie ist in schönem Sonntagsputz. Wie man sie dem Bräutigam vorstellt mit der Frage, ob die es sei, steht jener auf und gibt ihr die Hand mit der Antwort: »Dö is!« (die ist's), indem er ihr zwei bis vier Krontaler (Brauttaler, Brotola) zugleich in die Hand drückt. Solange diese von der Braut nicht zurückgegeben werden, bleibt der Verlobungsvertrag gültig. Den Beiständen werden schöne Schnupftücher als Präsente auf die Teller gelegt, und nachdem Bräutigam und Braut am Tische neben einander Platz genommen haben, beginnt unter Musik ein reichlicher Schmaus. Während dieses versammeln sich tanzlustige Burschen und Mädchen draußen, die nach aufgehobener Tafel hereingelassen werden und oft den meisten Teil der Nacht durchtanzen. Begibt sich der Bräutigam nach Hause, so wird er eingefangen von seinen Kameraden, und nur ein Lösegeld macht ihn wieder frei. – Am folgenden Morgen werden die Verlobungspunkte zu Papier gebracht. Wenn hierauf das Brautpaar eine Religionsprüfung beim betreffenden Pfarrer bestanden hat, so dürfen die Brautleute mit ihren Heiratsbedingungen beim Oberamte eingetragen und mit dem Erlaubnisscheine versehen werden, dass sie als Willens, in den Ehestand zu treten, vom Geistlichen dreimal an hintereinander folgenden Sonntagen öffentlich aufgeboten werden. Acht Tage nach dem letzten Aufgebot folgt gewöhnlich schon die Hochzeit. Während dieser letzten acht Tage ladet der »Hochzeitlader« die Gäste zusammen, indem er nebst einer mündlichen, in Verse gesetzten Rede, noch auf jede Stubentüre eines Gastes einen kleinen Kranz zeichnet, woraus sich ein Rosmarinstrauß erhebt. In den Kranz schreibt er den Preis, welchen jeder Gast am Hochzeitstische zu entrichten hat. Gewöhnlich beträgt die Summe 1 fl. 12–30 kr. C. M.
Um folgenden Tags eine Hochzeit zu sehen, blieb ich in einem Dorfe über Nacht. Das Haus, wo ich zu bleiben beschloss, war klein und aus Bäumen gezimmert mit flachem Dache, wie dort fast durchaus die Bauart ist und zur Befestigung der Schindeln mit vielen gewichtigen Steinen beschwert. Man räumte mir auf dem Boden ober dem Wohnzimmer ein Bett, und der Laternenschein aus der Hand des Wegweisers ließ mich merken, dass die Hälfte des reinlichen Bodens mit Heu gefüllt war, übrigens aber einer netten Kammer glich, zum Schlafe einladend und äußerst erquickend durch die allseitig herein streichende Luft der Frühlingsnacht. Die blühenden Kirschbäume um das freundliche Haus und duftige Kräuter taten dem Geruchsinne wohl, als ich die Bettdecke bis an die Brust über mich schlug, und während das Ohr angenehm erregt ward, dem Lispeln und Plätschern eines vorübereilenden Mühlbaches zu horchen, goss der Mond unzählige Strahlen durch die feinen Fugen des Daches, und mein Auge hatte einen zauberhaften Himmel voll Kometen und Sternlein ober sich, auf den schwarzen Grund des Daches gemalt. – »Wann wird die gesprächige Welle, deren Klang ich jetzt höre, das Rad der nahen Mühle erreichen, und jählings, die Rinne hinabstürzend, dessen Umschwung befördern? – Noch betet man laut in einem fernen Bauernhofe – verschlagene, unverständliche Worte kommen aus der Weite – geisterhaft klappen die hölzernen Haustüren zu – die Riegel werden vorgeschoben, und wie ein Schwarm Hühner schläfrig plaudernd im Winkel der Steige sich setzt und anschmiegt zum Schlafe, so tun die Bewohner des Dorfes. Alles ist heim und sucht den Schlaf.« – So denkend, schlief ich ein. Allein mein Erwachen folgte bald. Ich hörte in der Ferne eine Schar Burschen jauchzen, lärmen und singen. Sie kamen bald näher, bald entfernten sie sich, und endlich zerschlug sich die Versammlung; denn nach allen Seiten und Fernen jauchzte man einzeln und zusammen. Die Stille, die jetzt eintrat, unterbrach eine andere Szene. Im Nachbarhof erscholl erst ein leises, dann stärkeres Klopfen am Fenster. Eine Männerstimme rief: »Lena! Lenarl! Moch äf! I bin's – Jakob, da Mo (Mann).« – Nach einer Pause klopfte es wieder, und wieder sagte die Männerstimme: »So kennst mö denn nöd? Lena! Lenarlö! Äfmocha sollst, mia, dan Mo!« Drauf hörte ich ein Fenster öffnen, und eine Weiberstimme rief: »Aha! Eiz kamst? Kost dö furtmocha, eiz broch 'i dö nöd! Gsuffa heist – und eiz kamst? Eiz kamst, wo's To (Tag) wiad, und d' Hona (Hähne) kra'nt!« – »Sakra!« sagte der Mann mit Nachdruck, als ihm das Fenster vor der Nase zugeschlossen ward. »Lenarl! sog (sage) i nomol (nochmals)«, fuhr er fort mit etwas erzwungener Mäßigung – »moch ma r af! Sa guatwillö – i bi nöd lüadala gwöst.« – »Wast nöd lüadala gwöst, wast zälicha käma«, antwortete aus der Kammer das Weib, und die unsichere Stimme, die von einer Anstrengung zeigte, ließ mich meinen, dass Lenerl, das Weib, gleichgültig das Bett wieder besteige und den Mann vor dem Fenster seinem Schicksale überlasse. Jetzt fing ein Bursch an, in der Nähe zu jauchzen und dann eine Melodie zu pfeifen. Der Mann rief ihm zu: »Fronz, bist du's?« – »Jo, Voda (Vater)«, antwortete der Bursch. »Wei kimst denn du dohea?« sagte der erste wieder. – »Wei kemt's denn ös dohea?« erwiderte der Sohn. »Strächst ma wieda r um?« – »No (nun) Voda, sat's denn ös im Bött?« – »Stad (still) eiz (jetzt), und scho (schaue), doss ma r ins Hos kemma!« – »Stagts am Gog (ein hölzerner Balkon), und zuigts (zieht) a Spogotschnüa'l nieda, dös vom Dua'l owahängt. Guatö Nocht! Hod eng d' Muada kreigt? Gschid eng rächt – d' Mona keant hoam!« – »Wo willst denn du no hi?« – »Stad – i woas scho wohi. Guatö Nocht.« – Der Bursch pfiff nun die unterbrochene Melodie weiter, doch mit abnehmender Stärke, und schwieg endlich ganz. – Eben überkam mich wieder ein leichter Schlummer, als ein Krachen und Knistern mich plötzlich wieder munter machte. Schweres Atmen verriet einen Menschen in der Nähe, nur war nicht gleich zu entscheiden, ob der Nachtwandler über das Dach schreite, denn Schindeln am Rande des Daches wurden rauschend verschoben – oder ob jemand am Holzstoß um die Fenster nach dem Balkon steige. Ich saß auf und horchte. In der Kammer unter mir schnarchte man behaglich, Kinder dehnten sich und raunzten, sich umwendend, oder träumten, halbe Worte schwerzüngig plaudernd. »Was ist das?« dachte ich, und war nicht ganz ohne Sorgen, denn jetzt hatte sich offenbar jemand gerade in der Nähe meines Bettes außen auf dem Balkon festgemacht. Ich erwartete den nächsten Schritt, den der Nachtwandler vorhatte, um danach mein Benehmen zu regeln. In der Nähe meines Kopfes griff eine Hand nach dem Strohbündel, der ein rundes Wandloch verstopfte, und er fiel rauschend auf den Boden herein. Ich erwartete, eine Hand werde hereindringen (und mein Kopf wäre zu erreichen gewesen), allein es begann eine zärtlich wispelnde Stimme: »Liab's Margarl! Märgarlö! Heast? Sogst a ninx? – Polomargarl (zusammengesetzt aus Polo – der Name des Bauernhofes – und Margarl)! Bist denn trutzö häd? Margarlö! Schom dö, dast ninxö sogst! Heast a nöd? Owä (aber) woart (wart)! Woart no!« – Als ich so zärtlich tun hörte, verstand ich wohl gleich, dass ein Bursch zu mir »Fensterln« komme, in der Meinung, Margerl liege statt meiner im Bett. Auch erklärte ich mir nun die Verlegenheit dieses Mädchens am Abend, als man nach einigem Beraten in der Familie mir endlich nicht ohne Scherz ihr Bett angewiesen hatte. Sie mochte den nächtlichen Besuch und die Folgen vorausgesehen haben. Und ich brauchte nicht länger zu zweifeln, denn aus der Kammer war ein Hüsteln und Keuchen hörbar, was ein mit dem Polster unterdrücktes Lachen war, zu heftig, um ganz verhalten zu werden. Die Maid ist also wach geblieben aus Besorgnis und hörte nun wirklich die zärtliche Ansprache des liebenden Burschen, die er an einen Mann und Fremden richtete. Der Bursch aber fuhr fort, aus zartem in wehmütigen Ton überzugehen, weil er bei meinem sehr leisen Atemholen auf Wachsein schloss und meinte, die Liebste wolle sich nicht melden. Um ihn zu trösten, schnarchte ich ein wenig – worauf er begann, von Neuem das Liebchen zu wecken. – Mir war schon Anfangs der Gedanke gekommen, ihm zu antworten, und ich begann nun nach leichtem erzwungenem Gähnen und Raunzen mein Erwachen anzuzeigen, und in der Rolle der Geliebten, kundig des Dialektes, und weil das Wispern der Stimme mich nicht verraten konnte, Antwort zu geben und ein Gespräch zu führen. Das verstohlene Gekicher aus der Kammer wurde nun fast laut, weil ich das Liebchen vorstellte. Der Inhalt unseres Gespräches war anfangs sein milder Vorwurf, dass ich so lange keine Antwort gegeben, und meine Entschuldigung, weil ich zu tief geschlafen und ihn nur nicht gehört hätte; drauf eine Versöhnung, und hierauf folgte ein gegenseitiges Befragen über das Erscheinen bei der Hochzeit am folgenden Tage. Die Familie unsers Liebhabers war geladen, und er war die teilhabende Person. In »Margarls« Namen aber wusst' ich nicht zu antworten mit Bestimmtheit, log also einige Bedenklichkeiten, von Seite des Vaters und der Mutter herleitend. Darauf schied er, die Hand zum Wandloch hinreichend: »Gi ma d'Hend, Margarl! Guatö Nocht!« – Es lag herzliche Kraft in seinem Händedruck. Die Schindeln am Dache rauschten, Bretter und Balken krachten wieder, der Bursch pfiff unten und ging. Seinem Jauchzen aber antwortete kein Bursch in der Nähe und Ferne mehr – er schwieg nun auch, während ich, eine liebe Aussicht durch das offene Wandloch gewinnend, im Mondenschein die klappernde Mühle stehen sah, ganz von Fliederstrauch umgeben und silberähnlichem Rasengrund, auf welchen nordwärts das Schattenbild von Mühle und Gebüsch fiel. – Mit diesem nächtlichen Abenteuer wurde mir der Begriff des »Fensterlns« recht deutlich, und, wie ich erfuhr, bezeichnen diese Grenzler es mit dem Ausdrucke »'s Schrä« – von Schreien, Anrufen zu einem nächtlichen Plausch zwischen Bursch und Liebchen.
Am folgenden Morgen weckte mich Löffelgeklirr, das aus der Wohnstube scholl. Man reinigt da unmittelbar vor Tisch das Esszeug, und wirft es klingend auf die Tischecke, die nach der Mitte des Zimmers zeigt. Dieser Schall dient statt einer Glocke, um diejenigen zu rufen, welche im Hause gegenwärtig sind, für Entferntere muss jemand vor die Haustüre treten. In meinem Falle war es ein blonder Knabe, der auch mit unterspreizten Armen schrie, dass er bis unter die Blondlocken rot wurde, während die Mutter zum Kammerfenster hinaus dasselbe Amt verrichtete: »Geit's zon Öss'n! Kemts zon Öss'n zom!« – Als ich in die Stube trat, saß die Familie bereits um den Tisch, Milchsuppe (den fast unumgänglichen Bestandteil des Frühstücks und Nachtmahls) aus einer Schüssel essend. Man verrichtet dieses Geschäft langsam und gemessen. Mit jedem Löffel Suppe fischt sich jeder einen Brocken Brot heraus, und während das Kauen geschieht, wird der Löffel vor sich auf den Tisch gepflanzt. Und das ist der Moment, wo man fragt und antwortet, und dem Tischgespräch huldigt. Vor und nach Tisch wird der englische Gruß, bisweilen noch ein anderes Gebet gebetet, und zwar vor Tische still, nach Tische gewöhnlich laut. Der Hausvater ist immer der Vorbeter. – Ich suchte »'s Margerl«, denn ich dachte über den nächtlichen Besuch zu scherzen; allein sie fehlte beim Essen, auch fragte Vater und Mutter nach ihr: »Mö (warum) kimt denn 's Margerl nöd zon Össn? Wo is denn dö wieda? Hans'l gei sauch's (suche sie)!« – Der zurückkehrende kleine Bote sagte: »Sie steit hintan Bianbam und sogt, dass sa sö schomt!« (Sie steht unterm Birnbaum, und sagt, dass sie sich schäme!) Ich teilte die Ursache mit, und man lachte laut und lange. – Der Hausvater war bereits im Sonntagskleid, denn er war Hochzeitsgast. An die Türe war mit Kreide der erwähnte Kreis gezeichnet mit dem Strauß, und darin stand: »1 fl. 30 kr. C.M.« geschrieben. Gegen neun Uhr früh nahte Musik, Pistolenschüsse erschütterten nah und ferne die Luft. Unser Hausvater selbst streckte jetzt einige Male sein Geschütz knallend aus dem Fenster. Mit dieser Zeremonie grüßte er der Musik entgegen, welche kam, ihn in das Haus des Bräutigams abzuholen, weil er diesem verwandt war, und also gleichsam dessen Gast bei der Hochzeit vorzustellen hatte. Der Musik folgten mehrere Gäste, welche bereits abgeholt waren. Das Ganze hatte ein feiertägliches Ansehen. Vor jeder Haustüre standen gruppiert die ungeladenen Bewohner des Dorfes im Halbsonntagskleid, um die Hochzeiter vorüberziehen zu sehen. Nach jedem Pistolenschuss tönte ein anhaltendes Jauchzen; selbst von den entfernten Feldern tönte Jubel in das Dorf hinein. Aus dem Nachbarhofe hatte man eben jetzt einen jungen Burschen abgeholt, den ich für den nächtlichen Besucher halten musste. Eine schlanke Gestalt, fromm-jugendliches Aussehen im wohlgestalteten, blühenden Gesicht, machte den Jungen für jedes Auge angenehm. Aus seiner Hand krachten einige Pistolenschüsse schnell auf einander. Sein halb mutwilliges Leben, Jauchzen und Springen hob ihn vorteilhaft hervor vor den Übrigen. Plötzlich ließ er jetzt die Musik mitten in einer Melodie anhalten, bestimmte das folgende Musikstück, jauchzte, knallte einen Pistolenschuss in die Luft, und schrie: »Eiz spielt's ma r af, ös Sakra! Lustö und frisch!« Die Musik klang durch die heitere, ruhige Luft, aus Fenstern und von Haustüren her rief und lachte man dem lustigen Burschen zu. Dieser aber sang zur gespielten Melodie mit heftigen Gebärden eines natürlichen Entzückens:
»Wenn i zo man Deanla gei,
Nim i ma Hearzerl mit;
Woas ma goa r oftmol nöd,
Wos eam koa Doarat gschiht!«
Mein Hausvater zog jetzt seinen Rock an, um Musikanten und Gäste zu empfangen. »Margerl« lief herein und kichernd durch die Stube nach der Kammer. Aber die Mutter brachte einen großen Laib schönes Weißbrot, schnitt ihn nach einer Bekreuzigung darüber oben ein wenig an, legte ihn samt einem großen, frisch geschliffenen Messer auf den Tisch. Man spielte und jauchzte zur Türe herein und schwang die Hüte. Der lustige Bursch aber war auf einmal zahm und trat zuletzt ein, nicht ohne flüchtig-forschendes Umhersehen. Die Männer drückten sich die Hände. Musik schwieg jetzt. Die Hausfrau war geschäftig im Anordnen: »Sötzts eng, schnäds o a Braud! Olta (zum Vater) schenk' ä! (zu den Männern) Willts ös denn zwoamol hean, Mona? Össts und trinkts, dass da Mei (Mühe) weart is!« – Man aß und trank etwas. Dann wurde ein Ländler gespielt, den der Hausvater mit seinem Weibe tanzte. Der lustige Bursch ging frisch nach der Kammer, und holte sich's »Margerl«, die indes sich nett angezogen hatte. Nach dem Tanz wurde eine Art Marsch gespielt, man brach auf, und an der Türe sprengte die Hausfrau etwas Weihwasser über ihren Mann, der andächtig das Kreuz machte und hinaus schritt. – Unter Schießen und Spielen ging der Zug in das Haus des Bräutigams. Indes hatte die andere Hälfte der Musikanten die Verwandten der Braut in ihr Haus zusammengeholt. Sowohl hier wie dort wurde den versammelten Freunden jetzt ein Frühstück vorgesetzt, bestehend aus einer sehr kräftigen Rindsuppe mit eingebrocktem Weißbrot oder Semmeln, Rindfleisch, »Wackä« Eine fette, gähe Mehlspeise aus Semmelschnitten, Eiern, Milchkäse, Gewürz ect., Würsten und Kuchen. Dieses Frühstück heißt man »Gäklhenn« und findet es nur bei größrn Hochzeiten. Wecken und Bier standen sonst noch reichlich auf dem Tische, und man sprach Letzterem bis zu einiger Betäubung zu. Nach Tisch wurde ein wenig getanzt, doch auf einen Wink schwieg die Musik, alle Gäste wurden plötzlich ernst, der Vater des Bräutigams nahm diesen am Arm, indem eine tiefe Blässe sein Gesicht überzog, und große Tränen stürzten über seine Wangen. Die Gäste nahmen feierlich die Hüte ab. In der Kammer stand die Mutter mit den Geschwistern des Bräutigams, die beim Eintritt des Vaters mit dem Sohne zu weinen und schluchzen anfingen. Der Bräutigam kniete nieder, indem er unter Weinen den Kopf senkte und kaum die Worte reden konnte: »Göts mä engan Sögn, Voda und Muada!« – Die Mutter besprengte mit einigen Tropfen Weihwasser sein Haupt, indem ihm der Vater händeauflegend den Segen gab: »Gei in Got's Nom, unsa keast Du eiz nimma; an ondas Hos kreigst Du, a Wä kreigst, und Kina kost kreign. Holt af ollö, wei's unsa Heargotl will; sa guat und vonünftö. Unsä Hear is durt, wo mia rächtschoffa san, gwis mit Glück und Sögn. Eiz stei af – i ho da r eiz ninx mea zon sogn.« Geh' in Gottes Namen! uns gehörst Du jetzt nicht mehr; ein anderes Haus bekommst Du, ein Weib bekommst Du, und Kinder kannst Du bekommen. Halte auf alle, wie es der Herr haben will; sei gut und vernünftig. Unser Herr ist dort, wo wir rechtschaffen sind, gewiss mit Glück und Segen. Jetzt steh' auf – ich hab' Dir nun nichts mehr zu sagen. Viele Tränen liefen bei dieser Rede dem Vater aus den Augen, und er sprach mit oftmaligem Unterbrechen. Während die weinenden Eltern den scheidenden Sohn segneten, beteten in der Stube alle versammelten Hochzeitsgaste laut, ernst und langsam für des Bräutigams Wohl. Dann erschienen Vater, Mutter und Geschwister mit dem Bräutigam wieder in der Stube. Dem letzteren reichten der Reihe nach alle Gäste ihre Hände und sagten ihm freundliche Glückwünschungsworte: »No – so wünsch' i dia ollas Guatö« – oder »viel Glück!« – »möchts da krodn und guat gei« – »No, so wöllt i hold« – – Dankend erwiderte der noch tief gerührte Bräutigam: »I donk eng, Voda – Basl – Voda« – – Die Musikanten hatten sich indes vor das Haus gestellt, den Aufbruch erwartend. Wie der Bräutigam an die Stubentüre trat, sprengte die Mutter noch einmal Weihwasser über sein Haupt und machte das Zeichen des heiligen Kreuzes über ihn, alle andern aber folgten ihm. Die Musik begann jetzt eine marschähnliche, heitere Melodie. Pistolen verkündeten mit lufterschütterndem Knallen weithin, dass der Bräutigam seinen Zug in das Haus der Braut beginne, um sie zum Kirchengang abzuholen. Hier, im Hause der Braut fanden während dieser Zeit dieselben Zeremonien statt, wie im Hause des Bräutigams: »Gaklhenn«, Segenerteilung und vor beiden ein kurzer Tanz. In der Stube erwartete die Braut den Bräutigam. Beide reichten sich die Hand und hielten sich dieselbe gegenseitig so lange, bis der Hochzeitlader, dessen erste Amtshandlung jetzt begann, folgenden Spruch gesprochen hatte:
Glück af! Holt's eng im Hearz so föst wei mit 'n Handn,
Füa r ollö Naud und ollö Löbnszat;
Denkt's 's nämlö To füa To; lausst's eng nöd wendn,
Oas nöd vom odan nöd, wenns rengt, wenns schnät;
Holts zom! Holts zom! wei Stoi in föst'n Moan,
Wei Bama mit'n Wurzln i dar Ead,
Doss enga Glückshos, enga Stombam doan –
Dos globts no! bis zon Gro und länga wead.
Ös willts doch glückla sa – no jo! no fralö!
Ös willts doch oas vom onan eng nöd trenna?
Jo no – so sats no sats 'n onan halö:
So hots ös schö! Holts zom! Holts zom, mogs schnä'm, mogs renga!!
(Glück auf! Fasst euch im Herz so fest wie mit den Händen,
Für alle Not und alle Lebenszeit;
Denkt gleich von Tag zu Tag; lasst Euch nicht wenden,
Das eine von dem andern nicht, ob's regnet, schneit;
Haltet zusammen, fest wie Steine in sichern Mauern,
Wie Baumeswurzeln in der Erde,
Dass euer Glückshaus, euer Stammbaum dauern,
Das glaubt nur! bis zum Grab und länger werde.
Ihr wollt doch glücklich sein – nun ja! nun freilich!
Ihr wollt doch eins vom andern Euch nicht trennen?
Nun ja, so seid nur eins dem andern heilig:
So habt ihr's schon! Vereint Euch fest, mag's schnei'n, mag's regnen!)
Im Hause der Braut wollen wir nun, während sich die Gäste der Bräutigams- und Brautpartei begrüßen, und langsam zum feierlichen Kirchengang anschicken, einen Blick auf das Brautpaar werfen und die einzelnen Würdenträger und Würdentragerinnen erwähnen. – Der Bräutigam war durch einen Rosmarinstrauß am Hute erkennbar, wodurch dieser mit vielen frischen Zweigen ringsum verhüllt wurde, und die hundertfachen Flitter und Gegenstände am Strauß (wie Fluggold, silberner Zitterdraht, kleine weiße Täubchen, mit vergoldeten Herzlein im Schnabel, Kunstblumen u. dgl.) brachten einen angenehm heiteren Effekt hervor. Da, wo der unterste Stamm des Rosmarinstraußes befestigt war (nämlich über der Stirn des Bräutigams) prangte eine aus dunkelrotem Seidenband künstlich geformte Pfingstrose, dort »Bobl« genannt. Wo der Bräutigam stehen mochte oder gehen, versammelte sich um ihn oder lief ihm eine Schar Kinder nach, die mit andächtigem Vergnügen das ewige Schwanken und Zittern der glänzenden Flitter von Silber und Gold betrachtete und nach den lieben Täubchen und Blümlein lächelte, die Hände danach streckend, ob nicht eines herabfallen und zwischen ihren Fingern hängen bleiben möchte. Außer dem Hutstrauß hatte er noch einen kleinen Rosmarinzweig am rechten Rockärmel befestigt. Ein schweres, hellkarminrotes Seidenhalstuch, wohl anschließend und vorn zu einer buschigen Masche gebunden, ober der die zwei blendend weißen Hemdkrägen heraus- und herabgeschlagen waren, gaben dem ernst-wehmütigen Gesichte des Bräutigams einen zarten, lieblichen Schein. Zum Unterschiede von den ledigen Burschen war auch seine rohseidene Weste bis an den Hals mit einer Reihe stark versilberter Zwanzigerknöpfe sittsam geschlossen. Die hirschlederne Hose von frischer Schwärze, deren Nähte durch einen schnurähnlichen Streifen Weißleder hervorgehoben wurden, schloss wohl unter dem Knie, die weißen Strümpfe fest aufrecht haltend. Sein Tuchrock lag besser als gewöhnlich und übertraf die aller Gäste an Qualität. – An der Braut fiel wohl besonders der Kopfputz auf. Die Haare waren von allen Seiten nach dem Wirbel gekämmt, dort zu einem Nest gewunden, dessen ganze äußere Fläche mit kleinen Maschen rosenfarbner Seidenbänder und dazwischen befestigten Rosmarinzweiglein bedeckt war. Rings um das Haargeflecht und dessen Verzier wand sich ein Blumenkranz aus Kunstblumen, woraus sechs silberglänzende Getreideähren in gleicher Entfernung von einem Ohr bis zum andern über das Haupt herüber hervorstanden. Das Haar war leicht bepudert. Weil die Braut blond und ihr Haar sehr zart war, so hatte sich der feine Flaum desselben um die Stirne von dieser ungewöhnlichen Zwangfrisur losgemacht, und bildete in gewisser Beleuchtung einen Marienschein um ihr Gesicht. Gleich ihrem werdenden Gemahl trug sie ein rotseidenes Halstuch, nur sehr locker geschlungen und doppelt grün verbrämt. Über das rosenfarbene Mieder hatte sie noch eine schwarzseidene Jacke, die knapp anschließend bis zu den Hüften hinab reichte und um die Brust wenig ausgeschnitten und garniert war. Der Rock und das Vortuch, ebenfalls von schwarzer Seide, reichten bis an die Knöchel hinab; ein rohseidenes Band hielt das Vortuch, und rückwärts hingen die Maschen und die beiden Enden des Bandes hinab Sonst (und noch jetzt an manchen Orten) trug die Braut einen dunkelbraunen oder hellroten Rock, der wenig über die mittlere Wade hinab reichte. Die Jacke, gewöhnlich aus Tuch, ging kaum über die Hälfte des Rückens hinab. Am Kopfputz fehlte sonst der Kranz.. – Die Art des Kopfputzes teilte, nur vereinfachter, mit der Braut die sogenannte »Brautmaschl« – (Brodmaschl) oder »Kranzeljungfer« (Kranzljungfa) Schwester des Bräutigams, die nebst der »Brautmutter« (Brodmuada) Taufpatin der Braut zu dem höchstbewürdeten Frauenpersonale gehörte. Unter den Männern standen obenan: der »Brautvater« (Brodvödä) Taufpate der Brätigams, der »Brautweiser« (Brodwäsa) Ein Bruder der Braut, als dirigierende, feierliche Person oder Zeremonienmeister der »Hochzeitlader« (Hauzatloda) und endlich die beiderseitig nächsten Verwandten. Die weiblichen Gäste trugen an der Brust Bouquete und Rosmarinzweige, auf den Hüten die Männer. Dieses Zeichen zeichnete sie eben als Gäste. – Auf einen Wink und Ruf des Hochzeitladers mit einem großen Stock, von dem oben ein rotes Seidenband herabhing, wurde es nun in der Stube still. Er nahm den Hut ab, desgleichen alle andern Gaste, und hielt folgende Anrede:
Eiz heit ma Zät! Mia kantn gei und trochtn;
Foa r ollen is doch Sögn und Kircha z ochtn.
Wea nöd mit Got ofongt und Gota's Liab,
Dea r is – ös wissts! – am oigna Glück sa Diab.
Drum schots eiz nöd goa dz viel zätlö Dinga,
Wos äbba fält, dös laußts ö nocha bringa,
Und git da Himml eng (dem Brautpaar) san Sögn,
So bringts ös lächt und gwis a 's Zätla zwögn.
Mochts! Af! Mia r ollö weama's no dalö'm,
Da Himml wiad eng frummö Kina gö'm.
Ös weats goa dz frin sa, weats koa Naud nöd kenna,
Und longö Johr wead eng da Taud nöd trenna.
(Wir hätten Zeit! Wir könnten geh'n und trachten.
Vor allem muss man Seg'n und Kirche achten:
Wer nicht mit Gott beginnt und Gottes Lieb',
Der ist – Ihr wisst's! am eignen Glück sein Dieb.
Drum schaut jetzt nicht zu viel nach ird'schen Dingen,
Was etwa fehlt, das lasst herein sich bringen,
Und spendet Euch der Himmel seinen Segen,
So bringt Ihr leicht das Ird'sche auch zuwegen.
Macht! Auf! Wir alle werden es erleben,
Der Himmel wird Euch fromme Kinder geben.
Ihr sollt zufrieden sein, die Not nicht kennen,
Und lange Jahr' wird Euch der Tod nicht trennen.)
Hierauf ordnete sich der Zug, die Musikanten gingen voran, eine marschartige, heitere Melodie spielend, hinter ihnen folgten: der Bräutigam mit der »Brautmäschl«, dann Braut und »Brautweiser«, dann die übrigen Gäste. Heftiger begann das Pistolenfeuer und Jauchzen, die nahen und fernen Anhöhen bedeckten sich mit Scharen von Zuschauern. Das Dorf mit der Pfarrkirche war nur durch eine Wiese getrennt. Unter diesem Jubel und Schießen klang die Kirchenglocke, die nahe gottesdienstliche Feier verkündend. – Nachdem man bis zur Kirche gelangt war, verstummten plötzlich Spielen und Schießen, die Brautleute nebst den wichtigsten Personen der Hochzeit begaben sich in den Pfarrhof, um sich immatrikulieren zu lassen. Von da ging man in die Kirche. Beim Eintritte in dieselbe schieden sich die männlichen von den weiblichen Gästen. Rechts im vordersten Stuhle saß der Bräutigam, »Vorgeher« (Foageia) Taufpate des Bräutigams und »Brautweiser;« hinter diesen die übrigen männlichen Gaste. Links im vordersten Stuhle ließen sich die Braut, »Brautmäschl« und »Brautmutter« nieder, hinter ihnen die übrigen weiblichen Gaste. – – –
Nach dem Hochamte wartete Musik und Pistoliade auf das junge Ehepaar und begrüßte dessen Austritt aus der Kirche; dann stellten sich alle Gäste in einen Kreis um dasselbe, und der Hochzeitlader sprach folgende Jubelrede.
Hochzeitlader.
Fifat! Fifat!
Gäste.
Fifat! Fifat!
(Musik.)
Hochzeitlader.
No segt's! do homa 's Paar'l, richtö is!
So schuißt's! Sö spielt's! Sö schrät's: Fifat!
Doss d'Luft voll Plödra, Gschroa und Musö is,
Voll Frädngschroa: Fifat! Fifat!
Gäste.
Fifat! Fifat!
(Musik.)
Hochzeitlader.
No, Voderl, Muaderl, no, wei ist denn eng?
Wiad eng um 's Hearz nöd Läwl und Müada dzeng?
Fifat!
Gäste.
Fifat! Fifat!
(Musik.)
Hochzeitlader (zum Brautpaar):
So wät i's! Zombrod säts, so bläbts börnöna,
Und fräts eng eiz weit's willts, eng mit anona!
Fifat! Fifat! u.s.f. ...
Jetzt zog man in das nahe Wirtshaus, wo man sich mit Tanz so lange unterhielt, bis ungefähr die Stunde zum Speisen gekommen war, dann kehrte man in das Geburtsdorf der Brautleute zurück, wo im Wirtshause bereits sechs Tische gedeckt waren, jeder für zwölf Personen berechnet. Einer dieser Tische, der »Brauttisch«, war für Braut, Bräutigam und die nächsten Angehörigen bestimmt. Bevor man aber zu Tische ging, sammelten sich die geladenen jungen Burschen und Männer zu einem Fußwettrennen, das zu den Hauptzeremonien einer Hochzeit gehört. Der beste Läufer erhält von der Brautmutter 8 bis 4 fl. E. M., und ist verbunden, solange die Brautmutter bei der Hochzeit zugegen ist, ihren Trabanten und Launenbefriediger zu machen, oder wie man sagen könnte, mit allem Aufwand von Scherz und Geld ihr die Kur zu machen. Der Erfolg des Wettrennens (das man »Ofaschusselhrenna« nennt) entschied für den lustigen Burschen, den wir vom »nächtlichen Besuch« her kennen. Er begann auch seine Rolle mit Geschick und fast ausgelassener Laune zum Ergötzen aller. – Bei Tisch erschien zuerst Suppe, allein bevor man zu genießen begann, ging ein Teller auf jedem Tische herum, worauf jeder Gast das bestimmte Geld zu erlegen hatte. Nach der Suppe kam Rindfleisch, und zwar in solcher Quantität, dass kein Gast seinen Teil aufzehren konnte; weshalb vor jedem ein leerer Teller stand, auf den er das Ungenossene zurücklegen und nach aufgehobener Tafel seiner Familie nach Hause schicken konnte. Nach dem Rindfleisch stand jeder Gast auf (außer denen, die am Brauttisch saßen) und an ihre Stellen setzten sich die »Nachtafelgänger« (d 'Nogangla), gewöhnlich Kinder oder Geschwister der früheren, welche nun vieles eingemachte und gebratene Fleisch und Würste, Kuchen, »Wackala«, Knödel (Hraudkopfat) u.s.f. genossen und zurücklegten. Unter diesen Nachgängern war auch unser »Margerl« (vom nächtlichen Besuch her bekannt) an die Stelle ihres Vaters zu sitzen gekommen. Bei ihrem Erscheinen ergriff es unsern jungen, lustigen Burschen, den Preisrenner oder Kurmacher der Brautmutter, erst recht mit leidenschaftlicher Heftigkeit. Er ließ am Brauttisch aufspielen, kam dann mit den Musikanten an jenen Tisch, wo »Margerl« saß, und wollte nimmer von ihrer Seite weichen, die halb verlegen, halb erfreut die Huldigung geschehen ließ. Er sprang, jauchzte und sang mehrere Lieder, deren Melodie er sich nachspielen ließ.
Deanal, du Hearzagö,
Moist a, i leissat dö,
Moist a, i mächt ma Lö'm
Nöd füa di gö'm? –
Deanal, dös Vögal durt
Hötschat dur d' Lüftla furt,
Hea no sa Gsangl o,
Kreigst scho an Mo! –
Hitschadö, hotschadö,
Stöckst a da Hearz dawö?
Druckst a da n Ogerl zom?
Daustas foa Schom? –
Bei Fenstern und Türen herein schauten Gruppen von Kindern, die von den Gästen reichlich mit Wurst, Wecken oder Kuchen erfreut wurden und bestimmt waren, die zurückgelegten Speisen nach Hause zu tragen. Einem kleinen Blondkopf sah ich zu, wie er nach einem Bauernhof schlenderte und mit andächtiger Behaglichkeit die besten Stücke des anvertrauten Packes verzehrte. – Nach Tische entstand ein Getümmel um den Brauttisch. Wandbänke und Stühle wurden gedrängt voll von Zuschauern. Der Hochzeitlader begann nun den letzten Spruch, die Danksagung. Sie war in ähnlicher Manier abgefasst, wie die vorhergehenden. Es wurde der Reihe nach erst den beiderseitigen Eltern im Namen des Brautpaares für Erziehung, Erhaltung, Ausstattung und sonstige Gnaden gedankt, dann allen Gästen für ihre warme Teilnahme im Namen der Eltern und des Brautpaares Dank gesagt, worauf nochmal ein Herzenswunsch des Sprechers folgte, dass die Neuvermählten ihre seligsten Tage von nun an erleben und das Alter der Ihrigen erfreuen möchten. –
Nun war es die nächste Aufgabe des Preiswettrenners, die Braut vom Tische herabzubringen. Die Musik spielte eine Melodie, dann fragte der Kurmacher die Brautmutter, unter welchen Bedingungen ihm die Braut herabgeführt würde? Diese sagte: »Bring ma r an Äma ohnö Roaf« (B ringe mir einen Eimer ohne Reif). Der Bursch jauchzte und rief: »Lustö! Spielts af!« Die Musik ließ sich wieder hören, und der Bursch lief hinaus, kam mit einem Ei, das er wie Columbus an einer Spitze ein wenig einschlug, und vor die Brautmutter hinstellte, fragend: »Is rächt?« – »Rächt is!« sagte diese darauf. – Jetzt besann sich die Rätselgeberin ein wenig und begann: »Wos hrump'lt und pump'lt i da hilzan Kopaln?« Die Musik begann abermals, und der Bursch lief hinaus und kehrte mit einem Stempel eines Buttergefäßes zurück, rufend: »Dös hrump'lt und pump'lt im hilzaran Fassl!« – Nach Lösung dieser Aufgaben folgten noch folgende Fragen: »Welche sind die besten Weiberuhren?« – »Haushähne« »Welches Obst reift drei Jahre?« – »Wachholderbeeren«. Endlich musste der Bursch ein Mus bringen, wozu man weder Mehl noch Feuer brauche. Er brachte Honig. Die Aufgabe, ein Rad zu bringen, das kein Wagner gemacht und wozu man kein Holz gebraucht habe, löste er, indem er einen Spritzkrapfen brachte, dessen Form die eines Wagenrades war. Zum Schluss sollte ihm die Braut nur über eine silberne Brücke zugeführt werden. Er legte also eine doppelte Reihe von Zwanzigern auf den Tisch, von einem Eck desselben bis zu jenem, wo die Braut saß. Die Braut stieg darauf, und darüber gegen den Brückenbauer, der sie empfing und auf den Boden herab hob. Unter Jubel der Herumstehenden erschallte Musik. Der Bursche sollte nun den Brauttanz mit der Braut eröffnen, allein Letztere vermisste einen Schuh, den man ihr schon früher heimlich unterm Tische vom Fuß gezogen hatte. Nach langem Suchen fand ihn der Bursch. Er tanzte einen Ländler mit der Braut einmal herum, ihm folgte dann der Vater der Braut mit dieser, dann Brüder, nächste Anverwandte und Hochzeitsgäste nach einander mit der Braut einmal herumtanzend. Jetzt tanzte der Bräutigam mit der Mutter der Braut, – dann mit seiner eigenen Mutter, und zuletzt mit seiner jungen Angetrauten. Hierauf galt keine zeremoniöse Regel mehr, und das übrige tanzlustige Blut bemächtigte sich des Terrains. Bald hatte der Tanz die Gestalt des früher geschilderten angenommen. Burschen und Mädchen kamen zahlreich dazu. Als »Margerl« und der »lustige Bursch« zum ersten Male Muse hatten, länger und heimlich mit einander zu sprechen, entdeckte sie ihm, dass er diese Nacht bei mir fensterln war. Ich beobachtete beide, wie sie verlegen taten, dann plötzlich ein helllautes Gelachter aufschlugen. »Wos?« hörte ich den Burschen sagen, »ea wa's gwöst? Sakra! Host mö für an Noarn? 's ko nöd sa!? – Dea Hear durt is i dan Bött glögn? – Jessas! Eiz mau ö do gla dafohrenna, und ko 's Locha nimma r afhean!« rief er in höchst ergötzlicher Unruhe. Dann schlich er lachend und stotternd zu mir, den Hut verlegen über die Brust haltend. »Hear – Hear – Hear – i bins gwöst – dös is zon Hautz'schnä! Sakra! dös fogis ö mai Lotta nöd!« –
Drei Wochen lang nach der Hochzeit müssen junge Eheleute getrennt bei ihren Eltern leben. Während dieser Zeit wird das Meiste und Wichtigste der Brautaussteuer besorgt und angeschafft. Die junge Frau mit ihren Eltern wandert auf Jahrmärkten bei Kaufleuten herum; zu Hause sind Tischler und Schlosser beschäftigt, standesmäßige Hausgeräte herzustellen. Ist man allseitig befriedigt, so wird der Tag der Vereinigung und Übersiedelung bestimmt. Die schönsten vier Pferde der Gegend werden zusammengespannt vor den Wagen (Kommawogn), auf den man die neuen, bunten Kästen, Tische, Bettgestelle, kurz die kleinsten und größten Geräte für das Hauswesen sich aufschichtet nach einer Art Kunsttheorie. Über diesen Gegenständen wird das Brautbett befestigt, zu oberst eine bunt bemalte Wiege. Was von Wäsche und andern Gegenständen in den Kästen Platz findet, wird da zusammengepresst. Zerbrechliche und bestimmte andere Dinge müssen getragen werden. Zu diesem Ende bittet das junge Weib alle ihre Jugend- und Schulfreundinnen, welche noch nicht verheiratet sind, an diesem Tage zusammen und um Beistand. Man kommt nun auch gerne, der Freundin den Dienst zu leisten. Jedes dieser Mädchen wird mit einem größeen oder kleineren Tragkorbe versehen, um darin einen der von der Sitte bestimmten Gegenstände bei der Übersiedelung zu tragen. Ist vor dem Elternhause des jungen Weibes der Wagen mit seinen vier wiehernden, mutigen Pferden, die mit Blumen, purpurfarbenen Tuchlappen und einem Geschirre voll glänzend geputzter Messingrosen an Kopf und Halse ausgeschmückt sind, zum Fortfahren bereit und hat die scheidende Tochter weinend Abschied genommen von ihren Eltern, so schwingt sich der Pferdelenker, einen Blumenstrauß am Hut und ein Seidenband an der Geißel, auf ein Pferd, und lärmend und jubelnd umringt von einer zahlreichen Begleitung, beginnt er den Zug. Hinterher kommen die Jugendfreundinnen mit ihren Tragkörben. Die einen tragen Küchengeräte, obenauf mit einem ungeheuren Kochlöffel, die junge Hausfrau an ihr Geschäft als Köchin erinnernd, und mahnend, dass man in ihrem Hause künftig »mit dem großen Löffel esse.« Andere tragen Flachs, Getreidegarben, Gespinst von der Hand der jungen Hausfrau, Brot, das sie selbst gebacken, teils um die Wünsche glücklicher Erntejahre, teils die Ermahnung an ihre Pflicht und den Beweis ihrer Tüchtigkeit und Kenntnisse einer Hausfrau anzuzeigen. Den Zug schließt die junge Frau, begleitet von den bei ihrer Hochzeit als Brautmutter, Kranzeljungfer u.s.f. fungierenden Frauen. Ihre Eltern folgen eine geraume Zeit später nach. Von allen Seiten des Dorfes strömen Zuschauer. Die Burschen, welche mit der jungen Frau aufgewachsen sind, wollen anzeigen, wie ungerne sie eine Jugendfreundin verlieren, die nach einem andern, besonders entfernten Dorfe geheiratet hat, und sperren am Ende ihres Dorfes durch aufgehäufte Gegenstände den Fahrweg. Kommt nun der Übersiedlungszug an, und die Pferde können den Holzdamm nicht durchbrechen, so erlegt der Pferdelenker einen Geldtribut, den die hinzukommende junge Frau vermehrt. Rasch wird die Sperre weggeräumt, die Burschen umgeben die Jugendfreundin und begleiten sie weiter. Auf dem Wege müssen bei bestimmten Veranlassungen gewisse abergläubische Sitten beobachtet werden. Hört man zum ersten Male einen Kuckuck rufen, so greift jedermann in den Sack und rührt das dort befindliche Geld auf, zum Zeichen, wie sehr man die Vermehrung des Wohlstandes der jungen Hausfrau wünsche. Der Kuckucksruf gilt als verheißendes Orakel dafür. Hört man eine Wachtel schlagen, so zählt man die Schläge; ihre Zahl bedeutet die künftige Anzahl Kinder dieser jungen Hausfrau. Schlägt die Wachtel in einer Getreideart, so wird diese die ganze Ehe hindurch die günstigste Ernte liefern: schlägt sie auf einem Rain, so bedeutet es Jahre des Misswuchses und Unglück mit Kindern. Hört man zum ersten Male donnern, so muss die junge Frau den nächsten schweren Gegenstand fassen und zu heben suchen, was ihr Gesundheit und Stärke für alle Verrichtungen sichert. Die Einfahrt in das Dorf des betreffenden jungen Gatten versperren wieder die Mädchen jenes Dorfes, scheinbar erzürnt, dass der einen aus ihnen ein Gatte entgangen, und ein Jugendfreund allen durch eine Fremde geraubt worden. Ein Tribut öffnet wieder den Weg. Die junge Frau ladet zugleich alle diese Mädchen in das Haus ihres Mannes. Nun wird sie auch von diesen begleitet. Einige hundert Schritte vom Hause entfernt, erwartet den Zug der junge Gatte. Er küsst sein Weib, und führt sie am Arm bis zu seiner Haustüre. Da begrüßt sie Musik; die Eltern des jungen Gatten sprengen an der Schwelle Weihwasser über das junge Ehepaar und begleiten es in die Stube. Die ganze Begleitung von Burschen und Mädchen beginnt nun etwa eine halbe Stunde zu tanzen; dann werden alle bewirtet, und man verlässt hierauf glückwünschend das Haus. Der Wagen wird mit Weihwasser übersprengt, und die jungen Eheleute beginnen die Möbel im Hause zu ordnen. Indes sind die beiderseitigen Eltern und nächsten Anverwandten zusammengekommen und verbringen den Rest des Tages und größten Teil der Nacht mit Essen und Ratgeben über das künftige Hauswesen des jungen Ehepaares.
In der Woche vor Pfingsten wird jedes Dorf vorzüglich durch drei Dinge belebt: durch die Anstalten zu einer Wallfahrt; durch die Vorkehrungen zum Hexentusch am Vorabend des heiligen Pfingstsonntages – und durch die Proben zum Pferdewettrennen am Pfingstmontage. – Die Wallfahrt besteht in einem frommen Besuch des sogenannten »Heiligenberges« (Halöbear) bei Pribram in Böhmen. Ein oder mehrere Dörfer unternehmen den frommen Pilgerzug zugleich, an demselben Tage aufbrechend und zurückkehrend. Veranlasst sind bei den meisten diese Wallfahrtsbesuche durch Versprechungen in bedrägnsnisvollen Lagen, z. B. in gefährlichen Augenblicken einer Krankheitskrisis an Eltern oder Kindern. Man gelübdet mit folgenden Worten: »Halös, hraudguldaras Heargotmuaderl! Half ma r i mana Naud! Moch mi (ma Kid) gsund, so wollfortö zo dia am halö'n Bear!« (Heiliges, rotgoldiges Herrgottmutterl! Hilf mir in meiner Not! Mache mich (mein Kind) gesund, so wallfahrte ich zu Dir auf den heiligen Berg.) Die Mutter Gottes vom heiligen Berge ist dargestellt aufrechtstehend, gekrönt samt dem Jesuskinde, welches sie auf dem linken Arme hält und mit der rechten Hand am Kinn streichelt. Um ihr anliegendes Kleid schlingt sich der Faltenwurf eines Mantels. Die Dorfkirche oder Kapelle versammelt die frommen Wallfahrer; nach verrichteten Gebeten beginnt der Auszug, die Männer unter Leitung eines Ältesten oder Vorbeters voraus, die Weiber und Mädchen nach, jede den Speisevorrat von Brot und anderem Mehlgebäck in einem Bündel am Rücken tragend. Überhaupt ist das Vertrauen auf die Hilfe der Mutter Gottes vielseitig und groß. Wallfahrtsgeschenke, wie grellgemalte Heiligen-, meistens Muttergottesbilder (Bilgla), bleierne befarbte Heilige (Hälan), Kelche, Monstranzen und sonstiges Messgerät aus demselben Stoffe, Fingerringlein (natürlich geweihte) für Kinder u.s.w., werden in Menge vom »heiligen Berge« mitgebracht und hoch in Ehren gehalten von Großen und Kleinen. Außer der Mutter Gottes vom »Halänbear« hat man noch vielseitiges Vertrauen auf andere wallfahrtsbeliebte Gottesmutter. Ein Beispiel davon gibt uns gleich das Verfahren bei der Segensheilung eines Auges, in das ein schmerzender Gegenstand fiel. Erst wird das geschlossene Augenlid mit Speichel befeuchtet (in Erinnerung des Verfahrens Christi bei der Augenheilung), dann die Spitze des rechten Zeigefingers leise darauf in einem kleinen Kreise herumgeführt unter dem Segensspruch:
Liabö fro fon haua Bogn
Dieses Gnadenbild stand einst am Fahrtwege auf dem Hochbogen (einer bedeutenden Bergwand des Böhmerwaldes, die aber schon zu Bayern gehört). Ein holzfahrender Bauer, den das Gnadenbild im Weiterfahren etwas irrte, hieb mit einem Beile darnach und spaltete der Mutter Gottes den halben Kopf. Augenblicklich erstarrte er und konnte mit seinem Fuhrwerk nicht mehr von der Stelle. Das Gnadenbild befindet sich jetzt in der Klosterkirche von Neukichen (einem bairischen Marktflecken am Fuße des »Hochbogen«) und wird hoch verehrt. –,
Is ma r äbbas i's Ogn gfolln;
Liabö fro fo Possa
Muttergottes-Gnadenbild von Passau; nähere Legendenangaben davon konnte ich nicht erfahren.,
Dauma's wieda r ossa;
Liabö fro fon hälan Bluat
Muttergottes-Gnadenbild von Klattau. Von diesem erzählt man, dass es berühmt wurde, als es, von einem frevlen Steinwurf getroffen, blutete, zu großem Staunen des Volks und zur Zerknirschung des Täters.,
Mochma ma Ogn wieda guat!
(Liebe Frau vom hohen Bogen,
Ist mir was ins Auge geflogen;
Liebe Frauen Passaus,
Tu' mir's wieder heraus;
Liebe Frau vom heiligen Blut,
Mach' mir mein Aug' wieder gut.)
Im Allgemeinen sprechen folgende Zeilen das Vertrauen zur Mutter Gottes aus:
I hon a Fotraua
Af unsa liabö Fraua,
Ollö To und ollö Stund;
So geiwö nöd z' Grund! –
(Ich hab' ein Vertrauen
Zu unser lieben Frauen,
Alle Tag' und alle Stund;
So geh' ich nicht zu Grund!)
Burschen und Knaben sind indes für ein eigenes Fest beschäftiget, das man Hexentusch nennt ('s Häxnostusch'n). Jeder dreht sich nach Verhältnis seiner Kraft große oder kleine Stricke, die gegen das eine Ende hin fast als Schnur auslaufen. Daran knüpfen sie eine wirkliche Schnur von Flachs- oder Seidengespinnst und schwärzen dann beide Enden mit Räderschmiere, um ein vorteilhaftes Gewicht in die Vorrichtung zu bringen. An einem Peitschenstock befestigt, gibt das ihre sogenannte »Patschn«, was eine ungewöhnlich große Peitsche bedeutet, deren einziger Zweck es ist, den Knall auf möglich hohen Grad zu steigern, der auch oft Staunen erregt. Die starken Burschen, auch junge Männer nehmen teil, einen Tusch mit solcher Riesenpeitsche zu exerzieren. Mit beiden Händen wird der Peitschenstock gefasst, durch Ausfahren rechts und links die Peitsche so gezwungen, über dem Haupte zauberhafte Verschlingungen zu machen, und sie mit tüchtigem Knalle (oft einem Gewehrschuss an Stärke gleich) aufzulösen. Diesen Tusch führt jeder so lange aus, bis ihm die Arme zu ermatten beginnen, wo er dann den Schlussknall so bewirkt, dass er, um die letzte Verschlingung der Peitsche zu entwirren, die Peitsche heftig auf den Boden rechts neben sich niederhaut. Die Vorwoche der Pfingstfeiertage lässt von jedem Dorfe her diese »Patschn« hören, und Knaben mit kleinen Geißeln belfern und kneifen dazwischen. Gegen Abend eines jeden Tages, wo das beendigte Tageswerk Zeit gestattet, hört man diese Exerzitien eifriger und anhaltender als zu andern Tageszeiten, denn jeder Bursch muss vorm Schlafengehen noch aufs »Mangerl« (der Rasenplatz vor Bauernhäusern) – und »d' Patschn probian.« – Man kennt genau die vorteilhaften Stellen des Widerhalles, die auch täglich eine Schar Probehaltender versammeln. Einer nach dem andern betritt die geeignetste Stelle und tuscht sich müde. So ergibt sich die Meisterschaft eines oder mehrerer Burschen, die man stets mit Entzücken auf dem Probeplatze erscheinen sieht. Das eigentliche Tuschfest feiert die Jugend in der Nacht vor dem Pfingstsonntage und soll das Verjagen aller Hexen aus Wohnungen, Ställen und Scheuern zur Folge haben. – An einem solchen Abend war's, als ich einst noch ein Dorf zu erreichen eilte. Längst schon klang es aus der Ferne wie heftiges Flintenfeuer feindlicher Truppen, und ich stand auf einer Anhöhe horchend still, aufgeregt und eigenen Träumen ergeben; denn vor mir, im Nachtdunkel versunken, nur durch wenige matte Lichtschimmer verraten, lagen mehrere Dörfer, aus denen ein ununterbrochenes Knallen allseitig näher und stärker, oder ferner und schwächer klang. Dazwischen erhob sich Stimmenjubel, Jauchzen und Gesang. Mir verschwamm der Effekt im Ganzen, bei einiger Nachhilfe der Phantasie wie Schlachtlärm und Gewehrfeuer. Siegesjubel, Schreien der Flüchtlinge, hie und da noch heftiger Widerstand – die flackernden Fensterlichter, des Schießens blitzende Boten – das Auflachen der Weiber und Jauchzen feiner Knaben- und Mädchenstimmen, fliehender Dorfbewohner Klageschreien und Wimmern – das Anschlagen gehetzter Hunde, die Kunde vom letzten Schützlingseifer der treuesten Hauswächter, die heulend eine Kriegerschar von der Schwelle zu wehren eifern. – Ich stieg mit einer Art Grauen nach der Schlachtszene; denn der Widerhall in den kleinen Wäldern um mich erfüllte diese mit dem Lärmeffekt hervorbrechender feindlicher Hinterhalte, und allseits stürmte Gefahr scheinbar auf mich ein. Mit meinem Nähern an das erste Dorf vereinfachte sich das Lärmen. Weiber und Kinder gingen nach Hause, denn nur die Zeit der ersten Dämmerung war ziemend ihrer Gegenwart im Freien. Das Abendläuten verlöschte die ganze Szene plötzlich, und ich erreichte bereits das Dorf, ohne Tusch und Lärm zu vernehmen. Beim ersten Hause sah ich einen Mann frischen Rasen vor Statt- und Haustüre legen und Weihwasser herum sprengen unter der lauten Zauberformel:
Fluigt's dafo Nochtgoid und Haxna!
D' Patschna tuschnt eng os,
D' Engl tadnt eng zmäxna
J man guat gwatn Hos. –
Nicht weit davon stand ein kleines, hölzernes Haus, mit kleinen Fenstern und ganz, fast bis unter das flache Dach von gespaltenem Holz umschichtet. Als das Abendläuten zu Ende und keine Störung der Andacht mehr zu besorgen war, knallten plötzlich um dieses Haus bei zwölf derbe Burschen, die sich in Distanzen herumgestellt hatten, lange, ohne Ermüdung zu beachten, und betäubten mich Nahestehenden so, dass mir lange danach die Ohren klangen und eine gellende Stimme, die jetzt aus einem Fenster scholl, fast keinen Eindruck auf mein Gehör machte. Die Bewohnerin des Hausleins galt für eine Hexe in der Gegend, und der Tusch sollte ihr die Macht (Kühe zum Blut statt Milchgeben zu vermögen – in Feldfrüchte Brand- und Afterähren zu zaubern – mit Nebel hinter ihr und vor ihr, unsichtbar herumzuschweifen u.s.f.) in Zukunft benehmen. Sie aber eiferte wild mit fliegendem Haar aus dem Kammerfenster, bis sich die »Patschnhelden« entfernten. –
(Fortsetzung.)
Bald, wenn die Nacht weiter vorgerückt ist, erstirbt das Knallen allmählich und die am längsten den Schauplatz behauptenden Burschen gehen stille, scheinbar nach Ruhe und Schlaf verlangend, auseinander, kaum hier und dort einmal jauchzend. Doch haben sie ganz andere Schelmenstücke beschlossen, als sie bereits an verrufenen alten Weibern verübt haben. An einem bestimmten Platze versammeln sie sich vor allem, damit sie sich beraten (»doss Rot schlognt«), wie sie sich verteilen und über die Mittel, welche sie für ihre Schelmenabsichten anwenden sollen. Es handelt sich darum, das Hausgeräte jeder Art, welches man eben mit aller Vorsicht an diesem Abend in den Häusern verwahrt, herauszukriegen und mitten in dem Dorfsumpf, oder auf einem andern schwer zugänglichen Platz zusammen- und hoch aufzuschichten, wohl achtend, dass ja jeder Schaden der Geräte verhütet werde. Selten bleibt ein Haus bei aller sorgfältigen Verwahrung den Burschen unzugänglich in dieser Nacht, weil die eigenen Haussöhne und Knechte zu Verrätern und Helfershelfern werden. Haben die Burschen mit bewundernswertem Eifer die höchst beschwerliche Arbeit (denn sie schleppen Fässer, Bettgestelle, ja leere Leiterwagen herbei) endlich vollendet, so bleibt eine Wache bei den aufgehäuften Geräten zurück, teils um zu verhüten, dass etwas entwendet oder von den Eigentümern vor Tagesanbruch heimlich zurückgeholt werde. – Nach Mitternacht werden die Ställe ganz sachte geöffnet und das Vieh ohne Geräusch auf die Weide getrieben. Mit Tagesanbruch kehrt man damit wieder zurück. Man spart einen Platz fetter Weide eigens für diese Nacht. Am Morgen des Pfingstsonntages entsteht großer Tumult um die aufgehäuften Hausgeräte. Unter Scherzen und Neckereien werden die einzelnen den Eigentümern zurückgegeben. Man hat eigene Redeformeln, wie:
Eigentümer (der ein kleines Fass vermisst).
Haz, Saparamenta! wo is ma Fassl? –
Ma Fassl! Ma Fassl!
Wachhabender Bursch.
No'z, Voda, wos wa dös? A Fassl? –
A Fassl? A Fassl?
Eigentümer.
No hea damit! 's Fassl hea! Wa's zon dakreign?
Wachhabender Bursch.
Na, Voda, koa Fäßl! eng keat o do Weign!
Eigentümer.
Potz Wada und Dorschlo und Stutzn,
Ma Fassl, sist frissa dö mit Stingl und Putzn!
Wachhabender Bursch.
No, no! Satz rauö und taut's nöd so wild,
A Schoissl hod oftmol 'n Boweih scho gstilt!
Nach diesen Worten reicht der Bursch (in diesem Fall das Fassl) herunter. So wird jeder Gegenstand einzeln begehrt und zurückgegeben. Findet sich ein zweideutiger Gegenstand vor (Nachtgeschirr o. dgl.), so meldet sich wohl selten der Besitzer, und die Laune der Burschen ergötzt die lärmende Zuschauermenge. Solche Gegenstände werden in der folgenden Nacht zurückgestellt und man findet sie vor den Fenstern oder am Bestimmungsorte wieder. –
Die Pflege der dazu bestimmten Pferde wird lange vor Pfingsten der Eigentümer wärmste Sorge. Die erwählten Reiter (Söhne oder andere Burschen) müssen entweder selbst in der Pfingst-Vorwoche täglich einen Proberitt damit machen oder durch andere machen lassen. Zweimal wird Hauptprobe gehalten, wonach sich meistens ziemlich sicher der Erfolg des Wettrennens erraten lässt. Doch wird selten dadurch ein Reiter ganz entmutigt, dass sein Proberitt weniger günstig war; seine Entschuldigungen sind vielfach, und seine Pferdepflege wird umso eifriger. Am Pfingstmontage versammeln sich die Reiter in jenem Dorfe, in dessen Nähe der bestimmte Rittplatz sich befindet. Der Rittplatz ist ein Brachfeld oder eine Gemeinweide. Zuschauer strömen von allen Seiten herbei, nicht nur Dorfbewohner, sondern auch Herrschaftsbeamte, Provinzstädter und Herren jeder Art. Im Wirtshause ist der Sammelplatz. – Hier klingt heitere Musik für die Ohren und fallen beachtenswerte Dinge in die Augen. Eine Fahne, woran die Preise für die Reiter hangen: ein rot- oder blauseidener Westenstoff für den Preisritter; ein karminrotseidenes Halstuch für den zweiten Preisempfänger; ein schöner Hosenträger nebst Strauß von Kunstblumen, der an der Spitze der Fahnenstange prangt, ist bestimmt dem Dritten in der Ordnung. Der Vierte erhält eine unbedeutende Summe an Geld. (Zum Einkauf dieser Dinge und um die sonstigen Ausgaben zu bestreiten, erlegen die Reiter einige Tage vor dem Wettreiten eine Geldsumme.) Unter den Reitern figuriert die komische Person (da Gschboasmocha). Nicht nur er ist ergötzlich kostümiert, sondern man hat ihm auch das erbärmlichste Schindluderpferd der ganzen Umgegend zugeführt. Als ich einem solchen Wettreiten beiwohnte, sah dieses Pferd solchermaßen aus: wo es den Kopf hatte, da war ein H– von Stroh nachgemacht, und hinter dem Schweife desselben sahen die verschämten Augen hervor; und wo die Mähre wirklich den H– hatte, dort war ein künstlicher Strohhals und Strohkopf angebracht. Mittelst einer Leiter bestieg der »Gschboasmocha« seinen Hengst, während drei bis vier Mann von der entgegengesetzten Seite sich mit den Händen an die Rippen des Pferdes stemmten, um es aufrecht zu erhalten während des Besteigens. Ein betäubendes Gelächter zerriss die Luft, als der Hengst mit seinem Reiter einige ehrenrettende Sprünge machte und mit den Vorderfüßen aufstieg, denn es musste den Zuschauern scheinen, als bäume es sich mit dem H– und laufe mit ihm voraus. Die Belohnung des Spaßmachers sind gewöhnlich zwölf Päckchen Rauchtabak, oder wenn er will, eine gleiche Quantität Schnupftabak. Die ordentlichen Reiter tragen auf dem Kopfe eine lederne Mütze, die nicht viel mehr als den Wirbel bedeckt, ein nur locker geschlungenes Halstuch, haben keine Jacke an, sitzen ohne Sattel auf dem Pferd, ihre Weißstrümpfe hängen ungeknüpft bis an die Schuhe hinab. Das Pferd ist an Zaum, Mähne und Schweif mit roten Seidenbandmaschen geschmückt. Ein leichter Zaum dient dem Burschen als Lenkungsmittel. Unter fröhlichem Spiel der Musik beginnt die Reiterschar ihren Aufbruch, und die Zuschauermasse wälzt ihre bunten Haufen nebenher über Hohlweg, Hecken und Zäune; die Weiber schäkern und schreien ihre fröhlichen Launen in die Luft; die Männer streiten, rauchen, wetten trotz Engländern, und das leidenschaftliche Sprechen und beeilte Gehen macht alle fast atemlos. Manche leidenschaftliche Äußerung ergießt sich in dem bekannten Texte:
Laud is, wenn d' Hrossa schei gströckt,
Krod aß wenn's Nochtgoid Heid gschröckt,
Aho'nt und psälgschwing hi fluignt,
Und eng d' Hröda sö fürassö buignt;
Wei eng do 's Nosnlo schnurrt!
Wei eng dos Taiflsros pfurrt!
Wei so da Hröda hoisarö keart!
Gschwinka fürö sa Rapperl meart!
(Schön ist's, wenn die Pferde schön g'streckt,
Gleichwie vom Nachtkobold g'schreckt,
Einhau'n und pfeilschnell her fliegen.
Und sich die Reiter vorwärts biegen;
Wie euch da 's Nasenloch schnurrt!
Wie euch das Teufelsross pfurrt!
Wie da der Reiter, heiser vom Schrei'n,
Schneller zwingt 's Rapperl zu sein!)
Um den Rittplatz ist weit umher die Gegend bunt von Zuschauern besät. Bis an die Stelle, wo sich die Reiter postieren, begleitet diese Musik, das Ziel ist durch dünne Strohspur markiert, worüber hinweg der letzte entscheidende Sprung der Pferde gehen muss. Wenn die Reiter die möglichst ruhige Stellung angenommen haben, regt sich auch kein Laut mehr unter den Zuschauern, Alles starrt regungslos nach der Reiterfronte, die Pferdeeigentümer erblassen, gleich wie die Angehörigen der reitenden Burschen von ängstlicher Erstarrung heimgesucht werden, und niemand erwartet ohne Spannung den Moment, wo das Feuer der Flinte blitzt, und der Knall die Pferde aufschreckt und plötzlich unter Peitschenhieben und Schreien abgejagt wird. Dieser Augenblick bringt fieberhafte Bewegung in die Zuschauer. Einige wollen ihren Pferden vorwärts helfen, und starren danach hin, mit vorgestreckten Händen, die rechte Fußspitze vorwärts biegend und in den Boden grabend; andere summen heftig durch die Nase, mit den Fingern krabbelnd über die Hose; viele schreien ein ohrzerreißendes: »Wiah! Wiah! (Vorwärts!) Räpperl! Brail! (Braunes) Schimmerl wiah! Fixl! Ho zau! (Hau zu!) Fronz wiah dö (Franz wehr' Dich)! 's mö hot 's East (meins hat das Erste, Beste)! u.s.f.; wieder einige hauen sich mit den Händen über die Schenkel, als säßen sie selbst zu Pferde, und laufen hinter diesen her; im Enthusiasmus sah ich einen, dessen Pferd dem vordersten sehr nahe war, wie er mit einem dünnen Stabe die Umstehenden auf die Köpfe hieb, und als man aus seiner Nähe wich, stand er allein da, ein schnurrendes Rad schlagend mit dem Stabe. Knaben bilden sich entzückt ein, Pferde zu sein, beißen in die Zügel, schnauben und laufen wiehernd nach dem Ziele. Murren, Geschrei und Rauschen wird von allen Seiten laut; zusammen fließt die bunte Zuschauermasse um das erreichte Ziel. Jedermann sucht dem Preisbeteilten nahe zu kommen, der nun, die Fahne in der Hand, jauchzt und aufspielen lässt. Lob, Tadel, Freude, Zorn äußert sich nun, und in dumpfes Lärmen löst sich die Wirkung der Szene auf. Doch plötzlich knallt ein zweiter Flintenschuss, und der »Towaghräda« oder »Gschboaßmocha«, oder Nöstschässa« beginnt nun allein seinen Lauf. Sein Ross läuft mit Anstrengung aller Kräfte etwa zwanzig Schritte, dann steigt der Reiter ab, füttert und ergötzt einige Zeit die Zuschauer. Wenn er am Ziele anlangt, beginnt er einen heftigen Streit mit dem Preisritter um die Fahne, bis ihm sein Lohn anderer Art zugesagt ist. Unter Musik, Jauchzen und Lärmen feiert man den Triumphzug nach dem Dorfe. Nach kurzem Tanze reiten die Burschen durch das ganze Dorf unter Musik, sprengen einige Male um jeden Bauernhof, während die komische Person mit einem großen Tragkorb am Rücken die Hausfrau bestürmt mit den Worten:
»Baren schot's offö dur d'Fenzascha'm,
Kint's ös do hoathearzö bla'm?
Hrädnt ums Hos one Sodl und Woia –
Tadet eng hruia, hats! Keichal und Oia?«
(Bäurin schaut durch die Fensterscheiben.
Könnt ihr da hartherzig bleiben?
Reiten ums Haus ohne Sattel und Zaum –
Geizt ihr mit Kuchen und Eiern? Wohl kaum!)
Die gesammelten Kuchen und Eier speisen die Burschen im Wirtshause. Hierauf beginnt regelmäßiger Sonntagstanz. –
Eine originelle Seite gewinnt das Volksleben am Böhmerwalde durch die lustigen Streifereien der Burschen nachts in den Dörfern. Die Montag-Dienstag-Donnerstag-Nächte werden seltener und mit weniger Aufwand der Unterhaltungsgabe von Seite einzelner gefeiert. Doch wenn auch in solchen Nächten keine bedeutende Versammlung und Unterhaltung der Burschen stattfindet, so wird man gewiss häufig einzelne jauchzen und singen hören; denn der Weg bis zum Liebchen, der allnächtlich, wenn auch einsam, gewandert wird, muss mit Rosen bestreut werden. Diese Rosen sind Gesang, Jauchzen, Pfeifen einer Melodie mittelst der bloßen Lippen oder einer Mundharmonika. Sonst, vor dem Bekanntwerden mit den Mundharmoniken, waren in diesen Gegenden die Rohrpfeifen allgemein gebraucht; sie bestanden gewöhnlich aus elf Rohrstücken, die ihre bestimmte Stimmung von der Mitte (dem Orte des tiefsten Tones) gegen die beiden Enden hin hatten. Man besaß die Fertigkeit, jeden Ländler darauf zu spielen. Freitagnacht, Norma. Die Mittwoch- und Samstagnächte sind die herkömmlich festgesetzten, wo man sich zahlreich versammelt, lärmt, jubelt, singt, Possen liebt und treibt, wo man die empfindlichsten Verlegenheiten und ausgelassensten Tollheiten erlebt. Zu diesen beiden letzten darf man auch (aber mit vielen Ausnahmen) die Sonntagsnächte rechnen. Diese Einteilung behält während des längsten Teils des Jahres wenig abweichende Geltung. Am treuesten halt man sich an diese Ordnung im Winter, wo die Strenge der Witterung dem jugendlichen Blute weniger brausenden Übermut zulässt, und zu Zeiten, wo allzu strenge Tagesarbeiten den Körper der Burschen sehr erschöpfen, wie z. B. während der Ernte. Im Frühling aber und während des Sommers vor der Ernte, wie nach mehreren besonders arbeitsfreien Tagen gilt gar keine allgemeine Regel. Da wird jede Nacht, oft bis zum hereinbrechenden Morgenrot, auf die lustigste Weise durchschwärmt. Aber auch da bleibt jede Freitags- eine Ruhenacht. Ich will eine solche lustige Burschennacht, wie ich sie diesen Sommer (1842) als ungesehener Beobachter belauschte, nachfolgend schildern. – – Es war gerade Sonnabend, die meiste Ernte vorüber.
Gleich nach Sonnenuntergang verließ ich das Dorf. In den meisten Häusern nachtmahlte man eben bei Spanbeleuchtung. Indem man aber hier bei Tische aufgeräumt war und scherzte und lachte, kam ich auch manches Haus vorüber, wo man, bereits gesättigt, schon das Nachtgebet begann. Da man fast überall während dieser notwendigen Abendverrichtungen die Fenster geöffnet lässt, so vermengten sich Scherz und Gebet in meinen Ohren zu einem unverständlichen Gemenge von Lauten. Kaum war ich aus dem Dorfe und im Versuch, eine leichte Anhöhe zu ersteigen, so begann die Dorfglocke zum Abendgebet zu mahnen. Durch die Dämmerung der stillen Luft schwebten nach und nach die Glockentöne aus allen umliegenden Dörfern um mich zusammen und verhallten ebenso nach und nach wieder. »Liebliche Abenddämmerung! Holder Klang voll Gottvertrauen! Du Ende aller Dinge!« – und so weiter, was man sich denkt. Ich wollte auf der Anhöhe abwarten, bis mich irgendwo beginnender Gesang oder Jauchzen der Burschen wieder in das Dorf locken würde. Bald waren das laute Leben in den Häusern erloschen, die Lichter ausgegangen. Über den vier großen Linden um die Kapelle glimmte der unruhig-heitere Abendstern bereits. Beim langen Betrachten aller Bäume, Häuser und anderer größerer Gegenstände merkte ich deutlich die Wirkung, wie die tiefere Dämmerung denselben jenes Verschwimmen zu einer gewissen Rundform mitteilte. An den vier Linden war die Wirkung auffallend und gab nach und nach Charakter. Je mehr die Durchlichtung der Äste sich verlor und das Zurückschmelzen der vorspringenden Zweige an die Kernform der nebeneinander stehenden Linden überhandnahm, bildete sich auch auffallender ein regelmäßiger Mönchskopf heraus. Zwei große Äste gegen Westen vorspringend und dann abwärts hängend, stellten eine Adlernase vor, wie sie im Verhältnisse zu dem tonsierten Scheitel und der Völle des übrigen Gesichtes gerade groß und entsprechend genug sein musste. Weil die Äste der Linden von den Stämmen einige Länge herab verdeckten, so schien der Kopf mittelst eines kurzen Halsstumpfes auf der Erde zu sitzen. Und auf diese Täuschung sehend, bildete sich meine Einbildungskraft die verhältnismäßige Körpergestalt nach Breite und Tiefe des umliegenden Bodens dazu – jene Anhöhe die rechte Schulter – Brust und Bauch – – horch, da jauchzten zwei Burschen im Dorfe, und schnell Platz und Gedanken verlassend, eilte ich in das Dorf hinab den Stimmen der Burschen nach, welche von Westen nach Osten ihren Weg durch das Dorf gingen. Und kaum angelangt, jauchzten die zwei Burschen schon an dem letzten östlichen Hause. Wie ich ihnen ganz nahe kam, ohne bemerkt zu werden, erblickte ich im Lichte des eben aufgehenden Mondes zwei Burschen, welche sich auf dem grasigen Platz vor dem Hause neben einem Haufen Reisig hinstreckten. Der Eine stützte sich auf die linke Hand, fast eine sitzende Haltung annehmend und führte mit der rechten eine lieblich tönende Mundharmonika zwischen den Lippen hin und her, folgende Melodie spielend:

Der andere Bursch, platt auf den Rücken hingestreckt, jauchzte:
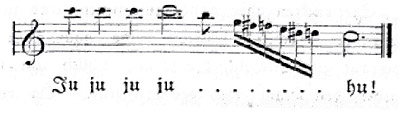
Die Harmonika wiederholte die vorige Melodie, dann sangen
beide zu derselben folgende Texte:
So weng, wos koa Wasserl
Gengä Bear kon hrinna,
So weng konö di os man
Hearzal bringa.
So wenig ein Bächlein
Den Berg hinauf dringt,
So wenig mein Herz Deinem
Bild sich entringt.
Gi ma koa Schmozerl mea
Af manö Wong;
As is o a folschö Lia,
Doat nöd long.
Gib mir kein Busserl mehr
Auf meine Wang';
Ist ja eine falsche Lieb',
Dauert nicht lang.
Beide:

Noch antwortete ihnen keine andere jauchzende Burschenstimme im Dorfe. Sie rückten aber näher zusammen, und indem sie leise zu einander sprachen, blickten beide nach dem nahen Hause. Hierauf entfernte sich der eine, schlich am Gartenzaun hin über den Bach nach der Scheune. Da rückte er ein Brett mit Leichtigkeit weg und stieg hinein. Der andere Bursch blieb liegen, auf der Harmonika bald vorige Melodie wiederholend, bald folgende spielend:

In wenigen Augenblicken darauf stieg der erstere wieder aus der Scheune, zog geräuschlos eine Leiter nach sich, schob das Brett wieder paffend vor die entstandene Spalte und kam zurück. Als er am hölzernen Balkon die Leiter festlehnen wollte, hörte er seinen Freund warnend zischen. Er hielt inne, und dieser lief auf den Zehen hinzu. »Woart! Stad! Dea Sakara wens'lt wieda r um häd! Is a wieda weia brunstö's Nochtgöid, und ko nöd hraua!« (Warte! Still! Der Sakramenter schleicht wieder herum heute! Ist wieder wie ein Gespenst, ein lausiges, und kann nicht ruhen!) Er meinte den Hausbesitzer, der eben mit einem Licht durch die Kammer ging. Als dieses verschwand, lehnten beide hastig die Leiter an den hölzernen Balkon, einer kletterte hinauf und sprang auf die Balken, worauf er an der Wand hinschlich, bis er an einem Fenster hielt und leise klopfte, indem er rief: »Nanö! Nanerlo! Heast? Heast a nöd?« Mehr konnte ich nicht verstehen, denn das Mädchen musste ihn jetzt gehört haben und leise mit ihm sprechen. Der andere Bursch hatte indes die Leiter zum Reisighaufen getragen und neben sich gelegt. So lag er ganz ruhig, ohne dem Jauchzen, welches jetzt von verschiedenen Seiten einzeln zu hören war, zu antworten. Seine ganze Beschäftigung bestand im einförmigen Niederschlagen neben sich mit einem Stocke. Gegen die Südwestseite des Dorfes schienen sich die jauchzenden Burschen zu sammeln. Fernes Lärmen und Lachen machte bald die Versammlung unleugbar. Nachdem man allgemein bald durch Jauchzen, Pfeifen, bald durch nachgeahmtes Krähen eines Hahnes oder Werfen nach bretternen Scheuerwänden seine lustige Tollheit bemerkbar gemacht hatte, vereinten sich alle Stimmen, seltsam gemischt zu einer harmonischen Wirkung in folgender Melodie:

Krähen, Jauchzen, Schnalzen mit der Zunge folgte darauf im wunderlichsten Chaos. Ich wollte die lärmende Schar in der Nähe beobachten, und eilte aus meinem Versteck an der Mühle vorüber bis hinter das nächste Haus bei dem Aufenthaltsplatze der Burschen. Sie standen, ungefähr ihrer Zwölf an Zahl, in einer zwanglosen Gruppe, in ihrer Mitte einer, der die Mundharmonika blies. Dieser wiederholte eben die obige Melodie, welche man so begleitete, dass man jeden Takt dreimal stark mit der Zunge schnalzte oder eben so oft mit den hohl gehaltenen Händen klatschte. Wenn der Bläser zu Ende war, führte jeder eine lärmende Narrheit aus, dann sang man zur Melodie mehrere Texte, wie:
Da Gucku is g'schäckat,
Hod owal blo Feiß –
Und wei is denn dö himmlischö
Liaschoft so seiß!
Der Kuckuck ist scheckig,
Hat immer blau' Fuß' –
Und wie ist doch die himmlische
Liebe so süß! –
I bin hold a Büawal,
I füa hold a Lö'm,
Und i bin no mai Lötta bo
Koan Deandla glögn. –
Ich bin halt ein Bürscherl,
Ich führ' halt ein Leben,
Lag bei keinem Mädchen noch
Mein ganzes Leben!
Durt hintn im Wold
Js a Wasserl schei kold –
In a ollaleists Deänal
Foliabt ma sö bold.
Dort hinten im Wald
Fließt ein Bächlein so kalt –
In ein allerliebsts Mädchen
Verliebt man sich bald.
Ma Schozal, dös hod mö
Wei sist nimma gean;
Wea 's Häuserl fokaffa
Und O a siedla wean.
Mein'm Schätzlein, dem geh' ich
Wie sonst nimmer ein;
Will 's Häuserl verkaufen,
Und Einsiedler sein.
I segs scho; i segs scho,
Dös geit ma nöd zom;
Doss i Zwoasiedla wean ko,
Geiwö af Rom!
Ich seh' schon; ich seh' schon,
Ich schwimm' gegen Strom;
Dass ich Zweisiedler werde,
Wandr' ich nach Rom.
Während des Gesanges verketteten die Burschen sich in einen Kreis, indem jeder zwei andern seine Arme um den Hals schlang. So bewegten sie sich zugleich nach dem Takte. Der Harmonika-Spieler begann jetzt, um vom Platze zu kommen, folgendes 3/4 taktiges Musikstück, welches gewöhnlich gespielt wird statt eines Marsches bei Hochzeiten, wenn man die Gäste in das Haus des Bräutigams oder der Braut zusammenholt, oder nach der Kirche zieht, und überhaupt, wenn die Musik im Freien jemand begleitet:

Hinter dem Bläser traten, klatschten, jauchzten die Burschen taktmäßig drein, teils noch zusammenhangend, teils aufgelöst. Man näherte sich wie durch Verabredung, nachdem man das nächste Haus unbeachtet gelassen, dem zweiten Hause, hielt davor an und einige riefen: »He, Nonal, schlofst scho? No, schlofst scho?« (He, Annerl, schläfst schon? Wie, schläfst schon?) Dann sangen alle folgende Melodien:

Vom Deanal ir'm Fenzerl
Mau 's woarm ossa gei;
Sist kant o z' Nocht 's Büawal
Nöd so long stei.
Beim Mädl ihrem Fensterl
Muss's warm heraus geh'n;
Wie könnt' bei der Nacht sonst
Der Bursch so lang steh'n!
(Harmonika, Solo.)
Jauchzen:

(Nach der obigen Melodie):
D' Stean san am Firmament,
Owahol'm Hos –
Und dea Bursch, dea ma b'stimmt is,
Dea kimt ma nöd os.
Sterne am Firmament
Steh'n über'm Haus;
Der Bursch, der bestimmt mir ist.
Kommt mir nicht aus.

Du Hearzaga Schotz,
Um da Leiberl is schod.
Doss koa Hearzal drin is,
Wos rächt africhtö is – rep.: Doss koa rc.
Du herziger Schatz,
Um dein Leiblein ist schad,
Dass kein Herzlein drin wohnt,
Das mich aufrichtig schont' – rep.: Dass kein rc.
Dieses Singen und Lärmen, das die Stelle eines Ständchens vertritt vor jedem Hause, worin ein Mädchen schläft, wurde plötzlich durch den Mordjoschrei eines Burschen unterbrochen, der: »A Diab! Ein Dieb Sakara, a Diab!« schreiend, einen Knittel vom nahen Holze ergriff und um die Ecke des Hauses fortstürzte. Augenblicklich hatten sich auch alle übrigen Burschen auf diese Weise bewaffnet und sprangen in wilden Sätzen nach, um den Dieb zu fangen. Bald erblickte ich wirklich jemand von der andern Seite um das Haus fliehen, die Burschen lärmend und keuchend hinterdrein: »Holt! Fongts'n! Hi mau a sa! Diab! Lump! Wean dö gla hoa'm! Sakara, woart!« Jetzt kollerte plötzlich der Flüchtling unter lautem Gelächter auf die Wiese hin, und wälzte sich so lachend eine Strecke fort. Im Schwung des Laufes konnten sich die vordersten seiner Verfolger nicht augenblicklich zurückhalten; sie stürzten über ihn und hielten zwar den Flüchtling, aber keinen Dieb im Arm. Ein allgemeines Gelächter erschallte. Schnaufend drängten sich alle zusammen um den gefallenen Gefangnen. »Der Hallunk! Der Schleicher! Der listige, geheimtuende Schlingel!« Dieser Gefangene war niemand sonst als ein Bursch, Kamerad aller, die um ihn standen; vor einer halben Stunde schützte er leichtes Unwohlsein, Schläfrigkeit, üble Laune vor, die ihn abhielten, an der nächtlichen Wanderung heute teil zu nehmen. Deshalb entfernte er sich, sagte von Weitem nochmals »Gute Nacht!« zurück, ging wirklich, und schien damit Ernst zu machen, wovon er sprach, dass er sein Bett suchen wolle. Indes war nichts weniger als das der Fall, wovon er sprach. Er liebte seit einiger Zeit ein Mädchen im Hause, wo man ihn jetzt ertappte, und wollte damit den Geheimnisvollen spielen. Als die Burschen ihr Ständchen vor dem Hause sangen, hing er ganz mäuschenstill am hölzernen Balkon und wollte eben, als sich jene zu entfernen schienen, eilig entschlüpfen. Das war der Augenblick, wo man ihn erblickte und verfolgte. Jetzt nahm man ihn lärmend in die Mitte und zwang ihn wie einen Verbrecher, die nächtliche Wanderung mitzumachen. Nun folgte er auch ohne Widerstreben und sang und jubelte trotz dem Fröhlichsten. Eine marschartige Melodie, auf der Mundharmonika gespielt, bewog die lustigen Burschen jubelnd weiter zu eilen. Eine seltsame Erscheinung machte aber plötzlich alle stutzen. Der Mond stand eben hinter einer dichten Wolke und warf bedeutendes Dunkel über die Gegend. Die Wand des nächsten Bauernhauses schien durch und durch helle Glut. »Hilsakra! 's Schaustawoferlhos brint!« schrien einige, zu Hilfe stürzend. Doch erkannten sie freudig verwundert bald, dass ein phosphoreszierender Stoß faulen Holzes ihr Auge getäuscht habe. Der Hausbesitzer hatte dasselbe am vorigen Tage erst aus dem Walde geführt. Erst ein Gegenstand des Schreckens, wurde das phosphoreszierende Holz nun ein Gegenstand scherzhaften Übermutes. Jeder Bursch ergriff ein Scheit, und wie mit einer Fackel durch die Luft fahrend, sprangen und tanzten sie, wo sich nur Raum dazu bot. Einige ließen auch gleich ihren Einfall laut werden, die Liebchen ein wenig in Angst zu jagen. Der eine führte auch seinen Vorsatz sogleich aus. Er stand mit der netten Magd des Hauses vertraut. Wie ein Kater erkletterte er geübt die Höhe eines Bodenloches, in dessen Nähe er das schlafende Liebchen wusste, rief: »Nonal! Nonalo! Heast?« nachdem er ein Stück scheinbar glimmenden Holzes auf ihre Bettdecke hineingeworfen hatte. Die Angerufene erwachte: »Jessas, ma Bött brent!« schrie sie, und sprang im Hemde davon. Lachend beschwichtigte sie der Bursch und wollte sie bewegen, ins Bett zurückzukommen, allein der eben wieder hervortretende Mond, dem einige Lücken des Daches Gelegenheit gaben, bedeutende Helle um die Nähe des Bettes zu verbreiten, hinderte das Mädchen an der Rückkehr in das Bett. Es blieb so lange geschämig im Hemde in einen Winkel gedrückt, bis der Bursch, »Gute Nacht« sagend, herunterstieg, und sich zu den lachenden Kameraden gesellend weiter zog. Gesang gewann nun wieder volles Vorrecht, indem man mit folgender Melodie begann:
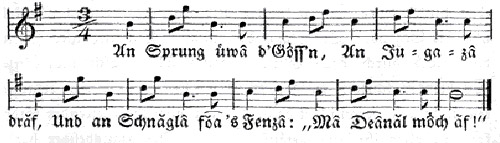
An Sprung üwa d' Gossn,
An Jugaza draf,
Und an Schnagla foa 's Fenza:
»Ma Deanal moch af!«
Einen Sprung über'n Weg,
Einen Jauchzen darauf,
Einen Mundschnalz vors Fenster –:
»Mein Maderl mach' auf!«
Zwoa r Antla im Wossa,
Zwoa Fischla r im See – –
Dö Liaschoft geit inta,
Geit nimma in d' Höh!
Zwei Entlein im Wasser,
Zwei Fischlein im See – –
Die Liebschaft geht unter,
Geht nimmer in d' Höh'!
I bin a Fleischhaka'sknecht,
Und mochs koan Deanla recht,
Weil i glei jedö Kau
Opoka dau!
Ich bin ein Fleischhauersknecht,
Mach's keinem Madel recht,
Weil ich gleich jede Kuh
Angreifen tu'.
Dös Steigl, wos i gstign bi,
Dös stägö nimma, –
Und dös Deandl, wos ö gliabt ho,
Dös liawö nimma.
Die Trepp' stieg ich auf und ab –
Ich steig' sie nicht mehr;
Das Madl, das ich g'liebt hab' –
Ich lieb' es nicht mehr.
Ös deaftsma koan Wä'brun af
Ma Gro mia sprenga,
Draf wiad o man Beiwl sa
Ogerl hrenga.
Dürft nicht mit Weihbrunn mein
Grab mir einst segnen,
Drauf wird ja des Liebsten
Sein Äugelein regnen.
Ein Teil eines Lanner'schen Walzers überraschte mich jetzt auf der Harmonika.

Er brachte die beste Wirkung unter den Burschen hervor. Man kannte ihn erst seit der letzten Musik im Dorfwirtshause, wo man ihn zum ersten Male hörte. Dieser rief dem Blasenden sogleich noch einen zweiten ins Gedächtnis:

Man sprang und klatschte taktmäßig dazu. Ein kurzes, heftiges Bombardement mit Steinen auf ein nahes Bauerndach folgte. Da man aber eine verweisende Stimme eines Greises aus dem Fenster des nächsten Hauses vernahm, ergriffen alle scherzend die Flucht und kamen so bei jenem ersten östlichen Hause an, wo ich die ersten zwei Burschen fand, von denen einer mittelst der Leiter auf den Balkon stieg, der andere neben dem Reiserhaufen einschlief. Hier setzte man sich rastend auf die Wandbank vor dem Hause (af da Gred). Doch wie eine Schar rastloser Vögel, die sich niedergelassen hat, aber bald hier, bald dort in kleinem Zwiste aufflattert, neckten sich die muntern Burschen, jetzt zwei zu zwei über den Hof, um das Haus sich verfolgend, jetzt versuchend, seinen Nebenmann von der Bank wegzudrängen. Wer nicht mit lärmte, sah lachend zu, oder pfiff mehr gleichgültig eine Melodie. Auf einmal machte ein Lärm auf dem Boden des Hauses alle Burschen ruhig und aufmerksam. Das war der Wortwechsel zweier Männer. Jetzt flogen die Scherben des Bodenfensters klirrend herab und zwischen wilden Donnerworten der Männer tönte eine klagende Weiberstimme. Vom Reisighaufen her stürzte der früher erwähnte Bursch mit der Leiter, setzte diese an den Balkon und rief: »Michl! i bin do, stag owa!« Die Balkontüre sprang auf, eilig heraus kam der Gerufene und fiel mehr die Leiter herunter, als er kletterte. Hinter ihm erschien wild räsonierend der Hausbesitzer. Wissbegierig, obwohl alles ahnend, eilten die Burschen um den Geretteten zusammen. Dieser erzählte, wie es ihm gelungen sei, vor etwa einer halben Stunde die Balkontüre zu öffnen und bis zum Bette des schlafenden Liebchens zu dringen. Der Hausvater, längere Zeit schon argwöhnend, habe unglückseliger Weise die Nacht über aufgepasst und ihn jetzt im höchsten Zorn überrascht. In der folterndsten Verlegenheit habe er dem Hausvater gesagt: »Sats stad, Voda – i bin enga Töd« – (Seid ruhig, Vetter – ich bin euer Pate); aber jener habe wütend geantwortet: »Töd oda Drög!« (Pate oder Dreck) und ihn an der Brust gefasst. Nach einigen Augenblicken des Ringens und Schreiens sei es ihm endlich gelungen, sich loszumachen und zu entkommen. Seine größte Sorge blieb nur um das Mädchen. Als sich aber bald der polternde Hausvater wieder stille verhielt, lachte er selbst mit den Burschen über die Geschichte. – Bei dieser Gelegenheit wurden mehrere ähnliche Abenteuer erzählt, von denen einige hier stehen mögen. – Der eine erzählte, wie er einmal durch das Dach zu seinem Liebchen gelangen wollte. Als er bereits Dachsteine und Schindel beseitigt hatte, habe er beim Einsteigen ein Geräusch gehört und einen Lichtschein von der Stiege herauf verbreiten gesehen. Stutzig darüber habe er sich ganz still gehalten. Aber seine Lage sei höchst peinlich geworden, teils weil er, mit den Händen sich an einen Dachbalken haltend, mit dem übrigen Körper auf den Boden hineinhing, teils weil er den alten, brummigen Hausvater mit einer Laterne die Bodenstiege heraufkommen sah, um eine Mausfalle zu suchen. Dieser kam den Boden kreuz und quer, in jeden Winkel, endlich auch an den Burschen, ohne ihn aber zu bemerken, bis dessen Füße ihm die Mütze vom Kopf streiften. »Lau eiz – wos wa denn dös?« (Ei – was wäre denn das?) sprach der Alte und blickte auf. In diesem Augenblicke wich dem erschrockenen Burschen alle Kraft aus den Händen; diese ließen vom Dachbalken los und der Bursch sprang neben dem Alten herunter, und schlug ihm die Laterne aus den Händen, dass das Licht verlöschte. Der Alte schrie Zeter über Diebe und Mörder, allein bis das aufgelärmte Haus Licht brachte, war der Bursch durch die Bodentüre entkommen. – Ein anderer begleitete einmal seinen Freund nach einem weit entlegenen Dorf, wo dieser sein Liebchen hatte. Gegen Mitternacht kamen sie an, und der verliebte Freund bat seinen Begleiter, bis er heruntersteigen würde, vor dem Hause Wache zu halten. Dieser streckte sich auf einen Holzstoß hin und schlief ein. Nach einigen Stunden kam der verliebte Freund herunter und eilte, ganz seinen Begleiter vergessend, davon, zu sehr des Glückes voll, weil ihn das Liebchen erhört hatte. Der Bursch auf dem Holzstoße schlief fort; – es dämmerte; – es kam das Morgenrot; – es ging die Sonne auf; – der Bursch auf dem Holzstoße schlief fort. Endlich kommt das Liebchen seines Freundes, um Holz zu holen. Der Schläfer fühlt sich gerüttelt und hört erwachend die ängstlichen Worte: »Wenzl! Jessas, bist a du no do?« Um Gotteswillen! bist Du auch noch da, Wenzl? Entsetzt springt der Bursch auf – Heller Tag! – er in schlechten Kleidern! – es ist Sonntag! – zwei volle Stunden bis zu seinem Elternhaus! – welchen Weg er zurückeilen will, überall durch bekannte Orte unter den Augen bekannter Menschen! Was war zu tun? Er musste auf den Heuboden des Hauses, und da den ganzen Tag, heimlich gespeist und getränkt vom Liebchen seines Freundes, in der einsamsten Lage zubringen, bis ihm der einbrechende Abend die Rückkehr gestattete. – Ein Familienvater war seiner Tochter seit längerer Zeit auf der Spur einer Liebschaft. Sie leugnete zwar nicht gerade ihre Liebe, aber den Burschen wollte sie durchaus nicht verraten, weil sie fürchtete, der Vater dürfte vielleicht dem Burschen wegen zu geringer Wohlhabenheit strenge jede Verbindung mit ihr untersagen. Öfters war es dem Vater schon gelungen, den Burschen nachts am Balkon zu erblicken, doch entschlüpfte ihm dieser immer, so oft er Anstalt machte, ihn abzufangen. Vor wenig Tagen erst blieb ihm ein entscheidendes Kennzeichen in den Händen, nämlich der Sonntagshut des Burschen, der ihn beim Entspringen verlor. Nach dieser Entdeckung bedachte der gute, nachsichtsvolle Vater den Fall mit aller Milde der Gesinnung und beschloss, seine Tochter dem Burschen zu geben. Aber einen wunderlichen Einfall wollte er ausgeführt sehen, um doch eine Genugtuung für die Verschwiegenheit der Tochter zu haben. Er ließ am folgenden Morgen das ganze Dorf zusammenkommen und versprach seiner Tochter den Burschen zum Mann, wenn sie auf einer Stange den Hut durch das Dorf tragen und vor aller Augen dem Burschen überreichen würde. Nach vergeblichen Bitten trug das Mädchen endlich wirklich den Hut zum allgemeinen Ergehen der Zuschauer durch das Dorf und überreichte ihn dem Geliebten unter Tränen der Scham und Freude. – Ein Bursch musste bei seinem ersten, schüchternen Versuche, beim Liebchen zu »fensterln«, folgendes Abenteuer bestehen. Er hatte sich schon längere Zeit her genau umgesehen, wo er am leichtesten und sichersten bis zum Bodenloche klettern könnte, durch das er das Mädchen anreden musste. Aber diese Anstalten begünstigten sein Unternehmen das erste Mal nicht, weil er nicht dazukam, sie zu benützen. Indem er nämlich in der bestimmten Nacht gerade daran war, zum Bodenloch zu klettern, vernahm er plötzlich ein eigentümliches Geräusch und die Stimme des etwas ungestümen Hausvaters in der Nähe. Um einen Augenblick unentdeckt zu bleiben, kletterte er wieder eilig herunter, und versteckte sich in den nahen leeren Schweinstall. Allein zu seinem Schreck bemerkte er, dass der kommende Hausvater eben junge Schweine, die er in einem entfernten Dorfe gekauft hatte, nach Hause treibe. Zum Entspringen, ohne sich zu entdecken, war es zu spät, denn schon sprang die Stalltüre auf, und die grunzenden Schweine stürmten wild durch einander hinein. Der Bursch streckte sich der Länge nach in den Futtertrog. Der Hausvater sperrte die Türe ab und schien sich zu entfernen. Halb aufgerichtet horchte der Bursch den sich entfernenden Fußtritten und glaubte aus dem Stalle zu entkommen, wenn der Hausvater in das Haus sich begeben hatte. Allein dessen Schritte näherten sich plötzlich wieder. Ein Geräusch über seinem Haupte erschreckte den Burschen – und im nämlichen Augenblicke goss ein suppenähnlicher Saufraß seine Fluten über ihn nieder. Schnaubend und blasend, wie einer, der bis über die Ohren in einen Sumpf gefallen ist, kollerte der Bursch aus dem Futtertrog heraus unter die hungrigen Schweine, die leckend und nagend über ihn herfielen. Aber jedes andern Hilfsmittels beraubt, musste er seinen Ausweg durch die Türe nehmen, obgleich der Hausvater davor stand. Mächtig erschreckt, wich dieser einige Schritte zurück, als er plötzlich aus dem Schweinstalle einen teig- und wassertriefenden Menschen entspringen sah. Zu spät erholte er sich, den vermeintlichen Dieb zu verfolgen. – Diese und ähnliche Erlebnisse kamen an die Reihe. Als man fortfahren wollte, solche Geschichten zu erzählen, hörte man einen Burschen in der Nähe jauchzen. Sogleich erkannte man ihn und jauchzte ihm entgegen. Der Bursch beeilte sich näher. Seine ersten Worte waren ein Aufruf, ihm zu folgen, wenn man eine komische Szene mit ansehen und hören wolle. Man folgte ihm neugierig. Auf dem Wege erzählte er, wie er seinem künftigen, brummigen, alten Schwiegervater einen kleinen Ärger verursachen wolle, und dass er bereits Anstalten dazu gemacht habe. Der Alte war nämlich ein starrer Ordnungsfreund und etwas geizig. Es war eben Mitternacht, gerade die Stunde, wo er vom Besuch eines alten Nachbars regelmäßig nach Hause ging. Der Bursch hatte ihm auf dem ganzen Wege bis zu seinem Hause Holz gestreut, so dass er immer nach einigen Schritten ein schweres Scheit finden musste. Den Monolog des Alten zu hören, spannte das höchste Interesse der Burschen. Der Alte kam, die Hände überm Rücken, gedankenlos vor sich hinschreitend und dann und wann ein unverständliches Wort brummend. Jetzt stieß er auf das erste Scheit – »Lau, do liegt a Schädl Holz; wea hod dös wieda foloan? Dö Läd gö'mt hold nöd Ocht! Dös is o! Sö ochtnt ninx – dös is! Sö wissnt nöd, wos homant, wenns a Schädl Holz homant – dös is!« (Ei, da liegt ein kleines Scheit Holz; wer hat das wieder verloren? Die Leute geben nicht Acht! Das ist's ja! Sie achten nichts – das ist's! Sie wissen nicht, was sie haben, wenn sie ein kleines Scheit Holz haben – das ist's!) Er hob das Holz auf, trug es wie ein Kind auf dem Arm und räsonierte und klagte und richtete gute Lehren an seine einzige Tochter, obgleich sie zu Hause – – »No lau, do hots ös! Do liegt wieda r oas!« (Nun seht einmal, da haben wir's! Da liegt wieder eins!) Er stand wieder vor einem Scheit Holz. »No, so macht i doch wissn, wos denn dös wa? Wei köma denn zwoa Schäda foluisn, und ninx mirka? deaft o doch da greißt Stean owäfoll'n, so mirkadö dös nöd bössa, wos zwoa Schäda foluisn! – No, i hös af!« (Nun so möcht' ich doch wissen, was denn das wäre? Wie kann man denn zwei Scheite verlieren und nichts merken? Da dürft' doch der größte Stern herunterfallen, so merkt' ich's nicht besser, als zwei Scheite verlieren! – Nun, ich heb's auf!) Er hob's nun auf und setzte seine Lehren an seine Tochter fort, indem er wohl einschärfte, vor allem Schlendrian, Leichtsinn im Hauswesen »No lau, do hots ös!« (Nun so – da habt ihr's!) Er stand vor dem dritten Scheit. »So macht i doch wiss'n – dös kannt o ma Holz a sa! No jo, dös wa 's rächt! Wea – no lau, gits denn koa hoalauß Burscha nöd?« (So möcht' ich doch wissen – das könnte ja mein Holz auch sein? Ja, das war' 's Rechte! Wer – ja nun, gibt's denn kein heilloses Burscher nicht?) »Segsta's, Onnamial? a so mochtma's 'n Lädn, wenn ma ninxnutz is! Dö Lumpn!« – (Siehst Du, Annamirl? Seine Tochter so macht man's den Leuten, wenn man nichtsnutzig ist! Die Lumpen! –) Einige Schritte weiter: »No lau, do hots ös! Sog i's denn nöd? Do liegt scho wieda r oas! 's hots neamad to, wos dös Burschal – i kenn's o, dö Schliffl'n – No lau, do hots ös, do liegt wieda r oas, und durt wieda – jo no – und ma Holz is, do frog i goa nimma! jo derrr – Taifl hots wieda r um ma Hos khod! Jo i seg's scho – i mau ma Töchta häratn lauss'n, sist is koa Hrau – i seg's scho! Da Girgl wiad wol nöd dabä gwöst sa? Dös wa east 's rächt! Dem gawö o sist gean ma Hos und ma Deandl; – owa ea r is nöd daba gwöst!« (Nun da seht – da habt ihr's! Sag' ich's nicht? Da liegt schon wieder eins! 's hat's niemand getan, als das Burscherl – ich kenn' sie ja, die Schelme! – Nun da habt ihr's, da liegt wieder eins! und dort wieder! – ja nun – und mein Holz ist's, da frag' ich gar nicht mehr! ja der Teufel hatte sie wieder da um mein Haus! Ja, ich seh' schon – ich muss meine Tochter Heimchen lassen, sonst ist keine Ruhe – ich seh's schon! Georg geben der Bräutigam seiner Tochter und Urheber der Posse, wird wohl nicht dabei gewesen sein? Das wäre erst 's Rechte! Dem gäbe ich ja sonst wohl mein Haus und mein Mädl; – aber er war nicht dabei!) Die Burschen konnten ihr krampfhaftes Lachen nicht mehr zurückhalten und kollerten im nahen Garten keuchend auf dem Grase herum. Das Finden und gesteigerte Räsonieren des Alten dauerte fort bis zu seinem Hause, und als er das Holz auf den Stoß vor dem Hause gelegt hatte, und einen der Burschen jauchzen hörte, drehte er sich um und rief: »Ho nös nöd gsogt – lau durt gurzt scho oana ra!« (Sagt' ich's nicht? – Dort jauchzt auch wirklich Einer!) – Nachdem sich die Burschen genug belustigt hatten, wurde einer nach dem andern schweigsam. Schlaf überwältigte sie und sie blieben schlafend im Grase des Gartens liegen. Nach Verlauf von einer Stunde erwachten sie wieder, die Mundharmonika machte sie aufgeräumt, aber die wenigsten schienen Lust zu zeigen zum ferneren, gemeinschaftlichen Herumstreifen, sondern die meisten sagten: »Guatö Nocht, Bauma!« (Gute Nacht, Burschen!) und zerstreuten sich hierhin und dorthin. Einer jauchzte, der andere sang:

Ein anderer sang:

Nach einer andern Seite hin pfiff die Mundharmonika:
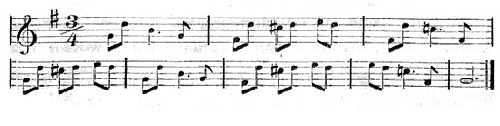
Und diese Melodie erfassend sang ein Bursch folgende Texte
dazu:
Wenn 's Wirthshos d' Kircha wa,
's Deandl da r Oltor,
Und so mächtö a Pfoara sa
Rächt gean zwoa Jor.
War's 's Wirthshaus die Kirche,
Und 's Mädl der Altar,
So möchte ich Pfarrer sein.
Gerne zwei Jahr.
Ma Beiwl leißö nöd,
Leiwa ma Lö'm;
Und so deaftma mä Voda
Koa Haratsguat gö'm.
Mein Bürschlein ließ' ich nicht,
Lieber mein Leben;
Und so dürft' mir mein Vater
Kein Heiratsgut geben.
Ma Hearz is frisch,
I lögs ossa r am Tisch,
Und lau tuif enö gro'm:
O ma Schotz mogst mö ho'm.
Mein Herzlein ist frisch,
Ich leg's her auf den Tisch,
Und lass tief hineingraben:
»Meinen Schatz muss ich haben!«
Hierauf wurde es allseitig ganz still. Einige suchten ihr Bett, die meisten gingen erst »fensterln« oder »a fs Schrä.« Nach einer halben Stunde meldete sich hier und dort noch Einer, pfeifend oder jauchzend und begab sich vom Liebchen weg nach Hause. –-
Howägoas (zusammengesetzt aus Howan – Hafer, und Goas – Ziege, Geis), weil Hafer immer das letzt einzuführende Getreide ist.
Die Auftritte des letzten Erntetages sind nicht selten sehr ergötzlich. Es darf sich nur treffen, dass zwei Hausbesitzer noch gleichviel Getreide einzuführen haben, so kann ein Gefecht um das Leben nicht mit größerer Anstrengung geführt werden, als der Kampf um die Ehre, nicht der Letzte geblieben zu sein. Jeder zahlt Arbeiter, so viele er auftreiben kann, leiht Wagen, Gespann und befeuert durch Bier, Versprechungen, Scherz u.s.f. alles um sich. Die Wagen unter ihren Ladungen knarren und fliegen; die Garben werden ohne Ordnung auf die Tenne der Scheuer geworfen, um sofort eine neue Fahrt beginnen zu können. Die letzte Fuhre, welche die beiden wetteifernden Hauswirte nach Hause führen, gleicht einem römischen Wettrennerwagen in der Laufbahn. Das ganze Dorf wird Zuschauer. Alles jauchzt, treibt an, ermutigt, lacht. Weh! da liegt oft der Wagen des einen umgestürzt, und der Hoffnung beraubt, Sieger zu werden, während der andere nun jubelnd und gemächlich, von seinen Arbeitern umringt, im Triumphe nach Hause zieht. – Der besiegte Hausbesitzer muss sich eine Posse gefallen lassen, welche ihm die Burschen zufügen. In der folgenden Nacht nämlich schleppen diese so viel Stroh zusammen, als sie bekommen können, besteigen in Stille des Bauern flaches Hausdach und setzen da eine ungeheure Strohfigur zusammen in Gestalt einer Ziege, die von einem Ende des Daches zum andern reicht. Auf die Ziege setzen sie einen kolossalen Strohmann, repräsentieren sollend den Hausherrn, in der einen Hand eine Geißel, in der andern einen Knittel haltend. Wenn die Statue völlig aufgestellt ist, bleibt ein Bursch als Wache auf dem Dache zurück, während die andern gegen Tagesanbruch die Dorfbewohner wecken mit den Worten des Spottgedichtes:
Af! Af! segt's – d' Howogoas steit!
Wia homa dö gonz Nocht uis gmeit,
Und goarwat, und kicha und g'füllt,
'n Vät'n af's To affö d' Howagoas gstillt. –
Gschwing af eiz, und schots eng's Wunadia r o,
Sist gogt eng's da Vat, foas To wiad dafo! –
(Auf! Auf! seht – es steht die Hafergeis!
Wir haben die ganze Nacht uns geplagt in Schweiß,
Getan, gekichert und ausgefüllt.
Die Geis dem Veiten aufs Dach gestellt. –
Schnell auf jetzt, und auf das Wundertier geschaut!
Sonst jagt euch's der Veit davon, eh' der Tag graut. –)
Da strömt nun vor Tagesanbruch das Dorf zusammen, um ringt lachend und lärmend das Haus, mit dem Wundertier auf dem Kopfe, und verlässt es nicht, bis der Hausherr zum allgemeinen Ergötzen mit seinen Knechten die Zerstörung der Ziege beginnt, und deren Reiter vernichtet, unter Zuruf der Menge:
Wea nöd afsteit und oarwat und gogt,
Dea wiad, mirk da's, mit da Howagoas plogt!
(W er nicht aufsteht und strebet und jagt,
Der wird, merk' Dir's, mit der Hafergeis 'plagt!)
Ergötzliche Szenen veranlasst der Fasching in einem deutschen Dorfe. Jedermann erlaubt sich einen unschädlichen Scherz und ist gewiss, dass er nicht missverstanden und übel aufgenommen wird. – Ein junger Dorfbursch nimmt einen Geiger, durchzieht mit Musik das Dorf, durchstöbert Stuben und Stübchen, alle uralten Mütterlein, die gesund und noch heiter sind, hervorholend, die ihm auch lachend und scherzend folgen, unter großem Zulauf des Volkes. Hat er sie beisammen, so beginnt er allerlei Streiche auszuführen. – Ich sah einst zu, wie ein solcher Bursch im tiefen Schnee eine Bahn kehrte und die Mütterlein aufforderte, ihm zu folgen. Das taten sie auch. Plötzlich hielt er inne und begann mit einem Mütterlein im Schnee einen Tanz; allein wie groß war ihr Schrecken, als sie unter ihren Füßen Glatteis fühlte, und sich dem mutwilligen Burschen nicht entwehren konnte, der absichtlich lustige Sprünge machte. Seinem Beispiel folgten alle übrigen herumstehenden Burschen, und es begann unter großem Gelächter der Zuschauer der Tanz des vorigen Jahrhunderts mit dem jüngsten allgemein zu werden. Für die erlittene Angst wurden hierauf die Mütterlein durch eine gute Schmauserei entschädigt. Abends sitzt oft eine Familie ruhig im Gespräch in der warmen Stube um einen Tisch, da beginnt es plötzlich draußen zu klirren und poltern, und ein scheußliches Gesicht schaut zum Fenster herein; drauf daneben noch eins, ein drittes, und in Kurzem ist das Fenster über und unter dem ersten voll Fratzen. Die Kinder flüchten in einen Winkel, während ein Gepolter an der Haustüre Einlass begehrt und Musik erschallt. Ein Maskenzug tritt ein. Um aber eine Anschauung solcher Verkappungen zu geben, will ich eine männliche und eine weibliche Maske beschreiben. Erstere hat eine ungeheure, aus Stroh geflochtene Bischofshaube oder einen Kopfpolster mit Sturmband auf dem Kopfe, und um das Kinn befestigt. Statt der Larve beschmiert man sich das Gesicht mit Eierweiß und bläst dann mit hineingehaltenem Antlitz in einen Mehlkasten, so dass ein Mehlteig dasselbe überzieht und unkenntlich macht. Dazu nimmt er ein Hemd über die gewöhnliche Kleidung. – Die Weibermaske hat einen ungeheuren Kittel aus Flachswerg, aus demselben Stoffe eine Brust von erstaunlichem Umfang, und aus Stricken eine Lockenperrücke. Eine weibliche Maske wird immer durch einen großen Dorfburschen vorgestellt. Beginnt ein Tanz, so wählt sich dieser die kleinste Männermaske, der mit seinem Kopfe unter ihrem Busen wie unter einem weit vorspringenden Felsenhange steht. Die lächerliche Komposition eines solchen Paares wird dadurch erhöht, dass die Tänzerin ihren Tänzer unter der Brust an beiden Ohren fasst. Man pflegt auch manche lächerliche Gewohnheiten in Tracht und Gebärden alter Männer und Weiber nachzuäffen, und gerade da, wo die Verspotteten gegenwärtig sind. Diese lachen dann am meisten selbst über ihren Doppelgänger. – Großen Spaß verursacht ein Maskenzug um oder nach Mitternacht. An einer Haustüre wird leise geklopft, und eine Stimme fleht um Einlass. Der arglose Bauer eilt im Hemde, den vermeintlichen Wanderer einzulassen. Wie er aber die Türe öffnet, erblickt er einen Schwarm Masken, und es fällt auf ihn der Lichtschein vieler Laternen. Der geschämige Mann will der Beleuchtung entgehen, fühlt sich aber schon ergriffen, und muss in der Stube einen Tanz in seinem einfachsten Kostüme mitmachen. Indem hat sein Weib den Lärm richtig erklärt, und schaut kichernd und verlegen durch die etwas geöffnete Kammertüre zu, wie ihr behemdeter Gespons zu den entsetzlichsten Sprüngen veranlasst ist. Um aber kein Ärgernis zu geben, darf nie ein Kind zugegen und der maskierte Bursch nicht unter achtzehn Jahre alt sein. Gewöhnlich führen eine solche Szene nur Männer aus, um einen brummigen Phlegmatiker zum Tanz zu bringen. Allein wenn ihm dieser auch eine Tortur ist, so fühlt er sich durch den zugefügten Streich doch nicht beleidigt. – Es herrscht während des Faschings lebhaft die Sucht, irgendeine Überraschung, einen Scherz, einen kleinen Schrecken in oder außer dem eigenen Hause zu veranstalten, daher auch der Vater vor dem Sohne, der Knecht vor seinem Herrn, kurz niemand vor einem anderen behutsam genug sein kann. – Einst traf ich eine Familie samt Knecht und Mägden beim Abendessen. Man war arglos und aufgeräumt. Die erste Magd, welche den neben ihr aufgesteckten Span, dass er hell und ohne Rauch brenne, bald zu heben, zu senken oder umzuwenden, und in die unterstellte Wasserwanne abzuräuspern hatte, löschte durch scheinbares Ungeschick plötzlich das Licht aus, indem sie den Span ganz aus der Klemme in die Wanne hinabstieß. Sie ging in die Küche, um aus dem Ofen Licht zu holen; beim Hereinkommen hielt sie die Hand vor das Licht, so dass Schatten auf die Stelle fiel, wo die Knechte saßen, und als sie an den Tisch kam, entfernte sie plötzlich die Hand vom Lichte. Mit einem Schrei stoben Weiber und Kinder vom Tische weg – denn eine entsetzliche Maske saß zwischen den Knechten. Die Männer blieben ruhig und aßen von der guten Mehlspeise, die man eben vorgesetzt hatte, in Gesellschaft der Maske fort, ohne diese bemerken zu scheinen, während diese jeden Versuch der Weiber, dem Tische zu nahen, durch Auffahren und Grimassen vereitelte und Geschrei und Gelachter nicht wenig vermehrte. In der Maske aber stak der junge Nachbarsohn, dem man die gute Mehlspeise angerühmt hatte, welche für den Abend auf den Tisch kommen sollte. Durch Neckereien, von dem Genusse ausgeschlossen zu sein, im Stillen veranlasst, verabredete er mit den Knechten und der lichtbesorgenden Magd heimlich das Einverständnis, huschte vor dem Nachtessen ungesehen in die Stube und unter den Speisetisch, nur das Auslöschen des Lichtes erwartend, um hervorzutauchen und gleich einem Gespenste unerwartet zwischen den Knechten dazusitzen. – Der Argwohn, der zur Faschingszeit überall eine Posse sucht, ist oft selbst an einem lächerlichen Auftritte schuld. Tritt zum Beispiel ein Bettler in die Stube, so besieht ihn die Bäuerin mit bedächtig prüfenden Augen, zögert mit der Gabe (denn es könnte der schelmische Nachbar sein), und umgeht ihn mit der Miene des Zweifels und Glaubens, indem sie verlegen lächelt, nicht gerne sich täuschen ließe, und gern doch, wenn es ein wirklicher Bettler wäre, die Gabe nicht versagte. – »Maiz! – Maiz! Globt's i kenn' eng nöd? Dau no wög 'n Haud – bist's scho, den i moi! – Mö denn nöd? Ahm! Mö denn nöd? A Stickal Broud kost o ho'm! – Jekassl! Du kantst ma gstoll'n wean! Eiz gei bol! No, wos is denn? Do hots a Broud – dös hod da Gschboas foteit.«– (Geht! – – Geht! Glaubt ihr, ich kenn' euch nicht? Tu' nur weg den Hut – bist schon, den ich meine! – Warum denn nicht? Hm! Warum denn nicht? Ein kleines Stück Brot kannst ja haben! – Ei! Du könnt'st mir gestohlen werden! Jetzt geh' bald! Nun, was ist's auch? Da habt ihr Brot – das hat der Spaß verdient.) Der Bettler starrt die Redende an, und weiß keine Erklärung für solche Ansprache, als dass die Bäuerin eine Närrin sei. Kichernd aber haben ihr die andern Hausbewohner zugehört und stürmen endlich unter lautem Gelächter herbei. Viel teilt folgendes Volksgedicht über den Karneval in wenigen Zeilen mit:
Wea kant so im Foschen dakenna?
Au! d' Mona und Bauma san Noarn!
Segt's durtn an Maschkara hrenna?
Und heat's ös dz Nocht pauß'n und schoarn?
Durt springant's foa d' Tia hi und kearnt,
Durt hupfant's vol Zris um und mearnt,
Durt segtma dur d' Fenzaschä'm hröka
A Loarfagfris, dös uis möcht schröka –
Ui! Hosna r und Kidln, dem Taifl z'schlächt.
San doch füar an Maschkra no rächt.
(Wer könnt' sich im Fasching auskennen?
Seht! Männer und Burschen sind Narrn!
Seht ihr jene Maske dort rennen?
Und hört sie nachts pochen und scharrn?
Vor Türen hinspringend schreien sie Zeter,
Ganz Lumpen und Fetzen erregen sie Wetter,
Dort sieht man durch Fenster sich strecken
Eine Larvenfratze, die uns möcht' schrecken –
Ah! Hosen und Kittel, dem Teufel zu schlecht,
Sind doch einer Maske noch recht!)
An den Faschingsfeiertagen ist ordentlicher Tanz, bisweilen von Masken unterbrochen. Oft geschieht es selbst, dass mehrere maskierte Burschen auf einem Pferde in die Wirtsstube reiten gleich den sieben Haimonskindern und die Mädchen von einem Stubenwinkel in den andern jagen. – Am Faschingdienstage gebührt den Mädchen die Oberhand. Sie wählen selbst ihre Tänzer und zahlen Musik und Getränk. Ihre Geldsteuer wird folgendermaßen erpresst. Man stellt einen Sessel inmitten der Tanzstube, darauf einen Teller. Jeder Bursch ergreift eine Tänzerin und tanzt um den Stuhl, bleibt dann vor demselben mit ihr stehen, und fordert Geld. Der erste Aufruf wird ohne Weigern befolgt; allein der Bursch drängt wiederholt und so stürmend, bis er bei reicheren Mädchen oft zwei Gulden C. M. herausgelockt hat. Wenn das Geld gesammelt ist, wird davon die Musik gezahlt, Getränke gekauft (mehr Branntwein als Bier) und jeder Gegenwärtige damit bewirtet. – Überdies findet man in einzelnen Ortschaften auch noch besondere und verschiedene Bräuche, z. B. dass am Fasching-Dienstage jedes Liebchen irgendein gutes Mehlgebäck (a »Wakerl« – oder »an mir'n Zältn« – »Flöckn« – »Keichal« o. a. dgl.) in Bereitschaft halten muss, um damit den Liebsten, der sie zum Biere führt, daselbst zu beschenken. So bleibt wohl im Allgemeinen der Geist der Faschings-Unterhaltungen überall und jährlich derselbe, und nur im Einzelnen trifft man nach Verschiedenheit der heitern Einfälle verschiedene Szenen der Unterhaltung während des Landkarnevals am Böhmerwalde. –
Das beliebteste Fest im Jahre ist das Kirchweihfest. Drei Nachmittage und Nächte nach einander wird getanzt; Jedermann muss da, wenn nicht ganz, doch größten Teils neu gekleidet sein; die Küche versorgt den Tisch mit verschwenderischer Fülle; überall lärmt Freude und ländliches Glück. Wie zu den Pfingstfeiertagen Kuchen (Keichal), zu Ostern gefärbte Eier (hraudö Oia) an der Ordnung sind, so bäckt man zur Kirchweih sogenannte »Flöck'n« – d. i. Brote, die an Umfang einem großen Teller gleichen, an Dicke nicht 14 Zoll überschreiten und auf der Oberfläche mit Lebzelten, Mandeln, Weinbeeren ect. bedeckt sind. Über den Kirda sprechen sich folgende Verse eines Volksgedichtes am genügendsten aus:
»Heargotl! wei is am Kirda so schei,
Wiad 'n gonzn To gössn, gurzt und gsunga,
Deaf ma dra Ta zön Spiellädn gei,
Is zo koan Schloffar und Orbatn zwunga,
Is eng an Neidn sa Gwonta r east nui,
Glonznt eng d' Stroßn – ö jekkassl ui! –
Doss du foa Stroßn koan Haud nöd sagst,
Standst a foan Haud durt'n znagst.
Kirda! r o Kirda! wei homa dö gean,
Wei weama no dia so traorö wean!
's Gwonta wiad zrissn sa, d' Flöckn san nimma,
Hearma wei long koan Spielmo mea stimma.« –
(Herrgottlein! wie ist die Kirchweih so schön,
Wird den ganzen Tag 'gessen, g'jauchzt und gesungen.
Darf man drei Tag' zu den Spielleuten geh'n,
Ist nicht zu Schlaf und zur Arbeit gezwungen,
Sind eines jeden Kleider erst neu,
Glänzen die Sträuße – o jemine ei! –-
Dass man vor Strauß den Hut nicht sehen kann,
Stündest Du auch dem Hut zu nächsten.
Kirchweih! o Kirchweih! wie lieben wir dich,
Bist du vorüber, wie betrübt man sich!
's Kleid wird zerrissen sein, d' »Flöckn« sind hin,
Kommt's Stimmen wie lang keinem Spielmann in Sinn! –)
Jeder Bursch bekommt von seinem Liebchen einen Rosmarinstrauß, dessen Zweige mit Flittergold, silbernem Zitterdraht, kleinen Täubchen ect. geschmückt sind. Der Strauß wird quer um die Rundung des Hutes herum befestigt. Die drei Festtage hindurch prangt der Bursch damit auf dem Kirchengange und bei der Musik. – Am Kirchweih-Montage haben die Männer in der Tanzstube vor den Burschen die Oberhand und führen das große Wort. Am Dienstage wird der etwas barbarische Hahnenschlag gehalten. Es ist nämlich Sitte, an diesem Tage durch das Dorf mit Musik zu ziehen, in jedem Bauernhofe einzukehren, ein wenig da zu tanzen, und hierauf von der Wirtin mit Bier und den erwähnten »Flöckn« traktiert zu werden. Zu dem Ende hat jede Hausfrau auf dem großen Ecktische einige solche »Flockn« in gleiche Stücke geschnitten, die bestimmt sind zum augenblicklichen Genuss. Außerdem aber sammelt ein Bursch noch eifrig in einen Tragkorb. Besitzt nun ein Haus einen schönen, fetten Hahn, so wird dieser während der Flöcknverteilung heimlich eingefangen und, nach geendigter Runde durch das Dorf, an einer langen Schnur am Fuße befestiget und das entgegengesetzte Ende der Schnur an einen Baum oder sonstigen unbeweglichen Gegenstand gebunden. Man verbindet einem Burschen nach dem andern die Augen, gibt ihm einen Dreschflegel (a Drischl) in die Hand, worauf er an der Schnur mit den Füßen fortfühlt, bis er dem Schreien des hin und her flatternden Hahnes und der Kürze der Schnur nach schließt, wie er mit einem Schlage den Hahn töten könne. Der Bursch, dem der Hahn erlag, hat dann bei der Verspeisung des gekochten Hahnes und der »Flöckn« den Vorsitz. Die Musikanten sind dazu geladen. –
Mägden wird außer dem Geldlohne das Erträgnis eines bestimmten Stückes Feld an Flachs zugewiesen. Saat und Pflege besorgt der betreffende Hausvater. Kommt aber die Zeit, wo der Flachs aus dem Boden zu raufen, ('s Floxraffa), vom Samen zu befreien ('s Floxriff'ln), zur nötigen Dörrung auf ein Stoppelfeld oder eine Wiese auszubreiten ('s Flöxbroit'n), einzudörren im Ofen und dann zu brechen ist ('s Dirrn und 's Bracha), so bleibt die Verrichtung dieser Geschäfte ganz den Mägden überlassen. Dazu reicht aber die Tageszeit nicht aus, welche der Hausherr ganz in Anspruch nehmen muss. Dieser Übelstand, nach den schwersten Tagesanstrengungen auch die Nacht hindurch ohne Ruhe und Rast arbeiten zu müssen, wird aber durch eine erheiternde Sitte nicht nur gehoben, sondern zu einem jedesmaligen Feste. Die Magd, welche eine Nacht für die genannten Arbeiten benützen will, ladet alle andern Mägde des Dorfes zur Hilfe ein; diesem Rufe folgen nicht nur diese, sondern auch alle Töchter der Hausbesitzer. Sobald diese Mädchenschar das Feld erreicht hat, und an das Geschäft geschritten ist, beginnen sie im vollen Chore Gesang. Dieser ist kaum angestimmt, so lassen sich erst einzeln, bald von allen Seiten des Dorfes her jauchzende und singende Burschen hören. Sie versammeln und bewaffnen sich und ziehen zum Felde als Bedeckungskorps der Mädchen hinaus. Daselbst aber ist es keinem erlaubt, das Feld zu betreten. Daher lagern sich die Burschen am Rain vor das Feld, zünden Wachfeuer an und singen nach ihrer Art Kriegslieder, denen die Mädchen schäkernd erwidern. Burschengesang:
Sakra, wea tad sö dro,
Rüarat uis d' Deandla r o?
Dös wa koa kloana Gschboas –
Dem wearat hoas!!
Mädchen drauf:
Hrennats wol all dafo,
Kam no da bluadö Mo!
Dös wa da rächtö Gschboas –
Wearat eng hoas?
Burschen.
Kennt ma ruis Leidla r af,
Mochma Soldot'n-Straf;
As deaf uns koa frema Bua
Zon Deandl'n dazua.
Mädchen.
Kaments no, wa scho recht!
Schmozatma, tadma recht!
Doss eng fodruiß'n meid,
Brenna wei's Leid.
Ähnliche Lieder werden neckend fortgesetzt. In Zwischenpausen des Gesanges erzählt ein Bursch eine schauervolle Gespenster- oder Teufelsgeschichte laut, dass man sie allgemein hören kann; je greller, umso lieber. Geschichte und Nacht wirken tüchtig auf die Nerven, und das absichtliche, seltsame Pfeifen, Knurren, Quietschen, Murren und Keuchen der Burschen während der Erzählung, die dazu Gelegenheit hinlänglich darbietet, würzt die abenteuerliche Sagenspeise. Bei den schauerlichsten Stellen, wo von den Wachfeuern jede erhellende Flamme unterdrückt und das Grässlichste aufgeboten wird, ist es eine sehr erleichternde Wohltat für die Mädchen, ohrzerreißend aufzuschreien. Hierauf verjagt der erste Scherz wieder elektrisch rasch alle Angst, und wenn Burschen und Mädchen einige Zeit aus der Entfernung zu und durch einander konversiert haben, erheitert wieder Gesang.
Ist der Flachs aus dem Boden, so wird ein Wagen geholt. Mittelst Laternen bindet man Garben, welche die Mädchen bis zum Rain tragen und den Burschen zuwerfen können, ohne ihnen ganz nahe zu kommen. Ist aufgeladen, so leitet ein Bursch den Wagen fort, die Mädchen umringen ihn singend, und in einiger Entfernung folgen die jubelnden Burschen. Zu Hause wird in eine Scheune der Flachs abgeladen, aber nur von den Burschen, während die Mädchen ruhend sich um die Scheune lagern, wie wachhabende Amazonen, und den Burschen die nun für sie beginnende Arbeit des Abstreifens des Flachssamens mittelst Eisenkämmen angenehm machen durch Gesang. – Die folgende Nacht kommen wohl alle Mädchen wieder, aber es darf nur ein erwählter Bursch erscheinen, um den Flachs hinauszuführen auf das Stoppelfeld oder die Wiese, wo dieser ausgebreitet wird. Beim späteren Brechen des Flachses erscheinen wieder alle Mädchen und alle Burschen, letztere in einem Umkreis um die ersteren sich lagernd. – So hat die Sitte für Unterhaltung, Sittlichkeit und Erleichterung der Mühen und Plagen gesorgt.
Am Tage, wo man mit dem Dreschen des Getreides zu Ende kommt, feiert man einen großen Schmaus. – Sind die letzten Garben auf die Tenne gelegt und gehörig leer gedroschen, so stürzen die Drescher aus der Scheuer nach einem etwa hundert Schritte entfernt liegenden Brett, worauf sie taktmäßig wie auf Stroh mit ihren Dreschflegeln schlagen. Auf ein Zeichen eilen alle, nachdem jeder seinen regelmäßigen Schlag noch geführt hat, zurück in die Scheuer unter Schreien und Lachen, binden in aller Eile das letzte auf der Tenne liegende Stroh zu Garben, und wer der Unbeholfenste und Letzte ist mit Zustandebringung seiner Aufgabe, der muss den ganzen folgenden Tag und während des festlichen Abends die Zielscheibe alles Scherzes sein. Spottnamen regnen über ihn her.
– Indes siedet und brät die Hausfrau beinahe den ganzen Tag, und so viel sich aus Mehlkasten, Schmalztiegel, Rahm, Milch, Obst, Käse, Geflügel – kurz aus ländlicher Hauswirtschaft herausformen lässt für eine reichliche Tafel, wird und muss bei dieser Gelegenheit erscheinen. Mit einbrechender Nacht beginnt der Schmaus, und die Freude streift fast an Ausgelassenheit, wenn noch dazu reichlich gutes Bier herumgereicht wird. Die Hausfrau schickt wohlangefüllte Teller den Freunden und Nachbarn ins Haus. Die Jugend des Dorfes kommt aber »af 's Ofaschüsslhröka«. – Plötzlich rückt nämlich ein Teller oder eine Pfanne von außen auf das Fenster, und eine Hand zieht sich zurück »A Gost! A Gost!« rufen die Schmausenden im Zimmer. Das Geschirr wird hereingenommen, mit Speisen gefüllt und wieder hinausgestellt. Die Hand kommt sachte wieder und holt die Gabe weg. Will sich der Empfänger kennen lassen, so springt er herum vor dem Fenster unter freudigem Ausruf:
»Tira! Tira! Juch eissa! Tiradö!
Ho Keichal, Nudl – owa koan Hradö.
Da Hoistöffl-Girgl is eng donkbala gsinnt,
Ea r isst, doss eam da Sof t vom Meal owahrinnt. –
(Tira! Tira! Jucheissa! Tirade!
Hab' Kuchen, Nudl – doch keinen Rettich.
Hanssteffen-Görg
Hier nennt jeder seinen eigenen Namen. ist euch dankbar gesinnt,
Und isst, dass vom Mund ihm das Fett hinab rinnt!)
Hat ein Bursch kein Geschirr bei sich, so stellt er gewöhnlich nur seine kleine lederne Wirbelmütze auf das Fenster. Wird die Mütze erkannt und der Eigentümer taugt für einen Spaß, so gießt ihm die Hauswirthin zuerst Zwetschkenröster in die Mütze, legt darauf erst Liwanzen, Kuchen, Semmelschnitten u. dgl. – Einen Spaßvogel, dem diese Posse bei solcher Gelegenheit geschah, hörte ich einmal folgendes Selbstgespräch führen. Er hatte sich mit seiner speiseschweren Ledermütze in den nahen Garten geflüchtet, um ungestört essen zu können. »Himml is dös a 'n Öss'n!« begann er; »dea Keichal – jekkassl, wer guat! Kant mö dadroßln dron! Jessas! a Hrivanzö a daba! – Wei gschmolzn dea wieda r is! – Au – a Semmlschnidl – Holt! Sakra! Sakara! wös kimt denn do füra Matscht?« »Himmel, ist das ein Essen!« begann er – »dieser Kuchen – ach, wie gut! Könnt' mich ersticken damit! Jesus! Liwanzen auch dabei! – Wie schmalzig der wieder ist! – Sieh da! eine Semmelschnitte Halt! Teufel! Alle Teufel, was kommt denn drunter für ein Matsch?«) – Dabei ließ er die Mütze fallen, denn er hatte in den Zwetschkenröster gegriffen. – Ähnliche Festabende feiert man nach Beendigung der Ernte; und wenn man mit dem Brechen des Flachses zu Ende kam; letzteres heißt: »Dar olt Mo.« – – – –
Einige Tage vor dem ersten Mai macht der Dorfhirte die Runde in allen Bauernhöfen, mit einer Feile versehen, und fromm gerüstet mit erbaulichen Kraftgebeten. Er wird in jedem Hause mit einer Art Hochachtung diesmal empfangen und bewirtet, worauf er an sein Geschäft geht, welches ihn herführte. Er verlangt den Stall und die Rinder zu sehen. Der Hauseigentümer öffnet, und der Hirt betritt mit entblößtem Kopf die Schwelle, wo er stehen bleibt und die frommen Grußworte spricht:
»Pfeits Got! dö Kalwla, Öxla, Hrößla ollö,
Dö Haißla, Schaffla, weis do san,
Wenn Äbba schödn wollt, strof den Lollö,
Mia wiss'n o, doss d' Läd gean nädö han.«
(B'hüt' Gott! die Kälber, Öchslein, Rösslein alle,
Die Füllen, Schäflein, wie sie da sind,
Wenn jemand schaden wollt', o straf den Lümmel,
Wir wissen ja, dass die Leut' gern neidisch sind.)
Hierauf nimmt er die Feile, stumpft damit die während des Winters sehr scharf gewordenen Hornspitzen der Rinder, und untersucht als praktischer Tierarzt die Gesundheit jedes einzelnen. Nach dieser Operation wird Weihwasser durch die Räume des Stalles gesprengt. Indes haben sich Zuschauer und Zuhörer vor dem Hause gesammelt, die begierig den Augenblick erwarten, bis der Hausvater seine Herde Stück für Stück heraus- und vorführt, um die Anwesenden über seine Zucht während des Winters urteilen zu lassen. Der Gegenstand kommt unter den Versammelten mit großer Lebhaftigkeit zur Sprache. –
Am ersten Mai gibt es schon um die Zeit des Sonnenaufganges lärmende Bewegung in dem Dorfe. Jeder Hausvater lässt seine Herde vor das Haus treiben, damit sie die erste Freude der Befreiung von Ketten austoben könne. Das Läuten der Halsglocken und »Hrölln« Blecherne Kugeln mit zwei kleinen Rundöffnungen, worin sich einige runde Steine befinden, die bei jeder Erschütterung durch Hin- und Herrollen ein Getöse erregen. erfüllt die Luft, vermengt mit lustigem Blöken der Rinder und Meckern der Schafe und dem Zuruf der aufsichtführenden Dorfbewohner. Von diesen führt jeder eine »geweihte Rute« in der Hand, die aus einer Birkengerte besteht, welche gegen das Ende mit einem Strauß aus am Palmsonntage geweihten Palmzweigen, wilden Staudenfrüchten (Hoawuzl ect.) und Blumen geschmückt ist. Der Glaube schreibt diesen »heiligen Ruten« eine wunderbare, schiedsrichterliche Kraft zur Trennung des kämpfenden Hornviehes zu. Auch soll der Schlag mit solcher Rute das ganze Jahr ein Haustier vor tödlicher Verwundung schützen. Um sechs Uhr früh findet sich der Hirt des Dorfes vor dem letzten Hause ein. Sein erstes Ankündigungszeichen sind drei Stöße in ein langes Rohr aus Baumrinden. Auf dieses Zeichen ertönt allseitig der Ruf: »In Gotts Nom, da Heita träbt os!« (In Gottes Namen, der Hirte treibt aus!) Jetzt werden die Schafe dem daher treibenden jungen Hirten zugejagt. Kaum hat dieser mit der Schafherde das Dorf verlassen, so knallt von demselben Platze, wo früher die Rohrtöne klangen, ein kurzer, aber starker Patschntusch. Nun beginnt ein Treiben, ein Wehren und Trennen, Geschrei von Manschen und Brüllen der kämpfenden Rinder. Hier muss ein wütender Stier gebändigt, dort zwei bereits im Kampf begriffene Kühe getrennt und hier wieder der Ausbruch eines Kampfes verhindert werden. Die wildbewegte Herde wird bunt durchkreuzt von den friedestiftenden Dorfbewohnern, und die heiligen Ruten durchfechten rauschend die Luft. Erst nach und nach verlieren sich die Dorfbewohner aus der Herde und überlassen die fernere Wache dem Hirten. Ein Schauspiel fesselt nun die Gegenwärtigen. Unter der Herde befinden sich zwei gewaltige Gemeinde-Stiere (Bummln), welche jährlich abwechselnd zwei andere Hausbesitzer zu nähren verpflichtet sind. Die zwei Stiere werden jetzt zum Zweikampf gereizt. Er ist oft anhaltend und blutig. Den Sieger nennt man den König der Herde. Der Zweikampf wiederholt sich an demselben und folgenden Tage noch häufig. Der Eigentümer des Siegers tut sich in seiner Freude nicht wenig zu Gute. –
Am Vorabend der Christnacht belebt man die Phantasie der Kinder mit einem lieben, frommen Bilde vom Christuskindlein und dessen Wirken. Man sagt, es komme da alljährlich mit den ersten Dämmerungen der Heiligen Nacht Christus als verklärtes Kindlein durch die Luft, sitzend in einem kleinen, goldenen Wagen, gezogen von zwei weißen, mutigen Pferdlein. Fromme Sonntagskinder oder auch vorzüglich begnadigte und gute seien so glücklich, die Erscheinung zu sehen. Die Milde des kleinen verklärten Christus soll unbeschreiblich sein. Die Pferdlein, über jede Vorstellung edel gebaut, sollen verständig sein wie Menschen und so lieblich mit einander plaudern während ihres Trabes durch die Luft, dass man lange danach, wenn man so glücklich war, sie reden zu hören, die schönste Musik vor irdischer Rauheit nicht anhören kann. Die Zähne der Pferdlein beschreibt man wie vom schönsten Elfenbein geformt. Das wunderbare Gebiss sei aus dem feinsten Gold, die Zügel zwei Sonnenstrahlen, die Hufe mit Kronengold beschlagen, deren Auftreten, wie das Bewegen der Wagenräder harmonisch klingend die dadurch geweihten Luftteilchen zermalme. Im Wagen befände sich (in jenen Gegenden vorkommendes, wachsendes oder kaufbares) Obst: Äpfel, Birnen, Nüsse, Feigen, Mandeln, Rosinen usw. nebst dem besten, bekannten Gebäck. Diese den Dorfkindern unschätzbaren Sachen seien für gute Kinder als Geschenke in kommender Christmitternacht bestimmt, wo Himmel und Erde des Jesuskindleins Geburtsandenken feiern. Aber auch Ruten, Erbsen, Schwarzbrot usw. enthalte der Wagen für unfolgsame, schlimme Kinder. Und so komme denn der kindliche Heiland schon in den ersten Dämmerungen der Heiligen Nacht, um sich anzukündigen bei guten und schlimmen Kindern. Deshalb muss um diese Stunden alles ruhig und andächtig sein im Haus, wo möglich versammelt in der Stube; die Kinder aber, gekleidet wie am wichtigsten Festtage, müssen ihre Gebete, so viel sie auswendig wissen, laut hersagen, kniend, wenn sie erwachsener, auf dem Elternschoße sitzend, wenn sie noch klein und zart sind. Bei der Annäherung des Christkindleins, belehrt man die gläubigen Kleinen, entfliehen alle bösen Dinge aus dem Hause, in welchem Winkel oder Gegenstände sie verborgen sein mögen, daher, wenn alles still und andächtig horcht, man Tische und Kasten leise schnalzen, das Licht knistern hört und wanken sieht, als ob ein Luftzug die ausgestoßenen bösen Geister durch alle Öffnungen und Spalte n des Hauses wehe; die Fenster laufen leicht an, und ein wunderbares Summen, Rauschen, Singen und Klingen werde Begnadigten hörbar, das sich so lange verstärkt, bis es alle hören können, wo es endlich zum Ton einer kleinen Glocke geworden sei. Dieser Schall deute an, das Christkindlein steige aus dem goldenen Wagen, lasse die Pferdlein rasten, und wolle den Kindern andeuten, welche Geschenke es die Nacht austeilen werde. Diesem frommen Märchen zu Liebe kaufen die Mütter Geschenke, welche sie sorgfältig vor den Augen der Kinder verbergen, beauftragen jemand, der in der Familie nicht leicht vermisst wird, dass er im Augenblicke, wo das Christkindlein sich melden soll, vor der Stubentüre mit einem Glöcklein zwei- bis dreimal klingle, dann die Türe so weit öffne, dass er mit einer Hand, die mit Goldpapier überklebt ist, die bestimmten Geschenke hineinwerfen könne. Wie das Glöcklein vor der Stubentüre zu klingeln beginnt, fangen die Kinder an, so laut als möglich zu beten. Die vermeinte Nähe des Christkindleins regt eine Art heiliger Begeisterung in den Kindern an, vermengt mit der Begierde, die goldene Hand zu sehen, und die Geschenke aufzufangen. Nun erscheint dann einige Male die goldene Hand und wirft Fluten von Geschenken herein, wonach die losgelassenen Kinder mit dem Jubelruf des Entzückens stürzen und nach Möglichkeit viel zu erhaschen suchen. Wehe aber, wenn eine kleine Rute oder Erbsen oder ein Stücklein Brot mit hereinfliegt. Entsetzt und weinend weichen die Kinder zurück.
Mit dem einen oder andern muss das Christkindlein nicht zufrieden sein, und wird also, wenn es um Mitternacht zurückkommt, dem Gemeinten eine Rute, Erbsen und Brot in den Geschenkteller legen. Die Rute bedeutet, dass das schlimme Kind Züchtigung verdiene; Erbsen sollen gebraucht werden, um das Kind bei Ungezogenheiten darauf knien zu lassen, und das Brot, dass es am Tage solcher Vergehen nur Brot solle zu essen bekommen. Kinder, die zu klein sind, um am Boden von den hereingeworfenen Geschenken etwas wegzuhaschen, werden von der Mutter beteilt, indem diese vorgeblich nachsieht, ob das Christkindlein für die Kleinen in der Kammer oder auf dem Boden besondere Geschenke zurückgelassen habe, die sie denn wirklich auch immer findet. – Vor dem Schlafengehen stellt jedes Kind auf einen Tisch in der Schlafkammer seinen Teller, um Christkindleins Geschenke darin am andern Morgen zu finden. In solcher Christnacht erinnere ich mich, dass ich einmal, von dem Märchen fantastisch aufgeregt, nicht schlafen konnte, und in frommer Begeisterung das Erscheinen des Geschenke bringenden Jesuskindes abwarten wollte. Gegen Mitternacht hörte ich eine Türe leise knarren und richtete mich ein wenig auf, um zu sehen, ob das Christkindlein kommen werde. Ein Lichtschein, der aus der Nebenkammer fiel, wohin die eben sich öffnende Türe führte, machte, dass mein Herz in ängstlich froher Hast zu klopfen begann, denn ich meinte den heiligen Nimbus Christi zu sehen. Allein gleich darauf schlich meine Mutter heraus, ein Licht in der Hand und einen Korb am Arme. Mit leiser Stimme rief ich: »Muadarl, is 's Kristkindl do gwöst?« Verlegen und ohne zu antworten, zog sich die Mutter schnell in die Nebenkammer zurück und machte die Türe wieder zu. Ich konnte hören, wie sie drinnen mit dem Vater leise sprach und kicherte. Aber ohne weiter ein Geräusch zu machen, legte ich mich wieder zurück und glaubte, die Mutter sei herausgekommen, um das Christkindlein zu sehen und zu sprechen. Ungefähr nach einer Viertelstunde hörte ich die Türe wieder knarren, der Lichtschein drang wieder aus der geöffneten Türe. Ich hörte noch in der Nebenkammer sagen: »Ei weanz schloffa!« – Die Mutter trat heraus. Aber gleich war mein Kopf wieder in der Höhe, und ich fragte: »Muadarl, kimt 's Kristkindl eiz?« – Rot vor Verlegenheit und unterdrücktem Lachen, zog sich die Mutter schnell wieder zurück, und das leise Gekicher und Reden erneuerte sich in der Nebenkammer. Gleich darauf kam der Vater heraus mit einem Licht, stellte dieses auf den Tisch mit den Geschenktellern und sagte zu mir, indem er mich aus dem Bette hob und in die Nebenkammer trug, damit ich bei ihm schlafe, dass das Christkindlein nicht kommen würde, wenn ich wach bliebe und zusehen wollte. Ich verklagte die Mutter, dass wahrscheinlich sie das Christkindlein zu kommen hindere, denn sie sei gar mit einem Lichte gekommen, um es anzuleuchten, und mit einem Korbe, um ihm all seine Geschenke abzunehmen. Während ich mit dem Vater so verhandelte, war die Mutter hinausgeschlüpft und vollbrachte des Christkindleins Bescherung.
Die Art, seinen Neujahrswunsch zu bringen, und die Sorge, nicht der Letzte im Hause zu bleiben, der gratuliert, gewährt eigentümliche Unterhaltung. –
Erwacht z. B. ein Knecht zuerst vor Tagesanbruch, so macht er sich sachte auf und zum Bette des Mitknechtes, stößt ihn leicht an, und wenn der sich muckst, raunt er ihm ins Ohr:
»Brüaderl! Nuis Gohr! Nuis Gohr!
's Kristkin'l liegt im Krostnhoor; –
Longs Lö'm, löngs Lö'm,
Und an Badl voll Gald danö'm!«
(Brüderl! Neu's Jahr! Neu's Jahr!
Christkindlein liegt in krausem Haar; –
Lang's Leben! Lang's Leben,
Und einen Beutel voll Geld daneben!)
Der geweckte Knecht fährt auf, und stottert schlaftrunken: »Ah! – Wos e – Nuis Gohr – Sakra! bist ma r a foakemma.«
»Bist stad?!« sagt der andere weiter; »moch dö ossa r os n Bött, wök du d' Diana, i wök 'n Boa und d' Baren.«
Einer stellt sich sogleich an die Türe, hinter der die Mägde schlafen, der andere wartet vor der Kammertüre des Hausherrn auf das verabredete Zeichen. Plötzlich pochen beide heftig und rufen: »Lädla! nuis Gohr!« – Kaum sind diese Worte ertönt, so regt sich's wie elektrisch in allen Ecken.
Der Sohn. Voderl, nuis Gohr!
Die Mutter. Beiw 'l, nuis Gohr! –
Der Vater. Kinla und Muaderl, nuis Gohr! – Kristkin'l –
Geschrei. Bädl voll – longs Lö'm – Krostnhoor – und an Bä – danö'm – – »Und schon ist die Glückwünschungsformel in tausend Silben zerrissen. Der Lärm weckt den Nachbar, der Nachbar den »Mirtl«, der Mirtl den »Vät« (Veit) – da Vät 'n »Kristi'l« – da Kristi'l »'n Gloamichal« – da Gloamichal »'n Schitznwa'mhonnas« – und dea n »Heitgonga!« usf. Wirklich bestehende Namen in den Dörfern Friedrichsthal und Hirschau. –
Wo sich zwei am folgenden Morgen ansichtig werden, müssen sie die Glückwünschungsformel wiederholen. Verliebte werden beim Glückwunsche rot; Feindselige schauen sich dabei gegenseitig auf Halstuch und Brustknöpfe; Geschwister kichern; Eltern haben Tränen im Aug', und die zwei letzten Verse der Gratulationsformel erleiden dabei entsprechende Änderungen. Man wünscht einer Jungfrau:
»Longs Lö'm, longs Lö'm,
Und an schei'n Mo danö'm!«
(Läng's Leben, lang's Leben,
Und 'nen schönen Mann daneben!)
Dem Burschen:
»Longs Lö'm, longs Lö'm,
Und a schei's Wa danö'm!«
(Läng s Leben, lang's Leben,
Und ein schönes Weib daneben!)
Die neckende Schwester dem Bruder:
»Longs Lö'm, longs Lö'm,
Und hüsch viel Schlö danö'm!«
»Lang's Leben, lang's Leben,
Und recht viel Schläg' daneben!)
Der Mann seinem Weib:
»Longs Lö'm, g'sund's Lö'm,
Und oll ma Lia danö'm!
(Lang's Leben, lang's Leben,
Und all meine Lieb' daneben!) usf. –
Kinder gratulieren den Eltern, Eltern den Kindern, Geschwister, Verwandte, Nachbarn unter einander auf eine und dieselbe Art. Der Namenstags-Patient (man darf den Armen wohl mit Recht so nennen, der seinen Namenstag erscheinen sieht) wird von dem Gratulierenden raschlings angepackt, am Halse mit beiden Händen umspannt, gewürgt (aber sachte) und gekitzelt unter immerwährendem Zuruf: »Wos koist ma? Wos koist ma?« Was versprichst Du mir?, bis es dem Keuchenden gelingt, ein Versprechen hervorzustottern. Ist das geschehen, so ist der Begratulierte frei und die Gratulation zu Ende. Ein am Halse Kitzlicher, besonders ein Vater von vielen Kindern, die ihn am Namenstage wie eine wilde Herde überfallen und kitzeln und kneipen am Halse, rechnet den Namenstag zu den Leidenstagen im Fegefeuer. Daher geschieht es nicht selten, dass man Vater oder Mutter auf der Flucht einholen, oder aus einem Versteck ziehen muss, um gratulieren zu können. Die Versprechen müssen nicht notwendig erfüllt werden. Diese Art, glückzuwünschen, heißt: »'s Drossl'n«.
Am »Gehoisto« (St. Martin) versammeln sich Burschen und Mädchen in jedem Dorfwirtshause, um zu trinken. In dem Maße, als man dem Getränke zuspricht, trinkt man sich Schönheit und Stärke an. Damit jedoch bei Mädchen die zu lebhafte Sucht nach Verschönerung nicht zu weit verführe, bewachen Eltern dieselben, ohne gerade durch Strenge den Scherz zu stören. Burschen wohl lassen manchmal ein Beispiel an ihnen erleben, dass sie vor Eifer, Stärke anzutrinken, sich unter den Tisch trinken.
Ich weiß nicht, ob die heilige Luzia noch in irgendeiner andern Gegend außer am Böhmerwalde zu einer strafenden »Wauwauin« herhalten muss. Es scheint, als wollte man auch aus »Wauwau« und »Wauwauin« (Nikolo und Lizia) ein Paar machen. Nikolo ist fast überall Kindern bekannt und furchtbar. Im Böhmerwalde erscheint er in keinem bestimmten Kostüm. Einmal sah ich ihn mit einem Leintuche umhüllt, und mit übermehltem Gesicht; auf dem Kopf saß ein eigens zur Mütze eingedrücktes Kopfkissen, und in der Hand hielt er eine Rute. Sein Erscheinen schreckte die Kinder, und auf seinen Ruf: »Willst bet'n?« stürzten alle betend in die Knie. Hierauf rollte er ihnen Obst am Boden zu, und ging ab. – »D' Luzia« ist den Kindern eine viel drohendere und gefürchtete Erscheinung. Sie soll schlimmen Kindern den Bauch aufschlitzen und Stroh und Kieselsteine statt der Gedärme hineinlegen, dann den Bauch wieder zunähen. Ihre Gestalt zeigt sich verschieden. Ich sah sie einmal als Ziege mit überbreitetem Leintuch und durchstehenden Hörnern, von einer Art Nikolo geführt. – Sie ermahnte zum Beten, teilte Obst aus und drohte übler Aufführung die erwähnte Strafe. –
Am Palmsonntage lässt jedes Haus nebst wilden Palmzweigen auch noch zwei bis drei hartgesottene, in der Mitte durchschnittene oder an der Spitze bloß aufgebrochene, rote Eier (Sodlasoi), Salz, ein Stück »Flöck'n« in der Kirche weihen. Man bringt diese Dinge in einem Glase zur Weihe, und öffnet während dieser das Glas. Zu Hause verschlingt jedes Glied der Familie, ohne sie zu beißen, mehrere der Palmkätzchen (Polmkatzla); dann werden die geweihten Eier zerstückt und verteilt, die Empfänger aber wechseln wieder unter einander die Stücke, die gegessen werden, um sich vor Verirrungen zu bewahren. Als Würze dient das geweihte Salz, als geweihter Nachbiss das Stückchen »Flöck'n«.
Ist ein Mensch dem Sterben nahe, so wird an dessem Haupte mit einem kleinen Glöcklein leise geläutet, damit die scheidende Seele, gelockt durch die schwebenden Töne, noch einige Augenblicke auf der Erde in der Nähe des erstarrenden Körpers verweile. Die Verwandten und Nachbarn stehen feierlich betend herum, nur vom Weinen der Angehörigen unterbrochen. Ist der Tod unverkennbar erfolgt, so läutet man mit dem Glöcklein weiter weg, immer etwas weiter weg vom Toten, dann zur Türe hinaus, und einmal um das Haus herum, damit man so die Seele auf ihrem Scheidungszuge geleite. Hierauf wird ein Bote geschickt, mit der Dorfglocke das Absterben zu verkünden. Der Tote wird gewaschen und im Leinwandhemde auf ein paffend langes, glatt gehobeltes Bret (Toudnbröd) gelegt, mit einem großen, feinen Leinwandtuche ganz überbreitet und neben seinen Kopf eine ewige Öllampe gestellt nebst einem Glas Weihwasser, worin man sechs bis sieben zusammengebundene Kornähren taucht. Während die Dorfglocke den Tod verkündet, wird das Stroh, welches die Tiefe des Bettgestelles des Verstorbenen ausfüllte, unweit des Hauses verbrannt. Wer die Glocke hört oder das Totenfeuer sieht, betet für die abgeschiedene Seele. – Nach und nach kommt man, die Leiche zu sehen. Man nähert sich derselben, ergreift die in das Weihwasser getauchten Kornähren, besprengt damit von Kopf bis zu den Füßen das überbreitete Leichentuch, kniet dann nieder, einige Augenblicke zu beten, und schlägt nun erst das Tuch bis an die Brust des Toten herab. Die jugendlichen Leichen werden mit Heiligenbildern und Kunstblümlein, soweit nur Platz dazu ist, überdeckt. Im Namen weiblicher Leichen wird das ärmste, älteste Weib in der Gegend herumgeschickt, den Tod und Tag des Leichenbegängnisses anzusagen; im Namen männlicher Leichen der ärmste Greis, und dieser Todesbote wird in jedem Hause reichlich beschenkt. Die drei Nächte, welche der Tote im Hause liegt, kommen abwechselnd alle älteren Bewohner des Dorfes, um da bei der Leiche wach zu bleiben, Kränze und sonst Nötiges zu besorgen, und die betrübten Angehörigen zu trösten und zu zerstreuen. Daher auch mitunter recht lustige Geschichten erzählt und Scherze getrieben werden.