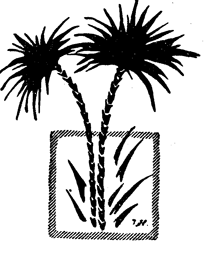|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Im Verdacht der Spionage – Ein Leidensgenosse – Flucht aus dem Gefängnis – An Bord des »Corregidor« – Sturm und Schiffbruch – Im Rettungsboot – Unverhofftes Wiedersehen
Es war vor fünfundzwanzig Jahren – so erzählte Kapitän Settekorn –, da fuhr ich als junger Vollmatrose auf der Hamburger Schonerbark »Manzanilla«. Das Schiff, ein guter Dreimaster, hatte ursprünglich einer spanisch-kubanischen Reederei gehört, war dann in deutsche Hände übergegangen und segelte im Frachtdienst zwischen westindischen Häfen. Wir hatten einen sehr tüchtigen, vernünftigen Kapitän, mit dem ich mich ausgezeichnet stand, und da sich unter der Mannschaft noch ein paar Spanier und Kubaner befanden, konnte ich nebenbei auch Spanisch lernen, was mir später bei meinen selbständigen Fahrten sehr zustatten gekommen ist.
Eines Tages liefen wir, von St. Thomas kommend, in Fort de France ein, um dort eine Fracht nach Trinidad zu übernehmen. Ich hatte vom Kapitän Landurlaub erhalten und benützte die paar Stunden freie Zeit, um mir einmal die Beine zu vertreten und durch die Stadt, weiter dann am Strande entlang zu bummeln. Nun war ich, wie ich einfügen muß, damals in jungen Jahren sehr aufs Zeichnen erpicht; jeder hat ja seine Passion, und mir bereitete es in meinen Mußestunden das größte Vergnügen, über meinem Zeichenheft zu sitzen und irgend etwas, so gut es eben ging, aufs Papier zu zaubern. Mein Kapitän und die Kameraden haben mich deswegen gern geneckt, aber das focht mich weiter nicht an. Meiner Gewohnheit gemäß führte ich auch bei Landurlaub immer ein kleines Skizzenbuch bei mir, um irgend etwas, das mein besonderes Interesse erregte, eine landschaftliche Szenerie oder dergleichen, mit dem Stifte festzuhalten.
Ich ahnte ja nicht, daß mir diese wirklich sehr harmlose Neigung eines Tages schlecht bekommen sollte. So geschah es in Fort de France. Als ich mich dort in Nähe des Hafens am Strande befand, gefiel mir das Bild der Hafenanlagen mit den auf der Reede liegenden Schiffen so gut, daß ich zur Erinnerung daran eine flüchtige Skizze entwerfen wollte. Ich setzte mich also an der ziemlich einsamen Stelle auf einen Baumstumpf, zog mein Skizzenbuch hervor und begann zu zeichnen. In meine Arbeit vertieft, bemerkte ich gar nicht, daß ich aus einiger Entfernung beobachtet wurde. Als ich mit der Zeichnung fertig war und aufstand, traten mir zwei Polizisten, ein Franzose und ein Schwarzer, in den Weg und verlangten zu sehen, was ich gezeichnet hätte. Der barsche Ton der Leute verdroß mich so, daß ich unvorsichtigerweise eine nicht sehr höfliche Antwort gab, und als mich nun der Franzose am Arm packte und mir das Skizzenbuch mit Gewalt wegnehmen wollte, ließ ich mich – ich war damals sehr heftig und leicht erregt – dazu hinreißen, ihm einen tüchtigen Schlag auf die Finger zu geben.
Nun stürzten sich die beiden auf mich, es entspann sich ein Handgemenge, ein paar in der Nähe befindliche Eingeborene liefen herbei und halfen den Polizisten – kurz und gut, alles Sträuben nützte nichts, in ein paar Sekunden war ich überwältigt und wurde nun im Triumph, unter dem üblichen Ehrengeleit des Janhagels, wie ein Schwerverbrecher nach dem Polizeibüro transportiert. Mit den gröblichsten Beschimpfungen, bei denen meine deutsche Nationalität besonders herhalten mußte, beschuldigte mich dort der Kommissär erstens einmal der Spionage, begangen durch das Abzeichnen der Hafenanlagen, und zweitens des tätlichen Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Vergebens war mein Hinweis darauf, daß Fort de France doch kein Kriegshafen oder ein Platz von irgendwelcher militärischen Bedeutung wäre, und daß man in meiner harmlosen Zeichnung unmöglich so etwas wie Spionage erblicken könnte, vergebens meine Bitte, aus dem von mir sehr bedauerten Zusammenstoß mit den Polizisten doch keine Haupt- und Staatsaktion zu machen. Man erklärte mir in brüsker Weise, daß Fort de France – was mir ganz unbekannt gewesen war – verschiedene Befestigungswerke besäße und daß ich zur weiteren Untersuchung des Falles an Ort und Stelle bleiben müßte. Auch die persönlichen Bemühungen meines Kapitäns, der auf die Kunde von dem Vorfall herbeigeeilt kam, nützten nichts. Meine Sachen wurden vom Schiff geholt, und nach kurzem Abschied vom Kapitän, der abends weiterfahren mußte, brachte man mich in Sicherheit.
Ich befand mich in einer sehr unangenehmen Lage. Denn wenn der lächerliche Spionageverdacht bei näherer Untersuchung auch in nichts zerfließen mußte und meine kleine Widersetzlichkeit mir schlimmstenfalls nur eine kurze Haftstrafe einbringen konnte, so hatte ich nun doch meine Stelle verloren und mußte sehen, wie ich nachher von dieser verwünschten Insel wieder fortkam. Niemand war hier, der mir Beistand leisten konnte, denn einen deutschen Konsul oder Konsulatsvertreter gab es damals nicht in Fort de France. Es läßt sich also denken, in welcher Stimmung ich mich befand, als ich abgeführt wurde.
Gefängnisse sind wohl selten willkommene Unterkunftsstätten, am wenigsten aber darf das Gefängnis von Fort de France Anspruch auf diese Bezeichnung erheben. Es sind fast ausschließlich nur farbige Mitbürger, Neger und Mulatten, die man dort ins »cachot« steckt, da lohnt es sich nicht, sich anzustrengen und um solche Dinge wie Lüftung und Reinlichkeit zu kümmern. Für die Nigger ist das Schlechteste gerade gut genug, und wem es nicht paßt, der soll sich eben so führen, daß er nicht ins Gefängnis kommt. So denkt die Behörde von Martinique in ihrer fürsorglichen Weisheit.
Ich war ja als einfacher junger Seemann wahrhaftig nicht verwöhnt, aber es ging mir doch wie ein Schauer über den Rücken, als mich der Schließer ins »cachot« hineingeschoben hatte und die eiserne Tür sich hinter mir knarrend schloß. In dem nur matt erleuchteten Raum herrschte eine Luft zum Ersticken. Ich suchte mir ein noch freies Plätzchen an der Wand, setzte mich auf mein Bündel und sah mir zunächst einmal meine Umgebung näher an. Ein halbes Dutzend Neger und Mulatten standen und lagen um mich herum, keine großen Missetäter, sondern Leute, die wegen irgendeiner kleinen Spitzbüberei ihrer Verurteilung entgegensahen. Außerdem war noch ein Weißer da, ein mexikanischer Matrose, ein wild aussehender Bursche mit einer furchtbaren Narbe im Gesicht, wahrscheinlich ein Andenken an eine Messerstecherei. Er befand sich, wie ich hörte, wegen Desertion in Haft, und war überglücklich, als er merkte, daß ich Spanisch genug verstand, um mit ihm in seiner Muttersprache sprechen zu können.
In jammernden Worten, und nach der Gewohnheit des niederen mexikanischen Volkes fortwährend alle Heiligen anrufend, schilderte Castillo, so nannte sich der Matrose, das ihm widerfahrene Mißgeschick.
»Du kennst unseresgleichen, Kamerad, und weißt, von welchem Schlage wir sind. Hat man ein paar Wochen oder gar Monate lang bei schlechter Kost und harter Arbeit auf dem Wasser gelegen, so will man auch einmal lustig sein und sich einen guten Tag vergönnen. Man trinkt eins über den Durst, und ehe man sich's versieht, hat man Dummheiten gemacht. Ich bin ein braver Bursche, mein Freund, sanft wie eine Turteltaube, aber wenn einmal der böse Geist in mich fährt, dann weiß ich nicht, was ich tue. Kurz und gut, als wir vorgestern hier einliefen und ich Urlaub bekam, begann ich zu trinken, und im Rausch geriet ich in Streit und habe ein paar von diesen elenden Niggers, die doch gar keine richtigen Christenmenschen sind, ein bißchen unsanft behandelt, und als ich deshalb arretiert werden sollte, bin ich davongelaufen, ins Land hinein, und habe mich versteckt, bis mich die Häscher fanden. Und weil der Alte (Castillo meinte den Kapitän) einen großen Zorn auf mich hatte, hat er mich wegen Desertion einsperren lassen. Ich wette, es tut ihm schon leid, denn obwohl er ein arger Filz und Leuteschinder ist, weiß er doch, was er an mir hat und daß er nicht so leicht einen brauchbaren Ersatzmann findet.«
Ich mußte trotz meiner Niedergeschlagenheit lachen, als mein brauner Schicksalsgenosse so lamentierte. Dieser Castillo war wahrscheinlich nicht schlechter, als tausend andere seinesgleichen, leichtsinnig und zügellos in der Freiheit, aber sonst im Grunde ein ganz gutmütiger Bursche.
»Liegt euer Schiff noch im Hafen?« fragte ich.
»Freilich, es ist der ›Corregidor‹, er soll morgen nach Trinidad wieder in See gehen – und ich Sohn des Unglücks muß auf dieser verruchten Insel zurückbleiben.«
Ich entsann mich, das Schiff, einen ganz verwahrlosten alten Dampfer, in der Nähe unseres Schoners bemerkt zu haben.
»Mindestens ein paar Wochen Gefängnis sind mir sicher,« begann Castillo von neuem zu jammern. »Ich wette, der Alte gäbe was drum, wenn er mich morgen bei der Abfahrt wieder auf seinem Kasten sähe. Denn, wie gesagt, ohne Zweifel tut ihm die ganze Geschichte schon leid. Aber nachdem er mich einmal verpetzt hat, kann er es nicht mehr rückgängig machen.«
»Nun, so reiß doch aus und kehre reumütig zu deinem Alten zurück,« sagte ich, mehr im Scherz, ohne mir etwas dabei zu denken.
Der Mexikaner warf mir einen lauernden, prüfenden Blick von der Seite zu. Dann bat er mich, ihm meinerseits zu erzählen, was mich eigentlich ins Gefängnis gebracht hätte. Mein kurzer Bericht vom Hergang der Geschehnisse riß ihn förmlich hin.
»Ja, das sieht ihnen ähnlich, den Herren Franzosen,« sagte er und zeigte grimmig lächelnd seine gesunden, schneeweißen Zähne. Wir sind Unglücksgenossen, mein Freund.« Und nach einer Pause fuhr er fort, indem er die Stimme zum Flüstern dämpfte, obwohl die andern alle schon schliefen und auch schwerlich einer von ihnen Spanisch verstand: »Du sagtest vorhin, daß ich doch ausreißen sollte. Das kann man schon, unmöglich ist es nicht. Aber einer allein schafft es nicht. Wenn du mithelfen wolltest, dann ginge es wohl.«
Ich horchte auf, ungläubig zwar, denn ich konnte mir kein Bild davon machen, auf welchem Wege die Flucht aus diesem wohlverwahrten Gefängnis möglich sein sollte. Aber man konnte doch wenigstens hören, wie sich Castillo die Ausführung seines Planes dachte, und ich war gespannt, was für Ideen er hervorkehren würde.
»Du darfst mir volles Vertrauen schenken,« erwiderte ich also. »Selbstverständlich möchte ich auch entfliehen, aber ich weiß nicht, wie, und dann auch nicht, wohin. Wie soll ich von dieser Insel entkommen, nachdem unser Schoner jedenfalls schon in See gegangen ist?«
»Mein Alter nimmt dich sicher gern an Bord des ›Corregidor‹ auf und nach Trinidad mit,« sagte Castillo lebhaft. »Das laß nur meine Sorge sein, ich helfe dir schon weiter, ich laß dich draußen nicht im Stich. Die Hauptsache ist, daß wir aus diesem Loch herauskommen. Und das ist gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick aussieht; es erfordert nur Kraft. Ich habe nämlich in voriger Nacht eine Entdeckung gemacht. Befühl' einmal diesen Stein in der Wand, Kamerad, hier hinter meinem Lager.«
Meine im Halbdunkel tastende Hand fühlte, daß der bezeichnete Quaderstein im Mauerwerk locker saß und sich ein wenig hin und her bewegen ließ. Anscheinend war der Mörtel von einem früheren Gefängnisinsassen, der seine Flucht vorbereiten wollte, herausgekratzt worden. Durch die Ritzen sickerte Feuchtigkeit, eine kleine Probe des Regens, der sich, nach jähem Wetterumschlag, in voller Heftigkeit ergoß und dessen Rauschen sich mit dem Heulen des Windes zu einer wilden Musik verband.
Castillos Plan war ohne lange Erläuterungen leicht zu erfassen. Da der Gefängnisraum sich zu ebener Erde befand, brauchte man nur den Stein zu entfernen, um dann durch das Loch, das gerade groß genug zum Durchschlüpfen eines menschlichen Körpers war, ins Freie gelangen zu können. Aber die Mauer war anscheinend sehr dick, und der große, schwere Quaderstein saß immerhin noch so fest, daß ich nicht viel Vertrauen zur Sache hatte. Und außerdem: draußen gab es doch auch eine Wache.
Der Mexikaner beschwichtigte meine Zweifel. »Mit vereinter Kraft geht es sicher. Was die Wache betrifft, so macht sie mir keine Sorgen. Erstens grenzt diese Seite des Hauses, wie ich bestimmt weiß, an den Hof, in den die Wache überhaupt nicht kommt, und zweitens haben wir bei dem Hundewetter kaum eine Störung zu befürchten. Du weißt, wie regenscheu die Nigger sind. Bei solcher Nässe verkriechen sie sich. Der Hof ist nur von einem gewöhnlichen Staketenzaun umgeben, da geht es mit einem Satz drüber weg. Da ich gestern auf dem Hof zum Holzhacken kommandiert war, kenne ich die Örtlichkeit genau.«
Castillos Vorschlag leuchtete mir allmählich ein, jedenfalls konnte man die Sache probieren. Da es die Zeit auszunützen galt, machten wir uns sofort ans Werk. Der Länge nach ausgestreckt nebeneinander auf dem Boden liegend, stemmten wir unsere Rücken gegen die Pritschen, die Füße gegen den Stein. Anfangs wollte der Stein sich durchaus nicht aus seiner Lage bringen lassen, er wackelte nur hin und her, dann aber gab er plötzlich mit einem Ruck unter unseren krampfhaft stemmenden Füßen nach und wurde um etwa einen Zoll nach außen gedrückt.
Das war ein erster Erfolg, zwar nur ein sehr kleiner, jedoch ein Erfolg. Wie lange sollte es aber dauern, bis wir zum Ziele kamen! Fast drei Stunden mußten wir, durch häufige Ruhepausen unterbrochen, im Schweiße unseres Angesichts tätig sein, immer in der Angst, daß die damit verbundenen unvermeidlichen Geräusche unsere Entdeckung herbeiführten. Aber das Prasseln der Regenflut übertönte zum Glück jeden anderen Laut. Noch eine letzte Kraftanstrengung, noch ein Ruck, dann ein Kollern – der Steinblock war glücklich hinausgestemmt und draußen etwa zwei Fuß tief auf den Erdboden des Hofes gefallen. Durch die Öffnung strömte die regenfeuchte Nachtluft herein.
Es war jetzt gegen Mitternacht, und die günstigste Zeit zum Entweichen. Castillo steckte den Kopf durch das Loch und hielt draußen vorsichtig Umschau. »Die Luft ist rein,« flüsterte er mir zu. Dann schlängelte er seinen geschmeidigen Leib durch die Öffnung, und ich folgte ihm sofort nach.
Im strömenden Regen, in pechschwarzer Finsternis, schlichen wir geduckt über den Hof. Das Hindernis des Staketenzaunes war rasch genommen. Nun standen wir auf dem von der Regenflut überschwemmten Rasenplatz der Savanna, in nächster Nähe des Hafens. An einer Mauer uns entlang drückend, jede Deckung benützend, suchten wir die Gebüsche der Anlagen zu erreichen, die den Hafenkai begrenzten.
Unsere Vorsicht schien beinahe übertrieben zu sein, denn schwerlich befand sich auch nur ein einziger Einwohner von Fort de France um diese Zeit bei diesem furchtbaren Unwetter im Freien, sicherlich hatte auch die Hafenwache eine trockene Zuflucht gesucht. Ohne störenden Zwischenfall erreichten wir die Promenadenanlagen und schlichen uns nun im dichten Buschwerk bis zu jener Stelle des Strandes, wo eine Anzahl kleiner Boote lag, jener leichten Fahrzeuge, deren sich die tauchenden Negerjungen bedienten. Die Boote waren an Land gezogen und umgedreht, die Ruder lagen in der Nähe. Flugs hatten wir ein Boot zu Wasser gebracht, und gleich darauf ruderten wir möglichst geräuschlos ins Hafenbecken hinaus.
Der wachhabende Matrose an Bord des »Corregidor« war nicht wenig erstaunt, als er das Boot neben dem Dampfer auftauchen sah, und noch größer war sein Erstaunen, zugleich seine Freude, als er die wohlbekannte Stimme Castillos vernahm. Er warf uns das Fallreep zu, und alsbald standen wir, vor Nässe triefend, auf den Planken des Schiffes. Dann hißten wir auch den Nachen an Bord, damit er nicht, leer auf dem Wasser treibend, Verdacht erregte.
Auch der Kapitän, den man weckte, um ihm das Ereignis zu melden, war über das Wiedererscheinen Castillos unverkennbar erfreut, obwohl er sich alle Mühe gab, seine wahren Gefühle hinter einer polternden, mit fürchterlichen Verwünschungen gespickten Strafpredigt zu verbergen. Er wußte, was er an seinem besten Mann trotz aller seiner Schwächen besaß, und war froh, ihn wieder an Bord zu haben. Minder entzückt war er von der Notwendigkeit, mich mitzunehmen.
Aber wohin nun mit uns beiden? Denn da der Dampfer erst am nächsten Vormittag, nach Erledigung der nötigen Förmlichkeiten, in See gehen konnte, und da es selbstverständlich war, daß die Behörde uns nach der Entdeckung unserer Flucht zunächst an Bord des Schiffes suchen würde, mußten wir, Castillo und ich, uns so verstecken, daß man uns nicht fand. Wir erhielten zunächst trockene Kleider und einen kräftigen Imbiß, dann wurden wir im untersten Laderaum in zwei großen leeren Kisten verstaut, die sich zwischen zahlreichen anderen gefüllten Kisten und Ballen befanden.
Angenehm war unsere Lage in dem engen, dunklen, zum Ersticken heißen Versteck wahrhaftig nicht. Acht Stunden lang mußten wir es so aushalten. Und doch war es gut, daß wir uns verkrochen hatten. Denn morgens hörten wir das Poltern und Schreien der französischen Beamten, die, nachdem unser Ausbruch aus dem Gefängnis bekannt geworden war, an Bord des Dampfers kamen, um ihn zu durchsuchen. Hätten sie die Durchsuchung gründlich und gewissenhaft vorgenommen, so wären wir ihnen natürlich nicht entgangen. Da die Herren sich aber nach Landesbrauch die Sache möglichst leicht machen wollten, fiel es ihnen gar nicht ein, sich wegen zwei Ausreißern eifriger zu bemühen, als gerade nötig war, um den Schein zu wahren. Sie gingen durch die Schiffsräume, spähten in ein paar Winkel, klopften an ein paar Kisten, und konstatierten zum Schluß, daß wir uns nicht auf dem Dampfer befänden. Dann wurde das Schiff zur Abfahrt freigegeben, und bald darauf, als wir im offenen Meere schwammen, konnten wir, in Schweiß gebadet, unsere Kisten verlassen und auf Deck wieder frische Luft genießen.
Meine ganze Sorge war nun, ob überhaupt und wo ich meinen Schoner, die »Manzanilla«, wieder treffen würde. Wie ich von Kapitän Pedrazza, dem Führer des »Corregidor«, hörte, war der Schoner programmgemäß am vorherigen Abend in See gegangen. Hatte ich Glück, so erwischte ich ihn noch in Port of Spain auf Trinidad, seinem nächsten Hafen. Vielleicht erreichten wir ihn aber auch schon unterwegs. Allerdings hält sich ein Segelschiff, wie Sie wissen, nicht genau an die Dampferkurse, sondern richtet sich nach dem Wind, und beschreibt deshalb oft Zickzacklinien und Umwege. Immerhin lagen die Windverhältnisse gerade so, daß ich mit der Möglichkeit rechnen durfte, daß der »Corregidor« den Schoner jetzt, wo der Wind immer mehr abflaute, einholte und in seine nächste Nähe kam. In diesem Fall konnte ich von der »Manzanilla« vielleicht auf offener See übernommen werden.
Was nun den »Corregidor« betraf, so war das der verrottetste Kasten, der mir in meiner Seemannslaufbahn je zu Gesicht gekommen ist. Ganz abgesehen von der ausgemergelten schwachen Maschine, die es trotz Keuchen und Stöhnen nur mit Ach und Krach zu der geforderten Knotenzahl brachte, klapperte das Schiff förmlich vor Altersschwäche. An Hunderten von Stellen geflickt, und überall wieder aus dem Leim gegangen, erinnerten Wände und Planken an das zerschlissene Gewand eines Landstreichers. Eine durchgreifende Reparatur lohnte sich wohl auch nicht mehr, aber es gehörte wahrhaftig Mut dazu, mit einer derartigen Ruine in See zu gehen.
Das halbe Dutzend Schiffsleute des »Corregidor« war trotz aller Zerlumptheit und mangelhaften Disziplin ein ganz gutmütiges Völkchen. Castillo besonders wußte sich vor Freude über den glücklichen Ausgang seines Abenteuers in Fort de France kaum zu fassen, obwohl ihm der Kapitän noch einmal gehörig den Kopf wusch.
Gegen Abend begann das inzwischen so heiter gewordene Wetter wieder umzuschlagen. Die wohlbekannten Sturmwolken stiegen auf und verbreiteten sich rasch über den Himmel. Drohende Anzeichen verrieten das Nahen eines jener gefährlichen Wirbelstürme, die den größten Schrecken des Antillenmeeres bedeuten. Die Lage des Schiffes war zur Zeit so ungünstig wie nur möglich. Wir befanden uns nämlich gerade in nächster Nähe der Grenadinen, jener Kette von kleinen und kleinsten felsigen Inseln zwischen den größeren Inseln St. Vincent und Grenada. Die Gegend ist bei den Schiffern sehr unbeliebt, denn es gibt dort zahlreiche Untiefen und Klippen, die bei unsichtigem Wetter und Sturm leicht verhängnisvoll werden.
Kapitän Pedrazza ließ den Dampfer scharf nach Westen abfallen, um aus der gefährlichen Nähe der Grenadinen zu kommen. Es dauerte auch gar nicht lange, da wurde das Meer von heftigen Böen aufgewühlt, und nach diesen Vorläufern brauste alsbald ein furchtbarer Sturm über uns weg, so daß sich der Dampfer nach See überlegte und unheimlich zu rollen begann. Die Kursänderung entfernte uns zwar von den Untiefen und Riffen, brachte aber sonst keine Erleichterung. Im Gegenteil, jetzt traf das Unwetter den Schiffskörper längsseitig mit solcher Wucht, daß der »Corregidor« sich ganz auf die Seite legte, und es den Anschein hatte, als ob er unfehlbar kentern müßte. Obwohl alle Luken auf Deck so dicht wie möglich verschalkt waren, fanden die überkommenden Sturzseen in dem altersmorschen Gehölz doch Löcher genug, durch die sie eindringen konnten, und so hatte die Dampfpumpe unaufhörlich zu tun, um das in den Innenräumen sich ansammelnde Wasser wieder hinaus zu befördern.
Die Mannschaft hielt sich sehr wacker und war unermüdlich auf den Beinen. Ich arbeitete natürlich mit den anderen mit. Es war inzwischen dunkel geworden, kohlschwarze Nacht. Immer lauter heulte der Sturm, immer wilder raste die See, und so oft bei dem Rollen und Stampfen des Schiffes die Schraube aus dem Wasser geriet, wirbelte sie wie toll in der Luft herum, daß der alte Kasten von vorn bis hinten ins Zittern kam. Wir mußten uns ordentlich vorsehen, um bei diesem verwegenen Tanz nicht über Bord geschleudert zu werden; der Kapitän und der Steuermann hatten sich auf der Brücke festbinden lassen.
Übrigens zeigte der alte »Corregidor« doch eine strammere Haltung, als man ihm zugetraut hätte. Er hätte das Unwetter wohl auch gut überstanden, wäre jetzt nicht ein unvorgesehener Unfall passiert. Es gab plötzlich einen Ruck, die Maschine stand still, und gleich darauf meldete der Maschinist, daß die Schraubenwelle gebrochen wäre.
Eine schöne Bescherung! Kapitän Pedrazza fluchte, wie nur ein Spanier fluchen kann, aber das half natürlich nichts. Bei Untersuchung der Schraubenwelle stellte es sich heraus, daß es unmöglich war, den Schaden sogleich, wenn auch nur notdürftig, auszubessern. Man konnte das erst im nächsten Hafen tun, und mußte bis dahin mit Notsegeln fahren, soweit das bei diesem Wetter überhaupt möglich war.
Inzwischen hatten Sturm und Seegang das kraftlos gewordene Schiff nach Osten abgedrängt, so daß wir wieder in die bedenkliche Nähe der Grenadinenriffe gerieten. Der Versuch, unter Segeln abzukommen, hatte wenig Erfolg, denn die Segeleinrichtung des Dampfers war ganz unvollkommen. Eine bange Stunde verrann. Wir manövrierten, so gut es eben ging. Dann geschah, es war gerade um Mitternacht, das längst Befürchtete. Ein Knirschen ertönte, ein Poltern, ein Krachen von niederfallenden Rundhölzern und berstenden Planken, alles an Deck fiel durcheinander, die Sturzseen erbrachen sich über das Schiff ... Der alte »Corregidor«, der so manches Jahrzehnt hindurch manches böse Wetter glorreich überstanden hatte, war am Ziel seiner letzten Reise angelangt: er war auf ein Riff geraten, saß fest, ein hilflos dem Untergange geweihtes Wrack.
Die spanischen und amerikanischen Schiffsleute ließen sich als echte Südländer einen Augenblick von der Verzweiflung übermannen. Sie fielen auf die Knie, riefen alle Heiligen an, schrien und weinten wie kleine Kinder. Aber dann rafften sie sich wieder auf, und wir versuchten zunächst das Leck abzudichten, freilich vergebens. Ein Felszacken des Riffs hatte sich tief in den Schiffsboden am Kiel gebohrt, so daß an Loskommen gar nicht zu denken war. Durch das Leck strömte massenhaft Wasser ein. Mit jeder Minute wuchs die Gefahr, daß die Sturzwellen den Dampfer sehr bald zerschlugen, obwohl der Sturm jetzt abzuflauen begann und der ungeheure Aufruhr des Meeres sich legte.
Aber selbst wenn der Dampfer die Nacht überstand – was dann? Es gab nur zwei Möglichkeiten der Rettung: entweder führte ein glücklicher Zufall ein Schiff so nahe vorbei, daß es uns bemerken und aufnehmen konnte, oder wir mußten versuchen, mit unseren zwei Booten, die glücklicherweise noch unbeschädigt waren, die nächste Grenadineninsel zu erreichen.
Langsam schlich der Rest der Nacht dahin, und mehr als einmal glaubten wir, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber das Unwetter hörte allmählich auf, und als die Sonne erschien, war die See nur noch mäßig bewegt. Wir ließen die Blicke nach allen Seiten schweifen. Die Aussicht, daß in dieser wegen der Riffgefahr gemiedenen Gegend ein Dampfer oder Segler auftauchen würde, war höchst gering. Der Kapitän ließ deshalb die Boote klarmachen und mit dem nötigen Proviant versehen.
Mir tat der Alte von Herzen leid. Zwar war Kapitän Pedrazza nicht Eigentümer des Dampfers, auch war der »Corregidor« samt Ladung versichert, und dennoch gibt es für einen Schiffsführer kein größeres Unglück, als wenn er sein Fahrzeug verliert, mag er selber auch noch so unschuldig daran sein.
Die Sonne stand bereits ziemlich hoch am Himmel, als alle Vorbereitungen zum Verlassen des Wracks getroffen waren. Um neun Uhr erscholl das Abfahrtskommando. Ich saß in dem vom Kapitän geführten Boot. Niemand wußte, was uns die nächste Zukunft bringen würde. War es doch keineswegs sicher, daß die nächsten Inseln, die wie kleine Punkte am Horizont sichtbar wurden, bewohnt waren, denn die Mehrzahl dieser kleinen Klippeninseln ist öde und leer. Und selbst wenn wir dort menschliche Behausungen fanden, konnte es Wochen und Monate dauern, bis sich Gelegenheit bot, mit Hilfe eines größeren Fahrzeugs eine der Hauptinseln der Grenadinengruppe zu erreichen.
Unsere Boote waren zwar mit kleinen Hilfssegeln versehen, aber bei der jetzt herrschenden Windstille, die auf den Sturm gefolgt war, nützten sie uns nichts. Wir sahen uns lediglich auf die Ruder angewiesen, da kam man natürlich nur langsam vorwärts, zumal eine starke Strömung entgegenwirkte. Stunde auf Stunde verrann. Ein zäher weißer Dunst, eine in dieser Gegend sehr häufige Erscheinung, hüllte das Meer ringsum in undurchdringliche Schleier. Wenn dieser Nebel lange anhielt, konnte er uns einen bösen Strich durch die Rechnung machen. Immer größer wurden die Pausen, die wir, schon aufs äußerste ermattet, beim Rudern eintreten lassen mußten. Nach ein paar weiteren Stunden beschloß Kapitän Pedrazza, still liegen zu bleiben, bis der Nebel schwand. So verharrten wir in den leise schaukelnden, von zahllosen Quallen umspielten Booten in dumpfer Niedergeschlagenheit. Hin und wieder stimmte einer von den Leuten ein Lied an, eines jener schwermütigen spanischen und mexikanischen Volkslieder, aber es war keine richtige Stimmung dafür vorhanden, der Sang schlummerte bald wieder ein, und selbst Castillos Galgenhumor verpuffte ziemlich wirkungslos.
Endlich, spät am Nachmittag, kam eine Brise auf und füllte unsere kleinen Segel, so daß es jetzt in schnellerem Tempo vorwärts ging. Da auf einmal war es uns, als ob wir ein Rauschen und abgerissene Rufe vernahmen, und gleich darauf tauchte hinter dem dicken Nebel auf Steuerbordseite eine schattenhaft dunkle Masse auf.

Der Kapitän wendete rasch das Boot, und das zweite folgte unserem Beispiel. Nur wenige Sekunden später erkannten wir den Bug eines in ziemlich flotter Fahrt begriffenen Segelschiffes – fast schien es, als ob wir überrannt werden sollten.
Wie aus einem Munde riefen wir das Schiff mit gellenden Stimmen an. An Bord des Schoners hatte man uns bereits bemerkt und begann das Schiff beizudrehen.
Bald darauf befanden wir uns so nahe am Schiff, daß ich, der ich soeben unser kleines Segel herabgelassen hatte, es genau ins Auge fassen konnte. Und da erkannte ich auch, wen wir vor uns hatten: das war ja am Bugspriet die mir so wohlvertraute Gallionsfigur der »Manzanilla«! Ja, es war meine Schonerbark, und der Mann oben an Deck, der uns zurief, war kein anderer als unser Oberbootsmann Kruse!
Es verging geraume Zeit, bis die »Manzanilla« beigelegt hatte und wir längsseits des Schiffes lagen und an den uns zugeworfenen Fallreeps hochentern konnten. Gleich darauf stand ich oben an Deck und schüttelte meinem Kapitän und den Kameraden, die ob dieses unvermuteten Wiedersehens nicht wenig erstaunt waren, die Hand. Kapitän Pedrazza wurde mit seinen Leuten liebevoll aufgenommen und untergebracht, so gut es ging, dann setzte der Schoner seine Reise fort.
Ich berichtete nun meinem Kapitän alles, was mir inzwischen passiert war, die Flucht aus dem Gefängnis in Fort de France und den Schiffbruch des »Corregidor«.
Auch der »Manzanilla« war es nicht gut gegangen. Das Unwetter hatte ihr übel mitgespielt und sie weit vom Kurse abgedrängt. Allerdings hatten wir Schiffbrüchigen es auch nur dieser Störung zu verdanken, daß wir der Schonerbark in den Weg kamen und von ihr aufgenommen werden konnten.
Vierundzwanzig Stunden später liefen wir Port of Spain auf Trinidad an, setzten hier Kapitän Pedrazza mit seinen Leuten ab und segelten dann nach dem Orinoko weiter. So endigte, wider alles Erwarten glücklich, mein Abenteuer von Fort de France.