
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Danke! Ein Maler wird doch wirklich Besuche empfangen!«
»Geschäftsbesuche, ja.«
»Normann hat vielleicht auch den meinigen für einen solchen gehalten, sonst wäre ich wohl sofort abgewiesen worden. Ich bilde mir also gar nichts darauf ein, in sein Atelier treten zu dürfen.«
»Sind Sie unfreundlich behandelt worden?«
»Mehr als das.«
»Also grob?«
»Grob und sogar noch schlimmer. Man glaubte mit mir scherzen zu dürfen.«
»Ah! Und das haben Sie geduldet?«
»Keineswegs. Ich habe ihnen sehr offen gesagt, wie ein gebildeter Mann ein solches Verhalten finden muß.«
»Recht so, recht so!«
Sie sagte das in so zustimmendem Tone, daß er verwundert zu ihr aufblickte.
»Wie? Sie freuen sich darüber?«
»Gewiß! Warum sollte ich nicht?«
»So hassen Sie diese Normanns auch?«
»Hassen? O nein. Das ist das richtige Wort nicht. Ich hasse sie nicht, und ich verachte sie nicht; sie sind mir eben so wenig gleichgiltig. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Es giebt nämlich kein passendes Wort für das, was ich sagen möchte.«
»Aber Sie sind ihnen unsympathisch?«
»Im höchsten Grade.«
»Ah, sind Sie auch beleidigt worden?«
»O nein. Man ist mir ganz im Gegentheile mit größter Zuvorkommenheit entgegengetreten.«
»So verkehren Sie mit ihnen?«
»So oft ich mich in Wiesenstein befinde.«
»Dann ist man gegen Sie freundlicher gewesen, als gegen mich.«
»Ich sage Ihnen ja, daß ich höchst zuvorkommend behandelt worden bin. Nicht ich habe mich an sie gedrängt, sondern sie haben mich eingeladen, über den Zaun herüber, wissen Sie, so recht nachbarlich.«
»Das ist ja reizend!«
»Aber ich bin ihnen keineswegs dankbar dafür.«
»Wirklich nicht?«
»Nein, gar nicht, denn nun bin ich gezwungen, sie fast täglich zu besuchen.«
»Ah, Sie verkehren mit ihnen?«
»Natürlich!«
»Das ist mir interessant!«
»Warum?«
»Davon vielleicht später einmal. Sind diese Leute nur höflich mit Ihnen, oder –«
»Oder – –? Was meinen Sie?«
»Oder haben sie Ihnen irgend ein Vertrauen geschenkt?«
»Ich weiß nicht, was ich darunter verstehen soll, wenn Sie sagen, irgend ein Vertrauen geschenkt. Wollen Sie sich nicht deutlicher ausdrücken?«
»Deutlicher könnte ich erst später sprechen. Für jetzt möchte ich fragen, ob der Verkehr ein herzlicher, ein freundschaftlicher ist.«
»Von ihrer Seite allerdings.«
»Aber von der Ihrigen nicht?«
»Nein. Ich muß mich zwingen.«
»Warum? Hat man Sie einmal beleidigt?«
»Sehr!«
»Womit?«
Jetzt ahmte sie ihm nach, indem sie antwortete:
»Davon vielleicht später.«
»Warum jetzt nicht?«
»Weil Sie ebenso zurückhaltend sind.«
»Wir müssen uns ja erst kennen lernen!«
»Allerdings, und darum dürfen Sie von mir nicht mehr Offenheit erwarten, als Sie mir zeigen. Uebrigens hätte ich diese Beleidigung vielleicht verziehen, aber ich passe nicht zu ihnen. Sie sind stolz, kalt und prätenziös, während ich ein offenes und heiteres Temperament besitze, mich gern unterhalte und einem jeden Dinge die gute, die lichte Seite abzugewinnen suche. Da fühle ich mich bei den Normanns wie in einer Klosterzelle; es friert mich im Gemüthe und ich reiße aus, so schnell es mir möglich ist.«
»Ja, das glaube ich Ihnen,« nickte er lächelnd. »So sind Sie, ganz genau so, heiter und hell wie ein Sonnenstrahl. Da passen Sie nicht zu diesen Leuten. Woher stammt denn dieser Maler eigentlich?«
»Das weiß ich nicht.«
»Und seine Frau?«
»Ist eine Deutsche.«
»Ich glaube, das Gegentheil gehört zu haben.«
»So hat man Sie falsch berichtet.«
»Schwerlich! Wissen Sie, wir von der Polizei, wenn wir uns auch bereits a. D. schreiben, haben doch noch unsere scharfen Augen und Ohren!«
»Hm! Ich weiß kein Wort.«
»Auch über die Freundin nicht, die mit dort wohnt, ich glaube, sie heißt Zykyma?«
»Nun, sie stammt ebenfalls aus Deutschland.«
»O nein!«
»Nicht? Man hat mir aber doch so gesagt!«
»So hat man Sie belogen!«
»Das wollte ich mir verbitten!«
Ihre Augen leuchteten zornig auf.
»Verbitten Sie es sich oder nicht, man hat Ihnen doch die Unwahrheit gesagt.«
»Das wäre ja niederträchtig!«
»Gewiß! Wissen Sie, wie die Frau Normann heißt?«
»Tschita.«
»Richtig! Und wissen Sie auch, was für ein Name das ist, welcher Sprache er angehört?«
»Nun?«
»Es ist ein türkischer.«
»Was Sie sagen!«
»Ja, ein türkischer. Und Zykyma ist ganz ebenso türkisch. Diese beiden Damen sind Türkinnen, und Normann schämt sich, dies zu sagen.«
»Herr, Sie setzen mich in das allergrößte Erstaunen! Sie müssen sich irren!«
»O nein, ich weiß das genau.«
Sie machte ein ganz betroffenes Gesicht, schlug die kleinen Händchen zusammen und rief:
»Türkinnen! Ist's die Möglichkeit!«
»Ja, Türkinnen,« wiederholte er.
»Woher wissen Sie das?«
»Aus einer sehr guten Quelle.«
»Darf man dieselbe erfahren?«
»Später vielleicht.«
»Gehen Sie mit Ihrem später! Jetzt will ich es wissen, gleich jetzt!«
»Geduld, Geduld! So schnell eilt man nicht.«
»Wer soll da Geduld haben, wenn man so Außerordentliches zu hören bekommt! Und mir haben sie es verschwiegen! Mich haben sie belogen!«
»Ja, schändlich belogen,« stimmte er bei.
Es lag ihm sehr daran, ihren Zorn möglichst zu steigern.
»Das ist unverzeihlich! Nicht?«
»Natürlich! Und noch wissen Sie nicht Alles.«
»Was denn, was weiß ich noch nicht?«
»O, man getraut sich kaum, es zu sagen.«
»Warum denn?«
»Weil es geradezu unglaublich ist.«
Sie rückte wie elektrisirt auf ihrem Sitze hin und her. Ihre Augen glänzten vor Begierde.
»Heraus damit, heraus!« sagte sie.
»Hm! Ich habe noch zu Niemand davon gesprochen.«
»Aber mir werden Sie es sagen?«
»Ich möchte wohl, aber – –«
»Was aber! Hier giebt es gar kein Aber.«
»O doch! Man soll nicht davon sprechen.«
»Meinen Sie denn, daß ich eine Plaudertasche bin?«
»Nein. Ich halte Sie im Gegentheile für eine sehr verschwiegene Dame. Habe ich da Recht?«
»Natürlich, natürlich.«
»Und weil ich außerdem ein so großes Interesse an Ihnen finde, möchte ich eine Ausnahme machen.«
»Thun Sie das, aber schnell!«
»Aber bei Ihnen soll auch Alles gleich blitzschnell gehen, Sie kleine, liebe Ungeduld!«
»Und Sie zerren den Faden so lang, daß es Einem angst vor dem Zerreißen wird.«
»Versprechen Sie mir zu schweigen?«
»Ja, hier meine Hand darauf.«
Sie schlugen ein. Er fuhr leise fort:
»So will ich Ihnen sagen, daß Tschita und Zykyma bereits verheirathet waren.«
»Herrgott!«
»Ja, sie waren verheirathet. Sie sind aber ausgerissen.«
»Ausgerissen! Also ihren Männern?«
»Ihrem Manne.«
»Ich verstehe Sie nicht.«
»Sie hatten Beide einen und denselben Mann.«
»Gerechter Gott! Polygamie!«
»Nein, sondern Polyandrie nennt man das.«
»Vielmännerei!«
»Oder nein! Wir haben uns Beide geirrt. Wenn ich so in Ihr hübsches Gesichtchen sehe, wie Ihre Augen vor Erstaunen noch einmal so groß werden, da verliere ich ganz den Unterschied zwischen Vielmännerei und Vielweiberei.«
Es war wirklich so. Sein Blick hing nur an ihrem Gesichte, welches durch die über dasselbe gehenden Gefühle, die sich in schnellem Wechsel folgten, außerordentlich fesselnd wurde.
»Zwei Weiber und ein Mann!« sagte sie, die Hände in einander legend. »Das ist ja schrecklich; das wird doch bestraft!«
»Hier bei uns, ja.«
»Nun also!«
»Aber in der Türkei nicht!«
»Ach so! Sie sind also wirklich echte Türkinnen?«
»Natürlich.«
»Wie sind sie aber denn hierher gekommen?«
»Normann hat sie entführt.«
»Entführt! Mein Heiland! Schrecklich!«
»Sie sehen, in welcher Gesellschaft Sie sich befunden haben! Meinen Sie nicht auch?«
»In einer entsetzlichen Gesellschaft! Man muß ja gewärtig sein, daß nun dieser Normann mit ihnen in Vielweiberei lebt!«
Das war ein neuer Gesichtspunkt, ein ganz neuer, über welchen Schubert beinahe laut aufgelacht hätte. Aber er bezwang sich und antwortete ganz ernst:
»Das muß man gewärtig sein.«
»Glauben Sie?«
»Na, solchen Türkinnen ist es ja ganz egal, ob eine Jede ihren eigenen Mann hat oder ob sie einen in Compagnie besitzen.«
»Einen Mann in Compagnie! Ich würde sterben! Ich will einen Mann für mich, ganz allein für mich! Hören Sie!«
»Hm!« lachte er. »Vorhin wollten Sie gar keinen.«
»Schweigen Sie! Ich spreche natürlich von dem Falle, daß ich heirathen würde. Da theile ich meinen Mann mit keiner Andern!«
»Das sollen Sie auch nicht. Sie sind eine Christin; aber diese beiden Heidinnen – –«
»Heidinnen!« rief sie. »Was werde ich noch zu hören bekommen! Heidinnen, Heidinnen!«
Sie zeigte jetzt ein solches Erstaunen, daß es gar nicht größer sein konnte.
»Halten Sie das für glaubhaft?«
»Eigentlich nein.«
»Und doch ist es wahr.«
»Wenn sie es mir nicht versicherten, so würde ich es für die größte Lüge halten.«
»Sie können es glauben. Meine Quelle ist gut.«
»Von wem wissen Sie es denn?«
»Lassen Sie mich das noch verschweigen. Ich habe meine Gründe, jetzt nicht davon zu sprechen.«
»Aber später werde ich es erfahren?«
»Vielleicht.«
»Kein vielleicht! Sehen Sie denn nicht, daß ich vor Begierde brenne, mehr zu erfahren?«
»Ja, Sie sind ganz erregt; aber ich darf jetzt wirklich nicht mehr sagen; aber da Sie sich so sehr dafür interessiren, können Sie sich an der Sache sogar mit betheiligen.«
»Betheiligen? Soll ich mich etwa auch dieser Polygamie ergeben?«
»O nein, o nein. Ich meine es anders. Ich wollte sagen, daß Sie vielleicht in dieser Angelegenheit auch beschäftigt werden können.«
»Das wäre ja außerordentlich interessant!«
»Meinen Sie?«
»Ja, natürlich!«
»Nun, wollen sehen!«
»Was denn? Was wollen Sie sehen? Ach, jetzt begreife ich, jetzt verstehe ich!«
»Nun, was begreifen Sie?«
»Daß Sie kein a. D., kein Beamter außer Dienst sind, sondern Sie amtiren noch jetzt.«
Daß sie auf diesen Gedanken zu kommen schien, war ihm außerordentlich lieb. Auf diese Weise konnte er hoffen, in ihr eine Verbündete zu gewinnen. Er hütete sich darum gar wohl sie zu enttäuschen, sondern er meinte bedeutsam lächelnd:
»Was Sie für ein kleiner Scharfsinn sind!«
»Nicht wahr? Ich habe Recht?«
»Ich darf weder Ja noch Nein sagen. Gewisse Rücksichten verbieten mir das.«
»Schön, ich begreife. Ihr Amtseid verbietet Ihnen, diese Sachen auszuplaudern. Nicht wahr?«
»Ich darf nicht antworten.«
»Gut, aber mir ist es nicht verboten, meine Gedanken auszusprechen. Sie sind ein geheimer Polizist und haben sich dienstlich mit diesem Falle von Vielweiberei zu beschäftigen. Ist's so?«
»Ich kann es nicht eingestehen. Aber angenommen, es wäre so, was dann?«
»Sie haben sich diesen Normanns vorgestellt und sind abgewiesen worden, weil man ahnte, wer Sie sind – –?«
»Möglich.«
»Nun suchen Sie, diesen Leuten auf andere Weise beizukommen. Habe ich Recht?«
»Nehmen Sie einmal an, es wäre so.«
»Schön! Aber Sie wissen nicht, wie es anfangen?«
»Allerdings nicht.«
»So weiß ich es!«
»Sie? Wieso?«
»Sie müssen sich an Jemand wenden, der in dieser Familie verkehrt. Das ist das Beste.«
»Vergeblicher Rath!«
»Nicht vergeblich!«
»Gewiß, denn die Familie verkehrt ja eben leider mit gar Niemandem.«
»Nicht? Habe ich Ihnen nicht gesagt, daß ich in der Villa verkehre? Haben Sie das vergessen?«
»Sie? Ach ja! Aber das ist etwas anderes.«
»Wieso?«
»Was habe ich davon, wenn Sie bei den Normanns aus und ein gehen?«
»Sehr viel, unter Umständen.«
»Meinen Sie? Ich glaube nicht. Ja, wenn Sie ein Mann wären!«
»Warum ein Mann?«
»Dann würden Sie sich beleidigt fühlen, daß man Sie belogen hat, daß man Sie zwang, mit Heidinnen zu verkehren.«
»Nun, bin ich etwa so sehr gleichgiltig dabei?«
»Ich – weiß nicht!«
»So, Sie wissen nicht! Glauben Sie, eine Dame habe kein Ehrgefühl? Glauben Sie, eine Dame könne nicht beleidigt werden?«
»Ja, aber – –«
»Nun, was wieder?«
»Nein, aber sie nimmt es ruhig hin.«
»Denken Sie? Da irren Sie sich gewaltig. Auch ein Weib kann sich rächen. Und übrigens brauchen wir gar nicht große Reden über diesen Fall zu wechseln. Ich bin beleidigt; ich kann diese Normanns nicht ausstehen; ich mag nichts von ihnen wissen, folglich stelle ich mich Ihnen zu Diensten.«
»Ernstlich?«
»Mit vollem Ernste. Nehmen Sie mich an?«
»Ich – ich – ich kenne Sie ja nicht.«
»Ich Sie auch nicht.«
»Ich weiß nicht, ob Sie Ernst machen. Sie können mich ja täuschen. Dann wäre der Schaden für mich geradezu unheilbar.«
»Aus welchem Grunde sollte ich Sie täuschen?«
»Aus Liebe zu den Normanns.«
»Schweigen Sie. Diese Menschen haben mich tödtlich beleidigt. Ich kann ihnen niemals verzeihen!«
»Darf ich das glauben?«
»Gewiß! Uebrigens vertrauen Sie mir oder nicht; in meinem eigenen Interesse biete ich mich Ihnen nicht an. Was habe ich davon, nichts! Ich werde niemals wieder zu Normanns gehen. Damit ist für mich die Sache abgemacht.«
»Nein, Sie müssen grad zu ihnen gehen!«
»Wozu? Um mich abermals und weiter fort beleidigen zu lassen?«
»Nein, sondern um – – ah, ich will Ihnen Vertrauen schenken. Sie sehen nicht so aus, als ob Sie lügen könnten.«
Er blickte ihr begeistert in die Augen.
»Ja,« sagte er dann, »ich nehme Sie an, falls Sie mir helfen wollen; aber Sie werden mich doch nicht verrathen?«
»Nennen Sie das helfen, wenn ich Sie verrathe?«
»Verzeihung! Man kann hier nicht vorsichtig genug sein. Es handelt sich um viel mehr, als Sie denken.«
»Wirklich? Sie setzen mich immer mehr in Spannung. Was giebt es denn noch?«
»O, viel, viel! Aber hier darf ich Ihnen davon nichts mittheilen, sprechen wir zu Hause davon. Hoffentlich haben wir Gelegenheit, uns heimlich zu treffen.«
»Sehr leicht. Wir dürfen nur wollen.«
»Werden Sie von Ihrer Tante beaufsichtigt?«
»Beaufsichtigt? Welche Frage! Was denken Sie von mir! Halten Sie mich für einen Backfisch?«
»Das nicht. Aber Tanten pflegen eben Tanten zu sein. Man kennt das ja.«
»O, die meinige ist ganz anders.«
»Ich bin bei ihr vollständig frei und ungenirt. Ich kann thun und lassen was mir beliebt.«
»Schön! So wird sich ein Oertchen und ein Augenblick finden, an welchem wir uns unbemerkt unterhalten können, denn es ist wirklich am allerbesten, wir thun so, als ob wir gar nicht mit einander verkehren.«
»Mir auch recht, Ganz wie Sie wollen. Sie können ja in mein Zimmer kommen.«
»Wirklich?« fragte er ganz glücklich. »Erlauben Sie mir das, gnädiges Fräulein?«
»Warum sollte ich nicht? Also Sie werden mir noch heut Verschiedenes mittheilen. Entweder kommen Sie zu mir, oder ich komme zu Ihnen. Da sind wir wohl am Ungestörtesten. Und das kann wohl so bald wie möglich sein?«
»Ja, aber nicht sogleich nach unserer Ankunft. Da habe ich zunächst einen sehr nothwendigen Gang zu unternehmen, gleich vom Bahnhofe weg.«
»Wohl grad in dieser Angelegenheit?«
»Ja; aber ich werde sehr bald zu Hause sein.«
»Schön! Da warte ich auf Sie und werde nicht eher ausgehen, als bis ich dann mit Ihnen gesprochen habe.«
»O nein; das wünsche ich nicht. Sie sollen ausgehen und zwar zu Normanns.«
»Ach so! Ich soll ihnen meine Ankunft melden?«
»Ja, und zugleich ein Bischen hinhorchen, ob vielleicht Etwas zu erfahren ist.«
»Wovon?«
»Zunächst nur Allgemeines. Später werde ich Sie näher informiren und Ihnen ganz genau sagen, was ich zu erfahren wünsche.«
»Das möchte ich am Liebsten gleich jetzt wissen.«
»Unmöglich. Ich weiß selbst noch nicht genau, woran ich bin, und kann Ihnen also erst später Auskunft geben.«
»Soll ich Normanns wissen lassen, daß wir mit einander in einem Coupé gesessen haben?«
»Bei Leibe nicht. Sie sollen nicht wissen, daß ich verreist war und wo ich gewesen bin.«
»Dürfen sie aber erfahren, daß wir uns kennen?«
»Wenn wir zusammen in einem Hause wohnen, müssen wir uns ja kennen; aber wir verkehren nicht mit einander. Verstanden? Am Besten ist es, Sie sprechen gar nicht von mir.«
»Ganz wie Sie wünschen. Als Ihre Verbündete werde ich stets Ihren Anordnungen folgen.«
»Das freut mich, denn auf diese Weise wird unsere junge Bekanntschaft wohl für beide Theile von den glücklichsten Folgen sein.«
»Hoffen wir das! Aber wo sind wir? Es pfeift.«
Der Agent blickte hinaus.
»Ah,« sagte er, »wir waren so in unser Gespräch vertieft, daß wir gar nicht auf die Schnelligkeit des Zuges geachtet haben. Da ist ja unser Wiesenstein schon. Wir werden gleich halten.«
Man hörte die Bahnhofsglocke erschallen, und dann dampfte der Zug in den Perron.
»Frau Berthold wird, wenn sie da ist, sehen, daß wir mit einander gefahren sind,« sagte er. »Wie wird sie sich wundern.«
»Darf sie es wissen?«
»Sie muß es ja sehen!«
»O nein. Wenn Sie mich zuerst aussteigen lassen, bemerkt sie nicht, daß Sie bei mir waren.«
»Na, ich denke, ihretwegen brauchen wir nicht so geheimnißvoll zu thun. Wir haben uns zufällig getroffen. Das ist Alles.«
»Dort steht Sie. Sie paßt auf.«
Ja, dort stand die Wirthin. Sie war gekommen, ihre Nichte vom Bahnhofe abzuholen, und hatte doch gar keine Nichte. Und das war folgendermaßen zugegangen.
Am frühen Morgen, eben als der Agent nach dem Bahnhofe gegangen war, kam der bereits mehrfach erwähnte Geheimpolizist zu Frau Berthold, welche auch bereits aufgestanden war.
Ueber einen so frühen Besuch verwundert, erstaunte sie noch mehr, einen vornehm gekleideten Herrn zu erblicken. Frühbesuche gehören ja gewöhnlich dem Handwerkerstande an.
»Frau Berthold?« fragte er freundlich.
»Das bin ich, mein Herr.«
»Kennen Sie mich?«
»Ja. Sie wohnen auf der Hauptstraße.«
»Und wissen Sie auch, wer ich bin?«
»Sie sind Rentier.«
»Wenn Sie meinen, daß ich von den Zinsen meines Vermögens lebe, so irren Sie sich. Haben Sie aber sagen wollen, daß ich von den Erträgnissen geistiger Anstrengung lebe, so bin ich freilich ein Rentier. Ich bin das.«
Er zog seine Polizeimedaille hervor und zeigte ihr dieselbe. Sie aber blickte ihn fragend an.
»Wissen Sie, was das zu bedeuten hat, Frau Berthold?« erkundigte er sich.
»Nein.«
»Aber das weiß ja Jedermann!
»Ich nicht. Ich bin eine einfache, anspruchslose Frau. Was so eine Münze, welche an der Uhrkette hängt, zu bedeuten hat, das ist mir fremd.«
»So muß ich es Ihnen erklären. Wenn nämlich ein Polizist seine Uniform
nicht trägt, so muß er diese Medaille bei sich führen, um sich als Beamter legitimiren zu können.«
»Aber ich sah Sie noch nie in Uniform!«
»Ich bin Detective und trage niemals eine Uniform.«
»Detective. Das verstehe ich auch nicht.«
»Das heißt geheimer Criminalpolizist.«
»Herrgott, was Sie mich erschrecken.«
»O bitte, Sie haben keine Veranlassung dazu. Ich bin nicht gekommen, Sie zu erschrecken.«
»Aber einen Grund haben Sie doch!«
»Allerdings.«
»Ein geheimer Criminalpolizist so in der Frühe bei mir! Das hat nichts Gutes zu bedeuten.«
»Leider bringt es mein Beruf mit sich, daß ich ziemlich überall unwillkommen bin. Ihnen aber sollte ich willkommen sein, denn ich bin da, um Sie vor großen Schaden zu bewahren.«
»Wirklich? Was ist geschehen?«
»Nichts. Es soll erst Etwas geschehen.«
»Was denn? Will man bei mir einbrechen? Bitte, reden Sie doch, mein Herr!«
Sie machte ein höchst ängstliches Gesicht. Der Polizist antwortete in beruhigendem Tone:
»Sorgen Sie sich nicht. Setzen Sie sich, und erlauben Sie auch mir, mich zu setzen!«
»Ja, ja, nehmen Sie Platz. Ich habe vor lauter Schreck das Allereinfachste vergessen, Ihnen einen Stuhl anzubieten.«
Als sie Platz genommen hatten, begann er:
»Zunächst muß ich Sie bitten, es heut und auch fernerhin zu verschweigen, daß ich ein Polizeibeamter bin.«
»Kein Wort sage ich!« betheuerte sie.
»Es könnte Sie das sonst in Unannehmlichkeiten bringen. Wir können unsere Pflicht viel leichter und schneller erfüllen, wenn die Verbrecher uns nicht kennen.«
»Das glaube ich; das glaube ich,« versicherte sie. »Es wird kein Wort über meine Lippen kommen.«
»Schön. Ich traue Ihrem Versprechen. Sie sind eine brave Frau und werden Wort halten.«
»Ach Gott, ja,« klagte sie. »Brav ist man; aber wenn Einem die Polizei schon früh sechs Uhr in das Haus kommt, so erschrickt man dennoch.«
»Ich wiederhole, daß Sie nicht zu erschrecken brauchen. Ich komme nicht Ihretwegen, sondern wegen einer Person, welche bei Ihnen wohnt.«
»Ah, wohl gar wegen den Herrn Polizeiinspector Schubert? Er ist also ein Herr College von Ihnen, und Sie werden ihn kennen.«
»Ich kenne ihn, aber ein College ist er nicht.«
»Ein Inspector von der Polizei!?«
»Das war er, aber er ist es nicht mehr. Er hat nicht einmal das Recht, sich so zu nennen. Wenn man ihn anzeigt, wird er bestraft.«
»Was Sie sagen!« staunte sie.
»Er ist nämlich abgesetzt worden.«
»Davon habe ich kein Wort gewußt.«
»Das glaube ich. Hätten Sie es gewußt, so hätten sie ihm Ihre Wohnung nicht vermiethet.«
»Gewiß nicht. So aber habe ich geglaubt, sehr beehrt worden zu sein.«
»Das Gegentheil, Frau Berthold.«
»Und wegen dem kommen Sie?«
»Ja. Er ist nämlich nicht nur ein abgesetzter Beamter, sondern nebenbei ein großartiger Schwindler – – –«
»O Du lieber Gott!« rief sie aus. »Und der wohnt bei mir? Was soll daraus werden!«
»Grad jetzt hat er einige Verbrechen im Plane, welche ihn vielleicht für das ganze Leben auf das Zuchthaus bringen können.«
»So muß er fort, fort, noch heut!«
»Halt, meine liebe Frau Berthold. Verfahren Sie nicht gar so schnell!«
»Je schneller, desto besser! Fort muß er, fort!«
»Und ich möchte Sie grad ersuchen, ihn bei sich zu behalten. Wollen Sie?«
»Kann mir nicht einfallen! Einen Verbrecher bei mir wohnen lassen? Niemals!«
»Aber es ist besser, wenn er da bleibt!«
»Meinen Sie? Ich bin eine ehrliche Frau. Soll ich mir meine Villa, die ich von meinem Seligen geerbt habe, durch so einen Menschen verschimpfiren lassen!«
»Von einem Verschimpfiren ist keine Rede. Es liegt im Interesse der Polizei, daß der Mann hier wohnen bleibt.«
»Wieso denn?«
Sie hatte ganz ihr gewöhnliches, bescheidenes Wesen verloren. Sie war rabiat geworden und blitzte den Polizisten mit zornigen Augen an.
»Der Mann muß beobachtet werden,« antwortete er.
»Dagegen habe ich nichts.«
»Und zwar hier bei Ihnen.«
»Dagegen habe ich viel!«
»Es paßt hier am Besten.«
»Aber mir paßt es nicht.«
»Es wird Ihnen dabei gar kein Hinderniß in den Weg gelegt und auch gar keine Unbequemlichkeit bereitet.«
»Ich danke ergebenst! Der Schwindler ist mir Hinderniß und Unbequemlichkeit genug!«
»Hier wissen wir, wie wir uns zu arrangiren haben. Zieht er aber aus, so fangen wir von vorn an.«
»Das geht mich nichts an.«
»Jetzt hat er keine Ahnung, daß wir ihn kennen und auf ihn aufpassen. Wenn Sie ihn ziehen heißen, ahnt er den Grund, auch wenn Sie ihm denselben nicht nennen.«
»Nicht nennen? Da irren Sie sich in mir. Ich werde ihm den Grund ins Gesicht sagen.«
»Das dürfen Sie nicht.«
»Oho! Ich fürchte mich nicht.«
»Er läßt Sie bestrafen.«
»Kann ich denn bestraft werden, wenn ich ihn einen Schwindler, einen Verbrecher nenne?«
»Allerdings.«
»Er ist es doch. Ich sage also die Wahrheit!«
»Können Sie es ihm beweisen?«
»Gesehen habe ich freilich nichts von ihm.«
»Also würden Sie bestraft werden.«
»Aber ich würde sagen, daß ich es von Ihnen erfahren habe.«
»Alle Wetter, sind Sie rabiat! Ich habe es Ihnen doch im Vertrauen mitgetheilt!«
»Das geht mich dann nichts an.«
»Amtsverschwiegenheit!«
»Ich habe kein Amt!«
»Aber wenn ich als Beamter Ihnen Verschwiegenheit anbefehle, haben Sie zu gehorchen. Gehorchen Sie nicht, so werden Sie bestraft.«
»Herrgott, ist das toll! Ich werde also bestraft, ich mag machen, was ich will!«
»O nein, gewiß nicht. Sie haben sich nur ruhig zu verhalten und nichts gegen mich zu unternehmen.«
»Gegen Sie? Das ist mir auch noch gar nicht in den Sinn gekommen.«
»Jawohl. Sie weigern sich, mir meinen Wunsch zu erfüllen. Das geben Sie doch zu?«
»Kann mich denn Jemand zwingen, einen Verbrecher bei mir zu behalten?«
»Nein. Und von einem Zwange ist auch gar keine Rede gewesen. Ich habe Ihnen nur so meine Vorstellung gemacht.«
»Ja, weiß schon! Nur so eine Vorstellung! So eine Vorstellung aber ist ein Zwang.«
»Gewiß nicht. Ich wiederhole sogar jetzt, daß ich Sie nur bittend, hören Sie, bittend ersuche, den Mann noch für kurze Zeit hier zu behalten.«
»Nein, das thue ich nicht.«
Die Frau war brav und selensgut. Sie konnte keinem Menschen eine billige Bitte abschlagen, aber in Punkto Ehre und Ehrlichkeit verstand sie keinen Spaß. Einen Verbrecher wollte sie auf keinem Fall im Hause dulden.
Der Polizist sah ein, daß er sie anders anfassen müsse. Was der Zwang und auch die Bitte nicht vermochte, das gelang vielleicht der Furcht.
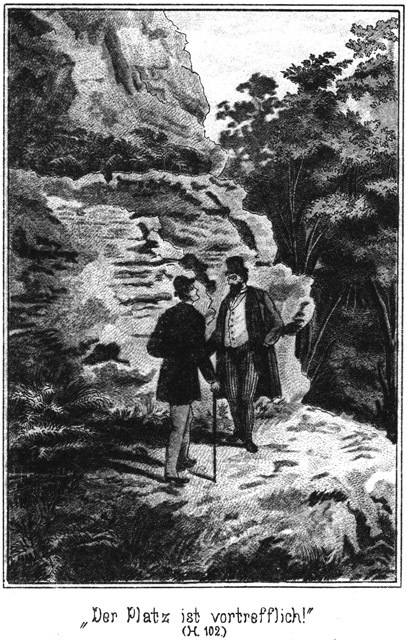
»Ganz wie Sie wollen,« sagte er. »Ich kam in guter Absicht. Sie verkennen dieselbe, und ich habe meine Pflicht gethan.«
»Die haben Sie gethan; das kann ich Ihnen bezeugen. Aber Ihren Wunsch kann ich nicht erfüllen.«
»Das thut mir leid. Leben Sie wohl, Frau Berthold.«
»Adieu, Herr!«
Er wendete sich zum Gehen. Als er sich schon unter der Thür befand, blieb er einen Augenblick überlegend stehen, drehte sich wieder um und sagte:
»Ehe ich gehe, will ich Sie doch noch warnen.«
»Vor wen?«
»Eben vor Ihren Miether.«
»Das haben Sie ja schon gethan. Sie haben mir ja schon gesagt, daß er ein Verbrecher ist!«
»Ich meine das Wort warnen anders. Ich wollte Sie mahnen, sich vor der Rache dieses Mannes in Acht zu nehmen.«
Er hatte das Richtige getroffen. Sie erbleichte.
»Rache?« fragte Sie. »Meinen Sie etwa, daß er sich rächen wird?«
»Ganz gewiß.«
»Kennen Sie ihn von einer solchen Seite?«
»Von noch schlimmeren Seiten.«
»Mein Gott! Ists wahr?«
»Ich will Ihnen ganz aufrichtig sagen: Wenn Sie ihn fortjagen, können Sie sich gefaßt machen.«
»Worauf denn?«
»Auf alles Mögliche. So einem Menschen ist eben Alles zuzutrauen.«
»Herr, ich erschrecke!«
»Vielleicht lauert er Ihnen auf!«
»Um mich zu ermorden?«
Sie sank leichenblaß in den Stuhl.
»Wenn auch das nicht, aber um Ihnen Eins auszuwischen. Passen Sie einmal auf!«
»Mir Eins auswischen! Mir, einer alten, schwachen Frau! Ich zittre an allen Gliedern!«
»Ob Sie alt und schwach sind, darnach fragt er nicht. Sie haben ihn beleidigt. Das ist genug.«
»Ich habe es ja noch gar nicht gethan!«
»Aber Sie wollen es thun.«
»Hm! Vielleicht unterlasse ich es!«
»Thun Sie es! Und wenn er sich auch nicht grad persönlich gegen Sie vergeht, so kann er sich doch leicht auf andere Weise rächen.«
»Wie denn?«
»Wie nun, wenn er Ihnen den rothen Hahn auf das Dach setzte?«
»Den rothen Hahn! Mein Herr und Gott! Mir ists, als ob es bereits an allen Ecken brennt!«
»Ich warne Sie nur!«
»Ich höre schon die Flammen knistern.«
»Geben Sie mir einen Rath, Herr!«
»Den habe ich Ihnen schon gegeben.«
»Daß ich den Mann hier behalte?«
»Ja.«
»Das ist aber doch erst recht gefährlich!«
»O nein.«
»Den Verbrecher im Hause!«
»Ein Dieb stiehlt niemals im eigenen Hause, sondern nur außerhalb desselben.«
»Ist er denn auch ein Dieb? Stiehlt er?«
»Das kann ich nicht behaupten. So was man gradezu stehlen nennt, das thut er wohl nicht.«
»Sie meinen also, daß er nicht bei mir einbrechen würde?«
»Gewiß! Ihnen thut er sicher nichts.«
»Da athme ich wieder auf.«
»Also überlegen Sie sich die Sache, ob Sie ihn wirklich noch fortjagen wollen!«
»Herr, es ist eine böse Geschichte. Aber besser ists doch vielleicht, ich folge Ihnen.«
»Da haben Sie freilich Recht.«
»Aber wenn er hier bleibt, komme ich den ganzen Tag und vollends gar des Nachts nicht aus der Angst heraus.«
»Es wird nur wenige Tage dauern.«
»Geht er dann fort?«
»Ja. Drei oder vier Tage.«
»So lange wäre es wohl auszuhalten.«
»Gewiß.«
»Im Nothfalle könnte ich mir ja Jemand ins Haus nehmen, einen tüchtigen, stämmigen Kerl.«
»O nein. Das würde auffallen.«
»Meinen Sie?«
»Gewiß. Ueberhaupt wozu einen stämmigen Menschen? List ist da besser als Gewalt.«
»Das ist wohl möglich. Also müßte ich mich nach einer recht listigen Person umsehen.«
»Das ist freilich gerathener.«
»Aber wo eine finden? Wer da hört, um was es sich handelt, der kommt sicherlich nicht, und wenn ich den besten Tagelohn bezahle.«
»Ich wüßte eine passende Person.«
»So? Das wäre gut, sehr gut. Ist sie listig?«
»Außerordentlich.«
»Aber dabei doch ehrlich?«
»Jawohl. Sie würde Ihnen lieber hundert Mark geben, als einen Pfennig nehmen.«
»So eine Ehrlichkeit lasse ich mir freilich gefallen.«
»Auch hätten Sie nichts zu zahlen.«
»Das wäre freilich billig.«
»Im Gegentheile würde die Person Ihnen Kost und Logis bezahlen.«
»Das wäre ja unbegreiflich.«
»Ist aber dennoch sehr erklärlich.«
»Wer ist denn diese Person?«
»Meine Schwester.«
»Ihre Schwe – Schwester?«
»Ja. Begreifen Sie mich nun?«
»Ich begreife vor der Hand gar nichts.«
»Aber es ist doch leicht zu verstehen!«
»Nein. Ihre Schwester will zu mir, um mich gegen den Schwindler zu beschützen. Sie will bei mir wachen und auch noch Kost und Logis bezahlen?«
»So ist es. Meine Schwester kann das. Sie bekommt es ja selbst auch bezahlt.«
»Von wem denn?«
»Von mir, von der Polizei.«
»Ach so! Jetzt kommt mir der richtige Gedanke. Der Mensch soll von Ihrer Schwester bewacht werden?«
»So ist es. Würde man ihm einen männlichen Aufseher setzen, so würde er das vielleicht bemerken. Bei einer weiblichen Wächterin ist das aber nicht der Fall.«
»Wie schlau! Aber Ihre Schwester kann ihm doch nicht draußen nachlaufen!«
»Das soll sie auch nicht; dazu bin ich da. Sie soll ihn nur in Ihrem Hause beobachten. Sie soll sehen, was er da thut und treibt.«
»Schon! Gut! So mag sie kommen, aber bald!«
»Nur Geduld! Noch sind wir nicht fertig. Er darf natürlich keine Ahnung haben, wer meine Schwester ist.«
»Das versteht sich!«
»Oder gar, daß sie ihn beobachtet!«
»Das fehlte noch.«
»Darum müssen wir eine Ausrede ersinnen, die es ihm plausibel macht, daß meine Schwester zu Ihnen kommt.«
»Ganz richtig. Ein Dienstmädchen soll sie wohl nicht spielen?«
»Nein. Dazu ist ihr Aussehen zu nobel.«
»Aber was sinnen wir uns sonst aus!«
»Ich wüßte Etwas, was das Passendste wäre. Wissen Sie, ich bin mit Ihnen verwandt.«
»Davon weiß ich kein Wort!« meinte sie im Tone des Erstaunens.
»Ich auch nicht,« lachte er. »Aber wir wollen so thun. Meine Schwester Ist Ihre Nichte.«
»Schön, also blos so thun. Dann bin ich die Taute.«
»Ja, und meine Schwester kommt zu Ihnen auf Besuch.«
»Das wäre ja herrlich!«
»Nicht wahr? Sie wohnt in der Residenz und hat Sie benachrichtigt, daß sie heut mit dem Vormittagszug kommen will.«
»Ist das wahr?«
»Ja.«
»Sie kommt wirklich?«
»Gewiß. Was ich Ihnen da sage, das ist Alles bereits mit meiner Schwester besprochen. Sie ist nach der Residenz und wird mit dem Zuge kommen.«
»Das ist ja prächtig!«
»Wissen Sie, was ich Ihnen im Vertrauen sage, Ihr Schubert ist auch nach der Residenz und – – –«
»Das wissen Sie?«
»Wie Sie hören!«
»Mir hat er nichts gesagt.«
»Mir auch nicht; aber die Polizei weiß Alles. Er will sich dort verschiedene Gegenstände kaufen, welche er zur Ausführung seines nächsten Verbrechens braucht. Dabei wird ihn meine Schwester heimlich beobachten. Dann richtet sie es so ein, daß sie in ein Coupée mit ihm kommt.«
»Kann sie das denn?«
»Ich habe Ihnen ja gesagt, daß sie listig ist, Sie wird das sehr leicht fertig bringen. Sie fahren also mit einander hierher. Natürlich sprechen sie da mit einander, und da wird meine Schwester sagen, daß sie Lina Berthold heiße und zu ihrer Tante Frau Berthold hier auf der Schillerstraße zu Besuche wolle.«
»Vortrefflich!«
»Natürlich wird er ihr sofort mittheilen, daß er bei dieser Tante Bertholt wohne. Das giebt eine rasche Bekanntschaft, und so ahnt er gar nicht, daß sie zu seiner geheimen Aufseherin gesetzt ist.«
Die Frau schlug die Hände zusammen und rief:
»Nein, was die Polizei Alles fertig bringt! Das sollte man gar nicht glauben!«
»Gefällt es Ihnen?«
»Natürlich.«
»Dann spazieren Sie nach dem Bahnhofe und holen Ihr liebes Nichtchen ab.«
Von diesem Gedanken fühlte sich die alte, gute Wittwe förmlich electrisirt.
»Abholen, vom Bahnhofe abholen!« rief sie. »Das thue ich so gern, und habe das Vergnügen doch seit Jahren nicht mehr haben können. Ja, ja ich hole sie ab. Wie freue ich mich darauf!«
Sie lief in der Stube auf und ab, hin und her, als wolle sie sich schon alle zum Ankleiden und Ausgehen nothwendigen Gegenstände herbeiholen.
»Nehmen Sie sich Zeit, meine liebe Frau Berthold!« lachte der Polizist. »Solche Eile hat es ja nicht. Sie haben noch vier Stunden Zeit!«
»Ach ja, es ist ja wahr! Richtig! Aber wird sie denn auch gewiß und wirklich kommen?«
»Ja.«
»Nicht etwa den Zug versäumen?«
»Nein.«
»Das wäre schade, jammerschade! Nein, wie mich das freut! Und wie soll ich sie rufen? Wie heißt sie?«
»Lina.«
»Lina. Das klingt gut. Also Fräulein – – –«
»Um aller Welt willen nicht Fräulein. So nennt doch eine Tante ihre Nichte nicht!«
»Aber sie ist ja die rechte Nichte gar nicht!«
»Sie muß aber dafür gelten. Er steht dabei und hört jedes Wort, welches gesprochen wird. Er würde schöne Augen machen, wenn Sie Ihre Nichte Fräulein nennen wollten.«
»Hm, Recht haben Sie.«
»Sie haben Sie also Lina zu nennen, meine liebe Lina. Und Sie werden hören, daß meine Schwester Sie sogleich ihre liebe, gute Tante nennt.«
»Liebe, gute Tante!« rief die Frau, die Hände andächtig zusammenschlagend.
»Ja, jedenfalls werden Sie von meiner Schwester geküßt.«
»Geküßt! Du lieber Gott!«
»So nahe Verwandte küssen sich doch.«
»Allerdings, aber – –«
»Kein Aber! Sie müssen eben genau so thun, als ob Sie wirkliche Verwandte seien.«
»Wie alt ist sie denn?«
»Fünfundzwanzig.«
»So ein junges Blut soll mich küssen, mich alte Frau! Ist sie denn hübsch?«
»Sogar sehr hübsch.«
»Ich glaube, da laufe ich vor lauter Wonne wie Butter auseinander!«
»Und Berthold heißt sie auch. Ueberlegen Sie sich das, wenn Schubert vielleicht darnach fragen sollte. Der Bruder Ihres Mannes ist der Vater meiner Schwester.«
Sie blickte ihn rathlos an und sagte dann confus:
»Da wäre doch der Vater Ihrer Mutter der Mann meines Bruders.«
»Unsinn,« lachte der Polizist laut auf. »Sie werden vor Vergnügen ganz und gar irr. Sorgen Sie dafür, daß Ihre Gedanken in Ordnung bleiben!«
»Das hat gute Weile. Wenn man Besuch bekommt, weil man einen Spitzbuben im Hause hat, so geht alles drunter und drüber!«
»Meine Schwester wird Sie schon instruiren. Die Hauptsache ist, daß die Begrüßung gut und fehlerlos von statten geht.«
»Schön! Ich will mir sogleich die seidene Mantille zurecht legen und den kleinen Herbstmuff. Auf dem Bahnhof geht gewöhnlich ein zugiges Lüftchen.«
»Ja, richten Sie sich hübsch vor, und machen Sie Toilette. Was meine Schwester bei Ihnen braucht, wird bezahlt.«
»Da wolle mich der liebe Gott behüten! Meine Nichte, die Lina, hat nichts zu bezahlen!«
Da brach er abermals in ein herzliches Lachen aus und rief vergnügt:
»Ausgezeichnet! Sie beginnen, sich in Ihre Rolle einzuleben. Sie werden sie vortrefflich spielen.«
»Wenn mir das Nichtchen gut gefällt, gebe ich sie vielleicht gar nicht wieder her!«
»Noch besser! Wollen hoffen, daß diese Bekanntschaft zur gegenseitigen Zufriedenheit ausfällt. Jetzt aber bin ich mit meiner Instruktion zu Ende und will gehen. Verrathen Sie Schubert nicht, daß ich dagewesen bin!«
»Soll mir nicht einfallen, lieber Herr – Neffe!«
»Besten Dank! Ich sehe, daß Sie Ihre Sache ausgezeichnet machen werden. Also, guten Morgen, bestes Tantchen!«
Sie schüttelten sich herzlich die Hände, und er ging. Die Wittwe blickte ihm nach, so lange sie ihn sehen konnte und sagte dann zu sich:
»Ein Polizist, und noch dazu gar ein crimineller! Was man von solchen Herren für eine falsche Vorstellung hat. Dieser Mann war prächtig. Ich wollte, er wäre in Wirklichkeit mein Neffe. Na, auf die Nichte freue ich mich! Wenns die Beiden wirklich wären, so hätte ich wenigstens Erben, denen ich meine Villa vom Seligen gönnen könnte.«
Der ›Neffe‹ ging in der Richtung nach dem Bahnhofe zu, bog aber kurz vor demselben rechts ab und schritt einem größeren Gebäudecomplexe zu, welcher aus der Entfernung von wohl einer halben Stunde zur Stadt hereinschimmerte.
Das war der Meierhof, in welchem der Agent und der Pascha beabsichtigten, den einstigen Derwisch unterzubringen.
Er gab sich den Anschein eines Spaziergängers, welcher beabsichtigte, die frische Morgenluft zu genießen. Solche Leute waren auf dem Meierhofe nichts seltenes. Sie kamen, um sich ein Glas Milch geben zu lassen und sich dann auf den weichen Wies- und Waldwegen zu ergehen.
Er hatte früher einmal Veranlassung gehabt, sich der Besitzerin des Meierhofes zu decouvriren. Seit jener Zeit kannte sie ihn und hielt ihn hoch, denn er hatte sie vor einem großen Verluste bewahrt.
Als sie ihn kommen sah, kam sie ihm entgegen, denn sie zeichnete ihn seit jener Zeit dadurch aus, daß sie ihn selbst bediente. Sie öffnete ihm sogar die Thür zur guten Stube und brachte ihm eigenhändig die gewünschte Milch herbei.
Im Laufe des Gespräches fragte er:
»Wie kommt es doch eigentlich, daß hier bei Ihnen keine Sommerfrischler wohnen?«
»Das hat wohl zweierlei Gründe,« antwortete sie. »Der erste Grund bin ich.«
»Weil Sie keine Gäste wollen.«
»Ja. Sie verursachen Störung, und was sie ja zahlen, das brauche ich nicht zu rechnen. Und sodann liegt der Hof allzu weit von der Stadt entfernt. Zum Herausspazieren mag es gehen. Zum Hierwohnen aber ist es nichts.«
»Wenn sich nun doch Jemand fände, der herziehen wollte?«
»Das passirt nicht.«
»Und wenns doch passirte?«
»So fragt es sich, ob ich einwilligte. Es müßten sehr hübsche Leute sein, oder man müßte sie mir empfohlen haben.«
»Wer denn?«
»Irgend ein Bekannter, auf den ich etwas halte, so zum Beispiele Sie.«
»Fast möchte ich Sie beim Worte halten.«
»So? Haben Sie Jemand?«
»Ja.«
»Einen Herrn?«
»Nein, zwei Damen.«
»O weh!«
»Warum?«
»Damen machen dreimal mehr Ansprüche als Herren und sind mit dem Zahlen doch zwanzigmal knickriger.«
»Die, welche ich meine, nicht.«
»So? Es sind Verwandte?«
»Nein. Sie gehen einander gar nichts an.«
»Also zufällig zusammengetroffen?«
»Auch nicht. Sie haben einander noch gar nicht gesehen.«
»Und wollen doch mit einander hier bei mir wohnen? Das ist sonderbar!«
»Verstehen Sie wohl: Zusammenwohnen wollen sie nicht. Keine weiß bis jetzt von der Anderen etwas.«
»So, so ist es! Nur Sie wissen es; das heißt, die Polizei weiß es? Nicht wahr?«
»Ja, meine Beste.«
»Sie wollen zwei Damen gut unterbringen und wenden sich da an mich. Nun, da Sie es sind, will ich Ja sagen.«
»Danke!«
»Andere hätte ich abgewiesen.«
»Da ist es gut, daß ich gekommen bin.«
»Wissen die Damen denn, daß Sie ihren Quartiermacher machen sollen?«
»Nein, und sie sollen es auch nicht erfahren.«
»Wer sind sie denn eigentlich?«
»Das weiß ich selbst noch nicht.«
»Was! Sie wissen es nicht? Das ist ja geradezu fremdartig. Es sind doch nicht etwa gar schlechte Frauenzimmer?«
»O nein; solche würde ich Ihnen ja gar nicht zuweisen. Die Sache ist folgende: Es wird heut Vormittag ein Herr kommen, der Agent Schubert, welcher – –«
»Den kenne ich!«
»So?«
»Ja, er ist einige Male hier gewesen. An dem liegt mir allerdings nicht viel oder wohl gar nichts. Also der will kommen? Hat der seine Hand dabei im Spiele?«
»Ja.«
»So möchte ich lieber gar nichts mit dieser Angelegenheit zu thun haben.«
»Auch nicht, wenn ich es wünsche?«
»Auch dann nicht, denn wenn der dabei in Betracht kommt, so kann die Betreffende nicht viel taugen.«
»Sie taugt allerdings nicht viel.«
»Wie? Und das sagen Sie mir!«
»Wie Sie hören.«
»So offen und in solcher Gemüthsruhe! Ich sehe sogar, daß Sie lächeln!«
»Wenn ich weinte, würde es nicht anders sein.«
»Ja, ich kenne Sie. Sie haben irgend eine Absicht, welche Sie verfolgen, und ich soll die Hand dazu bieten.«
»So ist es allerdings.«
»Ich sage Ihnen aber nochmals aufrichtig, daß ich trotz Ihrer Empfehlung keine Lust dazu habe.«
»Das ist mir unlieb. Ich habe geglaubt, mein Wort gelte etwas bei Ihnen.«
»Das gilt es auch; aber soll ich Leute hernehmen, welche mir nicht behagen?«
»Die betreffende Dame wird gar keine Ansprüche machen.«
»So heißt es erst; dann kommt der hinkende Bote.«
»Hier ist es wirklich der Fall. Sie wird sehr einsam auf ihrem Zimmer wohnen und sich fast gar nicht sehen lassen.«
»Und weiter?«
»Bedienung wird sie auch nicht viel beanspruchen, wie ich voraussehen kann.«
»Ist sie so bescheiden?«
»Sie ist zur Bescheidenheit gezwungen.«
»Also arm?«
»Sie wird von Anderen unterhalten.«
»Das könnte mich rühren; aber es ist doch etwas dabei, was mir nicht gefällt.«
»Was denn?«
»Das kann ich nicht sagen, weil ich es selbst nicht weiß; aber ich ahne es. Erlauben Sie mir, daß ich lieber davon absehe!«
»Hm! Ich muß Ihnen mittheilen, daß die Behörde es wünscht, daß sie hier wohnt.«
»Ah, hat die Behörde die Hand im Spiele?«
»Sehr.«
»Hm! Wären Sie es nicht, so würde ich mich dennoch weigern. Es gefällt mir nicht.«
»So aber sagen Sie Ja?«
»Ich muß wohl.«
»Nun, so wird noch an diesem Vormittage der Agent Schubert zu Ihnen kommen und anfragen, ob Sie nicht eine Wohnung für eine einzelne Frau habe». Sagen Sie Ja, aber suchen Sie so viel wie möglich zu verdienen. Stellen Sie den Preis nicht niedrig.«
»Dieser Schubert würde auf keinen Fall etwas von mir geschenkt erhalten.«
»Nicht viel später wird ein fremdes Ehepaar kommen, ein kleiner, dicker, gemüthlicher Herr mit seiner Frau, für welche er auch eine Wohnung verlangt.«
»Und die soll ich ihm geben?«
»Ja.«
»Ist er vornehm?«
»Nein. Aber im Vertrauen will ich Ihnen sagen, daß er ein Freund unseres Prinzen ist.«
»Was Sie sagen!«
»Ja. Er weiß sonderbarer Weise aber selbst noch gar nichts davon.«
»Wie kommt das?«
»Er hat dem Prinzen große, sehr große Dienste erwiesen ohne aber zu wissen, daß es ein Prinz ist. Er hielt ihn für einen einfachen Mann.«
»Das ist ja sehr interessant!«
»Allerdings.«
»Da soll seine Frau meine besten Zimmer bekommen, und zwar sehr gern.«
»Nicht so eilig. Es giebt noch etwas dabei zu überlegen. Nämlich die zweite Dame kommt wegen der ersteren.«
»Und doch kennen sie sich nicht?«
»Und doch haben sie einander nie gesehen.«
»Wie ist das zu erklären?«
»Sehr einfach, obgleich ich Ihnen nicht Alles sagen kann. Der Agent ist ein Feind des Prinzen. Er bringt seine Dame bei Ihnen unter. Der dicke Herr, dessen Name Barth ist, der sich aber anders nennen wird, ist ein Freund des Prinzen und bringt seine Frau, damit sie die Erstere beobachten kann.«
»Sonderbar, sehr sonderbar!«
»Sie müssen also die Wohnungen der Beiden so auswählen, daß die Eine nichts thun kann, ohne daß die Andere es genau zu beobachten vermag. Haben Sie solche Zimmer?«
»Gewiß.«
»Und wollen Sie?«
»Das versteht sich.«
»Aber kein Mensch darf erfahren, was wir hier gesprochen haben.«
»Auch die zweite Dame nicht?«
»Mit dieser können Sie allenfalls davon reden, aber ja so, daß Niemand es belauscht!«
»Haben Sie keine Sorge!«
»Am besten ists, Sie bekümmern sich um Beide gar nicht, suchen aber der zweiten in jeder Weise förderlich zu sein. Besonders wenn es sich darum handelt, einen eiligen Boten nach der Stadt zu schicken, darf es Ihnen nicht darauf ankommen, nöthigenfalls ein Pferd zum Reiten aus dem Stalle ziehen zu lassen, selbst mitten in der Nacht. Es wird Alles bezahlt.«
»Sprechen Sie davon nicht. Das ist ja bei mir Nebensache.«
»Ich weiß es. Haben Sie sich vielleicht noch nach etwas zu erkundigen?«
»Nein.«
»So will ich aufbrechen.«
Er wollte seine Milch bezahlen, aber sie nahm nichts. Er ging wieder nach der Stadt. Dort traf er zufälliger Weise Sam und theilte ihm kurz mit, was er verabredetermaßen vorbereitet hatte.
Bei einander bleiben konnten sie nicht, um nicht etwa von dem Pascha bei einander gesehen zu werden.
Später ging der Polizist nach dem Bahnhofe, um die Ankunft des Zuges zu erwarten.
Er trat in das Zimmer, welches ausschließlich für die Polizei reservirt war. Von da aus konnte er den ganzen Perron überblicken, ohne selbst beobachtet zu werden.
Da sah er Sam, den Dicken, stehen und ließ ihn zu sich herein holen.
»Sie wollen Ihre Frau abholen?« fragte er ihn.
»Meine Braut!« verbesserte Sam.
»Egal! Da sollten Sie sich nicht da draußen hinstellen.«
»Warum nicht?«
»Wenn Schubert Sie erblickt, kann der ganze Plan zu schanden werden.«
»Ich möchte doch wissen, wie?«
Der Polizist hielt sich für pfiffig, und Sam war auch der Ansicht, daß er kein Dummkopf sei. So sahen sie sich ein Weilchen lächelnd an; dann erklärte der Erstere:
»Der Agent darf doch Ihre Braut nicht kennen lernen.«
»Warum denn nicht? Er soll sie grad sehen!«
»Aber er darf nicht wissen, daß sie Ihre Braut ist.«
»Ach, so meinen Sie es!«
»Ja. Wenn nun Ihre Braut mit dem jetzigen Zuge kommt, so –«
»Das wird sie freilich. Sie hat es mir von der Grenzstation aus telegraphirt.«
»Nun sehen Sie! Sie werden also mit mir von dem Agenten gesehen werden.«
»Wer sagt das?«
»Ich. Sie werden sie doch empfangen?«
»Fällt mir nicht ein!«
»Nicht? Warum nicht?«
»Eben weil ich nicht so dumm bin, wie Sie denken. Nicht die Polizisten allein sind pfiffig. Ich sage Ihnen, daß ich aus Sibirien komme und meine Auguste seit achtzehn Monaten nicht gesehen habe. Wir sehnen uns nach einander, als ob wir erst achtzehn Jahre alt wären, aber wenn Auguste aussteigt und mich auf dem Perron stehen sieht, so geht sie an mir vorüber wie an einem wildfremden Menschen.«
»Das schrieben Sie ihr wohl?«
»Dazu gab es keine Zeit. Ich habe es ihr telegraphirt. Ich sage Ihnen, es ist doch herrlich, wenn man verliebt ist und auf dem Telegraphen so ein bischen hin und her klappern kann. Nichts geht über dieses Vergnügen. Hätte es damals in Herlasgrün schon einen Telegraphen gegeben, so wäre – – horch, der Zug kommt!«
Das Glockenzeichen ertönte, und Sam eilte hinaus. Da stand die gute Frau Berthold in ihrer Seidenmantille und mit dem kleinen Herbstmuff und blickte mit hellen, erwartungsvollen Augen dem Zuge entgegen.
Sam kannte sie; er hatte sich bemüht, sie einmal zu sehen zu bekommen. Darum lächelte er still in sich hinein.
Der Zug hielt, die Thüren wurden geöffnet, und die Passagiere stiegen aus. Leicht wie ein Reh kam Lina aus ihrem Coupée gehüpft. Schubert hatte sie unterstützen wollen, war aber damit zu spät gekommen.
»Tante, meine liebe, gute Tante!« rief sie voller Freude und eilte auf die Alte zu, welche nach links und rechts geblickt hatte, wo die Nichte wohl herkommen werde.
Sie schlang die Arme um sie und küßte sie zärtlich auf Mund und Wangen.
Die Tante war vor Entzücken einen Augenblick lang sprachlos. So hübsch, so schön hatte sie sich die neue Nichte denn doch nicht vorstellen können.
»Mein Gott,« stammelte sie. »Sie sind, Sie – – –«
»Pst!« flüsterte Lina schnell. »Da kommt Schubert. Nimm Dich zusammen, Tantchen.«
Das gab der guten Frau die Fassung wieder. Sie das schöne Mädchen an sich und rief strahlenden Auges:
»Lina, mein Nichtchen, welche Freude, nein, welche Freude für mich!«
Schubert hatte mittlerweile seine Packete dem Portier zum Aufheben gegeben und kam jetzt herbei.
»Verehrteste Frau Wirthin,« sagte er in verbindlichstem Tone, »ich habe Ihnen auf das herzlichste zu gratuliren.«
»Wozu denn?« fragte sie mit erzwungener Freundlichkeit.
»Zu Ihrer Nichte. Was müssen Sie doch für eine glückliche Tante sein.«
»Die bin ich allerdings. Nicht wahr, Lina?«
Lina nickte ihr lächelnd zu und antwortete:
»O, ich kann viel, viel stolzer auf meine Tante sein als sie aus mich. Das ist stets so gewesen. Ich war immer ein recht zuwideres Ding.«
Da beeilte sich Frau Berthold zu antworten:
»Nein, gewiß nicht. Du warst immer ein braves, gutes Nichtchen. Mach Dich nicht schlecht.«
»Wie es scheint, werde ich den Schiedsrichter machen müssen,« scherzte Schubert.
»Komm, Tantchen, wir nehmen eine Droschke,« rief Lina.
»Droschke? Wollen wir nicht gehen?«
»Nein. Wir wollen unsere alten Beinchen schonen.«
»O, ich wäre doch so gern gelaufen!«
Sie wäre so stolz gewesen, neben dem schönen Mädchen hergehen zu können; aber Lina hatte ihre Gründe, dies nicht zu gestatten. Sie fuhren ab, nachdem sie sich in kurzer Weise von dem Agenten verabschiedet hatten, und Lina begann sofort, der neu creirten Tante ihre Instructionen zu ertheilen.
Der Agent begab sich directen Weges nach dem Meierhofe. Dort angekommen, verlangte er in seiner wenig höflichen Weise nach der Besitzerin. Aus diesem Grunde ließ sie ihn grad recht lange warten.
Als sie endlich kam, fragte er, indem er die Brauen finster zusammenzog: »Sie hatten wohl keine Zeit?«
»Nein,« antwortete sie kurz.
»Ich komme, um Ihnen Geld zu verdienen zu geben.«
»Das Geld, welches mir die Sommerfrischler bringen, kann gezählt werden.«
»Aber Sie erhalten es doch!«
»Umsonst nicht!«
»Uebertreiben Sie nicht. Sind Ihre Zimmer alle besetzt?«
»Welche Zimmer?« fragte sie verwundert.
»Nun, Ihre Fremdenstuben.«
»Ich habe keine Fremdenstuben.«
»Sie vermiethen doch?«
»Nein.«
*