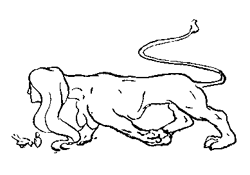|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Eben hatte es Mittag geschlagen. Die Schulthüre öffnete sich und die Knaben stürmten lärmend und drängend heraus. Anstatt aber, wie sonst täglich, sich schnell zu zerstreuen und zum Essen zu eilen, blieben sie jetzt nach einigen Schritten stehen und steckten eifrig flüsternd die Köpfe zusammen.
Heute war nämlich Simon, der Sohn der Blanchotte, zum ersten Male zur Schule gekommen.
Jeder von ihnen hatte zu Hause von der Blanchotte sprechen gehört; und obschon man sie öffentlich sehr gut aufnahm, sprachen die Mütter unter sich über sie mit einer Art verächtlichem Mitleid. Dies hatte sich auch auf die Kinder übertragen, ohne dass sie eigentlich recht wussten warum.
Simon selbst hatten sie vorher noch gar nicht gekannt, denn er ging niemals aus und trieb sich nicht mit ihnen auf der Dorfstrasse oder am Flussufer herum. Schon deshalb mochten sie ihn nicht leiden; und es bereitete ihnen eine gewisse allerdings mit Erstaunen vermischte Freude, als sie jetzt eine Neuigkeit erfuhren, die sofort von Mund zu Mund ging. Ein Junge von vierzehn oder fünfzehn Jahren hatte sie mitgebracht. Er schien sie übrigens schon länger zu wissen, denn er zwinkerte listig mit den Augen, als er zu ihnen sagte:
»Wisst Ihr . . . der Simon . . . nun, er hat keinen Vater.«
Der Sohn der Blanchotte trat in diesem Augenblick über die Schwelle der Schulthüre. Er war sieben oder acht Jahre alt, etwas bleich, sehr sauber angezogen und von furchtsamem, beinahe linkischem Wesen. Er wollte gerade zu seiner Mutter nach Hause gehen, als seine Schulgefährten, die immer noch flüsternd in Gruppen beisammen standen und ihn mit jenem tückischen und grausamen Blick der Kinder betrachteten, aus dem die Absicht irgend eines bösen Streiches spricht, sich ihm langsam näherten und ihn schliesslich ganz dicht umringten. Er blieb überrascht und verlegen mitten unter ihnen stehen, ohne recht zu begreifen, was sie eigentlich wollten. Aber der Bengel von vorhin, der noch ganz stolz auf die Neuigkeit war, die er den anderen gebracht hatte, frug ihn:
»Du, wie heisst Du?«
»Simon!« antwortete er.
»Simon, was?« frug der andere weiter.
»Simon«, wiederholte das Kind ganz bestürzt.
»Man heisst doch nicht nur Simon . . . das ist doch kein eigentlicher Name . . . Simon« rief ihm der Bengel zu.
»Ich heisse Simon«, sagte das arme Kind, dem jetzt die Thränen nahe standen, zum dritten Male. Die Jungens begannen zu lachen.
»Seht Ihr nun, dass er keinen Vater hat?« rief der Bengel triumphierend aus.
Hierauf entstand tiefes Schweigen. Die Kinder waren ganz bestürzt durch diese seltsame, fast undenkbare Thatsache, – ein Junge, der keinen Vater hatte; – sie betrachteten ihn wie ein Wunderding, ein unnatürliches Wesen, und allmälig griff auch in ihnen jene Verachtung Platz, die sie bisher bei ihren Müttern bemerkt hatten, ohne sie zu verstehen.
Simon hatte sich an einen Baum gelehnt, um nicht umgestossen zu werden, und stand nun erschreckt und verwirrt vor ihnen. Er suchte nach einer Erklärung, aber er fand nichts, womit er die schreckliche Thatsache, keinen Vater zu haben, hätte widerlegen können. Endlich rief er ihnen auf gut Glück zu:
»Wenn ich aber einen habe?«
»Wo ist er denn?« frug der grosse Bengel.
Simon schwieg; er wusste es ja nicht. Die Kinder lachten wie toll. Diese Bauernjungen, tierisch von Natur aus, fühlten eine grausame Lust ähnlich der, wie sie die Hühner haben, wenn sie eines von ihnen, das krank oder verletzt ist, mit ihren Schnäbeln gänzlich umbringen. Plötzlich bemerkte Simon unter der Schar einen kleinen Nachbarn, den Sohn einer Witwe, den er immer allein mit seiner Mutter gesehen hatte.
»Und Du«, sagte er, »Du hast ja auch keinen Papa.«
»Wohl«, antwortete der Andere, »ich habe einen.«
»Wo ist er denn«, warf Simon ein.
»Er ist tot«; erklärte das Kind mit stolzer Zuversicht, »mein Papa liegt im Grabe.«
Ein Beifallsgemurmel lief durch die Schar der Jungen, als wenn die Thatsache, einen toten Vater im Grabe zu haben, ihren Kameraden bedeutend gehoben hätte, während der Andere sich mit nichts dergleichen rühmen konnte. Und diese Gassenbuben, deren Väter in der Hauptsache Taugenichtse, Trinker, Diebe und schlechte Ehemänner waren, drängten sich immer enger zusammen, als wollten sie den gewaltsam ersticken, der ihnen ausserhalb des Gesetzes zu stehen schien.
Plötzlich streckte der eine, der sich Simon gerade gegenüber befand, ihm mit verächtlicher Miene die Zunge aus und rief:
»Keinen Papa, keinen Papa!«
Simon fasste ihn mit beiden Händen beim Schopfe und stiess ihn mit den Füssen, während er ihn heftig in die Backe biss. Nun ging eine gewaltige Rauferei los. Die beiden Kämpfenden wurden getrennt, und Simon fühlte sich gerissen, gestossen und in einem Kreise von Jungens auf der Erde herumgewälzt, welche alle lebhaft Beifall klatschten. Als er wieder aufstand und mechanisch mit den Händen sein Röckchen vom Staube säuberte, rief ihm einer zu:
»Geh und sag's Deinem Papa!«
Da empfand er in seinem kleinen Herzen einen grausamen Schmerz. Sie waren stärker wie er; sie hatten ihn beschimpft und er konnte ihnen nichts antworten, denn er fühlte es nur zu gut: Es war richtig; er hatte keinen Papa. Stolz suchte er eine Weile gegen die aufquellenden Thränen anzukämpfen; aber schliesslich überwältigte es ihn. Ein inneres Schluchzen erschütterte seinen Körper, dann rannen langsam, ohne dass er einen Ton von sich gab, die Thränen in grossen Tropfen über seine Wangen.
Dies erregte bei seinen Feinden ein wildes Freudengeheul; sie fassten sich bei den Händen und tanzten um ihn herum, wie es die Wilden bei ihren schrecklichen Opferfesten machen. Dabei riefen sie fortwährend: »Keinen Papa! Keinen Papa!«
Aber plötzlich hörte Simon auf zu weinen; eine sinnlose Wut ergriff ihn. Vor ihm lagen Steine auf dem Boden; er hob sie auf und schleuderte sie mit aller Kraft nach den kleinen Teufeln. Drei oder vier derselben wurden getroffen und rannten laut heulend davon. Seine Mienen hatten einen so wilden Ausdruck angenommen, dass auch die übrigen ein panischer Schreck ergriff. Feige, wie es stets die Menge vor dem Zorne eines Einzelnen ist, lösten sie ihre Reihen auf und suchten ihr Heil in der Flucht.
Als der arme Kleine sich allein sah, rannte er nach dem Felde zu; denn es war ihm plötzlich eine Erinnerung aufgetaucht, die in seinem kleinen Gehirn eine vollständige Umwälzung hervorrief: Er wollte sich im Flusse ertränken.
Es fiel ihm nämlich ein, dass vor wenigen Tagen ein armer Teufel, der sich mühsam durch die Welt bettelte, sich ins Wasser gestürzt hatte, weil er kein Geld mehr besass. Simon war zugegen, als man ihn herausfischte, und der arme stille Mann, der ihm sonst höchst beklagenswert, schmutzig und widerwärtig vorgekommen war, hatte diesesmal durch die Ruhe seiner Züge, mit seinen bleichen Wangen, dem langwallenden vom Wasser geglätteten Barte und den friedlich blickenden offenen Augen einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. »Er ist tot«, hatte der Eine gesagt, und »Er ist jetzt glücklich« der Andere.
Simon wollte sich ebenfalls ertränken, weil er keinen Vater mehr hatte, wie es jener Unglückliche machte, als ihm das Geld zum Leben ausging.
Er trat ganz nahe an das Wasser heran und sah seinem Laufe zu. Einige muntere Fischlein trieben ihr Spiel in der Strömung, schnellten hin und wieder empor und schnappten nach den Fliegen, die über die Oberfläche segelten. Überm Zuschauen bei diesem interessanten Anblick vergass der Knabe seine Thränen. Nur zuweilen durchfuhr ihn der schmerzliche Gedanke: »Ich will mich ertränken, weil ich keinen Papa habe«, wie zwischen den Ruhepausen eines Gewitters plötzlich heftige Windstösse dareinfahren, die das Geäst der Bäume krachen lassen und sich dann langsam in der Ferne verlieren.
Es war sehr heiss und drückend; die Sonnenstrahlen lockten die Gräser aus dem Boden hervor und das Wasser glänzte wie ein Spiegel. Simon hatte Augenblicke des Wohlbehagens, jener angenehmen Erschlaffung, die so oft auf stürmische Thränen folgt, und fühlte sogar ein heftiges Verlangen, sich ins warme Gras zu legen, um einzuschlummern.
Zu seinen Füssen hüpfte ein kleiner grüner Frosch, den er zu haschen suchte; aber er entwischte ihm. Der Knabe verfolgte ihn, aber dreimal hintereinander bemühte er sich umsonst, bis er ihn endlich unten an den Hinterbeinen erwischte; jetzt brach er bei den vergeblichen Anstrengungen des kleinen Tieres, wieder loszukommen, in ein herzliches Lachen aus. Der Frosch duckte sich auf seine dicken Schenkel zusammen, dann streckte er sich mit einem plötzlichen Sprunge aus, sodass seine Hinterbeine gerade wie zwei Stangen waren; seine runden goldgeränderten Äuglein starrten ängstlich aus dem breiten Köpfchen hervor, während er mit den Vorderfüssen, die wie kleine Hände aussahen, in die Luft schlug. Das Ganze erinnerte ihn an ein kleines Spielzeug, das er besass, wo man auf kleinen schräg übereinander liegenden Stäbchen die aufgesteckten Soldaten im Zickzack vorwärts bewegen konnte. Da musste er aber auch wieder an zu Hause denken, an seine Mutter; und von grosser Traurigkeit ergriffen, weinte er aufs Neue heftig. Er schauerte an allen Gliedern; schliesslich kniete er nieder und betete, wie vor dem Einschlafen, sein Abendgebet. Aber er brachte es nicht zu Ende, denn seine Thränen flossen jetzt so unaufhaltsam und heftig, dass sie alles Andere unterdrückten. Er dachte und sah nichts mehr; er war nur noch mit Weinen beschäftigt.
Plötzlich legte sich eine breite Hand auf seine Schulter und eine laute Stimme hinter ihm frug:
»Was bekümmert Dich denn so sehr, kleiner Mann?«
Simon wandte sich um. Ein robuster Arbeitsmann mit schwarzem, ganz krausen Haupt- und Barthaar schaute ihn freundlich an.
»Sie haben mich geschlagen . . . weil . . . weil ich . . . keinen . . . Vater habe . . . keinen . . . Vater«, antwortete er stockend und unter heftigen Thränen.
»Wie?« sagte der Mann lächelnd, »aber alle Welt hat doch einen.«
»Aber ich . . . ich . . . habe keinen!« antwortete das Kind, immer noch schluchzend.
Jetzt wurde der Arbeiter ernst; er hatte den Sohn der Blanchotte wiedererkannt, und obschon noch nicht lange in der Gegend, wusste er oberflächlich ihre Lebensgeschichte.
»Geh' doch, tröste Dich, mein Junge!« sagte er, »und komm mit mir zu Deiner Mutter. Man wird schon . . . einen Papa für Dich finden.«
Sie begaben sich auf den Weg, und während der Grosse den Kleinen an der Hand führte, lächelte er aufs Neue; denn er war schliesslich nicht traurig, Blanchotte kennen zu lernen, die, wie man erzählte, eines der hübschesten Mädchen in der ganzen Umgegend war. Vielleicht mochte er sich im Herzen sagen, dass ein Mädchen, das einmal schwach gewesen war, auch noch ein andres Mal schwach sein könnte.
Sie kamen zu einem weissen reinlichen Häuschen.
»Hier ist es«, sagte der Kleine und rief »Mama!« Eine weibliche Gestalt zeigte sich in der Thüre, und plötzlich erstarb dem Arbeiter das Lächeln auf den Lippen; denn er begriff sofort, dass weiter kein Scherz mit diesem hochgewachsenen bleichen Mädchen zu treiben war, welches ernst auf der Schwelle stand, als wolle es einem Manne den Eintritt zu einem Hause verwehren, in dem es schon einmal von einem Andren verraten worden war.
Schüchtern die Mütze ziehend stammelte er:
»Hier, Madame, bringe ich Ihnen Ihren kleinen Jungen wieder, der sich am Flusse verlaufen hatte.«
Simon aber fiel seiner Mutter um den Hals und sagte ihr unter neuen Thränen:
»Nein, Mama, ich wollte mich ertränken, weil die Andren mich geschlagen haben . . . geschlagen haben . . . weil ich . . . keinen Papa habe.«
Eine brennende Röte ergoss sich über die Wangen der jungen Frau, und tief ins Herz getroffen umarmte sie ihr Kind mit stürmischer Zärtlichkeit, während ihr die Thränen über die Wangen strömten. Tiefbewegt schaute der Mann zu und wusste nicht recht, wie er sich empfehlen sollte. Aber Simon sprang jetzt hastig auf ihn zu und sagte:
»Willst Du mein Papa sein?«
Alle schwiegen. Blanchotte lehnte stumm und schamerfüllt an der Wand, beide Hände auf ihr Herz pressend.
»Wenn Du nicht willst«, fuhr der Kleine fort, als ihm Niemand antwortete, »dann gehe ich von Neuem ins Wasser.«
Der Arbeiter nahm die Sache scherzhaft und antwortete:
»Nun gut, ich will ja.«
»Wie heisst Du?« frug nun das Kind, »damit ich den Anderen antworte, wenn sie Deinen Namen wissen wollen.«
»Philipp«, antwortete der Mann.
Simon schwieg einen Augenblick, um den Namen seinem Gedächtnis fest einprägen zu können; dann breitete er seine Ärmchen aus und sagte ganz getröstet:
»Gut! Philipp, Du bist jetzt mein Papa!«
Der Arbeiter hob ihn auf, küsste ihn zärtlich auf beide Wangen und ging dann schleunigst mit grossen Schritten von dannen.

Als das Kind am andern Morgen wieder die Schule betrat, wurde es von allen Seiten mit boshaften Lachen empfangen. Beim Herausgehen, als der grosse Bengel wieder mit seinen Neckereien beginnen wollte, schleuderte ihm der Kleine, als ob es Steine wären, die Worte entgegen:
»Er heisst Philipp, mein Papa.«
Ein Freudengeheul erfolgte von allen Seiten.
»Philipp, wie? . . . Was, Philipp? . . . Was heisst das, Philipp? . . . Wo hast Du Deinen Philipp hergenommen?«
Simon antwortete nichts, und unerschütterlich in seinem Glauben streifte er sie mit verächtlichen Blicken; er hätte sich eher von ihnen zerreissen lassen, als dass er vor ihnen davongelaufen wäre. Schliesslich befreite ihn der Lehrer von seinen Quälgeistern und er ging heim zu seiner Mutter.
Drei Monate lang spazierte der grosse Arbeiter Philipp häufig am Hause der Blanchotte vorüber, und einige Male fasste er sich auch das Herz, sie anzureden, wenn er sie gerade am Fenster stehen sah. Sie antwortete ihm höflich, stets sehr ernst, ohne jemals mit ihm zu lachen oder ihn aufzufordern, bei ihr einzutreten. Eitel indessen, wie nun einmal alle Männer sind, bildete er sich doch ein, dass sie einige Male röter geworden wäre als gewöhnlich, während sie mit ihm plauderte.
Aber einmal vernichtete Ehre ist so schwer wieder herzustellen und bleibt stets so sehr allen Angriffen ausgesetzt, dass man trotz der strengen Zurückhaltung Blanchotte's doch schon im Dorfe anfing, von ihnen zu tuscheln.
Was Simon betraf, so liebte er seinen neuen Papa ausserordentlich und spazierte fast alle Tage nach Schluss der Arbeit mit ihm herum. Er ging stolzen Schrittes jetzt zur Schule und hielt sich abseits von den andren Jungen, ohne ihnen jemals auf ihre Spässe zu antworten.
Eines Tages jedoch sagte ihm der Bengel, der ihn schon das erste Mal angerempelt hatte:
»Du hast gelogen; Du hast gar keinen Papa, der Philipp heisst.«
»Wieso denn?« frug Simon erregt.
»Weil«, entgegnete der Bengel, sich vergnügt die Hände reibend, »wenn Du einen hättest, er mit Deiner Mama verheiratet wäre.«
Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung machte Simon verwirrt.
»Es ist aber ebensogut mein Papa«, sagte er trotzdem.
»Das kann schon sein«, hohnlachte der Bengel, »aber er ist nicht ganz Dein Papa.«
Blanchotte's Kleiner liess den Kopf hängen und begab sich nachdenklich zur Schmiede des Vater Loizon, wo Philipp arbeitete.
Diese Schmiede lag unter Bäumen wie begraben. Es war schon finster dort und nur das Feuer eines mächtigen Heerdes warf seinen hellen Schein auf fünf Schmiede, welche in blossen Armen mit schrecklichem Getöse auf ihre Ambosse losschlugen. Sie standen da wie eine Gesellschaft von Dämonen, die Augen auf das glühende Eisen gerichtet, welches sie unter ihren Händen formten, während ihre Gedanken mit den sprühenden Funken auf und ab hüpften.
Simon trat unbemerkt ein und schlich sich leise zu seinem Freunde, um ihn am Ärmel zu zupfen. Dieser wandte sich um, seine Arbeit plötzlich unterbrechend, was seine Genossen veranlasste, das Gleiche zu thun. Alle schauten neugierig auf. Dann ertönte mitten in diesem ungewöhnlichen Schweigen die schwache magere Stimme des Knaben:
»Sag' mal, Philipp, der Michaud ihr Bursche hat mir eben erzählt, Du wärst nicht ganz mein Papa!«
»Warum denn nicht?« frug der Arbeiter.
»Weil Du nicht Mamas Mann bist.«
Niemand lachte. Philipp hatte die Stirn auf den Rücken seiner breiten Fäuste gelehnt, mit denen er den auf dem Amboss gestützten Hammer umklammert hielt; er schien zu träumen. Seine vier Gefährten sahen ihn an, und Simon, der sich so klein unter diesen grossen Gesellen vorkam, wartete ängstlich. Plötzlich griff einer der Schmiede den Gedanken Aller auf und sagte zu Philipp:
»Sie ist trotzdem ein braves gutes Wesen, diese Blanchotte, wacker und ordentlich trotz ihrem Missgeschick; sie gäbe eine tüchtige Frau für einen ehrbaren Mann.«
»Alles, was wahr ist!« sagten die drei Anderen.
»Ist es ihr Fehler«, fuhr der Arbeiter fort, »wenn sie hereingefallen ist? Man hatte ihr die Ehe versprochen und ich kenne mehr wie eine, die heute hochgeachtet ist, und der es einmal gerade so ging.«
»Das ist wahr!« riefen die Drei wieder einstimmig.
»Wie hat sie sich gemüht«, hob Jener wieder an »um ihren Burschen allein aufzuziehen, und wie viel hat sie geweint, seitdem sie nirgends mehr hingeht, als nur noch zur Kirche. Gott allein mag das wissen.«
»Auch das stimmt«, sagten die Anderen.
Dann hörte man eine Zeit lang nur noch das Knistern des Feuers auf dem glimmenden Herde.
»Geh und sag' Deiner Mutter«, wandte sich Philipp plötzlich an den Knaben, »dass ich sie heute Abend noch sprechen muss.«
Hierauf schob er ihn bei den Schultern zur Thür hinaus.
Er begab sich wieder an die Arbeit, und wie mit einem Schlage fielen die fünf Hämmer gleichzeitig auf die Ambosse.
So bearbeiteten sie ihr Eisen bis zum späten Abend, diese kräftigen robusten Gestalten, dass es eine Freude war, ihnen zuzusehen. Aber wie die grosse Glocke eines Domes an Festtagen das Geläute der übrigen Glocken übertönt, so schallte auch das Hämmern Philipps mächtig über das der Anderen hinweg. Er schmiedete blitzenden Auges sein Eisen, während er fortgesetzt in einem Regen von sprühenden Funken stand.
Die Sterne glänzten schon am Himmel, als er an Blanchotte's Thüre klopfte. Er hatte seinen Sonntags-Rock angezogen, ein frisches Hemd angelegt und den Bart ausgekämmt.
»Es ist nicht Recht, Herr Philipp, so in später Stunde noch zu kommen«, sagte die junge Frau mit ängstlicher Miene, als sie auf der Schwelle erschien.
Er wollte antworten, aber in seiner Verwirrung brachte er nur unverständliches Zeug hervor.
»Sie begreifen doch«, fuhr Jene fort, »dass es nicht viel braucht, um mich ins Gerede zu bringen.«
»Was macht das«, brach er plötzlich los, »wenn Sie meine Frau sein wollen?«
Er vernahm keine Antwort, aber bei der Dunkelheit glaubte er aus dem Innern das Geräusch eines umsinkenden Körpers zu hören. Hastig trat er ein; und Simon, der in seinem Bettchen lag, unterschied deutlich das Geräusch von Küssen, zwischen denen seine Mutter einige leise Worte flüsterte. Dann fühlte er sich plötzlich von den Händen seines Freundes emporgehoben und dieser, der ihn auf seinen nervigen Arm gesetzt hatte, rief ihm zu:

»Du kannst ihnen sagen, Deinen Kameraden, dass Dein Papa Philipp Remy, der Schmied, ist und dass dieser jeden bei den Ohren zausen wird, der Dir zu nahe tritt.«
Am andern Morgen, als schon alle Schüler da waren und auf den Lehrer warteten, erhob sich der kleine Simon ganz bleich und mit zitternden Lippen:
»Mein Papa«, sagte er mit lauter Stimme, »ist Philipp Remy, der Schmied; und er hat versprochen, jeden bei den Ohren zu zausen, der mir zu nahe treten wird.«
Diesmal lachte Keiner mehr, denn sie kannten ihn Alle, diesen Philipp Remy, den Schmied; und es war ein Papa, auf den Jeder stolz gewesen wäre.