
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In dem aristokratischen Wien konnte das junge Genie nicht lange im Verborgenen bleiben. Vorerst haust er freilich noch in der dürftigen Dachkammer, die er seit seiner Wiener Ankunft bei dem Buchdrucker Strauß in der Alservorstadt innehat und dann mit einem Zimmer zu ebener Erde vertauscht, für das er der Hausfrau nicht mehr als sieben Gulden zu geben für nötig findet, wie er in seinem Notizbuch gewissenhaft vermerkt. Der Umsturz der Verhältnisse in Bonn, das Ausbleiben der zugesagten Unterstützungen haben zur Folge, daß er ein strenger Sparmeister sein muß; indessen tritt sehr bald ein Umschwung in seiner äußeren Lage ein, der ihn den Verlust seines Bonner Einkommens leicht verschmerzen läßt. In wuchtigen Sätzen geht der Anstieg, eine stürmische Eroberung. Im Hause des Fürsten Karl Lichnowsky, der Schüler und Freund Mozarts war, findet der neue Genius glänzende Aufnahme. Der Fürst und seine Gemahlin Christiane, eine Tochter der Gräfin Thun, die den Neuling eingeführt hat, sind ihm Freunde und Gönner geworden. Besonders die Fürstin erweist ihm geradezu mütterliche Fürsorge. »Sie hätte eine Glasglocke über mich machen lassen wollen, damit kein Unwürdiger mich berühre«, äußert Beethoven über sie. »Von gewinnender Freundlichkeit und unbeschreiblicher Milde, aber infolge großer körperlicher Leiden bleich und schwächlich«, so wird ihr Bild überliefert.

Fürst Karl Lichnowsky (1756)
Bei Lichnowsky, Alstergasse Nr. 45, finden jeden Freitag Gesellschaftskonzerte statt, hausmusikalische Veranstaltungen, die die eigentliche Pflegestätte der ringenden Begabungen in jenen Zeiten waren, als es einen öffentlichen Konzertbetrieb im heutigen Stile noch nicht gab. Man kann sagen, daß das Beste des damaligen Musikschaffens aus der Hausmusik hervorgegangen ist oder hier den Anfang genommen hat, was auch für Beethoven gilt. In der fürstlichen Hauskapelle wirkt der berühmte Primgeiger Schuppanzigh, »ein kleiner beleibter Mann mit einem dicken Bauche«, von Beethoven »Falstafferl« genannt, der mit den Musikern Weiß, Kraft und Linke als das vielgenannte »Schuppanzigh-Quartett« von dem Fürsten Rasumowsky in feste Dienste genommen wird. Auch das mit verschwenderischer Pracht und feinstem Kunstsinn ausgestattete Palais Rasumowsky auf der Landstraße, wo große Musikfeste an der Tagesordnung sind, wird alsbald eine der Triumphstätten des neuen Genius, ebenso wie das Palais des Fürsten Lobkowitz, der sich aus Liebe zur Musik und zum Drama finanziell geradezu ruiniert und mit dem jungen Fürsten Kinsky zu den Bewunderern und späteren Mäzenen Beethovens gehört. Neben dem musikalischen Hochadel kann der musikeifrige Präses der Studienhofkommission, Gottfried van Swieten, der in der Hofbibliothek und in seinem eigenen Hause eine rege Musikpflege entfaltet, ebensowenig unerwähnt bleiben wie der Sekretär der königlich-ungarischen Hofkanzlei, Nikolaus Zmeskall von Domanovecs, der in den Freitagskonzerten bei Lichnowsky mitwirkt und in seiner Wohnung einen Kreis bürgerlicher Musikfreunde regelmäßig vereinigt. Er tritt in freundschaftliche Beziehungen zu Beethoven, dem er jahrelang hindurch geradezu als Famulus dient.
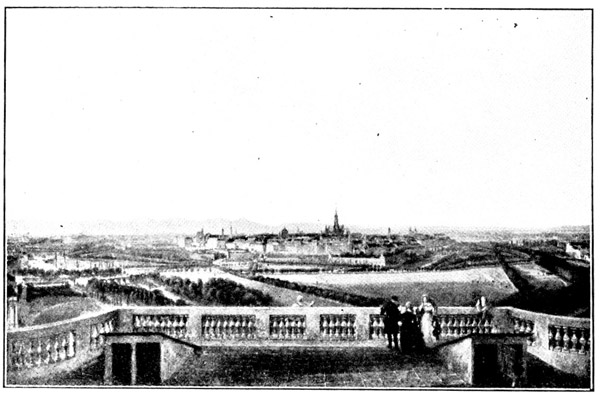
Blick von der Karlskirche auf die innere Stadt
Damit ist der Personenkreis umschrieben, der dem jungen Genius vom Rhein bald nach seiner Ankunft in Wien huldigte und einen Resonanzboden schuf, wie ihn kaum ein anderer Künstler vor und nach ihm in den entscheidenden Jahren des Werdens gefunden hatte. Die fürstlichen Hauskapellen und das Schuppanzigh-Quartett standen jederzeit zu seiner Verfügung; alle Neuheiten wurden »brühwarm von der Pfanne« gebracht, die musikalischen Eingebungen des jungen Meisters fanden stets einen bereitwilligen Apparat zur Erprobung und Ausführung und enthoben den Künstler jener schmerzlichen Sorge, die den ringenden Begabungen in der Musik selten erspart bleibt.
*
Damals war noch der große Haydn der Hausheilige in den Palais des musikliebenden Adels. Beethoven hatte gleich nach seiner Ankunft, Ende 1792, die Stunden bei ihm aufgenommen, und zwar gegen ein Honorar von je acht Groschen. Aber Lehrer und Schüler waren zu verschiedene Naturen, als daß sie aneinander viel Freude hätten finden können. Ludwig war schon ein zu eigenwilliger Meister, um ein angenehmer Schüler zu sein; Haydn hinwieder war kein rechter Lehrer für ihn. Er war alt und bequem, verwöhnt im Genusse seines Ruhms und seiner Erfolge, wohl auch ruhebedürftig; und obschon in seinem Wesen liebenswürdig, kindlich heiter und geduldig, behandelte er doch den empfindlichen Schüler etwas geringschätzig wie einen Anfänger. Den »Gradus ad Parnassum« fand Beethoven gräßlich, trocken und langweilig; er meinte dergleichen nicht lernen zu brauchen, da er die wesentlichen Grundsätze in sich hatte und mit instinktiver Sicherheit anwendete, ohne sie erst theoretisch lernen und wissen zu müssen. Ein schrecklicher Schüler für Haydn, mit seinem ewigen Aufruhr ein unlösbares Rätsel für den Altmeister, der sich oft bitter beklagt: »Alle Welt redet von diesem Beethoven weiß Wunder was – und da kann man sehen, wie er in der Theorie zurück ist.«
Und ein andermal: »Ich werd bald aufhören müssen, selber zu komponieren; der glaubt rein, daß ihm keiner mehr gleichkommt – dieser Großmogul!«
Das war die Lieblingsbezeichnung Haydns für den allzu selbstbewußten Schüler. Trotzdem nimmt er seinen lieben jungen »Großmogul« mit nach Eisenstadt zu den Musikfesten im Schloß des Grafen Esterhazy, der jahrzehntelangen Wirkungsstätte Haydns, und läßt sich die Mühen um dieses Kuckuckskind nicht verdrießen. Alsbald aber kommt Beethoven dahinter, daß ihm Haydn gewisse Kompositionsfehler in den gelieferten Arbeiten nicht verbessert habe. Das erweckt Mißtrauen in dem von Haus aus argwöhnischen Schüler. Er hat bei einem der damals beliebten Wiener Komponisten, dem Abbé Joseph Gelinek, den Musiker Johann Schenk kennengelernt, der später den »Dorfbarbier« komponiert« und in Armut lebte. Bei diesem Mann nimmt er heimlich Unterricht und läßt sich die Fehler in den Kontrapunktübungen verbessern, die Haydn übersehen hatte. Diese Hilfe sollte geheim bleiben. Schenk war der rechte Mann als Lehrer, nicht nur gewissenhaft, sondern auch erfüllt von Verehrung für das junge Genie, dem er nichts anderes sein wollte als ein ergebener Diener; so liebte es Ludwig van Beethoven. Der Unterricht bei Schenk endet im Sommer 1793, als Beethoven von Haydn nach Eisenstadt mitgenommen wird. Für lange Zeit verschwindet Schenk von der Bildfläche; erst zehn Jahre später begegnet Beethoven dem alten Freund und Lehrer, und mit schallendem Gelächter rufen sie es sich ins Gedächtnis, wie sie damals den guten Papa Haydn hinters Licht geführt haben.
Aber auch die Stunden bei Haydn waren nach einem weiteren Jahre eingeschlafen; der Hoforganist und Kapellmeister der Stephanskirche, Albrechtsberger, ein geschätzter Theoretiker und Komponist, wurde nun sein Lehrer im Kontrapunkt. Die Sache fand ebenfalls ein vorzeitiges Ende. Lehrer und Schüler dachten nicht gut voneinander. Albrechtsberger nannte ihn einen »exaltierten musikalischen Freigeist«, der nichts Ordentliches gelernt hatte und nie etwas Ordentliches machen würde; der Schüler hinwiederum meinte vom Lehrer, daß ihm nicht ein Gedanke einfiele, der sich zum doppelten Kontrapunkt brauchen ließe, und daß er nicht mehr könne, als musikalische Gerippe schaffen. Nebenbei nimmt Ludwig Unterricht bei Salieri, dem Leiter der Hofmusik, über die richtige Deklamation der Texte, besonders der italienischen; sogar von dem jungen Schuppanzigh sucht der Wißbegierige zu lernen und setzt gelegentlich sein Studium bei dem feinsinnigen Musiker Wilhelm Krumpholz fort, der von aufrichtiger Bewunderung für den genialen Schüler erfüllt ist; Beethoven nannte ihn mit Vorliebe »seinen Narren«. Das Eigentliche, was er suchte und brauchte, hat er indessen bei keinem dieser Lehrer und auch nicht aus trockenem Regelwerk gelernt, sondern aus Händel, Bach und Mozart, von denen er vieles zur Übung abgeschrieben, und deren Einfluß in seinen Frühwerken deutlich fühlbar ist. Mit dem ihm eigentümlichen Starrsinn, der hier Tugend ist, sucht er die letzten Geheimnisse des Handwerks. Der Meister ist immerfort zugleich ein Lernender. Aber seine nominellen Lehrer hatten ihm nichts zu geben, ihnen gegenüber fühlte er sich als Fertiger; die Lehrzeit bei ihnen ist zu Ende.
Ergiebige Einnahmequellen haben sich dem jungen Genius alsbald erschlossen. Er wird gut bezahlt für seinen Klavierunterricht in aristokratischen Häusern, für seine Mitwirkung bei musikalischen Veranstaltungen und für die Dedikationen seiner Schöpfungen an Gönner und Freunde. Von entscheidender Bedeutung ist jenes Konzert im Palais Lichnowsky 1794, wo er seine berühmten ersten drei Trios zur Aufführung bringt, die er bezeichnenderweise Opus 1 nennt. Die Ideen dazu hat er schon in Bonn mit einem dicken Zimmermannsblei in das Skizzenbuch eingetragen, das er stets nebst dem Taschentuch von ansehnlicher Größe in einem seiner Frackschöße trug, wie es seine Gewohnheit blieb. Jeder gewöhnliche Bleistift wäre abgebrochen unter der stürmischen Hand. Opus 1 will besagen, daß er selbst einen Abschlußstrich unter die Vergangenheit gesetzt hat und neu anfängt mit einem unbestreitbaren Meisterwerk. Neuartig ist vor allem das Akkompagnement. Die Instrumente hängen nicht mehr unselbständig vom Klavier ab, sondern bewegen sich in eigenen freien Modulationen und vereinigen sich im selbständigen Reigen sinnvoll und ausdrucksvoll miteinander. Das Streben danach ist schon in Bonn zu spüren gewesen, wenngleich das Ziel damals noch nicht erreicht war. Doch hatte er gefühlt, was er wollte und mußte, darauf ging einmal sein Wort: »Ich bin gewissermaßen mit dem Akkompagnement geboren.« Jetzt war es erreicht und das frühe Selbstbewußtsein gerechtfertigt.
Unter den Anwesenden befanden sich seine Lehrmeister, Haydn und Salieri, beide als Rokokorepräsentanten nach der alten Mode gekleidet mit gepuderter Perücke und Seitenlocken, gestickter Weste und Schnallenschuhen; Beethoven nachlässig angetan in der »freieren Weise der überrheinischen Mode«, die bereits Ausdruck einer neuen Zeit ist. In der Gewähltheit des höfischen Kreises wirkt sein Gebaren fast derb und anstößig, naturhaft, wie Pan unter den Göttern. Eine russische Pianistin, Frau von Bernhard, entwirft folgendes Bild von ihm: »Er war klein und unscheinbar, mit einem häßlichen roten Gesicht voll Pockennarben. Sein Haar war ganz dunkel und hing fast zottig ins Gesicht. Sein Anzug war sehr gewöhnlich.« Das Ungewöhnliche seiner Erscheinung wird indessen gehoben durch die magische Kraft seiner drei Trios, die den Hörern geradezu revolutionär vorkommen mußten, sie waren zu neu und zu kühn; alle andere Musik erschien daneben als »zahm und geistlos«.
Am höchsten griff das dritte Trio in C-Moll. Eine neue unbekannte Empfindungswelt erschloß sich, die spezifisch Beethovensche Tonart, pathetisch, männlich kraftvoll, heroisch, voll von ungebändigter Leidenschaft und auflehnendem Trotz. Das paßte zu ihm: C-Moll. Für ihn hatte jede Tonart ihre bestimmte Individualität, ihre eigene Farbe, ihren besonderen Vorstellungsinhalt. Nach seiner Überzeugung war »Transponieren« künstlerisch ein Unding. Die Liebhaber gingen bereitwillig und verständnisvoll mit, nicht so aber die Berufsmusiker oder die Leute vom Bau. Jedoch war alles gespannt, was Altvater Haydn dazu sagen würde, den Fürst Lichnowsky vor allen Anwesenden aufforderte, sein Urteil zu sprechen.
Der Altmeister wußte viel Anerkennendes zu sagen, gab jedoch den Rat, das dritte Trio in C-Moll nicht zu veröffentlichen, mit der allerdings etwas sonderbaren Begründung, das Publikum werde es nicht verstehen. Beethoven hielt es indessen für Neid und dachte: »Der meint es nicht gut mit mir.« Er wußte, daß C-Moll das Beste war. Der Neid lag indessen dem reinen Charakter des grundgütigen Haydn fern. Er war nur erschrocken über den Bekenntnisdrang dieser leidenschaftlich aufrüttelnden Musik, die der klassischen Ästhetik widersprach. Man war gewohnt, Menschliches nur leichthin anzudeuten. Aber gerade dieses tiefmenschliche Bekennertum war Beethovens eigentümlichste Kraft. Es war nicht mehr Barock und nicht mehr strenger Klassizismus; es war Romantik und Beethoven ihr Bahnbrecher und Verkünder.
Fürst Lichnowsky, dem die drei Trios gewidmet sind, läßt das Werk auf seine Kosten bei Artaria stechen und überreicht dem Künstler eine Ehrengabe von zweihundert Gulden, die er zartfühlend als Verlegerhonorar bezeichnet. Außerdem werden ihm Freiexemplare in gewisser Anzahl zur Verfügung gestellt, die er im Subskriptionswege absetzen darf, um damit seinen persönlichen Ertrag zu erhöhen. Auch einige Sonaten kommen in Druck, die Haydn gewidmet sind und auf den Wunsch des Altmeisters den Zusatz tragen sollen: Haydns Schüler. Doch davon will Beethoven nichts wissen; die Verstimmung wegen des absprechenden Urteils über das C-Moll-Trio läßt es nicht zu. »Ich habe bei Haydn nichts gelernt«, ist sein Standpunkt.
*
Der Verkehr mit den Großen und Vornehmen bringt ihn bald zur Einsicht, daß er den borstigen Igel ausziehen und sich einigermaßen der Umgebung anpassen muß. Diese Erkenntnis drückt sich in einer Tagebuchnotiz aus: »Ich muß mich vollständig neu equipieren.« Fürst Lichnowsky überbietet sich in Gunstbezeugungen für den jungen Meister und stellt ihm eine Wohnung in seinem Palais zur Verfügung. Was Beethoven in frühreifem Selbstbewußtsein als Knabe vorausgesagt, hat sich nun schier erfüllt. Ein Herr ist er geworden, und man sollte ihm die einst bekundete Gleichgültigkeit gegen Kleidung und äußere Erscheinung gar nicht anmerken. So elegant und standesgemäß geht er nun einher, in seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen, er nimmt die Allüren der vornehmen Gesellschaft an. Seinen mangelhaften Umgangsformen und seiner Schwerfälligkeit abzuhelfen, läßt er sich Unterricht bei einem Tanzmeister geben; im Fasching ist er viel auf Bällen und Redouten zu sehen, er tanzt leidenschaftlich, aber schlecht, und ist als Tänzer gefürchtet. Es ist kaum eine Merkwürdigkeit, daß der mechanische Takt dem feineren, komplizierten Rhythmus seiner Musikempfindung so gar nicht zu entsprechen schien. Jedenfalls ist er in dieser Zeit kein Einsiedler und kein Asket. Er möchte nicht zurückstehen hinter den anderen und tritt als Gleicher unter Gleichen auf.
»Mit dem Adel ist gut umgehen,« betonte er, »aber man muß auch etwas haben, womit man ihm imponiert.«
Das »van« vor seinem Namen ist eine scheinbare äußere Deckung, die ihn gesellschaftlich legitimiert; aber das ist nicht das Imponierende, das er meinen konnte. Vielmehr ist es der unzweifelhafte Adel des Genies, den er fühlte, und mit diesem die Macht seiner Persönlichkeit. Er hatte nicht jene untertänige Ergebenheit, wie sie noch der große Haydn an den Tag legte; er wollte durchaus nicht bloß als Musiker oder Vorspieler gelten, sondern als Ebenbürtiger, ja sogar als Überlegener, und ließ es die Gesellschaft fühlen, was er von sich hielt und was von ihr, und siehe da, man nahm es von dem verzogenen und leicht auch ungezogenen Liebling widerspruchslos hin. Es ist bezeichnend für ihn, daß er nicht nur als Künstler, sondern vielmehr noch als Mensch und als Persönlichkeit gewürdigt werden will.
Die Herrengewohnheiten sitzen allerdings nicht sehr tief. Ein tragikomischer Widerspruch zwischen der Neigung, den Kavalier zu spielen, und der Hemmungslosigkeit alter Gewohnheiten tritt zutage. Er findet es zum Beispiel unerträglich, die Zeit zum Mittagessen einzuhalten, die bei Lichnowsky auf halb vier Uhr nachmittags festgesetzt ist.
»Täglich um halb vier zu Hause sein, mich etwas besser anziehen, für den Bart sorgen usw. – das halte ich nicht aus!«
So bleibt er öfters unentschuldigt vom Tisch weg und geht ins Gasthaus. Er merkt gar nicht, wie ungezogen das ist. Auch sonst verfehlt er den richtigen Takt, daran zum Teil seine Erziehungsmängel, zuweilen aber auch sein übertriebenes Ehrgefühl schuld sind. Der Fürst gibt mit seiner metallischen Stimme, so daß es der neue Hausinsasse hören muß, dem Jäger den Auftrag, falls er und Beethoven zugleich klingeln, der Künstler zuerst bedient werden soll; Beethoven, der die gute Absicht mißversteht und empfindlich, wie er ist, nimmt sich fortab einen eigenen Diener. Auch ein eigenes Reitpferd hält er sich, obzwar ihm der Fürst seinen Marstall angeboten hatte. Über seine Arbeit hat er indessen den Sport wieder vergessen und wird daran erst erinnert, als der Reitknecht die Futterrechnung präsentiert. Damit hatte auch die edle Passion ihr Ende gefunden.
Ist ihm der Fürst väterlicher Freund, so ist ihm die Fürstin Christiane eine zweite Mutter. Sie weiß alles an dem zerstreuten Künstler zu entschuldigen und die strengeren Ansichten des Gemahls zu entwaffnen. Was er für shocking hält, erklärt sie für originell und liebenswürdig. Dankbar anerkennt Beethoven später: »Mit großmütterlicher Liebe hat man mich dort erziehen wollen«; aber er gibt in launiger Selbsterkenntnis zu, daß es eine vergebliche Mühe war.
Der Fürst erhob daher keinen Widerspruch, als Beethoven, der goldenen Fesseln müde, der Annehmlichkeit dieses verwöhnten Daseins entsagte und ein Jahr später im Ogylvischen Hause hinter der Minoritenkirche eine bescheidene Wohnung nahm. Es war ein Schritt aus der Gebundenheit in die unentbehrliche Freiheit; aber auch ein Schritt aus einem wohlgepflegten, schützenden Gehege in die Wüste des grauen Alltags, mit dem der Künstler um so weniger fertig werden konnte, je älter er wurde. In dem aufreibenden, zermürbenden Kleinkampf mit dem äußeren Leben spielt die Wohnungsmisere eine nicht geringe Rolle, wie wir später noch sehen werden.
*
Wenn sich auch der äußere Mensch gehäutet hatte, so blieb dennoch der Sinn für feinere Lebensart in dem Künstler unentwickelt. Gerade den Vornehmen gegenüber gefiel er sich in einem geradezu absichtlich rauhen, um nicht zu sagen plebejischen Betragen, das oft genug nur der Furcht entsprang, seiner Würde etwas zu vergeben und vor den Großen kleiner zu erscheinen. Die aristokratischen Freunde sahen über diese kleine Schwäche nachsichtig hinweg. Daß er es oft so sehr an nötigem Takt fehlen ließ, war der Grund so vieler Zerwürfnisse in seinem Leben. Das war es auch, was Goethe so an ihm mißfiel und einer wirklichen herzlichen Annäherung zwischen den beiden Großen hindernd im Wege stand. Dazu kam, daß der feinorganisierte Künstler so gar nicht gewohnt war, sein aufbrausendes Temperament zu zügeln, und daß er sich nur zu oft den Ausbrüchen seiner erregbaren Natur überließ. Das sind Schattenseiten seines Wesens, unter denen er im Leben persönlich am schwersten selbst gelitten hat, und die nicht verschwiegen oder vertuscht werden können, weil gerade diese verzeihlichen Mängel die Folie sind, die seine edlen Eigenschaften, seine Herzensgüte und seine reumütige Offenheit desto strahlender hervortreten lassen. Er war es sich nicht immer bewußt, wie rauh und verletzend seine ungezügelte Art auf die Mitmenschen, die ihm am nächsten standen, wirken mußte; aber wenn er es inne wurde, dann ließ er es nicht an rührenden Beweisen fehlen, das unabsichtlich Geschehene gutzumachen und sich zu verdemütigen, wenn es auch oft damit zu spät war. Es gibt zahlreiche derartige Dokumente in seinem Leben, die seinen seltenen Herzenseigenschaften und der Vornehmheit seiner Gesinnung das schönste Zeugnis ausstellen und beweisen, daß in der rauhen Schale eine wahrhaft schöne Seele verborgen war. Ein Stammbuchblatt aus der ersten Wiener Zeit, und zwar vom 2. Mai 1793, für den Bonner Freund Vocke bestimmt, enthält seine Selbstcharakteristik, die durchaus zutreffend erscheint:

Der jugendliche Beethoven.
Nach Steinhäusers Zeichnung von Joh. Steidl gestochen
»Ich bin nicht schlimm – heißes Blut ist meine Bosheit – mein Verbrechen Jugend – schlimm bin ich nicht – schlimm wahrlich nicht – wenn auch so oft wilde Wallungen – mein Herz verklagen – mein Herz ist gut. – Wohltun, wo man kann – Freiheit über alles lieben, Wahrheit nie – auch sogar am Throne nicht verleugnen!«
In diesen wenigen Zeilen als inneres Selbstbildnis haben wir den ganzen Menschen Beethoven. Für den Psychologen und Seelenforscher ein interessantes und dankbares Problem. Viele Züge, die als Anlage sich schon in dem Knaben zeigen und bei mangelhafter Jugenderziehung unausgeglichen bleiben oder sich zu verhärten beginnen; andere wieder, die als scheinbare Fehler bloß Notwehr übergroßer Sensitivität sind; und wieder andere, wie etwa die Erregbarkeit und Unbeherrschtheit seiner explosiven Natur, die ihre natürliche Erklärung in einem körperlichen Leidenszustand finden, in der Unordnung von Galle und Leber, die sich schon in früher Jugend meldet und die braune Gesichtsfarbe verursacht. Im Gegensatz zu diesem widerspenstigen Temperament die ethische Kraft seiner Gesinnung und Willenshaltung, die mit der leidenschaftlichen Natur fortwährend im Kampf liegt, mit diesen »wilden Wallungen«, die sein »Herz verklagen«, und rührende Beweise liefert, daß dieses Herz wahrhaft gut ist. Ein solcher Beweis unter vielen andern ist der Brief, mit dem er 1793 die »verehrungswürdige Eleonore und teuerste Freundin« bittet, den fatalen Zwist zu vergessen, der seine Erinnerung an sie belastet:
»Wieviel gäbe ich dafür, wäre ich imstande, meine damalige, mich so sehr entehrende, sonst meinem Charakter zuwiderlaufende Art, zu handeln, ganz aus meinem Leben tilgen zu können ...«
Er legt dem Briefe Variationen als Dedikation bei und macht auf die Schwierigkeiten der Triller in der Coda aufmerksam, die absichtlich mit Geheimzeichen versehen sind, um die Wiener Klaviervirtuosen, die sich über den rasch berühmt werdenden »Großmogul« nicht wenig ärgern, in Verlegenheit zu setzen. Dann noch die Bitte an Leonore: »er möchte eine gestrickte Weste von ihrer Hand besitzen, um etwas von einem der besten, verehrungswürdigen Mädchen in Bonn sein eigen zu nennen«; die erste nun unmodisch gewordene Weste aus ihrer Hand habe er als teures Andenken aufbewahrt.
Eine schöne Halsbinde, von Leonorens Hand gearbeitet, wird ihm zum Lohn; das Geschenk erweckt Gefühle der Wehmut; Tränen entstürzen seinen Augen, und eine unbeschreibliche Traurigkeit kommt über ihn ...
Auch der arme Wegeler muß eines Tages die Reizbarkeit seines Gemüts erfahren. Er kam Oktober 1794 nach Wien, um hier ein paar Semester Medizin zu treiben und den Franzosen auszuweichen, die inzwischen Bonn besetzt haben. Er findet den Jugendfreund Ludwig in seiner neuen herrenmäßigen Verfassung, von Selbstbewußtsein geschwellt, vielleicht auch ein wenig überheblich, was ihm der bescheidene Student sehr übel vermerkt. Entfremdet und gekränkt hält ihm nun Wegeler in einem tadelnden Brief einen schonungslosen Spiegel seines veränderten Betragens vor; es ist ein wenig schmeichelhaftes Porträt, das der Bonner Freund von dem jungen Beethoven zeichnet. Der edle Kern seines Wesens ist von des Freundes Vorwurf tief berührt; es kommt der zerknirschte Brief zustande, der es verdient, im Andenken der Menschheit unvergessen zu bleiben, wie manches andere menschliche Dokument dieses innerlich so stürmisch bewegten Lebens. Wieder ist es einer der schönsten und schwersten Siege, die Beethoven errungen, der Sieg der Selbstüberwindung, die so charakteristisch für seinen Heroismus und für seine sittliche Grundverfassung ist. Der Brief lautet:
»Liebster, Bester! In was für einem abscheulichen Bilde hast Du mich mir selbst dargestellt! Oh, ich erkenne es, ich verdiene Deine Freundschaft nicht, Du bist so edel, so gutdenkend, und das ist das erstemal, daß ich mich nicht neben Dich stellen darf. Weit unter Dich bin ich gefallen; ach, ich habe meinem besten, edelsten Freund acht Wochen lang Verdruß gemacht. Du glaubst, ich habe an der Güte meines Herzens verloren; dem Himmel sei Dank, nein! – Es war keine absichtliche, ausgedachte Bosheit von mir, die mich so gegen Dich handeln ließ, es war mein unverzeihlicher Leichtsinn, der mich nicht die Sache in dem Lichte sehen ließ, wie sie es wirklich war. – Oh, wie schäme ich mich für Dir wie für mir selbst – fast traue ich mich nicht mehr Dich um Deine Freundschaft wieder zu bitten. – Ach, Wegeler, nur mein einziger Trost ist, daß Du mich fast seit meiner Kindheit kanntest, und doch, oh, laß mich's selbst sagen, ich war doch immer gut und bestrebte mich immer der Rechtschaffenheit und Biederkeit in meinen Handlungen; wie hättest Du mich sonst lieben können? – Sollte ich denn jetzt seit der kurzen Zeit auf einmal mich so schrecklich, so sehr zu meinem Nachteil geändert haben? – Unmöglich! Diese Gefühle des Großen, des Guten sollten alle auf einmal in mir erloschen sein? Mein Wegeler, Lieber, Bester, oh, wag es noch einmal, Dich wieder ganz in die Arme Deines Beethoven zu werfen; baue auf die guten Eigenschaften, die Du sonst in ihm gefunden hast. Ich stehe Dir dafür, der neue Tempel der heiligen Freundschaft, den Du darauf aufrichten wirst, er wird fest, ewig stehen, kein Zufall, kein Sturm wird ihn in seinen Grundfesten erschüttern können – fest – ewig – unsere Freundschaft! Verzeihung – Vergessenheit, Wiederaufleben der sterbenden, sinkenden Freundschaft! – O Wegeler, verstoße sie nicht, diese Hand zur Aussöhnung, gib die Deinige in die meine – Ach Gott! – Doch nichts mehr – ich selbst komme zu Dir und werfe mich in Deine Arme und bitte um den verlorenen Freund, und Du gibst Dich mir, dem reuevollen, Dich liebenden, Dich nie vergessenden Beethoven wieder ...«
*
Ende 1794, als die Franzosen Bonn besetzten, packt ihn die Sorge um das Schicksal der Brüder, die mit dem Aufhören des Bonner Hofes ihrer Existenzmittel gänzlich beraubt sind. Er läßt sie zu sich nach Wien kommen. Ihnen gegenüber fühlt er auch später seine Autorität als Familienoberhaupt, was bei dem widerspenstigen Charakter der Brüder und ihrer krassen Selbstsucht zu unaufhörlichen Reibereien und Zwistigkeiten führt. Der kleine rothaarige, häßliche Karl wird, nicht ohne Zutun Ludwigs und seiner einflußreichen Freunde, Beamter in der Staatsschuldenkasse und erteilt nebenher Klavierunterricht. Dem Wesen nach ist er dem berühmten Bruder Ludwig nicht unähnlich; unbändig, leicht aufbrausend. Eine Zeitlang leistet er dem Künstler Famulusdienste, besorgt seine geschäftliche Korrespondenz und nimmt ihm die Sorgen des Alltags ab, denen gegenüber der junge Meister sich als äußerst unpraktisch erweist. Diese Dienste geschehen nicht ohne egoistische Nebenabsichten; Karl hatte jedenfalls seine Vorteile dabei, und das ist wieder Veranlassung zu neuen Zerwürfnissen, die auch in dem Mißtrauen Ludwigs, das mehr oder weniger berechtigt erscheint, einen steten Zündstoff finden. In den Zeiten der Entzweiung mit Bruder Karl übernimmt Johann die Sekretärdienste, mit dem sich Ludwig indessen noch weniger als mit Karl verträgt. Bruder Johann hat das Apothekergewerbe erlernt und in Wien alsbald eine passende Anstellung gefunden. Von ansehnlicher Gestalt, ein hübscher Mensch mit blassem Gesicht und schwarzem Haar, erscheint er als das Ebenbild des Vaters. Im Grunde gutmütig, aber etwas borniert, neigt er, besonders später, als er durch Chininlieferungen an die Armee ein reicher Mann geworden ist, zu einem gewissen protzigen und geldstolzen Wesen, darüber sich Ludwig nicht wenig ärgert. Als Johann in einem Brief an ihn die Bezeichnung »Gutsbesitzer« seiner Unterschrift beifügt, erwidert ihm Ludwig mit etwas giftigem Humor als »Hirnbesitzer«.
Am 29. März 1795 tritt Meister Ludwig zum erstenmal öffentlich hervor und wirkt an einer Akademie zum Besten der Witwen und Waisen im Nationalhoftheater mit; diesem ersten Auftreten folgt ein zweites und drittes unmittelbar nach. Noch zwei Tage vor diesem ersten Auftreten schrieb er an dem C-Dur-Konzert unter heftigen Kolikanfällen, mit denen er oft zu tun hatte. Vier Kopisten warteten im Vorzimmer auf jedes noch nasse Blatt.
»Mut! Bei allen Schwächen des Körpers soll doch mein Geist herrschen! Fünfundzwanzig Jahre sind da! Dieses Jahr muß den völligen Mann entscheiden! Nichts muß übrigbleiben!«
Der kategorische Imperativ dieser Tagebuchnotiz verrät zu deutlich, wie früh er es mit körperlichen Beschwerden zu tun hat, und wie schwach seine Gesundheit ist. Dazu kommt die Unregelmäßigkeit des Gasthauslebens und die mangelhafte Diät. Instinktiv sucht er Abhilfe. Das viele Laufen und Wandern hat nebst seiner Naturfreude auch diesen Grund. Die Vorliebe für eine gute Suppe, die er einer hitzigen Kost vorzieht, spielt eine große Rolle; und ein Haus, wo eine gute Suppe gekocht wird, kann sicher sein, daß die Einladung von ihm gerne angenommen wird. Aber in diesem Alter spielen vorübergehende Beschwerden dieser Art keine bedeutende Rolle. »Der Geist soll herrschen«, und wie wenig dieser Geist vom körperlichen abhängig ist, gerade dafür ist Beethoven ein einzigartiger und überzeugender Beweis.
Sein Name leuchtet bereits in die Ferne, doch ist es der glänzende Klavierspieler und Virtuose, nicht der Tondichter, dem er seinen jungen Ruhm verdankt. Er denkt ganz ernstlich daran, seinen Ruf als Klaviervirtuose zu befestigen, und richtet seine Blicke ins Weite, wo große Triumphe winken.
Die erste und übrigens einzige Kunstreise führt über Prag und Dresden nach Berlin. Fürst Lichnowsky gibt ihm das Geleit bis nach Prag, wo er im Hause des Grafen Clam-Gallas ausgezeichnete Aufnahme findet. Noch ist hier die Erinnerung an Mozart lebendig als Gegenstand begeisterter Huldigung, und es scheint, als ob von diesem Enthusiasmus etwas für Beethoven abfiele, der hier in nicht geringem Maße gefeiert wurde.
Nicht ganz so dankbar sind Dresden und Leipzig. Mit um so größeren musikalischen Ehren dagegen empfängt ihn Berlin. König Friedrich Wilhelm II. ist selbst Cellist und liebt das Quartett. Seine Gunst hat schon Mozart erfahren. Beethovens Improvisationen machen einen überwältigenden Eindruck. Die Kronprinzessin, später Königin Louise, flüstert ihm zu: »Oh, lasset den Himmel wieder blau werden, das Herz tut mir zum Sterben weh!« So sehr ist sie von dieser tief innerlichen Dichtersprache ergriffen. Der König beehrt den Künstler mit einer goldenen Dose, gefüllt mit Louisdors. Beethoven ist stolz auf das königliche Geschenk. Oft und gern erzählt er: »Keine gewöhnliche Dose, sondern eine Art, wie sie wohl den Gesandten gegeben werden.«
Am besten versteht er sich mit dem genialen Prinzen Louis Ferdinand, der auch komponiert und auf dem Klavier phantasiert. Beethoven drückt seine Anerkennung drastisch aus:
»Euer Königliche Hoheit haben meine in der Tat nicht geringen Erwartungen übertroffen. Sie wirken gar nicht prinzlich, sondern wie ein tüchtiger Musiker!«
Die Schranzen sind starr vor Entsetzen. Der Prinz reicht ihm gerührt die Hand: es sei das schönste Lob, das ihm je zuteil geworden sei.
In einem öffentlichen Konzert auf der Singakademie phantasiert Beethoven über ein Choralthema: »Meine Zunge rühmt im Wettgesang dein Lob.«
Niemand wagt zu klatschen, alles drängt sich an ihn heran, um ihm sprachlos die Hand zu drücken, viele haben Tränen in den Augen. Gewiß eine großartige Huldigung. Aber das liebt der Meister nicht, Sturm will er, Beifallssturm.
Acht Tage später noch einmal in der Singakademie. Wieder Tränen und lautes Schluchzen. Der Künstler möchte in Lachen ausbrechen.
»Narren!« brummt er. »Musik soll Feuer aus der Seele schlagen, nicht Rührseligkeit. Wer kann unter so verdorbenen Kindern leben?!«
Mit dem Hofkapellmeister Heinrich Himmel hat er einen kleinen Strauß. Unter den Linden treffen sie sich in einem bescheidenen Kaffeehaus; Himmel bittet Beethoven, auf dem Klavier etwas zu phantasieren. Hierauf soll Himmel seine Kunst zeigen. Himmel glaubt sein Bestes getan zu haben, da fragt Beethoven: »Nun, wann fangen Sie denn einmal ordentlich an? Ach so! Ich habe geglaubt, Sie hätten nur ein bißchen präludiert.«
Himmel ist ganz wütend. Es gibt erregte Worte, sie scheiden in Unfrieden. Es kommt zwar später zu einem Briefwechsel; Beethoven möchte immer Neues wissen aus Berlin, aber Himmel kann seine Schlappe nicht vergessen. »Das Neueste in Berlin«, schreibt er, »ist die Erfindung einer Laterne für Blinde.« Beethoven nimmt es ganz ernsthaft, erzählt die Geschichte harmlos weiter und bittet Himmel um nähere Aufklärung. Darauf erfolgt eine boshafte Antwort. Nach diesem Reinfall hat auch der Briefwechsel ein Ende.
Trotz allem, Beethoven ist nicht sehr erbaut von Berlin. Das Musikleben dort kann sich mit Wien nicht messen. Friedrich Wilhelm II., der ihm gut gesinnt ist, stirbt schon im nächsten Jahr. Beethoven kehrt gerne nach Wien zurück, um es, von kleineren Reisen abgesehen, nicht mehr zu verlassen.
Jetzt erst ist Wien so recht seine Heimat geworden.
*
Nach seiner Rückkehr aus Berlin hatte Beethoven zunächst vorübergehend wieder im Palais Lichnowsky gewohnt, dann aber bald die Mietwohnung vorgezogen, die seiner Freiheit weniger Schranken setzte. Er glaubte am Tiefen Graben Nr. 241 im fünften oder sechsten Stock das Rechte gefunden zu haben. Es war das fünfte Logis in Wien, wo der junge Karl Czerny sein Schüler wurde fast zugleich mit Ferdinand Ries, dem Sohn seines väterlichen Bonner Freundes und Lehrers; mit Christoph und Stephan Breuning war der junge Ries nach Wien gekommen. Wegeler war inzwischen nach Bonn zurückgekehrt; Stephan Breuning blieb und fand eine Anstellung im Hof- und Kanzleidienst. Die herzliche und innige Jugendfreundschaft mit Beethoven wurde hier fortgesetzt, und kam es auch im Laufe der Zeit zu einer Unterbrechung, die bei dem Wesen des Meisters fast unvermeidlich war, so fanden sich die Freunde doch wieder in späteren Jahren, und namentlich gegen das Lebensende Beethovens war der Bund fester geschlossen als je.
Turmhoch stieg man hinauf in das sehr wüst aussehende Zimmer des Meisters am Tiefen Graben, wo überall Papiere und Kleidungsstücke verstreut umherlagen, einige Koffer an den kahlen Wänden, kaum ein leerer Stuhl neben dem wackelnden Klavier ...
Was Czerny hier sah, war annähernd der gleiche Zustand aller Mietwohnungen, die Beethoven in Wien und Umgebung im Laufe der Zeit innehatte. Sechzig an der Zahl! Die Ziffer ist erschütternd. Sie enthält eine Tragödie. Eine stille, bittere, ruhmlose Alltagstragödie. Sechzig irdische Leidensstationen.
Und immer dasselbe Lied: ein wunderliches Durcheinander, Bücher, Musikalien in allen Ecken und Enden, keine Ordnung; und wenn Ries oder Czerny oder abwechselnd die Brüder Karl und Johann wirklich einmal die kostbaren Originalmanuskripte ordneten, so flog doch alles wieder wirr durcheinander, wenn der Meister zufällig etwas suchte. Er hätte es auch nicht bemerkt, wenn einer der Famulusse das eine oder andere wertvolle Blatt hätte verschwinden lassen. Auf dem Piano lagen bekritzelte Blätter, die Embrios schlummernder Tonschöpfungen; hier eine Korrektur, die der Erledigung harrt, dort der Rest des vorigen Abendessens, versiegelte oder halbgeleerte Weinflaschen; dann, zwischen den Fenstern, ein tüchtiger Laib Strachinokäse, daneben umfängliche Trümmer echter Veroneser Salami; Geschäftsbriefe am Boden verstreut, dazwischen Freundschaftsbriefe; neben dem Klavier ein armseliger Schreibtisch, der die Spuren des umgeworfenen Tintenfasses trägt, das sich zuweilen ins Klavier ergießt; ein halbes Dutzend verkrusteter Federn, die ihm Zmeskall zurechtschneiden muß; die Strohsessel mit Kleidern bedeckt, ein Teil mit Speiseresten; Staub überall, Staub und Wasserlachen am Fußboden, wenn sich morgens der Meister kalt übergießt, brummend, singend, heulend, stampfend, oft zum Verdruß der ungeduldigen Hausnachbarn.
Eine Unordnung und Unsauberkeit, eine Öde und Unwohnlichkeit, die oft das Entsetzen der Besucher ist. Keine menschliche Wohnung, die Behausung eines »Zyklopen«, der zwischen Trümmern lebt. Zerbrechliches ist überhaupt nicht sicher vor seinen Händen; will er etwas achtsam behandeln, dann ist es auch schon entzwei. Zmeskall hat fast immer zu tun für ihn, er muß ihm einen Spiegel leihen, wenn der eigene zerbrochen ist; den Diener zur Aushilfe schicken; eine gute Repetieruhr kaufen oder einen grünen Wichskasten, ein andermal einen Vorhang, dann für ihn mit dem Klavierfabrikanten verhandeln; gelegentlich mit einem Darlehen beispringen, um das zu bitten der Meister sich »herabzulassen« gezwungen sieht; hin und wieder eine neue Wohnung suchen usf. ohne Ende. Es regnet kurze Billette, die fast nichts als kategorische Aufträge enthalten und im witzelnden Ton abgefaßt mit Anreden: Liebster, liebstes Schaf, Kommandant morscher Festungen, Musikgraf, Freßgraf, Baron Dreckfahrer, womit die Liste der Ehrenbezeichnungen noch lange nicht vollständig ist. Der Meister ist unerschöpflich in der Erfindung derber Witzworte oder Wortspiele. Sein Humor ist etwas grobkörnig, und Empfindlichkeit ist eine Sache, auf die er allein Anspruch erhebt, und die andern nicht zusteht. Immerhin ist es nur eine täuschende Maske, dahinter sich seine Hilflosigkeit dem praktischen Leben gegenüber verbirgt.
Alles in allem das Bild eines tief einsamen Daseins, eines aussichtslosen Kampfes, den der nach innen gewendete schöpferische Geist mit den gemeinen Tatsachen des Lebens kämpft. Die äußerliche Verwahrlosung ist nebenbei Ausdruck eines Jugendfehlers, der sich nun ins Gigantische versinnbildlicht. Nicht als ob der Wunsch nach einem behaglichen Heim gefehlt hätte, im Gegenteil. Aber nicht gering, schier unerfüllbar sind die Anforderungen, die er an die Mietwohnung stellt, und doch wieder einfach und bescheiden, wie man's nimmt.
Nicht Vornehmheit verlangte er, kaum Behaglichkeit, am wenigsten Luxus; weder Salons noch Empfangsräume. Eine Werkstätte des Geistes soll seine Behausung sein, das wäre des Adels genug. Aber gerade dafür braucht er Dimensionen. Er muß sich ausbreiten können nach allen Richtungen und nirgends eine Hemmung, nirgends eine Enge fühlen müssen. Also nicht groß genug, nicht hoch genug, nicht breit genug können ihm die Räume sein. Und nur keine Nachbarschaft! Am liebsten allein in einem so unendlich weiten, hohen und breiten Hause wohnen, von niemandem gehört, von niemandem gesehen, von niemandem gestört und also selbst niemanden hören, sehen und fühlen müssen, unbehelligt bleiben im Alleinsein mit der Muse. Und hoch soll die Behausung liegen, in Himmelsnähe, in Gottes Nachbarschaft. Das will heißen: unbegrenzte weite Aussicht in die freie Natur. Aus allen Fenstern soll man ins weite Land sehen, über Wälder, Berge und Strom, auf weite Horizonte mit abenteuerlichen Wolkengebilden, auf denen die Gedanken ruhen wie Sturmvögel, wenn er am Werke schafft und im Ideenflug die Grenzen des Irdischen weit hinter sich läßt.
Auch das ist eine Eigentümlichkeit schon von Jugend auf. Sie ist ihm geblieben von jener Zeit, wo er am Speicher des Elternhauses in das strahlende Land am Rhein hinausblickte und durch Fernrohre sieben Stunden weit sah, viele einsame Nachmittage lang. Rheinisches Land, das will er auch hier sehen an der Donau, zumal ihn so vieles verwandt berührt, wenigstens draußen in der Umgebung, wo er im Sommer haust und oft zweimal in der Jahreszeit die Wohnung wechselt, unbekümmert um Mietverträge, so daß er zuweilen drei Wohnungen zugleich innehat. Denn immer hat es einen Haken, aus naheliegenden Gründen; nur die weite Aussicht wird ihm in den Stadtwohnungen auf den Basteien zum Geschenk, weshalb er auch immer hochgelegene Räume wählt. Ansonsten aber ist die Wirklichkeit ein grotesker Gegensatz zu seinem Ideal. Und darum das ewige Suchen, das ewige Wandern, das ewige Nomadentum innerhalb der einen Stadt und ihrer nächsten Umgebung. Darum die fortwährenden Aufträge an die nächsten Freunde, das Geeignete aufzutreiben, das nicht aufzutreiben ist. Und darum die lächerlich traurige Groteske der Umzüge von der Stadt aufs Land, vom Land in die Stadt, von Wohnung zu Wohnung.
Pittoresk, zugleich aber peinlich und schmerzvoll diese Übersiedlungen, wie jene einmal nach Mödling, die typisch ist, mit vierspännigem Lastwagen, etwas Mobilien darauf und eine ungeheure Last von Musikalien, Manuskripten, Notizheften, Büchern – ein turmhoher Bau. Der Besitzer, zu Fuß, seelenvergnügt voran. Lerchenjubel, sanfte Lüfte, schaukelnde Kornfelder. Ideen schwirren heran, wetterleuchten durchs Gemüt, das Zimmermannsblei hat zu tun im flüchtigen Festhalten der Eingebungen. Der Sänger schwebt im Elysium; vergessen ist die Welt, vergessen aber auch der Möbelwagen.
Todmüde, staubbedeckt, schweißtriefend, hungrig und durstig kommt der Meister spät abends ans Ziel. Nirgends der Möbelwagen zu sehen. Am Marktplatz findet er endlich seine Habseligkeiten, zu einem Haufen aufgestapelt, ein halb Dutzend Straßenjungen herum. Der vorausbezahlte Rosselenker hat sich längst davongemacht und ist heimgefahren. Zuerst Wut, dann schallendes Gelächter und bis gegen Mitternacht das mühselige, eigenhändige Bergen dieser Schätze in die Sommerwohnung, wo es kunterbunt durcheinandergeht in gewohnter Weise.
Das ist die Straße der Mühseligkeiten, an deren Anfang er noch steht.
*
Der Blick in die äußere Werkstatt wäre nichtssagend ohne den Blick in die innere Werkstatt, weil dann erst der Kontrast sinnfällig wird, der dieses Leben beherrscht. In der Betrachtung seines Schaffens wollen wir uns an die entscheidenden Hauptpunkte halten.
Hoch oben in der öden Behausung am Tiefen Graben ist 1799 die Sonate Pathétique entstanden. Magisches Licht strahlt von ihr in die äußere Trostlosigkeit der Stätte. Von Harmonien umwoben, fühlt der Meister kaum den herben Gegensatz zu dieser sichtbaren Umgebung, die so grell absticht von der gepflegten Vornehmheit der adeligen Häuser, in denen er verkehrt. Aber in Gedanken ist die Sonate doch mit diesen verknüpft; sie ist dem Freund Fürsten Lichnowsky gewidmet. Sie will etwas Besonderes sagen; ausnahmsweise hat ihr der Schöpfer einen Namen gegeben, und gerade diesen Namen. Sie ist irgendwie Bekenntnis.
Bekenntnis ist schließlich alle Musik Beethovens. Seine Sonaten sind intimste persönliche Aussprache. Und Organ dieser Seelensprache ist das Klavier. Das Instrument ist unter ihm etwas geworden, was es früher niemals war, ein völlig Neues, Ungewöhnliches, Persönliches. Ausdrucksmittel sind gefunden, die man nicht für möglich hielt. Der Erstlingsruhm des Künstlers, sein Virtuosentum, seine schöpferische Entwicklung, die Kundgebung seines Genius beruhen auf dem Klavier, hier nimmt seine Entfaltung ihren Ausgangspunkt. Die Sonate Pathétique ist ihrer Art nach ein Höhepunkt, ein Rückblick, eine Zusammenfassung, Ausdruck einer Sendung.
Und diese Sendung? Sie liegt in dem Wort verborgen: das Pathetische. Das kann leicht mißverstanden werden. Schwulst und Unnatur ist selbstverständlich damit nicht gemeint. Vielmehr die Betonung eines tragischen Prinzips; das Tragische als Wesensinhalt seiner Tondichtung. Das ist die klare Selbsterkenntnis, die hier der Künstler in seiner Sonate ausspricht – dem Freunde gegenüber. Ahnungsvolles Träumen eigener Tragik, die das Drama noch nicht zu Ende sieht, aber den dröhnenden Schritt dunkel kommen hört, den heroischen Gang. Was in allen bisherigen Frühwerken aufflammt, wetterleuchtet, fernhin donnert wie vergrollende Gewitter am Horizont unter schräg hindurchbrechenden Sonnenstrahlen in übermütigen Scherzi, ist hier düster und mächtig zusammengeballt. Noch kein schweres persönliches Leid, noch kein tieferschütterndes Erlebnis, noch keine aufwühlende Katastrophe, keine Entsagung und Resignation, aber doch die Grundanlage von allem, hier als Stilforderung erkannt, wie eine Herausforderung des Unvermeidlichen. Jugendlicher Weltschmerz, das Pathetische als Stilgesetz.
So hat er die Sonate zu seiner Form gemacht und persönlich ausgebildet als intimstes Tagebuch, dem die innersten Seelenregungen anvertraut sind. Düsterer Ernst, Schatten über Schatten, immer wieder phantomhaft das Einleitungsmotiv, dumpf wirbelnde Bässe, leidenschaftliche Allegro-Stürme, Ekstase, die ins Unermeßliche peitscht. Ein donnerndes Halt, klagendes Zucken im Nachsatz und jähes Aufbrausen zum Schluß, ganz kurz.
Noch keine Tragödie, aber der Fingerzeig hin zu ihr, zu Katastrophen, die geahnt sind wie etwas, das vor der Türe steht, verschleiert, ein unheimlicher Gast. Ein Pochen und Rütteln am Tor der Tragik, ohne daß es noch aufgestoßen wird. Und zugleich ein Ausblick auf äußerste Höhen einer Kunst, die wie ein fernes, hohes Gebirge mit zerrissenen Gipfeln und jähen Abstürzen durch geteilte Wolkenschleier erscheint. Dorthin, dorthin, lautet eine unerbittliche Mahnung. Ein Berauschen an der eigenen Leidenschaft, die echt ist. Das ist seine Pathetik.
Darum ist diese Sonate ein Abschluß, eine Rechenschaft und ein Ausblick, ein Höhepunkt seiner Klavierschöpfungen. Er mag sich dann freundlicheren Gefilden zuwenden, heiteren Augenblicken, denn Heiterkeit ist die andere Seite des Tragikers, aber innerhalb des klavieristischen Gebietes hat die Pathetische den dramatisch-tragischen Gipfelpunkt erreicht. Sie ist Vollendung in dieser Form und doch nur Vorspiel, das auf die Symphonie weist, wo die Lebenstragik sich zum wuchtigen Drama gestaltet, um so pathetischer, je einfacher sie in ihren Grundelementen ist.
Noch wendet in dieser Wiener Frühzeit die heitere Seite des Lebens ihm ihren vollen Sonnenglanz zu. Darum wirkt die Pathetische zunächst so aufwühlend und rätselhaft, daß die Traditionellen vor ihr erschrecken und der strenge Lehrer Dionys Weber in Prag seine Jünger vor dem exzentrischen Genie warnt. Aber die Jugend hat sich an ihr berauscht. Die Atmosphäre der Zeit ist erfüllt von tragischer Erwartung, die sich hier ausspricht. Die Katastrophe am Rhein zieht näher, und der Boden dieser heiteren Welt zittert unter den Füßen ...
Diente das Klavier seiner persönlichen Aussprache, so bilden die Kammermusiken des Tondichters, Klavier mit Streichern, oder Bläserensembles, oder Streichinstrumente allein, seine Trios, Quartette, Quintette, das Sextett und das berühmte Septett, sein Gesellschaftsleben. Hier werden keine schweren Probleme gewälzt; hier will man sich unterhalten und die Fragen des Lebens in spielender Gesprächsform behandeln.
Auch das Septett ist gewissermaßen ein Abschluß, ein Dank an die fröhliche Kavalierzeit, als gälte es einen Abschied. Irgendeine Wende steht bevor; sie liegt in der Luft. Außerdem will das Septett den Schluß der Lehrzeit bedeuten. Die orchestralen Mittel sind erschöpft, ihre Handhabung ist auf das Äußerste der Erreichbarkeit gebracht, soweit dies auf dem geselligen Boden der intimen Hausmusik möglich war. Ein heiteres Gastmahl, das der scheidende Fürst der Töne seinen fürstlichen Freunden gibt, ehe er sich in die wolkenumflorte neunzackige Hochgebirgskette, in die Einsamkeit seiner Symphonienwelt, zurückzieht.
Eine Bläsergruppe und eine Streichergruppe vereinigen sich in dem Septett zu einem munteren Reigen. Der Violine steht die Klarinette gegenüber, der Bratsche das Horn, dem Cello das Fagott; der Kontrabaß gibt dem Ganzen eine treffliche Untermalung. Zu traumhaften Höhen rufen die Bläser, und die erste Geige schwebt zu diesem Ziel empor. Und dann wiegen sich alle im Menuett; das Tonwerk atmet feinen, behaglichen Humor; über der sehnsuchtsvollen Melodie des ersten Satzes, von der Klarinette gesungen und von der Violine weitergeführt, entsteht das reizendste Geplauder, ein Schwärmen, Flüstern und Kosen von Gruppe zu Gruppe, die sich lösen und wieder vereinigen zu neuen Bildungen, ein bezauberndes Gesellschaftsbild, das im Geiste dem adeligen Leben entspricht, daran er in seiner Wiener Frühzeit so starken persönlichen Anteil nimmt.
Die Kammermusik war Vorbereitung und Abschluß; in ihr ruht ein neuer Anfang, die erste Symphonie, die inzwischen insgeheim aus dem Septett hervorgeht. Spricht seine Klaviermusik persönliche Tragik aus, seine Kammermusik gesellschaftliche Fragen, so behandelt die Symphonie das Drama des Lebens. Dazu drängt es ihn, nachdem die Kräfte voll entwickelt sind und die Reife der geistigen Überlegenheit erreicht haben. Jetzt genügen Klavier und Kammermusik nicht mehr, er bedarf der ganz großen Form, um Größtes auszusprechen. Er mußte dreißig Jahre alt werden, ehe er anfing, Symphonien zu schreiben, obgleich ihn die Musik seit seinem vierten Jahr beschäftigte.
Auch insofern ist das Septett ein Wendepunkt, als es das erste eigene Konzert ist, das der nunmehr Dreißigjährige veranstaltet. Nebenher geht seine Ballettmusik »Die Geschöpfe des Prometheus«, eine Gelegenheitssache, die er mit anderen schreibt, und die ungefähr in diese Zeit fällt. Nach der Aufführung des Septetts ist auch der Ruhm des Komponisten, nicht nur des Virtuosen, befestigt. Der Pianist J. B. Cramer, der in London mit dem berühmten Violinisten, dem Mischling Bridgetower, die Trios durchgespielt hatte, rief begeistert aus: »Das ist der Mann, der uns für den Verlust Mozarts trösten wird.« Trotzdem hatte er an Beethoven manches zu tadeln und machte sich über die Beethoven-Verehrer lustig, indem er witzelte: »Wenn Beethoven sein Tintenfaß über ein Stück Notenpapier ausschüttete, so würden sie es bewundern.«
Der Aufführung des Septetts am 2. April 1800 im Hoftheater ist die Erstaufführung von Haydns »Schöpfung« vorausgegangen. Bald darauf, es war überdies nach der Aufführung der Prometheus-Musik, begegnet Beethoven dem Papa Haydn. Der freundliche Greis hatte sich oft nach dem einstigen Schüler erkundigt und immer wieder gefragt: »Was treibt denn unser Großmogul?«
Er hatte gehört, daß Beethoven über die »Schöpfung« mißfällige Äußerungen getan habe. Der Tadel verletzte den alten Meister: »Das ist unrecht von ihm,« sagte er unwirsch, »was hat er denn geschrieben? Etwa ein Septett? Aber freilich, das ist schön, ja herrlich!« Und seine Bewunderung ist so innig, daß er in diesem Augenblick auch schon die Bitterkeit vergessen hat.
Und nun, bei der persönlichen Begegnung, tut Beethoven über sein Septett die etwas selbstbewußte Äußerung: »Das ist meine Schöpfung!« Haydn verwindet den aufsteigenden Ärger und sagt: »Nun, gestern habe ich Ihr Ballett gehört, es hat mir sehr gefallen.« Darauf Beethoven: »Oh, lieber Papa, Sie sind sehr gütig – aber es ist doch noch lange keine ›Schöpfung‹.« Eine kurze Pause folgt, dann gibt es ihm der gekränkte Haydn zurück: »Das ist wahr, es ist noch keine ›Schöpfung‹, glaube auch schwerlich, daß es dieselbe je erreichen wird.«
Der gute Haydn nahm es immerhin dem einstigen Schüler nicht übel, daß er oft eine scharfe Zunge hatte und unbekümmert Kritik an den Kollegen übte, die nicht wenig erbost über ihn waren. Er verfolgte den Weg des unähnlichen Jüngers, der ihm schier unbegreiflich schien, immer mit freundlichem Interesse, ja mit bewunderndem Anteil. Und auch Beethoven zollte dem Altmeister trotz der Gegensätze größte Verehrung. Als er in seiner Spätzeit ein Bild des Geburtshauses Haydns in Rohrau, einem Dörfchen an der österreichisch-ungarischen Grenze, zum Geschenk erhalten hatte, äußerte er mit großer Freude: »Eine schlechte Bauernhütte, in der ein so großer Mann geboren wurde!« Und als bei der Festaufführung der »Schöpfung« im Saal der alten Wiener Universität der sechsundsiebzigjährige Haydn in einer Sänfte von den Adeligen eigenhändig in den Festraum getragen wurde, war auch Beethoven unter jenen, die dem großen Meister solche Ehre erwiesen. »Beethovens Kraft denkt liebend zu vergehen, so Haupt und Hand küßt glühend er dem Greise«, singt der Dichter Collin anläßlich dieser erhebenden Feier, die ein Ereignis Wiens bildete.
Das Septett ist ein Meilenzeiger für die schönste Zeit in Beethovens Leben. Sein junges Haupt ist von Ruhm umstrahlt. Er selbst hat keine geringe Meinung von sich, er kennt seinen Wert und trägt sich mit starkem Selbstgefühl. Das bekommt ein sächsischer Gesandtschafts-Attaché zu spüren, mit dem er bei Lobkowitz ins Gespräch kommt, und der ihm auf die Bemerkung Beethovens über die Verlegereinkünfte eines Goethe und eines Händel die tadelnde Antwort gibt: »Mein lieber junger Mann, Sie müssen nicht klagen, denn Sie sind weder ein Goethe oder ein Händel, und es ist nicht zu erwarten, daß Sie es je werden. Solche Meister werden nicht wieder geboren.«
Der darüber aufgebrachte Beethoven ruft den Fürsten, der ihn zu beruhigen sucht, man sei eben augenblicklich vielfach der Meinung, solche gewaltige Menschen würden nie wieder hervorgebracht. »Um so schlimmer,« erwidert der Meister, »aber mit Menschen, die keinen Glauben und kein Vertrauen zu mir haben, kann ich keinen Umgang haben.«
Um diese Zeit, von der sein Septett erzählt, hat der Künstler wenig Ursache, sich zu beklagen. Der fürstliche Freund Lichnowsky hat ihm eine Jahressumme von 600 Gulden ausgeworfen für solange, als er kein sicheres Einkommen bezieht. Sein Ruhm wächst zu ungeahnten Höhen. Er kann bald an Wegeler nach Bonn schreiben:
»Von meiner Lage willst Du etwas wissen?! Nun, sie wäre eben so schlecht nicht.« Er gedenkt der Jahresrente von Lichnowsky, von dem er sagt, daß er immer sein wärmster Freund war und geblieben ist, wenn es auch kleine Mißhelligkeiten gegeben habe, aber diese hätten eben die Freundschaft nur gefestigt. Und dann heißt es weiter: »Meine Kompositionen tragen mir viel ein, und ich kann schon sagen, daß ich mehr Bestellungen habe, als fast möglich ist, daß ich sie befriedigen kann. Auch habe ich auf jede sechs, sieben Verleger und noch mehr, wenn ich es mir angelegen sein lassen will: man akkordiert nicht mit mir, ich fordere, und man zahlt. Du siehst, daß es eine hübsche Sache ist, zum Beispiel ich sehe einen Freund in Not, und mein Beutel erlaubt mir nicht gleich zu helfen, so darf ich mich nur hinsetzen, und in kurzer Zeit ist ihm geholfen.«
Sein Schüler und Famulus Ferdinand Ries, dem es in Wien sehr schlecht geht, hat diese Hilfe oft erfahren und viele andere auch. Jedenfalls bewegt er sich jetzt auf der Höhe des äußeren Glücks, von dem das Septett strahlend kündet.
*
Diesem äußeren Glück entspricht auch sein persönliches Bild in der Zeit des ersten blühenden Mannesalters: Eine mittlere kräftige Gestalt, untersetzt, fast gedrungen. Aber der Kopf! Ein Löwenkopf, groß und bedeutsam, das dichte, ungeordnete Haar wie eine Mähne, eine schwarzbraune Gesichtsfarbe, die exotisch wirkt, und diese Majestät der gewaltigen, offenen Stirn! Die Haut pockennarbig, die Miene finster, die Nase, nun ja, nicht schön, aber kann man sich eine andere Nase in diesem Gesicht denken? Auch Michelangelo hatte eine verunglückte Nase; eine äußere und innere Ähnlichkeit liegt hier zweifellos vor. Und wenn schon diese Nase eine Dissonanz bildet, so ist sie hier ein Mittel der gewaltigen Instrumentation eines Widerspiels, das sich in der Harmonie dieser Stirn, in diesem energiegeladenen Kinn, in der edlen Zeichnung des Mundes und in den Augen auflöst. Unruhige, düstere Augen, die blitzen, wenn ihn Gedanken bewegen, und wenn er von Musik spricht. Wenn er spielt und phantasiert, dann geht in diesem Antlitz ein Drama von furchtbarer, schauererweckender Schönheit vor sich. Sein Lächeln aber ist ein Sonnenstrahl aus dunklen Wolken. Dazu sein scharfer Witz, sein ätzender Humor, den er auch gegen die Höchsten gerne spielen läßt. Daß Herzensgüte und Gemütsweichheit hinter diesem Dräuen verschanzt sind, ahnen verstehende Herzen. Von der bezaubernden Macht seiner Erscheinung wissen die Zeitgenossen, besonders die Frauen. Daß er selbst liebebedürftig, leicht entzündlich Feuer fing und Wonne und Qual der Verliebtheit durchmachte, ist kein Wunder. Er war durchaus nicht unempfänglich für Frauenschönheit. Wegeler will beobachtet haben, daß er »immer in Liebesverhältnissen war und mitunter Eroberungen gemacht, die manchem Adonis wo nicht unmöglich, doch sehr schwer gewesen wären«. Jedenfalls war der Künstler viel umschwärmt.
Aber er nahm diese Dinge nicht tragisch, nicht einmal poetisch oder gar sentimental. Darauf zielt seine anscheinend zynische Bemerkung ab, daß ihn keine Liebschaft länger fesselte als höchstens sieben Monate. Das besagt nicht, daß er tiefer Seelenneigung nicht fähig gewesen wäre. Sie war vielmehr der lebenslängliche Zustand seiner eigentlichen Liebe. Es sind Frauen in sein Leben getreten, die diesen tiefsten Grundton seines Wesens berührt haben. Bisher aber war keine, die ihm solcherart so nahestand als Leonore, deren Bild er aus der Bonner Zeit noch im Herzen trug.
In dem Gedanken an sie war 1795 sein berühmtes Sehnsuchtslied »Adelaide« entstanden. Es ist der Tribut an Matthisson, dem Dichter seiner Jugend im Breuningschen Hause. Das Idealbild Leonorens steht in zarten Umrissen dahinter. Sie ist bis dahin die frauliche Muse seiner Seele, die von fernher über seinem Leben steht, bloßes Sinnbild einer Sehnsucht. Sie klingt in der »Adelaide« durch. Dahinter ist keine Liebschaft zu suchen. Seine Musik ist rein, sie kennt erotische Probleme nicht. Sie atmet sittliche Hoheit und ist Seelenausdruck. Zugleich Ausdruck einer idealen Sehnsucht, die sich gelegentlich im Lied ausspricht, anfänglich drängend, fragend, stürmisch, wie in der »Adelaide«, weihevoll, wie später im »Opferlied« desselben Dichters, und schließlich immer verklärter, wunschloser, ätherischer, entsagungsvoll, wie in dem Liederkreis »An die ferne Geliebte«, zwanzig Jahre später.
Trotzdem, oder vielmehr gerade wegen seiner ethischen Lebensauffassung, liegt ihm der Gedanke an die Ehe als eine sittliche Forderung nahe. Besonders in diesen hochgemuten Tagen. Es wird überliefert, wenn auch nicht bewiesen, daß er um die Zeit, als die »Adelaide« entstand, der Sängerin Magdalena Willmann in Wien, die er von Mannheim her kannte, einen Heiratsantrag machte. Sie soll seine Werbung abgelehnt haben, weil er ihr angeblich zu häßlich war. Wenn es damit seine Richtigkeit hat, was durchaus zweifelhaft ist, so scheint er diese Ablehnung keineswegs als Unglück empfunden zu haben. Daß er aber trotzdem, und gerade damals, keine Lebensgefährtin fand, obgleich er der Liebling der Gesellschaft und von den Töchtern des Adels, seinen Schülerinnen, wie überhaupt den geistvollen und kunstsinnigen Frauen dieser Kreise mit Gunst ausgezeichnet war, ist doch zu verwundern. Es scheint, daß die Gründe in ihm liegen.
Bei aller Empfänglichkeit, er stellt nicht geringe Anforderungen, sowohl an Schönheit, Jugend und Bildung, wie an vornehmen Stand. Das mit der Willmann war, soweit es nicht überhaupt Legende ist, ein bloßes Theaterfeuer. In Wirklichkeit richtete er seine stillen Wünsche nach Sphären, wo er als Freier nicht vollwertig erschien, ohne Vermögen, ohne Rang und Stellung ... Trotzdem treten zwei Frauen aus den Kreisen des Hochadels groß und bedeutsam in sein Leben und beginnen eine gewisse Rolle für ihn zu spielen. Die eine ist die sechzehnjährige kokette, verführerische Gräfin Giulietta Guicciardi, seine Schülerin, die alsbald das Herz ihres Lehrers ganz gefangen nimmt. Er liebt sie und weiß sich wieder geliebt. Aber so heftig er in Flammen auflodert, so treu bleibt er dem Grundgedanken: »Bis ich dich erlaubt mein nennen darf.« Er geht nicht zart mit der Geliebten um; er wird leicht heftig, wirft die Noten hin, zerreißt sie. Die Kokette lacht dazu, es gefällt ihr, sie hat ihr Spiel mit ihm und kettet ihn damit um so fester. Er ist nicht schön und nicht elegant wie der junge verlebte Graf Gallenberg, ein damals beliebter Ballettkomponist, der um sie wirbt. Er ist struppig, fast verwildert, und just das gefällt der exzentrischen Komtesse. Aber er ist edel, feinfühlend, gebildet; und was an ihm häßlich scheint, ist schön in ihren Augen. Sie weiß, daß eine edle gehobene Empfindung ihn Frauen gegenüber beherrscht, sei es in Freundschaft oder in Liebe; seine Wutausbrüche sind prachtvolle Gewitter, und nach ihrem Verrauschen ist die Versöhnungsstimmung um so beglückender.
Die »Mondscheinsonate«, der Geliebten gewidmet, ist Denkmal dieses einzigartigen Verhältnisses. Man möge nicht eine Anekdote darin suchen. Aber die Sonate ist, wie alles, autobiographisch für seinen Seelenzustand: traumhaft wie diese heimliche Liebe, zerfließende Harfenakkorde in den schwermütigen Adagioharmonien, aufschäumendes Presto, fiebernde Erregung und darüber schwebender Gesang hoffnungsloser Melancholie – das ist Sprache dieser Leidenschaft. Trotz des Standesunterschiedes und der überaus ungleichen äußeren Verhältnisse beschäftigt ihn der Gedanke, sie zur Seinigen zu machen.
Die andere, die eine bleibendere und tiefere Bedeutung für sein Leben hat, ist die junge Gräfin Theresa von Brunszvik, die er ungefähr um dieselbe Zeit kennenlernt. Sie ist ihm flüchtig bei Lichnowsky begegnet, wo er auch ihren Bruder Franz, der fertiger Cellospieler ist, kennenlernt, mit dem er in dauernde Freundschaftsbeziehung tritt. Theresa und ihre Schwester Josephine, die nachmalige Gräfin Deym, sind im Jahre 1799 seine Schülerinnen geworden. Sie wissen, daß es nicht ganz leicht mit ihm ist, und daß sie sich schon bequemen müssen, die hohen Wendeltreppen zu dem Unnahbaren hinaufzuklettern, wenn sie ihres Erfolges sicher und als Schülerinnen angenommen sein wollen. Wie ein Schulmädchen, mit einer Sonate Beethovens unter dem Arm, betritt Theresa mit ihrer Schwester den Raum. Zu ihrer Überraschung ist der Gestrenge sehr freundlich und so höflich, als es ihm nur möglich ist. Sie singt und spielt recht brav, er ist entzückt und verspricht, täglich in den »Goldenen Greifen« zu kommen, wo die gräfliche Familie abzusteigen pflegte. Er kommt gewöhnlich gegen die Mittagszeit und bleibt statt einer Stunde oft bis vier oder fünf Uhr nachmittags, eifrig bemüht um seine Schülerinnen, namentlich um Theresa, die später seine Vertraute wird, seine Seelenbraut, die sogenannte »unsterbliche Geliebte«. Der vertrauliche Verkehr wird zunächst unterbrochen, als die Geschwister mit der Mama auf ihr Gut nach Marton-Vásár zurückkehren. Beethoven ist dort später wiederholt zu Besuch; im Jahre 1806 scheint es in Marton-Vásár, unter Mitwissen des Bruders Franz Brunszvik, zu einer heimlichen Verlobung mit Theresa gekommen zu sein, wenngleich sich alsbald die innere und äußere Unmöglichkeit einer Vermählung und somit der stillschweigende beiderseitige Verzicht ergeben mußte. Auf den Besuch in Ungarn bezieht sich jedenfalls der dreiteilige Brief an die »unsterbliche Geliebte«, das große Rätsel der Beethoven-Literatur, der nach dem Tode des Meisters von Stephan von Breuning in dem Geheimfach einer Kassette vorgefunden wurde. Von dem Brief wird noch die Rede sein. Trotzdem die heimliche Verlobung wegen ihrer Aussichtslosigkeit rückgängig wurde, dauerte das Freundschaftsverhältnis fort und hatte einen bestimmenden Einfluß auf sein Leben und sein Schaffen, wie sich noch zeigen wird. Wenn wir auch, allgemeiner Annahme zufolge, Theresa als die ideale Empfängerin jenes mit Bleistift geschriebenen überströmenden Liebeshymnus und als die »unsterbliche Geliebte«, wie er sie nannte, ansehen dürfen, so war doch seine Muse die eigentliche »Unsterbliche«. Die Kunst besaß ihn ganz; sie war die Geliebte, der er alles opferte, auch seine menschlichen Beziehungen. So groß war seine Pflichttreue und sein sittlicher Ernst für die musikalische Sendung, die er fühlte. Ausschweifungen, lockere Liebesverhältnisse, trotz der vorübergehenden intimen Beziehungen zu Giulietta, oder gar unerlaubter Verkehr mit verheirateten Frauen waren ihm ein Greuel, und er sprach sich darüber des öfteren rückhaltlos aus. Das war auch sein Einwand gegen Rossini, dem damaligen Beherrscher der Oper, dem er wohl Begabung beimißt, aber nicht sittlichen Charakter, ohne den ihm auch die Kunst auf schwachen Füßen zu stehen scheint.
Dagegen war ihm Freundschaft ein tiefes Lebensbedürfnis, auch Freundschaft mit hochgesinnten Frauen. In einem solchen idealen Freundesverhältnis stand er zur Fürstin Christiane und später zur kränkelnden Gräfin Erdödy, »seinem Beichtvater«, wie er überhaupt anmutigen aber leidenden Frauen sehr zugeneigt ist. Das hängt mit der mitleidigen, zärtlichen Erinnerung an die Mutter zusammen. So ist sein Kavaliertum in der lebenslustigen ersten Wiener Zeit immerhin von einer gewissen Gehaltenheit gezeichnet. Musik und Lektüre, Spaziergänge und Plaudereien, der Besuch des Theaters und Freundschaft sind die Hauptquellen seiner Freuden. Ist auch die Lebensweise ungeregelt, so ist sie doch beherrscht von Mäßigkeit. Das sind Züge vom Großvater her, und zugleich ist es eine bewußte Abkehr von dem weniger vorbildlichen Beispiel des Vaters. Auch im Dunkel weiß er eine Führung über sich und in sich!