
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In Berlins exklusivstem bürgerlichen Klub, dem neben den Großen der Industrie und Börse nur wenige namhafte Juristen angehören, diskutierte man beim Lunch am »Stammtisch der Jungen« lebhaft die gesellschaftlichen Ereignisse der letzten Woche.
Trotz der geistigen Interessenlosigkeit der jungen Leute hält die Unterhaltung hier stets ein bestimmtes Niveau. Den völligen Mangel jeder schöngeistigen Bildung ersetzt meist das sichere Gefühl für Wohlanständigkeit, das man von der Kinderstube her mitbringt. Dies Gefühl gibt auf alle Fragen des gesellschaftlichen Takts todsicher die richtige Antwort. Auch das Auge, von früher Kindheit an daran gewöhnt, nur das Gute und Wertvolle zu sehen, besitzt in den meisten Fällen Geschmack genug, um in künstlerischen Dingen das Wesentliche zum mindesten vom Kitsch unterscheiden zu können. Niemals aber wird hier auf Grund positiver Kenntnisse und eines inneren Verhältnisses ein sachliches Urteil abgegeben; man vermag Gutes selten vom Besseren zu unterscheiden und ist daher in erster Linie mit daran schuld, wenn auf allen Gebieten künstlerischen Schaffens heute die Größe des Erfolges durchaus kein Maßstab für die Güte eines Kunstwerkes ist. Denn wie man's im Klub in der Jägerstraße anstimmt, so tönt's in hundert westlichen Familien wider, die zwar nicht heiligsprechen und verdammen können, die aber doch zu den wenigen gehören, die in den Kunstausstellungen kaufen und in einem weiten Bogen um jede Leihbibliothek herumgehen.
Man verfährt bei der Aufnahme – wenigstens in der Praxis – hier nach andern Gesichtspunkten als im Klub der Geburts-Aristokraten in der Schadowstraße. Setzt in der Jägerstraße die Aufnahme auch ein gewisses Niveau der Familie und gute Finanzen voraus, die in der Schadowstraße leicht durch ein lückenloses Pedigré ersetzt werden, so prüft man selbst durch den bestsitzenden englischen Gehrock hindurch noch den Charakter des Kandidaten, während dort die Güte der Uniform auch die Qualität des Trägers gewährleistet. Hier wie da natürlich Ausnahmen. In der Schadowstraße die Aufnahme vom Grafen aufwärts gesichert. In der Jägerstraße die Söhne der Großen auch ohne moralischen Befähigungsnachweis geduldet. Hier wie überall: je mächtiger der Protektor, um so unwesentlicher die Qualitäten des Protegés. Hier wie überall als Weisheit letzter Schluß: die Millionen. Die Berliner Gesellschaft mit ganz geringen Ausnahmen kennt keine Qualitätsmängel, die nicht durch Millionen heilbar wären.
Die Stimmung am »Tisch der Jungen« war, wie immer, rege: Der erste Metropolball – geht man, geht man nicht. Die Flora-Büste – Bode oder Stahl. Die Winterhose – umgekrempelt oder glatt. Der bessere Lyriker – Dehmel oder Rilke. Das smarteste Bad – Biarritz oder St. Sebastian. Der größere Könner – Debussy oder Richard Strauß. Das Knopfloch am Tage – Orchidee oder Nelke. Der wertvollere Michelagniolo – Makowsky oder Frey. Die beste Bouilla-baisse – bei Karnnenberg oder bei Borchardt.
Alles das in einer einzigen Stunde. Zwischen Fisch und Käse! Und neben Gemeinplätzen plattester Flachheit hin und wieder auch ein verständiges Wort.
Es sind immer die gleichen Gesichter, die man des Mittags hier sieht. Nur die Verteilung an den einzelnen Tischen ist je nach den Neigungen und Antipathien der einzelnen eine verschiedene. Aber im ganzen halten die Jungen sich doch getrennt von den Alten.
Die tragen – ohne die Absicht einer besonderen Würde – eine vornehme Behaglichkeit in die Räume. An ihnen ist nichts gewollt. Weder in ihrer Kleidung noch in ihrem Wesen. Sie bewegen sich mit einer selbstverständlichen Sicherheit und Ruhe, und man fühlt, daß sie immer die gleichen sind: ob zu Hause allein, ob hier unter ihresgleichen, ob bei Ministern oder bei Hofe. Unauffällig kommen und gehen sie und zeigen alle jene natürliche Vornehmheit, die sich nicht erlernen läßt und die eben vorhanden ist oder nicht; die ein besonderes Persönlichkeitsmerkmal und daher auch nicht die Fähigkeit besitzt, je nach der Umgebung und Richtung des Windes sich in Haltung und Gesinnung zu verändern. – Aber wie klein ist ihre Zahl geworden, und wo anders in Berlin fände man sie sonst noch als nur eben hier.
Am Tisch der Jüngern begann – als der Kaffee längst serviert war – die große Kritik der letzten gesellschaftlichen Ereignisse. Die zehn jungen Herren, deren Papas zusammen Vermögen in Höhe des Kapitals der Deutschen Bank versteuern, fühlen sich hier – und größtenteils mit Recht – als die allein maßgebenden Sachverständigen.
»Sie haben mehr Glück als Verstand, Graberg,« wandte sich Pölnitz, der Sohn unseres ersten rheinischen Großindustriellen, an sein Gegenüber. Er grinste dabei, die Riesen-Bülow zwischen seinen großen, blendend weißen Zähnen, halb gutmütig, halb ironisch und fügte, ob dieser Keckheit leicht errötend, hinzu: »Ich verstehe ja die Berliner Mädchen nicht.« Er nahm die Zigarre aus dem Mund, schüttelte die Asche auf die Untertasse und beugte seinen Oberkörper leicht über den Tisch. »Die Hölderlins sind ja wohl die reichsten Leute in Berlin. Das wären doch nun mal endlich Mädchen, die nach ihrem Geschmack heiraten könnten oder die,« und er richtete sich wieder auf, »was ich durchaus verstehe, wenn sie ehrgeizig sind, 'ne sogenannte große Partie machen könnten. Nicht etwa so'n fiesen adligen Kavalleristen aus der Provinz; ne, ich meine so was, wat in der Hofgesellschaft 'ne Rolle spielt, 'nen guten Uradel, dem nur die Millionen fehlen, um richtig repräsentieren zu können.«
Der, dem dies galt, saß frech und in überlegener Haltung da und fühlte nicht den Affront, der in Pölnitz' Worten lag. Er war stolz; denn aus der Rede spürte er nur heraus, daß er der Sieger war, der Sieger auf einem Terrain, dessen Lorbeeren eigentlich einem Vertreter des hohen Adels gehörten. – Und was gab's denn außer dem hohen Adel anderes, was er den Millionen seiner eben 17 jährigen Braut gleichwertig zur Seite stellte?
Noch unförmiger schien er, und seine aufdringlich breite und protzige Art, die von verständigen Juden nicht minder verurteilt wird als von Christen, wirkte abstoßend.
»Er hat sich eben beizeiten herangemacht, ehe sie unter Menschen kam und andere Männer kennen lernte,« erklärte ein kleiner, untersetzter Assessor und Syndikus einer Berliner Großbank.
»Das ist der ganze Witz,« sagte ein Dritter.
»Sie irren, meine Herren,« – selbstgefällig klang's und belustigt, – »meine Braut hat vor unserer offiziellen Verlobung drei Monate lang Gesellschaften besucht und ist während dieser Zeit mehr herumgekommen als andere junge Mädchen im ganzen Winter.«
»Vorher aber hatten Sie sie sicher. Das wußte jeder Mensch. Sie gingen daher auch überall mit ihr zu Tisch, und man hat mir erzählt, daß Sie wie ein Falke über die Trägerin Ihrer Millionen gewacht haben.«
Jetzt verlor Graberg seine Sicherheit. Er reckte sich und schien sofort proportionierter, obschon das breite und volle Gesicht, in dem die dunkeln, kleinen Augen wie schmale Risse lagen, nun noch widerwärtiger wirkte. Der kugelrunde, dicke Kopf schoß so gerade empor, daß er fast nach hinten überlag und breite Falten in den feisten Nacken grub. Wie ein Rekrut auf das Kommando: Achtung! Bereit zum Ohrfeigen! Er hatte etwas durchaus Provozierendes, wie er so dasaß.
»Ganz ohne persönlich werden zu wollen,« meinte mit einer knappen Verbeugung Dr. Heiden, ein trefflicher junger Jurist und Selfmademan, der einzige vielleicht in diesem Klub, »dieses frühe Heiraten ist doch recht bedenklich. Wie soll ein Mädchen in dem Alter schon imstande sein, eine für ihr ganzes Leben so wichtige Entscheidung zu treffen?«
»So ist das nicht,« meinte Fleischer, der kleine Assessor, »entscheiden tun in unseren Kreisen ja doch schließlich die Eltern nach Zweckmäßigkeit, und das ist auch ganz verständig. Denn mit der Liebe …«
»Armeleutesache,« fiel ihm Steiner ins Wort und suchte Dr. Heiden in seinem Bemühen, das Thema wieder auf neutralen Boden zu führen, zu unterstützen. »Wir haben bei unserm Monatswechsel Zerstreuung genug und können auf das bißchen Liebe gern verzichten. Wenn nur Familie und Geldpunkt stimmt, können wir schon froh sein, – na, und überfroh, wenn das Mädchen dabei noch manierlich aussieht und unsere Interessen, sei's nun für Sport, für Reisen oder für sonst was, teilt.«
»Oder für Mode,« sagte einer. Denn Steiners tägliche Besuche beim Schneider, sein Stiefelklapps und seine Sammlung seidener Strümpfe waren längst ein beliebter Gesprächsstoff der jungen Damen.
»Oder für Ehebruch,« warf ein Dritter dazwischen.
»Der gilt wohl allgemein als stillschweigend vereinbart,« grinste Pölnitz, schob seinen goldenen Zwicker wieder in die richtige Lage und ließ dabei Graberg, den er nicht ausstehen konnte, nicht aus den Augen.
»Höchstens doch für die Männer,« sagte mit Bedacht Dr. Heiden, was allgemeine Heiterkeit hervorrief.
»Einer, der an die Treue unserer Frauen glaubt!! Ich bitte die Anwesenden sich von ihren Sitzen zu erheben.« Und alle erhoben sich auf Pölnitz' Aufforderung. Nur Graberg blieb sitzen. »So ehrt der ›Tisch der Jungen‹ den Herold weiblicher Tugend!« Und man ließ ihn leben.
»Und ich trinke auf die Frauen,« erwiderte Dr. Heiden und leerte sein Aleglas.
»Die treuen oder die untreuen?« fragte der Assessor.
» Jede ist untreu, wenn der Richtige kommt,« rief Pölnitz dazwischen. Und sehr aufrichtig setzte er hinzu: »Gott sei Dank.«
Ganz ohne Grund, denn längst dachte niemand mehr an Grabergs Braut, schrie der in unfreundlichem Tone:
»Jede?«
»Für Sie nicht,« erwiderte Pölnitz, belustigt über die unbeabsichtigte Wirkung. »Sonst würde ich den Betrieb einstellen.«
»Was wollen Sie damit sagen?« fragte Graberg fast drohend.
»Daß ich mit Ihnen nicht teilen möchte.«
Graberg war außer sich. Seit acht Tagen war er mit dem reichsten Mädchen Berlins verlobt. Alle Welt wußte es und lag ihm zu Füßen. Unzählige frühere Bekannte waren seit jenem Tage für ihn erledigt. Er kannte und grüßte sie nicht mehr. Andere – und auch ihre Zahl war groß – die ihn früher geschnitten, zum mindesten kaum beachtet und allenfalls des Nachts in den Tanzsälen begrüßt hatten, schüttelten ihm jetzt – selbst in Uniform und unter den Linden!! – die Hand, begleiteten ihn, luden ihn ein, suchten seine Freundschaft. Ja, was glaubte denn dieser Pölnitz? Wer war er denn? Konnte er nicht ebensogut wie hier mit diesen Kaufmannssöhnen im Klub heut mittag mit dem Grafen Kleist und dem Baron Recum von den Gardehusaren bei Hiller sitzen? Freilich, dann müßte er zahlen und wurde womöglich noch angepumpt. Und hier zahlte jeder für sich. Aber wenn schon? Zahlte man schließlich nicht lieber für den Grafen in Uniform, als sich von diesen Herren hier freihalten zu lassen? Er wollte es diesem schon besorgen, noch dazu, da er von seinem Vater abhängig war, während das Geld seiner Braut vom Tage der Ehe ab zu seiner freien Vertagung stand. All das schien dieser Pölnitz völlig zu ignorieren. Aber er wollte es ihn schon fühlen lassen.
In wenigen Sekunden rasten diese Gedanken durch seinen Kopf, und er schrie so laut, daß man es am Nebentische hören konnte, zu dem belustigten Pölnitz hinüber:
»Haben Sie etwa schon mal aus Liebe eine Frau besessen?«
Der Assessor sprang auf. »Sie sind hier nicht im Séparée, Graberg, sprechen Sie leise oder ich stehe auf.«
»Ich ebenfalls,« sagte Dr. Heiden. »Kommen Sie,« rief er dem Assessor zu. Sie verabschiedeten sich kurz und gingen.
Aber Pölnitz war nur um so belustigter, je mehr Graberg raste.
»Aus Ihrer Clique vielleicht nicht. Aber das liegt nicht an den Frauen, sondern an mir,« sagte er ruhig und heiter.
»Keine gibt sich Ihnen,« antwortete Graberg und schob seine Zigarre, die in einer langen Papierspitze steckte, fortgesetzt von einem Mundwinkel in den andern.
»Jede!« sagte Pölnitz und lachte laut.
»Keine!« kam's zurück.
»Wollen Sie mit mir wetten?« fragte Pölnitz scherzend.
»So hoch Sie wollen. Sie wissen, ich kann zahlen.«
»Sie wollen Ihre Mitgift bei mir anlegen? Gut. Halten Sie hunderttausend Mark?«
»Ich halte!«
Sie reichten sich die Hände über den Tisch und Dr. Burg, Pölnitz' Freund, schlug durch.
Die Bedingungen lauteten:
Innerhalb eines Monats. Es kann eine junge Frau oder ein junges Mädchen sein. Beide müssen der Gesellschaft angehören. Pölnitz darf weder Geld geben noch Geschenke machen, noch eins von beiden in Aussicht stellen. Geschenke in Form notwendiger Aufmerksamkeiten sind gestattet. Der Name der Dame bleibt geheim.
So schlug's Erich Burg vor, und so wurde es von den beiden Parteien genehmigt. Die Anwesenden gelobten, über diese Wette vor ihrem Austrag Stillschweigen zu bewahren, da sonst Pölnitz' Bemühen von vornherein aussichtslos wäre. – »Es sei denn, daß er sie am Gewinn beteiligt,« rief ein schlanker, eleganter, aber oberflächlicher Junge.
»Das darf er ja nicht!« rief man dazwischen.
Heut war der 16. November. Man vereinbarte also ein Festessen, das der »Tisch der Jungen« am 17. Dezember zu Ehren des Siegers zu geben habe. Ein Fest mit Damen, an welchem natürlich auch die große Unbekannte teilnehmen müsse. Erst am Tage nach dem Fest, für das man einen wohltätigen Vorwand schon finden werde, dürfe man, aber auch dann natürlich überall nur diskret, den wahren Grund der Veranstaltung erfahren.
Diesen Vorschlägen des kleinen Groß stimmte man begeistert zu. – Assessor Groß, aus Berlins reichster Verlegerfamilie, hielt sich von allem gesellschaftlichen Trubel fern. Er besaß keinen Ehrgeiz, nach außen hervorzutreten, der es ihm erschwert hätte, ein Leben nach seinem Geschmack zu führen. Als stillem Beobachter bereitete ihm die Berliner Gesellschaft Zerstreuung ohnegleichen, und für seine Liebe zum Humor erschloß sich in ihr ein dankbares Feld regster Betätigung. Dabei besaß er auch Geist und Geschmack genug, um Stil und einen tieferen Sinn – und gibt's einen tieferen Sinn als den Humor? – in sein Leben zu bringen.
»Ich habe noch eine andere Idee,« sagte er mit dem durchtriebensten Gesicht, durch die günstige Aufnahme seines ersten Vorschlags animiert. »Niemand darf bis zum 17. Dezember wissen, wer die Dame ist. Nur dabei muß sie sein. Nach dem Fest versammeln wir uns im Klub. Ich eröffne einen Weltmarkt, und jeder wettet auf die Dame, die er für die große Unbekannte hält. Bevor Pölnitz aber den Namen nennt, muß jeder seine Wahl begründen. Auf diese Weise werden wir viel interessante Details über unsere Damen hören. Dann erst hat der Sieger das Wort.«
»Also bringen Sie uns nicht um die Sensation, Pölnitz,« rief ein Dr. Lohr.
Die Stimmung nahm Höhen an, die hier selten waren. Nur Graberg war in Sorge. Wenn er verlöre! Hunderttausend Mark!! Er sprach leise zu Steiner, der sein Freund war, schob sich langsam in die Höhe, suchte vergeblich den untersten Westenknopf zu schließen, trank stehend seinen 21 er Meukow, warf ein Goldstück auf den Tisch, rief Fritz, den Kellner, und ging satt und schwer, ohne zu grüßen, zur Tür. –
»Mit wem versuch ich's?« fragte Pölnitz seinen Freund Erich, als alle anderen fortgegangen waren.
»Mit seiner Braut, das wäre ein Witz,« erwiderte der.
»Ist mir zu häßlich. Wenn mir die Sache keinen Spaß macht, bin ich schwerfällig und komme keinen Schritt vorwärts. Es muß eine Frau sein, die mich reizt.«
»Also sehr jung?«
»Oder Fähigkeiten, die das Alter rechtfertigen.« Sie lehnten eine nach der andern ab. Viele, die geeignet schienen, ließ man fallen, sobald man in die Harmlosigkeit des Gatten Zweifel setzte. Und da dies Hindernis bei den jungen Mädchen von selbst fortfiel, so schieden die verheirateten Frauen schließlich ganz aus.
Man suchte nur noch unter den jungen Mädchen und bevorzugte Töchter, von deren Müttern man wußte, daß sie nicht eben Wert darauf legten, für besonders moralisch zu gelten.
»Ich hab's!« rief Erich erfreut. »Vorzüglich! Sonderbar genug, daß ich nicht gleich darauf gekommen bin.«
»Wer ist's?« fragte Pölnitz.
»Die Prädestinierte,« gab er zur Antwort.
»Willst du's nicht sagen?« und ungeduldig fügte er hinzu: »Ich werd's ja doch wohl erfahren müssen.«
»Ich beneide dich fast,« meinte Erich, »am nächsten Dienstag ist Jour, ich führe dich ein. Nur einen Haken hat die Sache … Gesellschaft ist ja wohl Bedingung! – Hm – Ob man die zur Gesellschaft – aber eigentlich gibt's ja gute und schlechte Gesellschaft – also warum nicht?«
»Reich?« fragte Pölnitz.
»Millionen!«
»Na also! – Gute Gesellschaft natürlich.«
»Gemacht!« rief Erich. »Fritz, ein Clicquot gelb, aber schnell.«
»Sehr wohl, Herr Doktor!«
Und während Pölnitz noch neugierig und verdutzt dasaß, stand Erich auf, stieß mit ihm an und rief: »Es lebe Ilse Reich!«
»Please, Sir.«
Pölnitz fuhr aus dem Schlaf, hob den Kopf, versuchte die Augen zu öffnen, und brummte:
» The bath is ready,« sagte sein Diener und hielt ihm eine Pyjama aus Kamelhaar hin.
»Ach Sie, Henri.« Er gähnte, und der Diener hielt sich die Hand vor den Mund.
Henris Manieren waren mustergültig. »Sie sind mein business,« war seine ständige Redensart, und er hatte recht. Denn er wußte, daß die Herren ihn nur so lange behielten, bis sie ihn ausstudiert hatten. Er verlangte zwei Pfund die Woche und außerdem freie Kleidung; das war ungefähr nochmal das gleiche. Dafür war er seit nunmehr drei Jahren bemüht, den Berliner Herren, denen er diente, die Manieren eines englischen Gentleman beizubringen.
»Schon neun Uhr?« fragte Pölnitz und faßte an den Kragen seiner Pyjama, da Henri seit mehreren Sekunden intensiv auf diese Stelle starrte. Er rückte mit leisem »ach so!« die oberste Quaste zurecht, die sich verschoben hatte.
» Yes, Sir.«
»Sprechen Sie deutsch! Wie oft soll ich Ihnen das sagen?«
Pölnitz sprach laut, und Henri erwiderte:
»Ich höre, Herr.« Das klang aber mehr, als meinte er, daß Pölnitz leiser sprechen dürfe. Henri öffnete die Tür zur Badestube, in der ihn der Masseur erwartete.
»Morjen, Rebsch!«
»Guten Morgen, Herr Pölnitz.«
»Ich bin wie gerädert heute. Sie müssen mich ordentlich wieder zurechtbügeln.«
»Wird gemacht, Herr Pölnitz.«
Pölnitz setzte ein Bein in die Wanne.
»Brr! Ist das kalt.«
»Ja, ja, die schönen Zeiten sind vorüber.«
»Welche Zeiten?« fragte Pölnitz, froh, einen Grund zu haben, um noch einen Augenblick in der Wanne stehen zu bleiben.
»Na, ich meine, die heißen Bäder.«
»Ach so – ja. Sie haben recht – aber Henri erklärt,« und dabei glitt er langsam immer tiefer in die Wanne, »in London bade man bei zweiundzwanzig Grad und da gibt's nichts dagegen. Huh, huh,« – und er setzte sich ganz hinein, – »verflucht, brr! – Übrigens, Henri hat recht – im ersten Augenblick freilich – aber! Es erfrischt und (er fror furchtbar) das heiße Bad macht schlapp.«
Kaum saß Pölnitz regelrecht in der Wanne, als Henri herantrat und wie jeden Morgen den Hörer des Telephons, das außen an der Wanne angebracht war, abnahm.
»Darf ich?« fragte Henri.
»Bitte!« sagte Pölnitz, und Henri rief.
»Nummer 12642!«
Sofort plantschte Pölnitz mit dem rechten Arm aus der Wanne, entriß Henri den Hörer:
»Ne, ne, um Himmelswillen! Die heute nicht. Da, hängen Sie an!« Und er wollte ihm den Hörer zurückreichen. Henri aber war entsetzt zur Seite gesprungen und tupfte, wie eine Dame, der der Kellner Bratensauce über die Balltoilette gegossen hat, langsam jeden Wassertropfen von seiner Livree.
»Kaffer!« rief Pölnitz ihm zu, und trennte selbst die Verbindung.
»Verzeihung, Herr, aber ich konnte nicht ahnen – – denn seitdem ich in den Diensten des gnädigen Herrn stehe – das sind heute drei Monate – …«
»Gratuliere!« unterbrach ihn Pölnitz.
Henri verbeugte sich leicht, »... muß ich jeden Morgen zuerst die Verbindung mit dem gnädigen Fräulein Lizzy herstellen.«
»Ne, ne, natürlich konnten Sie das nicht wissen. Sie klingeln nachher an und sagen, ich wäre mit dem Grafen Hech zur Jagd. Ich brauche den Tag und kann sie heute nicht sehen.«
»Gewiß, ich verstehe,« sagte Henri, und trat vorsichtig wieder an den Apparat.
»Nun Dr. Burg!«
Und Henri verband und reichte ihm zaghaft den Hörer.
»Hallo, Erich! Also denk' dir, gestern ist es zum Klappen gekommen.«
»Nicht möglich!«
»Ich habe die Wette gewonnen.«
»Wie? wo? – Das mußt du mir erzählen.«
»Einfach war es nicht. Das Mädel hatte Prinzipien.«
»Also was tust du nun?«
»Augenblicklich sitze ich in der Wanne.«
»Auf alle Fälle gratulier' ich.«
»Danke! ich bin sehr froh. Es ist mal was anderes. Etwas, was so ganz aus dem Rahmen fällt.«
»Ja, du willst die Sache doch nicht etwa fortsetzen.«
»Doch! das ist meine Absicht.«
»Und Lizzi, was wird aus der?«
»Derentwegen klingle ich an. Ich weiß, du hattest doch immer etwas für sie übrig. Sie wird jetzt frei.«
»Du kannst sie doch unmöglich von heut auf morgen auf die Straße setzen.«
»Also so rat' mir! was soll ich tun?«
»Bist du dir denn ganz klar über deine Gefühle?«
»Durchaus! Ich bin auf dem besten Wege, mich zu verlieben.«
»Dann würde ich dir raten, Lizzi auf Reisen zu schicken. Nach Paris oder …«
»Famoser Gedanke! Sag mal …«
»Ja?«
»Willst du sie nicht begleiten?«
»Ich? – Ja, wie kommst du denn darauf?«
»Nun, ihr versteht euch doch so gut.«
»Das tun wir allerdings.«
»Nun also.«
»Wenn ich dir damit einen Gefallen tue.«
»Am Ende fällt es dir nicht einmal so schwer.«
»Damit willst du doch nicht etwa sagen …«
»I Gott bewahre! Wie werd' ich denn!«
»Wenn dir so viel daran liegt.«
»Das tut es allerdings.«
»Also dann werde dir den Gefallen tun.«
»Ich bin dir sehr dankbar.«
»Und wann meinst du, daß wir …?«
»Am besten noch heute.«
»Ich werde es möglich machen.«
»Gute Reise! Grüß' sie, und laßt von euch hören.«
»Gern. Also leb' wohl!«
»Adjes!«
»Na,« sagte Pölnitz und hing den Hörer an – »das ging ja ganz glatt.«
Dann stieg er aus der Wanne, Henri trat einige Schritte zurück und Rebsch hielt ihm das warme Laken vor.
»Eine Palast-Revolution?« fragte Rebsch und gönnte sich einen Augenblick Muße.
Ein empörter Blick Henris traf ihn ob dieser Indiskretion.
»In Aussicht,« erwiderte Pölnitz und grinste. Er wies auf die Kniekehle hin: »Hier bin ich noch naß.« Rebsch trocknete.
»So – bei dem Mangel an brauchbarem Material« – dabei legte er sich auf die Chaiselongue, über die ein Laken gebreitet war – »kann man gar nicht vorsichtig genug sein.«
»Aber ich bitte, für Sie, Herr Pölnitz, kann's doch keine Schwierigkeiten haben.«
»Gerade« – Rebsch massierte ihn und rieb den ganzen Körper mit Crême de Lentheric ein – »sehen Sie, bei mir heißt's immer: der reiche Pölnitz. Jede Frau, mit der ich in Berührung komme, denkt an nichts weiter als ans Geld und kommt vor lauter Rechnerei gar nicht auf den Gedanken, daß es zum mindesten nicht hinderlich ist, wenn man bei derlei Verrichtungen, denen ich übrigens als letzter jeden geschäftlichen Charakter abspreche, auch ein bißchen Liebe mitspielen läßt.«
Rebsch schüttelte ungläubig den Kopf. »Sie übertreiben.«
»Fällt mir nicht ein! Fragen Sie Henri, der weiß es. Hier denken meist alle so, nur ich bin der einzige, der sich selbst nichts vormacht. – Ist's nicht so, Henri? Wie war's bei den früheren Herren?«
Henri war außer sich.
»Reden Sie, Henri!«
»Der gnädige Herr wollen mich auf die Probe stellen.«
»Was will ich?«
»Der gnädige Herr wollen sich von meiner Diskretion überzeugen.«
»Ach!‹Fällt mir nicht im Traum ein. Ihre Diskretion ist mir höchst langweilig. Sehen Sie, Rebsch,« – und er wies auf Henri, der immer verlegener wurde – »das da sind die Leute, die geliebt werden: wo man nach dem Gelde nicht fragt; das heißt natürlich die Frau, der Mann fragt schon.«
Rebsch wand sich vor Vergnügen.
»So'n Mensch braucht gar nicht zu reden oder er kann die ganze Zeit über englisch sprechen und die Frau braucht kein Wort zu verstehen, nur um so besser. Aber so müssen sie aussehen, – gerade wie Henri, –« – der wußte vor lauter Verlegenheit sich gar nicht zu bewegen, – » überlegen und resigniert! Das sind die beiden Eigenschaften; wenn sie die haben, und Henri hat sie, dann wird sie jede Frau lieben. Nicht wahr, Henri? So reden Sie doch!«
»Ich …« sagte er langsam und sah zur Erde.
»Wat ich? Heraus, habe ich recht?«
»Ich finde …«
»Was finden Sie?«
»Ich weiß nicht, ob ich …«
»Sie dürfen, also, was finden Sie?«
»Ich finde es obszön, von der Liebe …« und er ging schnell aus dem Zimmer.
Pölnitz lachte ganz laut: »Ein Juwel! Unbezahlbar, dieser Mensch! Denken Sie, er ist bis über die Ohren in die Lizzi verschossen.«
»Was? In das Fräulein Lizzi vom Herrn Pölnitz?«
»Ja, ja, er verfolgt sie mit Anträgen und spielt sich bei ihr als Gentleman auf, mir, einem deutschen Barbaren gegenüber.«
»Und Sie setzen ihn nicht an die Luft?«
»Fällt mir nicht ein. Eine Lizzi finde ich mit einiger Mühe immer wieder, einen Henri aber finde ich zum zweiten Male nicht. Und dann ist das Studium, ob man die richtige Freundin hat, weit angenehmer als das Ausprobieren eines Kammerdieners.«
Es klopfte.
Pölnitz rief: »Herein!«
Henri blieb diskret an der Tür stehen: »Der Friseur, gnädiger Herr.«
»Na und – – wartet er auf die Einholung?«
Henri erwiderte fast schüchtern: »Ich wollte erst fragen, ob der gnädige Herr das Thema – – ich meinte, vielleicht, daß der Friseur dann warten könnte …«
Rebsch ging, der Friseur Rommel wurde von Henri eingelassen. Rommel erbte seit Jahren Pölnitz' abgelegte Anzüge und Stiefel. Henri fand das zwar »unästhetisch«, und Rommel führte daher bei seinen Kollegen den Beinamen »Helly«; wohl mit Unrecht, denn sämtliche Dienstmädchen, deren Herrschaften er besuchte, fanden ihn liebenswürdig und begehrenswert.
Rommel war Pölnitz' Liebesmarschall. Er war Mitwisser seiner sämtlichen Verhältnisse seit nunmehr beinahe dreizehn Jahren. Aus einem sorgsam von ihm geführten Liebesalmanach, der neben dem Bildnis jeder Dame, die er besessen, genaue Angaben der Geburt, Ort und Zeit der Anknüpfung, Dauer der Beziehungen, außergewöhnliche Ausgaben, Trennungssumme und Höhe der weiterzuführenden Weihnachts- und Geburtstagsraten enthielt, machte er monatlich seine Auszüge, erinnerte, besorgte, rechnete ab. Den meisten brachte er die Geschenke selbst ins Haus, versicherte sie in wohlgesetzter Rede der dankbaren Erinnerung seines Herrn und stellte regelmäßig besten baldigen Besuch in Aussicht, der jedoch nie erfolgte.
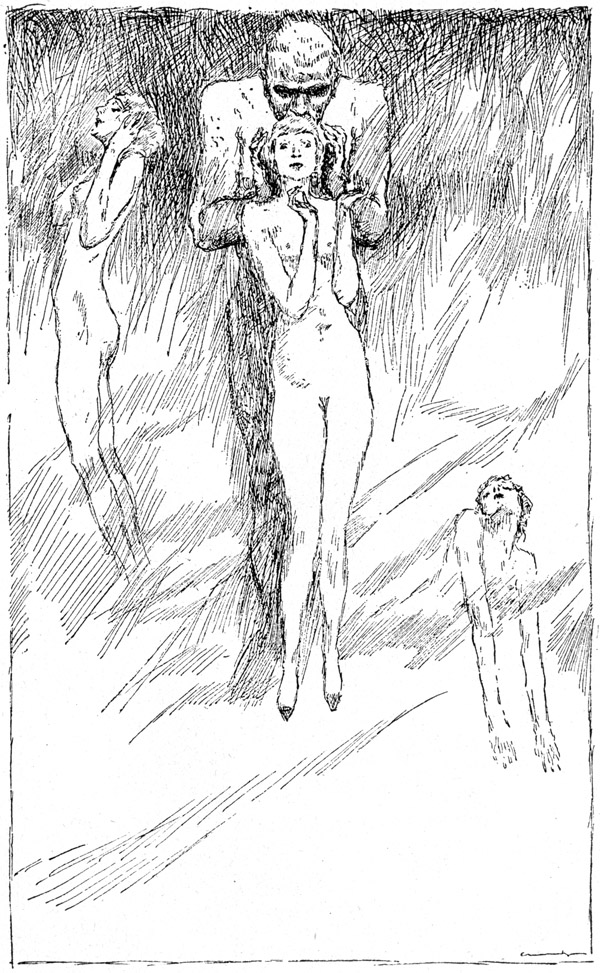
Viele fanden es geschmacklos, daß Pölnitz sich gerade seines Friseurs für diese Dinge bediente; aber wie anders sollte er sich helfen? Auf Herren der Gesellschaft, die er Freunde nannte, war kein Verlaß. Denn wo fand man einen vollendeten Kavalier, der sich zu derartigen Dingen hergab? Zudem, brauchte man ihn, war er verreist oder durch eigene Liebesabenteuer verhindert. Und mit der Diskretion war es auch meist so 'ne Sache. Sie waren so lange verschwiegen, als nicht eigene Neigungen, deren kostspielige Seite der Betätigung man gerade in diesen Kreisen so gern auf das Konto eines andern setzte, unerwidert blieben. Sie erzwangen sich dann entweder Gehör und man war verraten; oder sie kompromittierten beide Teile, und zwar so geschickt, daß man sie selbst nie der Indiskretion überführen konnte, beleidigte Gatten, Väter und Brüder aber auf dem Halse hatte.
Rommel aber verlor sein Brot, sobald er klatschte. Klatschte er aber, so hörte man sein Geschwätz kaum an und Pölnitz fragte, wenn sich jemand in seinen Beschwerden auf ihn berief: »Rommel? – Wer ist der Mann?« Und wenn er zur Antwort bekam: »Ihr Friseur!«, so lächelte er verächtlich und meinte: »Wollen Sie oder soll ich mich zuerst mit ihm schlagen?«
Mit diesem Mann also lief Pölnitz bei seinen oft recht wagehalsigen Eskapaden verhältnismäßig am wenigsten Gefahr. Und dann glaubte auch er an »Helly«, weil sich Rommel gern putzte, Hände weiß wie eine Dame hatte und Friseur war.
Das Telephon klingelte.
»Nehmen Sie den Apparat am Schreibtisch, das wird Fräulein Lizzi sein.«
Henri ging, kehrte sogleich wieder: »Eine Dame.«
»Fräulein Lizzi?«
»Nein, bestimmt nicht, heller.«
»Soll Namen nennen.«
»Darum bat ich. Herr Pölnitz wüßten schon.«
»Immer derselbe Unsinn! Gar nichts weiß ich. Bekannte Stimme?«
»Nein, sehr hell, wie gesagt. Wie ein Kind.«
Pölnitz sprang ohne Strümpfe an den Füßen, in den Untersachen, auf und stürzte an den Apparat.
Henri lief, außer sich, die Strümpfe in der Hand, hinter ihm her.
»Sie erkälten sich, Herr Pölnitz. Ich kann ja umstellen.«
Aber schon war Pölnitz am Apparat.
Seine Erregung war so auffallend, daß der sonst nicht neugierige Henri den Hörer am Haupttelephon nahm, um die Unterhaltung mit anzuhören.
»Hallo!« begann Pölnitz.
Erregt und doch sicher kam die Antwort: »Ich bin's.«
Sofort wechselte er seine Stimme und sagte zärtlich: »Liebling, Ilse, du?«
»Ich bin sehr zufrieden.«
»Nicht auch glücklich?« fragte er. »So glücklich wie ich?« und suchte, noch zärtlicher zu werden.
»Ich will es werden – durch dich,« antwortete sie.
»Und hast keine Reue?« fragte er weiter.
»Reue? Worüber?« sagte sie erstaunt. Und ihr Erstaunen war echt. »Ich habe Vertrauen und den Willen. Beides gleich stark. Warum sollte ich Reue haben?«
»Ich danke dir,« sagte er, da er keine Antwort wußte. Er sprach leiser und suchte Rührung in seine Stimme zu legen, was sie durchaus nicht begriff. Auch nicht, wofür er dankte. Sie war es doch, die zu danken hatte.
»Was wird nun?« fragte sie unruhig.
Pölnitz sah nach der Uhr. Gerade elf war es.
»Um einhalb ein Uhr mache ich bei euch Besuch. Sieh zu, daß wir uns auf wenige Minuten allein sprechen.« Dann gab er sich einen Ruck und fragte kurzweg: »Kannst du es nicht einrichten, am Nachmittag, wenn auch nur auf eine Stunde?«
»Wie meinst du das?«
»Bei mir will ich dich haben,« und wieder zärtlich fügte er hinzu, »wo uns niemand ruft und wir ruhig und glücklich sein können, ganz nur für uns.«
»Wird das gehen?« Und aus ihrer Stimme klang mehr die Besorgnis, es nicht ermöglichen zu können, als etwa ein Bedenken – das ihr nicht kam –, ob ihr Besuch denn wohl auch nicht kompromittierend sei.
Pölnitz fühlte das nicht recht; auch wäre es ihm wohl unnatürlich erschienen. Er sagte daher:
»Wenn du willst, so wird es gehen. Bringe nur die Miß mit. Um so besser.«
»Ich will's versuchen. Mama ruft mich. Leb' wohl!«
Sie war fort, noch ehe er ihr etwas sagen konnte.
Henri stürzte wieder ins Toilettenzimmer und sagte nicht eben leise: »Shocking, Shocking! Und das alles durchs Telephon.«
*
Pölnitz ließ die ganze Wohnung erleuchten und bestimmte für die Blumen, die das Kammermädchen in eine Reihe Gallet- und Nancyvasen verteilt hatte, selbst die Plätze; fragte Henri, der sich unbemerkt glaubte und mit kritischer Miene in den »Studio«-Heften blätterte, ob er ihm nicht ein paar englische Bücher für den Nachmittag geben wolle.
Dieser Auftrag schmeichelte Henri und er schleppte sofort mit Hilfe des kleinen Max, der mit seinen sechzehn Jahren dazu engagiert war, eine sehr geschmackvolle Livree möglichst selbstverständlich zu tragen, und der sonst nur noch als dekorative Zier bei Ausfahrten im Dogcart zur Verwendung kam, ein halb Dutzend dicker Bände herbei.
Pölnitz sah sie sich an.
Macaulays Bilder der englischen Gesellschaft, die Depeschen Malmesburys, Charles Grevilles Denkwürdigkeiten, die Briefe von Horace Walpole …
»Etwas einseitig, Ihre Bibliothek, Mr. Henri – und etwas langweilig.«
»Mir wird es nie langweilig, Sir, über die Sitten und den Takt der guten englischen Gesellschaft etwas zu lesen.«
»Wie sieht der Teetisch aus?« fragte er Henri.
»Wenn Herr Pölnitz sich selbst überzeugen wollen.«
Henri schob die Flügeltür, die ins Nebenzimmer führte, auf, und Pölnitz war mit Henris Anordnung zufrieden.
Nie hatte er sein old silver, dessen Hauptstücke in Oxford gewonnene Sportpreise waren, so wirken sehen.
»Keine Servietten, keine Bestecke?« fragte Pölnitz.
»Zum Tee? – aber nein! Ganz unmöglich!« erwiderte Henri nicht ohne Ironie. »Und wenn ich noch auf etwas Hinweisen darf.«
»Bitte!« sagte Pölnitz belustigt.
»Die Dame wird doch wissen, daß sie den Tee eingießt – nicht ich! wie neulich, so daß der footman gänzlich den Kopf verlor und wie ein Aushilfskellner den buttered toast und die concombre Sandwiches herumreichte – was doch Sache der Herren ist,« fügte er hinzu, – »wenigstens bei uns – in London – in den besseren Salons.«
»Seien Sie ohne Sorge. Es sind Damen, die wissen, was sich schickt. – Deshalb braucht sie das Dienstpersonal auch nicht zu sehen.«
»Selbstverständlich.« Henri verneigte sich.
»Aber Sie könnten … hm … sagen wir … vielleicht wenn ich zweimal läute … so ganz unauffällig hereinkommen und sich … hm … natürlich nur, wenn es sich macht … und Sie einen Anknüpfungspunkt finden … mit Takt … sich ein wenig, meinetwegen auch intensiver, mit der Miß … nicht wahr … Sie sind ja Landsleute, da findet sich gewiß für eine Viertelstunde Stoff … ich möchte nämlich … Sie werden begreifen, daß ich mir die junge Dame nicht zum Teetrinken eingeladen habe … das könnte ebenso jeder für sich besorgen …«
Henri stand unbeweglich und erwiderte nur:
»Haben Sie die Güte, Herr Pölnitz, abermals zweimal auf den Knopf zu drücken, sobald die Miß wieder in die Erscheinung treten darf.«
*
Ilse und die Miß kamen.
Sie tranken zu tritt Tee.
Dann lud Pölnitz die Damen ein, sich seine Kupferstiche, die in einem der hinteren Räume hingen, anzusehen.
Die Miß war taktvoll, lehnte ab und blieb im Herrenzimmer zurück.
Pölnitz führte Ilse in die hinteren Räume.
Als er beim Hinausgehen zweimal auf den Knopf der Klingel drückte, war Henri sofort zur Miß ins Herrenzimmer geeilt. Es dauerte nicht lange, da war ein lebhaftes Gespräch im Gange.
Das Thema war gegeben.
»O diese Deutschen! Oh shocking!« sagte Henri.
» Shocking!« erwiderte die Miß.
»Sie nennen mich einen Anarchisten, denn ich habe keine Furcht vor dem Schutzmann und beschwere mich beim englischen Konsul, wenn die Behörden mich schikanieren.«
»Und mich schelten sie dünkelhaft und verschroben, weil ich die Werbung eines Mannes abschlug, obgleich er Geld und ein halbes Dutzend Titel hatte.«
»Auch sonst«, meinte Henri, »bewerten sie den Menschen gesellschaftlich und moralisch nicht nach seiner Leistung, seinem Charakter und seinen Manieren, sondern nach seiner Herkunft, seiner Religion und der Höhe seines Vermögens.«
»Und sie wechseln für Titel und Orden ihre Überzeugung.«
» Oh shocking.«
Pause
»Oh, wie unschick sind die Deutschen!«
»Und wie laut sind sie!«
»Sie essen den Fisch mit dem Messer.«
»Und stippen das Brot in die Sauce.«
»Sie gehen am Tage im Frack.«
»Und des Abends im Gehrock.«
»Sie gehen mit Hemden ins Bett.«
»Und baden wöchentlich einmal.«
» Oh shocking!«
» Shocking!«
Henri war nahe an sie herangetreten. Er legte seine Hand auf ihre Schulter.
»Bedauernswerte! was müssen Sie leiden!«
»Und Sie, Ärmster!« erwiderte sie.
»Wir wollen zusammenhalten!«
»Wir wollen,« sagte sie und legte ihre Hand auf die seine.
Dann stand sie auf, und er geleitete sie mit Anstand in sein Zimmer. Hier zog er sie an sich. Einmal, zweimal. Und sie entkleidete sich ruhig und sachlich und stellte gewissenhaft ein Stück neben das andere. Das Gleiche tat er. Dann nahm er sie bei der Hand und führte sie an sein Bett.
»Wie schwer du atmest!« sagte er und nahm sie in seine Arme.
Dann sagte er nichts mehr.
Und dieses Schauspiel wiederholte sich in den nächsten Wochen, so oft die Teegesellschaft beieinander war.
Und wenn Pölnitz zum zweiten Male auf den Knopf der Klingel drückte, dann saß die Miß längst wieder an dem Teetisch, an derselben Stelle wie zuvor, und las mit unveränderter Miene in der Spezial Winter number des Studio von 98/99 die Austria Book-plates auf Seite 71.