
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Mein Herr, ich wiederhole, daß ich mein Urteil nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben habe. Noch kann ich mir kaum vorstellen, daß es nicht richtig sein sollte.«
»Sie sehen doch, was hier in diesem Brief steht! Und Sie sehen diese verbrecherischen Daumenhüllen!«
»Ich sehe diese Schatten toter Meisterhände, diese Gespenster aus dem Friedhof der Jahrhunderte, und ich schaudere!«
Zum zwanzigsten Male betrachtete Nicole Ferrand die Gummidaumen, die er in der bebenden Hand hielt. »Zu welchen Höhen kann sich doch die Arglist des Menschengeistes aufschwingen! Ich schaudere!«
Alkyon Argyropoulos ballte die Hände gegen einen unsichtbaren Feind.
»Einmal treffe ich noch diesen König der Schelme – aber dann! Nun muß ich mich mit Ihnen über andere Dinge beraten, Kyrie! – Ich wünsche Ihre Hilfe.«
Die Augen des Millionärs verschleierten sich bald, bald funkelten sie hell auf, während er weiter sprach; dann schoß er wieder wie ein Rasender im Zimmer umher.
»Gehen Sie doch in den Louvre«, rief er, »gehen Sie in welches Museum Sie wollen! Sie sehen ganze Wälder von Marmorstatuen. Wer hat sie geschaffen? Hellas! Woher kommen sie? Aus Hellas! Und wie sind sie erworben worden? Durch Kauf? Nein – sondern durch Raub! Im Louvre steht die Venus von Milo. Wie ist sie in den Besitz Frankreichs gekommen? Ein französischer Diplomat hat sie dem griechischen Bauern, der sie gefunden hat, um 6000 Franken abgeschwindelt! Heute könnte Frankreich die Hälfte seiner Schulden bezahlen, wenn es dieses unschätzbare Meisterwerk verkaufen wollte. Im britischen Museum befindet sich der Parthenonfries. Wie ist er nach England gekommen? Ein anderer Diplomat, ein Lord Elgin, hat sich unsterblich gemacht, indem er ihn raubte und entführte. Wenn heute die Bank von England Konkurs machen würde, England braucht keine andere Sicherheit für eine Anleihe bei den Wucherern auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans!«
Herr Ferrand räusperte sich.
»Möglicherweise haben Sie recht«, murmelte er. »Gewiß – Sie haben recht. Aber was hat alles das mit der Hilfe zu tun, die Sie von mir wünschen?«
Der Millionär senkte seine Stimme, aber das Funkeln seiner Augen verminderte sich nicht. Durch zehn Minuten hindurch sprach er, ohne daß Herr Ferrand ihn unterbrach. Als er endlich verstummte, dauerte es lange, bis der Kunstverständige das Wort ergriff.
»Sie – Sie sagen, daß man Ihnen den Kauf – den Rückkauf verweigert hat –!«
»Ja.«
»Und Sie wollen, daß ich Ihnen behilflich bin –«
»Wie können Sie es wagen, mir einen derartigen Vorschlag – zu machen? Man müßte glauben, Sie wüßten nicht, wer ich bin –«
Der Millionär sah sein Gegenüber durchdringend an. »Sie haben durch einen gewissen Lehrsatz großen Ruhm erlangt. Dieser Lehrsatz ist durch den König der Schelme lächerlich gemacht worden.«
Herrn Ferrands zitronengelber Teint bekam einen Stich ins Orangefarbene.
»Noch glaubt die Welt an Ihren Lehrsatz«, fuhr der Millionär unerbittlich fort, »noch weiß sie nichts von der Nichtigkeit Ihres Ruhms. Wenn Sie mir helfen, wird sie auch weiterhin nichts erfahren.«
Herrn Ferrands zitronengelbes Antlitz schillerte plötzlich ins Grünliche.
»Aber – wie können Sie glauben, daß ich helfen kann? Daß ich der rechte Mann bin –«
»Das glaube ich auch gar nicht«, unterbrach ihn Alkyon Argyropoulos. »Aber Sie müssen schon viele Schelme entlarvt haben, wenn Sie auch nicht den König der Schelme entlarven konnten. Was ich wünsche, ist folgendes: Bringen Sie mich in Berührung mit einem von jenen; helfen Sie mir durch einen solchen, das zu erreichen, was ich will.«
Herr Ferrand starrte bald auf das Faungesicht seines Besuchers, bald auf die Gummifinger Lavertissens, die er noch in der Hand hielt. Er befeuchtete die Lippen mit der Zunge.
Am Tag nach dieser Unterhaltung gab Alkyon Argyropoulos seinem Sekretär Auftrag, eine Villa im Passyviertel zu mieten.
»Sorgen Sie für eine Wohnung, die einsam liegt, von Bäumen beschattet und nahe dem Flusse. Aber es eilt, wichtige Dinge stehen bevor.«
»Und Dienerschaft?« fragte der Sekretär.
»Stellen Sie nur ganz wenig Personen ein. Suchen Sie unter unseren Landsleuten und wählen Sie lieber Verwandte der kuhäugigen Hera als der klarblickenden Athene. Nur den Posten des Küchenchefs will ich selbst besetzen.«
»Mit wem, Herr?«
»Niemals«, sagte Alkyon Argyropoulos, »habe ich besser gegessen als in diesem Hotel. Wenn der König der Schaffer gewillt ist, uns zu folgen, soll er willkommen sein! Lassen Sie ihn holen!«
Herr Henry kam, die weiße Mütze auf dem Kopf. Der Millionär machte seinen Vorschlag. Nur ungern pflegen die Chefs und Unterchefs großer Hotels einen Privatposten anzunehmen. Doch es zeigte sich, daß Herr Henry eben an diesem Morgen eine ernste Auseinandersetzung mit dem Oberchef gehabt hatte. Er nahm Alkyon Argyropoulos Vorschlag offenkundig mit Freude an.
»Wenn ich das Hotel verlasse, um in Ihre Dienste zu treten, bedeutet das für mich einen guten Tausch, mein Herr. Nur eines muß ich mir vorbehalten.«
»Und zwar?« fragte der Millionär ein wenig unruhig.
»Ich bin Künstler, mein Herr. Ein Künstler kann nicht nur von Geld leben. Er will besprochen werden, er bedarf der Kritik. Hier im Hotel ist Ihr Menu täglich veröffentlicht worden, es wurde besprochen, kritisiert und belobt. Meine Bedingung, unter der ich in Ihren Dienst trete: daß ich Ihr Menü in einer Zeitung veröffentlichen darf.«
Alkyon Argyropoulos, der eben in Behandlung des Raseurs war, klatschte in die Hände, obwohl er seinen Hals dadurch in Gefahr brachte.
»Ehrbarer Schaffer, dein Wunsch sei erfüllt! Und wenn du es willst, sollst du den Rest meines Lebens um mich sein!«
»Es ist also abgemacht, mein Herr?«
»Es ist abgemacht«, sagte Alkyon Argyropoulos mit einer Handbewegung, würdig des olympischen Zeus.
Drei Tage später verließ er das Hotel Cesarini und zog in die Villa Nitschewo, ein großes Gebäude mit flachem Dach, umgeben von einem Garten und mit freier Aussicht auf die Seine. Das Haus wurde von seinem Besitzer, einem Russen, der auf Reisen war, möbliert vermietet. Anstatt eines Hauswarts hatte es einen Aufseher, der einige Häuser weiter weg wohnte. Eine diskretere und abgelegenere Behausung konnte man sich kaum denken.
Der erste Gast, der seinen Besuch in der Villa machte, war Herr Ferrand. Er und der Hausherr zogen sich sofort in das Arbeitszimmer zurück. Der Kunstsachverständige war sichtlich nervös.
»Es geht nicht«, waren seine ersten Worte. »Niemand will von derartigem auch nur reden hören!«
»Mit wem haben Sie gesprochen?«
»Mit mehreren – mit mehreren Personen von der Art, die Sie andeuteten. Alle haben dasselbe geantwortet. Sie wollten überhaupt nicht glauben, daß das, was ich ihnen vorschlug, etwas anderes sei als ein schlechter Witz. Und das alles nur, weil Sie sich wegen meines kleinen Irrtums an mir rächen wollen?«
»Was nennen Sie einen kleinen Irrtum!« lachte der Millionär. »Daß ich 50 000 Franken verloren habe? Daß ich sie verloren habe, weil ich mich auf den in ganz Europa berühmten Kenner von Falsch und Echt, Nicole Ferrand, verlassen habe?«
Der Kunstexperte raufte verzweifelt seinen Bart.
»Warum haben Sie sich eine Sache in den Kopf gesetzt, die völlig unmöglich, die wahnsinnig ist? Meinen Sie, ich könnte zaubern? Niemand, sage ich Ihnen, niemand kann das machen, was Sie von mir verlangen!«
»Da Sie niemand sagen«, gab der Millionär kalt zurück, »rufen Sie mir jene Persönlichkeit in Erinnerung, die zwei gewisse Daumenhüllen anfertigte.«
Der Kunstexperte schnellte von seinem Stuhl auf. »Was wollen Sie denn, daß ich tue«, schrie er beinahe. »Was wünschen Sie?«
»Ich habe Ihnen schon gesagt, was ich wünsche. Ihre Hilfe zur Wiedererlangung der –«
»Um Gotteswillen, schreien Sie doch nicht Ihre wahnwitzigen Pläne von allen Dächern aus! Ich verspreche nichts – niemand kann das tun, was Sie wünschen – aber –«
Er verschwand. Bald darauf kam der Küchenchef, um sich mit seinem Herrn über das Lunch zu beraten. Und am nächsten Tage erblickte Alkyon Argyropoulos mit kindlicher Freude sein Menü in der Zeitung wiedergegeben.
|
Antipasta Milanese * Friture de Goujons Ypsilantis ou Raie beurre noir Tártaros * Oie braisée Ilion ou Dinde rôtie Léda * Interim d'Écrevisses * Terrine de Foie Navarino * Éclairs Écume |
»Basilides«, sagte der Millionär am selben Abend zu seinem Sekretär, »ich befinde mich wohl in dieser Villa. Hier habe ich von dem Schelm Collin und seiner Bande nichts zu befürchten. Über diese Schwelle tritt er nicht so leicht, wie über die, von lärmenden Gästen wimmelnden, der Hotels. Geben Sie allen Dienern Auftrag, sie mögen auf ihrer Hut sein vor ihm. Schärfen Sie ihnen die Worte des römischen Dichters ein:
Daß die Behausung so lag, nicht beschmutzt von Sünde und Lastern,
Dankte man emsigem Eifer, spärlichem Schlaf und der Vorsicht
Reisiger Männer, die sorgsam die Porta Collina bewachten.
Lassen Sie das Tor meines Hauses die Porta Collina sein und die Männer davor Wache halten. Dann haben wir von dem Erzbetrüger nichts zu befürchten, aber alles für unsere Pläne zu erhoffen.«
Einige wenige Tage später begann eine Zeitungskampagne, die für einen kurzen Abschnitt die Gedanken der Allgemeinheit auf folgendes Geschehen lenkte:
Während des Krieges hatte der Kommandant eines französischen Kanonenbootes an der Insel Mytilene angelegt – an jener Insel, deren Name im Altertum Lesbos war. Ein Zufall fügte es, daß man hier einen besonderen Fund machte; ein Bauer, der mit Grabungen auf seinem Grundstück beschäftigt war, stieß auf eine gemauerte Nische, öffnete sie und fand darin eine Marmorstatue, die offenbar aus der Antike stammte. Der Befehlshaber des Kanonenbootes hörte davon erzählen und begab sich an den Fundort. Er stellte fest, daß die Statue bis auf einige Schrammen unversehrt war und fand sie, wie er sich ausdrückte, »hübsch«. Er hatte Privatvermögen; so bot er dem Entdecker der Statue stehenden Fußes 5000 Franken. Als sich der Bauer weigerte, zahlte er ihm die Summe, gemäß seinem Angebot, kurzerhand bar auf den Tisch und ließ den Fund an Bord bringen. Die Statue wurde nach Frankreich gebracht. Der Kommandant jenes Schiffes fiel bei Gallipoli und bestimmte in seinem Testament, daß die Statue aus Mytilene – er hatte sie die »Aphrodite von Lesbos« getauft – in den Besitz der Nation übergehen sollte. Das Ministerium der schönen Künste nahm das Geschenk an und übergab es dem Louvre. Doch es war der letzte Abschnitt des Krieges; Geschosse aus Deutschlands weitreichenden Kanonen explodierten in der Nähe des Louvre; man versuchte, die hier aufbewahrten Kunstwerke durch Sandsäcke zu schützen; es war nicht daran zu denken, neue hinzuzubringen. Die Aphrodite jenes Kommandanten wurde auf einem provisorischen Postament im Tuileriengarten aufgestellt und vergessen.
Plötzlich, mehrere Jahre nach dem Friedensschluß, einige Tage nach dem Einzug Alkyon Argyropoulos in die Villa, erschien jene Notiz in den Blättern. Binnen einer Woche stand die Aphrodite von Lesbos im Brennpunkte der Ereignisse. »In dieser Zeit der Skandale, in dieser Stadt der Skandale«, schrieb die Zeitung, »haben wir einen neuen Skandal zu verzeichnen. Eines der unsterblichen Meisterwerke der Kunst steht seit Jahren im Tuileriengarten, ohne Dach über dem Kopf, dem Wind und Wetter preisgegeben. Es handelt sich um die Aphrodite von Lesbos. Hat man die Absicht, dieses Kunstwerk, das Frankreich von einem seiner tapferen Söhne als Geschenk erhielt, zugrunde gehen zu lassen? Wir geben diese Frage an jene Stellen weiter, die man in Ermangelung eines anderen Namens als die maßgebenden bezeichnet. Wird dies genügen, um sie aus den Papiermauern herauszulocken, hinter denen sie schlafen? Wir geben diese Frage an unsere Kollegen von der Presse weiter.«
Die Kollegen von der Presse blieben die Antwort nicht schuldig.
»Wir nennen«, so schrieb eine andere Zeitung, »Paris die Hauptstadt der Welt. Wir sprechen mit Stolz von den Schätzen an Schönheit und Geschmack, die das Genie von Generationen uns hinterlassen hat. Haben wir noch das Recht dazu? Gehe doch in den Tuileriengarten, o Leser, und suche jenes Wunder aus Marmor auf, das die Venus von Mytilene genannt wird. Stelle dir diese Frage und beantworte sie, wenn du kannst, ohne dein Antlitz abzuwenden.«
Die Wirkung dieser und ähnlicher Artikel ließ nicht auf sich warten. Eine Völkerwanderung begann zu dem stillen Park, wo Kindermädchen im Schutze von Soldaten die heranwachsende Generation behüteten und die nächste vorbereiteten. Paris betrachtete sich die Mytelinische Venus und sah, daß sie schön war. Es war ein Schönheitstypus, der nicht unbeträchtlich von dem gewöhnlichen Ideal der Antike abwich. Die niedrige Stirne und die gerade Nase waren wohl da, aber der Mund hatte nichts von dem erhabenen Ernst der Venus von Milo; die Mundwinkel waren leicht emporgekräuselt wie zu einem Lächeln; der Kopf war ein wenig zurückgeneigt und einer der schlanken Marmorarme erhob sich, wie um die Flechten des Haares zu lösen. Junge Dichter zitierten die Worte Mussets von der Venus, die »den Wellen entstiegen, die Erde befruchtete, indem sie ihr Haar auswand«.
Am dritten Tag der Zeitungskampagne und der Völkerwanderung erschien in der Villa des griechischen Millionärs ein Herr zu Besuch. Es war der Kunstsachverständige Nicole Ferrand. Doch diesmal war er nicht so nervös wie bei seinem ersten Besuch.
»Nun, mein Herr«, rief er, bevor er noch richtig zur Türe hereingekommen war, »was sagen Sie zu den Zeitungen! Wollen Sie Ihren Plan nun unter den Augen von tausenden Zuschauern im Tuileriengarten ins Werk setzen oder sie den Museumsdirektoren und Aufsehern vor der Nase wegführen? Ich habe getan, was ich konnte, um Ihnen zu helfen, ja mehr – und vor allem, mehr als ich sollte – aber wenn Sie nicht einsehen, daß die Sache jetzt unmöglich ist –«
Das Faungesicht wandte sich ihm langsam zu.
»Die alten Griechen kämpften zehn Jahre lang, bis sie Troja einnahmen. Soll ich meinen Plan nach einer Woche aufgeben? Nie und nimmer!«
»Als die Griechen Troja einnahmen, geschah es mit Hilfe des trojanischen Pferdes. Haben Sie ein trojanisches Pferd zur Verfügung? Da Sie es nicht haben, beschwöre ich Sie zum letztenmal: geben Sie Ihre wahnsinnigen Pläne auf!«
Alkyon Argyropoulos erhob sich.
»Worte der Warnung«, sagte er, »sind eine gute aber nicht sehr kostspielige Freundesgabe. Eine Gabe ist mir willkommen und Sie wissen welche! Der ist mein wahrer Freund, der sie über meine Schwelle bringt.«
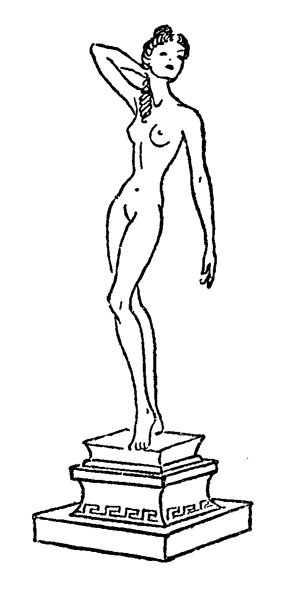
Die Pressekampagne ließ nicht nach. Tag für Tag fragten die Zeitungen:
»Wann erfüllt Paris seine Pflicht? Wann wird die mytilenische Venus entsprechend untergebracht?« Die Völkerwanderung in den Tuileriengarten dauerte an. Auf diese Weise kam der dreißigste April heran. In vielen Ländern wird dem letzten Tag des Aprils die gleiche Bedeutung zugelegt, wie anderswo dem ersten dieses Monats.
Der Gedanke, daß man diese Sitte auch in Frankreich einführen wollte, war die erste Empfindung der Pariser, als sie an besagtem Morgen ihre Zeitungen aufschlugen.
Die mytilenische Venus war gestohlen worden!
Die Zeitungen brachten folgenden Bericht:
»Gestern nachmittags, gegen drei Uhr, eben als der Tuileriengarten besonders überfüllt war, kamen fünf Männer in Arbeitskitteln in den Park. Sie hatten zwei Karren mit sich und auf dem einen der beiden befand sich ein kleiner Hebekran. Ohne zu zögern rollten sie die Karren an die Marmorstatue heran, die seit einiger Zeit das Gesprächsthema von ganz Paris bildet, krempelten die Hemdärmel auf und gingen daran, den Hebekran aufzustellen. Plötzlich bahnte sich ein Schutzmann den Weg zu ihnen heran, um sie zu fragen, was sie da planten. Sie überreichten ihm ein gestempeltes Papier; er las es durch und gab es wieder zurück. Einer der Männer, offenbar der Vorarbeiter, steckte das Papier ein und bemerkte: ›Nicht zu früh, daß sie wegkommt, was?‹
Der Schutzmann nickte zustimmend. Von ihm und einer ständig anwachsenden Menge beobachtet stellten die Arbeiter ihren Hebekran auf, legten Säcke und Stricke um die berühmte Statue und holten sie auf diese Weise von dem provisorischen Postament herab.
Dann machten sich die fünf Arbeiter daran, die Statue auf den zweiten Karren zu verladen. Sie taten dies mit großer Sorgfalt, ohne daß die Statue irgendwelchen Schaden nahm und schickten sich schließlich an, zu gehen. Die Neugierde, die die Menschen immer mehr zusammenströmen ließ, hatte die Scharen verdreifacht. Durch ein förmliches Menschenmeer rollten die fünf Arbeiter ihre beiden Karren fort. Man lächelte ihnen zu, man wünschte ihnen guten Abend, die Kinder riefen Hurra. Lächelnd beantworteten sie Grüße und Hurrarufe. Die Schutzleute forderten die Volksmasse auf, sich zu zerstreuen und nahmen ihren gelassenen Rundgang wieder auf. Die beiden Karren rollten langsam in der Richtung des Louvre fort, wohin die Arbeiter, ihrem Ausweis zufolge, die Göttin von Mytilene zu bringen hatten. Das Letzte, was man von ihnen sah, war, daß sie durch das Tor des Louvre verschwanden.
Ja, buchstäblich das Letzte!
Denn dieses Tor führte wohl in den Hof des Louvremuseums, aber weit davon entfernt, auf diesem Hof stehen zu bleiben, fuhren die beiden Karren über den Hof und durch eines seiner drei Tore wieder hinaus. Welches die fünf ›Arbeiter‹ gewählt haben, ist unbekannt; ebensowenig bekannt ist, wer sie waren und am wenigsten bekannt ist, wo sich die Aphrodite von Lesbos derzeit befindet. Die Vollmacht, die man den Schutzleuten gezeigt hatte, war falsch. Die Göttin von Mytilene wurde am hellichten Tag vor der Nase von hundert Parisern geraubt, und die Mona Lisa, die persönliche Erfahrung in Entführungen hat, lächelt an der Wand rätselvoll, aber vielleicht auch ein wenig neiderfüllt. – Das ist alles, was derzeit feststeht.
Doch von dem Raub einer Leinwand im Format der Mona Lisa bis zur Entführung einer Marmorgöttin in Lebensgröße ist immerhin ein beträchtlicher Schritt. Wer ist es, der diesen Schritt gewagt hat? Diese Frage wird im Namen der Allgemeinheit – jener Allgemeinheit, die gesehen hat, wie das unsterbliche griechische Meisterwerk zuerst verwitterte und dann gestohlen wurde – gestellt! Und wir verlangen eine Antwort!«
So schrieben die Zeitungen. Als die Allgemeinheit sich etwas zaghaft einfand, um nachzusehen, ob dies Ernst oder ein Aprilscherz war, benötigte sie nicht lange Zeit, um festzustellen, daß dies der volle Ernst war. Das Postament im Tuileriengarten stand leer, die Göttin, die nach Musset die Erde befruchtete, indem sie ihre Flechten auswand, hatte es verlassen und war verschwunden. Und sie war höchst passend gerade an einem jener blauen Abende verschwunden, von denen der gleiche Dichter sagt, daß da der Wein der Jugend in den Adern der Unsterblichen gärt.
Am gleichen Tage, an dem die Zeitungen solches mitteilten, machte Nicole Ferrand seinen dritten Besuch in der Villa. Er fiel mit der Tür ins Haus.
»Mein Herr«, sagte er, »ich komme, um Ihnen mitzuteilen, daß Sie in größter Gefahr sind.«
Alkyon Argyropoulos, der eben mit der Betrachtung einer Anzahl von Vasen beschäftigt war, blickte seinen Gast mißtrauisch an.
»In Gefahr?« wiederholte er verständnislos.
»Jawohl – und in außerordentlicher Gefahr, falls Sie nicht bereits über Ihre Diebesbeute verfügten?!« Der graue Bart des Millionärs sträubte sich. »Wer spricht von Diebesbeute?«
Nicole Ferrand lachte schrill.
»Mein Herr, ist es nötig, mir eine Komödie vorzuspielen? Wie lange haben Sie schon versucht, mich zu zwingen, Ihnen bei einer ganz bestimmten Sache behilflich zu sein: nämlich die Aphrodite von Lesbos zu stehlen – oder, wie Sie sich auszudrücken belieben, sie zurückzuerwerben. Gestern nachmittag wurde sie gestohlen, heute spricht ganz Paris davon – nur Sie, Sie allein wissen von nichts! Hahaha!«
Er verstummte. Der Millionär hatte sich erhoben, sein Brustkorb schwoll an und er brüllte:
»Gestohlen! Die Aphrodite gestohlen! Das ist nicht wahr!«
Einen Augenblick wurde Herr Ferrand unsicher, dann zuckte er ironisch die Achseln.
»Wenn Sie glauben, daß Sie mich hinters Licht führen können, gut! Schwieriger wird es jedoch für Sie sein, die Behörden dranzukriegen!«
Alkyon Argyropoulos stöhnte wie ein verwundeter Hirsch:
»Die Göttin sollte gestohlen sein! Unmöglich! Sie lügen!«
Der Kunstsachverständige überreichte ihm eine Zeitung. Während der Millionär sie verschlang, sprach er weiter:
»Sie wollen das Theater weiterspielen? Sie behaupten, daß Sie aus ideellen Gründen handeln und so habe ich Mitleid mit Ihnen. Es ist Ihnen jetzt gelungen, Sie haben Ihre Aphrodite gestohlen, aber glauben Sie nicht, daß die Sache damit abgetan ist. Einige der Leute, an die ich in Ihrem Namen herangetreten bin, haben die Polizei von den Vorschlägen verständigt, die Sie ihnen durch mich machen ließen. Ich gebe Ihnen nur den einen Rat: Lassen Sie die Beute im Stich und verschwinden Sie so rasch Sie nur überhaupt können!«
Der Millionär war mit der Durchsicht der Zeitung zu Ende gekommen. Mit halbgeöffnetem Mund starrte er in Ferrands gelbes Gesicht. Er schien nicht zu wissen, ob er wachte oder träumte.
»Sie ist gestohlen! Wer hat das getan? Wer ist der Barbar, der sie um schnöden Gewinnes willen geraubt hat? Wer?«
In seinem Ton lag solches Pathos, daß der ironische Ausdruck aus Herrn Ferrands Gesichtszügen beinahe verschwand.
»Haben Sie es nicht getan?« fragte er, »wollen Sie das wirklich behaupten?«
Der Graubart antwortete nicht. Herrn Ferrands Züge wurden wieder skeptisch.
»Wie gesagt, ich wollte Ihnen einen guten Rat geben. Ich habe es getan. Je früher –«
Im gleichen Augenblick dröhnten harte Schläge an die Eingangstüre der Villa. Der Kunstexperte erblaßte.
»Schon! – und nun bin ich hier und – ah! Das kommt davon, wenn man ein gutes Herz hat.«
Ein Polizeikommissar trat über die Schwelle, begleitet von zwei Beamten in Zivil. Der Kommissar verbeugte sich kurz vor dem Herrn des Hauses. »Mein Herr«, sagte er, »leider ist eine ernste Anklage gegen Sie erhoben worden. Gestern wurde eine kostbare Statue aus dem Tuileriengarten gestohlen. Heute haben wir von gewissen Personen die Nachricht erhalten, daß Sie durch einen Vertreter – hier sehe ich den betreffenden Herrn – versucht haben, sie zu eben diesem Verbrechen zu verleiten. Was haben Sie dazu zu erwidern?«
Alkyon Argyropoulos sagte dumpf: »Ich habe die Statue nicht gestohlen. Wenn Sie mir nicht aufs Wort glauben, dann bitte ich Sie, mein Haus zu durchsuchen.«
Der Kommissar zauderte nicht, dieser Aufforderung nachzukommen. Gefolgt von seinen Begleitern begann er die Villa eingehend zu durchsuchen. Sie prüften jeden Winkel, vom Keller bis zum Dachboden; sie öffneten Schränke, Truhen und Garderoben; sie untersuchten sogar den Kohlenkeller und die Kohle, die hier lag. Alkyon Argyropoulos führte sie selbst von Raum zu Raum. Endlich war die Untersuchung beendigt. Der Kommissar verbeugte sich und entfernte sich mit einer kurzen Entschuldigung. Herr Ferrand war mit dem Hausherrn allein.
»Das hätte ich nicht gedacht«, murmelte er und wischte sich den Schweiß von der Stirne. »Haben Sie sie also doch nicht gestohlen? Oder haben Sie sie so gut versteckt? Das bleibt sich gleich – folgen Sie meinem Rat und verschwinden Sie! Sie bekommen sie ja doch nie von hier weg!'
Im gleichen Augenblick klopfte es an die Tür des Arbeitszimmers. Herr Henry erschien mit unschlüssigem und verblüfftem Antlitz auf der Schwelle.
»Verzeihung«, sagte der dicke Küchenchef, »haben Sie ein Pferd bestellt?«
Alkyon Argyropoulos kam langsam in die Wirklichkeit zurück. »Was fragst du mich da?« murmelte er. »Was soll ich bestellt haben?«
»Ein Pferd«, wiederholte der Küchenchef, »aber kein lebendes und auch kein geschlachtetes Pferd, sondern ein hölzernes Pferd.«
Der griechische Millionär trat einen Schritt zurück und starrte seinen Küchenchef mit geradezu abergläubischem Entsetzen an.
»Ein hölzernes Pferd? Wo ist es? Zeig es mir!«
»Es ist eben gekommen, nachdem die drei Herren von der Polizei fort waren. Fünf Kerle schleppten es in das Haus. Es ist bestellt, sagten sie und gingen. Bevor ich noch weiß, wie mir geschieht, stehe ich da mit einem hölzernen Pferd in der Küche!«
Sie waren in die unteren Räume gelangt. Mitten in einem Gemach, das zur Aufbewahrung von Koffern bestimmt war, stand ein großes Holzpferd. Es füllte den halben Raum mit seinem Rumpf aus, der von vier kurzen, dicken Beinen getragen wurde. Ein grobbehauener Kopf starrte schwermütig gegen die Wand.
Alkyon Argyropoulos schien von einer plötzlichen Ahnung erfüllt zu sein.
»Eine Hacke!«
Der Küchenchef schaffte eine herbei. Wie ein Rasender fiel der Millionär über das Holzpferd her. Bald plumpste der Kopf zu Boden. Durch die Öffnung des Halses konnte man in das Innere des Körpers blicken. Es war mit Heu ausgefüllt. Alkyon Argyropoulos raffte eine Hand voll heraus und hielt plötzlich inne.
»Gehen Sie«, sagte er zu Herrn Henry.
Der Koch ging.
»Sehen Sie her«, flüsterte der Millionär dem Kunstsachverständigen zu. »Wir haben nichts voreinander zu verbergen. Sehen Sie her!«
Er riß immer mehr von dem Heu heraus und durch die Höhlung schimmerte ein Antlitz – ein Marmorantlitz von berückender Schönheit. Es hatte die niedrige breite Stirne und die gerade Nase der griechischen Statuen, aber der Mund zeigte nichts von dem hohen Ernst der Marmorgöttinnen. Die Mundwinkel waren leicht gekräuselt, wie von einem Lächeln; der Kopf war ein wenig zurückgeneigt und einer der schlanken Marmorarme hob sich empor, wie um die Flechten des Haares zu lösen – oder sie befruchtend auf die Erde auszuwinden.
Doch nicht dieses starrte Alkyon Argyropoulos wie behext an. Er betrachtete eine Marmorplatte, die er soeben aus dem Inneren des hölzernen Pferdes gehoben hatte. Sie war beschrieben und die Inschrift sagte:
Einer, der Sie schlecht behandelt hat, sendet Ihnen mit der Bitte um Verzeihung das, was Sie, wie er weiß, vergebens angestrebt haben. Da ihm die Schwelle Ihres Hauses verschlossen ist, mußte er sein Geschenk auf einem Ihnen nicht unbekannten, uralten Weg einschmuggeln.
»Eine Gabe«, murmelte Nicole Ferrand mit starren Augen und starren Lippen. »Eine fürstliche Gabe! Doch was sagt der Dichter von den Danaern? Fürchte sie, auch wenn sie Geschenke bringen. Die Polizei ist heute wohl fortgegangen, mein Herr, aber sie behält Sie im Auge!«