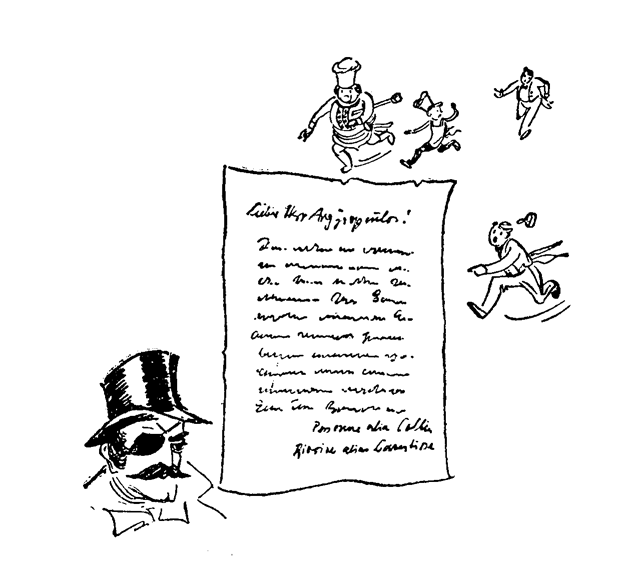|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Festnahme der Männer vom blauen Zug erregte in Paris außerordentliches Aufsehen: »Verbrecher, die mit Cookfahrkarten reisen!« – »Der Verfolgte hilft der Polizei!« – »Professor Pelotard ungerechter Weise verdächtigt, nimmt selbst die Schuldigen fest!« – Das waren einige der Zeitungsüberschriften. Der Inhalt der Artikel ließ sich in einer Frage zusammenfassen: Wer ist Professor Pelotard? Er war wie ein Meteor aus der Nacht aufgetaucht, hatte Licht in die Angelegenheit gebracht und war verschwunden. Wo befand er sich jetzt?
Einer von denen, die diese Frage besonders hartnäckig stellten, war Alkyon Argyropoulos. Die Antwort seines Mitarbeiters Kenyon befriedigte ihn ebenso wenig wie die um ihr Kind weinende Niobe irgendwelche Trostgründe.
»Meiner Ansicht nach«, erklärte der Detektiv, »hat der Professor einige seiner Helfershelfer angezeigt, um den Verdacht von sich abzulenken. Das ist eine höchst primitive Finte, die mich nicht hineinlegen kann.«
»Wenn sie Sie nicht hineinlegt«, sagte der graubärtige Millionär mit dem Faungesicht, »was hilft das schon, da er selbst Sie doch immer wieder hineinlegt.«
»Ich bin von verdammtem Pech verfolgt –«
»Kyrie, wenn das Pech Sie verfolgt, so hat dieses launenhafte Wesen größere Geschicklichkeit bei seinen Verfolgungen gezeigt, als Sie bei den Ihren.«
»Ich sehe nicht ein, warum ich mich darein finden soll, solche Reden anzuhören!«
»Finden Sie sich nur!« lächelte der Graubärtige höhnisch. »Sonst können Sie ja doch nichts finden!«
Das war zuviel. Kenyon sprang auf, bleich vor Erbitterung, und ging ab, ohne zu grüßen.
Algyon Argyropoulos begann schnaubend auf und ab zu traben, wie ein um den Honig geprellter Bär. Plötzlich blieb er vor seinem Sekretär stehen. »Basilides! Ich will diesen listigsten unter den Schelmen fangen.«
»Ja Herr!«
»Ich will ihn in meine Macht bekommen!«
»Sehr wohl, Herr!«
»Ich will hören, wie er mir mit seinem eigenen Munde eingesteht, daß ich ihn überlistet habe!«
»Gut, Herr!«
»Wie Odysseus Polyphem überlistet hat, werde ich den einäugigen Kenner kryselefantinischer Dinge überlisten.«
»So soll es geschehen, Herr!«
Der Millionär erhob sich, als wollte er einen Eid ablegen. »Das soll nun bis auf weiteres der erste Zweck meines Aufenthalts in dieser Stadt sein! Beim Hund! Beim Hades!«
Seine Augen funkelten unter den buschigen Brauen. Während er seinen Schwur ablegte, wandte er sein Gesicht nach allen Seiten, wie um die vier Enden des Himmels zu Zeugen seines Gelübdes anzurufen. Nach angemessener Pause hustete der Sekretär.
»Dies sei fortan der Zweck Eures Aufenthaltes, gut! Aber sollen wir deshalb alles andere vernachlässigen. Für diesen Abend habe ich vorzügliche Sitze für die Folies Bergère.«
Der graue Bart teilte sich langsam wie das Gras am Eingang einer Grotte, und ein dröhnendes Lachen bahnte sich den Weg in die Gemächer.
»Folies Bergère! Wir können dem Schelm überall begegnen, warum nicht auch dort? Ich bin überzeugt davon, daß wir ihn gerade dort treffen werden!«
Im gleichen Augenblick hörte man von der Türe des Speisesaals her ein diskretes Räuspern. Auf der Schwelle zeigte sich eine Persönlichkeit, die bei dem Millionär stets persona gratissima war: Monsieur Henry, die rechte Hand des Küchenchefs. Allmorgendlich kam er, um in einer Beratung mit Alkyon Argyropoulos den Entwurf für das Lunch zu besprechen; später am Tage war es dieses Lunch, das unter der Bezeichnung ›le Déjeuner du Millionaire‹ von den fashionablen Gästen des Hotel Cesarini bevorzugt wurde. Monsieur Henrys Aussehen war seiner Stellung würdig. Er war üppig, wie einer der Bacchanten von Rubens oder Jordaens; er besaß Augen von der Farbe blauen Porzellans, die aufleuchteten, wenn die Rede auf Essen oder Trinken kam; seine weiße Mütze und sein aufgezwirbelter Schnurrbart gaben ihm jenes intensiv kulinarische Aussehen, das man von einem französischen Küchenchef erwartet. Im übrigen hatte Monsieur Henrys Französisch einen stark englischen Klang.
»Heil dem Schaffer!« rief Alkyon Argyropoulos. »Was bringt mir der heutige Tag? Sind es Schenkel des beineschwingenden Ochsen, strotzend von Mark, oder Fische, dem erdumschlingenden Poseidon entrissen? Laß es mich hören!«
Monsieur Henry entnahm einen Bleistift seinem Platz hinter dem Ohr, blickte träumerisch zur Decke empor und begann auf einem Stück Karton zu schreiben. »Paßt dies Monsieur?« fragte er nach einiger Zeit.
Der graubärtige Epikureer studierte die Karte mit glitzernden Augen.
»Speise von jeglicher Art, wie mächtige Könige tafeln – Eier mit Senf wohl gewürzt, Geflügel und Braten und Früchte. Du bist fürwahr der König der Schaffer! Nimm diese Note und trinke auf das Wohl Deines Lehrmeisters Epikur!«
Eine Stunde später wurde in der Hotelhalle das Déjeuner du Millionaire angeschlagen. Das Menü lautete:
|
Fantaisie Suédoise * Oeufs Béchamel * Langouste Naturelle * Bécasse Belle Hélène * Entrecôte Bouillant Achille ou Rumpsteak Garni * Gâteaux Fruits |
Die Vorstellung in den Folies Bergère ist nur ein Vorwand für den Aufenthalt im Foyer; als die erste Pause kam, verließen Alkyon Argyropoulos und sein Sekretär ihre Loge, um sich das berühmte Treiben im Eingangssaal anzusehen. Zwei Negerkapellen trommelten, feilten, pfiffen, rasselten, donnerten, heulten und husteten, jede an einem anderen Ende des großen Lokals; Kellner mit eisgekühlten Spitzgläsern und goldhaubigen Flaschen eilten umher. Herren in Smoking und Monokel wandelten auf und ab. Hin und her, auf und nieder wogte, strömte und schäumte das Meer der Frauen. Es überflutete alle einsamen Männer und bildete Wirbel um alle Tische und löste sich vor der Bar in Schaum auf. Aus seinen tausend rhythmischen Bewegungen ergab sich eine Melodie ohne Worte:
»Sieh mich an, ich bin schön! Begehre meine Gunst, oder du ziehst dir meine Ungunst zu!«
Der Millionär und sein Sekretär hatten sich kaum gezeigt, als die Wogen auch schon über ihren altertümlich geschnittenen Gesellschaftskleidern zusammenschlugen. Der Sekretär trug einen Frack, dessen Schnitt möglicherweise anno 1840 letzte Mode gewesen war; sein Arbeitgeber hatte sich mit einem purpurroten Mantel umgeben, der einer Toga glich. Bei dem Heranfluten des Frauenmeeres bemächtigte sich ihrer Entsetzen und sie retteten sich an die Bar. Der graubärtige Millionär klammerte sich keuchend an den Bartisch.
»Das ist die Höhle der duftenden Winde! Euere Frauen sind rosenfingrig wie die Morgenröte, aber ich zweifle daran, daß eine von ihnen zehn Jahre auf einen Mann warten würde wie Penelope!«
Er erhob sein Glas mit Champagner. Neben ihm hatte ein Herr Platz genommen und hob lächelnd, wie zur Antwort das seine.
»Und ebensowenig«, meinte er, »verbringt eine von ihnen die Nacht damit, sich wie Penelope durch Tränen ihre schönen Farben zu zerstören!«
Der Millionär blickte den Sprecher an. Es war ein distinguierter Herr im Smoking, glatt rasiert, mit dunklem Teint und dichten Augenbrauen, unter denen seine schwarzen Augen glitzerten. Sein Lächeln war gewinnend.
»Diese Frauen«, sagte Alkyon Argyropoulos, »erinnern mich durch ihre Rastlosigkeit an der Delphine Schar, die munter die Meere durchgaukeln. Durch die List aber, die aus ihren Augen leuchtet, erinnern Sie mich an den listigsten aller Schelme, den zu fangen ich mir vorgenommen habe. Auf seine Gesundheit!«
Man trank.
»Wer ist derjenige, den zu fangen Sie sich vorgenommen haben?« fragte der Fremde. »Ein Dieb? Hat er Ihnen Geld geraubt?«
»Er hat Schlimmeres getan: Er hat mich in meinen eigenen Augen und auch in denen anderer Leute lächerlich gemacht! Sein Name ist Collin, aber er nennt sich auch Pelotard.«
»Wie sieht er aus?«
»Als ich ihn zuletzt sah, hatte er einen buschigen grauen Schnurrbart und trug eine Binde über dem linken Auge, als wäre er einäugig.«
»Aber die Augenbinde konnte doch eine Maskierung sein«, meinte der Fremde. Wenn er ein solcher Schelm ist, wie Sie es behaupten, dann ist es wahrscheinlich, daß das doch nur Maskerade war.«
Der Zwischenakt war zu Ende, die Negerkapellen hatten aufgehört zu trommeln, zu pfeifen, zu donnern, zu heulen; in schäumendem Strome flutete das Frauenmeer in den Zuschauerraum zurück. Alkyon Argyropoulos stellte sein Glas beiseite und starrte seinen Nachbar mit einem Auffunkeln im Blick an. Anscheinend war ihm ein Einfall gekommen. Er musterte mißtrauisch das Aussehen des Fremden, Einzelheit für Einzelheit. Er verglich ihn mit einem anderen, seine Augen wanderten auf der Jagd nach Ähnlichkeit hin und her. Der Fremdling sah sich ruhig im Saale um, ohne die prüfenden Blicke zu beachten. Plötzlich berührte er leicht den Arm des Millionärs:
»Sah Ihr Freund etwa so aus?« fragte er. »Sah er dem Mann dort drüben ähnlich?«
Er machte eine Geste nach dem Ausgang zu, eine Geste, der ein Gebrüll des Millionärs antwortete. Taub und blind gegen das Aufsehen, das er erregte, stürzte Alkyon Argyropoulos vor und stieß laute Rufe aus: »Haltet ihn, haltet ihn!«
Doch niemand kümmerte sich um seine Rufe.
Als er mitten im Saal war, durchschritt der Mann, den er suchte, die Tür; als er sich dem Ausgang näherte, trat der andere über die Schwelle auf die Straße. Als der Verfolger die Schwelle erreichte, bog der Verfolgte um die Ecke in eine Querstraße. An der Ecke brannte eine Bogenlampe, die ihr blaues Licht über den buschigen grauen Schnurrbart und die schwarze Binde über dem Auge ergoß. Eben in diesem Augenblick kam der Tischgenosse aus der Bar heran.
»Wenn er es wirklich ist«, rief er außer Atem, »soll er uns nicht entgehen! Diesen Weg, ihm nach!«
Abermals nahmen sie die Jagd auf, nunmehr drei Mann hoch. Der Herr aus der Bar war beinahe der Eifrigste. Er verstand es, die Fährte des Verfolgten zu finden, wenn der Millionär und sein Sekretär bereits ratlos waren. Doch plötzlich verschwand der Verfolgte, wie vom Erdboden verschlungen, und diesmal versagte nicht nur der Instinkt der beiden Griechen, auch ihr Freund aus der Bar stand ratlos da.
»Das nächste Mal fassen wir ihn!« rief Alkyon Argyropoulos mit flammenden Augen. »Hätten wir einen Mann wie Sie zur Hilfe gehabt und nicht diesen blinden Argosbesieger aus London, er wäre jetzt schon in meiner Hand. Sie werden derjenige sein, der ihn besiegt! Besuchen Sie mich im Hotel. Wie ist Ihr Name?«
»Ich habe einen ungewöhnlichen Namen«, sagte der Mann aus der Bar und suchte in seiner Brieftasche nach einer Visitenkarte. »Ich heiße Personne!«
Die Bekanntschaft aus den Folies Bergère erwies sich als fruchtbringend. Schon am nächsten Tag stattete Mr. Personne im Hotel Cesarini seinen Besuch ab und zeigte sich als unterhaltender Gesellschafter. Nun war es so, als ob der Zufall beabsichtigt hätte, ihn und den Millionär immer wieder zusammenzuführen. Ein um das andere Mal trafen sie aufeinander, auf den Boulevards, in den Kaufläden, im Louvre. Personne zeigte offen, daß der Millionär ihn interessierte, und daß er gern mehr über ihn und sein Tun und Treiben wissen wollte.
Im Louvre kam das Gespräch unwillkürlich auf die Kunst.
»Sie lieben wohl schöne Dinge, Herr Argyropoulos?«
Die schwarzen Faunaugen umschleierten sich.
»Ich liebe alles, was schön und ebenmäßig ist! Ich liebe die Säulen, die gleich schlanken Armen die Last des Daches emporheben. Ich liebe den Marmor, der die Schönheit des menschlichen Körpers verewigt! Ich liebe die bunten Muster des Mosaiks und die Farbenpracht der Gemälde. Ich will schöne Dinge erwerben – Krüge aus gehämmertem Silber für den eisgekühlten Wein; Behälter aus edelgeformtem Ton, woraus das Öl strömen soll; Marmorstatuen und Mosaiken, die Artemis und Aphrodite zeigen!«
»Und Pergamentrollen mit den Gesängen Homers?« fragte Personne mit einem Seitenblick.
Das Faungesicht verzog sich plötzlich. »Woher wissen Sie das?« knurrte der Millionär mit lauerndem Blick und schob den Unterkiefer vor. Der andere war überaus bestürzt über seine Taktlosigkeit.
»Ganz zufällig habe ich im Hotel davon gehört«, sagte er. »Ich wußte nicht, daß Sie es so übel aufnehmen würden. Doch selbstverständlich ist es für Sie eine unangenehme Erinnerung.«
»Dieser elende Schurke!« rief der Millionär. »Was hätte es schon geschadet, wenn ich diese Lammhäute für einen Preis gekauft hätte, der ihren Wert übersteigt. Jetzt dagegen lacht die ganze Stadt ein unauslöschliches Lachen – auf wessen Kosten? Auf meine! Doch ich werde abrechnen mit diesem dreimal ver–«
»Sicher!« beruhigte ihn Mr. Personne. »Aber sagen Sie mir eines: Lieben Sie schöne Bilder?«
So kehrte das Gespräch zur Kunst zurück. Der Millionär erklärte, er liebe zwei Meister mehr als alle anderen! Nämlich Raffael und Jordaens.
»Bei dem ersteren bewundere ich seine olympische Harmonie, bei dem letzteren die bacchantische.«
»Haben Sie nie daran gedacht, eines ihrer Bilder zu erwerben«, fragte sein Begleiter mit einem neuen Seitenblick.
»Doch! Nur möchte ich nicht ein zweites Mal dem gleichen Mißgeschick ausgesetzt sein.«
»Da haben Sie recht. Es wimmelt von Fälschungen. Aber heutzutage muß niemand eine Fälschung kaufen, wenn er nicht will.«
»Und welches Zaubermittel bietet Schutz gegen ein solches Schicksal?«
Der Begleiter des Millionärs spreizte die rechte Hand aus.
»Das hier«, sagte er. »Der Daumen?«
»Ich verstehe Sie nicht.«
»Haben Sie nicht gehört, auf welche Weise man Leute, von denen man schon genügend in Paris angetroffen hat, zu kontrollieren versucht? Durch ihren Daumenabdruck. Es gibt nicht zwei Menschen, die die gleichen Linien in der Haut ihrer Finger haben. Es läßt sich nicht vermeiden, daß die Finger eines Malers mit der Leinwand in Berührung kommen. Indem man nun nachweisbar echte Bilder untersuchte, hat man ein unfehlbares Mittel erreicht, festzustellen, ob andere Bilder echt sind oder nicht. Es gibt hier in Paris einen Mann, der Sachverständiger in dieser Methode ist. Wenn Sie jemals ein Bild kaufen, dann lassen sie es zuerst von ihm untersuchen.«
»Wie heißt er?« rief Alkyon Argyropoulos begeistert.
»Ferrand. Nicole Ferrand. Doch hier sind die Bilder des großen Flamländers. Sehen Sie sich nur diesen betrunkenen Satyr an. Man muß nicht erst nach Jordaens Fingerabdrücken suchen, um zu wissen, daß dieses Bild echt ist.«
»Basilides«, sprach der Millionär zu seinem Sekretär. »Dieser Ferrand, von dem Herr Personne sprach, existiert tatsächlich. Noch mehr – er ist ein berühmter Kenner kryselefantischer Dinge!«
»Haben Sie daran gezweifelt, Herr?«
Der Millionär zupfte gedankenvoll an seinem Bocksbart. »Offen gestanden, ja. Dieser Personne hat etwas an sich, das mir Mißtrauen einflößt. Er lächelt mit den Augen, ohne mit dem Mund zu lächeln, und mit dem Mund, ohne daß die Augen lächeln. Als er von Ferrand sprach, witterte ich eine Falle wie der Fuchs die Angel wittert. Doch der Portier des Hotels verscheuchte meinen Verdacht. Ferrand ist hochberühmt in ganz Europa wegen seines Scharfblicks in Dingen der Kunst. Was meinen Sie? Er hat ein Buch herausgegeben, in dem die Daumenabdrücke der großen Meister gesammelt und abgebildet sind, wie die der großen Schelme in den Alben der Polizei.«
»Sie haben ihn besucht, Herr?«
»Jawohl, ich habe ihn aus einem ganz bestimmten Grund besucht. Heute in aller Früh hatte ich den Besuch Personnes. Er teilte mir mit, daß einer seiner Freunde einen echten Jordaens verkaufen wollte. Da er wüßte, daß ich etwas von diesem Maler halte, hatte er das Bild mitgebracht. Ich witterte Verrat und wußte, was ich tun würde: Ferrand zu bitten, sich hier einzufinden. Ist das Bild echt – gut und schön. Aber wenn es nicht echt ist, um so schlimmer für Personne und seinen Freund!«
In diesem Augenblick meldete ein Boy: Monsieur Ferrand.«
Monsieur Ferrand war ein kleiner magerer Herr mit schwarzem Bart und Augengläsern, gelb von Farbe wie der Umschlag französischer Romane. Er verbeugte sich tausendmal vor dem Millionär, dessen Tracht ihn mit schlecht verhehltem kulturhistorischen Enthusiasmus erfüllte. Alkyon Argyropoulos geleitete ihn sofort in sein Arbeitszimmer, wo das umstrittene Gemälde auf einem Fauteuil placiert war wie ein Ehrengast. Es stellte einen Bacchuszug dar, braune Männer, weiße Frauen, schwere Trauben und einen lächelnd taumelnden Silen. Hätte der Millionär sein Kostüm abgeworfen, mußte er diesem Silen gleichen wie ein Zwillingsbruder.
Nicole Ferrand betrachtete das Bild aus der Ferne, aus der Nähe und mit der Lupe; er bog den Kopf nach links und nach rechts; er legte das Bild auf den Fußboden, und er hielt es gegen das Fenster. Unterdessen sprach er mit sich selbst.
»Ausgezeichnet! Kann echt sein! Ist es echt? Vielleicht – der Stil stimmt. Die Beleuchtung stimmt. Sprünge in der Farbe? Sind da. Fliegenschmutz in angemessener Qualität und soviel man beurteilen kann, nicht mit der Spritze aufgetragen.«
Herr Ferrand begann, die Leinwand Zoll für Zoll zu untersuchen. »Da? Nein, da ist nichts! Da? Wieder nichts! Aber da? Sollte das der gesuchte Beweis sein? Kein Zweifel. Da und da – das sind Finderabdrücke des Künstlers. Untersuchen wir die tote Meisterhand; möge sie durch Jahrhunderte sprechen, durch die sie längst zu Staub verwandelt wurde. Möge sie Zeugnis ablegen: ich bin es! Oder sich anklagend gegen den Fälscher erheben und sagen: das warst du!«
Herr Ferrand hatte einen bestimmten Fleck der Leinwand lange geprüft, nun streute er etwas Pulver aus einem Fläschchen darauf und drückte ein Papier auf den Fleck. Er hob das Blättchen ab, und es zeigte den Abdruck einer Menge konzentrischer Linien. Das gleiche Verfahren wiederholte er an zwei weiteren Stellen. Darauf zog er ein in Pergament gebundenes Buch aus der Tasche und sah darin nach. Er ließ ein vergnügtes Kichern hören, das in einen Ausruf der Befriedigung überging.
»Mein Herr«, sagte er und wandte sich an Alkyon Argyropoulos, »verschiedene Zeichen sind vorhanden, die darauf hinweisen, daß dieses Bild echt ist. Doch hier sehen Sie den ausschlaggebenden Beweis. Linie für Linie stimmen diese Fingerabdrücke mit dem Abdruck überein, den ich in meiner Kartothek verwahre. Mein Herr, ich habe Ihre Untersuchung zu Ende geführt, ich gratuliere Ihnen und habe die Ehre, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen.«
Herr Ferrand verbeugte sich unzählige Male, nahm das Honorar entgegen, wobei er sein Antlitz abwandte und entschwand.
Kaum zehn Minuten später öffnete sich die Türe, um Herrn Personne und seinen Freund, den Besitzer des Bildes, einzulassen.
Der Millionär erblickte diesen zum erstenmal. Er beachtete ihn kaum, so sehr ging er in der Betrachtung des Bildes auf. Endlich raffte er sich auf und fragte nach dem Preis.
Der Besitzer des Bildes, Herr Rivoire, nannte 50 000 Franken. Offenbar hatte der Millionär eine höhere Summe erwartet. Er zog seine Brieftasche und zählte einen Stoß Banknoten auf. Herr Rivoire steckte die Noten ein und streckte die Hand aus, um sich zu verabschieden. Erst jetzt fiel Alkyon Argyropoulos etwas auf.
Herr Rivoire war einäugig und trug ein schwarzes Band über dem linken Auge!
Hatte er diese Binde bisher dadurch verborgen, daß er sein Antlitz nach der anderen Seite wandte? Das war ungewiß. – Aber eines war gewiß: im selben Augenblick, in dem Alkyon Argyropoulos den schwarzen Stoffstreifen erblickte, verwandelte sich für ihn der Bacchuszug des Bildes in einen tollen Wirbel. Er fiel über Rivoire her, erfaßte die schwarze Binde, ein Ruck, und er hielt sie in der Hand. Ein schwarzes, vollkommen unversehrtes, lächelndes Auge blickte in das seine. Seine Finger zuckten auf, um sich in dieses Auge zu vergraben, aber sie erreichten ihr Ziel nicht.
Mit pfeilschneller Bewegung des Oberkörpers wich Herr Rivoire dem Griff der rachgierigen Finger aus; er glitt zwischen den ausgestreckten Armen des Millionärs hindurch, sprang über den Fauteuil, auf dem sich Jordaens Faune und Nymphen umhertrieben, öffnete eine Türe und verschwand in den Korridor. Zu gleicher Zeit legte Herr Personne schleunigst die ganze Breite des Zimmers zwischen sich und seinen Gastgeber, öffnete die Türe in den Salon und verschwand durch dieselbe. Brüllend vor Wut erreichte der Millionär die Korridortüre, doch nur um sie von außen verriegelt zu finden. Er raste zur Salontür, die er in der gleichen Verfassung fand. Nun stürzte er blind vor Zorn auf den dritten und letzten Ausgang zu. Es war die Türe zum Schlafzimmer. Er riß sie auf, durchsauste wie ein gereizter Stier das Schlafzimmer in fünf Sekunden und stand auf dem Korridor.
Der Korridor erstreckte sich nach rechts und links, breit und teppichbelegt, rot, gelb und bläulich wie der Sand der Arena. Mit gesenkter Stirne und gesträubten Haaren starrte Alkyon Argyropoulos um sich. Niemand war rechts, niemand war links zu sehen. Vor wenigen Sekunden hatten zwei Personen seine Wohnung verlassen und waren hier hinaus geflüchtet, aber keine Spur von ihnen war zu erblicken. Nur am Ende des Ganges stand Herr Henry, sein Freund aus der Küche, im Gespräch mit zwei anderen weißbekleideten Küchenbediensteten.
Als Herr Henry die Rufe des Millionärs hörte, kam er auf ihn zugewatschelt.
»Was ist geschehen, mein Herr?«
»Haben Sie nicht jemanden aus meinen Zimmern kommen gesehen?«
»Nein mein Herr. Ich bin soeben erst gekommen. Wer sollte das gewesen sein?«
Die Stimme Alkyon Argyropoulosens war heiser vor Wut, als er ausrief: »Zwei Schelme! Zwei dreifach verfluchte Schelme! Sie sind mit 50 000 Franken verschwunden! Haben Sie sie denn nicht gesehen? Man muß sie doch gesehen haben! Man muß!«
Er stürzte zum Treppenabsatz, an dem der Fahrstuhl hielt, verhörte die Liftboys, lief die Stiege zur Halle hinunter und unterzog Portier, Unterportiers und Türhüter einem Kreuzverhör. Doch alles war vergebens.
Die beiden konnten also das Hotel nicht verlassen haben? Doch! Sie mußten das getan haben. Das Hotel durchsuchen? Das ließ sich nicht machen. Man hatte 50 000 Franken gestohlen? Gut, das Hotel würde untersucht werden.
Das Hotel wurde untersucht, man fand nichts, nicht einmal eine Fährte, die zeigte, auf welchem Weg die Herren Personne und Rivoire verschwunden waren.
Lange nachdem Herr Henry in Begleitung von zwei weißbekleideten, ungewöhnlich munteren Küchenbediensteten über die Küchentreppe verschwunden war, wanderte Alkyon Argyropoulos in seine Wohnung hinauf.
Noch immer stand der Bacchuszug auf dem Fauteuil. Haßerfüllt blickte er ihn an. Aber plötzlich prallte er einen Schritt zurück. Angelehnt an das, was er soeben noch für ein Meisterwerk gehalten hatte, erblickte er einen Brief. Er las ihn mit heiserer Stimme sich selbst vor:
Lieber Herr Argyropoulos!
Das Bild ist wirklich nicht so falsch, wie Sie es im Augenblick glauben. Ich möchte aber auch nicht so weit gehen wie Herr Ferrand und behaupten, daß es echt ist. Es ist ein braver alter Flamländer, Kopie oder Schülerarbeit. Nachdem ich die Farbe ein wenig aufgeweicht hatte, war es mir leicht, es mit einem jener Daumenabdrücke zu versehen, die sich auf Jordaens anderen Bildern vorfinden. Wie? Zur Erläuterung lege ich zwei Gummifinger bei. Sie sind sorgfältig, nach der besten vorhandenen Quelle, dem Buch des Herrn Ferrand von meinem Freund Lavertisse hergestellt worden. Der eine Gummifinger gibt die Daumenabdrücke Raffaels, der andere die Jordaens wieder. Wir haben gerade diese beigeschlossen, weil wir wissen, daß diese beiden Meister Ihre Lieblingsmaler sind.
Wenn Sie logisch überlegen, müßten Sie noch froh sein, daß ich Ihnen nicht einen Raffael angehängt habe. Der hätte sich doch unmöglich zu solch billigem Preis herstellen lassen, wie Sie ihn für den Bacchuszug bezahlt haben.
Was diesen Preis anbelangt, so entspricht er meinen Spesen für die Herstellung des Bildes, zuzüglich der Belohnung von 40 000 Franken, die Sie für meine Ergreifung ausgesetzt und trotz meiner Ermahnungen noch nicht zurückgezogen haben.
Wenn Sie mich nun fragen, wieso ich so kühn sein konnte, mich Ihnen in den Folies Bergere vorzustellen, dann bitte ich doch zu bedenken, daß zu der Zeit, da Sie mich als Kunstexperten Duval kannten, mein Schnurrbart die ganze untere Partie meines Gesichtes verbarg, ferner, daß ein sehr großer Unterschied zwischen einem Gesicht mit einem und mit zwei Augen ist, und schließlich, daß dieser Unterschied sich noch außerordentlich verstärkt, wenn man mit Hilfe von etwas Belladonna den Augen stärkeren Glanz verleiht. Sie hatten trotzdem Verdacht geschöpft, als wir miteinander in der Bar standen. Es muß Sie jedoch absolut nicht demütigen, daß Sie Ihr Mißtrauen beiseite ließen, als Lavertisse im entscheidenden Augenblick als Polyphem im Theatersaal auftauchte. Das hätte den Scharfsinnigsten von der richtigen Spur abbringen müssen.
Dagegen wundert es mich einigermaßen, daß Sie sich nicht durch den Namen warnen ließen, unter dem ich mich vorstellte. Personne bedeutet übersetzt, niemand – und welche Rolle dieser Name im Abenteuer des Odysseus mit Polyphem spielte, dürfte Ihnen sehr wohl bekannt sein. Niemand war es, der den listigen Zyklopen besiegte – und niemand anderer!
Werden wir uns noch in anderen homerischen Abenteuern sehen?
Ihre dankbaren Freunde
Personne – alias Collin
Rivoire – alias Lavertisse