
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1. Durch den Firth of Forth nach Leith-Edinburgh. – 2. Quer durchs schottische Hochland. – 3. In Irland. – 4. Englands schwarze Diamanten. – 5. Manchester-Liverpool. – 6. Von Gravesend bis London. – 7. Die Docks von London. – 8. In der City von London. – 9. Wie London wächst. – 10. Londoner Verkehrsleben. – 11. Der Engländer in seiner Häuslichkeit. – 12. Die englischen Parks und Landhäuser.
Quelle: A. Baumgartner, Island etc. S. 4 ff. Freiburg 1889, Herdersche Verlagsbuchhandlung, und Zeitungsnotiz aus der Frankfurter Zeitung von Mamroth. Von Kopenhagen fuhr der kleine Postdampfer durch das Kattegat und Skagerrak in die Nordsee hinein, hinüber nach den britischen Inseln. Die ersten zwei Tage gab es nichts als Meer, dunkel eisengraues Meer und bewölkten Himmel darüber. Am dritten, als nebelhaft verschwommen die schottische Küste in Sicht kam, klarte der Himmel auf; die Sonne beschien das alte liebe Schottland, und es stand mit seinen poetischen Hügeln und Seen, seinen Schlössern und Klosterruinen sofort vor unserer Seele, umsponnen von tausend schwermütigen Geschichten und Sagen, umklungen von alten Balladen.
Baß Rock, ein ungeschlachter Felsenklotz, bezeichnet den Eingang in den Firth of Forth, jenen schmalen schottischen Fjord, an dem Edinburgh liegt. Die Klippe steigt nach allen Seiten schroff aus der Brandung auf wie ein riesiges Seezeichen. Tausende von Seevögeln bewohnen sie, ihre Schwärme umflattern schon weit draußen das ankommende Schiff: der weiße Seerabe oder Tölpel haust hier zu Tausenden. Der Vogelberg ist ein Kennzeichen des Nordens, der Polarkreisnähe. Drüben aber von der Küste grüßt das Felsenschloß Tantallon herüber, ein Zeuge vergangener Zeit, ritterlicher Kämpfe und schottischer Treue.
Der Leuchtturm von North Berwick meldet sich zur Linken, dann das Feuer von Iron Craig, endlich der Leuchtturm von Inchkeith, der auf einer Insel in der Mitte des Firth liegt und ihn beherrscht – alles Kennzeichen dafür, daß dieser tiefste aller schottischen Busen auch den größten Schiffsverkehr hat. Über die dunkeln Felsen laufen kleine weiße Mauern hin, zum Teil mit Kanonen besetzt. Das weiße Lighthouse hebt sich scharf aus der dunstgesättigten graublauen Luft; dunkles Gewölke kämpft am Himmel, bis endlich eine schwache Brise der Abendsonne zum Siege hilft. Das malerische Edinburgh verschwindet beim Näherkommen mit seinen Schlössern und Türmen hinter dem nüchternen Leith. »Da sieht das Auge ganz in der Ferne zwischen Himmel und Wasser etwas hängen, wie ein Spinngewebe. Bald erkennt man, daß es ein Irrtum ist, Spinnen waren hier nicht am Werke. Vielleicht haben Kinder mit Garn »Aufnehmen und Abheben« gespielt und ihr Gewebe geschickt an den zwei Streichhölzern befestigt, die jetzt aus dem Meere aufsteigen? Auch das ist verfehlt. Das fremdartige Gebilde wird größer und größer, ein Wunder der Welt: die Eisenbrücke der North British Railway über den Firth of Forth, ein Werk der Verkehrstechnik ohnegleichen. Selten war der menschliche Geist kühner und siegreicher als hier, wo er eine ungeheuere Eisenmasse auf eine Entfernung von 2½ km und in einer Höhe von 110 m mit bloß drei Spannungen über diesen Meeresarm (67 m tief) legte! Ein Schiff, das unter dieser Brücke durchzieht, macht uns das Gewaltige der Erscheinung klar. Das ist ein riesiges Gewirr von Eisenstangen, das die starken Stahlrohrpfeiler festhalten! Eben sucht ein winzig klein erscheinender Zug mit weißer Rauchwolke seinen Weg durch das Gitterwerk, 45 m über dem Seespiegel. Müßte er den Umweg von Edinburgh um den Fjord nach Dundee am Firth of Tay machen, er hätte 40 km mehr zu fahren!«
Wenn die Flut kommt, steuert der Lotse durch die sich öffnenden Hafentore das Dampfschiff in den Hafen von Leith hinein. Durch die Docks, Werften, Speicher, Krane, Kontore dieser Hafenstadt führt eine lange und platzartig breite Straße geradeswegs hinauf nach der Oberstadt Edinburgh, hinauf auf die schöne, 2 km lange Princesstreet. Edinburgh ist eine Tal- und Hügelstadt. Unwillkürlich zieht das alte Felsenschloß der schottischen Könige, der Akropolis entfernt ähnlich, den Blick auf sich. Zu seinen Füßen breitete sich eine jener langgestreckten schottischen Senken aus, der Loch North. Er ist seit 1816 erst entwässert und in prächtige Gärten verwandelt worden. Er trennt die Altstadt, das Adelsviertel des Edinburghs des 16. Jahrhunderts, von der prächtigen Neustadt, die seit 1768 entstanden ist. Zwei große steinerne Brücken und die 300 m lange Straßenüberführung des Mound verbinden die beiden ungleichen Viertel. Die Altstadt ist heute Wohnstadt der Armen und Ärmsten. Wie Schwalbennester kleben die vielstöckigen Häuser an einer Felsenwand. Krumm und eng und winklig sind die Gassen und führen steil hinauf bis zum Königsschloß. Die armen Schotten in der düsteren Schlucht laufen Sommer und Winter barfuß, das fällt besonders auf, weil es in England unerhört ist.
Die prächtige Häuserzeile der Grenzstraße zwischen Alt- und Neuedinburgh, die Princesstreet, mit dem Scottdenkmal führt nach dem Caltonhügel, den die Sternwarte krönt. Von dort wie von dem anlagenumringten Arthursitz mit dem düsteren Holyroodhouse an seinem Fuße hat man einen wunderbaren Überblick über Stadt und Fjord; in nächster Nähe ragt Nelsons Monument gleich einem Leuchtturm in den Himmel; geisterhaft wie ein Traum aus Child Harold Pilgrimage starren daneben die trümmerhaften Säulen des unvollendeten Nationalmonuments zum Andenken an die Schlacht von Waterloo; riesige Schlote ragen aus weiten Fabrikvierteln heraus, dampfende Schienenwagen und gewaltige Schiffe verkünden die Triumphe modernen Erfindungsgeistes, und ritterlich poetisch wie ein alter Balladenkönig thront das Felsenschloß über dem Prunk der Neuzeit. Man muß die sinkende Sonne hier die Felsen röten und später das Mondlicht die Meereswellen versilbern und die Dächer und Türme umspielen sehen, um die Eigenart dieses Stadtbildes ganz zu empfinden.
Unter Benutzung von Theodor Fontane, Aus England und Schottland. Berlin 1900, Fontane & Co. Die schottischen Highlands sind durch die Dichtungen Walter Scotts und die Lieder Robert Burns' berühmt geworden und werden alljährlich von vielen Fremden aus dem Süden besucht, besonders die Gegend um den Loch Lomond und den Loch Katrine, die country of the lady of the lake; sie sind berühmt durch die Stammessagen ihrer »Clane«, jener gälischen Männerbünde, deren Tapferkeit die angelsächsische Eroberung aufhielt – und Scharen von Pilgern suchen alljährlich diese durch Kunst, Sage und Geschichte geheiligten Lochs und Moore, Ruinen von Schlössern und Kirchen auf.
Berühmt ist Culloden-Moor im Lande Macbeths am Morayfirth, in der Nähe von Inverneß, der Hauptstadt des Hochlands, wo der Herzog von Cumberland mit seinen Truppen die aufrührerischen Clane der Hochländer entscheidend schlug im Jahre 1745. Es hat in seiner Öde und Baumlosigkeit etwas Unheimliches und Düsteres; Ginster und Edelheide und Gras bedecken weithin das Land.
Der Morayfjord setzt sich in einem berühmten Glen, das heißt einer Engschlucht durch die ganze Halbinsel fort. Diese Glens sind schon vor der Eiszeit vorgebildete, dann durch Gletscher ausgetiefte Täler, die alten Bildungsspalten des Felsenlandes folgen; denn Nordschottland erscheint, um einen Vergleich Ratzels zu gebrauchen, wie ein Gerippe eines alten Landes, von dem das Fleisch und Fett abgenagt und abgefallen ist, so daß das alte Gerüst nur noch mühsam zusammenhält. Tatsächlich schnürt das große Glen, Glen-More, das von Inverneß am Morayfirth bis Oban am Firth of Lorn reicht, eine Art Inselschottland ab, besonders nachdem seit 1822 nach dem Vorbilde des Trollhättakanals die langen Fjordseen des Glens durch einen ziemlich 100 km langen Stufenkanal verbunden sind und so eine Wasserstraße zwischen den beiden Firths geschaffen worden ist, der kaledonische Kanal, dessen Einkünfte freilich kaum die Unterhaltungskosten decken.
Auf diesem Kanal fahren wir durch das lange Glen. Der Himmel hängt voll trüber grauer Wolken, und der leise herabstäubende Regen mischt sich mit dem Wasserstaub des Dampfrohrs an Bord des Dampfers in Inverneß, der uns in ½ Stunde zunächst in den langen Loch Neß bringt. Über den hohen bewaldeten Berghängen, die im Schmuck frischen, schattierungsreichen Grüns sich zu den Ufern des schmalen Fjordsees herabsenken, die ein spärlicher Kranz von Schlössern, Häusern und Hütten umflicht, liegt eine trübe Eintönigkeit, ebenso wie in den Schauergeschichten, die von ihren früheren Bewohnern im Lande laufen. Bei Schloß Urquhart vorbei kommen wir an die Stelle, wo von Südosten her der Foyerfluß in einem brausenden Wasserfall in den See stürzt, doch nicht geradeswegs; vielmehr fällt er erst in eine Art Felsentopf, in dem die Wassermasse kocht und tobt, um dann durch ein Loch am Boden zum See abzufließen.
Loch Oich ist der höchste Punkt des Kanals, ein kleiner Gletschersee, 27,6 m über dem Meere. Mit Hilfe einiger Schleusen geht es zu dem längeren Loch Lochy hinab, der landschaftlich dem Loch Neß durchaus ähnlich ist, nur daß der höchste Berg Schottlands, der Ben Nevis (1343 m) auf 3-4 Stunden der Fahrt den Blick auf sich zieht mit seinem massigbreiten Felsenkegel. Ein Fort bewacht den Eingang zum Kanal. Der kleine Dampfer genügt nicht zur Einfahrt in den Firth of Lorn, ein seetüchtigerer liegt vor dem letzten Schleusentor bereit und trägt uns hinaus in atlantisches Wasser. Der Ben Nevis entschwindet unseren Blicken mehr und mehr, der Seegang macht seine Wirkungen auf die Reisenden geltend, bis gegen Abend das Schiff durch einen Irrgarten von Inseln und Vorgebirgen sich in die schöne Bucht von Oban windet. Zu der ewigen Schönheit des Ozeans gesellt sich hier ein so besonderer Reichtum an flachen Inseln und hohen Vorgebirgen, daß man zweifelhaft wird, wem eigentlich das Feld gehöre, dem Land oder dem Meere. Der Ort selbst zieht sich im Halbkreis an der Bucht entlang; gleich hinter seinen Häusern steigen bewaldete Felsen auf, hier und dort mit Lusthäusern und Schlössern besetzt.
Von hier aus fährt in dem kurzen schottischen Sommer ein Dampfer regelmäßig nach den berühmten Felseninseln Staffa und Iona. Ein breiter Meeresarm trennt das schottische Festland von der Insel Mull und der Halbinsel Morven. Aber diese sind wieder durch eine schmale Fjordstraße geschieden, einen »Sund«. Mull bleibt links, Morven rechts. Wer den Ossian einigermaßen in Kopf und Herz mit sich herumträgt und sich besinnt, wie viele Helden und Könige Morven ihre Heimat nannten, der ist enttäuscht, daß heute diese Küste menschenleer ist, ja kaum Baum und Strauch hervorbringt.
Um die Mittagsstunde kam Staffa in Sicht. Man setzte Boote aus, um die Reisenden nach dem »Stabeiland« (= Staf‑ö) hinüberzubringen; denn diese Felseninseln haben keine Dampferlandebrücken und eine tolle Brandung. Die kleine Insel gleicht einer alten eisenbeschlagenen Truhe, deren Schätze erst sichtbar werden, wenn man den Deckel lüftet. Seit 1772 erst wird sie häufig besucht. Tuffstein, der die Fläche des Ozeans kaum merklich überragt, bildet den Sockel, darauf erheben sich 15-20 m hohe Basalt»stäbe«, die wiederum eine formlose Felsmasse als Dach tragen. Zu oberst eine dünne Erdschicht mit einer spärlichen Grasnarbe, die ein paar Schafe abweiden, welche die Bewohner der Nachbarinseln während der Sommermonate hier ohne Hirten aussetzen.
An der Südspitze der Insel lenkt das Boot zwischen zwei stumpfwinklig aufeinander gestellten natürlichen Basaltmolen in eine Art Wasservorhof ein, die Auffahrt zur Fingalshöhle. Über basaltene Stümpfe, eine Art steinernes Parkett, klettern wir vorwärts zur Pforte der tiefen wassererfüllten Ganghöhle, in welche die Brandung hineintreibt. Von der Decke hängen die Basaltsäulen herein wie Zapfen, die Wände sind Bündel von Steinstämmen, ein schmaler Damm erlaubt, das 70 m tiefe Schiff der Halle, den hellgrünen Meerstreifen, zu umwandern. Aus der Tiefe der finsteren Höhle schweift der Blick hinaus aufs lichte Meer, aus dem sich ein Vorgebirge mit Kloster- und Kirchenruinen erhebt: das ist Iona, die Quelle christlicher Gesittung für das heidnische Schottland, die seit 560 von Irland aus ins heidnische Hochland floß. Bei einem Dörfchen, das trotzdem den gälischen Namen Baile Mor = große Stadt führt, steigen wir aus dem Boote an den heiligen Strand. Sofort umringen uns Kinder, die Muscheln und Steinchen als Andenken zum Verkaufe bieten. Die Feldsteinruinen eines Nonnen- und eines Mönchklosters, besonders aber die Ruine der Kathedrale, in deren Seitenschiffen die mächtigsten Clanhäuptlinge Westschottlands ihre Ruhe fanden, sowie die Schieferkreuze und Steine des alten Königsfriedhofs, wo viele schottische, irische und norwegische Fürsten schlafen, zeigen, welche Bedeutung einst dieser Insel zukam.
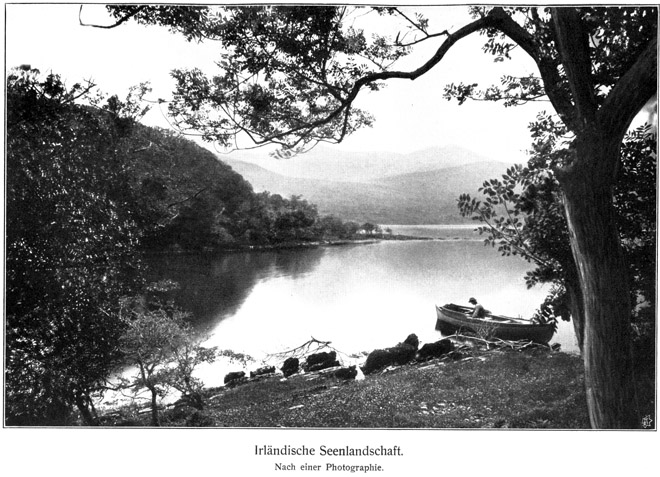
Quellen: Dr. Gustav Zielers Aufsätze in der Leipziger Zeitung. Wiss. Beilage 1902, Nr. 59, u. Woche 1902, Heft 21, und Leopold Katschers Aufsatz in Vom Fels zum Meer 1886/87, Heft 8. Erin ist das Land des Sonnenuntergangs, Japan das des Aufgangs. Es liegt darin fast ein Verhängnis! Das westlichste Inselland der alten Welt ist auch seiner Geschichte, seiner Kultur nach ein Land des Niedergangs, während das Ostendland die Wehen seiner Wiedergeburt zum modernen Kulturstaat glücklich überstanden hat und seinen Weg als Weltmacht des Ostens stolz emporsteigt.
Irland ist eine Beute der englischen Nachbarn geworden, die auf wiederholten Zügen über den St. Georgskanal den Boden der grünen Insel betraten – den irisch-keltischen Uradel vernichteten und den Bauernstand durch kurzsichtige Raubpolitik in sklavische Abhängigkeit herabdrückten. So ausgesaugt ist das Irenvolk von den allzeit geldbedürftigen englischen Lords und Baronets, daß Hunger und Verzweiflung es oft schon in den Aufruhr getrieben haben, daß ein großer Teil der Bevölkerung die Freiheit, die er verloren, jenseit des großen Wassers in Amerika suchte und fand.
Der Haß der Iren gegen England ist das auffälligste Kennzeichen ihrer Volksnatur. Mit der Leidenschaftlichkeit des Kelten berauschen sie sich gern an der Glanzzeit ihrer frühesten Geschichte, an der Zeit des heiligen Patrick, der der Sage nach 365 Kirchen und ebensoviele Klöster und Schulen schuf, lauter Brennpunkte irisch-christlicher Kultur, deren Feuer hinauf nach Schottland, nach Sankt Iona, der Hebrideninsel, hinüber aufs Festland, nach Sankt Gallen im alemannischen Deutschland durch die irische Mission getragen wurde. Mit derselben Leidenschaftlichkeit und feurigen Art bekämpfen sie die Engländer, seit sie 1170 ihr Land unterjochten, seit sie 1800 ihr Parlament genommen haben. Noch stehen in der Landeshauptstadt Dublin im Sitzungssaale des Oberhauses Tische und Stühle unberührt, als harrten sie der eintretenden Lords – noch tobt der Kampf um die Selbständigkeit, die der schlagwortbegeisterte Ire Homerule, das heißt Heimherrschaft, nennt. Sie ist 1914 unter Asquith bewilligt worden und sollte nach dem Ende des Weltkrieges in Kraft treten. Man darf darin einen Erfolg des irischen Geheimbundes Sinn-fein, das heißt aus dir selbst, Selbsthilfe, sehen, der alle auf die völkische und staatliche Genesung Irlands gerichtete Bestrebungen in sich vereinigt. Den Iren fehlt wie den Polen und Tschechen die nüchterne Klarheit, die die Kräfte zielbewußt in langsamem Fortschritt auf einen Punkt sammelt. Das Land ist immer voller »Bewegungen«, bald politischer Natur, bald sozialer Art, wie jene gewaltige Enthaltsamkeitsbewegung in den 40er Jahren, als »Father Matthews« mit eifernder Beredsamkeit gegen den »Whisky« und den »Porter« zu Felde zog. Und dabei hat doch der Bierfürst Irlands Sir B. L. Guineß derartige Einnahmen – und zwar zumeist durch den Absatz im Inlande –, daß er Dublins schönstes Gotteshaus, die Sankt-Patrickkirche, für die Kleinigkeit von 3 Millionen Mark erneuern lassen konnte; ja der Schnapsbrenner Henry Roe verschmerzte sogar 4 Millionen, um sich durch die Erneuerung der Christs Church ein Denkmal zu setzen. Darin liegt ein bitterer Spott! Bezeichnend ist auch die Begeisterung des Iren für den »Shamrock«, die Landesblume; eine gelbe unscheinbare Kleeart. Solche äußerliche Kleinigkeit wirkt auf ihn wie ein Zauber.
Aber wie alle Phantasiemenschen haben die Iren im persönlichen Verkehre etwas außerordentlich Liebenswürdiges. Ihr beweglicher Geist liebt das ballspielartige Hin und Her einer flotten Unterhaltung. Sie sind geborene Erzähler, erstaunlich schlagfertig und witzig, und die lebensprühende Munterkeit der Irin, die auch körperlich mit ihrem schwarzen Haar, ihren blauen Augen und roten Wangen von der Natur bevorzugt ist, wirkt bestrickend. Die Werke des allbekannten Bernhard Shaw zeigen diese Eigenart irischer Geistigkeit, als Dramatiker bietet Synge meisterliche Volkspsychologie. W. Butler Yates schenkte in dem ergreifenden Drama »Counteß Cathrine« ein Stück irisches Volkstum, soweit es Phantasiefülle mit heiligstem Opfermut verbindet.
Die irische Landschaft steht im Banne der außerordentlichen Luftfeuchtigkeit, die hier noch stärker als in England drüben hervortritt. Sie erzeugt besonders im Südwesten der Insel eine große Üppigkeit des Pflanzenwuchses, man hat den Eindruck, als ob Baum und Strauch von Saft strotzten. Nirgends kann man den rankenden Efeu in solch schwellender Pracht seine grünen Gewinde um Stämme und Ruinen legen sehen, nirgends die Rhododendren in üppigeren blumenübersäten Kissen bewundern als etwa an den Seen von Killarney. Und dazu die satte tiefgrüne Färbung des Laubes! Außerdem webt die Luft um all das Grün der grünen Insel ständig ihre feuchtblauen Schleier und erzeugt jene »Luftperspektive«, die in wasserumgebenen Ländern die wunderbare Abstufung des Fernblicks in Dunkel-, hell- und immer heller Blaßblau hervorzaubert.
An den landschaftlich schönen Seen von Killarney im SW., die in den ziemlich hoch aufsteigenden Kerry-Mounts liegen, sind vornehme Gast- und Landhäuser nichts Seltenes. Oft liegen freilich an den zahlreichen Regentagen die einsamen Klippen und ruinengekrönten Eilande der Seen in dicken Nebeln, oft zerstören Stürme die lieblichen Gegenbilder, die im stillklaren Wasser von den Abstürzen und Gehängen entstehen, durch die Wogen, die sie mit ihrem Ungestüm auftürmen.
Mit der »Mailcoach«, dem einheimischen Gesellschaftswagen, fährt der Fremde durch den Wunderpark, den wiederum jener Dubliner Bierlord diesen Gestaden geschaffen hat: durch einen grünen Urwald von Ulmen, Kiefern, Tannen, Buchen, Eichen, von Ilex, Linde, Weide, Birke, Arbutus und Kastanie, durch efeuüberwucherte oder bemooste Felsgehänge, durch Rasengebreite, die in bläulich schimmerndem Grün leuchten, vorbei an Rhododendronhainen und -dickichten, die im Mai ihren weißen, rosaen, flieder- und orangenfarbenen oder dunkelpurpurnen Flor entfalten.
Ein Ritt führt den Reisenden aus der Üppigkeit und Pracht der Seen in die Armut und Öde der Moorlandschaft: aus den elenden Hütten eilen zerlumpte Torfbauern bettelnd den Fremdenscharen entgegen, die dem Engpaß von Dunloe zustreben. Schwarz und feucht überall das Moor, grau die Felsen, aus deren Spalten das helle Knallgelb des Heideginsters hervorschreit. Weiter oben irrt das Echo klagend über schwarze todestraurige Seen, hinüber zu den nackten Felsen. Im Moor sucht der arme Kartoffelbauer das irish bog-oak, die Mooreiche, und schnitzelt daraus allerhand Kleinigkeiten, die er an die Fremden verkauft. Die Frauen klöppeln irish point lace, feine Spitzen, die den venetianischen und flandrischen nicht nachstehen.
Dicht neben solcher Armut wohnt in Kemnare und Glengariff wieder moderner Prunk, üppige Pracht der Pflanzenwelt. Kleine Schären liegen in der fjordartigen Seebucht, an der sich das bunte Leben eines Weltbades entfaltet.
Berühmter ist noch der im Norden der Insel gelegene Badeort Port Rush. Hier ist die Steilküste des Riesenspazierwegs, des Giants causeway. Über der Kreidebank liegt eine basaltische Decke, die in senkrecht stehenden Säulen erstarrt ist. Die Brandung hat sie vielfach zertrümmert und einen gewaltigen Schutzwall von Blöcken vor der weicheren Unterschicht geschaffen. Trotzdem bleiben noch genug seltsame Säulen und Felsnadeln, Höhlen und Tore in der Kreideküste übrig, zwischen denen die Brandung ihren Chorus singt. Ein malerisches Seeschloß, Dunluce Castle, thront auf einem Vorgebirge. Dort aber, wo sich die Basaltdecke zum causeway plötzlich in die Brandung hinabsenkt, um nach einiger Entfernung ebenso plötzlich wieder mit den Kreidefelsen emporzusteigen, hat man leider erwerbssüchtig schon ein Eisengitter um den orgelpfeifenartigen Basaltdamm gezogen und gestattet den Zutritt nur gegen Lösung von Karten. Die Anordnung der Säulen dieses Steinparks erinnert an die berühmte Fingalshöhle drüben über dem Nordkanal bei Iona.
Hier im Norden ist das Gebiet des irischen Großgewerbes. Die eingewanderte schottisch-protestantische Bevölkerung hat hier reges, praktisches Leben mitgebracht: nach Dublin die Brauerei, nach Belfast den Schiffsbau, die Leinen- und Wollweberei. Der Gesamteindruck dieser Städte ist trotzdem der völliger Nüchternheit, ja teilweise des Niedergangs.
Daß Dublin zum Beispiel im Zeichen des Krebses steht, zeigt ein Blick auf seine Webindustrie. Mag der Liffey-Fluß uns in die Bezirke des Geschäftslebens führen! Den Schlammablagerungen an der Flußmündung (keltisch Duibh-Linn) verdankt die übrigens sehr schön gelegene Stadt, die sich teils in der Ebene, teils auf Hügeln ausbreitet, ihren Namen. Die frühere Sandbank vor der Flußmündung ist beseitigt, gewaltige Molen, welche nur eine sehr enge Einfahrt am Poolbeg-Leuchthaus zwischen sich haben, schützen vor Nord- und Ostwinden. Schöne lange Uferwege aus Granit ziehen sich an den Flüssen entlang; doch ist bedauerlich, daß der Liffey den Inhalt sämtlicher Schleusen in sich aufnehmen muß innerhalb der Stadt, wodurch er – anstatt die Zierde der Stadt zu sein – zuweilen Anstoß und Abscheu erregt. Wir nehmen auf einer der 11 Brücken, welche den Liffey überspannen, Aufstellung, am besten auf der O'Connelbrücke, bis zu welcher Schiffe mit 5 m Tiefgang im Flusse aufwärts gelangen können; die Brücken und Fähren vermitteln den Verkehr zwischen der Nord- und Südstadt. Der Liffey ist die Längenachse der eirunden City; die »Circular Road«, die einen breiten, mit Bäumen gesäumten Boulevard von 12 km Länge darstellt, der Grenzsaum; jenseits liegen die Vorstädte. Die innere Stadt entvölkert sich zugunsten der weit gesünder und stattlicher angelegten Vorstädte. Wollte man in dem Langrund die kleine Achse von Norden nach Süden ziehen, so gehören Nord- und Südost dem Reichtum, der Nordwesten dem Mittelstande und der Südwesten der Armut.
Dieser Stadtteil mit seinen erstickend engen, schmutzigen Gassen erzählt uns ein Stück Leidensgeschichte der Stadt; ein großer Teil führt den Namen »Liberties« (Freiheiten) und nährte ehemals 40 000 Arbeiter durch eine blühende Woll-, Leinen- und Seidenindustrie. Bis zum Unglücksjahre 1800 konnte man diese Liberties mit den Geschäftsvierteln Manchesters vergleichen. Durch gesetzliche Kniffe in erster Linie, und in zweiter durch den Mangel an Kohlen und Wasserkraft, wie auch durch die gedrückten politischen Zustände wurde die blühende Industrie erstickt; daher die vielen verlassenen Arbeiterhäuser, verschlossenen Herbergen, die Versteigerungsankündigungen an Fenstern und Türen; daher die Menge herumlungernder, betrunkener menschlicher Ruinen beider Geschlechter, die den Sockel der prächtigen Nelsonsäule in der boulevardähnlichen Sackville-Street besetzen oder sich in der Nähe des Zollhauses am Liffey herumtreiben. Wohl hat man alles getan, um den Schiffsverkehr zu heben: zahlreich und großartig sind die westlich vom Zollhause gelegenen Docks, deren Ufer aus irischem Granit hergestellt sind, mit ihren mächtigen Warenhäusern; zwei Kanäle ermöglichen die Wasserbeförderung nach dem Innern des Landes, wie die Eisenbahnen die Verfrachtung zu Lande: doch die Zolleinnahmen bleiben auf demselben Standpunkt stehen oder heben sich kaum merklich; die Einfuhr überwiegt bei weitem die Ausfuhr; die Fabriken beschäftigen verhältnismäßig wenig Leute. Der Ire findet es feiner, Arzt, Jurist, Beamter – als Fabrikant zu sein.
Dublin ist trotzdem das Herz aller auf die Wiedergeburt des Landes gerichteten Bestrebungen. Ihr schönster baulicher Schmuck, die sogenannte Bank von Irland, ein Prachtbau in Halbkreisform mit schöner Torhalle in der Mitte und daran anschließenden seitlichen Säulengängen, ruft jedem Iren die bessere Vergangenheit ins Gedächtnis; denn hier war der Sitz der beiden Kammern des irischen Parlaments bis zu seiner Aufhebung. Der Beratungssaal des Unterhauses ist umgewandelt in den Thronsaal des Gottes Mammon: wo einst ein Burke seine Beredsamkeit spielen ließ, klingt heute die Guinee des Bankiers. Gerade gegenüber diesem ehemaligen Mittelpunkte des politischen Lebens steht die Landeshochschule, das Trinity College, als Mittelpunkt des wissenschaftlichen Strebens. Der vollständige Name desselben würde lauten: »Kollegium der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit zu Dublin.« Reich begabt durch Zuwendung von Stiftungsländereien und Geldbeiträgen von privater Seite, gehört diese Hochschule zu den bestgestellten Europas; beträgt doch das Jahreseinkommen fast 1½ Million Mark, und gibt es doch zahlreiche Stiftungen auf 4, 7 Jahre und auf Lebenszeit in Höhe von 2000-6000 Mark. Allerdings genießen diese nicht Studenten der jüngeren Semester, sondern die Herren der »Korporation«, die aus dem leitenden Provost, 7 älteren Genossen, 26 jüngeren Genossen und 72 Scholaren besteht. Während den Professoren der eigentlich akademische Unterricht zufällt, sind ältere Genossen mit der Wiederholung beschäftigt; sie haben ihre Wohnung in der Universität. Den ungefähr 1300 Studenten steht eine reiche Bücherei mit über 200 000 Bänden und 1500 Handschriften zur Verfügung; sie wächst nicht bloß durch Ankäufe, sondern auch auf Grund der gesetzlichen Bestimmung, daß ein Stück aller im Vereinigten Königreiche erscheinenden neuen Werke ihr unentgeltlich zuzuweisen ist. Wenn wir den beiden ebenfalls zum Trinity College gehörigen, aber im prächtigen Park des Kollegiums untergebrachten »Museen« unseren Besuch machen, so fesseln uns weniger die Altertümer, als besonders die zoologische Sammlung, die unter anderen eine wohlgeordnete, vollständige Fauna der zahlreichen irischen Vögel besitzt. Das mit Hörsälen ausgestattete neue »geologische Museum« fällt schon durch den lombardisch-venezianischen Baustil auf. Dabei sind sämtliche im Lande vorkommende Marmor- und Serpentinarten verwendet worden, und namentlich das großartige Treppenhaus und die Vorhalle sind Musterkarten aller einheimischen Schmucksteine. Als Zubehör dieser Landeshochschule sind zu betrachten die medizinische und technische Schule, der botanische Garten und die Sternwarte von Dunsink.
Von der O'Connelbrücke aus schweift der Blick zur Wellingtonsäule im Phönixparke. Um solchen Riesengarten, von dem 526 ha der Bevölkerung zugänglich sind, möchte jede Großstadt Dublin beneiden. Wasser, Rasen, Teppiche, Baumgruppen und Buschholz; Rotwild in Menge, so zahm, daß es sich füttern und streicheln läßt; der Obelisk des Helden von Waterloo, der ein geborener Dubliner war; der zoologische Garten: alles das macht diesen Park zum angenehmsten Erholungs- und Lustort.
Wie das im Phönix-Park gelegene Militär-Hospital darauf hinweist, daß beim gegenwärtigen Stande der Dinge im Lande eine bedeutende Militärmacht hier vereinigt ist, so lenkt das »Vizeregal Lodge«, die Wohnung des Vizekönigs für die Sommerszeit, unseren Blick auf die Landesverwaltung; der »Lord-Leutnant« bezieht im Winter das Stadtschloß, »Dublin Castle«, das wegen seines ursprünglichen Zwecks als Schutzwehr durch seine Stärke ins Auge fällt; merkwürdig ist die Anbringung der Wappen aller Vizekönige von 1170-1814 an den Wänden der Schloßkapelle. Dem Lordleutnant steht ein Staatssekretär, der einen Sitz im Unterhause haben muß, sowie ein geheimer, von der Krone ernannter Rat zur Seite, zu dem zum Beispiel der Lordkanzler von Irland, der Stadtkommandant von Dublin und andere Herren gehören. Der Lordkanzler überwacht die gesamte Rechtspflege, außer ihm gibt es einen Vizekanzler, einen obersten Berufungsrichter, einen Urkunden-Archivrichter, 12 gewöhnliche und eine Anzahl von Admiralitäts-, Handels- und Landrichtern.
An der Spitze der städtischen Verwaltung hingegen steht eine Körperschaft von 15 sogenannten Ältesten und 45 Ratsherren, mit dem Oberbürgermeister oder Lord-Mayor an der Spitze, der jährlich durch Wahl aus den 15 Ältesten hervorgeht. Wie in unseren städtischen Gemeinwesen, unterstehen dem Stadtrate Marktwesen, Nahrungsmittelfälschung, Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern und die starke städtische Polizeimacht. Auch die Beaufsichtigung der Maße und Gewichte, sowie die Schuldklagen von 40-400 Mark fallen in ihren Machtbereich.
Möchte für die Hauptstadt und das gesamte Land bald die Zeit des »Aufgangs« kommen. Nur in dem Sonnenschein der Freiheit entfaltet sich frisches, vorwärts drängendes Leben!
Teilweise nach Charles Dickens, Household Words. Von den berühmten Diamanten, die in den Händen mancher Gewaltigen dieser Erde sind, macht man gemeinhin viel Aufhebens; man hat diesen strahlenden, seltenen Juwelen einen fabelhaften Wert verliehen, vor dem die Phantasie erschrickt, doch über ihren Nutzen weiß man wenig zu sagen. Im Boden Englands liegen dunkle, schwarze Edelsteine in großer Menge; ihrer Häufigkeit und ihrer Verwertbarkeit verdanken sie ihren Wert. Und dieser ist kein Scheinwert; denn sie bringen Wohlsein in die Hütte des Armen wie in die Wohnung des Reichen. Sie haben den Hochstand unserer europäischen Kultur in Wissenschaft und Kunst, besonders in der Technik mit heraufgeführt.
In England wurde die Steinkohle schon in vorgeschichtlicher Zeit als Brennstoff verwendet. Als sie aber unter der Regierung Eduards I. im 14. Jahrhundert in einigen Gewerbebetrieben Londons von Newcastle on Tyne aus eingeführt wurde, erhob sich großer Unwille dagegen; denn die Ruß- und Rauchbelästigung wollte sich anfangs niemand gefallen lassen. Zuerst machten nur einige Schmiede, Brauer und zwei oder drei andere Handwerksmeister einen kleinen Versuch mit dem neuen Brennstoff. Ein dicker, schwarzer Rauch begann aus einer geringen Anzahl von Schornsteinen aufzusteigen. Sogleich erhob sich ganz London dagegen wie ein Mann. 1316 richtete das Parlament eine Bittschrift an den König, worin es hieß, daß, wenn er den Reiz eines frischen Gartens, den Vorzug eines reinlichen Antlitzes oder die Annehmlichkeit weißer Wäsche schätze; wenn er nicht wolle, daß seine treuen Untertanen ersticken oder mindestens gleich schlechten Schinken geräuchert werden sollten – er inständig gebeten werde, den Gebrauch dieses neuen pestilenzialischen Brennstoffes, genannt »Steinkohle«, gänzlich zu untersagen. Der König, die Wahrheit und Gerechtigkeit dieser Vorstellungen anerkennend, erließ unverzüglich eine Verordnung, durch welche allen seinen getreuen Untertanen anbefohlen wurde, sich fortan des Gebrauchs jenes lästigen und ungesunden Brennstoffes zu enthalten. Die Schmiede, die Brauer und die anderen Handwerksmeister, welche bei der Verwendung der Steinkohle großen Vorteil gefunden hatten, hielten Rat und beschlossen, ungeachtet der königlichen Verordnung, damit fortzufahren, jedoch gewisse Vorsichtsmaßregeln zu beobachten; aber sie vergaßen jenen unglücklichen Rauch, welcher solch Geschrei verursacht hatte, oder dachten in ihrer Herzenseinfalt vielleicht nicht daran, daß dieser sie noch einmal verraten müsse.
Jener dichte Rauch hatte aber kaum seine Erhebung und Ausbreitung über die Schornsteine begonnen, als er von unzähligen Aufpassern bemerkt und dem Parlament die Kunde unter lauten Verwünschungen hinterbracht wurde. Hierauf erfolgten neue Bittschriften des Parlaments, infolge deren Seine darüber sehr erzürnte Majestät befahl, daß alle Schmiede, Brauer und andere Schelme, die sich erlauben würden, trotz seines Verbotes Steinkohlen zu brennen, mit hohen Geldstrafen zu belegen seien, außerdem aber sollten ihre Herde und Öfen zerstört und vollständig weggeschafft werden. Dieser Befehl wurde wirklich ausgeführt, aber dennoch hatten auch die strengsten Maßregeln keinen Erfolg; die Anwendung der Steinkohle hatte den Verbrauchern zu ausgezeichnete Ergebnisse geliefert. Man sah demnach aus einer immer größeren Anzahl Rauchfänge schwarze Wolken aufsteigen, und die Behörde hatte noch mehr Herde und Öfen zu zerstören, die aber in demselben Maße wieder aufgebaut wurden, so daß die Dinge sich von beiden Seiten auf demselben Fuße erhielten. Es stellte sich endlich bis zur Klarheit heraus, daß niemand erstickt, vergiftet oder eingeräuchert wurde, daß sogar niemand irgendwelche Nachteile oder unangenehme Folgen erlitten hatte. Man sollte meinen, daß von dem Augenblicke an, wo die Vorteile der Steinkohle in ihrem vollen Umfang hervortraten, während die Nachteile sich als unbedeutend zeigten und die Gefahren verschwanden – die Anwendung des neuen Heizmittels ohne Verbot, Kampf oder Erörterung bald ganz allgemein werden mußte.
Aber leider geht es nicht so in der Welt. Man kann die Menschen nicht zwingen, Neuerungen im wirtschaftlichen Leben, selbst wenn sie, wie in diesem Falle, handgreifliche und augenscheinliche Verbesserungen darbieten, ohne weiteres anzunehmen. Wer dies glaubt, kennt die menschliche Natur nicht und irrt sich ebenso sehr, wie die Kinder, welche glauben, daß es den Personen, die ihnen Vernunft predigen, nie daran fehlen könne. Statt demnach die Einführung der Steinkohle in die Hauptstadt durch alle möglichen Mittel zu erleichtern, setzten die Behörden den Verbindungen zwischen London und Newcastle jedes denkbare Hindernis entgegen, indem sie die abenteuerlichsten Steuern und Abgaben ersannen. So hatte der neue Heizstoff – die künftigen schwarzen Diamanten Englands – um seine Freiheit zu kämpfen während einer Reihe von Regierungen, welche die Geschichte nichtsdestoweniger »weise und glorreich« nennt.
Bevor eine Ladung Steinkohle in London gelandet werden durfte, mußte die Erlaubnis des Lord-Mayors eingeholt werden. Amtliches Dunkel läßt uns in Unwissenheit über den genauen Betrag der Abgabe. Glücklicherweise ist dasselbe nicht der Fall mit den Nebenvorteilen der Aldermen; wir finden, daß die Mitglieder dieser Körperschaft befugt waren, die Steinkohle zu messen und zu wiegen, entweder in Person und in ihrer Amtskleidung, oder, wenn sie es vorziehen würden, durch einen Bevollmächtigten, und daß sie für ihre Mühe eine Summe von 8 Pence für die Tonne im voraus zu entnehmen berechtigt waren. Dieses Vorrecht ward durch einen Erlaß vom Jahre 1613 bestätigt; der City entstand dadurch, zur großen Genugtuung des hochweisen Magistrats, eine jährliche Einnahme von 50 000 Pfund Sterling.
Diese Schutzmaßregel, während langer Jahre unter verschiedenen Formen und mit mannigfachen Änderungen aufrecht erhalten, wurde über ganz England ausgedehnt und lastete vorzugsweise auf den ärmeren Klassen. Zwar kamen manche Einwohner Londons auf den Gedanken, darüber Klage zu führen, indem sie nicht nur keinen Schutz gegen die Steinkohlen von Newcastle nötig hatten, sondern im Gegenteil sich glücklich schätzten, sie bekommen zu können; wenn sie geschützt werden sollten, so war dies eher gegen den Lord-Mayor und den Magistrat notwendig, welche diesen unentbehrlichen Dinge mit allerlei Steuern und Auflagen belegten. Aber jene guten Leute wurden als Unwissende und Übelgesinnte verschrien, und man bedeutete ihnen, daß sie nichts weiter zu tun hätten, als gutwillig zu bezahlen – zuerst den Schutz, dann die Steinkohlen. Sie mußten sich fügen. Allein, da die Wichtigkeit des Gegenstandes die Habgier des Magistrats überstieg, wurde der Gebrauch der Steinkohle unter der Regierung Karls I. allgemein.
Nicht früher als im Jahre 1830 wurden die lästigsten auf der Steinkohle ruhenden Abgaben aufgehoben; man ließ jedoch diejenigen bestehen, welche auf Kosten der Bewohner von London und von zwei bis drei Seehäfen erhoben wurden, die gleichfalls sich erlaubt hatten einzukommen und so für ihre Frechheit bestraft wurden.
Wie aber bei jeder kulturgeschichtlichen Entwicklung dem einseitigen Druck ein Gegendruck folgt, so hat der Handel mit Steinkohlen, durch die Entwicklung des Dampfes, in unseren Tagen einen Aufschwung genommen, welcher mit dem langsamen und peinlichen Gange der verflossenen Jahrhunderte in lebhaftem Gegensatze steht. Man darf zwar hieraus nicht schließen, daß durch die schwarzen Diamanten zählreiche Millionäre entstanden seien, oder daß es leicht sei, durch diesen Industriezweig große Reichtümer zu erwerben; die Ausbeutung der Steinkohlengruben gehört vielmehr zu den gewagten Geschäftsunternehmungen. Die Anlegung der Schächte ist sehr kostspielig; die Schlagwetter, das Eindringen der Gewässer sind ernste Gefahren, welche die Werkleute und deren Arbeiter unaufhörlich bedrohen. Es ist wahr, daß die großen Eigentümer der Steinkohlenwerke am Tyne, an der Wear und von noch anderen Bezirken eine Art Alleinherrschaft ausüben, aber es ist nicht die Folge dieser Herrschaft, daß die Steinkohle in London fast das Dreifache von dem kostet, wofür sie am Eingang des Schachtes verkauft wird. Der Grund dafür liegt an den Kosten der Beförderung, die oft dem Preise der Ware gleichkommen oder ihn übersteigen, an dem Verluste beim Fortschaffen, an den Leichter- und Kaigebühren, an den Unkosten, welche das Löschen, die Wächter, Beamten, Träger, Karrenführer, Fuhrwerke, Pferde, Säcke usw. verursachen, ferner an den langen Gestundungen und langen Schulden, an dem Gewinne der verschiedenen Vertreter und Zwischenhändler, deren zahlreichste Klasse aus Leuten besteht, welche sich für Kohlenhändler ausgeben, während sie in Wirklichkeit nur Makler sind, endlich an der Geldgier der Kleinhändler jeglicher Art. Wie dem aber auch sei, der Steinkohlenhandel blüht, man hat ihm einen neuen Tempel in der Hauptstadt weihen müssen. Unweit des Zollhauses erhebt sich heutzutage die Kohlenhalle oder Kohlenbörse (Goal Exchange).
Einige der gesamten Steinkohlen-Industrie Englands und des Auslandes entnommene Ziffern werden die Wichtigkeit der an der Kohlenbörse gemachten Geschäfte zur Genüge herausstellen.
Im Jahre 1860 besaß England 3009 Kohlengruben, welche 84 Millionen Tonnen zutage förderten.1 Tonne = 20 englische Zentner. Die Hauptgebiete der Steinkohlenförderung Englands sind Südwales und Bristol, der mittelenglische Industriebezirk, in Nordengland Newcastle und in Schottland der Südrand der Grampian Mountes. Sie werden, die heutige Förderung vorausgesetzt, noch etwa 300 Jahre lang Englands Industrie und Schifffahrt versorgen können, ehe sie erschöpft sind. Bewertet man die Gesamtförderung der Erde an Steinkohlen auf 450 Millionen Tonnen jährlich, so entfallen auf Großbritannien ungefähr 2/5.
Der außerordentlichen Leichtigkeit, mit der man auf dem Seewege und auf Binnenwasserstraßen nach den besten Steinkohlenlagern Englands, Schottlands und Wales' gelangen kann, verdankt Großbritannien den Vorteil, ungeheure Massen zu niedrigen Preisen nicht allein für den eigenen Verbrauch liefern, sondern auch nach fast allen Häfen Europas ausführen zu können. Es ist in dieser Hinsicht weit günstiger gelegen als die Steinkohlenländer des Festlandes, deren Lager aber vom Meere entfernt liegen; so gibt es auf der langgedehnten Küstenstrecke von Dünkirchen bis Bayonne nur zwei Steinkohlenlager in geringer Entfernung vom Meere. Frankreich ist auch, was die Güte der Kohle betrifft, minder begünstigt als England; denn mit Ausnahme der Gruben zu Anzin, zu St. Etienne, Rive du Gier und einiger anderer liefern die Steinkohlenwerke im Innern des Landes ein Erzeugnis von nur untergeordneter Güte. Diese beiden Umstände machen Frankreich hierin bis zu einem gewissen Grade abhängig von England; die französische Regierung beschickt demgemäß alle Jahre die bedeutendsten Märkte zur Versorgung ihrer Dampfschiffahrts-Niederlagen mit englischen Steinkohlen. Belgien, dessen eigener Verbrauch im Steigen, dessen Erzeugung aber geringer ist, und dessen Steinkohlenlager vom Meere entfernt liegen, ist nicht imstande, den Bedürfnissen Frankreichs allein Genüge zu leisten. Der Kohlenhunger Frankreichs hat dazu geführt, Deutschland im Frieden von Versailles und im Abkommen von Spa unerträgliche Kohlenlieferungen aufzuerlegen, und die Besetzung des Saarbeckens hat das Gelüsten nach dem reichen Ruhr-, ja nach dem oberschlesischen Becken in Frankreich geweckt. Bei Spanien muß man abwarten, bis die in Asturien, Altkastilien, Leon, in Katalonien und an den Küsten des Meerbusens von Biscaya in Angriff genommenen Steinkohlenlager in vollem Betriebe sind, um den Ertrag und die Güte der Ausbeute zu prüfen.
Die Steinkohlenlager Englands sind so gelegen, daß sie kaum 50 km voneinander entfernt sind, und die Eisenbahnen bilden von Schottland bis Südwales und Somersetshire ein engmaschiges Netz, das die »schwarzen Diamanten« leicht überall an die inländischen Verbrauchsstätten gelangen läßt. Dazu kommt, daß die Ost- und Westküsten des Insellandes nirgends mehr als 75 km vom nächsten Steinkohlenlager entfernt sind und so auch der Überseeverkehr mit Kohlen sehr erleichtert ist.
Vor 400 Jahren genügten zwei oder drei Schiffe zur Kohlenversorgung Londons; 1610 waren es schon 200; 1848 aber brachten 2717 Schiffe 12 167 Ladungen, die sich auf fast 3½ Millionen Tonnen beliefen; 1870 erhielt London 50 Millionen Zentner. Viele Menschen finden bei der Versendung, viele bei der Hebung der Kohlen ihr Brot; wer zählt die Tausende, die bei der Verwertung der schwarzen Schätze mithelfen?
Beim Heizen, beim Leuchten, beim Antrieb aller Kraftmaschinen verbraucht sich nach und nach das riesige Sonnenkapital, das im Laufe der Jahrtausende in den Erdschichten sich ansammelte – und die Frage nach dem Ersatz des verzehrten Kapitals wird in absehbarer Zeit in England zur brennenden Lebensfrage des Landes werden. Der Kohlenstreik vom Frühjahr 1912 ließ das ganze wirtschaftliche Leben des Vereinigten Königreichs auf einige Wochen stocken; denn Steinkohle ist das Blut der Industrie.
Im Weltkriege hat die amerikanische Kohlenausfuhr nach Europa und nach den Häfen des Welthandels der englischen Kohle scharfen Wettbewerb gemacht. Denn der britische Kohlenhandel hatte beinahe die Welt erobert. Ob nicht auch hier die englische Weltherrschaft zugunsten der amerikanischen aufsteigenden für immer in Nachteil geraten ist?
Nach Hippolyte Taine, Aufzeichnungen über England. Aus dem Französischen übertragen von Ernst Hardt. Jena 1906, Eugen Diederichs. Von London nach Manchester! Während anfangs die Gegend flach und trübe ist, fängt sie dann durch Hügelland an ausdrucksvoll zu werden. Die hohen wogigen Erdwellen schwimmen im Nebel; wenn die Sonne durchschimmerte, legte sich eine schwache Helligkeit wie ein Lächeln über ihr blasses Grün . . Wir betraten das Land des Eisens und der Kohle, überall bilden die Erzreste ganze Berge, überall ist das Erdreich durch Grubenbauten zerwühlt, überall flammen Fabriköfen. Dann näherten wir uns Manchester. An dem vom Sonnenuntergange kupferrot gefärbten Himmel zog eine seltsame Wolke dicht über die Ebene, darunter ragten Schornsteine wie Obelisken zu Hunderten empor; man unterschied eine ungeheure schwärzliche Anhäufung von Bauten. Endlich fuhren wir in das große Babel von Backsteinen ein.
Düster ist der Anblick der Straßen; Luft und Boden scheinen von Nebel und Schweiß durchtränkt zu sein. Fabrik an Fabrik, alles schmutzige Ziegelbauten, ihre kahlen Mauern und vorhanglosen Fenster lassen sie wie ungeheure karge Gefängnisse erscheinen. Eins dieser Gebäude zum Beispiel ist ein Rechteck mit 6 Stockwerken, jedes hat 40 Fenster. Dort unter dem Gaslicht, beim betäubenden Rattern der Maschinen stehen Tausende von Arbeitern tagtäglich von früh bis spät an der Maschine! Gegen 6 Uhr abends speien die Werkstätten eine wogende, brausende Menge auf die Straßen: Männer, Frauen, Kinder in dürftiger Kleidung, mit hageren Gesichtern. Viele verschwinden in den Schnapskellern, die andern zerstreuen sich und erreichen ihre ärmliche Behausung. Durch das halbgeöffnete Fenster sieht man in das tiefliegende Zimmer, eingebaut in den feuchten Boden. Ein Teppichüberbleibsel, ein Wäschestück zum Trocknen, schmutzige Kinder auf der Diele. – Besser sind die Häuser in der Vorstadt, dort sind im freieren Raume Reihen kleiner billiger Häuser von Unternehmern gebaut worden. Die schwarzen Straßen sind mit Eisenschlacken gepflastert, und die niedrigen Dächer heben sich mit ihren roten Ziegeln von dem allgemeinen Grau des Himmels ab; aber jede Familie wohnt wenigstens für sich allein, und der Nebel, den sie atmet, ist nicht allzu unsauber. Das sind die Begünstigten, die Glücklichen. Wie mag es erst im Winter sein, wenn der Nebel die ganze sichtbare Natur ertränkt, erstickt, verschlingt!
Im Reichenviertel Manchesters zeigen die Bauten wie in Liverpool und London den englischen Charakterzug zur Ländlichkeit und zur Freiheit. Der Städter tut alles, was er kann, um aufzuhören, ein Städter zu sein. Daher hier die unermeßlichen Straßen ohne Läden, in denen jedes Haus inmitten eines grünen Vierecks einzeln dasteht und nur einer Familie gehört. Außerdem breitet sich hinter Manchester Bowdon aus, eine Art allgemeinen Landhauses mit einem herrlichen, Lord Stamford gehörigen Parke, welcher für jedermann offen steht: prachtvolle Bäume, üppige Rasenflächen, Herden zahmen Damwildes, die in den Farnen liegen. Wie tief muß solche natürliche Stille und Schönheit auf die Menschen wirken, die fast immer an Schreibstube oder Maschinensaal gefesselt sind! Im übrigen ist die Reichenstadt langweilig; zehn, fünfzehn, zwanzig Häuser hintereinander sind nach demselben Plane erbaut und reihen sich wie die Damensteine auf einem Spielbrett mit ausdrucksloser Regelmäßigkeit aneinander.
Die geologische Karte zeigt rings um Manchester eine breite schwarzgefärbte Fläche, das Kohlengebiet. Zahlreich sind hier große Städte entstanden; es gibt ihrer 7-8 neuentstandene mit vierzig- bis achtzigtausend Einwohnern, zum Beispiel Oldham. Eine Tonne Kohle kostet hier 5-8 Schilling; in Paris schon 23 Franken, in den Vogesen 34-40! Dazu kommt der Lehmboden, der Ziegel liefert, und wie in London eine breite Flußmündung als Ein- und Ausfuhrweg, als natürlicher Hafen: Liverpool. Endlich ein Volk von unermüdlichen, zähen Arbeitern und klugen, berechnenden Unternehmern! Reiche Kapitalien und vorzügliche Gliederung der Arbeitskräfte.
Liverpool,pool = Pfuhl. der Name deutet auf einen ehemaligen See – und die flache, feuchte, von den Seenebeln durchtränkte und von stehenden Gewässern bedeckte Gegend scheint auch wirklich weniger für Menschen als für Wildenten geeignet zu sein. Plötzlich wird die Landschaft ursprünglich, man gewahrt unfruchtbare Heide, rostige Torfmoore, uneingehegtes Land, das am Himmelsrande von einem Streifen fahlgrünen Laubes gesäumt wird. Schwere, violette Wolkenzüge und die unaufhörliche Ausdünstung des Meeres und des Bodens erfüllen und trüben wie in Holland den Raum zwischen dem niedrigen Himmel und der endlosen Ebene.
Im Mittelpunkte der Stadt liegt ein großes griechisches Bauwerk, eine Art Tempel mit vergoldeten Wandfeldern und nachgemachten Jaspissäulen, das Ganze ein Konzertsaal. Gegenüber eine von einem Privatmanne gestiftete Bücherei, die 1 Million Mark gekostet hat. Also auch hier soll man nicht Schönheit oder Zierlichkeit suchen. Liverpool ist ein Ungeheuer wie Manchester: mächtige Waren- und Handelshäuser, unermeßliche Straßen, deren Häuser wie in London mit Bogenhallen, Säulen und Pfeilern überladen sind. Der Hafen ist auch hier das Herz der Stadt. Neben den Docks bilden besonders die Baumwollspeicher einen riesigen, endlosen, einförmigen Wall; hier ist der Sammelplatz fast aller Baumwolle der Welt. Wie ein Meeresarm breit erstreckt sich die Mersey nach Westen, die Schiffe herbei- und hinaustragend. An ihrer Flanke fahren sie auf einer Strecke von 6 Meilen in Kanäle ein, in steingepflasterte Becken, eine Art vielfacher, sich abzweigender Wasserstraßen und -plätze, in denen sie ausgebessert und gelöscht werden: das sind die Docks. Die dichtgedrängten Masten sehen aus wie ein Winterwald, der sich bis ins Unabsehbare hinein erstreckt und den ganzen nördlichen Horizont versperrt. Und dabei reichen diese zahlreichen und geräumigen Docks nicht aus! Haufenweise drängen sich die Schiffe an den Kanaleinfahrten und warten auf Platz. Drüben in Birkenhead ist eine neue Dockreihe im Entstehen begriffen. Von dort aus umfaßt der Blick den ganzen Hafen und den Strom: er leuchtet gelblich und ein wenig unruhig im Nebel. Dampfboote kreuzen darauf mit starren, mechanischen Bewegungen wie schwarze Krabben. Segelschiffe ziehen geschmeidig und geneigt wie schöne Schwäne dahin. Der ganze Schwarm der Schiffe weicht einem schweren Kriegsschiff, dem »George«, aus. Auf der andern Seite die Masten und das Tauwerk, dahinter die riesenhafte Stadt.
Auf den Werften herrscht reges Leben, auf der einen von Laird sollen in den letzten 20 Jahren 250 Schiffe gebaut worden sein. Ein großer Schraubendampfer ist wieder im Bau. Natürlich fehlt auch hier nicht die Kehrseite dieses Großunternehmertums, das Elend in den Arbeitervierteln: Trunksucht, Schmutz und Laster.
Quelle: Theodor Fontane, Ein Sommer in London. Das ist die englische Küste! Durch den Morgennebel schimmern die Türme von Yarmouth. Ein gutes Stück Weges noch in der Richtung nach Süden, und die Themsemündung liegt vor uns: da ist sie! Sheerness mit seinen Baken und Tonnen taucht auf. Nun aber ist es, als wüchsen dem Dampfer die Flügel, immer rascher schlägt er mit seinen Schaufeln die hochaufspritzende Flut, und die prächtige Bucht durchfliegend, von der man nicht weiß, ob sie ein breiter Strom oder ein schmales Meer ist, trägt er uns jetzt an Gravesend vorbei in den eigentlichen Themsestrom.
Alles Große wirkt in die Ferne; wir fühlen ein Gewitter, lange bevor es über uns ist; große Männer haben ihre Vorläufer, so auch große Städte. Gravesend ist ein solcher Herold; es ruft uns zu: London kommt! Und unruhig, erwartungsvoll schweifen unsere Blicke die Themse hinauf. Des Dampfers Kiel durchschneidet pfeilschnell die Flut. Wir haben noch 5 Meilen bis zur alten City. Noch an großen volkreichen Städten müssen wir vorbei, und doch sind wir bereits mitten im Getriebe der Riesenstadt. Greenwich, Woolwich und Gravesend gelten noch als besondere Städte, und doch sind sie es nicht mehr. Die Äcker und Wiesen, die zwischen ihnen und London liegen, sind nur erweiterte Hydeparks. Von Smithfield nach Paddington quer durch die Stadt hindurch ist eine schlimmere Reise wie von London-Bridge bis Gravesend; nicht mehr Milesend ist die längste Straße Londons, sondern der prächtige Themsestrom selbst; statt der Kabs und der Omnibusse befahren ihn Hunderte von Booten und Dampfern; Greenwich und Woolwich sind Anhaltepunkte, und Gravesend ist die letzte Station.
Der Zauber Londons ist – seine Massenhaftigkeit. Wenn Neapel durch seinen Golf und Himmel, Moskau durch seine funkelnden Kuppeln, Rom durch seine Erinnerungen, Venedig durch den Zauber seiner meerentsteigenden Schönheit wirkt: so ist es beim Anblick Londons das Gefühl des Unendlichen, das uns überwältigt – dasselbe Gefühl, was uns beim ersten Anschauen des Meeres durchschauert. Die überschwengliche Fülle, die unerschöpfliche Masse: das ist die eigentliche Wesenheit, der Charakter Londons. Ob man von der Paulskirche oder Greenwicher Sternwarte herab seinen Blick auf das Häusermeer richtet, ob man die Citystraßen durchwandert und, von der Menschenmenge halb mit fortgerissen, den Gedanken nicht unterdrücken kann, jedes Haus sei wohl ein Theater, das eben jetzt seine Zuhörerschwärme wieder ins Freie strömt – überall ist es die Zahl, die Menge, die uns Staunen abzwingt, aber auch die Kraft und Energie, die all dem groß sich entfaltenden Leben zugrunde liegt.
Gravesend liegt hinter uns; noch sehen wir das Schimmern seiner hellen Häuser, und schon taucht Woolwich, die Arsenalstadt, vor unseren Blicken auf. Rechts und links liegen die Wachtschiffe; drohend weisen sie die Zähne, hell im Sonnenschein blitzen die Geschütze aus ihren Luken hervor. Vorbei! Wir haben nichts zu fürchten: Alt-Englands Flagge weht von unserem Mast; friedlich nur dröhnt ein Kanonenschuß über die Themse hin und verhallt jetzt in den stillen Lüften der Grafschaft Kent. Weiter schaufelt sich der Dampfer an Ostindienfahrern vorbei, die jetzt eben mit vollen Segeln und voller Hoffnung in Meer und Welt hinausziehen; seht, die Matrosen grüßen und schwenken ihre Hüte! Wenn wieder Land unter ihren Füßen ist, so sind es des Indus oder Ganges Ufer. Glückliche Fahrt!
Was ist aber das? Eine wahre Flottille von Dampfbooten, nur heimisch im Themsefahrwasser, kommt unter Sang und Klang den Fluß hinunter. In Gravesend ist Jahrmarkt oder ein Schifferfest. Da darf der Londoner Junggesell, der Commis und Handwerker nicht fehlen; die halbe City, scheint es, ist flügge geworden und will in Gravesend tanzen und springen und sich einmal gütlich tun nach der Melodie des Dudelsacks. Kein Ende nimmt der Festzug: bis hundert habe ich die vorbeifliegenden Dampfer gezählt, ohne zu Ende gekommen zu sein.
Nun taucht Greenwich auf, immer reger wird das Leben, immer bunter der Strom, wie wenn Ameisen arbeiten, hierhin, dorthin, rechts und links, vor und zurück, aber immer rastlos, so lebt und webt es zwischen den Ufern. Da breitet sich prächtig und groß vor unseren Augen das Invalidenhospital von Greenwich aus, mit seiner schönen Terrasse und allen seinen reizenden Umgebungen.
Diese Freistatt, welche die Nation dem vom Kampfe mit den wilden Elementen endlich ermüdeten Helden darbietet, ist mit Recht ihr Stolz; denn die Welt hat ihresgleichen nicht. Eigentlich sind es vier voneinander ganz abgesondert liegende Gebäude, die aber, von der Wasserseite gesehen, sich ausnehmen wie ein einziger großer Palast, geziert mit Säulen und aller Pracht der neueren Baukunst. Eine große Terrasse, die eine entzückende Aussicht nach London zu bietet, zieht sich davor hin, bis an den Strom, zu welchem man auf breiten steinernen Treppen hinabsteigt.
Das ganze Gebäude ist aus schönen Quadersteinen erbaut. Vorzüglich bewundert man die mit fast verschwenderischer Pracht geschmückte Kapelle. Einige schöne, große Hallen dienen bei schlechtem Wetter zum Spazieren. Ein angenehmer Park mit einer auf einem Hügel erbauten Sternwarte umgibt das Gebäude der anderen Seite.
Es war ein schöner, menschenfreundlicher Gedanke, diese Ruhestätte am Ufer der Themse zu erbauen, im Angesicht aller ankommenden und auslaufenden Schiffe. Die abgelebten Helden haben hier den Tummelplatz ihres ehemaligen Lebens noch immer vor Augen; sie leben gleichsam noch darin, und dem in die See stechenden Schiffer gibt der Anblick dieses Ruhehafens Trost und Mut. Nahe an 3000 Seeleute ruhen hier von ihrem mühevollen Leben aus. Sie wohnen angenehm, werden gut genährt und gepflegt, alle zwei Jahre neu, anständig, bequem gekleidet und erhalten wöchentlich ein gar nicht unbedeutendes Taschengeld zu ihren kleinen Bedürfnissen und Vergnügungen. Erkranken sie, so finden sie sorgfältige Pflege. Sie sind nicht, wie in anderen Verpflegungsanstalten, von allem, was ihr Leben bedeutend machte, geschieden; sie leben und weben noch darin und kämpfen mit alten Kampfgenossen nochmals alle ihre gewonnenen Schlachten in froher Erinnerung vor Gemälden, welche diese vorstellen und die Wände ihrer Speise- und Wohnsäle schmücken.
Besonders gut eingerichtet fanden wir die Schlafstellen. In langen, hohen, luftigen Sälen, welche zur Winterszeit von mehreren großen Kaminen erwärmt werden, sind auf der den Fenstern entgegenstehenden Seite eine Reihe den Schiffskajüten ähnliche Kammern dicht aneinander angebracht. Jede hat neben der nach dem Saale ausgehenden Tür zwei Fenster und ist groß genug, um ein geräumiges Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Koffer zu enthalten. Es gibt nichts Netteres und nichts Saubereres als diese kleinen Zimmerchen; jedes hat einen Teppich; Fenster und Betten sind mit reinlichen Vorhängen versehen; an den Wänden auf dazu angebrachten Leisten stehen die zierlichen Tabaks- und Teekästchen, Gläser, Tassen und dergleichen in gefälliger Ordnung. Kupferstiche zieren die Wände. Jeder hängt daran, nach Gefallen, Bildnisse der Königsfamilie oder berühmter Seehelden auf; dazwischen Seeschlachten, Häfen und wohl auch manch lustiges Scherzbild.
Hundertundvierzig Witwen verdienter Seemänner wohnen ebenfalls im Hause; sie verrichten darin alle weiblichen Arbeiten, pflegen die Kranken und werden in jeder Hinsicht ebenso gehalten als die Veteranen selber. Auch für die Waisen der gebliebenen Seeleute ist gesorgt; denn einige hundert Knaben werden in einem besonderen Teile des Hauses zum Seemannsberuf erzogen.
Noch haben wir London nicht betreten: es liegt noch vor uns, und schon haben wir ein Stück im Rücken – auf 100 Dampfern eilte es an uns vorbei: die Bevölkerung ganzer Städte ist aus der einen Stadt ausgezogen, und doch, die Tausende, die ihr fehlen, sie fehlen ihr nicht, es ist das gleiche unabsehbare Gewimmel.
Erinnerungen an England und Schottland von Moritz v. Kalckstein, Berlin. In der unmittelbaren Nähe des Tower bis Blackwall, in einer Ausdehnung von einer deutschen Meile, liegen die Docks. Wie alle Unternehmungen in England, so sind auch diese Docks aus Anlagekapitalien von Aktiengesellschaften hervorgegangen. Es sind künstliche Wasserbecken zur Aufnahme fremder Schiffe, mit fünf- bis siebenstöckigen Warenspeichern umgeben. Alle zusammen umfassen einen Flächenraum von mehr als 300 ha, in denen einige tausend Schiffe ganz bequem Platz finden. Der ungeheuere Verkehr auf der Themse, in deren Hafen oft an einem Tage 300 Schiffe einlaufen, hat die Anlage dieser Becken notwendig gemacht. Ohne sie müßte der Strom wenigstens das Dreifache seiner Breite haben, um für alle angekommenen Fahrzeuge hinreichend Raum darzubieten. Auch würde, da alle Schiffsladungen vor ihrem Absatz an die Londoner Handelshäuser einem Zoll unterworfen sind, die dadurch herbeigeführte Verzögerung oft mit den nachteiligsten Verlusten für die Schiffseigner verbunden sein. Diesen Übelständen wurde durch Anlage der Docks abgeholfen. Sie geben den einlaufenden Schiffen eine bequeme Gelegenheit, ihre Fracht entweder auf den weiten Lagerräumen sofort zu versteuern oder unter Umständen unverzollt in den Warenhäusern bis zu einer passenden Gelegenheit liegen zu lassen. Da bei den fortwährenden Schwankungen des Großhandels häufig das schnelle Ergreifen des Augenblicks den Ausschlag gibt, so sind diese Anlagen für die Erleichterung und Förderung des Handelsverkehrs von nicht zu berechnender Wichtigkeit.
Von dem ältesten, unmittelbar an den Tower grenzenden St. Katharine-Dock (4 ha) gelangt man durch einige schmutzige, fast ausschließlich von Matrosenschänken eingenommene Viertel zu den drei Becken der London-Docks. Hier spiegelt sich die bewegliche Regsamkeit des britischen Welthandels in den wechselvollsten Formen ab. An den Lagerplätzen vor den Lagerhäusern bilden hoch aufgetürmte Faßreihen lange Straßen, zwischen denen sich Handkarren, Wagen, Menschen in dem dichtesten Gewühl fortbewegen. An keiner Stelle des Londoner Hafens, von Gravesend bis London-Bridge, sind die Schiffe verschiedener Völkerschaften so dicht gedrängt. In dem buntesten Gemisch erblickt man holländische Schiffe, Brasilianer mit Kaffee und Farbhölzern, Dänen mit Schlachtvieh, französische Schiffe mit Obst, Gemüse, Eiern, Amerikaner mit Tabak und Zucker, deutsche Fahrzeuge mit Getreide, englische Schiffe mit Kolonialwaren aus Indien, Australien, Kanada und dem Kap.
Jeder Handelsgegenstand hat sein besonderes Viertel. Gleich beim Eintritt liegt das Ivory-House, in welchem ungeheure Vorräte von Elefantenzähnen und Schildkrötenschalen aufgehäuft liegen; ein anderer fünf Stock hoher Speicher, schon durch einen bläulich gefärbten Dunstkreis, der ihn einhüllt, wahrnehmbar, umfaßt das Indigolager. Daran reihen sich die Niederlagen für die Teevorräte, die hier in vielen tausend, mit chinesischen Aufschriften versehenen Kisten in einer Massenhaftigkeit aufgespeichert liegen, wie nicht leicht an einer anderen Stelle der Welt. Sehr umfangreich ist auch die Einfuhr von Tabak. In einem der Warenhäuser »the queens warehouse« fällt ein aus roten Backsteinen gemauerter, kugelartig geformter, stets brennender Ofen auf. Der Volkswitz hat denselben mit dem bezeichnenden Namen der »Tabakspfeife der Königin« (the queens Tobacco-Pipe) getauft. Alle verdorbenen oder wegen Einschmuggelung mit Beschlag belegten und wegen der Höhe des Strafsatzes nach einem bestimmten Zeitraum nicht abgeholten Waren werden zu möglichst schneller und am wenigsten umständlicher Beseitigung der rastlos arbeitenden Esse dieser queens Tobacco-Pipe übergeben, und so groß ist die Menge des hier der Zerstörung anheimgegebenen Stoffes, daß der Ofen nun schon seit Jahren seine Vernichtungsarbeit verrichtet und sogar die daraus gewonnene Asche für Landwirte, Seifensieder und Besitzer chemischer Fabriken der Gegenstand eines erträglichen Geschäfts geworden ist.
Durch ihre Massenhaftigkeit wirken in ganz eigentümlicher Weise die unterirdischen Weinlager der London-Docks. Man steigt eine breite Treppe hinab und gelangt in ein Wirrsal von Weinfässern, das durch viele sich kreuzende Schienenwege, auf welchen die Fässer fortgeschafft werden, durchschnitten wird. Die Richtung dieser Wege ist durch Öllampen angedeutet, welche besonders an den Kreuzungspunkten eine ungewöhnliche Helle entwickeln und so ein anschauliches Bild dieses Riesenkellers zurücklassen, der wohl das umfassendste unterirdische Gewölbe unserer Zeit ist. Er hat einen Flächenraum von 4,8 ha, und seine Schienenwege sollen eine Länge von 25 Kilometern erreichen. Für die Zulassung in diese unterirdischen Weinlager bedarf es einer Karte, die, mit einer tasting-order versehen, gleichzeitig die Erlaubnis des Kostens der verschiedenen Weinsorten in sich schließt. Jeder Kaufmann, der in den Docks Weinvorräte liegen hat, kann dergleichen Erlaubnisscheine ausstellen. Mit einem solchen ausgerüstet und mit einem Grubenlichte versehen, wird man von den Küfern durch die verschiedenen Quartiere der Unterwelt geführt, worin die Geister der verschiedenen Weingottheiten ihren Herrschersitz aufgeschlagen haben; aber schon halb berauscht durch das Einatmen ihrer duftigen Blume versetzen nur wenige Tropfen des Xeres oder Malvasiers den Besucher in den Zustand eines Traumwachens, der ihn aus jener von Wein- und Lampenduft verdickten Luft und den niedrigen, mit Schimmel bedeckten Gewölben wieder hinausdrängt nach der dem menschlichen Dasein befreundeten Tageshelle.
Weiter gegen Osten liegen auf der Isle of Dogs die Millwall-Docks, namentlich für Getreide, und die drei gleichlaufenden West-India-Docks mit einer Gesamtfläche von 120 ha für 500 Westindienfahrer, welche vornehmlich Farbhölzer und Rum herzubringen. Bei Blackwall folgen die jetzt etwas veralteten East-India-Docks (12 ha) für Schiffe, die nach Indien und Ostasien gehen. An der Themsekrümmung am Südufer liegen die 15 Becken der Commercial- und Surrey-Docks mit 32,5 ha Wasser- und 136 ha Landfläche, die namentlich dem Getreide- und Holzhandel dienen. Weiter stromabwärts eröffnete man 1880 den Viktoria-Dock (36 ha) und den Albert-Dock, die beide mit Trockendocks, Speichern, Eiskellern, Wasserdruckkranen, Bahnanschlüssen, elektrischem Lichte und anderes aufs beste ausgestattet sind. Die Eiskeller nehmen das gefrorene Rind- und Schöpsenfleisch auf, das die Schiffe als Ballast aus Australien herzuführen. In den Speichern sammelt sich Getreide, Tabak, Guano, Jute usw. Die Londoner Docks gehören vier Gesellschaften und haben 305 ha Wasserfläche und 550 ha Lagerräume. Sie beschäftigen ein Heer von über 20 000 Dockarbeitern.
Nach Carl Peters, England und die Engländer. Berlin 1904, Schwetschke & Sohn. Der Mittelpunkt Londons ist die City. Trotz ihrer geringen Größe von 270 ha ist sie nicht nur das Herz Londons, sondern nimmt auch im Staatsleben Englands, ja in der ganzen Weltwirtschaft eine hervorragende Stellung ein. Die City ist es, welche fast alle Völker Großbritannien zinspflichtig macht: in der Form von Gewinnanteilen, welche doch überall letzten Endes in Naturerzeugnissen zu entrichten sind. Sie ist der deutlichste Ausdruck der englischen Weltherrschaft.
Die City reicht vom Temple und Holborn-Viadukt bis nach White-Chapel, von der Themse bis etwa zum Regents-Kanal. Dieser Raum von 270 ha und einer ständigen Bevölkerung von nur 27 000 Einwohnern, ist angefüllt mit Speichern, Kontoren und Läden – und darüber ausgesprenkelt Restaurationen. Bei einer Häuserzahl von 10 230 gibt es doch fast keine eigentlichen menschlichen Wohnstätten, nur die sogenannten housekeepers, die Pförtner, schlafen in der City. Trotzdem drängen sich am Tage an 360 000 Menschen in ihre langen öden Straßen, des Nachts aber liegen sie menschenleer und verlassen da.
Am nördlichen Themseufer zwischen Blackfriars und Towerbridge zieht sich Speicher an Speicher hin, 4, 5, 6-8 Stock hoch mit eigentümlich malerischen Giebeldächern, abenteuerlichen Kranen, Luken zum Aufnehmen der Ladungen, welche in plumpen Barken herangeschleppt werden. Dort liegt auch der alte Hansaspeicher, ein mächtiges Gebäude aus der Zeit, als der Themsehandel noch zum größeren Teil in deutschen Händen lag. Enge und merkwürdig verschlungene Gassen führen vom Ufer hinauf nach Cannon-Street, King-Williams-Street oder Tower-Street. Kaum bleibt zwischen ihren schwindelnd hohen Häusern ein schmales Band Himmels sichtbar. In den Speichern werden Tausende von Katzen auf öffentliche Kosten gehalten, als Wohlfahrtspolizei gegen die Ratten, welche die verschiedenen Frachten anlocken. Einige Male wöchentlich wird diesen Katzen Fleisch gereicht. Auf den grellen Schrei: meat, meat, cat's meat! kommen sie von allen Seiten aus den Häusern, um ihren Lohn in Empfang zu nehmen.
In Cannon- oder King-Williams-Street gerät man in ein gefährliches Wagen- und Menschengedränge. Omnibusse, Droschken und Kutschen bringen aus dem Westen in ununterbrochener Reihe wahre Menschenfluten heran. Durch Fleet-Street strömen alle zwölf Stunden 71 677 Personen zu Fuß, durch Cheapside sogar 91 190. Gleichzeitig besorgen unter unseren Füßen zwei Eisenbahnlinien, die Metropolitan und die elektrische Tube, die Arbeit der Verbindung von Westen nach Osten. Obwohl sie alle drei Minuten lange Züge befördern, sind diese, mit Ausnahme der Zeit von 12-2 Uhr, meistens voll besetzt und überfüllt.
Die Sammelpunkte dieses Riesenverkehrs sind die Bank von England, das Mansion House und die Stock Exchange. Am Mansion House eilen täglich 248 015 Fußgänger vorüber, während 26 200 sich des unterirdischen Durchgangs bedienen, der hier eröffnet ist. Das ganze Straßennetz der City ist, wie in alten Stadtkernen Europas meist, sehr verschlungen; seltsame Gänge und Höfe, die nur der Eingeweihte weiß, führen durch die Häuserviertel von einer Straße zur anderen. Alles wimmelt von Geschäftsleuten, Handlungsgehilfen und Ladenboten, welche in der Regel mit Zylinder, im Sommer jedoch sehr oft barhäuptig in raschem Schritte dahineilen. Das Straßenbild an der Ecke von Cheapside, gegenüber der Bank von England, ist geradezu eine Weltsehenswürdigkeit.
Eine Geschäftsstube oder ein Cityoffice ist meist ungastlich und trüb. Steinerne Stufen führen in einem engen dunkeln Treppenhause zu engen Stockwerken; zwei bis drei schlecht ausgestattete Zimmer, die auf einen Hinterhof hinaussehen, genügten den alten Firmen, die in der Einfachheit ein Zeichen der Ehrenhaftigkeit des Geschäfts sehen. Neuerdings sorgt man mehr für Licht und Luft und Ausstattung.
Die Bank von England ist der Grundstein des englischen Geschäftslebens, ja des Geldverkehrs der ganzen Erde. Sie macht das englische Papiergeld. Für 15 Millionen Pfund darf sie unter Bürgschaft des Staates ausgeben, ohne Deckung in Gold. Was mehr in Verkehr gesetzt wird, dafür muß Deckung in Goldbarren in den Kellern der Bank liegen. Wenn die Verhältnisse es erfordern, wird der Zinsfuß der Bank neu festgesetzt, und seine Höhe ist maßgebend für die Geldwirtschaft der City, ja der ganzen Erde.
Der Bank von England stehen eine ganze Reihe Depositenbanken zur Seite, die nur Gelder ihrer Kunden aufbewahren und in gewissen festgesetzten Papierwerten anlegen, ohne jedoch mit ihnen irgendwie zu spekulieren. Neben diesen zuverlässigen Banken arbeitet der Finanzier mit Anleihen, Emissionen, Kompaniegründungen usw. – er darf aber sein Haus nicht Bank nennen und mit diesem Namen seine unsicheren Geschäfte decken. Auf den Banken ruht der englische Scheckverkehr. Jeder schafft sich sein Papiergeld, dessen Höhe natürlich sein Bankkonto nicht überschreiten darf. Solcher Scheck geht oft von Hand zu Hand als Geld, bis er bei der deckenden Bank eingelöst wird. Der Privatmann zahlt seinem Schuster mit einem Scheck, der gibt ihn vielleicht seinem Bäcker, welcher wiederum seine Waschfrau damit bezahlt – vorausgesetzt immer, daß der Name, der unter dem Scheck steht, im engeren Kreise als ehrenhaft bekannt ist. – – Neben dem Geld spielt der Warenumsatz der City die größte Rolle. Sie ist das größte »Tauschgeschäft der Welt«. In den Häfen Londons und auch Liverpools laufen jährlich ungeheuere Warenmassen aus und ein, aber in der City werden auch Kommissionsgeschäfte abgeschlossen zwischen Käufern und Verkäufern, die weit entfernt wohnen und nur an diesem Mittelpunkt miteinander verhandeln. Dazu gibt es in der City die Exchanges für Wolle, Getreide, Kohlen usw.
Schiffsreederei und Versicherungswesen geben ferner der City das Gepräge – vor allem aber auch die Fondsbörse mit ihrem Glücksspiel, ihrem Schwanken zwischen boom (hoch) und slump (niedrig). Aus den Gesichtern der Vorübereilenden kann man den Stand des Marktes ablesen. Gehen die Kurse herunter oder stockt das Geschäft, so blickt die vorübereilende Menge sorgenvoll drein, ist aber flotter und aufsteigender Geschäftsgang, so eilt alles munter und lebensfreudig einher.
Die Schankhäuser der City endlich sind meist Tageswirtschaften und besonders Frühstücksstuben. Die meisten schließen abends 8 Uhr und haben zwischen 1-3 Uhr Hochflut. Dann ist der Zudrang oft so groß, daß hinter unserem Stuhl schon der Anwärter steht, der darauf rechnet, wenn wir fertig sind. In anderen steht alles an einem langen Schenktisch. Alles hat den Hut auf dem Kopfe. Häufig sind es unterirdische, dann ganz elektrisch beleuchtete Gasthäuser, in die man mit Fahrstühlen einfährt. Der Seestadt entsprechend überwiegen auf den Speisekarten Fische, Krebse, Krabben, Muscheln usw. Daneben steht sicher überall Steak oder Hammelkotelett. Bitter-Ale und Stout, Whisky und Soda, Lagerbier werden am meisten getrunken. Im allgemeinen trinkt man mäßig, um den Kopf fürs Geschäft klar zu halten.
Um 6 Uhr setzt der Abfluß der Menschenmassen ein nach allen Himmelsrichtungen, und nach 8 Uhr ruht das Schweigen der Nacht auf den tags so volkbelebten Gassen, daß es einen anwandelt, wie es in Jahrtausenden den letzten Vertretern unserer Art auf der absterbenden Erde zumute sein mag.
Die Riesenstadt London ist nicht ringförmig um einen Kern gewachsen wie Paris, sondern an die City gliederte sich gleichsam Zelle an Zelle wie in einer Bienenwabe. Über hundert Vororte und Dörfer und Nachbarstädte verwuchsen so mit der Stadt. Baugesellschaften gründen an dem Stadtsaume immer neue Straßen, ja ganze Viertel, so daß die Stadt ständig größer wird. Sie bedeckt jetzt eine Oberfläche von 30 176 ha, also über 300 qkm.
Natürlich schwillt auch die Einwohnerzahl dementsprechend an, und es ist lehrreich, das Wachstum Londons ziffernmäßig zu zeigen: Am Ende des 14. Jahrhunderts hatte London etwa 35 000 Einwohner.
| Im Jahre | 1801: | 959 310 | Einwohner |
| " | 1841: | 1 948 417 | " |
| " | 1881: | 3 815 544 | " |
| " | 1901: | 4 536 267 | " |
| " | 1906: | 7 113 560 | " |
| " | 1910: | 7 252 963 | " |
Die letzten Zahlen beziehen sich allerdings nicht auf die Grafschaft London allein wie die vorhergehenden, sondern auf das »größte London«, das heißt den Polizeibezirk London, der noch 149 Kirchspiele mehr faßt und einen Kreis bildet, der 24 km Halbmesser hat.
Noch viel weiter würde der geographische Begriff London reichen, wenn man das wirtschaftliche Weichbild der Stadt ins Auge faßt, das heißt alle die Orte und Städte hinzu rechnete, deren Bewohner großenteils tagsüber in London selbst tätig sind. Die gewaltige Ausdehnung der Stadt erklärt sich zum Teil aus der Eigentümlichkeit des Engländers, stets im eigenen kleinen Hause mit Garten wohnen zu wollen.
Im Jahre 1905 wurden in London 39 586 Ehen geschlossen, das heißt im Durchschnitt 17‰; es wurden 129 335 Geburten gemeldet, das heißt 27,9‰ und 74 990 Todesfälle, das heißt 16,9‰. Diese Sterblichkeitsziffer ist eine der niedrigsten unter den Hauptstädten der ganzen Welt. Dabei beziehen sich 18 600 Todesfälle auf Kinder unter einem Jahr.
Die Größe der Bevölkerung von London und deren Zunahme erscheint im ersten Augenblick unbegreiflich; denn es ist an und für sich ein fast unerhörtes Verhältnis, daß eine Hauptstadt fast 1/6 der Bevölkerung eines Reiches enthält, noch mehr, daß sie die Hälfte der jährlichen Zunahme der Gesamtbevölkerung für sich beanspruche. Es scheint um so sonderbarer, wenn man die Abneigung der Engländer gegen London kennt. In Frankreich ist es der erste Wunsch eines jeden, in Paris zu wohnen, und nur die Unmöglichkeit hindert ihn, diesen Wunsch auszuführen; in London ist es der erste Wunsch eines jeden, auf dem Lande zu wohnen; hat er sich bereichert, so kauft er einen großen oder kleinen Landbesitz und kommt nur zu Geschäften oder auf einige Wochen in der modischen Zeit im Frühjahre in die Stadt; hat er es aber noch nicht so weit gebracht, so sucht er wenigstens einige Stunden außerhalb der Stadt zu wohnen. Aber die Anziehungskraft des Reichtums und der Macht dieser unbegreiflichen Stadt, die Größe der geschäftlichen und sittlichen Vorteile, die hier ihren Mittelpunkt finden, die Tätigkeit des Handels und die Leichtigkeit, Arbeiten aller Art hier obzuliegen, sind so übermächtig, daß sie notwendig viele Tausende von Menschen aller Art hierher führen. Dazu kommt, daß London nicht nur die Hauptstadt vom europäischen England, sondern von einem Kolonialreiche ist, aus dem jährlich Tausende von Familien zurückkommen, die keinen Familiensitz in England haben und es daher bei weitem leichter und wohlfeiler finden, sich in London niederzulassen, wo für Bedürfnisse aller Art besser gesorgt ist als irgendwo anders in der Welt. So entstand vor mehreren Jahren ein neues Viertel sehr schöner Straßen nördlich vom Park von Kensington, das den Namen Kleinasien erhielt, weil es größtenteils von ehemaligen Offizieren und Beamten aus Indien bewohnt wurde, und in einem anderen neuen Quartier, das gegen Hammersmith hin gebaut wurde, waren fast alle Häuser von den aus Australien zurückgekommenen Kolonisten gekauft worden. Es macht der englischen Selbstverwaltung die größte Ehre, daß für das Bedürfnis einer so zunehmenden Bevölkerung auf die natürlichste Art und wie von selbst gesorgt wird, ohne daß die Regierung oder selbst die Stadtverwaltung sich darein mischt. Wenn man bedenkt, mit welcher Gewalttätigkeit und Verschwendung in Paris, mit welcher Langsamkeit und Schwerfälligkeit in Wien für eine unendlich kleinere Ausdehnung der Stadt gesorgt wird, so erstaunt man, zu sehen, wie in London die Dinge fast wie durch ein Naturgesetz vor sich gehen und neue Straßen aus dem Boden zu wachsen scheinen und überall neue Viertel entstehen, die mit Wasser, Gas und allem versehen werden, und wie die Größe der Arbeiten einen Menschenverstand und eine Leichtigkeit dabei eingeführt hat, welche die Regierungsweisheit jener schreibseligen und viel geplagten Städte gänzlich zu schanden machen. Denn das Ergebnis ist, daß in London der Bau der Häuser dem Bedürfnisse eher vorangeht, daß jeder in den neuen Stadtvierteln leicht eine seinen Mitteln und Bedürfnissen angemessene Wohnung findet, daß die Straßen schöner sind als sonst irgendwo, und daß trotz der schwierigen Verhältnisse des Grundbesitzes die Wohnungen in London wohlfeiler sind als in jeder anderen großen Stadt. Der Mietzins kostet in London in dem größeren Teile der Stadt (mit Ausnahme der City) nur die Hälfte von dem, was er in Paris und in Wien (nicht nur in der inneren Stadt, sondern auch in den zugänglicheren Teilen der Vorstädte in Wien) kostet, während die Häuser bequemer und gesünder sind als in diesen beiden Städten.
Die Häuser- oder vielmehr Städtefabrikation geht um den ganzen äußeren Umkreis der Stadt vor sich, und das Verfahren ist überall dasselbe. Niemand oder wenigstens fast niemand baut selbst ein Haus, mit Ausnahme einiger sehr reicher Leute, deren Zahl in der Masse des hiesigen Bauwesens kaum in Betracht kommt. Es ist im Gegenteil so weit gekommen, daß es kaum noch der Mühe wert ist, eine Straße zu bauen, obgleich dies auch noch vorkommt, sondern ein rechter Bauunternehmer findet es vorteilhaft, ein ganzes Viertel zu bauen, das Straßen für reiche, für wohlhabende, für mittlere und arme Leute enthält. Jede Seite eines Straßenviertels stellt gewöhnlich eine bauliche Einheit dar, die eine Vorderansicht bildet und im Innern in gleichförmige Häuser abgeteilt ist, mit der Ausnahme, daß die Eckhäuser gewöhnlich geräumiger sind. Häuser erster Klasse bilden oft einen Square, das heißt ein hohles Viereck, das in der Mitte einen Garten hat, zu dem die Anwohner des Square Schlüssel haben, oder sie bilden Halbmonde oder Terrassen, das heißt sie sind von der großen Straße durch einen Streifen von Gartenanlagen getrennt, hinter denen die Anfahrt zu den Häusern herumläuft. Häuser zweiter Klasse stehen meistens in kleinen Gärten, die zu ihnen gehören; die dritter Klasse haben zwischen sich und der Straße einen kleinen Garten, aber keine Anfahrt. In allen diesen gibt es keine Kaufläden. Häuser mit Läden bilden eigene Straßen, welche teils die großen Durchfahrten und Verkehrsadern der Stadt sind, wo sich die reichen Läden finden, teils kleinere Nebenstraßen für die ärmeren. Diese strenggeordnete Verteilung der Häuser nach Klassen ist dieselbe in allen neuen Stadtteilen, nur wechseln, je nachdem die Gegend mehr oder weniger modisch ist, die Zahlverhältnisse der Häuser erster und letzter Klasse; im Ost- und Südende der Stadt sind mehr Läden und Warenhäuser, im Nord- und Westende mehr Eigenhäuser erster und zweiter Klasse. Ein Quartier dieser Art ist daher eher wie die Stiftung einer Kolonie, bei der man darauf sehen muß, für alle Bedürfnisse zu sorgen und die Reichen und die Armen, die einander nötig haben, in gehörigen Verhältnissen zusammenzubringen, so daß sie einander ohne zu großen Zeitverlust finden können.
Nach einer gewissen Reihe von Jahren, jetzt gewöhnlich nach 99 Jahren, fallen sämtliche Häuser wieder dem Grundbesitzer anheim. Dabei wird immer ausbedungen, daß die Häuser in gutem Zustande zurückfallen müssen, und dies ist keineswegs eine bloße Formel, wie es wohl früher der Fall war, sondern wird jetzt streng eingehalten; denn gegen das Ende der Zeit kommt ein Baumeister von seiten des Grundbesitzers, besichtigt die Häuser und läßt sie auf Kosten des derzeitigen Besitzers ausbessern, anstreichen usw., und der Betrag dieser Ausbesserung wird von dem Mietbewohner bezahlt, der ihn seinerseits an der Miete dem bisherigen Hausbesitzer abzieht. Die Zunahme an Vermögen und Einkommen, welches die Grundbesitzer um London herum im Verlaufe der Zeit und für die älteren Teile der Stadt schon seit langer Zeit an sich ziehen, übersteigt alle Berechnung. Es liegt ihnen daher auch daran, daß auf ihrem Grund und Boden möglichst wertvolle Häuser gebaut werden, und sie lassen sich also, ehe sie einen Mietvertrag über Land eingehen, immer die Pläne vorlegen, verlangen so viel als möglich Häuser der besseren Klassen und möglichst dauerhaften Bau.
Je mehr sich die Stadt ausdehnt, um so mehr gewinnen natürlich die schon gebauten Teile an Wert, und er steigt im Innern der Stadt, wie zum Beispiel in der City, auf das Unglaubliche. Diese bildet ja nur einen sehr kleinen Teil von London, und das Bedürfnis für Geschäftsräume der Bankiers und Großhändler ist so groß, daß für ganz kleine Räume und oft nur für wenige Jahre unerhörte Summen geboten werden. So steht zum Beispiel in der Nähe der Börse, in Cornhill, eine kleine Bude eines Obstverkäufers, die an die Geschäftszimmer einer Kompanie stößt, welche sich ausbreiten wollte; sie bot dem Manne 1000 Pfund Sterling = 20 500 Mark jährlich für die noch übrigen Jahre seines Mietvertrages an, aber er verlangte 2500 Pfund Sterling = 50 000 Mark jährlich, und sie sind nicht handelseinig geworden. Der Rechtsanwalt der City hat einmal bei Gelegenheit eines Streitfalles erklärt, daß nach einem Durchschnitte von vielen Jahren die City, wenn sie Häuser gekauft habe, um öffentliche Verbesserungen anzubringen, wie beim Durchbruch neuer Verbindungsstraßen, den Grundbesitz zu 7 200 000 Mark für den Morgen bezahlt habe, und es ist der Fall vorgekommen, daß ein ganz kleines Stück Land in der City zu einem Preise verkauft wurde, zu dem ein Morgen 20 Millionen Mark gekostet hätte. Die Folge ist natürlich, daß die City sich nach und nach entvölkert, indem die Niederlagen und Geschäftsräume den Platz einnehmen, der zu teuer zum Bewohnen geworden ist, die Kaufleute außerhalb der Stadt wohnen und niemand mehr in den Häusern schläft, als wer zu ihrer Bewachung nötig ist. Ähnlich wie in anderen Großstädten vollzieht sich in London eine »Aushöhlung« der City: Der Stadtkern wird immer mehr Geschäftsgegend, und die Bewohner ziehen in die Vororte. So ergab die Volkszählung von 1910 für Innerlondon 4 522 961 Einwohner, 13 306 weniger als 1901.
Ist der Grund und Boden von den Körperschaften, zum Beispiel der Universität Oxford oder von den großen Landbesitzern angekauft, so fängt der Unternehmer seine Bauten damit an, daß er die Straßen zieht und ebnet und dann den ganzen Grund und Boden, der ein Häuserviereck bildet, sowie den, welchen die Fußsteige an den Straßen hin einnehmen sollen, etwa 3 m ausgräbt. Hierauf baut er an der Straße hin eine fortlaufende Reihe von Gewölben aus Backsteinen, die nach dem Innern des Vierecks hin sich öffnen, etwa 2 m tief und ebenso breit, und zu Kohlenkellern für die künftigen Häuser bestimmt sind; sie werden oben mit Erde zugedeckt, geebnet, mit Steinplatten belegt und bilden die Fußwege. Sie haben eine Öffnung im Gewölbe, deren Mündung auf der Gangbahn mit einer eisernen Platte geschlossen ist, durch welche die Kohlen eingeschüttet werden. Die Tür des Kellers ist natürlich gegen das Innere des Vierecks gewendet und geht in den kleinen unterirdischen Hofraum (area), der das Haus von der Straße trennt und bestimmt ist, der unterirdischen Küche Licht und Luft zu geben. Diese Area ist 1-2 m breit und gewöhnlich von der Straße aus durch eine Treppe zugänglich, welche in die Küche hinabführt und für Verkäufer und die Dienstboten bestimmt ist; die Area ist vom Fußsteig durch ein eisernes Gitter getrennt, das mit einer Tür versehen ist, die auf die herabgehende Treppe führt. Sobald die Keller unter dem Fußsteig gebaut sind, wird mit den Häusern angefangen, und die ganze Straße erhebt sich zu gleicher Zeit; die Küche, Speisekammer usw. sind unter der Erde oder vielmehr unter der Höhe der Straße; denn sie sind nirgends von Erde umgeben. Das Erdgeschoß in einem bürgerlichen Hause enthält immer das Speisezimmer und das Arbeitszimmer des Hausherrn; der erste Stock wird von der Frau bewohnt, der zweite enthält Schlafzimmer, der dritte Kinderstuben usw., der letzte Schlafzimmer der Dienerschaft, und die Bauart ist so einförmig, daß man nur bei größeren Häusern, die drei und mehr Zimmer auf jedem Stockwerk haben, einen Augenblick in Zweifel sein kann, wohin jede Türe führen müsse. Für den inneren Ausbau der Häuser haben die großen Bauunternehmer eigene Werkstätten, in denen alle Holz- und Metallarbeit im großen und vortrefflich gemacht wird. Das Holz zu Türen, zu Treppengeländern, Böden, Fenstern usw. wird mit Dampfsägen und Hobeln bearbeitet und Tausende von jedem Gegenstande in ganz gleicher Größe und Beschaffenheit angefertigt; so mit Schlössern, Angeln, Schrauben, Türheben, Riegeln aller Art, die je nach Größe und Klassen so gleich hergestellt werden, daß jedes Stück in jedem Hause einer gleichen Klasse ohne weiteres angebracht werden kann. Diese Herstellung im großen mit Maschinen aller Art macht es den großen Bauunternehmern möglich, alle diese Dinge gut und wohlfeil zu geben, neue und bequeme Einrichtungen leicht einzuführen, und man findet auch in den neuen Häusern die Verteilung des Raumes sehr zweckmäßig, die Holz- und Metallarbeit sehr dauerhaft und gut und die Wasserbehälter und Röhren mit größter Sorgfalt und Berechnung der Bequemlichkeit und Reinlichkeit angelegt.
Sobald eine Straße angelegt wird, macht der Bauherr einen Vertrag mit einer der Wassergesellschaften, welche die großen Röhren durch die neue Straße legt, und beim Bau jedes Hauses wird am Anfang dafür gesorgt, daß alle Stockwerke mit Hähnen versehen werden, durch welche man eine tatsächlich unbeschränkte Masse von Wasser entweder durch den unmittelbaren Druck aus den Hauptröhren, oder durch einen Behälter oben im Hause, der alle Morgen von den Hauptröhren aus gefüllt wird, abziehen kann. Dieser Überfluß an Wasser ist es vor allem, dem es London verdankt, die gesündeste Stadt in Europa zu sein. Man muß in London gewohnt haben, um zu begreifen, wie groß der Einfluß dieser Wassermasse auf alle Lebensgewohnheiten, auf die Reinlichkeit, Bequemlichkeit und Gesundheit ist, und um das Grausen zu teilen, mit dem Engländer von dem pestartigen Geruch sprechen, der in den Häusern der großen Städte des Festlandes herrsche, den man aber auch in London in alten und vernachlässigten Vierteln finden kann, wo ewig Fieber weilt. Wenn eine Straße fertig ist, so beeilt sich der Unternehmer, die Häuser zu vermieten und womöglich zu verkaufen; denn es liegt ihm vor allem daran, sein Geld wieder zu erhalten, um dieselbe Arbeit von neuem anzufangen, und gewöhnlich verkauft er sie in nicht langer Zeit, da jeder lieber in einem eigenen Hause wohnt und man wohlfeiler kauft als mietet, weil der Verkäufer ein Häuserhändler und nicht ein Häuservermieter ist und im großen, also wohlfeil, gebaut hat. Die Bauunternehmer haben im allgemeinen Glück; viele erwerben bald große Vermögen. Es geschieht bisweilen, daß ein Maurer, ein Tischler und ein Schlosser sich zusammentun, um eine Straße zu bauen, daß sie mehr unternehmen, als ihr Kapital erlaubt, und genötigt sind, auf die halbgebaute Straße Geld aufzunehmen; aber auch diese Unternehmungen gedeihen gewöhnlich, wenn sie mit Verstand in der Wahl der Gegend und der Klasse der Häuser gemacht wurden.
Die Folge der großen Freiheit, die man hier im Hausbau genießt, hat einen Wettbewerb herbeigeführt, welcher mit der schnellen Zunahme der Bevölkerung völlig gleichen Schritt hält und die neueren Teile von London zu der schönsten und gesündesten Stadt von der Welt gemacht hat, wo man mehr Raum, breitere Straßen, mehr Bäume und Bequemlichkeit hat als irgendwo, und das alles um einen Preis, der im ganzen die Hälfte von dem nicht überschreitet, was man in Wien und Paris für ungesündere Wohnungen zahlt. Da die Stadt sich nicht in die Bauten gemischt hat, so entgeht sie aller der Gewalttätigkeit und Verschwendung, die man in Paris sieht. Sie bricht nicht selbst neue Straßen durch und braucht die Leute nicht zu zwingen, ihre Häuser deshalb zu verkaufen; sie hat keine Schulden und daher keine Nötigung, sie zu bezahlen und das Leben zu verteuern, und die Folge ist, daß das Leben in London sehr beträchtlich wohlfeiler ist als in Paris. Wir sprechen hier von allem, was wirklich zum Leben nötig ist, von Wohnung, Feuerung, Nahrung, Kleidung und Bedienung, und wenn das Leben in London wirklich teuer, und zwar viel teurer ist als in Paris oder Wien, so kommt dies einzig von dem größeren Aufwand her, den der allgemeine Reichtum eingeführt und so allgemein gemacht hat, daß ihm auch die nicht entgehen können, die ihn gern entbehren und deren Mittel ihn schwer erlauben. In reichen Häusern in der Stadt und auf dem Lande herrscht eine geradezu ausgesuchte Pracht hinsichtlich der Pferde und Wagen, der Möbel, der Bedienung, des Essens bis zur Abgeschmacktheit, und dieses Beispiel wird von Stufe zu Stufe herab soviel als möglich nachgeahmt, so daß nach und nach die Bedürfnisse und Gewohnheiten von jedermann gesteigert worden sind.
Quelle: Otto Waldau, Londoner Verkehrsmittel. Universum VI, 14. Das Straßenleben der Siebenmillionenstadt ist in den letzten Jahren eigenartiger, fesselnder und lehrreicher geworden, als es jemals gewesen, und zwar durch die ungeheuere Vermehrung, Verbesserung und Verbilligung der Verkehrsmittel.
Londons oberirdische Personenbeförderung bildet einen Gegensatz zu derjenigen unserer Großstädte dadurch, daß die Pferdebahnen trotz der bequemen und netten Ausstattung der Wagen und der gleichmäßig ruhigen Fortbewegung nicht zu einem beliebten Verkehrsmittel der besseren Klassen geworden sind. Die auffällige Erscheinung findet ihre Erklärung dadurch, daß man bei Anlage der vielen Pferdebahnlinien eine Störung der vornehmen Kutschen durch die Schienenlegung befürchtete und daher die erste Strecke in einer der vielen Vorstädte Londons ausbaute, die nicht wie die großen Geschäftsstraßen des Westends von allen möglichen anderen Gefährten in jedem Augenblick durcheilt wurde, die jedoch auch nicht so weit vom Mittelpunkt des Geschäftslebens entfernt war, um eine gute Verzinsung des Anlage- und Betriebskapitals von vornherein auszuschließen. Da nun derartige Vorstädte in der Hauptsache von sogenannten »kleinen Leuten« bewohnt werden, so waren die ersten und zahlreichsten Fahrgäste der Pferdebahn diese kleinen Leute und Arbeiter, die auf dem Wege von und zur Arbeit das neue, billige Beförderungsmittel benutzten. Die Folge davon war, daß die Bewohner der vornehmen Straßen Tramwaylinien mehr abwehrten als erstrebten, da es selbstverständlich ist, daß duftige Frühjahrskleider und geschwärzte Arbeitskittel sich nicht recht vertragen.
Welche Verkehrsmittel sich der größten Beliebtheit erfreuen, lehrt ein Gang durch eine der Hauptstraßen zwischen morgens 8 Uhr und Mitternacht: es sind die Omnibusse und die Cabs, die mit den Omnibussen und Droschken anderer Großstädte fast nur die fortbewegende Kraft – das Pferd – gemein haben.
Der Omnibus ist ein zierlicher und doch – man denke an die englischen Fahrräder – ungemein festgebauter Wagen; seine Seitenflächen zeigen große Spiegelscheiben, sein Fassungsraum ist auf 12 Fahrgäste im Innern und 14 auf den unbedeckten Außensitzen berechnet. Große Aufschriften an den Außenwänden kennzeichnen das Woher und Wohin, im Innenraum aufgehängte Tafeln die Fahrtaxe, welche der Schaffner während oder am Ende der Fahrt erhebt. Er verläßt seinen Platz auf dem Trittbrett nie, da er fortwährend nach Fahrgästen auslugt und beim Herannahen durch Pfiff oder Glockensignal den Kutscher verständigt, der auf hohem Sitz, mit grauem oder schwarzem Zylinder, feinen Glacés und der Blume im Knopfloch geschmückt, seine kräftigen Rosse antreibt; seine wohlgenährte Person mit dem geröteten Gesicht sticht lebhaft ab gegen den jugendlichen, unbärtigen, schmächtigen Schaffner in seiner sehr bescheidenen Kleidung; denn Uniformen gibt es für seinen Stand in England nicht. Ein »Bus« folgt dem anderen auf dem Fuße, und doch sind alle besetzt; es kommt dies nicht bloß von der bequemen Einrichtung der Wagen, auch nicht allein von dem Penny-Tarif (ein Penny = etwa 10 Pfennig), sondern vor allem auch daher, daß bei den Ausdehnungen der Weltstadt das Einhergehen auf Schusters Rappen bei Geschäftsgängen wahrlich nicht lohnt, und daß die Anfangs- und Endpunkte der einzelnen Fahrstrecken wie ihr Anschluß vorzüglich geordnet sind. Fortwährend sinnen die Gesellschaften auf Verbesserungen und größere Bequemlichkeiten der zahlreichen Fahrgäste, die allen Gesellschaftsklassen entstammen. Während früher die fast ein Stockwerk hohen Außensitze auf einer eisernen Leiter nur vom starken Geschlecht erklettert werden konnten und in der Richtung der Längenachse des Wagens mit der Rückenlehne gegeneinanderstießen, führt jetzt eine bequeme Wendeltreppe zu den in der Richtung der Querachse aufgestellten Gartenbänken, die nun auch von den jungen Damen fleißig benutzt werden. Und in der Tat – schöner läßt sich das Straßentreiben kaum beobachten als auf diesen Sitzen. Um die Männer für den Verlust eines bis dahin genossenen Vorrechts zu entschädigen, haben die Fahrgesellschaften Rauchomnibusse oder »saloon smoking cars« eingerichtet, die Automaten enthalten, gefüllt mit Zigarren, Tabak, Zigaretten und auch die wichtigsten Tagesblätter für leselustige Herren bereit halten. Auch des Abends braucht der Leser das Auge nicht übermäßig anzustrengen, da die Öllampe durch Gaslicht und durch Glühlampe ersetzt worden ist. Nach dem Grundsatze: »Die Menge muß es bringen,« hat man nicht bloß mit großem Kassenerfolge die Penny-Taxe durchgeführt, sondern einige Gesellschaften lassen zwischen den Themsebrücken und den Hauptbahnhöfen einerseits und den wichtigsten Kreuzungspunkten der Stadt andererseits Omnibusse ohne Schaffner verkehren, welche für einen halben Penny ihre Fahrgäste befördern; diese werfen die Kupfermünze in eine für diesen Zweck geeignete Kasse, die vom Kutscher geregelt werden kann.
Wie der wortkarge Bewohner Albions den Omnibus als »Bus« bezeichnet, so die Kabriolets als »Cabs«; ist jener das beliebteste Beförderungsmittel der Massen, so sind diese das für den einzelnen. Nur soll man, wenn man das Wort »Cabs« hört, nicht an jene vierrädrigen Marterkasten denken, die an den Bahnhöfen und an bestimmten Haltestellen der Riesenstadt ihre Fahrgäste erwarten; wer nicht Gepäck zu befördern hat, benutzt sie auf keinen Fall. Nein, die eigentlichen »Cabs« sind jene zweirädrigen Gefährte, die man in London unter dem Sondernamen »Hansoms« kennt. Der Kutscherbock ist hinter dem Rücken des Fahrgastes angebracht; von hier aus treibt der Kutscher sein Tier auch durch die engsten Straßen und das größte Gewühl von Menschen und Wagen mit Sicherheit und Schnelligkeit. Da es gegen 15 000 Cabs zu jeder Tageszeit auf den Straßen gibt, so begegnet man dem »Cabman« auf jedem Schritt; ist er nicht in Anspruch genommen, so stehen die Türen seines Gefährtes offen, gleichviel ob er am Halteplatz sich befindet oder im Schritt durch die Straßen fährt; er liest's jedem vom Gesicht ab, ob er einen Wagen sucht oder nicht. Durch das Schiebfenster im Wagendache erfragt der auf hohem Sitze thronende Rosselenker das Ziel des eingestiegenen Fahrgastes, und in raschester Gangart geht's von dannen; doch weiß er mit feinem Gefühl zu beschleunigen oder zu hemmen, je nachdem der Weg über Asphalt- öder Granit- oder Holzwürfelpflaster führt. Für einen Schilling (ungefähr eine Mark) legt er große Strecken zurück; kein Wunder, daß die »Cabs«, welche jetzt bequem Sitzplatz für zwei Personen bieten und auf Gummirädern geräuschlos und sanft durch die Straßen fliegen, das begehrteste Verkehrsmittel Londons sind; haben sie doch außer der Beleuchtung durch eine Leselampe auch Streichholzbehälter und Zeitung, um die Bequemlichkeit den Umständen nach aufs höchste zu steigern. Die Zahlen, die den Verkehr der Weltstadt darstellen, erfüllen mit Staunen. Sie können natürlich nicht vollständig sein, und die hier angeführten beziehen sich nur auf die wichtigsten Omnibus- und Eisenbahngesellschaften. Die Eisenbahn beförderte 1905 298 638 750 Menschen, die Tramways 433 731 880, die Omnibusse 288 965 214; das sind zusammen 1 021 335 844 Fahrgäste. Man kann also im allgemeinen sagen, daß jeder Einwohner von London 200 mal im Jahre eines der öffentlichen Verkehrsmittel benutzt hat.
Das unterirdische London umfaßt außer den Gas-, Wasser-, den Luftdruck-Briefröhren, Kabeln und Kloaken vor allem die Untergrundbahnen, die großartigste Anlage moderner Zeit.Quelle: Leop. Katscher, Bilder aus dem englischen Leben. 2. Aufl. Leipzig 1884, W. Friedrich, und teilweise Brockhaus' Konversationslexikon. Bd. 11. Als der Raum für neue Verkehrswege und Verkehrsmittel (für Omnibusse, Mietwagen, Trambahnen, Stadtbahnen, Dampfboote) über der Erde nicht mehr ausreichen wollte für die rasch wachsende Bevölkerung, erschloß man dem Verkehr unter der Erde neue Wege, unterirdische Bahntunnel. Freilich mußte diese Anlage kostspielig werden, einmal wegen der langwierigen Ausschachtungsarbeiten und sodann auch deshalb, weil eine gewaltige Anzahl von Gebäuden, viel Grund und Boden angekauft oder gerichtlich enteignet werden mußte. Noch heute spielen Prozesse zwischen der Unternehmerin, der Metropolitan Railway Company, und gewissen Privatbesitzern, welche die Preise ihrer Grundstücke dermaßen hoch schraubten, daß die Gesellschaft ohne weiteres auf Grund des Gesetzes Besitz ergriff und den Privaten die gerichtliche Geltendmachung ihrer Ansprüche überließ. Man konnte nur mit äußerster Vorsicht bohren und ausschachten, damit man nicht etwa durch Unvorsichtigkeit schon vorhandene Röhrennetze zerstörte. Da mußten Bäche und Kanäle seitwärts geleitet, Röhren verlegt, Leitungen vermieden werden. Der unterirdisch fließende, stromartige Flutgraben (fleet ditch), der »Styx von London«, mußte da, wo die Bahn ihn berührte, vollständig mit einer ungeheuren Eisenröhre umgeben werden, damit er durch sein plötzliches, oft 2 m erreichendes Steigen nicht die Bahn und die Bahnhöfe gefährde. Denn gerade dort, wo der King's Cross, die wichtigste Haltestelle der unterirdischen Strecke, zu stehen kommen sollte, gebärdete er sich am drohendsten. Um die eiserne Umhüllung zu legen, mußten an dieser Stelle zahlreiche, einander ablösende Arbeiter fast 14 Tage lang ununterbrochen in Nässe und Sumpf arbeiten, so daß ihnen die Stiefel in Wirklichkeit von den verschwollenen Füßen geschnitten werden mußten, und doch mußte die Arbeit in dieser Weise betrieben werden, um Überschwemmungen der Tunnels zu verhüten. Aus allen diesen Umständen erklärt sich der Preis von 23 247 000 Mark für 1 km des Innenringes. – Wiewohl die Untergrundbahn, die sich auch unter der Themse nach der Südstadt fortsetzt, in den Händen dreier Gesellschaften ist, ist doch der Betrieb gemeinsam, das Ineinandergreifen vollständig; ja gewisse Gesellschaften, die in London oberirdische Bahnen besitzen, haben nach ihren Hauptbahnhöfen besondere Verbindungsgleise legen lassen.
Diese Bahnhöfe der Underground Railway bestehen aus ober- und unterirdischem Bau. Jener ist von der Straße aus zugänglich, an Aufschriften und Bauart leicht erkenntlich. Er enthält die Schalter, wo man die Fahrkarten der drei Wagenklassen lösen kann, meist auch noch einen Speise- oder Trinkraum. Besonders erwähnenswert sind die »parly tickets«, das heißt die parlamentarischen Fahrkarten. Das Parlament knüpfte nämlich an die Erteilung der Erlaubnis die Bedingung, daß die Company Arbeiterzüge zu ermäßigten Preisen einrichte. Die Gesellschaft gibt jedoch zu jedem Zuge solche Fahrkarten (mit 50-70% Ermäßigung) aus, und da nicht jedem der Arbeiter an die Stirn geschrieben ist, so wird davon ausgiebigster Gebrauch gemacht. Ohnehin sind die Fahrkartenpreise sehr niedrig, so daß die unterirdische Bahn ein sehr gesuchtes Verkehrsmittel ist. Mit der Fahrkarte in der Hand steigt man die Treppen zum unterirdischen Bahnhof hinab, der meist nur Bahnsteige umfaßt. Diese unterirdischen Räume sind entweder Tunnels und dann mit Gas oder elektrischem Licht erleuchtet, oder hohe Räume mit Oberlicht. Der Aufsichtsbeamte durchlocht die Fahrkarte und gibt Weisungen, wo man sich aufzustellen habe. Denn die drei Wagenklassen folgen genau hintereinander, und außerdem muß man genau den Bahnsteig kennen, wo man Aufstellung zu nehmen hat, da jede Fahrrichtung ihren besonderen Zugang und ihr besonderes Geleis besitzt. An den Laternenglocken, an großen blauen Holztafeln sind die Stationsnamen zu lesen. Man setzt sich bis zur Ankunft des Zugs auf eine der Bänke nieder und studiert an den Wänden die blechernen, hölzernen und pappenen Tafeln. Doch hat man nicht lange Zeit, Umschau zu halten, da die Züge in Zwischenpausen von 2, 3 bis 5 Minuten abgehen. Schnell kommt der Zug angebraust; da gilt es, rasch heraus- und hineinzuspringen, da nur eine halbe Minute gehalten wird. Das Öffnen der Wagen besorgen die Aussteigenden, das Schließen die Schaffner. Der lange Zug fliegt weiter. Der Zug braust mit einer Geschwindigkeit von 75 km die Stunde dahin; trotzdem kann man diese nicht als übertrieben, die Sicherheit außer acht lassend bezeichnen, da jede Fahrrichtung ihr bestimmtes, gesondertes Gleis hat. Wie eine Erscheinung aus dem Märchen berührt es, wenn ein anderer erleuchteter Zug in der entgegengesetzten Fahrrichtung an uns vorüberfliegt. Das Getöse in diesen Tunnels war zur Zeit des Dampfbetriebes entsetzlich, der Kohlenrauch für das Atmen sehr beschwerlich. Im Jahre 1906 ist der elektrische Betrieb eingeführt worden, wodurch die Benutzung der Underground Railway viel angenehmer geworden ist, da die Rauchbelästigung fortfällt; auch die Erschütterungen sind jetzt geringer geworden als bei den Dampfbahnen, die wiederholt an den Häusern Beschädigungen erzeugten. Merkwürdig berührt es, daß auch die Wagenwände allseitig beklebt sind mit Plakaten, desgleichen jede Wand, wo der Zug einmal ohne Tunnel unter freiem Himmel dahinfährt. Ist man am Ziele, so springt man heraus und steigt die Treppe hinauf nach der Oberwelt.
Die alten Untergrundbahnen sind in drei Ringen in der Nordstadt gebaut. In den letzten Jahren sind eine Reihe von elektrischen Untergrundlinien (tubs) mit ungeheuren Kosten erbaut worden, die strahlenförmig (auch unter der Themse hinweg) aus den Vorstädten in die City führen, ohne daß man merkt, daß der Verkehr auf den zahllosen oberirdischen Vollbahn- oder Tramlinien schwächer geworden wäre.
In den Ländern, wo Germanen mit Slawen untermischt sich niedergelassen haben, wie namentlich in Sachsen, hat man die Bemerkung gemacht, daß bei den slawischen Völkerschaften neben der Rundlingsform der Dörfer die Verteilung der Ländereien sich wesentlich von den germanischen Ansiedelungen unterscheidet. Der Slawe liebt das Zusammensein, die Gemeinschaft; der Germane das Alleinsein. Ihm ist eine Hofreite lieber als der Schutz, die Sicherheit und das gesellige Vergnügen, das er als Mitglied einer Dorfgemeinde findet. Bei ihren Wanderungen besetzten die Deutschen überhaupt gewöhnlich nicht zusammenhängende Ländereien in Masse, sondern ließen sich einzeln und zerstreut nieder, und noch immer gibt es in Schwaben und Niedersachsen Bezirke, wo die Bevölkerung großenteils auf einzeln stehenden Höfen lebt, wobei ich nur an den von Immermann so meisterhaft gezeichneten westfälischen Hofschulzen erinnern will. Zäh und ein Freund der harten Arbeit, empfand und empfindet der Deutsche gar keinen Widerwillen gegen die abgeschlossene Lebensweise; sein Acker und seine Familie genügen ihm vollkommen. Schon Tacitus bemerkt von unseren Voreltern: »Von den germanischen Völkerschaften ist es hinlänglich bekannt, daß sie keine Städte bewohnen, ja nicht einmal zusammenhängende Wohnsitze unter sich dulden; sie bauen sich abgesondert und zerstreut an, wie ihnen eben der Quell, die Flur, der Hain zusagte.« Dem Römer, dem der alte Kunstfleiß der Griechen, der gartenmäßige Landbau des Italikers bekannt waren, mußte es auffallen, wie wenig Sorgfalt und Nachdruck der Germane auf die Bearbeitung der besseren Bodenteile, die gegen die undurchdringlichen Wälder und Sümpfe Germaniens gewaltig abstachen, verwendete. Gleichwohl waren es germanische Siedler, welche in dem sinkenden römischen Reiche beides, seine verödeten Fluren anbauen und die Reihen seiner Heere ergänzen sollten. Ackerbau und Viehzucht waren von Hause aus das eigentliche Gewerbe der Germanen. Der germanische Staat ist auf den Landbau gegründet; die geordnete Benutzung der Mark, sowohl der wechselnden, in Höfe geteilten Ackerflur als der unterschiedslosen der Almende war die Hauptsache.
Die außerordentliche Fruchtbarkeit des bei weitem größten Teiles der großbritannischen Inseln, ihr mildes Klima, die alle Arten der Pflanzenwelt fördernde Feuchtigkeit der Luft, machten ihre Bewohner von den ältesten Zeiten an zu einem ackerbautreibenden Volk, dessen Zahl vom Mittelalter bis in die neuere Zeit nur sehr allmählich wuchs. Bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus war die Volkszahl nicht viel höher als auf sieben Millionen gestiegen. Unter Heinrich VII. und VIII. nahm England so gut wie gar keinen Teil an den amerikanischen Entdeckungs- und Eroberungsreisen; Heinrich VIII. bediente sich zu Seefahrten gemieteter Schiffe. Obwohl unter Cromwell, durch die Eroberung Jamaikas, der englische Handel sich erweiterte, blieb doch der größte Teil des Weltverkehrs bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in den Händen der Holländer. Der Engländer blieb bis dahin der altsächsischen Sitte des Ackerbaus treu.
Wir haben etwas weit ausgeholt, um den Engländer in seinem Hauswesen kennen zu lernen; gewiß nicht mit Unrecht; sein Haus als Inbegriff der Familie ist für ihn das Wichtigste, sozusagen die Summe seines geselligen Daseins, und insofern steht er seinem germanischen Ursprung vielleicht noch näher als der heutige Deutsche. Der Brite legt einen uns anderen fast lächerlich vorkommenden Wert darauf, ein eigenes Haus zu haben und allein zu bewohnen. Daher in London die zahllose Menge von schmalen Häusern, hervorgegangen aus dem Streben nach Alleinsein und Unabhängigkeit. Äußerlich gleichen sich diese Wohnungen wie ein Ei dem anderen, der Backsteinbau, die Staketeinfassung, die unterirdische Küche, die Tür usw., alles ist nach ein und demselben Muster geformt. Nichts ist langweiliger, unerquicklicher für das Auge als diese Einförmigkeit: allein daran stößt sich der Engländer wenig, wenn er nur Herr, unbeschränkter, durch niemand behelligter Herr in seinem Hause ist: »Mein Haus – meine Burg!«
In der Bequemlichkeit, Vornehmheit und Dauerhaftigkeit der inneren Einrichtung seiner Wohnung übertrifft der Engländer alle anderen Völker; das Wort »Komfort« hat nur der Engländer, weil er die Sache hat. So unansehnlich in der Regel selbst die Wohnungen reicher Leute von außen erscheinen, so reich, glänzend, ja prachtvoll ist die innere Ausstattung. Was der Bequemlichkeit und dem Behagen dient, ist mit verschwenderischer Hand angebracht, und diese Sorgfalt erstreckt sich auf die geringfügigsten Gegenstände des Hausbedarfs, die man sonst keiner Beachtung für wert hält. Im englischen Hause fehlt es nicht an Teppichen, an glänzender Beleuchtung, trefflicher Küche, reich besetztem Keller, schwerem Silbergeschirr; am vollkommensten aber ist das Schlafzimmer ausgestattet, das jedem Bedürfnis mit der größten Freigebigkeit entgegenkommt. An schön gebundenen Büchern und an oft sehr wertvollen Kunstgegenständen ist kein Mangel. Was Wunder, daß der Brite gern zu Hause ist, seine Häuslichkeit über alles liebt und in Ehren hält! Es hat dies den unschätzbaren Gewinn, daß auf diesem sicheren Grunde echtes Familienleben erwächst. Gibt es natürlich auch viele Ausnahmen, so wird man doch in den bei weitem meisten Fällen sagen müssen, daß der Brite ein echter Familienmensch ist. Eine Sommerreise, einen Ausflug nach dem Festlande abgerechnet, weilt er fast beständig im Schoße seiner Familie und nimmt an öffentlichen Vergnügungen ohne Zweifel weniger teil als der Franzose. Treue, liebevolle Anhänglichkeit unter Familiengliedern trifft man dort allenthalben, und was noch mehr wiegt, sehr oft auch jene sittliche Achtung, welche die Eltern den Kindern erweisen. Dadurch mag es erklärlich werden, warum man in England so viele ganze Männer und Frauen findet. Man sieht wohl auf Reisen Väter ihren noch nicht ganz erwachsenen Töchtern mit einer Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit begegnen, die man bei uns bloß von Verlobten erwartet. Um so weniger läuft die elterliche Liebe Gefahr, in blinde Affenliebe auszuarten; sie trägt durchaus einen würdigen Charakter und flößt den Kindern schon von frühester Jugend an jenes Gefühl von Selbständigkeit und Selbstachtung ein, das fest ins Leben hinaustritt. Im Hause wie in der Schule ist die Erziehung die Hauptsache – denn diese bezweckt die Bildung des Charakters – der Unterricht mehr nur Nebensache, und wenn daher die englischen Unterrichtsanstalten in betreff der Kenntnisse mit den deutschen nicht entfernt den Vergleich aushalten können, so sind sie den unsrigen in den erzieherischen Leistungen überlegen.
Die »Feuerseite« des englischen Familienzimmers, wie sie den Sinn für Häuslichkeit weckt und pflegt, so ist sie auch ganz besonders geeignet, durch das gesellige Mittel des Gesprächs die jüngeren Familienglieder zu erziehen und zu bilden. Die englische Geselligkeit ist ihrem Grundwesen nach häuslich, weshalb der Engländer so oft im Gespräch jene liebenswürdige Offenheit und Geradheit entfaltet, die er im Kreise der Seinigen sich aneignet. Wer einen so überaus großen Wert auf das Familienleben legt wie der Brite, dem kann es nicht gleichgültig sein, die Umzäunung seines Familienglücks gewaltsam durchbrochen, die makellose Feuerseite verunreinigt zu sehen. Es ist ganz gewiß, daß in England Empfehlungsbriefe sehr oft den erwarteten Erfolg nicht haben, daß der Engländer ungastlich erscheint, indem er die Schwelle seines Hauses nicht den ersten besten überschreiten läßt, selbst wenn es dieser seinem inneren Werte nach vollkommen verdienen sollte.
Das zeigt nur so viel, daß der Engländer jene Gutmütigkeit nicht kennt, die in einem Empfehlungsschreiben schon den Schlüssel erblickt, der das Heiligtum des Familienkreises aufschließt. Der Engländer empfängt nur den, von dem er die feste Überzeugung hat, daß er dasselbe Vertrauen in ihn setzen kann, wie in ein Mitglied der Familie oder in einen langjährigen Hausfreund. Der einmal Zugelassene genießt dann aber auch alles Recht der innigsten Freundschaft, und man begreift, daß ein solches Vertrauen nicht um den Preis eines gewöhnlichen Empfehlungsbriefes erkauft wird. Englische Sitte schreibt vor, gegen Unbekannte ein gemessenes Betragen zu beobachten und auf sie ohne vorausgegangene Einführung wenig oder gar keine Rücksicht zu nehmen. Ist aber ein Fremder von guter Hand empfohlen und weiß er sich als Mann von Bildung und Erziehung zu betragen, so darf er darauf rechnen, als Freund des Hauses angesehen und mit Zuvorkommenheit, Höflichkeit und Herzlichkeit behandelt zu werden.
Nur darum herrscht in England zwischen den Unverheirateten beiderlei Geschlechts eine Freiheit und Natürlichkeit des Verkehrs wie wohl nirgend sonst: die Eltern rechnen mit der verdachtlosesten Zuversicht auf die vollkommenste Ehrenhaftigkeit der Eingeführten, versehen sich von ihrer Seite der Beobachtung eines durchaus rücksichtsvollen Betragens und erwarten, daß sie auch nicht um eines Haares Breite die Grenzen der Schicklichkeit und des Zartsinnes überschreiten. Es liegt auf der Hand, daß ein derartiges Verhältnis zwar nicht der gelehrten Schulbildung, wohl aber der Charakterbildung der britischen Frau ungemein zu statten kommt. Die Britin besitzt, außer einem feinen Gefühl für das Schickliche und einem geübten Sinn für die praktischen Verhältnisse des Lebens, einen tiefliegenden romantischen Zug des Charakters, der wohl bisweilen zu Übereilungen und Fehltritten verleitet, viel häufiger aber zur Quelle der edelmütigsten Handlungen und der hingebendsten Aufopferung wird.
Eine Erziehung, die es sich zur wesentlichen Aufgabe macht, in dem Kinde das Gefühl eigener Würde und Liebe zur Unabhängigkeit möglichst stark zu entwickeln und selbständige Menschen zu bilden, muß auch der Liebe und Ehre ihre ganze sittliche Würde und Freiheit lassen, daher die Eltern so rücksichtsvoll und zart bei den Heiraten ihrer Kinder sich zeigen, persönlicher Neigung einen so großen Spielraum gestatten und in die persönlichste aller Angelegenheiten so wenig als möglich sich einmischen. Das englische Mädchen folgt ihrer Neigung auf eigene Verantwortlichkeit, und trifft den Mann ihrer Wahl ein harter Schlag des Schicksals, so erprobt sich die wahre Liebe, die Stärke des Charakters, die uneigennützige Gesinnung, die Hingebung und Aufopferungsfähigkeit der Gattin im glänzendsten Lichte.
In einem solchen häuslichen Kreise muß auch der Fremde sich wohlfühlen. Wo immer nur ein Dienst, eine Gefälligkeit zu erweisen ist, hält der Engländer sich nicht bloß bereit, sondern für verpflichtet dazu; die kostbarste Zeit ist ihm nicht zu teuer, um etwas zur Belehrung und Erheiterung beizutragen, und dieser Eifer, anstatt mit der Zeit zu erkalten, erhält sich ungeschwächt. Bekanntschaften, die man in England gemacht, dauern selbst in der Ferne jahrzehntelang mit der alten Innigkeit fort.
Indem der Engländer sich abschließt, gewinnt er die Mittel, in seinen Kreisen mit ungeschwächter Kraft zu wirken. Wie der englische Boden, so ist das englische Leben, zumal die englische Gesellschaft, von allen Seiten eingehegt. Diese Umzäunung (fencing) erstreckt sich selbst auf die Wirtshäuser, weil der Brite seine Häuslichkeit so über alles hochachtet, daß er wenigstens ein Abbild davon auch außerhalb seiner eigenen vier Wände haben will. Ein Wirtstisch, an dem sich Leute ohne Unterschied zu geselligem Verkehr versammeln, die sich in ihrem Leben nie zuvor gesehen haben, ist dem Engländer ein Greuel, ein Unbegreifliches. Gemeinschaft des Unbekannten versteht er nicht, und selbst wenn er betet, beansprucht er für sich und die Seinigen einen besonderen Kirchenstuhl – eine Art kirchlichen Komforts.
Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Der Engländer liebt den Landaufenthalt über alles und sucht ihn so oft als möglich. Reiche Edelleute, Kaufleute oder Industrielle schaffen sich einen Landsitz nach ihrem Sinne und Geschmack. Obst- und Gemüsegärten und Treibhäuser liegen mit allen zur inneren Landwirtschaft gehörigen Gebäuden ganz nahe am herrschaftlichen Hause, werden aber durch allerlei Vorkehrungen dem Auge entzogen. Diese Bezirke sind es, welche der Engländer eigentlich Gärten (gardens) nennt, die aber nicht mit zum Park im engeren Sinne gerechnet werden. Auch der Blumengarten, ebenfalls in der Nähe des Herrenhauses, wird nicht zum Park im engeren Sinne gezählt. Dieser vorzugsweise zu Spaziergängen bestimmte Teil, pleasure-ground genannt, hat am meisten Ähnlichkeit mit unseren Parks; man trifft da geschmackvolle Blumenbeete, Gänge, die sich bald durch dichte Schatten, bald mehr im Freien hinschlängeln; Tempel, Säulen, Denkmäler, Ruheplätze und den ganzen Reichtum der neueren Gartenkunst. Hier blühen und grünen die vielen einheimischen Gesträuche, Bäume und Blumen neben den aus fremden Ländern herübergebrachten, die stark genug sind, den Winter im Freien zu ertragen. Obstbäume sind aus dem pleasure-ground verbannt.
Der eigentliche Park umfaßt die zum Wohnhaus oder Schloß gehörigen Ländereien, zu seinem Bereich gehören Äcker und Wiesen, mit lebendigen Hecken zierlich eingefaßt, durchschnitten von wohlgehaltenen Kieswegen zum Gehen und Fahren; auch einzelne Wirtschaftsgebäude stellen sich hier und da dem Auge dar, von gefälliger, aber doch ihre Bestimmung andeutender Form. Der unvergleichlich schöne Rasen, den England überall seinem feuchten Seeklima verdankt, dann die prächtigen Bäume, vornehmlich Eichen und Buchen, überall in Gruppen verteilt, bilden eine Hauptzierde der englischen Parks. Enge, durch dichte Schatten und Gebüsche sich hinschlängelnde Gänge findet man in keinem Parke; auch große Gehölze sind, wie überall in England, selten. Ein viele Quadratkilometer großer Wald, wie der in seiner Art einzige von Fontainebleau, ist in ganz England nicht zu finden. Man möchte sagen, es fehle Schatten, wenn nicht gerade in diesem Lande, wo bei sehr milder Luft dennoch die Sonne selten recht heiß und hell scheint, der Schatten entbehrlicher wäre als anderswo. Dagegen darf es an Wasser nie fehlen. Künstliche Wasserfälle kennt man nicht, und noch weniger Springbrunnen. Fließt aber ein Fluß oder nur ein Bach in der Nähe einer solchen Besitzung, so muß er, wenn auch mit großen Kosten herbeigeführt, sich in mannigfaltigen Krümmungen hindurchschlängeln. Fehlt es an lebendigem Wasser, so sucht man wenigstens einem stehenden Kanale den Schein davon zu leihen. Man gibt ihm eine leichte natürliche Krümmung, verdeckt Anfang und Ende mit überhängendem Gebüsch, wirft schöne Brücken darüber und täuscht so das Auge; oder man verwandelt die Ufer eines Teiches in die unregelmäßigen Umgebungen eines kleinen Sees; überall strebt man nach dem Natürlich-Schönen und flieht das Gesuchte, Steife.
Die verständige Weise, mit welcher alle Bäume in Rücksicht auf Höhe, Wuchs, dunklere und hellere Farbe ihres Laubes geordnet sind, gibt dem Ganzen einen Zauber, den man fühlt, ohne sich ihn gleich erklären zu können. Alles ist zur schönsten und befriedigenden Einheit gebracht. Das Auge wird sogar in Hinsicht der Entfernung eines Gegenstandes auf die angenehmste Art getäuscht. Die englischen Gärtner sind wahre Landschaftsmaler im großen, ja, wir möchten sie fast für die eigentlichen Künstler der Nation erklären. Jeden Vorteil, den Licht, Schatten und die Regeln der Fernsicht ihnen bieten, wissen sie vortrefflich zu benutzen, ohne doch dabei ins Kleinliche zu fallen wie etwa die Japaner.
Die Tierwelt vollendet den Reiz dieser lebendigen, zum Gemälde erhobenen Landschaft. Hunderte von halb zahmen Hirschen und Rehen weiden auf den grünen Wiesen, mit ihnen die schönsten Pferde, Kühe und Ziegen; besonders in der Nähe des Hauses, wo sich die Wiesen rings umher wie ein weicher grüner Teppich ausbreiten. Die schönen Gestalten dieser Tiere, ihre leichten, freien Bewegungen und ihr Wohlsein geben dem Ganzen einen unbeschreiblichen Reiz.
Der Haupteingang zum Park, ein oft sehr prächtiges Tor, hat zu beiden Seiten zwei kleine Gebäude, die Wohnung des Torhüters und seiner Familie, bei welchem sich jeder Einlaß Begehrende vermittels einer Glocke meldet. Dieses Tor mit seinen Gebäuden, the lodge genannt, ist eine Hauptzierde des Parks. Die beiden Pavillons sind bald in gotischem, bald in ägyptischem Geschmack aufgeführt; sie stellen Türme, griechische Tempel oder auch nur nette Gartenhäuschen vor, je nach dem Geschmack des Erbauers. Immer hat der Torhüter eine freundliche Wohnung darin, mit Küche, Keller und allem, was er bedarf, wohl versehen, und manche angesehene Familie in Deutschland würde zufrieden sein, einen solchen Sommeraufenthalt zu besitzen.
Das Wohnhaus liegt meist auf einer sanften Anhöhe; alle Bäume sind aus seiner Nähe verbannt, damit Licht, Luft und Sonne kein Hindernis finden. Dennoch ist es nicht heiß in den Zimmern, teils weil es überhaupt in England nicht heiß ist, teils wegen der wenigen Fenster, die aber so verständig angebracht sind, daß jeder Teil des Gebäudes hinlänglich Licht hat. Selten herrscht ein reiner Geschmack im äußeren Aufbau, oft sind die Häuser sehr schwer und mit Verzierungen überladen. Die Hauptansicht ist gewöhnlich mit Säulen geziert. Sind diese gleich in ihren Verhältnissen nicht immer die richtigsten, scheinen sie oft müßig dazustehen, so gewähren sie doch immer ein angenehmes, schattiges Plätzchen vor dem Hause, von welchem man recht behaglich ins Freie über den grünen Wiesenplan hinaussieht. Unter und vor diesen Säulen stehen viele fremde Gesträuche und Blumen in Vasen, teils auf schönen Gestellen übereinander getürmt, teils auf den Stufen des Eingangs und den Geländern zierlich geordnet. Die Verschwendung, die man mit diesen Pflanzen treibt, ist unglaublich. Täglich müssen die verblühten hinweggeschafft und andere an ihre Stelle gesetzt werden.
Die innere Einrichtung der Häuser richtet sich hier, wie überall, nach dem Reichtume und Geschmacke des Erbauers, des Bewohners und des Zeitalters, in welchem sie entstand. Die meisten Häuser haben große, vollkommen erleuchtete und hohe Räume im Kellergeschoß, in welchen sich die Küche, die Gewölbe zur Bewahrung der Vorräte und die Bedientenzimmer befinden. Auch diese sind durchaus gut möbliert, ja die der Haushälterin und des Haushofmeisters (in England butler genannt) sogar herrschaftlich zu nennen, hübsch tapeziert, mit Mahagonimöbeln und guten Fußteppichen versehen. Auch bei den Bedienten wird die englische Sitte beobachtet, daß sie außer ihren Schlafzimmern noch Wohn- und Speisezimmer haben.
Aus dem Garten tritt man gewöhnlich zuerst in eine große, hohe, öfters von oben beleuchtete Halle, die mit Gemälden oder Standfiguren, halberhabenen Bildern oder Vasen geziert ist. Zu beiden Seiten liegen die verschiedenen Putz- oder Wohnzimmer; ein langes Zimmer enthält die Bücherei, deren schöne Schränke und zierliche Einbände sie zu einem der stattlichsten Zimmer des Schlosses machen. In vielen Häusern versammelt sich hier die Familie zum Frühstück. Sonst gibt es auch besondere Frühstückszimmer, dazu Arbeits-, Musik-, Gesellschaftszimmer (drawing rooms), Wohnräume (parlours), Speise- und Spielzimmer. Überall vornehme Pracht; Teppiche auf Vorplätzen und Treppen.
Die Möbel stehen durchaus nicht überall an den Wänden, wie es in Deutschland üblich ist. Man liebt es, daß zwischen den Wänden und den Möbeln, die man in den Wohnzimmern gern in der Mitte anordnet, noch Raum zum Gehen und Stehen bleibt. Schreibtische und Flügel stehen dort, wo das Licht am günstigsten, wo die Schallwirkung am schönsten ist; wo weder die Hitze des Kamins noch der Zug am Fenster lästig wird. Die Kamine sind meist in Marmor aufgeführt oder mit brillantiertem Stahl verziert; Vasen und Lampen prangen auf den Simsen.
Im zweiten Stock liegen die Schlafzimmer, die niemand Fremdes zu sehen bekommt. Es ist englischem Gefühl zuwider, diese Räume der Häuslichkeit fremden Augen auszusetzen. Nichts empört die Engländerin mehr als die Sitte der Französinnen, die ihre Schlafzimmer und Boudoirs zu Empfangszimmern machen.