
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1. Die nordwestliche Durchfahrt. – 2. Die Suche nach dem offenen Polarmeere. – 3. Die nordöstliche Durchfahrt. – 4. Zum Nordpol. – 5. Nordenskjöld und Nansen auf dem Inlandeise Grönlands. – 6. Im Eisfjord auf Spitzbergen. – 7. Im nördlichen Polarmeer.
Zugleich mit der Auffindung der Neuen Welt und der Seewege nach Indien setzt die neuere Nordpolarforschung ein, weil die Spanier und Portugiesen die neugefundenen Seewege aus dem Atlantischen Ozean in den Indischen und in den Pazifischen Ozean für Schiffe anderer Staaten sperrten, um die Handelsherrschaft sich zu wahren. Denn die Unternehmungslust besonders der Engländer und Holländer suchte nun auf neuen Wegen um die Norderdteile herum den eigennützigen Gegnern ein Schnippchen zu schlagen, da die neuen Straßen nach Nordwesten und Nordosten, um Nordamerika und um Nordasien herum, den Weg nach Indien abzukürzen versprachen und vor den eifersüchtigen Mitbewerbern sicher waren. Diese rein praktischen Beweggründe führten zwar nicht zu dem erwünschten Ziele, dienten aber einerseits der wirtschaftlichen Erschließung des Nordpolargebiets als vor allem andererseits der wissenschaftlichen Erforschung und kartographischen Festlegung der bisher ganz unbekannten arktischen Gebiete. Mehr und mehr wurden wissenschaftliche Absichten aller Art die Triebfedern der kühnen Erkundungsfahrten und Vorstöße gegen die nördliche Eiskappe unseres Planeten, und dieser ideale Zug des Erkenntnistriebes feierte dabei Sieg auf Sieg, wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß eine Art Sportleidenschaft, die um jeden Preis den Pol selbst erzwingen will und sich der hohen Zahl der erreichten Grade und Minuten freut, manchmal dabei eingeschlichen ist.
Quellen für 1-3: J. Löwenberg, Die Entdeckungs- und Forschungsreisen in beiden Polarzonen. Prag 1886 (F. Tempsky). – K. Hassert, Die Polarforschung. Leipzig 1902 (B. G. Teubner).durch die arktische Inselwelt Amerikas zum Stillen Ozean bemühten sich besonders die Engländer zu finden. Die Land- und Meernamen, die die Karte in diesem Gebiete nennt, halten die Erinnerung an die kühnen englischen Seefahrer fest. Die vorbereitenden Fahrten eines Martin Frobisher 1576/78 (vgl. Frobisherbai auf Baffinland), eines John Davis 1585/87 (vgl. Davisstraße), der den englischen Walfang in jenen Gegenden ins Leben rief, eines Henry Hudson 1607/11 (vgl. Hudsonstraße und -bai), eines William Baff in 1612/16 (vgl. Baffinsbai und -land) und anderer klärten die Polargegenden Nordamerikas auf, ohne doch die Durchfahrt zu finden. Die Lösung der Aufgabe wurde erst im Anfange des 19. Jahrhunderts, besonders auf das Betreiben John Barrows hin (vgl. Barrowstraße als Fortsetzung des Lancastersunds) wieder aufgenommen, und der englische Staat machte die Polarforschung zur Nationalsache. Ein Preis von 400 000 Mark wurde für die Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt, eine Belohnung von 100 000 Mark für die Erreichung des 110. Grades westlicher Länge von Greenwich ausgesetzt.
Edward Parry war schon 1818 als Begleiter von John Roß an die Tore der nordwestlichen Durchfahrt gelangt, und das Vertrauen der englischen Admiralität setzte ihn 1819 in den Stand, an der Spitze zweier stattlicher Segelschiffe »Griper« und »Hekla«, begleitet vom jüngeren Roß, Sabine und Beechey, die Flagge Englands so weit zu tragen, als es ihm die eigene Kraft und die Umstände gestatten würden. Am 8. Mai 1819 lichtete er die Anker, erreichte glücklich die Baffinsbai, wo er mit Glück die Zusammenstöße mit den mächtigen, schwimmenden Eisbergen vermied, und warf am 1. August Anker im Lancastersund, der ersten Station auf der Nordwestlinie. Wo ein Jahr vorher Wolkengebilde dem älteren Roß ein hemmendes Gebirge vorgetäuscht hatten, fand er eisfreies Wasser, und mit geblähten Segeln fuhr er in ein die zweite Station seiner Route, die Barrowstraße. Hier verzögerte sich zum ersten Male seine unter so günstigen Zeichen begonnene Fahrt durch vorgelagerte Eismassen. Er versuchte nach Süden auszuweichen, fand aber denselben widerstandsfähigen Feind, und außerdem drohte die Magnetnadel ihren Dienst zu versagen; befand er sich doch, ohne es zu ahnen, in der Nähe des magnetischen Nordpols. Mit kühnem Mut zwang er seine Fahrzeuge wieder westwärts, drang glücklich in den Melvillesund ein, gewissermaßen den Binnenhafen der nordwestlichen Durchfahrt. Schon hatte er den 110. Grad w. Gr. erreicht und damit den Preis von 100 000 Mark errungen, als ihn der arktische Winter nötigte, an der Südküste der Melville-lnsel den sogenannten Winterhafen aufzusuchen. Er war hier zehn volle Monate festgebannt im Eise, sah am 15. November 1819 die Sonne zum letztenmal untergehen, um 84 Tage die teure Himmelsbotin nicht wieder zu begrüßen. Mit Willenskraft und richtigem Blick suchte er seine Mannschaften in der so notwendigen Tätigkeit zu erhalten, überdachte die Fahrzeuge gegen Sturm und Kälte, ließ Boote und Tauwerk an Land bringen und sorgte in seiner großen Familie für Arbeit wie für Unterhaltung. Erst am 15. August 1820 wurden seine Fahrzeuge befreit aus der Eispresse, und sofort begann die Fahrt nach Westen; doch es sollte ihm nicht vergönnt sein, auch die letzte Strecke der Nordweststraße zu durchfahren; vor Banksland stand ihm die Eisbarre ohne jede Öffnung drohend im Wege und nötigte ihn zu eiliger Heimkehr. Die ganze Inselflur der amerikanischen Arktis wurde später ihm zu Ehren Parry-Archipel getauft. Obwohl der große Forscher in den Jahren 1821 bis 1823 die Lösung seiner Aufgabe in niederen Breiten versuchte, der Hudsonstraße auf den Schiffen »Fury« und »Hekla« folgend, sollte ihm die Lüftung des Schleiers auch an dieser Stelle nicht vergönnt sein. Auch eine dritte Fahrt 1824 war nicht vom Glück begünstigt.
Von der irrigen Ansicht ausgehend, daß das Eis im höchsten Norden eine zusammenhängende, glatte Decke bilde, wollte Parry den Nordpol selbst erobern, und mit ungeschwächter Begeisterung warf er sich auf die Verwirklichung dieses neuen Gedankens, den er auf anderem Wege mit Hilfe des Schlittens auszuführen suchte. In Gemeinschaft mit Clark, Roß und Crozier stach er am 4. April 1827 mit der »Hekla« abermals in See und befand sich am 19. glücklich in Hammerfest, wo er acht Renntiere an Bord nahm. In nördlicher Fahrrichtung erreichte er im Kampfe mit widrigen Winden Spitzbergen; als jedoch die Reise nach dem Pol zu angetreten werden sollte, war die Jahreszeit (der arktische Sommer) schon zu weit vorgerückt. Er ließ die Renntiere samt dem Schiffe zurück, belud die Schlitten, die gegebenenfalls ebensogut als Boote verwendet werden konnten, für 71 Tage mit Vorräten und trat am 22. Juni seinen Marsch nach dem Pol an. Auf der ersten Strecke von 40 Stunden war das Eis glatt wie ein Spiegel, und man kam rasch vorwärts. Doch als man den Rand dieser Fläche überschritt, zeigten sich bereits die Wirkungen des warmen arktischen Sommers: das Eis war zerrissen, rauh, an manchen Stellen dünn und weich, von Kanälen durchschnitten, so daß der Vormarsch, besonders das Ziehen der Schlitten ungeheuer erschwert war. Man reiste nur bei Nacht, da bei Tage der Schnee das Auge zu sehr blendete; am Morgen wurde dann der Tag mit dem Abendgebet beschlossen, und sieben Stunden gab man sich einem erquickenden Schlafe hin auf treibenden Eisschollen. Zu den vorigen Beschwerden gesellte sich bald der Regen; oft hatte man in vier Stunden angestrengtester Arbeit nicht eine halbe Stunde Weges zurückgelegt; am 25. Juni war man unter 81°13' n. Br., am 29. desselben Monats unter 81°23', am 23. Juli unter 82°45' und am 26. Juli gar unter 82°40'23". Man war also auf dem nach Süden abtreibenden Eise rückwärts getrieben worden. 35 Tage hatte man sich übermenschlich abgemüht, den Pol zu erreichen, doch vergeblich. Unverrichteter Sache zwar, doch wohlbehalten, kehrte Parry zurück. Er hatte wenigstens den Erfolg, dem Pole so nahe gewesen zu sein, wie niemand vor ihm.
Die englische Admiralität verweigerte in Zukunft die Mittel zur Erreichung eines als Hirngespinst erkannten Zieles und zog 1828 auch den Preis für die Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt zurück. Doch jetzt tat die Privatunternehmung das ihrige. Der ältere Roß (John) rüstete mit Hilfe des reichen Privatmannes Felix Booth den Raddampfer »Victory« aus, um die nordwestliche Durchfahrt zu suchen. In Begleitung seines Neffen James Clarke Roß trat er am 29. Mai 1829 seine (zweite) Reise nach den arktischen Gegenden an. Nachdem er an der grönländischen Küste die Schäden der »Victory« ausgebessert, drang er durch den Lancastersund und die Barrowstraße; doch die Eisbarre zwang ihn, südwärts in die Prinzregentstraße abzubiegen. Er fand hier zu seiner Freude die 1824 von Parry als Wrack zurückgelassene »Fury« mit gut erhaltenen Lebensmitteln und Booten. Am 1. Oktober war er bis zum 70. Grad südwärts gelangt, als ihm auch hier Eismassen ein Ziel setzten. An der Ostküste einer nach Norden vorragenden Halbinsel des nordamerikanischen Festlandes, die er nach seinem Gönner Boothia Felix nannte, richtete er sich für den Winter ein; denn zwei volle Jahre hielt ihn das Eis gefangen; zwei Winter, in denen das Thermometer bis -50°R= 62½°C. fiel. Bei den Wanderungen über die schmale Halbinsel, die er mit geringen Vorräten und wenigen Gefährten unternahm, entdeckte er den durch Beobachtungen an der Magnetnadel vorher berechneten »magnetischen Nordpol« der Erde, jene Stelle, wo die Inklinationsnadel senkrecht steht. Sie liegt unter 70°5'17" n. Br. und 96°46'45" w. Gr. in einer trostlos öden Strecke der Westküste von Boothia Felix; er hißte an diesem für die Wissenschaft wichtigen Punkte die englische Flagge. Zwar gelang es, im Herbst 1831 die »Victory« aus der Eispresse zu befreien, doch unmöglich war es dem alten Seehelden, sie über die westliche Spitze der Halbinsel Boothia Felix hinauszubringen. Er mußte endlich die treue Gefährtin im Stich lassen und trat mit seinen Leuten die Wanderung an über Eis und Felsland nach jener Stelle, wo die »Fury« von Parrys Expedition lag. Hier verbrachten die Nordpolfahrer den vierten arktischen Winter in jenem furchtbaren Klima. Im Sommer 1833 endlich zwängte man sich mit den Booten der »Fury« durch bis zum Lancastersund, hoffend, daß Gott die Mutigen nicht verlassen werde. Ein Schiff zeigte sich, doch vergebens waren alle Anstrengungen, sich bemerklich zu machen. Nach langem, langem Warten erschien ein zweites, das sofort ein Boot aussetzte, sie aufzunehmen. Kein Mensch vermutete, in diesen bärtigen, von Schmutz starrenden, in Eisbärenfelle eingehüllten, bis auf die Knochen abgezehrten Gestalten europäische Landsleute zu finden. »Die ›Isabella‹ von Hull, einst von Kapitän Roß befehligt,« so rief der Steuermann den Ankömmlingen entgegen.1818 hatte John Roß auf der Isabella seine erste Polarfahrt gemacht.
»Der Kapitän Roß bin ich selbst, und das ist die Mannschaft der ›Victory‹«, entgegnete der erstaunte Seeheld. Der Steuermann starrte ihn ungläubig an; Roß hielt er längst für tot, und die »Isabella« war ausgesandt, die Spuren der Verschollenen zu suchen. So fügte es die gütige Vorsehung, daß die beiden Roß nach 4½jährigem Begrabensein im Eise des Nordens die Küsten Altenglands wieder erblickten.
Der Gedanke einer nordwestlichen Durchfahrt ließ trotz der bittern Enttäuschungen die Gemüter nicht zur Ruhe kommen, und die Frage darnach kam wieder in Fluß mit John Franklin, der 1845 mit den Schiffen »Erebus« und »Terror« England verließ. Er war damals 59 Jahre alt und hatte Entdeckungsreisen in Australien und im arktischen Amerika schon ausgeführt. Den tüchtigen französischen Kapitän Crozier zur Seite, mit 129 Schiffsleuten und Vorräten für drei Jahre, so ging er am 26. Mai mit großen Hoffnungen in See. Von Walfängern aus der Baffinsbai erhielt man von ihm Berichte aus dem Juli 1845. Es waren die letzten, die man überhaupt von ihm empfing. Als nach drei Jahren noch keine Nachricht über seine Unternehmung eingegangen war, legte sich die bange Ahnung, daß ihm irgendein Unglück zugestoßen sein müsse, beängstigend auf alle Gemüter. Doch nicht dumpfe Verzweiflung machte sich breit, sondern ein tatkräftiger, rühmlicher Wetteifer, der kein Opfer scheut, den Unglücklichen womöglich Rettung zu bringen, oder mindestens Gewißheit über ihr Schicksal zu schaffen. Man mußte den Vermißten auf dem Wege folgen, der sich nach ihrer Aufgabe vermuten ließ. Drei Möglichkeiten lagen vor: entweder mußte man sie in den Sunden der nordwestlichen Durchfahrt und ihrem Inselgewirre oder an Amerikas Nordküste oder endlich in der Nähe der Beringstraße suchen.
Und aus diesen Umständen erklären sich die zahlreichen Arktisfahrten, die zwar wenig über Franklins Schicksal, viel dagegen für die Wissenschaft ergaben, und die über dreißig Jahre lang den edelsten Wetteifer der Engländer und Amerikaner im Dienste der Menschlichkeit bekundeten.
Im Jahre 1850 waren nicht weniger als 16 Schiffe zur Aufsuchung Franklins unterwegs. Dampfkraft und Pulver sollten ihnen den Weg durch die Welt von Eis bahnen helfen, Kanonendonner den Vermißten Rettung verkündigen, kleine Luftballons sollten Tausende von bedruckten Papierstreifen durch die Lüfte tragen und ihnen die Kunde naher menschlicher Hilfe bringen. Doch nur gering waren die Erfolge der gewaltigen Anstrengungen; von Franklins Leuten fand man nur das letzte Winterlager und drei Gräber auf der kleinen Beecheyinsel am Eingange der Barrowstraße. Unter den 16 Schiffen, welche im Jahre 1850 ihre Tätigkeit begannen, war besonders der ›Investigator‹ unter Mac Clures (spr. mäkluhr) Führung glücklich, insofern er zwar nicht Franklin, wohl aber die von diesem und so manchem andern vergeblich gesuchte nordwestliche Durchfahrt fand.
Mac Clure war der erste Offizier Sir Richard Collinsons, des Befehlshabers der ›Enterprise‹, und beide wollten von der Beringstraße aus, wo zwei Stationsschiffe mit Vorräten ihrer harrten, nach den arktischen Inseln Amerikas vorgehen. Die beiden Schiffe hatten jedoch ganz verschiedene Geschwindigkeit, und so kam es, daß, als Mac Clure in Honolulu (Hawaiiinseln) eintraf, Collinson diesen Hafen bereits verlassen hatte. Um nicht von der Ehre der Entdeckung ausgeschlossen zu sein, nahm Clure einen viel geraderen Weg nach der Beringstraße, fand aber seinen Admiral Collinson nicht vor und machte sich allein an die Lösung der Aufgabe. Am 2. August 1850 umfuhr er Kap Barrow (Nordküste Amerikas), am 9. September erreichte er nach unendlichen Mühen in jener Einöde des Polareises die Südspitze der Insel Banksland, und von hohem Bergesgipfel erblickte er die zwischen Banks- und Prinz-Albertland hindurchführende Prinz-Walesstraße, die in den Melvillesund mündet. Es gelang ihm nicht, in demselben Jahre die Straße ganz zu durchfahren; 7½ geographische Meilen vom Melvillesund entfernt, mußte er inmitten gewaltiger Packeismassen überwintern.
Die Winterzeit benutzte er, um auf dem Schlitten sich seiner Entdeckung zu vergewissern. Doch seine Hoffnung, im nächsten Sommer den »Investigator« vollends zum Melvillesund vorzuschieben, erfüllte sich nicht, weil das Eis sich nicht in Bewegung setzte. Er fuhr rückwärts, um auf der Nordseite von Banksland durch die Banksstraße, die wohl nach ihm auch Mac Clurestraße genannt wird, seine Entdeckung vollständig zu machen. Doch nur mit Pulversprengungen war es möglich, vorwärts zu dringen, und schon am 24. September 1851 fror er wiederum ein, um sich nun volle zwei Jahre aus jenen Eismassen nicht wieder zu entfernen. Auch von hier aus erreichte er auf Schlitten den Melvillesund, fand eine Urkunde von Leutnant Clintock, die ein Jahr früher dort niedergelegt war, und schloß seinerseits ein Schriftstück bei. Als die Vorräte mehr und mehr schwanden, die Zuteilungen für die Mannschaften immer kleiner werden mußten und auch der dritte Sommer keine eisfreie Straße herstellte, da wurde seine Lage verzweifelt. So kam es, daß in einer Beratung am 30. März 1853 beschlossen wurde, daß 26 Mann den Weg übers Eis ostwärts nach der Barrowstraße, sechs dagegen die Richtung südwärts nach dem Mackenzie nehmen sollten, um wieder in bewohnte Gegenden zu gelangen. Der 15. April sollte der Tag des Aufbruches sein. Am 5. hatte Mac Clure seine Briefe geregelt, am 6. aber erscholl plötzlich der Ruf: »Leutnant Pim vom ›Herald‹«. Dieser gehörte einer vom Osten vordringenden Expedition an (Kellet), welche Mac Clures Urkunde auf der Melvilleinsel gefunden hatte. Pim war mit Hundeschlitten zu Hilfe gesandt worden. Mac Clure ließ sein Schiff im Stich und vollendete so 1853 die Durchfahrt nach dem Atlantischen Ozean auf den Schiffen seiner Retter. So war das Rätsel der lange gesuchten Nordwestdurchfahrt fast gelöst. Mac Clure erhielt dafür 200 000 Mark. Collinson aber hatte mit seinem großen schwerfälligen Schiffe die Viktoriastraße und damit in der Nähe von Boothia Felix den dritten Anschluß an die alten Entdeckungen gefunden, da er aber sein Schiff als braver Seemann nicht aufgeben wollte, kehrte er durch die Beringstraße zurück, ohne die Durchfahrt zu vollenden. Obwohl er ihre Möglichkeit auch nachgewiesen hatte, erhielt er nichts von dem ausgesetzten Preise.
Von Franklin freilich wußte man blutwenig. Auf die dringenden Bitten der Gattin des unglücklichen Nordpolfahrers setzten sich 1853 Kapitän Inglefield und Elisha Kane, ein Arzt, an die Spitze einer von dem Amerikaner Grinnell ausgerüsteten Unternehmung, um in dem vermuteten offenen, eisfreien Meere, nördlich von der Baffinsbai, die Forschungen fortzusetzen. Glücklich gelangte die kleine Zahl mutiger Männer in den Smithsund an Grönlands Westküste (78°) und von hier aus auf Schlitten bis zum 82. Grad n. Br.; die Küstenstrecken mit ihren durch herabhängende Gletscher ausgefüllten Fjorden wurden genau untersucht und aufgenommen, die Tier- und Pflanzenwelt, sowie die Temperatur, die Eisbildungen jener Breiten genau erforscht, doch eine Spur der Vermißten suchte man vergebens.
Ihr Schicksal wurde durch John Rae aufgehellt, welcher 1853 auf Boothia Felix mit Vermessungen tätig war: nach den Berichten dortiger Eskimos waren im Frühling 1850 gegen 40 weiße Männer an der (westlich von Boothia Felix gelegenen) König-Williamsinsel gesehen worden, welche mit einem Boote und Schlitten nach Süden zogen. Von ihnen waren später 35 als Leichen in der Nähe des Back- oder großen Fischflusses gefunden worden. Rae brachte auch aus den Händen der Eskimos Gegenstände mit, die sicher einst Eigentum der Franklinschen Expedition gewesen. So stand denn endlich fest, daß Franklin nicht nach Norden und Westen vorgedrungen war, sondern daß er den Weg nach Süden, nach den Stationen der Hudsonsbailänder gesucht. Daraufhin fand am 6. Mai 1859 Leutnant Hobson vom »Fox«, der unter der Führung von Mac Clintock von Franklins Gattin ausgesandt war, auf Point Victory der Nordwestküste von König-Williamsland unter einem Steinhaufen eine Blechbüchse mit einem Schriftstück folgenden Wortlautes:
»Ihrer Majestät Schiffe ›Erebus‹ und ›Terror‹ überwinterten im Packeise am 28. Mai 1847 in 70°5' n. Br., 98°23' w. Gr. Überwinterten 1846-47 auf Beecheyinsel in 74°43'28" n. Br., 91°39'15" w. Gr., nachdem sie im Wellingtonkanal bis 77° hinaufgefahren und an der Westseite der Cornwallisinsel zurückgekehrt waren. Sir John Franklin kommandiert die Expedition. Alle wohl!«
Die Umschrift lautete: »25. April 1848. Ihrer Majestät Schiffe ›Erebus‹ und ›Terror‹ wurden am 22. April 1¼ geographische Meilen nordnordwestlich von hier verlassen, nachdem sie seit dem 12. September 1846 eingefroren waren. Die Offiziere und Mannschaften, bestehend aus 105 Mann, unter dem Befehl von Kapitän Crozier, landeten hier in 69°37'4" n. Br. und 98°4' w. Gr. Dieses Papier wurde durch Herrn Irving unter dem Steinhaufen gefunden, von dem man vermutet, daß er von Sir James Roß 1831 eine geographische Meile nördlich erbaut sei. Hier wurde es niedergelegt durch den verstorbenen Kommandeur Gore im Juni 1847. Sir James Roß' Steinhaufen war nicht mehr vorhanden, dieser Bericht aber da niedergelegt, wo derselbe stand. Sir John Franklin starb am 11. Juni 1847, und der ganze Verlust durch Tod in der Expedition war bis heute 9 Offiziere und 15 Mann. – I. R. Crozier, Kapitän und ältester Offizier, James Fitzjames, Kapitän I. Maj. S. ›Erebus‹, reisen ab, morgen am 26. nach Backs=Fischfluß –.«
Verschiedene Gegenstände: Kleider, Eßwaren, Schaufeln, Kochgeräte, ein Arzneikasten, etwas weiter südlich zwei Boote mit einer Menge von Kleidungsstücken, zwei Menschengerippen, fünf Taschenuhren, silbernen Löffeln und Gabeln, religiösen Büchern und einer geladenen Doppelflinte wurden gefunden; das eine Boot lag an der Südküste von König-Williamsland, gegenüber der Mündung des großen Fischflusses (Backflusses). Was aus den Leuten geworden, darüber herrschte Todesschweigen.
Im Jahre 1878 durchsuchte der nordamerikanische Marineoffizier Schwatka als Führer des »Cothen« nochmals die König-Williamsinsel nach Überresten der Franklinschen Polfahrt. Als das Packeis den »Cothen« festbannte, unternahm er die größte, je gemachte arktische Schlittenreise, die ihn erst nach 11 Monaten und 4 Tagen zu seinem Schiffe zurückgelangen ließ, und auf welcher er 5232 km zurücklegte. Obwohl das Thermometer Anfang des Jahres 1880 wochenlang bis -57°C anzeigte, drang die kühne Schar, nach Eskimoweise lebend, doch unaufhaltsam vorwärts. Die Insel König-Williamsland und die gegenüberliegende Festlandsküste von Nordamerika wurden gründlich untersucht. Man fand noch Gebeine von Franklins Leuten und bestattete sie, aber keinerlei Aufzeichnungen der Unglücklichen. Wie entsetzlich die Leiden der Ärmsten gewesen sein müssen, das erkannte man unzweideutig daraus, daß die Unglücklichen in der äußersten Not das Fleisch der toten Genossen nicht verschmäht hatten. Ihre Aufzeichnungen waren den Eskimos in die Hände gefallen und verloren.
Den Spuren Collinsons folgend und die Rae-Straße, welche König-Williamsland vom Festlande trennt, nach dem Rate Mac Clintocks benutzend, ist es in den Jahren 1903-1907 Roald Amundsen mit nur sieben Leuten an Bord seines kleinen Schiffes Gjöa gelungen, die nordwestliche Durchfahrt in der Richtung von Ost nach West zu erzwingen. Zum Zwecke magnetischer Beobachtungen überwinterte Amundsen auf König-Williamsland im »Gjöahafen« an der Rae-Straße. Schlittenreisen zumeist in Begleitung von Eskimos, von denen die Reisenden den Schneehüttenbau erlernten, brachten Kunde von neuem Lande im Norden, auch der magnetische Pol auf Boothia wurde besucht. Durch die Simpsonstraße südlich von König-Williamsland gelangte die Gjöa in das inselreiche Dronning-Maud-Meer südlich von Viktorialand und dann, längs der Nordküste des Festlandes hinfahrend, glücklich durch die Beringstraße nach dem Goldgräberhafen Alaskas, Nome. Ein Mitglied der sieben Tapferen hatte sein Leben lassen müssen infolge einer Rippenfellentzündung. Bei Königs-Spitze, westlich vom Mackenziedelta, dem Winterlager 1905/6, liegt das Grab Gustav Juel Wiiks. Die Fahrt Amundsens löste endlich die Aufgabe der nordwestlichen Durchfahrt um Nordamerika herum zum Stillen Ozean; Verkehrsvorteile freilich konnte man von dieser Lösung nicht mehr erwarten.
wurde besonders rege durch die Nordamerikaner betrieben. Inglefield und Dr. Kane hatten im Smithsund zwischen Grönland und Ellesmeereland auf der Suche nach Franklin im Norden eisfreies Meer gesichtet und eine Zunahme des tierischen Lebens gefunden. Daraus schloß man, von dort aus in ein weites offenes Polarmeer gelangen zu können, das durch das warme Wasser eines Golfstromzweiges offen gehalten werde. Es gälte nur, die Packeiszone, die davor lagere, zu überwinden und man habe leichte Fahrt zum Pole. Diese wissenschaftliche Täuschung vom offenen zirkumpolaren Meere, die auch der deutsche Gelehrte August Petermann verfocht, führte zu einer Reihe kühner Vorstöße, anfangs besonders durch den Smithsund, die wenigstens die Inselnatur Grönlands zur Gewißheit machten, aber weder das offene Polarmeer noch den Pol fanden.
Der Arzt Isaak Hayes setzte die Forschungen Dr. Kanes fort, indem er 1860 mit ungeheurer Anstrengung längs dem Gestade von Grinnell-Land durch den Kennedykanal und den Packeisgürtel nach Norden vordrang und in morschem Eis und dunklem Himmel Anzeichen der gesuchten »Open Polar Sea« zu finden meinte. Die denkwürdigste Fahrt, die diesem Zwecke diente, wurde unter dem kühnen amerikanischen Kapitän Hall im Jahre 1871 auf dem sorgfältig ausgerüsteten Schraubendampfer »Polaris« ausgeführt. Von Deutschen begleiteten ihn: der Ingenieur Emil Schumann, der Arzt und Naturforscher Dr. Emil Bessels aus Heidelberg, der den Reisebericht schrieb, und der Meteorolog Friedrich Meyer. Auch unter den Matrosen waren zahlreiche Deutsche. Dazu kamen die wegkundigen Begleiter Kanes und Hayes, der Steuermann Morton und der Eskimo Hans Hendrik. Außerdem bewog Hall eine Eskimofamilie zur Mitfahrt: Joseph, Hannah und Pannik: Vater, Mutter und Tochter, die als Dolmetscher und als Jäger gute Dienste leisten sollten. Von Neuyork stach die »Polaris« am 29. Juni 1871 in See, gelangte an der Westküste Grönlands entlang schon am 24. August in den Smithsund und arbeitete sich in dem engen Robesonkanal zwischen Eismassen bis 82°26' durch, eine bisher von keinem Schiffe erreichte Leistung. Hier jedoch war das Glück des Sternenbanners zu Ende. Nebel und Eis drohten dem Schiffe den Untergang, aber aus dem Mastkorbe hatte man nordwärts offenes Fahrwasser gemeldet und taufte die weite Meeresfläche Lincolnsee.
Im »Gottseidankhafen« an Grönlands Westküste überwinterte man in 81°38' n. Br. Ringförmige Bauten, Harpunen, Lanzenspitzen und Schlittenkufen deuteten darauf hin, daß das menschliche Leben auch in diesen Breiten nicht ganz erstorben war; Moschusochsen, Eisbären, Füchse, Lemminge boten reiche Jagdbeute; ja selbst Bienen und Schmetterlinge fehlten nicht; im Sommer kleidete eine Moosdecke den Boden, durchwebt von rot- und blaublühenden Alpenpflanzen. Starkes Treibholz lieferte ausreichend Brennstoff. Den anstrengenden Eismärschen erlag Hall am 7. November 1871. Kapitän Buddington übernahm an seiner Statt den Oberbefehl. Seine Bemühungen, im Sommer 1872 nordwärts vorzudringen, mißglückten, zumal die »Polaris« leck geworden war. Mit schwerem Herzen kehrte man um an der Pforte des offenen Polarmeeres – wie man meinte. Bis zum 15. September zwängte man das Schiff durchs Eis; dann mußte man es verlassen. Man brachte Instrumente und Vorräte aufs Eis. Da brach plötzlich die gewaltige Scholle, und 19 Personen, darunter neun Eskimos, die zufällig auf dem abgebrochenen Eisfelde waren, trieben darauf mit dem Sturme südwärts, und bald waren Schiff und Gefährten ihren Blicken entschwunden.
Kapitän Tyson, Obersteward Heron, der Meteorolog Friedrich Meyer, sieben Matrosen und neun Eskimos – unter ihnen Hans Hendrik mit seinem einen Säugling nährenden Weibe – bildeten die Besatzung des wunderlichen Wracks. Der Mundvorrat für diese Gesellschaft von 14 Erwachsenen und fünf Kindern betrug 800 Pfund, während der Feuerungsvorrat – zwei Säcke Kohlen – kaum einige Tage ausreichen konnte. Da man nicht wußte, wie lange man von menschlicher Hilfe entfernt sein konnte, beschloß man, täglich nur zwei karge Mahlzeiten zu halten, die über einer Tranlampe erwärmt wurden. Besonders lästig war den unfreiwillig Reisenden der Wassermangel, welcher die Reinlichkeit fast unmöglich machte. Die Hütte auf dem schwimmenden Eisfelde war namentlich zur Zeit der Dunkelheit und des Schneegestöbers ein unheimlicher Ort. Als im November der Eskimo Joseph so glücklich war, einige Seehunde zu erlegen, war das blutreiche Fleisch ein rechtes Labsal, und eine zweite Tranlampe machte die Hütte wohnlicher hinsichtlich des Lichtes wie der Wärme. Doch die Polarnacht verbot ihnen endlich auch die Jagd, und bald trat das Gespenst der Hungersnot drohend vor ihre Augen; auf Licht und Wärme mußte man ebenfalls verzichten. Am Weihnachtsfest saßen die 19 Menschen hungernd, frierend, in Schmutz starrend in ihrer Hütte; ein bis zwei Lot zurückgelegter Schinken, ebensoviel Zwieback, fünf Lot Pemmikan und etwas gefrorenes Seehundblut bildeten ihr Weihnachtsmahl. Am 1. April 1873 trat zu den ihnen längst vertrauten Gefahren ein furchtbarer Sturm, ihre Eisscholle wurde zertrümmert, und das nasse, eiskalte Wasser nahte sich drohend ihrer Hütte. Als die Scholle immer kleiner und kleiner wurde und kein anderes Eisfeld sich zeigen wollte, sprangen sie ins Boot, um das im Westen vermutete Packeis zu erreichen. Doch das für sechs Personen berechnete, aber mit 19 Mann belastete Fahrzeug konnte nur dadurch über Wasser erhalten werden, daß man Bettzeug und Mundvorrat – freilich mit blutendem Herzen, über Bord warf. Sobald man eine nur irgendwie geeignete Scholle fand, sprangen die Männer darauf – nur Frauen und Kinder ließ man im Boote – und trieben so nach Süden. Die Jagd war im April wenig ergiebig, der Hunger wütete in den Eingeweiden, die Scholle schmolz wiederum zusammen, so daß man jeden Augenblick gefaßt sein mußte, ins Boot zurückzukehren. Sieben Monate war man nun unterwegs, und aus 77° n. Br. war man in die Nähe des 54. gelangt. Schon zeigte sich hie und da die Küste von Labrador und endlich auch die Rettung. Der englische Walfänger »Tigress« nahm die Schollenfahrer auf, und sie trafen sämtlich wohlbehalten in Washington ein. Ihre 14 Genossen von der »Polaris« hatten aus dem lecken Schiffe zwei Boote gezimmert, waren nach Süden gefahren und wurden in der Melvillebai von einem schottischen Walfischfänger gerettet.
Eine 1875 ausgefahrene englische Expedition unter Kapitän Nares drang von Grantland aus bis 83°20'26" vor, fand nichts als gewaltige Eismassen statt des gesuchten Seeweges zum Pole und faßte ihren Mißerfolg in das Telegramm zusammen: The North-Pole impracticable, der Nordpol ist unerreichbar. Doch zeigten Schlittenreisen, daß die grönländische Küste rasch nach Osten umbog, eine Stütze mehr für die Ansicht, daß Grönland eine Insel sei.
Auch die amerikanische Forschungsreise in den Smithsund unter Leutnant Greely scheiterte vollständig. Der tapfere Leutnant Lockwood drang zwar bis 83°30½' nach Norden vor, fand aber 1883 bei Kap Sabine auf Ellesmoreland den Hungertod mit vielen seiner Gefährten, nur 6 von 25 kehrten mit Sammlungen und Küstenaufnahmen zurück.
Erst dem amerikanischen Marineingenieur Peary glückte es, die Inselnatur Grönlands festzustellen. Seit 1891 ist der kühne Mann jahrelang in Nordgrönland tätig gewesen, hat bei 83°39' die Nordspitze Grönlands gefunden und ist Schritt für Schritt polwärts vorgedrungen. Die Umsegelung Grönlands, die der Norweger Kapitän Otto Sverdrup vom Smithsund aus 1898-1902 erzwingen wollte, gelang nicht, dafür fand er »neues Land« im Westen von Ellesmoreland: König Oskar-Land, Axel-Heibergland usw. Peary aber, der am 20. April 1906 schon eine Breite von 87°6' erreicht hatte, aber wegen Nahrungsmangels und Ermattung umkehren mußte, konnte nach über zwanzigjähriger, immer wiederholter Anstrengung im Frühjahr 1909 seinen Ehrgeiz, den Pol zu erreichen, durchsetzen. Mit seinem treuen Schiffe »Roosevelt« war er im Sommer 1908 durch den Kennedy- und Robesonkanal glücklich bis Kap Sheritan auf Grantland gekommen und dort eingewintert. Schon am 15. Februar 1909 verließ er mit Schlitten das Schiff und fuhr erst an der Küste von Grantland bis zu dessen Nordspitze, dem Kolumbiakap. Und dann ging es übers Meereis nordwärts; vom 2.-11. März verlor der kühne Mann viel Zeit durch Rinnen offenen Wassers, ebenso am 15. März nördlich von 84° – am 29. März jenseit 87°. Am 2. April überschritt er den 88. Breitengrad, den 89. am 4. April und am 6. April 1909 stand er am Nordpol und pflanzte das Sternenbanner auf dem beweglichen Eise auf. Auch die Rückfahrt ging glücklich von statten. Nur ein Mitglied dieser letzten Pearyfahrt hatte infolge eines Unglücksfalles an einer offenen Rinne im Eise seinen Tod durch Ertrinken gefunden. »Der wahre Forschungsreisende tut sein Werk nicht in der Hoffnung auf Lohn oder Ehre, sondern weil die Sache, die er sich vorgenommen, einen Teil seines Wesens bildet und nur um ihrer selbst willen ausgeführt werden muß.« (Peary am 15. Dezember 1906.)
* * *
Der deutsche Geograph August Petermann hatte wohl den Gedanken des offenen Polarmeeres verfochten, aber den Weg durch den Smithsund von Anfang an für verkehrt gehalten. Als nun die Amerikaner trotz wiederholter Vorstöße dort wirklich keinen Erfolg hatten, drang er um so mehr darauf, daß sein Rat, zwischen Grönland und Nowaja Semlja zum Pole vorzudringen, von den Deutschen befolgt werde. Auf dem ersten deutschen Geographentag 1865 in Frankfurt a. M., der unter Petermanns Leitung stand, faßte man denn auch den Entschluß, für das nächste Jahr eine deutsche Nordpolfahrt auszurüsten, die freilich, abgesehen von einer mißlungenen Vorbereitungsfahrt 1865, wegen des 66er Krieges erst 1868 zur Ausführung kam. Aber die Unternehmung des Kapitäns Koldewey auf der kleinen Jacht »Germania« erreichte nicht viel, so daß 1869 auf Petermanns Betreiben eine neue größere »Germania«, ein Dampfer, und mit ihr ein Segelschiff, die »Hansa«, von neuem in See stachen, der Dampfer unter Koldewey, der Segler unter Kapitän Hegemann. Sie sollten an der Ostküste Grönlands möglichst weit nach Norden vorzudringen suchen, dabei Lage und Natur des Landes aufhellend. Am 20. Juli aber, als dichter Nebel das Meer bedeckte, wurden die beiden Schiffe für die ganze Dauer der Expedition voneinander getrennt. Die »Hansa« blieb im Treibeis der Ostküste festsitzen und trieb darin südwärts, bis sie zerdrückt sank. Lassen wir uns das Schicksal der Hansamannschaft durch ihren ersten Steuermann Hildebrandt selbst erzählen:
»Unser erster Versuch, die Küste zu erreichen, mißlang. Wir waren nur so weit westlich vorgedrungen, daß wir die Ostküste Grönlands in schwachen Umrissen sahen, und da wir, mit dem Eisstrome immer weiter südlich treibend, nicht darauf rechnen konnten, durch die dichten Eismassen und eng aneinander liegenden Eisberge hindurchzukommen, steuerten wir weiter, dem freien Wasser im Osten zu, um dort nördlicher zu gehen und einen zweiten Vorstoß zur Küste hin zu versuchen. Die »Germania« hatte, wie sich später ergab, während dieser Zeit an der Eisgrenze gelegen und war, als wir das freie Wasser gewonnen hatten, in den Eisgürtel hineingegangen. Auch sie hatte das nämliche Mißgeschick wie wir, sie mußte wieder hinaus in das offene Meer, um einen zweiten Versuch zu wagen. Zu derselben Zeit saßen wir aber schon wieder tief im Eisgürtel und hatten etwa nur noch sieben bis acht deutsche Meilen bis zur Küste zurückzulegen, als wir dermaßen von dem Eise erfaßt wurden, daß ein Entrinnen unmöglich wurde. Wir kannten die Gefahren, die uns drohten, allein wie sollten wir uns dagegen schützen?
Einige Wochen hatten wir schon so dagelegen und waren mit dem ganzen Eislabyrinth mehrere Grade nach Süden getrieben. Manche Schneestürme hatten ungeheure Schneemassen über uns ausgeschüttet und das Eis in die heftigste Bewegung gebracht, ohne jedoch dem Schiffe Schaden zu tun. Allein es war unmöglich anzunehmen, daß es auch ferner so gehen würde; die hohen Eisdämme und Eisfelder, die uns umschlossen, mußten dem Schiffe endlich verderblich werden. Wir beschlossen daher, um für alle Fälle gerüstet zu sein, aus den Steinkohlenbriketts, welche wir für die »Germania« mitgenommen hatten, auf der größten der neben uns liegenden Schollen ein Haus aufzubauen.
Ende September begannen wir dieses eigentümliche Bauwerk aus Schnee, Wasser und Kohlen und beendeten es zu unserer nicht geringen Freude am 16. Oktober. Wir hatten für uns 14 Mann eine Art Stall errichtet, der mit seinen schwarzen niedrigen Mauern auf dem weißen Schneefelde allerdings einem Sarge ähnlicher sah als einer Behausung. Kaum hatten wir für das Haus, welches 6 m lang, 4 m breit und 2 m im Giebel und ohne Fenster war, eine Tür gemacht, als auch die Stunde des Unterganges der »Hansa« geschlagen hatte. Am 19. Oktober, als wir gerade unsere gewöhnlichen Tageseinträge über Wind und Wetter machen wollten und draußen der Schneesturm mit seiner ganzen Kraft tobte, fing das um uns liegende Eis dermaßen an zu tosen und gegen das Schiff zu pressen, daß die Balken zu brechen drohten, die Deckplanken sich bogen und das Pech wie Staub aus den Nähten sprang. Wir eilten auf das Verdeck, das Schneetreiben ließ uns nicht die allernächste Umgebung erkennen. Wir hörten nur das Seufzen und Stöhnen des Schiffes und fühlten, wie es bei jeder neuen Pressung unter unseren Füßen bebte. Dann war es wieder einen Augenblick still, und nur die umgebenden Eismassen hörte man sich auftürmen und wieder zusammenstürzen. Schon glaubten wir der Gefahr entronnen zu sein, als neue Eismassen gegen das Schiff andrängten. Diesen neuen Pressungen konnte es nicht widerstehen; 4 m hoch und fast 2 m querfeldein geschoben, sank es, als die Eismassen sich auseinander taten, als Wrack in das Wasser zurück, um nach 36 Stunden auf dem Meeresgrunde zu ruhen.
Wir hatten diesem Schiffsunglück natürlich nicht mit müßigen Händen zugesehen. War anfänglich nur eine geringe Menge Mundvorrat auf die Scholle geworfen worden, so lag jetzt schon ein großer Teil darauf, und hierzu Zeug, Feuermaterial, ein großes Faß Seehundsspeck, Seehunds- und Eisbärenfelle, der Kochherd, die drei Boote, überhaupt alles, was in der Eile aufgerafft werden und uns von Nutzen sein konnte. Nach dem Verschwinden der »Hansa« war unsere nächste Arbeit, die neue Wohnung besser und wohnlicher zu gestalten. Nach acht Tagen hatten wir es auch so weit gebracht, daß uns, obgleich die Kopfkissen noch an den Haaren festfroren, doch wenigstens nicht mehr vollständige Sturzbäder von dem lecken Dache ins Gesicht flossen.
Mit der Zeit wurde unsere Ansiedelung immer wohnlicher. In der Mitte stand das Wohnhaus, links dahinter ein Schneehaus, nicht weit davon ein anderes, welches als Waschhaus diente; dann standen die drei Boote verteilt, und endlich war, um bei unsern langen Spaziergängen nicht die Richtung zu verlieren, ein Flaggenstock aufgepflanzt, die vormalige Bramstange der »Hansa«. So trieben wir mit unserm ganzen Haushalt auf einem Eisgrund immer südlicher und an der ostgrönländischen Küste entlang, ohne jemals den Versuch, sie zu erreichen, glücken zu sehen. Um uns frisch und gesund durch Tätigkeit zu erhalten, wurde eine stetige Arbeitszeit eingehalten und befolgt. Arbeit war auch immer genug da. Bald waren wir so tief eingeschneit, daß wir keinen Ausweg finden konnten. Dann wurde ein unterirdischer Gang von ungefähr 8 m Länge zur Oberfläche geschaufelt; bald waren die Boote mit Schnee bedeckt und mußten wieder ausgegraben und von neuem segelfertig gemacht werden. Es wurden Rundhölzer zum Heizen zerhauen, Matten über unseren Eisboden geschlagen usw. Es galt nun einmal, unser Leben auf alle Weise zu erhalten. Jeder legte daher selbst gern Hand an, um alles das zu besorgen, was zu unserem Unterhalt not tat. An schönen Tagen machten wir lange Streifzüge über das Eis, um Jagd auf Bären oder anderes Getier anzustellen zur Vermehrung unserer Vorräte.
Unaufhaltsam trieben wir mit der Scholle und zwar, abgesehen von den häufigen Schneestürmen, ohne Ungemach weiter und hatten das neue Jahr 1870 schon begrüßt, als wir aus unserem ruhigen und geregelten Leben auf eine höchst unangenehme Weise herausgerissen werden sollten. Der 2. Januar 1870 brachte abermals einen schweren Schneesturm, so daß in Zeit von fünf Minuten unser Feld, welches einen Umfang von zwei deutschen Meilen, eine Stärke von ungefähr 18 m hatte, bis auf den achten Teil der ganzen Größe verkleinert ward. Unser Wohnraum, der nur 400 Schritte von dem Rande stand, blieb aber glücklicherweise unversehrt. Aber schon einige Tage darauf sollte unsere kleine Scholle, die inzwischen mehr und mehr ein Spielball der sie umgebenden größeren war, gerade zu brechen, wo unsere Ansiedelung stand. Der Bruch ging quer durch den Boden unseres Hauses. Wir flüchteten so, wie wir waren, auf einen noch fest zusammenhängenden Teil der Scholle.
Jetzt war guter Rat teuer. Soweit Nacht und Schneegestöber uns zu sehen gestatteten, wirbelten Eismassen durcheinander, welche uns jeden Augenblick erdrücken konnten. Wir wurden mit unserer Scholle hinaus in ein großes, eisfreies Wasser gedrängt, wo unser Grund und Boden ein Spiel der Wellen und der Dünung wurde. Beim Heben durch die Wellen brach ein Stück nach dem andern durch die eigne Schwere ab. Und doch wäre ein Verlassen der Scholle zu Boot sicher unser Untergang gewesen.
Nachdem wir drei Tage so umhergetrieben und unter freiem Himmel ohne jegliches Obdach dem Sturme Trotz geboten hatten, legte sich das Unwetter. Sogleich wurde die günstige Zeit benutzt, um aus dem Rest des alten Hauses ein neues aufzubauen. Am Morgen fingen wir diesen Bau an, des Abends war er fertig und wurde bezogen. Aber der neue Aufenthalt bot im Vergleich zu unserer früheren, mit einer gewissen Behaglichkeit ausgestatteten Ansiedelung einen traurigen und ärmlichen Anblick dar. Eßgeschirr, Kleidungsvorrat, Bettzeug usw., davon war keine Spur mehr zu finden. Alles das war mit dem alten Hause zugrunde gegangen. Die übriggebliebenen Steinkohlenwände lieferten Feuerung; denn unser Holzlager war verschwunden. Indes so gut es ging, setzten wir uns auf der kleinen Scholle wieder in erträglichen Zustand. Bären-, Seehunds- und Walroßspeck dienten auch zum Leuchten und Heizen, das Fleisch dieser Tiere ergänzte den zusammengeschmolzenen Mundvorrat. Im März gerieten wir mit unserem Stück Treibeis in einen Malstrom, in welchem wir das Vergnügen hatten, vier Wochen hindurch uns im Kreise herumzudrehen, bis wir endlich durch einen günstigen Wind herausgesetzt wurden und unser Eisfloß seine Reise weiter nach der Südspitze Grönlands antreten konnte. Die Nächte wurden allmählich kürzer, und mit den längeren und wärmeren Tagen stärkte sich unsere Hoffnung auf endliche Rettung.
Wir hatten uns mehr und mehr einem Küstenstriche genähert, wo wir erwarten konnten, Eingeborene zu treffen. Unserem bis auf ein Restchen verminderten Stück Eis trauten wir den Widerstand gegen einen schweren Sturm nicht mehr zu. Wir beschlossen daher, bei der nächsten Gelegenheit, d. h. sobald sich zwischen den Schollen Kanäle bilden würden, breit genug, um unsere Boote hindurchzubringen, aufzubrechen und zu versuchen, die Küste zu erreichen.
Am 7. Mai 1870 bot sich uns eine solche Gelegenheit dar. In wenigen Stunden waren wir mit unseren drei Booten fahrtbereit und hatten unsere treue Scholle, die uns sieben Monate auf ihrem Rücken über 300 deutsche Meilen nach Südwest getragen hatte, verlassen. Die ganze Ansiedelung trieb herrenlos weiter und wurde später an der Westküste von Eskimos getroffen und besucht, die noch einige zurückgelassene Gegenstände vorfanden. Wir hegten die größte Hoffnung, binnen kurzer Zeit landen zu können; aber auch hierin sollten wir uns täuschen. Der Wind, anfänglich Südwest, setzte nach Nordost um, und schon nach kurzer Zeit lagen wir wieder eingeschlossen mit unseren Booten auf einer anderen Stelle. Harren auf Änderung war ebenfalls vergebens. Die Vorräte gingen auf die Neige, und Ersatz war nicht mehr aufzutreiben, da sich keine Spur von Tierleben zeigte. Wohl oder übel mußten wir den letzten Versuch, unser Leben zu retten, unternehmen. Er bestand darin, die Boote über das Eis hinweg bis zur Küste, zwischen deren Klippen wir freies Wasser vermuteten, zu ziehen. Unter welchen unsäglichen Anstrengungen und Mühen dies endlich gelang, ist kaum zu schildern. Man denke sich in die Lage eines Menschen, der vier Wochen lang unter freiem Himmel in den arktischen Gegenden, Wind und Wetter preisgegeben, täglich die anstrengendsten Arbeiten verrichten muß, ohne des Nachts Ruhe zu haben, ohne dem hungrigen Magen seine Befriedigung angedeihen zu lassen, der dazu gelegentlich schneeblind wird und endlich auch zeitweise keinen trockenen Faden auf dem Körper hat!
Endlich am 4. Juni kamen wir, die Boote Schritt für Schritt hinter uns herschleppend, an der Küste an. In unseren Hoffnungen, freies Fahrwasser zu finden, hatten wir uns nicht getäuscht; es war eine ziemlich freie fahrbare Straße vorhanden. Wir machten an einer Insel Halt, um ein kärgliches Mahl einzunehmen und einige Seevögel zu schießen. Nach einer mehrstündigen Jagd hatten wir eine Mahlzeit für 14 Mann erbeutet.
Unsere Fahrt nach Süden ging jetzt in Booten weiter. Es war noch ein siebentägiges langes Umherirren zwischen Eisklippen und Fjorden, ehe wir die Nordspitze des Kap Farewell erreichten und zu der Eskimo-Ansiedelung Friedrichstal gelangten. Hier wurden wir zu unserer freudigen Überraschung von zwei deutschen Herrnhuter Missionaren begrüßt und aufgenommen. Wir 14 Schiffbrüchigen waren nach achtmonatigen Rettungsversuchen und grauenvoller Schollen- und Bootfahrt gerettet!«Vergl. S. 14 die Schollenfahrt der Polaris.
Die Germania war unterdessen (1869) bis 75½° und die Mannschaft 1870 in Schlitten bis 77° n. Br. vorgedrungen, wo das König-Wilhelmsland, der Franz-Josephs-Fjord, die Petermannspitze usw. an der Ostküste Grönlands an ihre Tätigkeit erinnern. Koldewey war so glücklich, auf der Kuhninsel Kohlenlager zu entdecken, die gerade für die Forschung in jenen Breiten von weittragender Bedeutung sind. Am 10. September 1870 kehrte die »Germania« von dieser wissenschaftlichen Nordpolfahrt zurück, ohne jede Ahnung, daß inzwischen der große Krieg ausgebrochen war.
Waren auch die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben, war vor allem das eisfreie Meer um den Pol nicht aufgefunden worden, so ließ sich doch der Geograph Petermann in Gotha nicht beirren, und auf sein Betreiben kam mit Hilfe der hochherzigen österreichischen Grafen Zichy und Wilczek die berühmte Nordfahrt des »Tegetthoff« unter Payer und Weyprecht zustande. Als äußerstes Ziel schwebte ihr die nordöstliche Durchfahrt vor, also von Nowaja Semlja ostwärts vorzudringen, womöglich bis zur Beringstraße. Petermann wies auch darauf hin, daß durch den warmen Golfstrom zwischen Spitzbergen und Nowaja Semlja wahrscheinlich eine offene Zufahrt zum »Polarmeere« sei, eine Gasse zum Pole. Am 13. Juni 1872 begann die Fahrt des gut ausgestatteten Schiffes, das außerdem drei Boote und sechs für Eisfahrten eigens gebaute Schlitten mit sich führte. Am 3. Juni war der »Tegetthoff« in Tromsö, am 21. August verließ er, nach abermaliger Einnahme von Mundvorrat und Kohlen die Bäreninsel, um auf drei Jahre gänzlich den Augen der Welt zu entschwinden. Bald war er vom Treibeis eingepreßt für lange Zeit. Das mächtige Schiff wurde in die Höhe gepreßt, drohte umzustürzen, und dazu kam am 28. Oktober die 109tägige arktische Nacht. Erst am 16. Februar 1873 erschien die Himmelskönigin wieder am Horizont, und am 25. desselben Monats gab das Eis seine Beute frei. Durch die Südwinde des August wurden die kühnen Forscher nach Norden getrieben in ein Gebiet, das wohl noch nie ein europäisches Schiff durchfurcht hatte. Plötzlich stieg am 31. August 1873 eine hoch über die Meeresflache emporragende Landmasse vor ihren Augen auf. Mit dreimaligem Hurra begrüßte man sie und nannte das neue europäische Inselreich Kaiser-Franz-Josephs-Land. Doch erst Ende Oktober konnte man es betreten, da Wind und Eis jeden Landungsversuch verhinderten.
Die Forscher verbrachten hier den zweiten Winter. In einer Schneehütte barg man die wissenschaftlichen Geräte, und es begannen nun Himmels- und Wetterbeobachtungen und magnetische Messungen. Namentlich fesselte das Auge die Pracht des in allen Farben und Formen erscheinenden Nordlichts. Erst im Frühjahr 1874 nahm die Durchforschung des Landes ihren Anfang und zwar zu Schlitten. Es war ein vergletschertes Hochland, fast ohne jedes Leben, ganz selten nur trat das bloße Gestein, vorwiegend Basalt, zutage, sonst war es überall in den Eispanzer gezwängt. Die Temperatur fiel bis zu -50°C. Alle Kleidungsstücke froren bei diesen Streifzügen infolge des Schneegestöbers steif wie Blech. Die Hunde waren bis auf drei tot oder dienstunfähig; so spannten sich denn die Männer – unter ihnen Kapitän Payer – selbst vor den mit 16 Zentnern belasteten Schlitten, um Ausdehnung und Natur des Landes zu erforschen. Es bestand aus zwei Hauptinseln, Wilczekland im O. und Zichyland im W., welche durch einen Sund getrennt sind. Reich an Fjorden und schöngeformten Bergzügen, war es doch arm an Häfen, arm an Pflanzen, und die einzigen Lebewesen waren Eisbär, Polarfuchs, Seehund und Alk. Die höchste erreichte Breite betrug 82°5' und lag 160 deutsche Meilen vom Standpunkte des »Tegetthoff« entfernt. Am 20. Mai 1874 begann die Heimreise und zwar, da das Schiff im Eise festsaß, in Booten und Schlitten. Am 16. August – nach 96 Tagen voller Gefahren und Abenteuer – erblickten sie Nowaja Semlja, wo zwei russische Fischer sich ihrer annahmen und sie nach Vardö (an der norwegischen Nordküste) brachten. Am 3. September meldete der Telegraph von Hammerfest aus der harrenden Welt ihre Heimkehr.
Die Forschungen der deutschen Expedition unter Koldewey 1870 hatten die schwer zugängliche Ostküste Grönlands bis 77° n. Br. bekannt gemacht. Von Norden aber hatte der unermüdliche Peary die Aufklärungsarbeit auf zahlreichen Fahrten soweit gefördert, daß die Inselnatur Grönlands als festgestellt angesehen werden konnte. Nun galt es noch, das letzte Stück der Ostküste von Kap Bridgman auf Pearyland unter 83½° bis zum Kap Bismarck auf König-Wilhelmsland unter 77° zu entschleiern. Diese Aufgabe löste die »Danmark«-Expedition unter Dr. L. Mylius-Erichsen 1906 bis 1908. Drei tapferen Männern aber, dem Führer selbst, dem Oberleutnant Höegh-Hagen und dem Grönländer Jörgen Brönlund kostete das kühne Unternehmen das Leben: auf der Rückwanderung wurden die Forscher durch brüchiges Eis und tiefeingeschnittene Fjorde so lange aufgehalten, daß ihre Vorräte ausgingen und sie als Helden und Märtyrer der Polarforschung durch Hunger und Entkräftung im Grönlandeise ihr Grab fanden. Die Tagebücher wurden bei der Leiche Brönlunds, der am längsten ausgehalten hatte, gefunden; die Leichen der beiden andern Forscher behielt das tückische Inlandeis als Opfer zurück.
längs der Nordküste Asiens zum Stillen Ozean, damit zu Chinas, Japans und Indiens Küsten war nach verschiedenen Versuchen der Engländer besonders das Ziel der Holländer, die einen Preis von 25 000 Gulden für diese Entdeckung ausgesetzt hatten. Aber auch ein Willem Barents kam nicht weiter als bis Nowaja Semlja, wo er mit fünf seiner Leute dem Skorbut erlag im Jahre 1597, nachdem er die Bäreninsel und Spitzbergen entdeckt hatte.
Die russische Eroberung Sibiriens mit Hilfe der Kosaken führte 1654 zur Auffindung der Beringstraße durch den Kosaken Deschnew, der die Ostspitze Asiens von der Tschuktschenhalbinsel bis ins Beringmeer umsegelte. Aber erst durch die Expedition Peters des Großen unter dem Dänen Vitus Bering 1725 wurde die wichtige Pforte zum Sibirischen Eismeere bekannt und benannt. Nachdem von 1734-43 die Russen in vielen Teilunternehmungen, an denen auch hervorragende deutsche Gelehrte beteiligt waren, das Nordgestade Asiens aufgeklärt hatten, nahmen sie auch das Rätsel der nordöstlichen Durchfahrt wieder auf, nicht mehr, um einen Wasserweg nach China und Japan, als vielmehr zu ihrem neuen Besitz Sibirien zu suchen, in dessen reichen Stromläufen man günstige Zugänge von Norden ins Innere erhoffte. Durch die Beringstraße drangen die Russen nach des Engländers James Cook Einfahrt 1778 verschiedene Male ins sibirische Eismeer ein, doch ohne für die Lösung der Aufgabe der Durchfahrt Erhebliches zu leisten. Auch vom Lande aus drangen Russen nordwärts wiederholt vor. Der Weg von Europa aus, den die Holländer versucht hatten, war gewöhnlich nur bis ins Karische Meer schiffbar, so daß der Erforscher Nowaja Semljas, der Naturforscher Karl Ernst von Baer, 1837 den eigentümlichen Ausdruck »Eiskeller des Nordpols« dafür prägte, obwohl damals schon die russische Küstenbevölkerung im Sommer einen gewissen Schiffsverkehr bis zu den sibirischen Strömen Ob und Jenissei unterhalten hatte.
Da das schiffbare Gebiet des Ob, Jenissei und der Lena einen Handelsbezirk darstellt weit größer als Europa, da die Güter dieses Landes (Getreide, Fleisch, Talg, Häute, Flachs, Holz, Metalle, Graphit, Salz, Pelzwaren, chinesischer Tee) Europa viel leichter zugänglich gemacht werden konnten, wenn es gelang, sie aus den Mündungen der Ströme jährlich auf dem Seewege nach Europa zu bringen, ruhte die Frage nicht.
Als im Jahre 1869 die norwegischen Robbenfänger Carlsen und Johansen das Karische Meer eisfrei gefunden hatten, zeigte sich der Unternehmungsgeist besonders tätig, um durch den schwedischen Seemann und Gelehrten Adolf Erik Nordenskjöld zum Siege geführt zu werden. Bereits geübt in Polarfahrten, verließ er das erstemal am 8. Juni 1875 Tromsö auf dem Segler »Pröven«, den ihm der Großkaufmann Oskar Dickson in Göteborg zur Verfügung gestellt hatte. Obwohl er bereits am 22. Juni an die Pforten des Karischen Meeres (Karische und Jugorstraße) klopfte, taten sie sich doch erst am 2. August auf. Er stach ins Karische Meer und landete am 15. desselben Monats an der Mündung des Jenissei, wo er im Dicksonhafen eine gute Stelle für künftige Landungen fand. Von hier aus nahm er seinen Weg in kleinerem Fahrzeug den Jenissei hinauf und dann zu Lande nach Petersburg und Schweden zurück.
Um zu zeigen, daß die »Handelsstraße nach Nordsibirien eröffnet sei« und seine glückliche Fahrt nicht bloß Spiel des Zufalls gewesen, legte er auf dem Dampfer »Ymer« vom 25. Juli bis 18. September 1876 denselben Weg in einem Sommer mit demselben Glücke zurück.
Diese Fahrten brachten Nordenskjöld zu der Überzeugung, daß die nordöstliche Durchfahrt, damit die Umsegelung Asiens eine lösbare Aufgabe sei, wenn nur die rechte Zeit wahrgenommen würde, da das Küsteneis von dem warmen Sommerwasser der sibirischen Ströme aufgelockert und nach Norden geführt wird. Mit Hilfe des opferwilligen Dickson, des reichen russischen Goldwäschereibesitzers Sibiriakow und des schwedischen Königs Oskar II. konnte er mit der »Vega« und drei anderen Schiffen die Fahrt am 25. Juli 1878 antreten. An der Mündung des Jenissei, die man ohne Hemmung durch Eismassen am 6. August erreichte, fand eine Trennung des kleinen Geschwaders statt; zwei Schiffe kehrten mit der Ladung heim, während »Vega« und »Lena« dem fernen Ziele zusteuerten. Bald traten ihnen in dem undurchdringlichen Nebel, den zahlreichen, bisher auf keiner Karte verzeichneten Inselreihen, dem seichten Fahrwasser dazwischen, bedeutende Hindernisse entgegen. Doch schon am 19. August hatte man mit dem Kap Tscheljuskin 77°42' n. Br. den nördlichsten Landvorsprung der alten Welt erreicht, am 27. August warf man in der Lenamündung Anker. Hier trennte sich auch der letzte Gefährte von der »Vega«, indem die »Lena« ihrem Ziele Irkutsk nach Süden zusteuerte.
Am 4. September trat die »Vega« ein in die Welt des Eises; rastlos drang das ausgezeichnete Fahrzeug vorwärts, überwand Kaps, die man früher von Osten her vergebens zu umschiffen versucht hatte, bis es endlich am 28. September, nur 180 km von der Beringstraße entfernt, festgekeilt wurde. Nordenskjöld richtete das Winterlager ein, um es 295 Tage (vom 28. September 1878 bis Juli 1879) nicht zu verlassen. Mit meteorologischen und magnetischen Beobachtungen, kartographischen Aufnahmen der Küsten, Studium der Tschuktschenbevölkerung verbrachte man in nützlicher Weise die lange Zeit. Im Juli 1879 endlich entfloh die »Vega« der Eispresse, fuhr am 29. ein in die Beringstraße, und am 2. September warf sie Anker im Hafen von Jokohama, um durch den Suezkanal die Fahrt um die alte Welt zu vollenden. Überall wurden Nordenskjöld und sein Stab begrüßt als Helden der Seefahrt und der Erderforschung. Widerlegt war also die Ansicht von einem sibirischen, in ewiger Erstarrung befindlichen Meere von Eis, dem sibirischen Handel war ein neuer – wenn auch jährlich nur sechs Wochen fahrbarer – Weg eröffnet, die alte Welt umfahren, Erdkunde und Naturwissenschaft bereichert.
Leider hatte diese überaus glückliche Expedition ein schreckliches Nachspiel. Als die »Vega« 295 Tage festgebannt war im Eis in der Nähe der Beringstraße, glaubte man, daß ihr ein Unglück zugestoßen, und in hochherziger Weise stellte Gordon Bennett, der Besitzer des »Neuyork Herald«, die Mittel zu einer Aufsuchungsfahrt zur Verfügung. Wie er 1871 Livingstone am Tanganika und 1874-77 Stanley im heißen Afrika geholfen, so rüstete er jetzt die »Jeannette« unter Führung des Kapitäns de Long aus zu einer Polarfahrt. Ende Juni 1879 fuhr die »Jeanette« aus San Francisco und nahm ihren Weg durch die Beringstraße nach der sibirischen Nordküste. Man erfuhr am 19. August durch einige Tschuktschen, daß Nordenskjöld bereits Ende Juli die Beringstraße durchfahren habe. Verschiedene Gegenstände in der Hand dieser Leute unterstützten ihre Aussagen, so daß de Long nicht daran zweifeln konnte. Um nicht tatenlos umzukehren, stach die »Jeannette« ins Polarmeer in nördlicher Richtung, war jedoch am 24. August vollständig vom Eise umschlossen; 21 Monate, bis zu ihrem Untergange, wurde sie darin willenlos umhergetrieben. Am 7. Januar 1880 war sie leck geworden, sie trieb beständig weiter nach NW. Am 12. Juni war der Aufenthalt auf dem Schiffe mit Lebensgefahr verbunden; unter 77°13' n. Br., fast 1000 km vom Festlande, mußte es verlassen werden. Am Morgen des 17. Juni 1881 fand es sein Grab im nordischen Eise. Die aus 32 Personen bestehende Mannschaft verteilte sich auf die drei Boote, die von de Long, Leutnant Chipp und Oberingenieur Melville geführt wurden. Der Kurs war südlich, nach der sibirischen Küste gerichtet. Als man ungefähr 400 km vom Lenadelta entfernt war, wurden die drei Boote durch Sturm und Nebel voneinander getrennt. Das Boot Melvilles langte mit 11 Insassen am 16. September im östlichen Arme des Lenadeltas an, erreichte glücklich den russischen Stützpunkt Bulun an der untern Lena und endlich Irkutsk.
Das Boot, in welchem de Long selbst die Führung hatte, landete in einem so seichten Lenaarme, daß die Bootfahrt unmöglich war. In durchaus ungenügender Kleidung, mit Vorräten nur für wenige Tage machten sich die 14 Mann zu Fuß auf nach Bulun, der einzigen, 750 km entfernten, ihnen bekannten Niederlassung an der untern Lena. Da die Lebensmittel sehr bald aufgezehrt waren und die Erschöpfung der Mannschaft sich fühlbar zu machen begann, schickte der Kapitän die beiden deutschen Matrosen Nindemann und Noros voraus nach Hilfe. Nachdem sie 23 Tage in vollständiger Einöde sich hingeschleppt, fielen sie schließlich Jakuten in die Hände, die sie nach Bulun brachten. Sie trafen hier mit Melville zusammen, der, sobald er über de Longs Weg Kenntnis erlangt hatte, ihnen entgegeneilte; er fand die treuen Gefährten, aber – tot, verhungert, erfroren, verbrannt. In ihren Taschen hatten die meisten Stückchen verbrannten Pelzwerks, an dem sie genagt zu haben schienen. Die Hände waren ihnen verbrannt, wohl weil sie dem Feuer zu nahe gekommen waren. Hören wir über die letzten Tage eine Stelle aus de Longs Tagebuch, die einen Einblick gewährt in ihre furchtbaren Leiden: »Am 10. Oktober ½6 Uhr früh genossen wir jeder die letzte halbe Unze Alkohol und aßen Streifen von Renntierhaut. Gestern morgen verzehrte ich die Fußspitzen meiner Renntierhaut. Luft nicht sehr kalt. Um 8 Uhr unterwegs. Um 11 Uhr sind wir sehr erschöpft. Feuer gemacht und einen Trank aus den Teeblättern bereitet. Mittag wieder vorwärts. Frischer SSW-Wind. Treibschnee. Schwieriger Marsch. Lee bittet, zurückgelassen zu werden. Um 3 Uhr machen wir, völlig erschöpft, halt. Wir krochen in ein Loch am Ufer, sammelten Holz und machten Feuer. Zum Abendessen hatten wir nichts als einen Löffel Glyzerin. Alle sind schwach und matt, aber heiter. Gott stehe uns bei! Am 12. Oktober SW-Sturm mit Schnee. Ich kann mich nicht bewegen. Ein Teelöffel voll Glyzerin und heißes Wasser zum Frühstück. Zum Mittag hatten wir einen Aufguß auf Weidenblätter. Alle werden schwächer und schwächer. Wir haben kaum noch Kraft genug, um Feuerholz zu holen. SW-Sturm mit Schnee. Am 13. Oktober Weidentee. Heftiger SW-Wind. Wir sind in den Händen Gottes, und wenn er uns nicht weiter hilft, sind wir verloren. Wir können nicht gegen den Wind gehen, und Hierbleiben heißt so viel als umkommen. Nachmittags gingen wir ein Stück, etwa eine Meile, weiter und kreuzten einen Flußarm oder eine Biegung des Hauptflusses. Darauf vermißten wir Lee. Wir legten uns in ein Loch am Ufer und sandten Leute nach Lee zurück. Er hatte sich niedergelegt, um zu sterben. Alle vereinigten sich im Gebet zu Gott. Abends brach ein Sturm los. Furchtbare Nacht. Am 14. Oktober früh Weidenblättertee. Zum Mittag genossen wir wieder solchen mit einem Löffel Öl. Alexia schoß ein Schneehuhn, das uns eine Suppe lieferte. Der Südwind wurde schwächer. Am 15. Oktober hatten wir zum Frühstück Weidenblättertee und zwei alte Stiefel. Wir beschließen beim Sonnenaufgang weiter zu ziehen. Alexia zusammengebrochen. Wir kamen zu einer leeren Hütte und lagerten darin. Bei der Morgendämmerung zeigten sich südlich Spuren von Rauch. Am 16. Oktober. Alexia liegt danieder. Gottesdienst. Am 17. Oktober. Alexia im Sterben. Der Doktor taufte ihn. Ich las Gebet für den Kranken. Heute ist Collins' vierzigster Geburtstag. Gegen Abend stirbt Alexia an Erschöpfung aus Mangel an Nahrung. Ich bedeckte den Leichnam mit der Flagge. Am 18. Oktober ruhiges müdes Wetter. Schneefall. Am Nachmittag legten wir Alexias Leiche auf das Eis des Flusses und bedeckten sie mit Stücken Eis. Am 19. Oktober schnitten wir das Zelt auseinander, um uns Fußzeug daraus zu machen. Am 20. Oktober hell und sonnig, aber sehr kalt. Lee und Knack sind am Ende. Am 21. Oktober. Lee fanden wir um Mitternacht zwischen mir und dem Doktor tot. Knack starb gegen Mittag. Wir lesen Gebete für die Kranken. Am 22. Oktober. Wir sind zu schwach, um die beiden Leichen aufs Eis zu bringen. So brachte der Doktor Collins und ich sie nur hinaus aus Sicht. Dann schloß sich mein Auge. Am 23. Oktober. Alle sind sehr matt. Wir schliefen oder ruhten heute und versuchten dann vor Dunkelwerden genug Holz zusammenzubringen. Dann beteten wir. Unsere Füße schmerzen uns; kein Fußzeug. Am 24. Oktober eine schwere Nacht. Am 27. Oktober. Iversen zusammengebrochen. Am 28. Oktober. Iversen starb in der Frühe. Am 29. Oktober. In der Nacht starb Dreßler. Am 30. Oktober. Boyd und Gortz starben in der Nacht. Collins liegt im Sterben.« –
Was dem dritten Boot und seinen Insassen zugestoßen, das erzählt wohl nie eine lebende Seele.
Diese schreckliche arktische Niederlage bewirkte, daß zunächst ein Stillstand in den Entdeckungsfahrten eintrat. Man begnügte sich damit, rings um den Pol einen Beobachtungsring von wissenschaftlichen Warten zu schaffen auf erreichbaren, doch vorgeschobenen Posten, z. Br. Fort Rae am großen Sklavensee, Point Barrow, Spitzbergen, Lenamündung usw., deren Einrichtung 11 seefahrende Staaten, zum Teil auch Einzelpersonen, besorgten.
Andererseits wurde gerade das Unglück der »Jeannette« der Anlaß zu der kühnsten und erfolgreichsten arktischen Forscherfahrt, die bisher unternommen worden ist, dem Vorstoß Fridtjof Nansens auf der »Fram« gegen den Pol selbst.
So heißt in neuerer Zeit die Losung der Arktisfahrer. Fridtjof Nansen gründete auf die Tatsache, daß Überreste der »Jeannette« in Julianehaab an der Küste Südgrönlands nach drei Jahren auf einer treibenden Scholle aufgefunden worden waren, einen kühnen Plan dazu. Er vermutete aus der Richtung dieser Schollendrift eine Meeresströmung, die über den Pol gehe von Asiens Nordküste her nach Grönland. Sibirisches Treibholz findet sich häufig in Grönland, und das stützte seine Ansicht von einer Polarströmung in der angegebenen Richtung.
Dieser Treibeisströmung wollte er sich auf einem Schiffe anvertrauen, das durch den Eisdruck nicht zerdrückt, sondern emporgehoben wurde vermöge seiner glatten, schrägen Seiten und seiner starken Bauart aus italienischem Eichenholz. Der norwegische Schiffsbaumeister Colin Archer baute ihm dies Schiff, an dem die Erfahrungen aller Polarfahrer wahrgenommen und verwertet wurden, die seitdem weltberühmt gewordene »Fram« (d. h. Vorwärts). Während der Polarnacht sollte sie elektrisch beleuchtet werden, die Dynamomaschine wurde während der Fahrt durch die Dampfmaschine, während des Aufenthalts im Eise durch eine Windmühle an Deck getrieben. Zwölf Norweger, darunter der Kapitän Otto Sverdrup, der die Querung des grönländischen Inlandeises mit bestanden hatte, begleiteten Nansen auf seiner Fahrt »durch Nacht und Eis«. Ein Reserveleutnant Fredrik Hjalmar Johansen war so begeistert für die Teilnahme an dem Unternehmen, daß er sich als Heizer meldete, weil sonst kein Platz für ihn frei war. Am Johannistag 1893 fuhr die »Fram« aus Kristiania ab, begleitet von Lustjachten, zuletzt bei Laurvik ein Stück gesteuert von Archer, ihrem Erbauer.
Am 21. Juli 1893 nahm die »Fram« Abschied von Norwegen in Vardö. In Chabarowa an der Jugorschen Straße brachte man 34 Schlittenhunde an Bord, die Baron Toll, ein russischer Polarfahrer, versorgt hatte. Am 7. August sahen die Framleute die letzten Menschen, zwei Samojeden von der Halbinsel Jalmal. Die Karische See war eisfrei und setzte der Fahrt wenig Widerstand entgegen, nur an den Küsten lagen Haufen von Meereistrümmern, Torosse, die übereinander geschoben und an den Kanten allmählich abgerundet, zu ungeheueren Blöcken zusammenfrieren. Nordöstlich der Jenisseimündung kamen die kleinen Kamennyjinseln (Felseninseln) in Sicht, und Nansen bemerkte deutliche Strandlinien, die für eine Hebung der sibirischen Küste seit der Eiszeit sprechen, auch wurden viele kleine Felseninseln vor der westlichen Taimyr entdeckt und benannt, eine kleine Gruppe auch Nordenskjöldinseln. Gegenwind und Totwasser hielten die »Fram« oft auf. Das Totwasser entsteht, wenn eine Süßwasserschicht über dem schweren Salzwasser liegt und sich an das Fahrzeug wie eine hemmende Schleppe heftet. Das Tierleben auf dem Eise war reich an Seehunden, besonders Phoca barbata, auf den Inseln und dem Festlande an Renntieren und Eisbären. Mit knapper Not gelang es, das Kap Tscheljuskin, den nördlichen Punkt der Alten Welt, noch vor der winterlichen Vereisung zu umschiffen, doch mußte Nansen auf eine zweite Lieferung von ostjakischen Schlittenhunden, die Baron Toll an die Mündung des Olenek gesandt hatte, verzichten. Nördlich der Lenamündung fand er bis über 77° n. Br. hinaus plötzlich freies Wasser, die neusibirischen Inseln blieben östlich der kühn polwärts fahrenden »Fram«. Sverdrup glaubte fast, in das offene Polarmeer gekommen zu sein. Wirklich trieb eine starke Strömung nach Norden, wie Nansen vermutet hatte. Am 20. September stieß er bei ziemlich 78° n. Br. auf die geschlossene Eiskante. Bald fror die »Fram« im Eise ein und trieb in sonderbaren Kurven im ganzen nordnordwestlich. Die lange Winternacht brach ein, das elektrische Licht ersetzte, vom Windmotor erzeugt, auf dem Schiffe das Tageslicht. Bärenjagden, Arbeiten aller Art, besonders wissenschaftliche Beobachtungen kürzten die Zeit. Hören wir eine Schilderung der Polarnacht aus Nansens Tagebuch:In Nacht und Eis I, S. 190.
»Es gibt nichts so wunderbar Schönes wie die arktische Nacht. Es ist ein Traumland, in den zartesten Tönen gemalt, die man sich denken kann; es ist in Äther verwandelte Farbe. Ein Schatten verschmilzt in den andern, so daß man nicht weiß, wo der eine endigt und der andere beginnt, und doch sind sie alle vorhanden. Keine Formen; alles ist schwache, träumerisch gefärbte Musik, eine weit entfernte, lang gezogene Melodie auf gedämpften Saiten. Ist nicht alle Schönheit des Lebens erhaben und zart und rein wie diese Nacht? Gebt ihr glänzendere Farben, und sie ist nicht mehr so schön.
Der Himmel gleicht einer großen Kuppel, die im Scheitelpunkt blau ist und sich abwärts in Grün, dann in Lila und Violett an den Rändern abschattiert. Über den Eisfeldern lagern kalte und violettblaue Schatten mit helleren blaßroten Tinten, wo hier und dort ein Grat den letzten Widerschein des entschwindenden Tages auffängt. Oben im Blau der Kuppel scheinen die Sterne, die den Frieden verkünden, wie es diese unveränderlichen Freunde stets tun. Im Süden steht ein großer rotgelber Mond, umgeben von einem gelben Ringe und leichten goldenen Wolken, die vor dem blauen Hintergrunde schweben.
Jetzt breitet das Nordlicht über das Himmelsgewölbe seinen glitzernden Silberschleier aus, der sich nun in Gelb, nun in Grün, nun in Rot verwandelt; er breitet sich aus und zieht sich wieder zusammen in ruheloser Veränderung, um sich dann in wehende vielfältige Bänder von blitzendem Silber zu teilen, über die wellenförmige glitzernde Strahlen dahinschießen; dann verschwindet die Pracht. Im nächsten Augenblicke erschimmert sie in Flammenzungen gerade im Zenith, dann wieder schießt ein heller Strahl vom Horizont gerade empor, bis das ganze im Mondschein fortschmilzt. Es ist, als ob man den Seufzer eines verschwindenden Geistes vernähme. Hier und dort sind noch einige wehende Lichtstrahlen, unbestimmt wie eine Vorahnung – sie sind der Staub vom glänzenden Gewande des Nordlichts. Aber jetzt nimmt es wieder zu, es schießen wieder Blitze herauf, und das endlose Spiel beginnt aufs neue. Und während der ganzen Zeit Totenstille, eindrucksvoll wie die Symphonie der Unendlichkeit.«
Anfangs schien es, als ob Nansens Vermutung einer nördlich gerichteten Eisströmung zunichte werden sollte; denn das Schiff trieb reichlich einen Monat südöstlich ab. Erst seit dem 8. November 1893 wuchs mit zunehmender Norddrift Nansens Hoffnung wieder, und bald wurde die Vermutung zur Gewißheit. Dagegen bewährte sich die »Fram« vorzüglich in den gewaltigen Eispressungen, die bei Flut eintraten, besonders stark bei Neumond. Im eigentlichen Polarbecken kamen sie nicht so regelmäßig vor, da sie hier mehr durch den Wind verursacht wurden, der das Eis trieb.In Nacht und Eis I, S. 209, 210.
»Solch ein Kampf zwischen den Eismassen ist unleugbar ein großartiges Schauspiel . . Zuerst vernimmt man in der großen Eiswüste ein Geräusch wie Donnergebrüll eines weit entfernten Erdbebens, dann hört man es, immer näher und näher kommend, an mehreren Stellen. Die schweigende Eiswelt widerhallt vom Donner, die Riesen der Natur erwachen zur Schlacht. Das Eis birst ringsumher und türmt sich auf, ganz plötzlich befindet man sich mitten im Kampfe. Auf allen Seiten hört man Heulen und Donnern, man fühlt das Eis erzittern, hört es unter den Füßen brüllen; nirgends ist Friede. In dem Halbdunkel sieht man es zu immer näher und näher kommenden hohen Ketten sich auftürmen und aufwerfen; Schollen von 3, 4 und 5 m Dicke bersten und werden übereinander geworfen, als ob sie federleicht wären. Sie sind jetzt ganz nahe, und man eilt fort, das Leben zu retten; aber plötzlich spaltet sich das Eis vor uns, ein schwarzer Abgrund öffnet sich, aus dem das Wasser emporströmt . . Ringsum wälzen sich neue Wälle von Eisblöcken heran mit Donner und Gebrüll wie von einem ungeheueren Wasserfall, mit Explosionen wie Geschützsalven . . Dies ereignet sich im hohen Norden jahraus, jahrein. Könnte man die Eisfelder von oben betrachten, so würden sie ein Netzwerk solcher zusammengeschobener Eisketten oder »Preßdeiche« mit fast quadratischen Maschen vorstellen.«
Nur in einer Beziehung erwiesen sich Nansens Vorbereitungen als unzulänglich, die Lotleine von 3475 m Länge war zu kurz; denn man stieß, je weiter nach Norden man kam, auf große Meerestiefen, bis zu 3900 m.
Das Fangnetz lieferte in hohen Breiten reiche Ausbeute an kleinem Seegetier: Flohkrebse, leuchtende Ruderfüßer und Crustaceen, so daß oft der Inhalt des Netzes wie glühende Kohlen aussah. Denn das Tiefenwasser wurde verhältnismäßig warm gefunden, in 250 m Tiefe z. B. +0,55°C.
Im taghellen Sommer bildeten sich auf dem drei und mehr Meter dicken Eise Süßwassertümpel, die sogar Segelfahrten gestatteten, und große offene Rinnen. Über diesen schwebten Beute suchend Möwen aller Art, fingen Garnelen und anderes Seegetier; besonders freute sich Nansen, die seltene Rosenmöwe in etwa 81° n. Br. schießen zu können. Auch Bären suchten diese Rinnen nach Seehunden ab.
Im Winter 1894/95 hatte Nansen den Plan gefaßt, die »Fram« zu verlassen, um begleitet von Johansen eine Schlittenreise polwärts anzutreten. Nach zwei verunglückten Anläufen brach er am 14. März 1895 endgültig auf, nachdem er den Oberbefehl an Kapitän Sverdrup übergeben hatte. Die Anstrengungen dieser Forschungsreise waren ungeheuer: Die Eisketten und offenen Rinnen waren auf den schweren Hundeschlitten kaum zu kreuzen, die Kälte blieb beständig zwischen 30 und 50°C. Die Kleider wurden von den Ausdünstungen des Körpers, die sich außen niederschlugen und gefroren, zu Eispanzern, die so steif waren, daß sie Wunden scheuerten und im Doppelschlafsack erst nach Stunden durch die Körperwärme auftauten. Sie konnten natürlich nie getrocknet werden: »es war, als lägen wir beständig in einem nassen Umschlag«, schreibt Nansen. Dazu trieb das Eis südwärts, während sie nordwärts wanderten, so daß sie bis zum 8. April nur bis zu der allerdings erstaunlichen Polhöhe von 86°4' N. vordrangen, dann aber des Mundvorrats für den Rückweg und der Hindernisse wegen nur noch 450 km vom Pol entfernt umkehren mußten. Auf der Rückfahrt gegen Franz-Josephsland mußte ein Hund nach dem andern als Nahrung für die übrigen geopfert werden, da die mitgenommenen Futtervorräte nicht ausreichten. Land war weit und breit nicht zu erblicken, die Lebensmittel fingen an, knapp zu werden, endlich glückte es, am 22. Juni, in einer der offenen Rinnen einen Seehund zur Ergänzung des Vorrates zu schießen. Drei Hunde waren nur noch vorhanden. Die Rinnen wurden schließlich so breit, daß sie auf Kajaks aus Bambus und Segeltuch gekreuzt werden mußten. Seehundstran diente zum Heizen, Seehundsfleisch wurde getrocknet. Endlich glückte es auch, eine Bärin mit zwei Jungen zu erlegen, damit auch die beiden letzten Hunde Kaiphas und Suggen wieder einmal reichlich zu füttern. Das war im »Sehnsuchtslager« auf dem Eise am 10. Juli 1895. Am 24. Juli endlich erscholl der Ruf: Land! Land! und belebte die Kräfte der armen Eiswanderer aufs neue. Aber erst am 7. August, nach 107tägiger Wanderung wurde es erreicht, zugleich aber auch offenes Meer! Diese erste Insel taufte Nansen nach seiner Gemahlin Evaland. Nun mußten die beiden treuen Hunde erschossen werden, da sie auf der Kajakfahrt auf offener See nicht zu gebrauchen waren. Bald folgte die Livinsel, nach Nansens Töchterchen genannt, und zwei andere; »Weißland« wurde die kleine Gruppe getauft. Zu Lande von Bären gefährdet, drohte den beiden Forschern in den leichten Kajaks jetzt von Walrossen Gefahr. Nun zeigte sich aber bald mehr und mehr Land und Leben: Blumen blühten zwischen Basaltblöcken! Am 28. August schon waren die beiden Wanderer gezwungen, ein Winterlager auf dem neugefundenen Lande zu errichten. Denn Eis sperrte den Weg nach Süden. Bären an Land, Walrosse auf dem Eise waren zur Genüge da. Aus Steinblöcken wurde eine Art Hütte gebaut, aus einem Treibholzstamm ein First gesetzt und Walroßhaut darüber gespannt, die durch Steingewichte straff gezogen wurde. Aus Schnee ein kleiner Schornstein; Speck, Verbandszeug und Blechschalen lieferten Brennstoff, Docht und Lampe. Wie kam Nansen jetzt sein früherer Verkehr mit den grönländischen Eskimos zugute und alle Erfahrungen, die er dort gesammelt, bei seinem 9monatigen Robinsonleben auf Frederik-Jacksonland unter 81°10' n. Br. Glücklicherweise blieben beide Einsiedler gesund bis auf Gliederreißen; der Skorbut, der von allen Arktisforschern gefürchtet wird, stellte sich nicht ein. Sie litten nur unter dem Schmutze, dem Mangel an Kleidung, den diebischen Blaufüchsen, die alles stahlen, was sie fortbringen konnten: Bambusstücke, Stahldraht, Harpunen, die Steinsammlung, das Moosherbarium, ein Thermometer sogar. Endlich drückte sie seelisch die Einsamkeit, der Mangel an geistiger Anregung – besonders während der langen Polarnacht. Dennoch blieben die beiden Männer gutes Mutes und suchten die lange Dunkelzeit zu verschlafen; eng aneinander geschmiegt, in Eisbärfelle gewickelt, brachten sie es bis zu 20 Stunden Schlaf hintereinander.
Den Frühling 1896 kündete im Februar der Krabbentaucher an, der anfangs in kleinen Scharen von Süden kam. Nun begannen die Vorbereitungen zur »Heimfahrt«. Die Kleider wurden geflickt, ein Schlafsack aus Bärenfellen genäht, auch Socken und Handschuhe; frische Vorräte: Speck und Fleisch lieferten die wieder eintreffenden Bären. Das kostbarste und notwendigste Gut waren für beide die Doppelflinten und der Schießbedarf; als sie am 19. Mai 1896 aufbrachen, hatten sie noch 100 Kugel- und 110 Schrotpatronen. In der Hütte ließ Nansen einen kurzen Bericht über die Reise der »Fram« und über seine Schlittenreise zurück. In kleinen Tagesmärschen erreichten sie das während des ganzen Winters mit Sehnsucht gesehene Kap M'Clintock, sie hatten es »Kap der guten Hoffnung« genannt. Die Zugschlitten trieb dabei zeitweilig ein guter Segelwind kräftig an. Schlechtes Schneesturmwetter hielt die Reisenden auf; am 4. Juni brachte man die Kajaks ins Wasser und paddelte längs Gletschern und Basaltfelsen, zwischen vogelbelebtem Meere südwärts, um freilich am 6. Juni vom Kap Richthofen an wieder mit dem Schlitten reisen zu müssen. Doch mit günstigem Winde gelangte man in kurzer Zeit bis zur Südseite des Franz-Josephlandes, wo offenes Wasser am 12. Juni die Segelfahrt auf den Kajaks gestattete. Als man sie aber am Abend am Küsteneise vertäut und zur Erkundung einen Hügel bestiegen hatte, rissen sich die beiden Boote durch Wind und Strömung los und trieben ab. Rasch entschlossen stürzte sich Nansen ins eisige Wasser und schwamm mit äußerster Anspannung aller Kräfte den Kajaks nach, die alles bargen, was ihnen geblieben war. Halb erstarrt und fast erschöpft erreichte er sie und brachte sie zurück. Auf der Weiterfahrt wurde Nansens Kajak durch einen wütenden Walroßbullen leck gestoßen, lief aber noch rechtzeitig auf dem Eisfuß der Küste auf. Am 17. Juni wurden die kühnen Männer plötzlich von aller Gefahr und Entbehrung erlöst: Bei Kap Flora auf der Northbrookinsel lagerte nämlich ein englisches Unternehmen unter Frederik Jackson. Nansen und Johansen wurden stürmisch begrüßt und herzlich aufgenommen in der russischen Blockhütte, die auf der 16 m über dem Meeresspiegel gelegenen alten Strandterrasse erbaut war. Am 26. Juli traf Jacksons Schiff »Windward« ein und brachte Vorräte. Es nahm Nansen und Johansen mit und brachte sie am 13. August nach Vardö. Als sie am 20. August in Hammerfest waren, erreichte sie die erlösende Nachricht, daß die »Fram« am 20. August 1896 in Skjärvö bei Tromsö wohlbehalten angekommen sei. Wie Nationalhelden wurden Nansen und seine Begleiter beim Einzug in Kristiania geehrt. Sverdrup hatte die »Fram« trefflich geführt, sie war am 15. November 1895 mit der Drift bis 85°55,5' n. Br. gelangt unter 66°31' der Länge. Im Frühjahr 1896 trieb sie nördlich von Spitzbergen südwärts, und nun durchbrach Sverdrup, die sich bildenden Rinnen benutzend, mit Dampfkraft und mit Schießbaumwolle und Pulver den 340 km breiten Packeisgürtel. Auf Spitzbergen traf die »Fram« mit der schwedischen Forschungsgesellschaft des Oberingenieurs Andrée zusammen, der im nächsten Jahre mit dem Luftballon »Örnen« d. h. Adler, den Pol zu erreichen dachte, aber dabei jämmerlich zugrunde gegangen ist. Von sonstigen Vorstößen zum Pole auf diesem Nordwege ist nur der der »Stella Polare« des Herzogs der Abruzzen, Prinzen Ludwig von Savoyen, von einigem Erfolge gewesen. Der Marineleutnant Cagni drang mit Nansenschen Hundeschlitten um 54 km nördlicher als Nansen vor, bis 86°33' N., und erreichte glücklich nach 104 Tagen wieder das Lager des Prinzen an der Teplitzbai auf Franz-Josephsland. Leider kostete dieser kleine Erfolg drei Menschenleben. Im Sommer 1918 hat Roald Amundsen auf dem Polarschiff Maud von Kristiania eine neue wohlvorbereitete Reise zum Nordpol angetreten. Von der Dicksoninsel an der Jenisseimündung will er längs der nordasiatischen Küste bis zu den neusibirischen Inseln fahren in der Hoffnung, daß die Eisströmung, die einst einige Ausrüstungsgegenstände der hier verunglückten Jeannettefahrt durch das Polarbecken an die Ostküste Grönlands verfrachtete, auch sein Schiff nordwärts in die Nähe des Pols und dann an die Küste von Grönland oder Spitzbergen treiben wird. Auch Sverdrup beteiligt sich an dieser kühnen Eismeerfahrt, die auf sechs Jahre in »Nacht und Eis« sich eingerichtet hat.
Quellen: Grönland von A. E. Freih. v. Nordenskjöld. Leipzig 1886 (F. A. Brockhaus); Auf Schneeschuhen durch Grönland von Dr. Fridtjof Nansen. 2 Bde. Hamburg 1891, Verlagsanstalt und Druckerei Aktiengesellschaft. Der Freiherr A. E. v. Nordenskjöld wurde durch die reichen Mittel, die ihm Dr. Oskar Dickson nach der berühmten Vega-Fahrt zur Verfügung stellte, in den Stand gesetzt, an die Erforschung der Eiswüste im Innern Grönlands heranzutreten; die Frage war nicht bloß deshalb wichtig, weil bis zum Jahre 1870 das Binneneis nur auf ein paar hundert Meter vom Rande aus beschritten war, sondern auch deshalb, weil der gegenwärtige Eispanzer Grönlands wichtige Aufschlüsse geben konnte über die geologische Vergangenheit Nordeuropas, das ja einst in ähnlicher Weise vergletschert gewesen sein muß. Schon im Jahre 1870 war Nordenskjöld in Begleitung des Dr. Berggren unter 68°30' n. Br. nach dem Binneneise aufgebrochen; 50 km weit arbeitete er sich über ein schwieriges, von bodenlosen Abgründen durchzogenes Eisgebiet; da ihm aber seine zwei Eskimos die Gefolgschaft kündigten und er ohne Taue, Zelte, Schlitten war, ja das Kochgeschirr zurückzulassen genötigt war, so mußte er vorderhand weiteres Vordringen aufgeben.
Nachdem König Oskar und die schwedischen Kammern auf das Gesuch Nordenskjölds ihm den aus schwedischem Eisen erbauten Dampfer »Sofia«, der sonst dem Winterpostverkehr auf der Ostsee diente, bewilligt, wurde die Ausrüstung (von Dickson allein in hochherziger Weise bestritten) mit Lebensmitteln für 24 Mann auf 14 Monate, mit wissenschaftlichem Rüstzeug, dem Gerät für Eiswanderungen, einer Dampfbarkasse, einem Walfischboot, einem kleinen norwegischen und zwei Bertonschen Segeltuchbooten besorgt und die Besatzung in sorgfältiger Weise ausgewählt; es gehörten dazu auch zwei Walfänger, zwei Lappländer und außer Nordenskjöld noch sechs Gelehrte: ein Zoologe, ein Konservator, ein Hydrograph, ein Kartograph usw. Trotz zahlreicher Warnungen, die namentlich auf die für die Eisverhältnisse Grönlands ungeeignete »Sofia« hinwiesen, stach Nordenskjöld am 23. Mai 1883 von Gotenburg aus in See.
Man fuhr um die Nordküste Schottlands herum nach den Färöer, jenen von Regen, Frost, Eisstoß und Meeresbrandung umkämpften Restinseln großer Basaltergüsse, deren einzelne Decken als Schichten an den dunklen Uferwänden heraustreten. Die dunkeln mächtigen Nordseewellen, die mit breiten nassen Schwingen unablässig dagegen anstürmen und mit Donnergetöse in regelmäßigen Zeiträumen sich daran brechen, daß der schäumende Gischt bis aufs Oberland hinauf spritzt, haben tiefe Klüfte und Höhlen darein gegraben. Auf den Höhlen und Absätzen der dunklen Gehänge finden zahllose Seevögel vorzügliche Schlupf- und Nistwinkel: Trottellummen, Seepapageien, Möwen, Eis- und Sturmvögel. Es wimmelt im Wasser, an den Wänden und in der Luft von weißem und graulichtem Gefieder, daß man den Eindruck eines lustigen Schneegestöbers aus der Ferne hat. Der größte dieser Vogelberge ist Großdimon, eine steilgeuferte Basaltinsel, die von einem Ansiedler bewohnt wird, der auf dem grünen Oberlande Schaf- und Rindviehzucht treibt, besonders aber dem Vogelfang obliegt. Die Vogelmänner klettern entweder vom Boote aus an den steilen Wänden empor oder werden von oben an einem langen Seile herabgelassen und gelangen, sich mit den Füßen abstoßend und so hin- und herpendelnd, bald zu dieser, bald zu jener ergiebigen Fangstelle, ein gefahr-, aber gewinnbringendes Gewerbe. Die Färinger sprechen eine altnorwegische Mundart, stehen aber jetzt unter dänischer Herrschaft. Auch ihre Tracht und Sitte, besonders der allsonntägliche Kreis- oder Kettentanz zu dem Takte eines alten Seeheldenliedes, zeigt den altnorwegischen Ursprung der Leute, die manches treuer wahrten in ihrer insularen Abgeschiedenheit als die Stammverwandten im Mutterlande. Die Hauptstadt der Färinger, Torshavn, hat sogar eine färingische Wochenschrift »Die Morgendämmerung«. Sie hatte den Bewohnern die Polfahrt der »Sofia« bereits gemeldet.
Bei bewegter See ging es auf Island zu, die armen Berglappen vermeinten an der Seekrankheit sterben zu müssen. »Noch halte ich ein wenig am Leben fest, aber knapp ist es,« klagte der eine; erst auf Island fühlten sie sich wieder wohl und erklärten, »daß ihnen das Leben wiedergekommen wäre«.
Die Ostküste Grönlands ist mit einem breiten Eisgürtel gepanzert; man versuchte nicht, ihn zu durchbrechen, sondern fuhr langhin nach Südsüdwest. Wild zerklüftete Bergzinnen dämmten die dahinter liegenden Inlandeismassen ein, so daß sie nur in Einzelströmen in den Scharten zur See herabflossen; aber je weiter man nach Süden kam, desto niedriger wurden die Uferfelsen, und breit und weiß drängte sich das Eis ans Meer. Am 15. Juni umschiffte man Kap Farvel, das seine haifischzahnscharfen Bergspitzen am Südende Grönlands ins Meer hinausschiebt. Das Eisband schlang sich damals auch um die Südwestküste, so daß eine Landung gefährlich war; Schiffe, die eine der dahinter gelegenen Ansiedelungen anlaufen wollen, müssen so weit nordwärts fahren, bis der Eisgürtel schwindet. Dann öffnet sich längs der Küste eine schmale Wasserrinne, in der man südwärts segeln kann.
Um in dem Hafen Invigtut die vorausgesandten Kohlen und anderes mehr einzunehmen, auch die dortige Grubenkolonie der Kryolithgesellschaft zu besuchen, ging man zwischen den Schären und Eisbergen durch dem Ziele zu und warf ohne Zwischenfall im Hafen dieser rein europäischen Ansiedlung Anker, wo jener seltene Stein, der Eisstein oder Kryolith, gebrochen wird; er ist halb durchsichtig, weiß, bricht sich wie Spat und ist so weich, daß er mit dem Messer geschnitten werden kann; in früherer Zeit hoffte man, ihn zur Aluminiumgewinnung verwerten zu können, doch die Herstellungskosten waren zu groß; die Kryolith-Gesellschaft versendet ihn besonders nach Amerika, wo Soda und Beizmittel für Färbereien (Tonerdepräparate) daraus gewonnen werden.Ausbeute 1914 13 800 t. Neuerdings stellt man in Pittsburg (Pennsylvanien) daraus ein glasiges Porzellan her, das sog. Heißgußporzellan. Die Aufnahme in dieser aus lauter Junggesellen bestehenden Niederlassung war überaus gastfreundlich.
Am 23. Juni litt es Nordenskjöld nicht länger, die Eiswanderung sollte sobald als möglich begonnen werden; die »Sofia« wandte sich nordwärts in den endlosen Schären über Godthaab nach Egedesminde; fern im Osten zog die blauweiße Masse des Landeises den Blick des Forschers auf sich. Ihn beschäftigte die Frage: Gibt es jenseits des blauen Walles bis an die eisgepanzerten Küstenberge im Osten nur eine Eisfläche, oder liegen dazwischen auch grüne Oasen?
Als Ausgangspunkt für seine Eiswanderung wählte Nordenskjöld den 130 km langen Aulatsivik-Fjord, der sich im Innern wiederum zu einer bedeutenden Meeresbucht, Tasiusarsuak (d. h. der große Binnensee), erweitert. Große, vom Landeise heruntergefallene und ins Wasser hinausgeschobene Eisblöcke schwammen im Fjord hin und her. Er fand eine günstige Ankerstelle; der kleine Hafen war von 2-300 m hohen Gneisfelsen umrahmt, die an einzelnen Stellen mit dichtem, niedrigem Gesträuch bewachsen, mit einem Teppich von Rauschbeeren (Empetrum nigrum), Weiden, Moosen und Flechten bedeckt waren; prachtvolle Blüten zierten den Teppich am 1. Juli, indes von einer steilen Felswand ein Wasserfall herabstürzte.
Während den Forscher auf der eigentlichen Entdeckungsreise nur neun Mann begleiteten, gaben ihm von der Ankerstelle bis zum Rande des Inlandeises der Leiter der grönländischen Handelsgesellschaft in Egedesminde, H. Hörring, der Händler Olsen und eine Anzahl echter und Halbbluteskimos das Geleite; unter diesen war auch der Schriftleiter, Dichter und Drucker der mit Bildern erscheinenden Eskimozeitung, welche den Titel Atuagagliutit, d. h. Lesestoff, führt und in Godthaab gedruckt wird, Herr Lars Möller. Er schloß sich den Forschern an, um durch Zeichnungen unterstützte Berichte für seine Zeitung liefern zu können.
Es war schon ein schweres Stück Arbeit, die für die Landbeförderung bestimmten, schwerbeladenen Karren, Zelte usw. bergan und bergab über den steinigen, von dichtem Moosteppich überzogenen Streifen zu schleppen, der sich in 3-4 km Breite zwischen dem Meeresgestade und dem Binneneise hinstreckte. Aber die eigentliche Mühsal begann erst am Fuße des Eises, wo ein kleiner, durch Gletscherbäche gebildeter See lag. Die Lasten der Karren wurden auf sechs Schlitten geladen und das Eis betreten. Es zeigte sich bald, daß es unmöglich war, gerade ostwärts fortzuschreiten, man drang am Eisabhange nordostwärts vor, die tiefen Spalten und Schluchten anfangs mit Leichtigkeit überwindend. Doch schon am dritten Tage wurde die Last der Schlitten drückend und daher der Mundvorrat auf 4/5 (d. h. auf 40 Tage statt auf 50) beschränkt, das kleine Bertonboot zurückgelassen, und nur ein gewöhnliches Zelt aus dünnem Baumwollzeug mit 12 Zeltstäben aus Eisen, ferner ein Schlafsack, eine Filzdecke und eine Kautschukmatratze für jeden Teilnehmer, sowie Blasebälge zum Aufblasen der Matratzen, isländische Jacken, eine Bluse aus Segeltuch, eine wollene Schlafmütze für jeden Mann, 16 Paar Schuhe aus Segeltuch mit Rietgras, Eissporen zum Befestigen an den Sohlen, Teller und Kaffeetassen aus verzinntem Eisenblech, Kocher für Spiritus, 2 Paar Schneeschuhe, 2 lappländische Bärenlanzen, farbige Brillen für alle, wissenschaftliche Geräte, Tragseile, ein starkes Manilahanftau usw. auf den 6 Handschlitten weitergeführt. Wohl wären auf harter, glatter Eisdecke die 20 Zentner Gepäck mit Leichtigkeit fortgezogen worden, aber auf dem von Schluchten und Spalten zerrissenen Binneneise mußte alles in Teillasten befördert werden, so daß man denselben Weg dreimal machte. Bald gesellten sich zu den Schluchten und Rissen zahlreiche reißende Flüsse mit Steilufern, die man auf einer Brücke überschritt, zu welcher die festen Alpenstöcke die Unterlage bildeten. Aufgefundene Knochen schienen anzudeuten, daß in dieser Sahara des Nordens das wilde Renntier auf seinen Wanderungen den Tod gefunden.
Je weiter die Forscher ostwärts vordrangen, um so mehr Formen nahm das Inlandeis an seiner Oberfläche an: Die von Steinen, Lehm und Eis gebildete Einfassung stellte die unbedeutende Randmoräne dar, die Grenze zwischen Eiswüste und Land; diese Moräne wird beim Zurückweichen des Binneneises von den Gletscherbächen bis auf die großen Felsblöcke wieder fortgespült; der ziemlich gleichmäßige Abhang des Inlandeises war von einer dünnen Lehmschicht bedeckt und von zahllosen Schluchten zerschnitten; am gefährlichsten und für die Schlitten kaum zu überschreiten war das Gipfeleis, das in Form 6 m hoher Gipfel und Eiskämme die steil abfallenden Höhenzüge krönte, sowie das Höckereis, welches in mehr abgerundeter Form die Höhenrücken bedeckte; aber diese Höcker standen so nahe beieinander, daß die Schlittenkufen kaum zwischen ihnen hindurchkonnten.
Man traf weiter schalenförmige Einsenkungen mit Seen, die von zahlreichen, reißenden Flüssen durchzogen waren; als der 13. Rastplatz nach dem Innern verlassen worden war und der Boden sich bereits bis 1100 und 1200 m erhob, war das Inlandeis von einer dünnen trügerischen Schneeschicht bedeckt, in die der Fuß sofort einsank bis in den Schneebrei, der in großen Flächen darunter lagerte; in Senkungen hatten sich dort Seen angesammelt, denen zahlreiche Flüsse Wasser zuführten; auch aus diesen »Schneebreiebenen« ragten oft Hügel mit Eishelm hervor. In der Höhe von 1600 m endlich, noch weiter im Osten traf man trockene Schneewüsten. Klüfte gab es überall, besonders auf den Höhen, oft nur meterweit auseinander; es gab parallele und sich durchkreuzende, leere und auch bis zum Rande mit stillstehendem Wasser gefüllte.
Am Abend des 9. Juli wurde der beste Zeltplatz erreicht; es war eine kleine Eisebene, die von Gletscherbächen umgeben war, glücklicherweise aber nur wenige wassergefüllte Schmelzlöcher hatte. In der Nähe des Lagers befand sich ein See, in den zahlreiche Gletscherbäche einmündeten, dessen Abfluß ein kurzer, sehr reißender, tosender Strom war, welcher sich in einen riesigen Gletscherbrunnen ergoß. Zwischen prachtvollen, steilen Eisufern schoß er dahin, als ob eine Künstlerhand eine Wasserleitung eingesenkt hätte zwischen Wände aus blauweißem, flecken- und fugenfreiem Marmor; selbst die Lappländer standen staunend vor diesem Gebilde, das einer fremden Zauberwelt anzugehören schien. Auf dem weiteren Wege nach Osten traf man ein ähnliches, nur wilderes Flußtal, in dem man hinzog; da das rechte Flußufer mit rotem Schnee bedeckt war, gab ihm Nordenskjöld den Namen Karmintal. Diese Erscheinung ist aus Hochgebirgen und polaren Gegenden bekannt und rührt von einer Kugelalge her (Sphaerella nivalis), deren Blattgrün sich durch einen blutroten Farbstoff vor dem Lichte schützt.
Bei herrlichem Wetter, einer Temperatur von +2 bis 8° im Schatten und 20° in der Sonne, Tag und Nacht andauerndem Sonnenschein, drang man immer kühn ostwärts vor; da die Lichtstrahlen von Schnee- und Eisflächen stark zurückgeworfen wurden, stellte sich die mit heftigem Schmerzen verbundene Schneeblindheit ein, die Dr. Berlin durch Schneebrillen und Einträufeln einer Lösung von Zinkvitriol hob. Weniger gefährlich, aber schmerzhaft war die durch den steten Sonnenschein bewirkte Gesichtsröte; das Brennen der Haut, besonders da, wo sich große Brandblasen gebildet hatten, war kaum erträglich. Die Blasen trockneten schließlich ein, hingen in Läppchen herab, eine neue Haut bildete sich darunter, die aber in der Morgenkälte empfindlich schmerzte.
Am 13. Juli stellte sich bei starkem Südostwind Regen ein, der nachts in Schneefall und Schneenebel überging; man begrüßte ihn als ein Zeichen des eisfreien Binnenlandes; sobald der Nebel sich hob, strengte man die Augen an, um Bergspitzen zu entdecken, die den Eishorizont überragten, der rund herum um die Wanderer einen ununterbrochenen, ebenen Kreis bildete. Wohl meinte man manchmal, dunkle Berggipfel in der Ferne zu entdecken, begrüßte sie mit Hurra, zeichnete sie ab, doch es war Täuschung.
Der Boden stieg – wie das Aneroid zeigte – nach Osten immer weiter an; immer gleich aber blieb sich die schwärzliche, graphitartige Decke des Inlandeises aus Lehmschlamm (Kryokonit), der zwar nicht ganze Flächen bedeckte, wohl aber die 1-3 Fuß tiefen runden Löcher ausfüllte, die überall siebartig ausgeschmolzen waren. Nordenskjöld vermutete, daß das ein Luftniederschlag sei, weil darin kosmische Bestandteile in großer Menge (Magnetit und ein staubfeines, durch den Magnet ausziehbares Eisen) enthalten sind. Dieser Eisstaub ermöglicht die Bildung einer eigentümlichen Eisflora, deren mikroskopische Gewächse sich darin entwickeln. Sie spielen in dem Haushalte der Natur eine wichtige Rolle, sofern sie bei ihrer dunkeln Färbung die Sonnenstrahlen kräftiger verschlucken als das Eis und somit die Ursache der löcherartigen Zerstörung der Eisdecke bilden. Nach neueren Forschungen ist der Kryokonit Verwitterungsstaub von den Küstenfelsen und kommt nur in ihrer Nähe vor.
Am 20. Juli hatte man die Höhe von 1510 m erreicht; am 21. erhob sich wiederum Südostwind, der Schnee und Regen brachte; bald watete man in wassergetränktem Schneebrei; alle Augenblicke blieb ein Schlitten stecken, so daß ihn vier Mann kaum wieder flott machen konnten; das Zelt fand kein trockenes Plätzchen; nur die Kautschukmatratzen bildeten gewissermaßen die Flöße, auf welchen die durchnäßten Leute vor dem feuchten Elemente einigen Schutz fanden; doch wer den Fuß über die Matratze setzte, wurde sofort bis über die Knöchel naß. Da sich die Unmöglichkeit ergab, die Schlitten weiter zu ziehen, wurde die Umkehr beschlossen; doch sollten vorher die zwei begleitenden Lappländer auf einer Schneeschuhfahrt nach Osten erkunden, ob die Verhältnisse unter allen Umständen Halt geboten. Lars und Anders erhielten Urlaub auf 3-4 Tage, und besonders der erste brannte vor Begierde, das – nach seiner Vermutung – wie eine Oase zwischen Inlandeis und Ostküste liegende Land zu erforschen, von dessen Wäldern er sogar im Traume erzählte. Nachdem sich die beiden aus dem Mundvorrat nach Belieben ausgewählt, vor allzu kühnem Vordringen gewarnt worden waren und Auftrag erhalten hatten, von dem etwa angetroffenen Lande Blumen und Gras mitzubringen, brachen sie am 22. Juli 1883 von dem Zeltplatz Nr. 18 auf. 117 km war man in 18 Tagen vorwärts gekommen. Die Zurückbleibenden vermochten in dem wassergetränkten Schnee nicht auszuharren, sondern kehrten zum vorhergehenden Zeltplatz zurück.
Sie beobachteten in diesen Tagen, daß der Himmel von einem ganz dünnen Wolkenschleier bedeckt war, der durch die Sonne warm, ja brennend beschienen wurde. Er senkte sich zeitweilig auf die Eisfläche herab; er war so trocken, daß nasse Kleider sofort trockneten. Wahrscheinlich war diese Naturerscheinung dem »Sonnenrauch« in Skandinavien und dem »brouillard sec« Aragos nahe verwandt.
Nach einer Abwesenheit von 58 Stunden kehrten die Schneeschuhläufer zurück, weil sie kein Trinkwasser und ebensowenig Brennstoffe zum Schmelzen des Schnees gefunden. Ihren Schätzungen nach hatten sie 230 km nach Osten hin zurückgelegt,Nansen berechnete später, daß sie vom Lager aus höchstens 70 km ostwärts vorgedrungen sein könnten. bis sie am Wendepunkte eine (barometrisch gemessene) Höhe von 1947 m erreicht. Sie hatten bald ostwärts kein Wasser mehr gefunden, das Eis wurde glatt und eben, das Thermometer zeigte -5°. Die Schneeschuhbahn war ausgezeichnet, der Durst aber brennend, bis man Schnee in einer Konservenbüchse schmolz. Keine Spur von Land bot sich den Blicken dar; sie sahen vor sich nur die Eisebenen, von ganz feinem und ebenem Schnee bedeckt. Stach man hinein, so entdeckte man eine 2 Ellen dicke Schicht losen Schnees, dann körniges Eis, unter dem sich ein Zwischenraum befand, in den man die Finger hineinstecken konnte, und der von kantigen Eisstücken umgeben war, darunter lagerte das Inlandeis.
Auf der Rückfahrt wurden zwei Raben bemerkt, die von Norden kamen und nach derselben Richtung zurückkehrten; ihre Nistplätze liegen auf den Küstenbergen. Am 25. Juli wurde der Rückzug beschlossen, da der Nebel den Marsch über die zerklüftete Eiswüste lebensgefährlich machte. Auch die Kälte nahm (-11°) zu, und Schneefall war zu befürchten, der die Klüfte und Löcher täuschend überdeckte. Die Flüsse waren, als man sie auf dem Rückwege traf, meist ausgetrocknet, die Eishügel hatten infolge Abschmelzens viel von ihrem früheren Umfang verloren, dagegen waren die Gletscherspalten bedeutend größer und für das Überschreiten gefährlicher; dasselbe galt von den Schmelzlöchern, die mit Eisstaub gefüllt waren – alles Wirkungen des kurzen arktischen Sommers, der an Wärme sofort einbüßte, als die Sonne nachts wieder unter den Horizont hinabsank. Einigemal begegnete man Scharen von Sumpfvögeln, die von Norden nach Süden zogen. Am 3. August erreichten die Forscher wieder den Westabhang des Inlandeises, kletterten hinab und eilten – alle schweren Gegenstände der Ausrüstung vorläufig zurücklassend – dem Zeltplatz am Sofiahafen zu; am 9. August traf man wieder in Egedesminde ein.
Ungleich erfolgreicher war der norwegische Zoolog Fridtjof Nansen auf seiner verwegenen, aber wohlüberlegten und -vorbereiteten Durchquerung Grönlands von Ost nach West im Jahre 1888. Sein Plan ging dahin, auf den in seiner Heimat als Verkehrsmittel im Winter benutzten Schneeschuhen mit wenig erlesenen Gefährten das Inlandeis zu überschreiten. Diese waren der Schiffskapitän Otto Sverdrup, der Oberleutnant Oluf Dietrichson und Kristian Kristiansen Trana, ein norwegischer Bauernbursche. Außerdem nahm Nansen noch zwei Lappen aus Finnmarken mit, den 45 Jahre alten Berglappen Ravna und den 26jährigen Balto aus Karasjok. Trotzdem, daß Sachverständige Nansens Plan, von der öden unzugänglichen Ostküste zur bewohnten Westküste Grönlands vorzudringen, für sehr wagehalsig, ja für verrückt erklärten, trotzdem ihm die norwegische Regierung die Mittel versagte, setzte der Mann, dessen Wahlspruch heißt: Der Mensch ist Wille! sein Unternehmen durch. Ein reicher Däne, der Staatsrat Augustin Gamél, gab Nansen die 5000 Kronen, die ihm sein Vaterland verweigert hatte.
Auf fünf leichtgebauten Schlitten aus Eschenholz mit breiten schneeschuhartigen Kufen sollte das Gepäck so befördert werden, daß jeder Mann seinen Schlitten selbst zog. Außer den Skiern nahm man indianische Schneeschuhe und norwegische Truger mit, die bei feuchtem Schneebrei das Einsinken verhindern sollten, Holzrahmen mit Flechtwerk darin. Ein leichtes, aber festes Boot, das über das Treibeis geschoben werden konnte, zwei Schlafsäcke aus Renntierfell, die je drei, zur Not auch vier Mann faßten, Pelzzeug und Wollkleider, Fellschuhe und Lederstiefel, Fausthandschuhe, Wollmützen und Frieskapuzen, Schneebrillen und rote Schleier, ein fünfteiliges festes Zelt aus wasserdichtem Segeltuch, ein Spirituskocher und haltbare und nahrhafte Lebensmittel, das notwendige wissenschaftliche Gerät u. a. m. vervollständigten die Ausrüstung.
Am 2. und 3. Mai 1888 brach man von Kristiania aus auf und gelangte über Leith in Schottland und die Färöer nach Island auf dem gewöhnlichen dänischen Postdampfer. Von Island aus schiffte man sich an Bord des Seehundfängers Jason ein, der in der Dänemarkstraße dem Fang der Klappmützen (Cystophora cristata), einer Seehundsart, oblag. Am 17. Juli setzte der brave Kapitän Jakobsen vom Jason die kühnen Forscher vor dem Sermilikfjord an der Ostküste Grönlands auf dem mitgenommenen Boot und einem dazu gekauften Fangboote aus, aber es sollte noch lange dauern, ehe sie die Küste betreten sollten. 500 km wurden sie durch die Strömung südwärts getrieben und erst am 29. konnten sie wenden, um hinter dem Treibeisgürtel in gefährlicher Fahrt bis zum 10. August wieder nordwärts vorzudringen. Auf der kleinen Felseninsel Kekertarsuak betrat die Schar zuerst festes Land, am Kap Bille stieß sie auf ein Eskimolager und verlebte mit den harmlosen Leuten manch heiteres Stündchen. Die schwimmenden oder festsitzenden Eisberge im Treibeise boten auf der Weiterreise einen herrlichen Anblick: bei einem ragten zwei steile Zinnen wie schlanke Kirchtürme in die Luft, unten hatte die See große Grotten ausgehöhlt, die in allen Tönen blau bis zum tiefsten Ultramarin spielten. Das sah aus wie ein schwimmendes aus Saphir gebautes Feenschloß; ringsumher rieselten Bäche in kleinen Wasserfällen an den Flanken herab, aus den Grotten klang die Musik fallender Tropfen heraus. An einzelnen Stellen war am Tage die Stechmückenplage groß, so daß Gesichter und Hände ganz zerstochen wurden, es gab keinen Widerstand gegen die Unzahl der winzigen Feinde. Nach einem nochmaligen Zusammentreffen mit Eskimos, nachdem man auch mehrfach an begrünten Stellen der Küste Reste alter Ansiedelungen gefunden, die durch Hungersnot in schweren Jahren ausgestorben waren; nachdem man eine sehr gefährliche Fahrt zwischen Eisbergen überstanden, von denen die einen wilde, blauschlüchtige Formen zeigten, die anderen glatte, weißlichblaue Tafelberge waren, die wahrscheinlich bei der Ablösung von den zerklüfteten Küstengletschern oder auch später ihr Oberstes zu unterst gekehrt hatten, so daß der polierte Eisfuß über den Meeresspiegel gekommen war; nach alledem landete Nansen am 10. August am Umivikfjord. Am 15. August wurden die Boote geborgen, die Schlitten gepackt, und über schmalspaltiges Eis begann der Aufstieg in nordwestlicher Richtung auf Christianshaab an der Westküste zu. Der Zug war beschwerlich genug. Regen stellte sich ein, dann Frost, der zwar die Schlittenbahn besserte, aber Trinkwassernot erzeugte, so daß man in den Blechflaschen Schnee auf der warmen Brust schmelzen mußte. Man wanderte anfangs vorzugsweise des Nachts über die Eiswogen, immer den 100 kg schweren Schlitten ziehend, daß die Schultern vom Seil wie verbrannt schmerzten. Entschädigt wurden die tapferen Männer für ihre harte Arbeit durch die Herrlichkeit der Polarnächte.
»Am südlichen Himmel führte das ewig wechselnde Nordlicht in langen, wogenden Bändern einen märchenhaften Tanz auf, bald unruhig jagend und flimmernd, bald mit glühenden Lichtspießen flammend und durcheinander fahrend, als gäbe es einen Kampf mit blitzenden Lanzen. Die Eskimos glauben dann, daß die Seelen der verstorbenen Kinder am Himmel Ball spielen. Oder der Mond ging auf und zog seine schweigsame Bahn durch den sternbesäten Himmel, spielte auf dem Gipfel der Eiskämme und badete die ganze tote, starre Eiswelt in seinem Silberglanze. Dann vergaß man die Mühsal, Friede kam über die Wanderer, und das Leben wurde ihnen zur Schönheitsoffenbarung.«
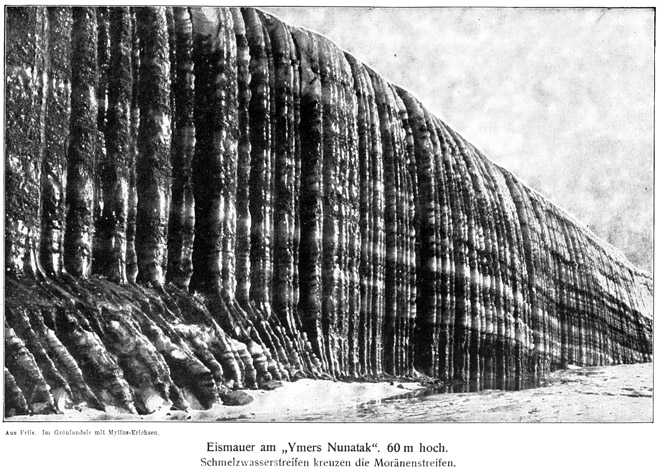
Nunataks tauchten überall anfangs aus der Eismasse auf, einzelne Spitzen des Felsuntergrundes, Gasen in der eisigen Sahara. Wo das Eis, wie an den Küsten, in Bewegung war, ist es an der Stoßseite dieser trotzigen Zacken aufgepreßt und zerrissen. An anderen Stellen aber machten sie das Eis eben, indem sie die gleitende Bewegung der Masse hemmten und aufhielten, so daß es nicht zur Spaltenbildung kam. Am 31. August wurde der letzte Nunatak gesehen. Bald wurde der Nachtfrost so hart, daß die Schlitten auf dem trocken-kalten, staubfeinen Schnee wie auf Sand liefen, so daß Nansen wieder des Tages reiste. Schneestürme bauten um das Zelt des Nachts oft hohe Dünen und verwehten die Schlitten. Am 26. August beschloß Nansen, die Fahrt abzukürzen und westsüdwestlich auf Godthaab loszusteuern, um das letzte Schiff nach der Heimat an der Westküste rechtzeitig zu erreichen. Nun wurden auch die Schneeschuhe fleißig benutzt auf der flachwelligen Schneehochfläche, deren Wellentäler von Norden nach Süden gingen. Vom 30. August an war die Fläche »glatt wie ein Spiegel ohne andere Unebenheiten als die Spuren, die die Füße hinterließen«. Das Wetter war fast immer klar und sonnig, selbst wenn der feine Frostschnee fiel, schien doch die Sonne hindurch und zauberte sich Nebensonnen, Ringe und Achsen in die Luft, besonders wenn sie im Westen niederging. Des Nachts sank die Temperatur im Zelte bis unter -40°C, während am Mittag die Luft nur -11°C hatte, in der Sonne aber bis über +30°C herrschten. Solche Temperaturverhältnisse wie auf der Höhe der Eiswüste in 2720 m mit so gewaltigen Schwankungen zwischen Tag und Nacht kommen am ehesten in der Sahara vor, wo es am Tage erstickend heiß sein kann, während in der Nacht das Wasser gefriert, schreibt Nansen und rechtfertigt damit die Bezeichnung Nordenskjölds für Innengrönland als der Sahara des Nordens. Der Schnee war in dieser Höhe nur oberflächlich verfirnt, da am Tage nur verschwindend wenig schmolz, das Schmelzwasser aber in der Nacht als dünne Schutzkruste gefror. Groß war der Jubel, als am 17. September, genau zwei Monate nach dem Verlassen des »Jason«, ein Schneesperling von der Westküste den ersten Gruß brachte. Und als sich am 19. eine östliche Brise erhob, wurden die Schlitten zusammengebunden, die Zeltwände als Segel aufgetakelt, und auf diese Weise kam man 65 km in einem Tage der Westküste näher. Am Morgen des 20. lag das ganze Land südlich des Godthaabfjordes mit seinen schneebedeckten Felsbergen vor den Augen der Reisenden, die Fjorde konnte man nur ahnen, nicht sehen. Aber der Abstieg zur Küste sollte sehr schwierig werden durch steilgetürmtes Eis mit gähnenden tiefen Spalten, erst am 24. September hatte man sich hindurch- und hinabgearbeitet und stand mit Wonne auf Felsen, lagerte auf Gras und Moos und Heidekraut, in dessen betäubendem Tannengeruch, umweht von frischer Bergluft, gewärmt von einem großen Feuer ein Festmahl gehalten und aus den lange ungefüllt gewesenen Pfeifenköpfen in Ermangelung des Tabaks Moos geraucht wurde. Selbst der alte mürrische Ravna gestand, daß er gern an die Westküste ziehen würde; denn hier sei ein guter Ort für einen Berglappen, es seien viele Renntiere hier wie auf den Gebirgen Finnmarkens. Durch das Austmannatal kam Nansen am 26. September endlich an den Ameralikfjord, baute aus den Zweigen der dort wachsenden Weiden mit Sverdrup ein Bootsgerüst, das mit dem Segeltuchboden des Zeltes umgeben wurde und ruderte mit dem gefährlichen Fahrzeuge vom 29. September bis 3. Oktober nach Godthaab, wo er von Europäern und Eskimos als ein Held empfangen ward. Diese Niederlassung hat einige europäische Häuser, eine hochgelegene Kirche und eine Reihe grönländischer Hütten. Der Ort liegt in einer Talsenkung an einer kleinen Bucht. Es gelang Nansen durch kühne Kajakfahrer noch Botschaft nach Ivigtut zu senden, da nur von dort noch ein Schiff, der »Fox« der Kryolithgesellschaft, nach Europa fuhr. Nachdem auch die zurückgebliebenen Inlandeisfahrer vom Ameralikfjord in einem Holzboot und einem großen Weiberboot oder Umiak am 12. Oktober nach Godthaab gelangt waren, mußte freilich überwintert werden. Die Zeit wurde von Nansen dazu benutzt, eingehend das Leben der Eskimos zu erforschen, ihr kühnes Fischerleben auf dem Kajak, dem leichten einsitzigen, gedeckten Seehundsfellboot, das sie mit dem zweiblättrigen Ruder regieren, von dem aus sie die Jagd auf Seehunde mit der Blasenharpune am langen Fangriemen, die mit dem Wurfbrette geschleudert wird, betreiben, ihr häusliches Leben im Sommer und Winter, ihre Sitten und Gebräuche, ihre Religion und Kunst. Am 21. Mai 1889 trafen alle sechs Mitglieder der Nansenschen Forscherfahrt in Kopenhagen ein; am 30. Mai wurden sie festlich im Hafen von Kristiania empfangen.
Mit Nansens Reise war die von Nordenskjöld noch offen gelassene Frage eines tundrenartigen Innern von Grönland endgültig verneint, und unsere Vorstellungen von der früheren Vereisung Nordeuropas traten in viel helleres Licht.

Quelle: Mit Zeppelin nach Spitzbergen, herausgegeben von A. Miethe und H. Hergesell, Berlin, Bong & Co. Wenig gekürzt.Der Gedanke, mit Hilfe des Luftschiffes die arktischen Gegenden zu erforschen, ist nicht neu: der unglückliche Andree ließ sein Leben dafür, und der Amerikaner Wellmann wollte von Spitzbergen aus im lenkbaren Luftschiffe nach Norden fahren. Eine neue Anregung erhielt der Gedanke durch die großartigen Erfolge der starren Zeppelinluftschiffe seit dem Jahre 1907.
Im Sommer 1910 unternahmen Prinz Heinrich von Preußen und Graf Zeppelin mit verschiedenen deutschen Gelehrten eine Studienfahrt nach der unter dem Meridian Mitteleuropas (15°) und unter 80° nördlicher Breite gelegenen Inselgruppe Spitzbergen, die für solche Entdeckungsfahrten als Ausgangs- und Stützpunkt recht geeignet erscheint. Wenn auch die Luftfahrten in so hohen Breiten noch lange Zeit auf sich warten lassen dürften, wir verdanken dieser Studienreise des Grafen Zeppelin auf dem Lloyddampfer »Mainz« ein treffliches Buch mit wundervollen Farbenphotographien aus arktischen Gebieten, wie sie noch von keiner Forschungsreise so zahlreich mitgebracht wurden.
Am 16. Juli 1910 besuchte die »Mainz« den größten Fjord der Südinsel des Staatenlandes, den Eisfjord. Er greift wie eine Hand mit fünf fingerartigen Buchten in das Land ein: der Daumen wäre etwa die Ekmanbai, der Zeigefinger die Dicksonbai, der Mittelfinger die Klaas-Billenbai, der Goldfinger die Sassenbai und der kleine Finger die Adventbai. Folgen wir nun der Schilderung, die Professor Miethe von dieser Fahrt gibt: »Das Packeis, das uns am Tage vorher zu schaffen gemacht hatte, war durchaus nicht aus Sicht gekommen. Es lag vielmehr als ein scheinbar schmaler, unschuldiger, weißer Streifen unter dem blauen Himmel um das Kap Staratschin herum und erstreckte sich von dort aus nach Süden und Westen weit in das offene, sonnbeschienene Meer, glitzernd und funkelnd, bis es fern im Dunst des Horizontes sich verlor. Vor uns liegt nach Süden zu die vollkommen offene Mündung des Grünen Hafens mit seinen schneegefleckten Bergen und mit einem flachen, den Hintergrund ganz ausfüllenden Gletscher, der von den südlichen Höhen herabsteigt. Auf dem blauen Wasser treibt nur hie und da ein vereinzeltes Eisstück oder eine große Scholle, während wir, die Mitte des Fahrwassers innehaltend, vorsichtig in die Bucht hineindampfen. In der flimmernden Sonne erblicken wir schon von ferne eine blaue Rauchwolke, die von einer undeutlich sichtbaren Gruppe von Gebäuden auf der Ostseite des Beckens aufsteigt. Dort befindet sich eine Transiederei, die vor einigen Jahren hierher verlegt worden ist.
Während nämlich früher das Abspecken und Verarbeiten der Wale, welche die Fangboote im Nördlichen Eismeere erbeuteten, in Fabriken an der norwegischen Nordküste vorgenommen wurde, hat schließlich die Regierung dieses Landes doch ein Einsehen gehabt und die wirklich sehr unbehaglichen Betriebe des Landes verwiesen. Gegenwärtig werden daher die Transiedereien an mehreren Stellen der spitzbergischen Küste und bis vor kurzem auch eine solche auf der südlich davon gelegenen Bäreninsel betrieben, wo genügend Raum und keine Nachbarn vorhanden sind . .
Auf der Westseite des Grünen Hafens, etwa drei Seemeilen von seinem Eingange entfernt, liegt ein größeres Segelschiff dicht unter Land vertaut, und darauf halten wir zu, um auch dort vor Anker zu gehen. Als wir näher kommen und uns durch die verstreuten Eisschollen im Fahrwasser durcharbeiten, erkennen wir, daß dieses Fahrzeug auch eine Walschlächterei ist, die sich in lebhaftem Betrieb befindet. Das alte Schiff, das im Winter jedesmal nach Norwegen geschleppt wird, liegt nur im Sommer hier, und neben ihm im Wasser sind eine Reihe von Waläsern verankert, die wir zunächst für Felsen ansehen und die von Tausenden und aber Tausenden von Eissturmvögeln umschwärmt werden. Einige hundert Faden entfernt fällt unser Anker. Unser erster Ausflug an Land gilt der Transiederei am jenseitigen Ufer, die unter einem einförmigen, mit schmalen Schneerunsen gestreiften Höhenzug gelegen ist, an dessen Abhang mehrere schwarze Flecke sichtbar werden, die Ausbisse der bekannten Kohlenflöze, die hier hauptsächlich für den Gebrauch der Transiederei abgebaut werden . .
Kaum an Land, bemerken wir schon, daß wir uns einen nicht gerade vorteilhaften Platz ausgesucht haben. Aus dem sandigen Ufer, an dem einzelne Eisschollen und kleine Eisberge rings gestrandet sind, erheben sich massenhaft entsetzliche Reste von Walleibern und Gerippen, über denen die Sonne warm brütet und den Tran als schwärzliche Flüssigkeit zwischen den verwesten Massen herausschwitzt, während die durch die Fäulnis aufgetriebenen Aasteile eher an braunen Fels als an Fleischklumpen erinnern. Dem unbehaglichen Anblicke entsprechen die Düfte, die von diesem Leichenfelde ausgehen. Niemand gibt sich hier die Mühe, die abgespeckten Körper in See zu schleppen; sie bleiben einfach am Ufer liegen, wo sie allmählich verrotten und dabei der unentweihten Nase des Nichttranverständigen höchst lästig werden. Selbst beherzte Naturen kennen diesem furchtbaren Gerüche gegenüber nur eine Rettung: ungeordnete Flucht. Daß aber dies alles Sache der Gewöhnung ist, erkennt man daraus, daß in dieser ekelhaften Luft die Leute mit derselben Ruhe arbeiten, wie etwa gegenüber dem Jülichsplatz in Köln . .
Unmittelbar vor den niedrigen Fabrikgebäuden, die von einem Wald von Trantonnen umgeben sind und zwischen denen Walknochen sich türmen, brauner, stinkender Tran rinnt und Fleischabfälle ganze Berge bilden, liegt an der Brücke ein Frachtdampfer, der soeben beladen wird, und zu beiden Seiten arbeiten die Leute mit scharfen, spatenartigen Eisen, um mehrere Wale ihrer Speckhülle zu entkleiden. Der Speck wandert dann, in vierkantige Stücke im Gewicht von 10-15 kg zerlegt, in kleine Wagen und wird den mit Dampf geheizten Kesseln zugeführt, die reihenweise auf einem erhöhten Gerüst stehen, und in deren Bauch der Tran ausgeschmolzen wird. Was dann übrig bleibt, wird entleert und wie das taube Gestein in einem Erzbergwerk auf die Halde gestürzt. Eine Verarbeitung des Fleisches und der Knochen scheint gegenwärtig nicht stattzufinden, wie das früher in einzelnen Fabriken in Norwegen geschah, wo aus dem Fleisch Dungstoff, aus den Knochen Leim und Knochenmehl hergestellt wurde.
Wir entfliehen schnell dieser unerträglichen Umgebung, und während ein Teil von uns sich den oben am Berge gelegenen Kohlengruben zuwendet, wandern wir am Gestade entlang, wo sich zwischen den prächtig blauen und grünen Eisbergen das ruhige Meer ausbreitet und die Höhen am jenseitigen Ufer im durchsichtigen Violett des herrlichen Tages schimmern.
Warum der Grüne Hafen diesen Namen führt, ist schwer einzusehen; denn rings an den mit Geröll bedeckten kahlen Bergen zeigt sich kaum eine Spur der Pflanzenwelt. Nur an einzelnen Stellen, wo das Land ebener und aus rinnendem Schneewasser und tonigen Verwitterungsmassen ein höchst unbehaglicher Sumpf entstanden ist, grünt es von Moos und kleinen, zarten Alpenpflanzen, deren farbige, niedrige Blumenkronen sich der hellen Mittagssonne öffnen. Aber im ganzen herrschen die grauen, braunen, nach der Ferne zu ins Violette spielenden Töne vor. Man könnte den Blick in die Weite einförmig und schwermütig finden, aber die wunderbare Sonne, die ihren Glanz über Schnee und Eis, über das ruhige Meer und die flache Uferlinie ausbreitet, übergießt alles mit einem stillen Zauber friedlicher Ruhe und arktischer Größe, der uns ergreift. Es scheint, als ob das Tagesgestirn sich in der kurzen Sommerzeit bemühte, auch diesen verlassenen Erdenwinkel mit einer Fülle von Farbe und Pracht zu verschönen, ehe es ihn den Nebeln des Herbstes und den Winterstürmen überlassen muß . .
Am Nachmittag empfangen wir den ersten Besuch von spitzbergischen Fremdlingen an Bord. Der Kapitän des Transchiffes nebenan und sein Lotse erscheinen und berichten uns über ihre Tätigkeit und ihre Erfolge. Mit dem Ergebnis dieses Sommers sind sie überaus zufrieden. Mehr als fünfzig Wale sind von ihnen schon abgespeckt worden, und das alte Schiff ist fast voll beladen. Wenn man bedenkt, daß ein Wal durchschnittlich einen Wert von 3-4000 Kronen besitzt, so kann man sich vorstellen, daß die Transiederei manches Verlockende hat. Leider ist unser Gast aber von einem derartigen Dunstkreis umgeben, daß wir unsere Zwiesprache zweckmäßig auf Deck führen und uns nicht enthalten können, ihn darauf aufmerksam zu machen, daß wir von dieser seiner Eigenschaft nicht gerade begeistert sind. Er aber erklärt uns lächelnd, daß wir uns in wenigen Tagen ebenso wie er selbst und seine Mannschaft an den Geruch gewöhnt haben und ihn dann »ganz angenehm« finden werden. In freier Luft einen Wal abzuspecken, sei nicht schlimm, dagegen sei eine Arbeit, die er jetzt gerade längsseits vornehmen lasse, weniger behaglich. Seit Wochen nämlich schon suchten seine Mannschaften in einem abgespeckten Wal eine steckengebliebene Sprengharpune, die man durchaus wiederfinden müsse, ehe man das Aas der Strömung überlasse! . .
Das Eis hatte unter der Wirkung des kräftigen Windes zum größten Teil den Hafen verlassen, und wir wagten mit der »Mainz« einen Vorstoß in den Fjord. Herrlich war es, vorn auf der Back zu stehen und zu sehen, wie die mächtigen, grünen Eisschollen, wenn sie nicht in kurzer Wendung umfahren werden konnten, krachend vor den Bug unseres Schiffes gerieten, sich hoch auftürmten oder zerbrochen wurden und ohnmächtig zurückblieben. Bald lag der schmale Eisgürtel hinter uns, und wir konnten der Adventbai zufahren. Unter dem südlichen Ufer des Eisfjords hinsteuernd, hatten wir schöne Blicke auf die flachen, sargartigen, vielfach mannigfaltig ausgemeißelten Höhen, fuhren am Kohlenhafen mit dem sogenannten Vesuv vorbei und erreichten gegen Abend die Einfahrt zur Adventbai. Links an den Höhen lagen die verlassenen Gebäude eines Kohlenbergwerks, und wir warfen unter Kap Advent Anker. In diese Bai münden zwar keine Gletscher, so daß man vor Gletschereis sicher ist. Um so unangenehmer wurde das Baieneis selbst, das aus außerordentlich schweren, harten und dicken Schollen besteht.
Wir planten zunächst eine Fahrt mit unserem Motorboot nach der unerforschten Nordküste des Eisfjords, dessen große, überhaupt kaum noch untersuchten Eisströme blinkend im Sonnenscheine lockten. Aber leider war die Adventbai mittlerweile an ihrer Mündung vollständig mit Eis verstopft, und wir mußten daher den uns zur Verfügung stehenden Ruhetag zu einem Ausflug nach dem Hintergrunde der Bai benutzen. Unser Motorboot fuhr vorsichtig in die Bucht hinein und landete schließlich, da die Wassertiefe ein Vordringen nicht ermöglichte, bei einer niedrigen Landzunge, wo wir ausbooteten. Der Kutter wurde an Land gezogen, und wir begannen unsern Marsch. Das Wetter war wie in den ersten Wochen auf Spitzbergen fast immer ziemlich heiter und warm. Der Wind blies uns auf unserm Marsche vom Rücken her, so daß wir allmählich merkten, daß man auf Spitzbergen recht gründlich schwitzen kann. Auf äußerst einförmigem, schwierigem Gelände ging es langsam nach Süden, zunächst an dem teils sumpfigen, teils steinigen Ufer der Bai entlang bis zu dem weiten Adventtal, das von einem ziemlich starken Strom durchflossen wird. Wir mußten über die erhöhten Deltas seiner Zuflüsse, die mit einem schier ungangbaren Steingeröll bedeckt waren, hinüberstolpern und dann die ziemlich tiefen und reißenden Bäche durchwaten – oder wir hatten das Vergnügen, die Mächtigkeit der aufgetauten Oberschicht einer unergründlichen Sumpflandschaft, die offenbar nur für Watvögel bestimmt war, auszumessen. Meist fanden wir bei etwa 20 bis 25 cm festen Grund, darüber aber die furchtbarste Mischung von Eiswasser, Lehm und Moos, torfigen Pflanzenresten und zähem Schlick, die man sich überhaupt denken kann. Jeder Schritt erforderte neue Anstrengung, und bald zog sich unsere Gesellschaft weit auseinander. Während die Zoologen hauptsächlich am Bergabhange einige seltene Vögel, darunter eine merkwürdige Abart des Schneehuhns erbeuteten, suchten wir unsern mühsamen Weg mehr in der Ebene und wurden schließlich jagdlich so anspruchslos, daß wir uns mit den harmlosen, aber wohlschmeckenden Strandläufern und kleinen Schnepfen einließen, die allerdings massenhaft vorhanden waren. So ging es stundenlang immer langsamer taleinwärts, und endlich wurde mir denn doch klar, daß es hier augenblicklich nicht mehr Renntiere gab als auf unseren heimatlichen Mooren. Wir fanden nur zahlreiche, teilweise schon morsche, abgeworfene Stangen von Renntieren im Moose stecken. Die sich kreuzenden Fährten waren meist alt, und nur hin und wieder war eine frischere dazwischen, über deren Entstehungszeit allerdings immer noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestanden. Zwischen den noch toten, grauweißen Moospolstern des Vorjahres ließ an einigen Stellen in der unergründlichen, weiten Sumpflandschaft das Wollgras seine weißleuchtenden Flockenbüschel nicken. An warmen, geschützten Plätzen zwischen dem Geröll erhoben sich die kleinen, glänzenden, gelben und weißen Blüten des Alpenmohns und der Dryas, und an anderen waren niedrige rote Nelken in ihre halbkugelförmig gewölbten, kräftig grünen, moosartigen Laubkissen eingebettet.
Wir ruhten an einer leidlich trockenen Stelle und freuten uns der warmen Sonne und des kühlenden Windes, der über uns hinstrich. Dann aber dehnte sich endlos der Rückweg. In der Mittagswärme waren die Schmelzwässer, die rings von den Höhen herabsprudeln, wesentlich zahlreicher und bedeutender geworden, was nicht gerade zum Vorteil der Wegsamkeit beitrug, und müde und stumpfsinnig arbeiteten wir uns durch Schlamm und Morast, über Steingeröll und Felsblöcke wieder unserem Boote zu . .
Leider endete dieser erste größere Landausflug auf Spitzbergen mit einem kleinen Unfall, da unser flinkes Motorbootchen zwischen den gewaltigen Eisschollen, welche mittlerweile die ganze Adventbai angefüllt hatten, einen Schraubenflügel ganz verlor und einen zweiten gründlich verbog. Nicht etwa, daß wir gegen einen der saumseligen Riesen angefahren wären, nein, der Angriff ging von einem Eisberge selber aus, der sich gerade in dem Augenblick umkehrte, als wir an ihm vorbeifuhren. Dieses plötzliche Kentern der Eisschollen und Eisberge wird bewirkt durch das Abschmelzen der in das Wasser tauchenden Teile, wodurch sie das Gleichgewicht verlieren und gefährlich werden. Die Maschineningenieure der »Mainz« hatten mehrere Tage zu tun, um den gröbsten Schaden auszubessern.
Der Zufluß des Eises in der Adventbai nahm unter der Wirkung eines lebhaften nördlichen Windes und des Flutstromes ständig zu; von der Landzunge aus, die von Westen her die schmale Einfahrt begrenzt, erblickte man ein endloses Gefolge von mächtigen Eistrümmern, die sich in raschem Strom in die Bucht ergossen, um im südlichen Flachwasser derselben schließlich zu stranden. Am Abende war unsere »Mainz« fest von den groben Gesellen umgeben. Auch der nächste Tag brachte kaum eine merkliche Veränderung unserer etwas unbehaglichen Lage. Zwar ein Teil des Eises war aus der Adventbai hinausgetrieben, aber unsere unfreiwillige Gefangenschaft im Eispreß war damit noch nicht zu Ende. So beschlossen wir eine Fahrt zur Landungsbrücke des Kohlenbergwerks mit dem Boote zu machen. Dieses Kohlenbergwerk in der Adventbai ist das einzige bis jetzt mit einigem Erfolg abgebaute Vorkommen wirklich brauchbarer, verhältnismäßig junger, aber sehr guter Kohle auf Spitzbergen. Die englische Gesellschaft, die während der Sommermonate arbeitet und ihre Ausbeute auf eigenem Dampfer verfrachtet, hat den ganzen Betrieb dieses merkwürdigen Bergwerks in mustergültiger Weise eingerichtet. Nicht nur, daß in dem öden Tal, an dessen nördlichem Gehänge der Stollen in das Innere des Berges führt, eine kleine »Stadt« von Holzhäusern entstanden ist, die den Arbeitern gute und gesunde Unterkunft gewährt, sondern auch in anderen Beziehungen ist für das Wohl derselben in vernünftiger Weise gesorgt. Alkohol gelangt nur auf dem Wege der Touristendampfer in die Adventbai. Die Umgebung dieser »Longyear City« genannten kleinen Ansiedlung ist nichts weniger als malerisch. Auf fahler, zertretener und staubiger Tundra am steinigen Abhange des Berges gelegen, blickt sie auf den südlichen Teil der Bai und das öde Adventtal an der einen Seite, nach dem traurig ernsten, schneeigen Talschluß auf der andern Seite. Durch eine Drahtseilbahn ist die Gruppe mit einer Ladebrücke am Fjord verbunden, und der Abbau selbst gestaltet sich in dem wagerechten, steinhart gefrorenen Flöz recht einfach. Es scheint, als wenn diese Anlage einen dauernden, wenn auch bescheidenen Gewinn abzuwerfen fähig wäre, solange wenigstens die norwegische Regierung für den Betrieb der Ofotenbahn von Narvik bis tief nach Schweden hinein die Adventkohle bevorzugt. Seit 1916 haben einige norwegische Gesellschaften mit dem Kohlenabbau auf Spitzbergen begonnen, besonders am Eisfjord. Das Schwierigste ist die Verschiffung der geförderten Kohle in dem unberechenbaren kurzen arktischen Sommer. Doch zwingt die Weltkohlennot immer mehr auch zum Abbau der ungünstig gelegenen arktischen Flöze. Auch Schweden beutet die Braunkohle Spitzbergens seit 1917 am Glockensund aus. Am 11. Februar 1920 ist Norwegen die Oberhoheit über die Inselgruppe von Spitzbergen durch einen in Paris unterzeichneten Vertrag zuerkannt worden.
Endlich gelang es der »Mainz«, trotz Sturm und Eis aus der Umklammerung in der Adventbai sich glücklich frei zu machen. Der Himmel hatte sich mit Wolken bedeckt, an denen der seltsame Widerschein der Gletscher und des Inlandeises deutlich sichtbar wurde.« . .
Nach Nansen, Auf Schneeschuhen durch Grönland, 1. Bd. Hamburg 1901. In Nacht und Eis, 2. Bd. Leipzig 1886, F. A. Brockhaus.Die Gewässer des Polarmeeres sind sehr fischreich. Nördlich und westlich von Island z. B. lohnt sich der Fang auf Dorsche mit der Angelleine, weit draußen auf Hellflundern. Bald stößt das Schiff auf das Treibeis des Polarmeeres. Diese Eiswelt ist einförmig und einfach, im kleinen hat sie zwar eine unendliche Formenfülle und alle Farbentöne zwischen Blau und Grün; im großen ganzen aber hebt sich das treibende Eis als schimmernde weiße Fläche vom schwarzdunklen Meere ab und wirft einen hellen Widerschein gegen die Wolken. Der Himmel ist an hellen Tagen weißblau, meist aber von treibenden Wolken bedeckt oder in dichte Nebel gehüllt, bald erglühend gegen Morgen und Abend, bald träumerisch-licht in den hellen Nächten, bald düster-ernst in den Nächten der dunkeln Jahreszeit, wo Sternenschimmer und Nordlicht über den weißen Flächen spielen oder der Mond seine Bahn über die öde Natur zieht. Die Landschaft bleibt sich hier gleich, der Himmel gibt ihr Wechsel und Leben.
Die Schollen gleiten plätschernd über die bewegten Wellen, sie mehren sich zusehends, und es entsteht ein Geräusch wie ferner Brandungsschwall, wenn die See darüber geht und rasselnd die Eisschollen gegeneinander schiebt. Die Seehundsfänger sind so stark gebaut, daß sie dem Schollenstoß widerstehen. Die großen Eisschollen werden zertrümmert, die Bruchstücke übereinander gestaut bis zu 15 m Mächtigkeit im Sturme, es bilden sich so Eisberge aus dem Treibeis. So gelangt das Eis aus dem hohen Polarmeere, z. B. durch den Polarstrom nach Süden geführt, längs der Ostküste Grönlands in die Dänemarkstraße. Darauf tummeln sich Scharen einer großen pelagischen Seehundsart, der sogenannten Klappmütze (Cystophora cristata). Eine vorwiegend norwegische Fängerflottille von ungefähr 15 Schiffen macht seit 1876 auf sie Jagd. Die Männchen tragen über der Nase eine faltige Haut, die sie aufblasen können, daher der Name Klappmütze. Sie tauchen in große Tiefen und fangen dort Fische. Gesellig lebt dies Tier auf dem Treibeise der Gewässer von Spitzbergen, Grönland, Labrador, bei Nowaja Semlja kommt sie nicht vor. Bei Jan Mayen wird der grönländische Seehund (Phoca groenlandica) ebenso gejagt, indem die Jäger in Booten heranrudern und die Tiere abschießen, abhäuten und entspecken; das Fleisch ist die Speise der unzähligen Möwen, obwohl es für Menschen ganz gut genießbar ist. Aber der Seemann hat ein Vorurteil dagegen und ißt lieber das schwerverdauliche Salzfleisch.
Eine kleine Walart, der Rüsselwal oder Entenwal (Hyperoodon diodon) mit weichem, rundem Fettpolster über der Stirn, das über dem Wasser erscheint, tummelt sich gern in Scharen von fünf und mehr Stücken um die Schiffe. Seltener trifft man die großen gewaltigen Blauwale oder Grönlandswale (Balenoptera Sibaldii). Man hört sie von ferne schon gewaltig pusten und sieht die wasserdampfreiche Atemsäule aus den Nasenlöchern steigen. Der Schrecken dieser Großwale ist der Speckhauer (Orca gladiator), ein kleiner Zahnwal, der jene Riesen als schneller und ausdauernder Schwimmer verfolgt und ihnen mit seinem scharfen Gebiß große Stücke Speck aus den Seiten reißt, so lange, bis sie ermattet vom Blutverlust ihm zum Opfer fallen. Auch der Seehund ist nicht vor ihnen sicher. Seehunde treiben schaukelnd auf den Wellen wie Korkbojen und schlafen zwischen Schollen und treibenden Tangmassen. Wenn sich im Sommer (Juli bis September) im eigentlichen Polarbecken Rinnen im Eise bilden, wandern Scharen von Narwalen nordwärts bis 84½° n. Br., tummeln sich darin, machen Luftsprünge und zeigen ihre großen langen Stoßzähne. An diesen Rinnen halten sich auch mit Vorliebe die ungeschlachten Walrosse auf. Wie »Fleischberge« liegen sie auf dem Eise. Im Wasser aber entfalten sie große Gewandtheit, schwimmen unter den Schollen fort und tauchen in den Rinnen koboldartig auf; mit dem dicken häßlichen Kopfe brechen sie auch nach heftigen Stößen durch das Eis, um schnaubend und grunzend Atem zu schöpfen. Die Hauer müssen ihnen helfen, auf die Schollen zu klettern. Weithin schallt dann ihr Schnauben und Bellen und wetteifert mit dem Möwengeschrei.
Auf dem Eise treibt und wohnt und wandert der Eisbär und der Polarfuchs bis in hohe Breiten. Besonders reich ist aber das Vogelleben des nördlichen Eismeeres: Elfenbeinmöwen (Laras eburneus), Eissturmvögel (Procellaria glacialis), Grillummen (Uria grylle), Schneeammern (Plectrophanes nivalis), Krabbentaucher (Mergulus alle), Rosenmöwen (Rhodosthetia rosea) besonders im nördlichen Gebiete von Franz-Josephsland und viele andere halten sich den arktischen Sommer hindurch über dem Eise auf, nisten und brüten auf Klippen und streichen im Winter südwärts.
Der Meeresgrund des Polarmeeres liegt sehr tief. Nansens Messungen ergeben 3400-3900 m für das eigentliche Polarbecken, im Meere zwischen Grönland und Spitzbergen liegt eine große Tiefe von 4800 m, während südlich von Franz-Josephsland und Spitzbergen nur Tiefen von 300 m, nördlich der sibirischen Küste solche bis zu 150 m gemessen worden sind. Grauer Ton, arm an organischen Resten, arm an Kalk, bedeckt den Meeresgrund. Die sibirischen und amerikanischen Ströme tragen viel Schlamm in das nördliche Polarmeer. Auf 86° n. Br. fand sich solcher Schlamm auf dem Treibeise, auch sibirisches Treibholz wird auf dem Wege der Eisdrift bis nach Grönland durch das Polarbecken verfrachtet. Durch Winde wird die Eisdrift hervorgebracht, die sich von den neusibirischen Inseln durch das Polarbecken gegen die Ostküste Grönlands bewegt, ähnlich einer Meeresströmung. In 5-6 Jahren, schätzt Nansen, ist das Eis von der Beringstraße auf diesem Wege in dem großen »Schlund« zwischen Spitzbergen und Grönland angelangt, so daß sich das Eis im Polarmeere immer erneuert. Es wird dabei 3-4 m dick, erreicht aber durch die Pressungen zur Zeit der Fluten gewaltigere Mächtigkeit, auch dann, wenn nach langen Zeiten gleicher Winddrift der Wind umspringt und die entgegentreibende Eismasse aufstaut. Vom Atlantischen Ozean strömt in der Tiefe zwischen 100-500 m warmes, schweres salzhaltiges Wasser ein, das die Aussüßung des landumgebenen Nordeismeeres durch das Wasser der Ströme verhindert, deren kaltes leichtes Wasser obenauf schwimmt und die Eisbildung fördert. Flohkrebse hausen darin in großer Menge, in der Nähe von Land auch Schnecken und Seeigel zwischen Laminarien und Blasentang.
1. Island. – 2. Die Hekla in Tätigkeit. – 3. In Hammerfest, der nördlichsten Stadt der Erde. – 4. Der Lappe und das Renntier. – 5. Durch den Sognefjord zum Galdhöpig. – 6. Im südschwedischen Granitlande. – 7. Von Gotenburg nach Stockholm. – 8. Nach Finnland. – 9. Kopenhagen.
Quellen: Dr. C. Keilhack, Reisebilder aus Island. Gera 1885, Reisewitz' Verlag; Prof. A. Heusler, Berlin, Bilder aus Island. Deutsche Rundschau 1896, Nr. 22. 23; Prof. F. Vetter, Bern, Eine Besteigung der Hekla. Vom Fels zum Meer 1889 H. 11. Außerdem verweise ich auf: Valtyr Gudmundsson, Island am Beginn des 20. Jahrhunderts, übersetzt von R. Palleske. Kattowitz 1904.Island ist ein durchaus eigenartiges Stück Erde, sowohl nach seiner Lage und nach seiner Bodengestalt, als nach seinen Bewohnern und ihrer Geschichte. Fern vom Festland steigt es als »Fels im Meer« empor, an der äußersten Grenze der Menschenwelt eine dauernd bewohnte große Insel von über 100 000 qkm; 14 000 qkm unter inlandeisartigen Gletschern begraben, umspült von den Fluten des Eismeeres, im Norden im Winter vom Packeis gepanzert und doch aufgebaut und noch heute erwärmt und erschüttert von den heißen Glutkräften der Tiefe, im Süden umworben von warmen Wassern des Golfstroms, die tropische Hölzer aus den amerikanischen Urwäldern an die holzarme Insel tragen; bewohnt von 80 000 Menschen, die sich vornehmlich als Fischer und Bauern (Viehzüchter) ernähren und dabei stolz sind, Nachkommen der seit 874 eingewanderten Normannen zu sein und in ihrer Inselabgeschiedenheit ihre Sprache und Sitte rein erhalten zu haben, stolz auch auf ihr Schrifttum und den allzeit regen Bildungstrieb.
Der Reisende, der auf dem dänischen Postdampfer, von Kopenhagen her über den schottischen Hafen Leith bei Edinburg und über die Färöer kommend, die im Mittagsglanze hellsilberblau leuchtenden Wogen des Faxafjords an der Südwestküste kreuzt, sieht bald die freundlichen Holz- und Lavahäuser der kleinen Inselhauptstadt Reykjavik herüberleuchten. Sie zählt jetzt über 11 000 Einwohner. Neben der evangelisch-lutherischen Kirche steht das Parlamentsgebäude, wo die 40 Männer des Altthings das Wohl des Landes beraten. Durch Staatsvertrag vom 30. November 1918 ist Island ein selbständiger Staat geworden, der durch »Personalunion« mit Dänemark verbunden ist. Ein Ausschuß vertritt das Land beim Ministerium des Auswärtigen in Kopenhagen, und jeder dänischen Auslandsvertretung wird ein isländischer »Attaché« zugeteilt. Auch eine Art Hochschule beherbergt die Stadt: es können sich Ärzte, Geistliche und voraussichtlich bald auch Juristen hier ihre Vorbildung holen, doch studieren viele in Kopenhagen. Die inselreiche Bucht von Reykjavik umschließen mäßig ansteigende Kuppelberge, deren bräunliche Tuffmassen zu dem Hengill (770 m) aufsteigen und weiterhin übergehen in die Basaltberge im Osten und Norden. Der Boden der Stadt ist ein von der Eiszeit geglätteter Lavastrom, verfolgt man aber die Straße nach Eyrarbakki südöstlich gegen das Hellisskard, einen Bergpaß, so gelangt man in vierstündigem Ritte auf ein junges Lavafeld. Die Straße ist gut und erinnert in ihrem sanften Gefälle, das durch schöne Schlangenwindungen erreicht wird, an eine gute kleinere Alpenstraße. Im weiteren Verlaufe führen zwei sehr große Brücken über die beiden nicht durchreitbaren Ströme des Südviertels.
Mäßig gewellt zieht sich das junge Lavafeld drei Stunden landeinwärts hin. Der Boden ist grau und spielt je nach der Beleuchtung ins Stahlblaue, ins Violette oder Rostbraune. Zwischen den Lavatrümmern und dem Schutte liegen Flecke grünen Rasens verborgen, bestickt mit blühenden Enzianen und Steinbrechen, hie und da auch unterbrochen von einem rosenroten Polster der Alpenblume Silene acaulis, die die Isländer lambagras nennen, d. h. Lämmerkraut. Noch bunter, einem Treibhaus der lieblichsten Flora gleich, zeigen sich die phantastischen jungen Laven von Budir an der Nordseite des Faxafjordes. Zwischen den scharfen Zacken und kühnen Säulen, den schmalen Firsten und rundlichen Knollen, die Wind und Wetter noch nicht eingeebnet haben, zwischen den gespenstischen schwarzen Lavagebilden dieses Labyrinths, die im Sonnenglanze blauschwarze, noch gespenstischere Schatten werfen, wuchert es herauf von Farnkräutern, kriecht kratziges Brombeergerank hindurch, auch lichtgrüne Bärlappschlangen kommen hervor; auf sonnigen Stellen leuchtet Enzian und goldgelber Mauerpfeffer; es ist wie ein Zaubergarten für sich. Leben kommt auch durch die kristallklaren Bäche in die Landschaft, die durch das Lavagrau irgend einer der blauen Buchten zueilen, die die steinige Küste zerfransen. Aber es gibt auch tote Stellen, Lavawüsten, wo die Erde, ausgebrannt und verkohlt, anmutet wie Hochofenschlacke. Dunkle rußige Aschenkegel steigen dort auf mit zinnoberroten Brustlätzen vulkanischer Sande, in wirrer Unordnung hie und da hingestellt. Die Blöcke haben nur silbergraue Moose und Flechten erst erobert, viele sind auch noch ganz nackt, und nur unruhige Schlagschatten spielen zwischenhin.
Den Horizont im Süden bildet eine kühne Zackenlinie, deren Umriß dem der Berner Alpen ähnlich scheint. Besonders scharf hebt sich daraus der Hahnenkamm des Vifilsfells heraus, und doch ist die Kette nicht höher als 650 m, die zerrissenen Formen des ausgewitterten vulkanischen Tuffes lassen sie höher erscheinen. Das Auge verliert leicht das Maß. Am braunen splitterbesäten Vifilsfell senken sich schwer und breit Lavaflüsse nieder in Felsenkesseln, fächerförmig am Gehänge sich ausbreitend. Die Oberfläche ist glatt wie ein versteinerter Stromspiegel, aber winzige, kreisrunde Kraterkegelchen werfen im Abendschein lange Schatten auf die altsilberne Fläche, daß man auf den Mond verzaubert zu sein glaubt.
Östlich von Reykjavik liegt das große alte Lavafeld der Thingvellir. 200 qkm bedecken hier aus verschiedenen Kratern zusammengeflossene Lavaströme zwischen noch älteren Tuff- und Basalthöhen. Ein im Südwesten am stärksten wirksamer Einbruch längs mehrerer Bruchlinien schuf hier einen Kessel, der heute von dem 100 m tiefen Thingvallasee ausgefüllt ist. Er liegt völlig abgeschlossen im Schoße weichgipfliger Bergmassen. Gelbe hügelige Inseln träumen in seinem violettgrauen Wasserspiegel, am nördlichen Rande hebt sich der wellige Bergumriß des Hengill empor. Hier in der Nähe der Almannagjá (aller Männer Kluft), einer wilden Lavaschlucht von über 7 km Länge und hohen Steilwänden, von denen der Weltreisende Lord Dufferin sagte, es sei der Mühe wert, um die Erde zu reisen, nur um die Almannagjá zu sehen, tagten einst unter freiem Himmel auf dem Grasboden der Seeufer die Kammern der Landsgemeinde, wo sich schildkrötenartig flachgewölbte Lavaplatten nackt ringsum daraus hervorschälen.
Weiter ostwärts kommt man in das Gebiet der Geysirs. Heiße Quellen – wohl 50 an der Zahl – entströmen hier dem sumpfigen Boden. Der große Geysir hat sich einen 5 m hohen Kegel aus Kieselsinter um sein Sprudelloch gebaut; es stellt einen Trichter dar, dessen Rand 50 m Umfang bei 16 m Durchmesser hat und stets mit dampfendem Wasser gefüllt ist. Der Speischlund in der Mitte ist immer noch 5 m breit und schleuderte 1810 aller sechs Stunden, 1860 nur noch aller 4-5 Tage (heutzutage etwa aller 20 Tage) eine gewaltige kochende Wassergarbe gen Himmel. Der alte Wüterich leidet eben an Altersschwäche. Doch hat er all den heißen Springquellen der Erde seinen Namen als Gattungsnamen gegeben. 70 m davon wallt in einer weißschimmernden Sinterröhre von 2 m Durchmesser im ebenen Boden die kochende Wassersäule des Strokkr auf und ab; ab und zu schießt auch hier das herrlich blaugrüne Wasser aus dem alabasterweißen Schlunde zu 30-40 m Höhe empor in gewaltigem Ausbruch, wenn die Wasserdämpfe in der Tiefe die nötige Spannung erreicht haben. Große Wolken heißer Dämpfe breiten sich dann pinienartig über der Ausbruchsstelle aus.
Südlich dieses Gebietes heißer Quellen liegt eine flache Stromebene, lauter junges, grünes Schwemmland, durchschnitten von milchgrauen Gletscherflüssen und silberblauen, felsentsprungenen und daher geläuterten Gewässern, die braunes Erdreich einfaßt. Rietflächen decken moorigen Boden zu, darüber tanzen irrlichtartig die weißleuchtenden Büschel des Wollgrases (Eriophorum augustifolium). Frei wölbt sich die zarte Bläue der reinen Luft. Inselgleich erheben sich hie und da übergrünte Hügelgestalten aus dem flachen Niederlande, auch größere Horste aus dem wasserreichen Plane, alte stehengebliebene Tuffpfeiler, einst lange Zeit vom Meere umkämpft, wie noch heute draußen die Westmännerinseln vor der Küste, dann landfest gemacht durch die Geschiebe und den Schlamm der Flüsse. Graue Zungen vulkanischen Flugsandes unterbrechen das lebhafte Grün der weiten Stromebene im Osten, die im Sturme oft ihre Lage wechseln und sogar Höfe öde gelegt haben. Sie entstammen der isländischen Schwester des Vesuvs, der Hekla, die sich im Osten der Niederung, südlich vom Geysir als schwarzblauer breit hingelagerter Vulkan mit einem glänzenden Schneemantel um die Schultern zu einer Höhe von 1557 m aufschwingt. Ihre Form ist ausgeprägt, als regelmäßige Halbkugel scheint sie sich aus der Tiefe empor und wieder zu Tale zu wölben, aber ihr fehlt die Rauchpinie, die den Vesuv so schön macht. Gewaltige Lavafluten sind rings um ihren Fuß erstarrt in schwarzen zerrissenen gletscherartigen Strömen.
Ein dürftiges isländisches Gehöft, Naefurholt, ist die letzte Raststätte vor dem Anstieg zum Gipfel des alten »Hechelbergs«, den schon Irenikus 1570 in seiner descriptio Germaniae als das Abbild der Hölle und des Fegefeuers beschrieb. Der Hof besteht wie fast alle isländische Bauernhäuser aus mehreren, mit den Langseiten aneinandergebauten Hütten, aus unbehauenen Steinen und Rasenstücken aufgebaut. Sie lehnen sich an den Hang und schauen auf einen kleinen See, den wilde Schwäne bewohnen, mit den bretterverschalten, bemalten Giebeldreiecken hinaus. Eine Rasenmauer umgrenzt den bachdurchrauschten grünen Rasenplatz; dort wuchert die breitblättrige Archangelica officinalis, und hohe rötliche Ampferstauden umrahmen wie eine kleine Allee den Zugang zum Hause. Aus Rasenstücken ist auch das Dach zusammengesetzt, von dem die schöne »Baldersbraue« (Anthemis cotula) mit ihrer leuchtenden Asterblume herabnickt. So gleicht das Gehöft von der Bergseite einer Reihe begrünter Erdhügelchen, von der Seeseite macht es den Eindruck, als sei das Giebelstück mit seinen Fenstern und Türen vor eine Erdhöhle hingesetzt. Der isländische Bauer ist sehr gastfrei; fast überall hat er eine gestastofa, Gaststube, für den Fremdling bereit, darin einige notwendige Möbel, bei Reichen bisweilen aus Mahagonitreibholz gebaut; abends werden dort Betten aufgeschlagen, mit sehr gutem Bettzeug; denn die isländischen Eiderenten haben gute Daunen. Hier aber im ärmlichen Einsiedelhof, am äußersten Vorposten der Kultur gegen das rauhe Innere, muß der Gast mit der badstofa (»Badestube«) fürlieb nehmen. Das war im Mittelalter allerdings ein Baderaum, ist jetzt aber der gemeinsame Schlafsaal der isländischen Familie, einschließlich der Knechte und Mägde.
Am Morgen erwarten den Reisenden und seinen Führer die kleinen ponyartigen Pferdchen, die an Gewandtheit im Klettern es den Maultieren gleichtun. Meist sind es Schimmel oder Füchse, häufig sind auch Schecken mit weißen und rotbraunen Flecken wie das Simmentaler Vieh. Über Lavafelder klettern die munteren Tiere, oft versinkt der Huf in graugrünen Kissen isländischer Flechte (Cetraria islandica), hier Fjallagras (Bergkraut) genannt. Mehrere parasitische Krater sitzen auf dem Gehänge auf, so der vom vorletzten Ausbruche von 1845. Der Lavastrom, der sich damals aus der südwestlichen Bergschulter ergoß, steht wie eine erstarrte Brandungswoge da, schwarz mit wenigen grauen Moosflecken, die Oberfläche zerrissen gleich spritzendem Schaum, wie die Tätigkeit der gespannten Gase im Innern sie bei der Abkühlung auftrieb. Hier versagen die Pferde, und der Reisende muß seinen Weg selbst suchen durch das zerspratzte Lavafeld. Eine Schneekehle führt zum Krater von 1845 hinauf, der, von roten und schwarzen Lavaschlacken eingefaßt, im Innern die erstarrte und zersprungene graue Masse zeigt, wie sie zurückebbend in sich selbst verbrodelt ist. Beim weiteren Aufstieg erleichtert der Schneemantel, der die Unebenheiten der Lava ausgleicht, das Gehen. Schwarzer Lavasand liegt schichtenweise darauf, hier steigt ein brandroter Schlackenkegel aus dem Weiß des verfirnten Schnees auf. Endlich steht man auf dem Rande des Hauptkraters, der in seinem Ring von etwa 300 m Durchmesser an zwei Stellen der schwarz, gelb und roten aperen Sonnenseite Wasserdampf aus Rissen und Poren des Tuffes aushaucht. Nach Osten hin liegt ein zweiter etwas kleinerer Krater, dessen Schanzring den höchsten Punkt des Berges trägt, vergraben in dichtem Schnee. Dort glänzt gegen Nordosten der breite Vatnajökull, mit seiner riesigen, alle Unebenheiten des Untergrundes verbergenden, ganz flachgewölbten Eiskappe mehr ein Inlandeisrest von über 8000 qkm Größe als ein Gletscher, ein echter Jökull; sein Eis ist glatt und nur wenig durchschrundet, von den Rändern hängt hie und da eine Zunge, ein gletscherartiger Zipfel herab. Violette, kühn geformte Bergumrisse im Vordergrunde bilden einen wirksamen Gegensatz zu der duftigen Firnlinie des Jökulls in der Ferne. Blaue Seespiegel sind dazwischen gelegt. Gegen Südost richtet sich der Blick auf die grauenvolle Lavawüste, in der 1878 der letzte gewaltige Ausbruch stattfand, gegen Westen auf die von 1845. Hier schimmern in der Ferne Strombänder und blaues Meer herüber. Gegen Norden flachwelliges Grasland und Heiderücken, wo kleine Gruppen isländischer Schafe äsen zwischen Blaubeergestrüpp und buschigen Birken und Zwergweiden, dahinter die zweitgrößte Gletschermasse Islands, der Langjökull, eine schimmernde Silberfläche, deren Umriß sich sanft der weißblauen Himmelsluft anschmiegt, aber absticht nach unten von dem dumpfen Grünbraun der Heide, das übergeht in das Grün des südlichen Stromlandes.
Ganz anders ist die Basaltlandschaft des Nordwestlandes und der Nordküste Islands! Ein fjorddurchschnittenes Hochland von 5-600 m Höhe mit vielen Halbinseln, Landfingern, die in die See hinauszugreifen scheinen nach den basaltenen Felsklippen, die in ihrer Verlängerung liegen, Seevögelsiedlungen. Das Hochland ist Heide und Trümmerland, auch flache Firndecken liegen darauf. Die Wände der Fjorde, die engen Täler der Nordflüsse legen tiefe Schnitte in das Schichtengefüge der alten Basaltlava. Die oberste Lage ist am weitesten zurückgedrängt, die nächsttiefere springt etwas vor, und so geht es über 20-90 Stufen einer Riesentreppe herab; die einzelnen Geröllhalden der Stufen sind oft mit grünem Weidenteppich behängt; Nebenflüsse haben unten am Fjordspiegel in kleinen Schuttfächern all das ausgebreitet, was sie in mühsam ausnagender Arbeit den schwarzen »Trappwänden« abrangen. »Man muß diese Küste im vollen Sonnenlichte des Abends sehen,« schreibt Prof. Heusler. »Dann gewahrt man erst, wie der Basalt, bei bewölktem Himmel eine mürrische Gesteinsart, Körper und Ausdruck erlangt; wie der Schattenschlag seiner Klüfte sich entfaltet; wie das metallische Rot (des Eisenoxyds) aufleuchtet und diese ganze Bergwelt ein leidenschaftliches Leben gewinnt. Und ihr zu Füßen funkelt das stahlblaue Meer: ein gemilderter Goldbronzeschimmer legt sich von den hohen Ufern auf die bewegte Wellenfläche.«
Der Isländer ist nicht mehr der hünenhafte Wiking, den eher der Färinger noch vorstellt. Er ist schlank und zierlich gebaut, nicht vierschrötig veranlagt, sondern eher nervös-zart. Obwohl auf den Dorschfang und die Schafzucht angewiesen, betreibt er beides nicht mit der Glut der Gewinnsucht; der Großfang liegt in den Händen der Bretagner und Norweger; den Handel hatten die Dänen einst ganz in ihren Händen, erst nach und nach haben sich die Isländer darein gefunden, das Geschäft selbst zu machen. Der Isländer richtete sein Streben von jeher mehr auf Geistesbildung, die sich besonders in liebenswürdiger Gastlichkeit und feinem literarischen Wissen und Können offenbart. So kommt es dahin, daß der uns geläufige Begriff des Standesunterschiedes auf Island überwunden ist: es gilt gleich, ob »einer eines Tagelöhners Habe hat, er hat doch eines Königs Sinn«. Die Isländer sind ein Volk von Aristo-Demokraten, das seine Kraft aus den Schätzen seiner Sprache, aus den Sagas und den Werken seiner Dichter und Gelehrten zieht.
Nach Jón Svensson, Zwischen Eis und Feuer. Ein Ritt durch Island. Übersetzung von Johannes Mayrhofer. Breslau, Franz Goerlich. Preis brosch. M. 5.– nebst Teuerungszuschlag.Der Gipfel der Hekla ist im allgemeinen von einer kleinen Wolkenhaube umgeben. Daher hat sie auch ihren Namen, denn Hekla bedeutet Haube. In geschichtlicher Zeit hat sie 21 Ausbrüche gehabt. Der erste fand statt 1104, der letzte 1878. Die kürzeste Zeit, die der Vulkan geruht hat, ist sechs, die längste 79 Jahre. Von allen Ausbrüchen der Hekla ist der, welcher 1845-1846 stattfand, der am besten beschriebene.
Der Winter 1844 auf 1845 war ungewöhnlich mild. Die Erde war schon im April grün und mit Blumen bedeckt. Frühling und Sommer entsprachen dem Winter. Es herrschte andauernd eine solche Wärme, daß man seit Menschengedenken kaum etwas Ähnliches gekannt hatte. Doch zu aller Verwunderung fiel kein Regen und das, obschon der Himmel oft mit Wolken überzogen war. Diese ungewöhnlichen Witterungsverhältnisse fingen zuletzt an, einzelnen Leuten Bedenken einzuflößen; denn man wußte in dem vulkanischen Lande gut, daß die meisten Vulkanausbrüche gerade durch ähnliche Zeichen vorher verkündigt worden waren.
Alte Leute erinnerten sich noch, daß vor dem furchtbaren Ausbruch der Skaptárvulkane 1783 der Winter besonders mild und der Sommer warm und trocken gewesen war. Es herrschte also im ganzen Lande eine gewisse bange Erwartung, eine drückende, nervöse Spannung; denn in diesem meist vulkanischen Lande der Welt kann niemand wissen, wo das Unglück losbrechen wird. Es kann gerade so gut im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen geschehen. Man lebte also auf einem brennenden Vulkan. Hier konnte diese Redewendung im eigentlichen Sinne gebraucht werden.
Dann verbreitete sich über die ganze Insel hin das Gerücht, daß die Schneeflecken auf dem Rücken der Hekla im Laufe des Sommers merkwürdig abnähmen. Einige beruhigten sich mit der Erklärung, daß ja im Laufe des ungewöhnlich milden Winters viel weniger Schnee als sonst gefallen war. Doch war jetzt aller Aufmerksamkeit ganz besonders auf die Hekla gerichtet.
Außer den erwähnten Beobachtungen hatte man auch eine neue gemacht, die von vielen mit einem möglichen Ausbruch gerade der Hekla in Verbindung gebracht wurde. Es trat nämlich vom 4. bis 5. August auf allen Gehöften, die in der unmittelbaren Nähe des Vulkans lagen, eine plötzliche und höchst auffällige Verminderung in den Milchmengen des Viehes ein. Man erhielt so von dieser Zeit an, ganz unerwartet, nur ungefähr den dritten Teil der Milch, die Kühe und Schafe bis dahin gegeben hatten. Auch dies kannte man im Lande als Zeichen eines baldigen Ausbruches. Die Naturforscher suchen den Grund für diese merkwürdige Tatsache in einer dem Ausbruch gerade vorangehenden allgemeinen Ausdünstung saurer Dämpfe von der Erde her.
Zu all diesen Vorboten kam dann noch einer: alle die kochenden Quellen, welche in großer Zahl in der Nähe der Hekla sprudeln, begannen im Laufe des Sommers in einem früher unbekannten Grade anzuschwellen. Ja, es war sogar eine ganze Anzahl neuer Quellen dazu gekommen. Dieser letzte Umstand wurde jedoch von einzelnen als eine Beruhigung aufgefaßt. Die unterirdische Wärme, sagten sie, sucht sich auf andere Weise einen Ausweg. Andere dagegen hielten diese Vermehrung der Wirksamkeit der warmen Quellen für ein sicheres Zeichen, daß das unterirdische Feuer jetzt daran war, sich der Oberfläche zu nähern, und daß man sich deshalb in nächster Zeit auf einen Ausbruch der Hekla gefaßt machen müsse. Und diese Leute bekamen denn auch vollständig recht.
Am 22. August wurde auf einmal das ungewöhnlich trockene Wetter vom Regen abgelöst, der jetzt mit wenig Unterbrechungen bis zum Ende des Monats andauerte. Den 1. September hörte der Regen auf, und das Wetter wurde mit einem Male auffallend schwül und still. Das war die Stille vor dem großen Unwetter.
Als man am 2. September 1845 erwachte, sah man weder die Hekla noch die andern nahegelegenen Berge. Sie waren alle in dicke, dunkle Wolken eingehüllt. Plötzlich, um 9 Uhr vormittags, begann das furchtbare Schauspiel, das nun 7 Monate dauern sollte, ganz dramatisch mit einem dumpfen Krachen, das von den großen Bergen im Osten zu kommen schien. Zugleich verspürte man ein eigentümliches Zittern der Erdrinde. Bald wiederholte sich das Gekrach. Das große Schauspiel hatte begonnen, und doch, wie merkwürdig das auch klingt, waren manche, die noch nicht daran glauben wollten. Sie meinten, das Geräusch rühre von einem Gewitter her, das zwischen den östlichen Bergen heraufziehe. Doch hatte man bei einem Gewitter noch nie ein solches Poltern gehört wie dieses.
Nach etwa einer Viertelstunde wurde das Dröhnen so deutlich und so unheimlich regelmäßig, daß jetzt alle Gewißheit darüber erlangten, es komme von der Hekla und ein wirklicher Ausbruch habe eingesetzt. Ängstliche Blicke richteten sich jetzt gegen den Vulkan, der noch in die dunklen Wolken gehüllt war. Um 10 Uhr sah man plötzlich, wie sich eine kohlschwarze Wolke himmelhoch über dem Berge erhob, ja hoch über den Wolken, in die er eingehüllt war, und gleichzeitig hörte man dort ein Krachen und Donnern. Um 11 Uhr entsandte die Wolke, die sich nun über den Himmel ausbreitete, einen dichten Regen graugelber Asche zugleich mit einer riesigen Menge graugelber Schlackenstücke, ungefähr von der Größe des Fuchsschrotes. Zugleich verdunkelte sich mit einem Male der Himmel, so daß der helle Tag sich plötzlich in die schwärzeste Winternacht verwandelte. Man konnte nicht mehr die eigene Hand sehen. Überall mußte man Licht in den Häusern anzünden, und Leute, die draußen auf den Feldern waren, konnten nur mit Mühe den Heimweg finden. Nach einer Stunde wurde es langsam wieder Tag, wie der Morgen graut nach einer finsteren Nacht. Der grobe graugelbe Gries bedeckte schließlich die Erde mit einer halbzolldicken Schicht.
Darauf hörte das auf, und statt dessen kam zuerst ein Regen von kohlschwarzem und darauf von stahlgrauem, etwas glänzendem, vulkanischem Sand. Dieser Sandregen dauerte den ganzen Nachmittag und wurde dann allmählich von dem Fall einer feineren kohlschwarzen Asche abgelöst, der die ganze folgende Nacht hindurch anhielt. Am Morgen des 3. September war die Erde mit einer anderthalb Zoll dicken Lage von Grieß, Sand und Asche bedeckt. Das unterirdische Krachen hielt beständig mit gleicher Stärke und mit der stets gleichen unheimlichen Regelmäßigkeit an.
Höchst merkwürdig war folgende Beobachtung: Obschon dieses regelmäßige dumpfe Krachen in unmittelbarer Nähe der Hekla nicht von überwältigend großer Kraft war, so hörte man es doch über das ganze Land hin, das eine Ausdehnung von nicht weniger als 100 000 qkm hat. Ja, man hörte es selbst auf den fernsten Inseln, die doch über 300 km vom Vulkan entfernt liegen. Aber das Allermerkwürdigste war, daß es an allen diesen Stellen mit einer ebenso großen Stärke gehört wurde wie in der Nähe des Vulkans. Das gibt eine Vorstellung davon, aus welch unermeßlicher Tiefe es kommen mußte. Man kann leicht einsehen, daß sich das Dröhnen über desto weiter ausgedehnte Landesteile in demselben Stärkemaß verbreiten konnte, je tiefer unter der Erdrinde es entstand.
Am 3. September in der Mittagszeit hörte man plötzlich zweimal ein außerordentlich gewaltsames Krachen, daß die Leute erschreckt zusammenfuhren –, aber gleich darauf ließ das regelmäßige unterirdische Getöse nach. Dies dauerte indes nicht lange; früh am Nachmittage fing es wieder an wie vordem, nur mit größerer Kraft. Diesmal klang es, als ob eine große Kanone nach der andern abgefeuert wurde. Gegen 3 Uhr klärte es sich etwas um den Vulkan auf, und jetzt konnte man deutlich eine gewaltige kohlschwarze Aschensäule senkrecht vom Gipfel des Berges aufsteigen sehen. Die Asche wurde mit solcher Riesenkraft herausgeschleudert, daß man den obersten Teil kaum sehen konnte; er war hoch über den Wolken. Ein anderes Zeichen dieser ungeheuren Kraft war dies, daß die Aschensäule ganz senkrecht nach oben strebte, obschon ein starker Wind ging. Außerdem wurde sie häufig von plötzlich aufleuchtenden, außerordentlich scharfen Blitzen durchkreuzt. Erst in der höchsten Höhe bog sie sich nach Osten um. So blieb es bis zum Abend. 7 Uhr 30 Minuten hörte man mit einem Male ein entsetzliches Dröhnen, als ob tausend schwere Kanonen auf einmal abgefeuert würden – oder vielleicht eher: als ob ein tausendfacher Donner auf einmal loskrachte. Menschen und Tiere wurden vom äußersten Schrecken ergriffen. Danach ward mit einem Male das glühende Innere des Vulkans sichtbar.
Der ganze Horizont wurde mit einem blutroten Schein beleuchtet. Eine mächtige, unruhige Flamme schlug vom Gipfel der Hekla empor, und ungeheure rotglühende Felsblöcke wälzten sich in diesem schauerlichen Scheiterhaufen. Diese leuchtenden Steinblöcke wurden unaufhörlich auf und ab geworfen in dem gewaltigen, grauenerweckenden Flammenmeer. Als es ganz finster geworden war, sah der Vulkan aus, als wäre er von oben bis unten in zwei Teile gespalten. Durch den mächtigen Riß sah man des Berges Inhalt: ein furchtbares leuchtendes Feuer. Doch war dies nur scheinbar so. Der leuchtende Feuerstreifen war der Lavafluß, der sich jetzt vom Gipfel der Hekla her voranwälzte und sich an der westlichen Seite des Berges bis ins Tiefland hinabstürzte.
Die Flüsse in der Nähe wurden in dem Grade von glühenden Steinen und Lavastücken angefüllt, daß sie an vielen Stellen über die Ufer gingen. Zugleich wurde ihr sonst eiskaltes Gletscherwasser plötzlich so heiß, daß man nicht die Hand hineinhalten konnte. Insbesondere ergoß der große, fischreiche Fluß Vestri-Rangá seine kochendheißen Wasser über das Land und warf unzählige halbgekochte Forellen auf das trockene Land. Das sonst so klare Wasser wurde zuletzt in dem Maße mit Grieß, Schlamm und Asche angefüllt, daß es am ehesten einem Lehmbrei glich.
Das Steigen der Gewässer rührte besonders von dem schnellen Schmelzen all des Schnees und des Eises her, das sich noch in den höher gelegenen Gegenden befand. Nachts sanken sie dann wieder und verminderten sich zu der gewohnten Höhe.
Die Aschenmenge, die beständig vom Gipfel der Hekla ausgeschleudert und mit großer Schnelligkeit von einem starken Sturm über den Atlantischen Ozean hingetragen wurde, war so groß, daß die Schiffe, die sich am 3. und 4. September in einem Abstand von 800-1000 km von Island befanden, bei den Färöern, Schetlands- und Orkneyinseln, von einem heftigen Aschenregen überfallen wurden. Auf diesen Inseln selbst fiel eine Menge Asche kurz nach dem Ausbruche.
Die großen Schafherden Islands (über 700 000 Stück!) leben den ganzen Sommer über in vollständiger Freiheit auf den Bergen in den innern, unbewohnten Teilen der Insel. Vor Wintersanfang, meistens im September, sammelt man sie und treibt sie wieder heim in die Hürden. Damals also waren sie noch oben, auf allen Seiten vom Schrecken umgeben, mitten in dem brennenden Aschenregen. Die Bauern waren sehr bekümmert und nahmen an, daß die meisten der Tiere umgekommen seien, besonders da sie ja ohne Schutz den niederfallenden, glühenden Schlackenstücken ausgesetzt waren. Aber die armen Tiere wußten sich besser zu helfen, als man geglaubt hatte. Sie hatten ihr Heil in der Flucht gesucht, und nur verhältnismäßig wenige gingen zugrunde. Nördlich der Hekla fließen zwei große Elfe, Thorsaa und Tungna-aa. Diese reißenden Ströme hinderten die Tiere daran, nach Norden zu flüchten. Sie mußten ihre Rettung suchen, indem sie zwischen Hekla und den Flüssen liefen. Man sah die gescheuchten Tiere dann auch schon am ersten Tage des Ausbruchs laut blökend in langen Reihen von den Höhen herniederlaufen. Ihr Pelz war schwarz von Asche, ja, an vielen war die Wolle versengt; einige hatten sogar schlimme Brandwunden erlitten. Das Fleisch um die Klauen war blutig, aufgeschwollen und zerschnitten von den scharfen Lavastücken, worauf sie beständig treten mußten. Die sich gar nicht mehr voranschleppen konnten, mußte man zu Pferde zurückbringen und sah sie noch lange nachher auf den Knien weiden . .
Der Ausbruch hielt einen Tag und eine Nacht an: immerfort Feuer und Asche und Krachen und Poltern. Der Lavastrom ergoß sich unaufhörlich über das flache Land mit Prasseln und Krachen, während andauernd lose Lavablöcke neben ihm hinabrollten. Bald aber bekam er eine dünne Kruste auf der Oberfläche. Von höher gelegenen Punkten konnte man deutlich sehen, wie die glühende, schwerflüssige Masse sich vorwärts schob unter der erstarrten Kruste. Doch drängte sich die geschmolzene Masse an vielen Stellen aus den Rissen in der Rinde hervor wie rotglühendes Metall. Bisweilen brachen größere Lavamassen plötzlich durch und bedeckten die Felder mit großen, feuerroten Flecken, die dann bald erstarrten. Diese plötzlichen Ausflüsse machten es sehr gefährlich, sich dem Lavastrome zu nähern. Doch wagten viele den Versuch. Aber wenn man in einen Abstand von etwa zwei Metern kam, wurde es fast unmöglich, die Wärme auszuhalten. Waren die Kleider naß vom Regen, so trockneten sie fast augenblicklich. Steckte man eine lange Eisenstange in die geschmolzene Masse, so wurde sie nach einigen Minuten rotglühend. Die wachsende Schnelligkeit des Lavaflusses im Tieflande betrug anfangs etwa 50 m in 24 Stunden, später gegen 300 m. Seine Dicke am Rande wechselte zwischen 12-25 m.
Die Asche verwüstete die Weideplätze. Schafe, Pferde und Kühe hatten keine Ruhe. Sie gingen auf den Weiden hin und her wie im Winter, wenn alles mit Schnee bedeckt ist. Das Gras war ja geradezu vergiftet von der vulkanischen Asche. Der Hunger trieb sie dann heim zum Gehöft, wo sie begierig das Gras von den Wänden des Hauses zu fressen suchten, wo die Asche sich nicht hatte aufhäufen können wie auf der flachen Erde . .
Am 14. und 15. September steigerte sich plötzlich das Gräßliche der Lage dadurch, daß man nun mit einem Male ein schreckliches Dröhnen vernahm, aber von einer ganz neuen Art. Es erfolgte regelmäßig mit einer Minute Zwischenraum. Dieses neue Dröhnen war so gewaltsam, daß die Leute in einem Umkreis von 20 km Tücher um den Kopf binden mußten, um es aushalten zu können. Es war, als ob ein Riese andauernd stöhnte. Nach jedem Stöhnen wurde schwarze Asche angeschleudert; dazwischen sah man nun weißliche Dampfmassen. So blieb es bis zum 18. September, nur daß der Aschenfall am 15. von unerträglichem Gestank begleitet wurde.
Am 18. September sah man plötzlich am nördlichen Himmel eine kleine schwarze Wolke, die sich langsam nach Süden bewegte. Sie näherte sich dem Vulkan mehr und mehr, bis sie zuletzt mit der Aschensäule zusammenstieß. Als der Zusammenstoß erfolgte, hörte man plötzlich zwei gewaltige Donnerschläge, die vollständig das sonst so starke Dröhnen vom Innern des Berges übertönten. Sie weckten zudem mehrfaches Echo von den umliegenden Bergen. Menschen und Tiere zitterten vor Entsetzen. Nachdem dies ohrenbetäubende Geräusch und sein Widerhall verstummt waren, hörte man jetzt ein so fürchterliches Brausen und Lärmen drinnen im Berge, daß kein Mensch in der folgenden Nacht auch nur einen Augenblick Schlaf bekommen konnte. Dies dauerte volle 36 Stunden.
Am 6. April 1846 endete das fürchterliche Schauspiel nach gut sieben Monaten Dauer. Aber fünf Jahre später war der Lavastrom noch nicht abgekühlt: aus zahlreichen Rissen und Löchern stiegen Dämpfe auf von über 75°C. Und doch war dieser Ausbruch nicht der schlimmste der Hekla: kein Menschenleben ging verloren, keine Wohnstatt wurde verwüstet, obwohl der nahegelegene Hof Naefurholt wegen der unbehaglichen Nachbarschaft verlassen werden mußte. Nur infolge der giftigen Asche auf den Weiden entstand eine Schafpest.
Bei dem Ausbruch 1294 barst die Erde an zahlreichen Stellen infolge starken Erdbebens, viele Wohnstätten wurden zerstört, und viele Menschenleben gingen verloren. Schon 6 Jahre später hatte die Hekla wiederum einen starken Ausbruch. 1341 wurden die fünf nächstgelegenen Landgemeinden vollständig verwüstet, 1436 18 Höfe in wenigen Stunden. 1554 waren die Stöße des Erdbebens beim Ausbruche so stark, daß sich die Leute hinlegen und am Grase festhalten mußten, um nicht hin und her geworfen zu werden. Auch 1597, 1636, 1766 hat der alte Hechelberg gewaltige Ausbrüche gehabt.
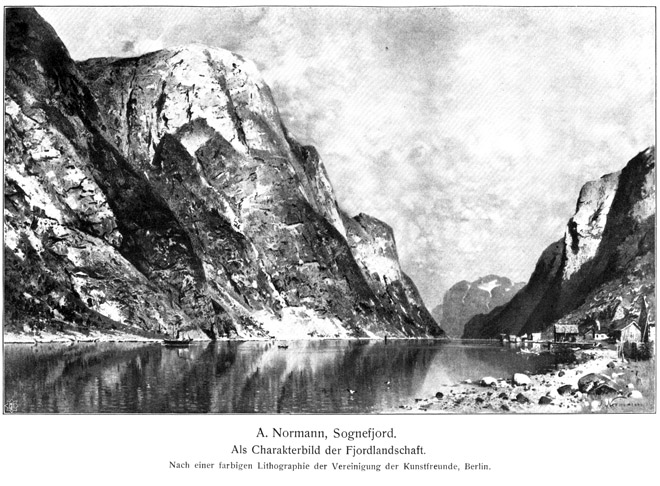
Aus Marmiers »Lettres sur le Nord« mit Entlehnungen aus S. Ruge, Norwegen. Leipzig 1899, Velhagen & Klasing.Auf der Westseite der »Walinsel«, norwegisch Qualö, liegt die nördlichste Stadt der Erde, Hammerfest. Nur in Norwegen konnte sie entstehen, denn von allen Ländern um den Nordpol hat es das günstigste Klima. Nirgends geht der Ackerbau höher gegen Norden hinauf auf der Erde, und am Nordkap unter 72° N. blühen noch Veilchen. Das dankt das Land der warmen Meeresströmung aus dem amerikanischen Mittelmeere, die sich an die Felsenküste schmiegt, in alle Fjorde dringt und warme Winde landeinwärts sendet, dem Golfstrome. Die Pflanzenwelt gewinnt freilich auch von dem langen Sommertage, wo die Sonne ziemlich sechs Wochen (in Hammerfest vom 14. Mai bis 28. Juli) über dem Horizonte schwebt und sich schraubenförmig höher am Himmel hinauf und wieder hinab zu drehen scheint.
Von der See her entdeckt das Auge kaum die gelbgrauen Holzhäuschen, den hölzernen Kirchturm, weil sie sich von der Felswand, an die sie sich anlehnen, kaum abheben. Die gewaltige Felsenwildnis ringsum, das breite Meer lassen die Stadt winzig genug erscheinen, »nicht größer als ein Schwalbennest zwischen den Pfeilern eines erhabenen Münsterbaues«, schreibt Dr. G. Wegener. »Es hat etwas Rührendes, dieses kleine tapfere Leben zu sehen, das sich an einem so weltverlorenen Orte festklemmt. Den Hafen bildet eine halbkreisförmige Bucht, die gegen die offene See durch Sorö gedeckt ist. Die meisten Häuser der Kaufleute, die Fischerhütten, die roten Speicher, liegen auf einer kleinen flachen Halbinsel am Südende der Bucht. Hier sind einige breite, rechtwinklig sich kreuzende Straßen, ein geräumiger Marktplatz mit einem Springbrunnen. In den Hafen hinaus springen geräumige Packhäuser, auf Pfählen errichtet, die Giebel dem Wasser zugekehrt und mit Kranen versehen. Hier lagern die Stockfische in luftigen Räumen, bis sie die Schiffe aus Rußland holen und Mehl dafür abladen.« Elektrisches Licht und Fernsprecher geben der Stadt einen großstädtischen Anstrich. Auf der anderen Seite der Bucht, gegen Norden, liegt die kleine Vorstadt Fuglnäs, wo zur Erinnerung an die skandinavisch-russische Gradmessung in den Jahren 1816-1852 eine Meridiansäule steht. Der Geruch, der von den Dorschtrockenplätzen ausgeht, liegt über der ganzen Stadt, und es bedarf langer Gewöhnung, bis man gegen den Trangestank genügend abgestumpft ist. Denn Hammerfest ist der Mittelpunkt der norwegischen Fischtransiederei.
Seit dem Anfange des Mittelalters erscheint der Name Hammerfest in den Handelsjahrbüchern von Finmarken. Es war damals nur eine Gruppe von Hütten; aber der sichere und bequeme Hafen war den Kaufleuten von Bergen schon bekannt, ebenso den russischen Fischern, welche bald hier ihre Netze ins Meer warfen, bald an den Küsten das Handwerk von Lotsen übten. Der während eines Jahrhunderts an eine Gilde verpachtete Handel brachte die Bevölkerung von Finmarken in eine Art Sklaverei und stürzte sie in das tiefste Elend. Im Jahre 1789 begriff die dänische Regierung endlich die traurigen Folgen des Vertrags, welchen sie mit einer habgierigen und grausamen Gesellschaft geschlossen hatte. Der Handel wurde wieder frei, und Hammerfest empfing zu gleicher Zeit die Gerechtsame einer Kaufmannschaft. Nach der Meinung derer, welche diesen Regierungsbefehl von 1789 ausstellten, sollte die Stadt einen reißenden Aufschwung nehmen. Man glaubte, sie sei bestimmt, der Mittelpunkt des Handels im Norden, eine Niederlage zwischen Finmarken und Archangel zu werden, aber diese Hoffnungen verwirklichten sich nicht; Hammerfest blieb lange Zeit nur ein Anlegeort. Leopold von Buch, welcher es im Jahre 1810 sah, entwirft davon ein trauriges Gemälde; die ganze Stadt – sagt er – besteht aus neun Wohnungen und hat nicht mehr als 44 Einwohner, worunter den Pfarrer, vier Kaufleute, einen Schullehrer und einen Schuhmacher. Man findet kaum Lebensmittel, nicht einmal Brennholz.
Binnen dreißig Jahren war aber der Ort so weit emporgekommen, daß er 80 Häuser mit 400 Einwohnern zählte, und gegenwärtig hat er fast 2500 Einwohner, große Speicher, Wirtshäuser, die den Namen Hotel tragen, Werkstätten und Fabriken. Dieser Fortschritt ist durch die Betriebsamkeit der Kaufleute geschehen, und Kaufleute bilden hier die Oberschicht. Einige sind Vertreter (Konsularagenten) verschiedener Staaten und genießen besonderes Ansehen. Im Alltagsleben ist die Auszeichnung des Konsuls eine Stickerei; bei wichtigen Gelegenheiten hat er den Vorrang vor allen übrigen Kaufleuten. Der Prediger ist zu bescheiden, um einer so vornehmen Würde nicht zu weichen. Der Zollaufseher allein mit seinen goldgestreiften Beinkleidern und mit seiner stets durch eine anspruchslose Tresse gezierten Mütze könnte ihm den Rang streitig machen.
Im Sommer bietet die kleine Stadt Hammerfest einen heiteren und belebten Anblick dar; sie sieht im Verlauf einiger Monate ein halbes Tausend Fahrzeuge, teils norwegische, teils fremde, namentlich englische und russische ankommen. Die einen freilich fahren nur durch den Fjord, um sich östlich nach Archangel oder westlich nach Tromsö zu wenden; andere gehen von Insel zu Insel, ihre Ladung voll zu machen, eine große Anzahl bleibt hier. Sie bringen Mehl, Hanf usw. und nehmen als Austausch Fische, Tran, Renntierhäute, Eiderdunen, Fuchspelze und Erze mit fort. Hammerfest ist die Hauptstadt von Westfinmarken. Sie zieht den größten Teil der Güter des Landes, von der Jagd nämlich und vom Fischfang, an sich und verbreitet die fremden Güter, welche sie empfangen hat, in die verschiedenen Kauforte des Bezirks.
Russen kommen in großer Anzahl in die Stadt. Es erscheinen auch schwedische, dänische und deutsche Briggs; aber jeden Tag führt der günstige Wind mehrere russische Bodjes heran. Dies sind kurze Fahrzeuge von drei Masten, die Mehrzahl so abgenutzt und alt, daß man sie kaum für fähig hält, einem Sturme zu widerstehen. Die kleinsten davon haben nicht einmal Nägel; von vorn bis hinten sind die Planken mit Hanf zusammengebunden. Man erzählt, daß, als einst der Kaiser von Rußland eines von diesen Schiffen in den Hafen von St. Petersburg kommen sah, ihm dasselbe so auffiel, daß er es für die Folge von jedem Zoll befreite. Mit diesen gebrechlichen Fahrzeugen umschiffen die Russen das Nordkap und dringen in alle Buchten des Eismeers. Während die einen den Handel mit Finmarken ausbeuten, begeben sich die anderen in die Fischgründe. Geschickter und tätiger als die Norweger, haben sie oft ein mit Fischen reich beladenes Boot, wo ihre Mitbewerber nur ein halbleeres Netz herausziehen. Es ist ihnen zwar verboten, auf eine Meile von der Küste zu fischen, aber sie überschreiten täglich die Grenzen, welche ihnen gezogen sind. Durch Beharrlichkeit ermüden sie die Aufmerksamkeit derer, welche sie überwachen sollen. Im Osten, im Westen, im Norden, von allen Seiten umringen sie die Küste von Finmarken; ohne Aufhören kehren sie wieder.
Neben den festen englischen und den minder festen russischen Fahrzeugen erscheint die ärmliche Barke des Lappen, welcher dem Kaufmann die Fische bringt, die er mühsam in mehreren Monaten gefangen hat, um einen Teil seiner Schulden in Ordnung zu bringen. Auf dem aus Holz gebauten Umgang, welcher die Speicher umgibt, bemerkt man alle Arten von Trachten, sowie man alle Sprachen des Nordens hier sprechen hört. Der Kaufmann ist immer auf dem Platze beschäftigt, die Mütze von Fischotter auf dem Kopf, die Feder hinter dem Ohre, von seinem Kontor zur Niederlage und von da wieder zurücklaufend. Jetzt ist die Zeit der Arbeit. Vom Geschäftsgang in diesen drei oder vier Monaten hängt der Erfolg des ganzen Jahres ab. Da fertigt er Fahrzeuge nach Spitzbergen und Fischladungen nach Spanien und Portugal ab. Der ganze Tag vergeht in einer ununterbrochenen Kette von Berechnungen und Schreibereien; nur abends bei der Punschbowle wird geplaudert. Dann überlassen sich diese braven Kaufleute mit Lust ihren Herzensergießungen, ihren gastfreundschaftlichen Gewohnheiten, und wenn ein Fremder unter ihnen ist, so haben sie für ihn eine Güte und Zuvorkommenheit ohnegleichen.
Wenn man durch die wogenden Nebel und die dichten Wolken, welche gewöhnlich den Himmel von Hammerfest verschleiern, plötzlich einen schönen Sonnenstrahl dringen sieht; wenn die Gebirge der Inseln mit ihren bläulichen Rändern und ihren schimmernden Gipfeln in der Ferne erscheinen; wenn das Meer wie ein silberner See sich zwischen der Stadt und dem Felsen ausbreitet: so ist das ein schönes, poetisches Schauspiel. Eines Abends im August habe ich von einer Höhe die Sonne, im ersten Augenblick durch eine leichte Wolke verhüllt, um Mitternacht in all ihrer Pracht strahlen sehen. Das ganze Meer erglänzte im Lichte; die Gebirge hatten eine Färbung von Azur, gleich dem fernen Horizont südlicher Gegenden, und die Sonne, zwischen den Hügelwänden von Granit wie in ihrem Bette eingeschlafen, glich einer kristallenen Schale. Sobald diese schönen Tage erscheinen, entsteht in der ganzen Stadt eine große Bewegung. Jeder will das seltene, eilig fliehende Schauspiel genießen. Aber diese Tage der Erheiterung sind nur spärlich; ein dunkler Nebel verhüllt das Blau des Himmels; der Frost beginnt mitten im schönsten Sommer, bald verschwinden die fremden Schiffe eines nach dem andern; die Warenhäuser werden geschlossen; die Geschäfte hören auf, alles wird still.
Der Winter ist da. Und welch ein Winter! Nächte ohne Ende, schwarzer Himmel, gefrorener Erdboden! Während im Sommer der längste Tag hier unter 70°30' N. eine Länge von 2½ Monat erreicht, muß man im Monat Dezember sich um 12 Uhr des Mittags ganz nahe ans Fenster stellen, um einige Zeilen zu lesen. Vom Morgen bis zum Abend ist die Lampe in allen Häusern angezündet, und keine Freude gibt es mehr, kein Leben, keine Neuigkeiten. Die Post, die dreimal monatlich ankommen soll, erscheint nur noch zu unbestimmten Zeitpunkten. Die, welche auf dem Landwege über die schwedischen Gebirge kommt, wird oft durch die Nacht und die schlechten Wege aufgehalten; die von Drontheim übers Meer stößt auf noch größere Hindernisse. Die Stadt ist jetzt eine Welt für sich, vom Reiche der Menschen getrennt. Die armen Einwohner suchen dann alle möglichen Mittel hervor, um sich zu zerstreuen. Sie haben einen Verein gebildet, um sich dänische und deutsche Bücher zu verschaffen. Sie versammeln sich des Abends bald bei dem einen, bald bei dem anderen, wenn die Schneewirbel sie nicht verhindern, auszugehen. Sie trinken Punsch, sie rauchen, sie spielen Karten. Selbst die wissenschaftlichsten unter ihnen müssen sich auf solchen Zeitvertreib beschränken; denn anhaltend beim Lampenschein zu lesen und zu schreiben ist unmöglich. Eines ihrer größten Vergnügen ist, wenn bisweilen der Himmel sich aufklärt, die langen norwegischen Schneeschuhe anzuschnallen und über die Felsen und Gebirge zu laufen, an denen die Schneemassen alle Unebenheiten ausgeglichen haben.
Gegen Ende Januar suchen sie am Horizont die ersten Lichtblicke der Sonne, welche sie so lange geflohen hat. Anfangs unterscheidet man in dem düsteren Gewölk nur einen rötlichen Schein; aber dies ist das wohlbekannte Zeichen, das alle freudig begrüßen: es ist der Vorbote der Sonne, welche Erde und Menschen wieder beleben will. Der erste, welcher das frohe Zeichen erblickt, verkündet es mit lauter Stimme, und jedermann läuft auf den Hügel. Dieser Tag ist ein Festtag in allen Familien. Nach und nach vergrößert sich der rote Schein; die unbestimmte Linie wird zu einer breiten Scheibe, welche die Wolken durchzieht, von Woche zu Woche sich mehr über den Horizont erhebt und da verweilt, bis sie fast drei Monate ununterbrochen den Nordmenschen leuchtet.
Ein Winter in Lappland und Schweden. Von Arthur de Capell Brooke. (Aus dem Englischen übersetzt.)Die Lappen von Finmarken, dem nordöstlichen Grenzbezirk Norwegens, sind ebenso ein Grenzvolk der Menschheit im äußersten Norden wie die Samojeden in Rußland, ihre Stammverwandten. Die Fortschritte der Gesittung, die Ausdehnung des Ackerbaues und anderer Gewerbe beeinträchtigen wesentlich die Rechte und beschränken die Freiheit dieses Volkes, welches noch in dem ursprünglichen Zustande des Hirtenlebens verharrt. Vorzeiten zogen die Lappen in einem großen Teil der skandinavischen Halbinsel ungehindert umher; jetzt verengert die Kultur ihre Grenzen. Der Lappe, welcher unter dem Einflusse der norwegischen Ansiedler lebt, ist eine Art Mischling, dessen ganzes Wesen durch diesen Verkehr in hohem Grade verändert wurde. Dies ist mit den Lappen Finmarkens noch nicht der Fall. Die natürliche Unfruchtbarkeit ihres Landes schützt sie gegen Angriffe auf ihre Freiheit; ihre kahlen Gebirge bieten keine Aussichten dafür, daß der Ackerbau sie je erobere; nach Verlauf von Jahrhunderten werden sie wahrscheinlich noch dasselbe sein, was sie jetzt sind: Naturkinder mit zähem Widerwillen gegen verfeinertes Leben und heftiger Liebe zur Freiheit. Freilich entpuppt sich ihr Land, das nördliche Norwegen, jetzt als ein Erzgebiet von großem Reichtum. In Südvaranger, dem nordöstlichsten, an Rußland grenzenden Teil Finmarkens, wurden Eisenerzfelder gefunden, die an Ausdehnung ihresgleichen suchen und die bekannten Erzfelder Dunderlandsdal in Norwegen, sowie Luossavara und Gellivara in Schweden weit übertreffen sollen. Einzelne der Adern sind 70, 100, ja 200 m dick, und selbst die kleinsten messen 30 m, während beispielsweise in dem mächtigen Dunderlandsdal Adern von 12 bis 20 m für groß gelten. Das Erzfeld umfaßt ungefähr 15 qkm Land, das dem Staate gehört. Der Eisengehalt dieses Erzes soll so bedeutend sein, daß eine großartige und lohnende Tätigkeit beginnen kann. In der Nähe des Erzlagers fließt der Pasvikelf und bildet einen mächtigen Wasserfall, der nach Angabe von Fachleuten 40 000 bis 50 000 Pferdekräfte darstellt und Triebkraft liefern wird. Dieser Wasserfall liegt an der Grenze, und die Hälfte gehört zu Rußland. Im übrigen haben die Unternehmer, auf deren Veranlassung die Untersuchungen stattfanden, alle nötigen Schritte getan, um sich Wettbewerb fernzuhalten, indem sie sich das ganze Gebiet sicherten. Die großen schwedischen Erzfelder von Kirunavara und Luossavara bringen neuerdings durch die Ofotenbahn ihre Ausbeute schon über den Hafen Narvik am Ofotenfjord zur Ausfuhr. Mit diesen Entdeckungen an den Grenzen Lapplands dürfte bald auch die Zivilisation in das Gebiet dieses Naturvolkes vordringen.
Im schwedischen und russischen Lappland gibt es eine Anzahl armer Lappen, Skogslappar – Waldlappen – genannt, welche meist in den Waldgegenden wohnen, und deren Renntierherden zu klein sind, um sie in den Stand zu setzen, auf den Gebirgen zu leben und von ihren Tieren allein ihren Unterhalt zu ziehen. Während des Sommers leben sie unter Zelten; allein bei Annäherung des Winters errichten sie sich eine dauerhaftere Wohnung von Rasen und Erdschollen. Dann bleiben sie an demselben Ort und leben teils von ihren Herden, teils von der Jagd auf Wildbret, wovon es einen Überfluß gibt, und dessen beständige Verfolgung sie zu sehr geübten Schützen macht.
Lappländer dieser Art sind in dem norwegischen Lappland unbekannt, da das Land viel Gebirge, aber wenig Wälder hat. Die Lappen in Finmarken können in zwei Klassen geteilt werden: die Fischer- oder Uferlappen und die Renntier- oder Berglappen, welche Sommer und Winter herumziehen, keine andere Wohnung als ihre Zelte haben und in ihrem ganzen Wesen das Bild eines nordischen Wandervolks bieten.
Die Lebensweise des schweifenden Lappländers im Sommer weicht gänzlich von der im Winter ab. Dann sind die inneren Teile Lapplands, namentlich dessen grenzenlose Wälder, von verschiedenen Arten Mücken und anderen Insektenarten so heimgesucht, daß kein Tier ihren unaufhörlichen Verfolgungen entgehen kann. Große Feuer werden angezündet, in deren Rauch das Vieh die Köpfe hält, um den Angriffen dieser Feinde zu entgehen. Die Eingeborenen selbst sind genötigt, ihre Gesichter mit Teer zu beschmieren, als dem einzigen Schutzmittel gegen Stiche und Bisse. Kein Tier leidet indessen mehr als das Renntier von den größeren Arten der Insekten (Oestrus tarandi), da sie ihre Eier in die Wunde, die sie auf der Haut machen, niederlegen. Wollte sich der Lappländer in den Monaten Juni, Juli und August in den Wäldern aufhalten, so liefe er Gefahr, den größten Teil seiner Herde zu verlieren; die Tiere würden auch von selbst auf die Gebirge entfliehen, um nicht von der Wespe gestochen zu werden.
Aber noch andere Gründe treiben den Lappländer an, nach den Gebirgen, die über die Küsten von Norwegen und Lappland hervorragen, zu ziehen. Während des Winters hat er von den Renntieren, die er zu seinem und seiner Familie Unterhalt schlachtete, eine große Anzahl Häute und Geweihe aufgehäuft; vielleicht hat er auch Gelegenheit gefunden, einige Bären zu erlegen; auch mag er einige Fuchs-, Fjeldfraß- und Marderfelle gesammelt haben. Die Federn der Berghühner, die er schießt oder in Schlingen fängt, werden ebenfalls aufbewahrt. Alle diese Dinge sind für ihn Handelsware, die er an die Kaufleute der Küsten vertauscht gegen das, was er im Winter braucht: grobes Tuch, Mehl, Pulver und Tabak.
Was den Lappen ferner an die Küsten treibt, ist das Salzwasser der See, das seine Renntiere notwendig des Jahres einmal trinken müssen. Sobald die Renntiere das Meer zu Gesicht bekommen, eilen sie in vollem Lauf samt und sonders darauf zu und schlürfen das Wasser wie einen Labetrunk, obwohl man sie später nicht mehr davon trinken sieht. Dieses Trinken soll sehr wirksam sein zur Vernichtung der Larven der großen Wespe, welche ihre Eier in die Haut des Tieres legt, bevor es die Wälder verläßt.
Anfang Juni fängt der Lappländer seine Wanderung an. Der Boden ist um diese Zeit gewöhnlich vom Schnee befreit; folglich fährt er nicht länger auf Schlitten. Er läßt daher diese samt allen seinen Wintergerätschaften zurück als eine zu große Last auf seinem Sommerzuge und verwahrt sie in dem Vorratshause, das fast jeder Lappe in der Nähe der Kirche besitzt, die im Winter den Mittelpunkt seines Aufenthaltes bildet.
Der Weg, den er zurücklegen muß, wechselt je nach der Lage der Küste, die er aufsucht. Die Gesundheit und Sicherheit der Herde ist der Gesichtspunkt, nach welchem die Gegend ausgewählt wird; die Bequemlichkeit des Menschen kommt hierbei nicht in Betracht, da dieser ganz von seinen Renntieren abhängt. Die vielen Inseln an der Nordwestküste von Norwegen und Lappland werden als Sommeraufenthalt vorgezogen, sowohl wegen der frischeren Luft als der größeren Sicherheit, die sie gegen Wölfe und Bären gewähren. Wenn diese Raubtiere auch, durch den Geruch der Renntiere angezogen, gelegentlich hinüberschwimmen, so werden sie doch alsbald von den wachsamen Lappen bemerkt und zurückgescheucht, was um so leichter wird, da kein Wald vorhanden ist, in welchem sie sich verbergen könnten. Um die Inseln zu erreichen, muß die Herde oft 2-3 km von dem festen Lande aus schwimmen, was ohne Gefahr abläuft.
Die Inseln bieten zugleich dem Lappländer viele Vorteile; denn hier sind bequeme Plätze für den Fischfang und gute Häfen; die Fische kommen zahlreich in die vielen engen Fjorde, und das lädt natürlich die Kaufleute ein, sich daselbst anzusiedeln.
Der Lappländer begibt sich dann nach der Fischerei des Kaufmanns, und wenn ein Trunk Salzwasser der Gesundheit seiner Herde notwendig ist, so scheint er einen Schluck Branntwein als unentbehrlich für die seinige zu halten.
Die häusliche Einrichtung und Wirtschaft des Berglappen ist äußerst einfach. Er wählt für sein Gezelt eine bequeme Lage an den Ufern eines Sees, wo nicht allein Wasser leicht zu haben ist, sondern auch Schutz vor den gewaltigen Winden, die leicht die winzige Wohnung wegraffen würden.
Das Zelt (Lawo) ist wenig mehr als ein Lumpen von einer Art groben Tuchs, im Norden unter dem Namen »Wadmal« bekannt, welches hauptsächlich in Schweden und Norwegen gemacht wird und ein Hauptstück des Handels mit den Lappländern bildet. Viel von diesem Tuche wird auch von den Küstenlappländern gewoben, die es gegen Renntierfelle an die Gebirgslappen vertauschen, um aus den Fellen ihre Winterkleider und Betten zu machen. Dieses Zelt wird von ästigen Birkenstämmen unterstützt, und darunter hält der Gebirgslappländer Finmarkens die lange dauernde strenge Kälte der Wintermonate in den inneren Gegenden aus. Die Höhe des Zeltes ist ungefähr 2 m, und der ganze Umfang des Inneren übersteigt selten 5-6 m. In diesen engen Raum drängen sich der Lappländer, sein Weib und seine Kinder und sehr oft eine zweite Familie, die des Mitbesitzers der Herde, zusammen. In den Ecken steckt einfaches Hausgerät, Näpfe, eiserne Töpfe, Löffel, hölzerne Kästchen usw. Dabei bleibt noch immer ein Plätzchen für die Hunde, die treuen Wächter der Herde, welche bis zu zwanzig in einem Zelte sind, wovon freilich viele auf den Leibern ihrer Herren eine bequeme Ruhestätte finden. In der Mitte brennt das Feuer, von einigen großen Steinen eingeschlossen; ein Teil des Rauches geht oben durch die Öffnung des Zeltes, der übrige erfüllt den unteren Raum fast immer mit einer dicken Wolke, hüllt die Bewohner gänzlich ein, so daß der Eintretende sie kaum erkennt, und beizt dem Fremden die Augen. Der höchste Grad von Kälte kommt einem erträglicher vor, als eine Stunde in einem lappischen Zelte. Der Lappländer gewöhnt sich früh an alle Unbequemlichkeiten, und eben das dichte Zusammengedrängtsein ist für ihn eine Hauptquelle von Wärme und Behaglichkeit, die ihm die strenge Winterkälte besiegen hilft und ihn zugleich vorbereitet, die für jeden anderen unerträgliche Sommerhitze im Zelte zu ertragen.
Oben an der Spitze des Zeltes, dicht an der Öffnung für den Rauch, ist eine Art Reck aufgehangen, worauf die Käse gelegt werden, um schneller zu trocknen. Das Innere des Zeltes ist gewöhnlich mit Birkenzweigen, an welchen das Laub gelassen ist, bestreut und mit einer Decke von Renntierfellen belegt, welche dem Lappländer in allen Jahreszeiten zum Bette dient. Der einzige Eingang zum Zelt ist ein schmaler Schlitz an der Seite, vor welchem ein Lappen hängt, der, wenn er in die Höhe gehoben wird, von selbst wieder in seine vorige Lage zurückfällt und die äußere Luft abhält. Den Gebirgszelten, welche in Lappland gebräuchlich sind, fehlt nie eine Art Speisekammer in der Nähe. Deren Errichtung ist ebenso einfach wie die des Zeltes: ein paar Zweige, in Form eines Dreiecks in die Erde gesteckt und grobes Tuch darüber gespannt. Diese kleineren Hütten dienen besonders zur Aufbewahrung der Käse.
Die Gebirgslappen Finmarkens sind natürlich wild und roh von Ansehen, Kleidung und Sitten. Man bemerkt an ihnen einen Grad von Trotz und stolzer Unabhängigkeit des Geistes, den man bei den Bewohnern der Ebenen des russischen Lapplands nicht wahrnimmt. Ihre Gemütsart ist finster und verdrießlich, durch ein Geschenk wird sie aber leicht gemildert. Die Gastfreiheit, welche die meisten Naturvölker auszeichnet, wird bei ihnen durch einen Hang zum Mißtrauen verdunkelt. Entfernt man indes dies natürliche Mißtrauen, erklärt man, was die Veranlassung ist, seine Tundra zu besuchen, und unterstützt man solche Rede mit einem Glase Branntwein oder einem Päckchen Tabak: so wird man den Lappländer bald umgewandelt, zu jedem Dienst bereit finden. Wo Pechtannen und Birken nicht mehr gedeihen und wachsen können, da scheint auch die menschliche Natur mangelhaft zu bleiben. Sie sinkt im Kampfe mit der Not und dem Klima.
Die Kleidung der Fjeld-Finner (Gebirgslappen) unterscheidet sich nicht sehr von der Tracht der übrigen herumziehenden Stämme in den anderen Gegenden von Lappland. Im Winter sind sie ganz mit Renntierfell bekleidet. Während der Monate Juli, August und September, von denen nur die ersten zwei nicht zu dem »Winter« gehören, zwingt sie indessen die heiße Witterung, statt des Pelzes einen Rock von Wadmal anzuziehen, der mit einem breiten ledernen Gürtel um den Leib festgebunden wird. Die Gappe (Sommerrock) reicht gerade bis unter die Knie; unter dem Rock werden lange Beinkleider getragen, welche aus dünnem Leder junger Renntiere verfertigt werden. An den Knöcheln kommen sie mit den Komagers, einer Art lederner Socken, zusammen. Auf den Kopf wird eine kleine, niedrige, vierzipflige Kappe von Tuch (Gappie), mit Pelzwerk von Renntier eingefaßt, gestülpt. Doch trifft man auch mitten im Sommer Gebirgslappen beiderlei Geschlechts, die ganz in Fellen stecken. Die Hitze dieser Kleider, namentlich auch der von dem filzigen, festgewebten Wadmal, würde unerträglich sein, wenn der Rock nicht sehr weit gemacht und vorn teilweise offen wäre. Da Leinwand dem Lappländer fast ganz unbekannt ist, wird kein Hemd darunter getragen, so wie sie ihre bloßen Füße in die Komagers stecken, welche mit weichem, trockenem Gras, Sena genannt, ausgestopft werden. Die Kleidung der Frauen ist ganz wie die der Männer.
Die Lappländer sind im allgemeinen eine kleine Rasse. Es ist jedoch bemerkenswert, daß die Lappen Finmarkens etwas größer sind als die in den südlicheren Teilen von Lappland. Vielleicht kommt es von der freieren und reineren Gebirgsluft her, daß sie größer, rüstiger und mutvoller sind als jene. Sie sind auch größer als die, welche an der Küste leben, um ihren Unterhalt durch Fischfang zu gewinnen, die also beständig den Nebel des Meeres atmen. Die gewöhnliche Größe der Gebirgslappen ist 152-157 cm. Leute von 165 cm sind eine Seltenheit.
Auszeichnende Züge der Rasse sind kleine, längliche Augen, hohe Backenknochen, ein breiter Mund und ein spitziges Kinn mit wenig oder gar keinem Bart. Das Haar ist gewöhnlich braun oder von dunkler Farbe, während die Küstenlappen meist helles Haar haben. Hände und Füße sind wie bei den Eskimos klein; aber der ganze Bau ist knochig und muskelstark. Die Stimme ist schwach und klingt dem Ohr des Fremden etwas quiekend. Die Farbe der Haut ist nicht dunkelbraun, wie sie oft beschrieben wird, sondern von Natur weiß und nur durch den Rauch in der Hütte und das Leben im Freien gebräunt.
Der Lappländer ist von Natur ein Renntiersenne. Da sein Unterhalt völlig von seinen Renntieren abhängt, welche fast frei und sich selbst überlassen sind, so kann man sagen, daß seine Bewegungen durch sie geleitet werden und daß seine ganze Lebensweise durch sie bestimmt ist. Die Anzahl der Renntiere, die zu einer Herde gehören, beträgt 300-500; mit einer solchen Herde kann ein Lappe sich wohl befinden und leidlich leben. Er kann im Sommer eine hinreichende Menge Käse machen für das Bedürfnis des Jahres, und im Winter kann er so viele Renntiere schlachten, daß er und seine Familie fast beständig Fleisch essen können. Mit 200 Renntieren kann ein Mann mit kleiner Familie sich so einrichten, daß er auskommt. Hat er nur 100, so ist sein Auskommen sehr unsicher; bei 50 ist er nicht mehr sein eigener Herr, kann nicht mehr seine eigene Wirtschaft führen, muß vielmehr seine kleine Herde mit der eines reicheren Lappen vereinigen und verrichtet nun die Dienste eines Knechtes, indem er die Herde begleitet und hütet, nach Hause zum Melken bringt usw. Es geschieht auch häufig, daß, wenn die Herde eines Lappländers durch Krankheit oder Unglück bis auf diese Zahl herunter kommt, er den Überrest einem anderen verkauft und nach der Küste wandert. Da sucht er entweder Arbeit bei den norwegischen Ansiedlern, oder, was noch häufiger ist, er läßt sich an den Ufern einer der benachbarten Meerbuchten auf der Küste nieder, treibt Fischfang zu seinem Unterhalt und wird aus einem Gebirgslappen ein Küstenlappe. Aber die Sehnsucht nach dem freien Nomadenleben verläßt ihn nicht, und zuweilen gelingt es ihm, die frühere Lebensart wieder zu beginnen.
Ein Lappländer, der Herr einer Herde von 1000 Renntieren ist, wird als ein reicher Mann angesehen. Manche haben 1500, ja 2000 Stück.
Das Leben dieser Menschen ist beständiger Veränderung unterworfen und wechselt zwischen größter Untätigkeit und größter körperlicher Anstrengung, zwischen höchstem Überfluß und Mangel, zwischen höchster Kälte und Hitze. Wenn der Lappe hungrig ist und seine Eßlust ungehindert befriedigen kann, so ist er gefräßig; die Masse, welche er verschlingt, ist ganz erstaunlich, und wie die wilden Tiere des Waldes ißt er so viel, daß er auf einige Tage satt ist und einem unvermuteten Mangel begegnen kann. Während der Wanderzeit im Sommer ist indes die Nahrung des Lappländers außerordentlich einfach und spärlich. Da genießt er nicht mehr seine Lieblingsspeise, das Renntierfleisch: dies ist die leckere Winterkost. Im Sommer ist er nur darauf bedacht, seine Herde zu vermehren. Er begnügt sich mit der Milch seiner Tiere und den Überbleibseln von Lab und Molken nach der Bereitung der Käse. Von der Milch genießt er sparsam und ist geizig damit; denn ein Renntier gibt nicht viel Milch, und diese muß zunächst für den Käse verwendet werden, der auch für den Winter vorhält. Da die Herde nur des Sommers gemolken wird, so setzt er, wenn dieser zu Ende geht, etwas Milch beiseite, um sie gefrieren zu lassen, nicht bloß zum eigenen Genuß während des Winters, sondern auch als Handelsware, die wegen des großen Wohlgeschmacks sehr gesucht wird.
Sonderbar ist es, daß der weiße Käse von dieser schönen Milch hart ist und unangenehm schmeckt und nur für den Lappländer genießbar ist. Die Zubereitung ist sehr einfach, indem man die Milch in einem großen eisernen Topfe über das Feuer stellt, wo sie mit Hilfe des Labs aus dem Magen des Renntiers schnell gerinnt. Dann wird die Masse ausgepreßt, die Molken werden gesammelt, die Käse in flache Formen gedrückt.
Der Lappländer mischt zuweilen Heidelbeeren, Zwergmaulbeeren und ähnliche Früchte seiner Gegend in die Molken, nachdem er sie vorher zu einem dicken Safte eingekocht hat. Gern ißt er auch die Angelikawurzel, die gut gegen den Skorbut sein soll. Darum mag man auch für das Blut des Renntiers so große Vorliebe haben; beim Schlachten des Tieres wird es sorgfältig gesammelt und aufbewahrt und in verschiedenen Gerichten zubereitet. Warm genossen, soll das Blut ein sicheres Mittel gegen den Scharbock sein.
Die geringe Entfernung, in welcher die Herden von Fuglnäs waren, setzte den Reisenden in den Stand, ihr Leben und Treiben fast jeden Tag zu sehen. Besonders malerisch und für Lappland bezeichnend war es, wenn sich des Abends zur Melkzeit die Herde um die Gamme (das Zelt) versammelte. Auf allen Höhen rund umher wird alles in einem Nu voller Bewegung und Leben. Die geschäftigen Hunde bellen überall und treiben die Herden immer näher; die Renntiere springen und rennen, stehen still und springen wieder in einer unbeschreiblichen Mannigfaltigkeit von Bewegungen. Welch schönen und majestätischen Anblick gewährt es, wenn das weidende Tier, von dem Hunde geschreckt, sein Haupt erhebt und seine breiten und mächtigen Augsprossen zeigt! Und wenn es läuft, wie flink und leicht ist sein Schritt! Nie hören wir seinen Fußtritt auf der Erde, nur das beständige Knarren seiner Hufe; ein sonderbares Geräusch, das wegen der Menge von Renntieren, die es hervorbringen, schon aus großer Ferne herschallt. Hat endlich die ganze Herde die Gamme erreicht, so stehen die Tiere still, ruhen aus oder springen zutraulich herum, spielen mit ihren Geweihen gegeneinander oder umringen gruppenweise einen Moosstock, um ihn abzuweiden. Während die Mädchen von einem Tiere zum anderen mit ihren Milchgefäßen herumlaufen, wirft der Bruder oder der Knecht einen Strick von Bast um die Augsprossen des Tieres, das ihm die Mädchen bezeichnen, um es heranzuziehen. Das Tier sträubt sich gewöhnlich und will der Halfter nicht folgen; das Mädchen lacht und freut sich über die Mühe, welche dies verursacht. Auch läßt es zuweilen aus Mutwillen ein Renntier wieder los, damit es noch einmal für sie eingefangen werde. Unterdessen hört man den Vater oder die Mutter schelten wegen des Mutwillens, der oft die Wirkung hat, die ganze Herde scheu zu machen. Wer würde bei diesem Schauspiele nicht an Laban und Lea, Jakob und Rahel denken? Wenn die Herde sich zuletzt hinstreckt, so viele hundert Tiere auf einmal rund um die Gamme, so bilden wir uns ein, ein ganzes Lager zu sehen, den Befehlshaber in der Mitte.
So anmutig und zierlich in seinem Äußeren, als etwa das Pferd und der Hirsch, ist freilich das Renntier nicht; denn es hat einen kurzen, dicken Hals, so daß das Tier, statt den Kopf in die Höhe zu halten, ihn in einer gebückten Stellung trägt, die fast eine gerade Linie mit dem Rücken bildet. Die eigentümliche Bildung und Stärke des Halses, der Schultern und des Vorderbuges deuten darauf hin, daß das Tier zum Ziehen geeignet ist; die Muskelkraft der Lenden und die Dicke der Knochen bestätigen dies. Die Hufe sind dem Lande wohl angepaßt; statt schmal und spitzig zu sein, wie die Hufe der Rehböcke und Damhirsche, sind sie sehr breit, platt und weit; auch kann das Renntier den Huf ausbreiten oder zusammenziehen, je nach der Beschaffenheit der Oberfläche, auf der es sich bewegt. Wenn Schnee auf dem Boden liegt, so gibt ihm die Breite seiner Hufe, die es dann so weit macht, daß sie den Pferdehufen gleichkommen, eine feste Haltung auf dem Schnee und verhindert das Einsinken.
Das Geweih des Tieres ist breit und sehr zierlich, beim Wachstum mit einem weichen, dunkeln, samtartigen Flaum bedeckt, der bis zum Winter bleibt. Die Stangen beginnen im Mai auszuschießen, und in einem Zeitraume von sieben bis acht Wochen erreichen sie ihre völlige Ausbildung; die Böcke bekommen sie zuerst, die Kühe zuletzt, werfen sie aber nicht vor dem Frühlinge ab. Weil diese Tiere das Geweih so notwendig zum Aufscharren des Schnees brauchen, so gab die Natur es auch dem Weibchen.
Ein anderes Geschöpf hat kaum ein so dickes Fell als das Renntier. Von allen Kleidern, welche die Bewohner der Polargegenden tragen, halten die von Renntierfellen gemachten am wärmsten. Darum besteht die Winterkleidung des Lappen ganz aus Renntierfellen; darum haben auch viele Polarfahrer solche Kleidung mit Vorteil getragen.
Im Sommer lebt das Renntier nicht bloß vom Tundrenmoos, sondern streift die Blätter von den Birken-, Weiden- und Espenbüschen begierig ab, frißt auch das junge Gras, die zarten Sprossen der Sträucher auf den Bergen und mancherlei duftiges Kraut, das der warme Sonnenstrahl schnell hervorlockt. Im Winter ist aber die Renntierflechte fast die einzige Nahrung. Dieses Gewächs ist nahrhaft genug, daß die Kühe, wenn sie davon fressen, noch Milch geben.
Hitze greift die Renntiere sehr an; darum suchen sie, wenn die Witterung sehr heiß ist, immer die Stellen, wo noch Schnee liegt, und wenn ein Windhauch entsteht, so kehren sie sich nach der Seite hin, wo er herkommt. Echte Geschöpfe der Polarwelt! Die lappländischen Tiere der Gebirgsfinnen sind imstande, eine Last zu ziehen von 240 Liespfund = 2400 kg. Der Schlitten (Pulk) kann nach seiner Einrichtung nur von einem Renntiere gezogen werden. In Sibirien und Kamtschatka gebraucht man das Tier auch zum Reiten, hier nicht. Die Schnelligkeit, mit der es große Lasten zieht, ist außerordentlich; denn sie beträgt bis 15 km in der Stunde, wohl zu merken auf gebirgigem Gelände.
Der Gebirgslappe bricht mit seinen Herden auf, sobald das Laub von den Bäumen fällt, und zieht sich von der Küste zurück. Denn je weiter in das Festland und in die Wälder hinein, desto reichlicher wächst die Renntierflechte, namentlich auf flachem Moorboden. Auf den Ebenen und Morästen des russischen Lapplandes, den Tundren, sind unabsehbare Strecken mit der Flechte bedeckt, deren weißliche Farbe ihnen das Ansehen einer beschneiten Fläche gibt. Auch der Schutz, den zur Winterszeit das Innere der Wälder vor den heftigen Stürmen verleiht, ist ein wichtiger Grund, die Winterlager hier aufzuschlagen; sodann der reiche Vorrat an Brennholz, der an der Küste fehlt, und endlich das jagdbare Wild, das der Lappe im Walde findet.
Nachdem der Lappe sein Zelt abgebrochen hat, wird es mit den Stangen, die es aufrecht erhielten, auf den Rücken eines Renntieres gepackt. Seine Käse und die Eßwaren, die er für den Winter angekauft hat, desgleichen die wenigen Hausgeräte werden in eine Art Korb von Zweigen und Bast verpackt, oben mit Fellen und Birkenrinde zugedeckt und dann zugeschnürt. Ein solcher Korb hängt an jeder Seite des Tieres; zuweilen bloß einer, wenn auf der anderen Seite eine Wiege mit dem Kinde hängt. Diese Wiege ist in der Form eines Schlittens aus Holz gemacht, offen, aber mit einer Lederdecke über dem Kopfe des Kindes, auch mit Renntierflechte und Renntierfell gepolstert. Sie wird an die Bäume gehängt, wenn Mutter und Mädchen mit der Herde beschäftigt sind, so hoch, daß das Kind vor Raubtieren sicher ist. Durch die Bewegung des Windes wird die Wiege von selbst geschaukelt und das Kind in Schlaf gelullt. Sollte es aufwachen, so zieht der Anblick der über seinem Kopfe hängenden Knöpfchen, die von der Luft aneinander schlagen, seine Aufmerksamkeit an und unterhält es, bis es wieder einschläft. – Will die Mutter das Kind auf einem Zuge mitnehmen, so befestigt sie die Wiege auf dem Rücken, so daß der Kopf des Kindes über ihren Schultern erscheint. Da das Ganze leicht ist und die Mutter ihre Hände frei hat, so kann sie ungehindert ihre Geschäfte verrichten. Gegen die Sonne und die Mücken ist oben an der Wiege ein Stück Tuch befestigt, das die Trägerin nach Gefallen herabläßt. Sind zwei kleine Kinder da, so wird je eine Wiege auf jede Seite des Tieres gehängt, gerade wie die Körbe. Die Erwachsenen gehen zu Fuß; einige ziehen an der Spitze und geben acht auf die Lasttiere. Dann folgt die Herde; die Nachhut wird von den übrigen und den Hunden gebildet.
Trotz der Sorgfalt des Lappländers kommt es zuweilen vor, daß einzelne Renntiere zurückbleiben, die sich von der Herde verirrt haben. Diese findet er gewöhnlich wieder, wenn er den folgenden Sommer zurückkommt; wenn nicht, so werden sie bald wild.
Die Lappländer, welche die Walinsel (Qualö) und die umliegenden Eilande besuchen, sind, wie wir bereits angedeutet, in die Notwendigkeit versetzt, ihre Renntiere quer über den Sund oder die Meerenge, die sie vom festen Lande trennt, schwimmen zu lassen. Dies ist dem Fremden ein fesselnder Anblick, besonders wenn die Herde groß ist und vielleicht aus 1000 Stück besteht. Sobald der Lappländer auf der Stelle ankommt, wo er übersetzen muß, mietet er mehrere Boote entweder von den Ansiedlern oder den Uferlappen. Da hinein stellt er die jungen Kälber, und hinterher zieht er die Tiere, welche schwach sind und Hilfe bei der Überfahrt nötig haben. Da die ganze Herde dieses Übersetzen sieht, während sie zugleich von den Hunden und dem Geschrei der Lappländer im Rücken angegriffen wird, so geht sie ins Wasser. Das Renntier schwimmt leicht, indem es den Kopf und die Schultern über das Wasser hebt; es ist imstande, mehrere Meilen zu schwimmen, selbst wenn die See unruhig ist. Sobald der Lappländer das Land erreicht, setzt er seinen Weg in bequemen Tagereisen fort, indem er 12-15 km täglich geht und gelegentlich einen Halt von zwei oder drei Tagen macht, wenn er eine Stelle findet, die ihm gefällt. So erreicht er endlich die Gegend, wo er zu überwintern gedenkt.
Das Winterzelt wird wieder in derselben Weise wie das Sommerzelt errichtet, die Herde weidet nach wie vor im Freien, und die Hirten müssen den Schneestürmen Trotz bieten. Die Winterkleidung des Menschen besteht nun ganz aus der Haut seines treuen Lebensgefährten. Der Pelz wird von der Rumpfhaut des im Winter geschlachteten Tieres gemacht; die Gamaschen und Handschuhe werden von der Haut, welche die Beine und Schenkel des Tieres umgibt, die Schuhe von dem Teile des Felles, welcher zwischen den Hörnern ist und den oberen Teil des Kopfes bedeckt, verfertigt. Die Haare sind nach außen gekehrt, und wegen der besonderen Festigkeit und Dichtigkeit ihres Gewebes ist es unmöglich, daß die Kälte durchdringe. Um die Wärme des Körpers zusammenzuhalten in einer warmen Luftschicht und den freien Umlauf des Blutes zu befördern, ist jeder Teil weit und bequem gemacht; insbesondere sind die Ärmel des Pelzes so weit, daß die Arme mit Leichtigkeit ausgezogen und wieder eingesteckt werden können, ohne daß man nötig hat, ihn auszuziehen. Wenn der Lappe bei großer Kälte gezwungen ist, auf dem Schnee zu schlafen, und ihm ein Arm vor Frost erstarrt, so kann er denselben leicht aus dem Ärmel ziehen und an seinem Leibe wieder erwärmen. Ebenso sind auch die Handschuhe weit und ohne Finger.
In ihrer Winterkapuze, welche Kopf und Schultern ganz bedeckt und nur ein Loch für die Augen hat, laufen die Lappen zu jeder Stunde und bei jedem Wetter in ihren Schneeschuhen hinaus, um nach ihren Renntieren zu sehen und sie gegen die Angriffe der Wölfe zu schützen. In diesem schwierigen Geschäft stehen ihnen die Weiber bei, die, sobald die Reihe an sie kommt, auch die Herde hüten und jede Arbeit mit den Männern teilen.
Im Winter lebt der Lappe in einer Art von Überfluß. Bei einer Herde von 500 Stück Renntieren wird wöchentlich eins geschlachtet; ist die Herde größer, zwei, ja zuweilen bei starker Familie drei. Renntierfleisch ist dann fast die ausschließliche Nahrung; darauf freuen sich die Leute schon im Sommer. Die einzige Weise, in der sie das Fleisch zubereiten, besteht im Kochen. Dadurch erhalten sie eine kostbare und nahrhafte Brühe, welche sie außerordentlich gern genießen. Ehe sie das Fleisch in den Topf tun, wird es in lauter kleine Stücke zerschnitten, damit der Saft besser herausdringen kann. Ist es hinreichend gar, so bekommt jeder einen Napf aus Birkenholz mit einem guten Teil Brühe und einem Stück Fleisch, das er mit den Händen herausholt und verzehrt.
Die Wanderungen sind im Winter auf den nächsten Kreis um die Kirche beschränkt und gehen selten über 18-20 km hinaus, wenn die Herde einigermaßen Nahrung findet. In der Nähe der Kirche stehen auch die hölzernen Vorratshäuser, von denen jeder Familienvater eins besitzt. Sie sind von Tannendielen gebaut, nur wenig über 1 m hoch, mit einer Tür an der vorderen Seite, durch welche der Besitzer kaum hineinkriechen kann. In diesem Hause bewahrt er alles auf, was er auf seinen Sommerwanderungen nach der Küste nicht mitzunehmen hat; zugleich ist es der Speicher für die Einkäufe, die gelegentlich bei den Kaufleuten gemacht wurden.
Der Renntierlappe hat verschiedene Arten von Schlitten, sowohl für seine eigenen Fahrten als für seine Sachen. Zuerst den Pulk, welcher hauptsächlich zum Gebrauche der Kaufleute oder anderer Reisender bestimmt ist. Der Form nach ist er einem Boote ähnlich, 2 m lang, ungefähr 40 cm breit und 20 cm tief, das Hinterteil aber um das Doppelte erhöht. Das vordere Ende ist spitz wie ein Kahn, das hintere breit und der Boden oder Kiel ausgehöhlt. Über den Sitz wölbt sich das Fell von einem Seehund als Decke. Der Lappländer bedient sich selten dieses bedeckten Schlittens. Die Notwendigkeit, in der er sich häufig befindet, auszusteigen, entweder um denen zu helfen, deren Tiere störrisch geworden sind, oder sein eigenes Tier zu erleichtern, wenn die große Tiefe des Schnees ihn nötigt, zu Fuß zu gehen, oder die Dunkelheit des Wetters ihn zwingt, den Weg zu suchen, nachdem er die rechte Richtung verloren hat – das alles veranlaßt ihn, sich des offenen Schlittens (Kjöre Achian) zu bedienen, welcher im übrigen dem Pulk sehr ähnlich ist und gleichfalls aus Birkenholz gemacht wird. Die dritte Art ist der Packschlitten (Raid Achian), gleichfalls offen und in Kahnform, aber viel größer, gegen 3 m lang und verhältnismäßig breiter. In diesem werden Handelssachen und andere Packwaren verfahren.
Vor jeden Schlitten wird nur ein Renntier gespannt; da aber die vor die schweren Packschlitten gespannten Tiere natürlich nicht mit den vordern, leichten Schlitten gleichen Schritt halten, so bekommen sie einige Schrittmacher, welche voranfahren in leichten, offenen Schlitten, indem jedes der nachfolgenden Tiere an den vorhergehenden Schlitten befestigt wird. Ein Zug von fünf so aneinander befestigten Schlitten heißt Raid (Reihe).
Die Renntiere werden schon im zweiten Jahre gewöhnt, den Schlitten zu ziehen, sind aber keineswegs ruhige, gelehrige Tiere. Der Lappländer aber weiß sie zu behandeln. Wird das Tier widerspenstig, so fährt er von dem gebahnten Wege ab, mitten in den Schnee hinein und macht es bald müde und zahm, so daß es sehr gehorsam auf die bequeme Straße zurückkehrt.
Das Geschirr der Renntiere besteht aus einer Halfter von Renntierleder, welche rund um den Hals geht; unten sind zwei Stücke ausgestopften Leders von eirunder Form, die zwischen den Beinen des Tieres hängen und an welchen der Zugriemen befestigt ist, dessen Ende sich um die Beine schlingt, unter dem Leibe hindurch geht und durch ein kleines Querholz in einem eisernen Ring an dem Schnabel des Schlittens befestigt wird. Rund um den Leib des Tieres liegt ein breiter Bauchgurt von gefärbtem Tuch, durch welchen der Zugriemen gezogen ist, damit er sich nicht in den Beinen des Tieres verwickelt. Um den Hals ist eine Art Halsbinde von weißem Tuch geschlungen, woran eine Glocke hängt, deren Klang den Raid zusammenhält. Das Kopfende des Zügels ist ein Stück Seehundsfell, der Halfter ähnlich; es wird nicht in den Mund gelegt, sondern um den Kopf gewunden. Das ganze Riemenzeug ist einfach, aber stark.
Sobald der Lappländer sich in den Schlitten gesetzt hat, läuft das Tier aus allen Kräften, aber immer von der geschickten Hand seines Herrn gezügelt und an die kühnsten Wendungen gewöhnt. Am größten ist die Schwierigkeit, das Gleichgewicht des Schlittens zu erhalten, was in einzelnen Fällen sehr schwierig ist, wenn es glatte, steile Abhänge hinabgeht, wo der Schnee sich in Eis verwandelt hat und der Schlitten wie im Fluge dahinsaust. Ein Fremder würde in diesem Falle jeden Augenblick umwerfen, obwohl wegen der Niedrigkeit des Fuhrwerks ohne üble Folgen. Das Gleichgewicht muß der Fahrer mit dem Körper halten, als wenn der Schlitten ein wirkliches Boot wäre, welches auf dem Lande immer auf eine Seite fällt wegen des schmalen, scharfen Kiels. Wäre der Boden des Schlittens breiter, so würden die Unebenheiten des Grundes, die Tiefe des Schnees, die Steilheit der Gebirge und viele andere Umstände es dem Tiere unmöglich machen, ihn zu ziehen.
Unfälle treffen den Eingeborenen auf seinen Fahrten nur in der Dunkelheit, in der er seinen Weg verliert, oder durch Böen, die ihn überfallen, namentlich bei trüber Nebelluft. In diesem Falle sichert er seinen Lauf durch scharfe Beobachtungen der Form und Richtung des Gebirges, auf dem er fährt, und von dem er aus langer Erfahrung weiß, daß seine Züge nach gewissen Himmelsrichtungen laufen und das ihm so den Kompaß ersetzt. Außerdem verläßt er sich in hohem Maße auf sein Renntier, wenn er die Richtung ganz verloren hat. Ist das Tier schon einmal den Weg gekommen oder stößt es auf Spuren anderer Renntiere, so bringt es ihn gewöhnlich wohlbehalten nach bekannten Gegenden und Pässen. Kommt plötzlich ein Schneesturm, der die Weiterfahrt unmöglich macht, so hat der Lappe für diesen Notfall sein Zelt bei sich, das er an irgendeinem geschützten Orte aufschlägt und darin wartet, bis das Unwetter vorüber ist. Nicht selten wird er auf diese Weise mehrere Tage aufgehalten. In der Regel ist es auch mit dem Fehlen der Sonne in der Winternacht nicht gefährlich. Ist der Himmel klar, so gibt der Mond, welcher mehrere Tage hintereinander fortscheint, ohne unterzugehen, ein Licht, das dem der Sonne wenig nachsteht. Ist der Mond untergegangen, so verbreiten das Nordlicht und der außerordentlich helle Schimmer der Sterne einen solchen Lichtglanz, daß der Mensch sicher seinen Weg durch die pfadlose Wüste des Schnees findet. Weil seine Augen während der Reise beständig auf die Himmelskörper acht geben, so erwirbt er sich ganz von selbst einige Kenntnis der Sternkunde, die sich auf eine kleine Zahl von Sternbildern, wie des großen und kleinen Bären, des Orion usw. beschränkt. Diese Sterngruppen unterscheidet er durch Namen, die er ihnen selbst gibt, und sie ersetzen ihm die Magnetnadel. So schlägt der Lappe sich mutig durch alle Gefahren und Hindernisse seines Klimas durch, und die großen Beschwerden dünken ihm leicht, weil sie notwendig zu seinem Leben gehören. Sitte und Gewohnheit versöhnen mit allen Dingen, bilden den Charakter und machen mit einem Worte den Menschen zu dem, was er ist.
Die Versuche der Regierung, den Lappen eine höhere Kultur angedeihen zu lassen – sie hat besondere Seminare errichtet, in denen lappländische Lehrer und Priester gebildet werden – sind zwar sehr achtungswert; da aber das Land mit seinen hohen, kahlen Gebirgsflächen und weiten Schneefeldern, mit seinen reißenden Strömen und mückenumschwärmten Seen, mit seinen düsteren Wäldern und einem neun Monate andauernden Winter nicht geändert werden kann: so wird auch die Lebensweise und Sitte des Volkes im großen ganzen stets so bleiben, wie sie ist.
Nach Paul Du Chaillu, Im Lande der Mitternachtssonne. Bd. I. Leipzig 1882, Hirt & Sohn, und Sophus Ruge, Norwegen. Leipzig 1889, Velhagen & Klasing. Wer die eigentümliche Schönheit des »Landes der Mitternachtssonne«, des Landes der Eddadichtung, die zerfranste Felsenküste mit ihrem Silbergrau und Weiß, ihren grünen Schuttsäumen, ihrer kristallklaren, fernsichtigen Luft, ihren tiefschattigen, gründunkeln Wasserspiegeln und stäubenden Sturzbächen kennen lernen will, muß von Bergen, der alten Hansestadt, die ihre Fische in die katholischen Mittelmeerländer verhandelt zur Fastenspeise, aufbrechen und den größten Fjord befahren, der sich 180 km weit in den höchsten Teil des skandinavischen Gebirgslandes hineinzieht, den Sognefjord. Dort oben liegen auf den Fjelden die noch immer majestätischen Reste des Eises, das als gewaltiger Strom mit mehreren Quellarmen, alte Risse und Brüche im Urgestein benutzte und den im Hintergrunde 1244 m tief ausgehöhlten, am Eingange mit einer Schuttbarre, über der nur 200 m Wasser stehen, gesperrten, alpenseeartigen, vielverzweigten Riesenfjord bildete.
Bergen liegt auf altem Felsengrund, auf einer von der Meeresbrandung glattgespülten alten Strandebene wie viele der norwegischen Küstenstädte. Draußen liegt ein Gewimmel von Granitinseln aller Größen und Gestalten; bald zackige Klippen, bald rund geschliffene Buckel ragen über den blanken Seespiegel hervor; manche sind bewohnt, manche kaum mit frischgrüner Moosnarbe überzogen; hinter den vordersten, deren Eigenfarben man noch deutlich unterscheidet, tauchen andere auf, die schon durch das Luftblau gedämpfte Töne haben, weiterhin andere, die wandartig blau darin stehen, an deren Fuße sich der Ozean in weißer Brandung bricht. Das ist der Schärengürtel, der diese ganze Küste säumt und schützt. Hinter dieser felsenstarrenden Brustwehr liegt der Skjaergaard, der Schärengarten, tiefes, gutes, stilles Fahrwasser, das auf der anderen Seite von den klotzigen Felsentürmen der Fjordküste begrenzt wird und dem Post- und Reiseverkehr dient. Der Dampfer gleitet ruhig nordwärts und legt wenig an, nur dann und wann dreht er bei, und seine Boote bringen Frachten und Fahrgäste ans Land. In sechs Stunden lenkt der Dampfer um die Sognefest, den gewaltigen südlichen Eingangspfeiler in den Sognefjord, herum und fährt auf dem langen Meerfinger landeinwärts zwischen 1000 m hohen Felsentürmen, die sich oft bis auf 5 km voneinander entfernen. Den Fuß säumen, je weiter landeinwärts, desto mehr liebliche Wäldchen von Birken und Nadelholz – auch Matten mit weidenden Kühen oder Ziegen –, und tief drinnen im Fjord, wo nur irgendeine kleine Strandebene, eine Schutterrasse eines Seitentals, der eingeebnete Schuttkegel eines Bergsturzes sich zeigt, steht auch ein kleiner Weiler von 2-3 Holzhäuschen, braunrot mit weißen Kanten angestrichen. Das macht einen »Gård« (sprich Goard), und der Bauer, dem der Grund gehört, nennt sich danach, z. B. der von Krokengård, und fühlt sich als Freiherr gegenüber dem Häusler, dem »Huusmann«, dessen Gårdhäuser Blockbauden sind, mit Rasen gedeckt, inwendig vom Kaminrauche geschwärzt. Die kleinen Ansiedlungen verkehren untereinander nur mit dem Boote, das am Strande liegt, blank und schmuck. Tiefer Frieden liegt über diesen Einsiedeleien. Die Häuschen lehnen sich an die Bergwände und zeigen durch ihre Kleinheit erst die majestätische Gewalt und trotzige Größe der Felsen an. Ihre Bewohner sind gebildete Leute, sprechen oft mehrere Sprachen, haben für den langen Winter eine gute Hausbücherei, in der auch ausländische Meister vertreten sind, lieben und pflegen die Hausmusik auf dem Klavier, der Harfe, Gitarre, Violine. Die Kirchen sind weit entfernt; zur Feier des heiligen Abendmahls, zur Konfirmation, zum Gottesdienst an einem schönen, klaren Sonntag fährt die Familie im Boote. Den Unterricht leitet anfangs die Mutter, späterhin erzieht sie die Töchter allein, die am Webstuhl, an der Nähmaschine, am Herde ausgebildet werden, aber auch Sprachen und Literatur nicht vernachlässigen, um später im häuslichen Kreise Pflegerinnen des Schönen und Idealen zu sein. Der Vater bereitet die Knaben für die höheren Schulen vor. Ihm liegt vor allem die Bewirtschaftung des Gutes ob. Er besucht seinen Obstgarten, in dem dank dem Einfluß des gemilderten ozeanischen Klimas sich Äpfel- und Kirschbäume unter der Last der Früchte beugen, Stachelbeer-, Johannisbeer- und Himbeerbüsche gedeihen. Eine niedrige Steinmauer wird von etlichen Wegen durchschnitten, die hinausführen auf die Wiesen und Weiden, auf die Felder und am Bache hinauf inmitten von Wäldern, deren Birken, Kiefern und Tannen das nötige Brennholz liefern, zur Mahlmühle. Im Gemüsegarten pflegt man alle unsere Gemüse, in Mistbeeten sogar Melonen, unter 61° N. Am Strande liegt ein Badehaus, und hinter den Wirtschaftsgebäuden führen Spazierwege zu einzelnen aussichtsreichen Felsvorsprüngen, auf denen Bänke und Lauben zur Ruhe laden.
Tief im Hochland verzweigt sich der Sogne in mehrere immer enger werdende Meeresstraßen und Felsengassen. Im Jahre 1868 fuhr eine Lawine vom Westrande nieder und baute über den 1½ km breiten Wasserspiegel eine Firnbrücke. Den südwestlichen Zweig des Fjords, den Näröfjord, fährt der Dampfer hinauf bis Gudvangen. Hier rücken die Felsenmauern so eng zusammen, daß sie bei ihrer gewaltigen Höhe das Sonnenlicht, das im Winter ziemlich flach einfällt, für mehrere Monate absperren. Im benachbarten Lärdalfjord vermißt man z. B. die Sonne 27 Wochen lang im Winter. In diesem südöstlichen Zweige trifft man auch eine der altertümlichen norwegischen Stabkirchen, die Borgundskirche, mit ihren schindelgedeckten Dächern und Türmchen, den vielen Giebeln. Sie ist sehr alt, stammt aus dem 12. Jahrhundert; seit der Reformationszeit ist diese echt norwegische Holzbauweise der Kirchen ausgestorben. Ein alter Opferstein des Thor dient darin als Altar.Die Kirche Wang bei Krummhübel im Riesengebirge ist eine solche aus Norwegen stammende Stabkirche, die der nordgermanischen Zimmererkunst alle Ehre macht.
Nach Osten schiebt sich der breitere Aardalfjord in das Gebirgsmassiv. Am Eingange des Aardalfjords ragen gleich Nadeln der 970 m hohe Bodlenakken und die 1250 m hohe Boermolnaase auf, während die schnee- und eisbedeckten Gipfel des Jötunheims den Hintergrund des alpenhaften Gemäldes bilden. Am Ufer liegen armselige Holzhäuschen, deren Bewohner, da der Steinboden den Anbau kaum gestattet, vor allem von den Fischschätzen des Fjords sich nähren. Davon zeugen die überall zum Trocknen aufgehängten Netze. Scharen flachshaariger Kinder laufen spielend am Strande umher.
Hier strömt aus dem Herzen des norwegischen Hochgebirges, des Jötunheims, wie es die norwegischen Wanderer getauft haben in Erinnerung an die Frost- und Reifriesen der Edda, die Utlaelv in den Fjord. Sie hat ihre wilden Gewässer, wie das meist im Hintergrunde der Fjorde geschieht, in einem See etwas beruhigt. Auf dem »Eid«, dem alten Moränenwall, der den See vom Fjorde abschließt, liegen einige Häuschen. Talaufwärts verengt sich das Bett des Bergstroms zum Vettisgjelet in weichem, bröckligem Gesteine.
Eine Strecke weiter dehnt sich das Tal wieder zu größerer Breite, und man erblickt das Vetti-Gehöfte, in welchem Reisende für die Nacht gute Unterkunft finden und von dem aus ein Zickzackpfad nach den zu den Wolken strebenden Höhen und nach dem Abgrunde führt, in dessen gähnende Tiefe man, am Rande des Felsens platt auf der Erde liegend, hinabblicken kann, um den Sturz des mächtigen Stromes zu verfolgen. Ein Seitenpfad führt abwärts in das Tal der Mörkedola, deren aus zwei kleinen Seen am Fuße der etwa 2100 m hohen Koldedal-Platte kommende Wassermasse im Vettisfos, dem höchsten der vielen norwegischen Fälle, aus einer Höhe von 260 m über eine Felskante senkrecht zwischen den im Halbkreise sich aneinander reihenden dunklen Felsen herabstürzt und vom Gegenstrom der herniedergepreßten Luft wie eine durchsichtige Wolke schimmernden Schaumes emporraucht, deren glänzende Helle sich leuchtend von der düsteren Pracht des felsigen Hintergrundes abhebt.
Über den Boden wie auch um die Felsen ringsum schmiegt sich eine Decke von dunklen, schwammigen Flechten; alles trägt dazu bei, die blendende Weiße des Schaumes hervorzuheben; die Wassermasse streift nur wenig die Felswand, über die sie sich herabwälzt und auf deren schroffem Grat einige wenige Birken einsam emporragen. Während der Blick an dem Falle hängt, beginnt die Schaumsäule, vom Winde getrieben, hin und her zu schweben, die Schwingung wird immer heftiger, bis das schimmernde Silberband schließlich, gleich dem Pendel einer Uhr, über einen Raum von mehr denn 80 m sich hin und her bewegt. Ein brausender Windstoß fährt dazwischen, und der glänzende Streifen zerstiebt in eine riesige Wolke, die wie ein durchsichtiger Schleier die düsteren Felsen umflattert; dann aber, wenn der Wind nachläßt, verwandelt sie sich wie mit einem Zauberschlage wieder in die wunderbare Säule aus leuchtendem Kristall.
Nun aber hinauf zum Jötunfjelde, in die Welt der norwegischen Gletscher und Braes (d. h. Breiten), die als große Firnfelder zipfelartig nach allen Seiten in Hochtälern vorwärts kriechen, bis sie sich in irgendeinem Fjordarme mit einem großen Gletschertore öffnen, aus dem brausend die Schmelzwasser hervorbrechen. Hier wächst in 1200-1500 m Seehöhe kein Baum mehr, Seen füllen alle Mulden und sind mit spärlichem Grase und Moosen gesäumt. Mitten aus dem vergletscherten Hochlande steigt der höchste Gipfel Norwegens, der Galdhöpig, zu 2560 m mit steilem Absturze als schwarze Felsmasse im weißen weichen Firn des Smörstabsbrae mit seinen blauen Gletscherterrassen auf.Vergl. A. Baumgartner. S. J. Durch Skandinavien nach Petersburg. Freiburg 1901, Herder'sche Verlagsbuchhandlung.
Die Aussicht auf diese Hochgebirgswelt der »Tinder«, »Pigger«, »Hörner« und »Nebber« ist anders als etwa die von Wengernalp aufs Berner Oberland. Treffend kennzeichnet Kjerulf, der Geolog Norwegens, diese Landschaft, indem er sie mit dem Anblick eines unabsehbaren Lagers vergleicht, dessen dunkle, weißgesprenkelte Zelte sich wirr aneinanderreihen, während über ihren Spitzen gewöhnlich dichtes Gewölke ruht, das, vom »Fjeldsnoe« angeblasen, wie die Wolke eines Vulkanes emporwirbelt.
Drunten windet sich wieder eine kleine Karawane von Fjeldwanderern heran; in groben Regenmänteln, breitkrempigen Hüten und hohen Reitstiefeln schwingen sie sich eben am Rande des Eisfeldes, des Braes, von ihren kleinen, sicher gehenden Reitpferdchen mit ihren gestutzten Mähnen und lassen sie und die Packpferdchen mit dem Mundvorrate zurück. Ein Renntierjäger ist hier der »Alpenjäger« und liegt auf der Lauer auf sein Wild.
Drunten in den Unterkunftshütten – oder besser noch in den freundlichen Sennhütten oder »Saeterstuen«, wo die wackeren Mädchen den Sommer lang ihr Milchvieh warten und melken, bei Sturm und Nebel in die Steinpferche treiben, dort findet der Fjeldwanderer Bewirtung und Nachtlager. Hat er sich erquickt an frischer Milch und Butter, an Renntierfleisch oder an einigen »Fjell-Örreter«, d. h. Bergforellen, die kurz zuvor aus dem kalten Schneewasser im Hochsee gefangen sind, hat er sich müde geplaudert mit den freundlichen Bergkindern, dann lädt ihn das eingeheimste duftige Alpenheu zu wohlverdienter Ruhe.
Der Auftrieb in die Berge geschieht Ende Mai und ist dann ein Freudentag für Mensch und Tier. Davon zeugen die fröhlichen Gesänge der mitziehenden Budeias (Sennerinnen). Ein von Franz StockFranz Stock, Lom in Gudbrandsdalen. Aus dem norwegischen Landleben. Im Deutsch-Nordischen Jahrbuch 1914. Eugen Diederichs Verlag, Jena. erstmalig übersetztes Säterlied möge hier einen Platz finden:
Zum Säter! (Tilsäters.)
So zählet die Schafe und zählet die Ziegen
Und holet die klingenden Glöcklein herbei!
Warum denn noch spinnen, warum denn noch liegen?
Der Sommer ist da, huhei, huhei!
Zum Säter!
Nun leuchtet die Sonne schon nächtlicherweile,
Nun sprießt auf den Bergen das duftende Gras,
Nun fliegen die Bäche so schnell wie die Pfeile,
Nun winkt uns das trauliche Sommergelaß
Zum Säter!
Schon schlafen im Fjelde die eisigen Winde;
Hoch oben am Gipfel nur glänzt noch der Schnee.
Nun steigen die Trolle hinab in die Gründe,
Und Elflein spielen auf blumiger Höh'!
Zum Säter!
Zum Säter, zum Säter! Durch Birken und Tannen!
Huhei, in die frische, sonnige Luft!
Nun laßt uns die Sorgen des Tales verbannen!
Bergauf, bergauf! Die Sommernacht ruft:
Zum Säter!
Die Kuhmilch wird zu Butter verarbeitet, die hauptsächlich nach England wandert. Aus der Ziegenmilch wird der jedem Nordlandsreisenden genugsam bekannte Myseost (Käse) hergestellt. In frischem Zustande süß und angenehm schmeckend, gewinnt er mit der Zeit an Härte und Schärfe. Selten findet der Deutsche Geschmack an ihm, aber um so mehr schätzt ihn der Normann. Die würfelige Form dieses durchaus geruchlosen Milcherzeugnisses findet sich ebensowohl auf dem Tisch des gemeinen Mannes wie auf der reich besetzten Tafel des Königs. Das Leben auf dem Säter dauert 4 bis 5 Monate. In dieser Zeit hat die Budeia mit einer jungen Gehilfin vollauf zu tun. Ist eine genügende Menge Butter vorhanden, ist die Zahl der großen Ziegenkäse auf 40 angewachsen, so begeben sich die Besitzer mit einigen Klövhesten (Packpferden) in die Berge und schaffen das Gewonnene nach Hause. Ein Besuch aus dem Tal ist jedesmal ein Fest für die einsamen Schaffnerinnen da oben, und als ersten »Velkom« bringt man ihm Raumgröd (Rahmen- oder Sahnengrütze), einen aus Mehl und Sahne zusammengekochten Brei, auf den Tisch, Milch, Sahne, Käse, Butter, Fladbröt in Hülle und Fülle!
Auf der Nordseite des Sogne liegt der gewaltige Jostedalsbrae, das größte zusammenhängende Gletschergebilde Norwegens, wie ein riesiges Eisbärenfell auf dem Fjelde, und seine weißen Tatzen kriechen nach den Fjordarmen zu. Lysterfjord und Fjärlandsfjord, der Schauplatz der Frithjofsdichtung Esaias Tegnérs, sind die größten dieser Nordarme des Sognefjords.
Schweden, Wisby und Kopenhagen. Wanderstudien von L. Passarge. Leipzig, Fr. Brandstetter. Als wir am frühen Morgen von Lund ausfuhren, standen die prachtvollsten Gewitter am Himmel; die Sonne brach hie und da durch und beleuchtete das schöne Hügelland Schonens, das indessen bald einer ganz neuen Landschaft, der echt schwedischen, Platz macht, die nun den Reisenden nordwärts begleitet, wohin er auch seinen Fuß setzen mag.
Diese eigentliche schwedische Natur ist etwas so vollkommen Neues und Eigentümliches, daß der Fremde anfangs wie vor einem Rätsel steht; erst allmählich versteht er die einzelnen Erscheinungen, indem er vergleicht und ordnet, und dann empfängt er ungefähr folgenden Gesamteindruck:
Schweden ist in keiner Weise ein Gebirgs-, sondern ein weites Felsland. Vorherrschend eben, oft in Hügelschwellungen übergehend, hie und da von langen einförmigen Rücken durchzogen, macht es den Eindruck eines aus dem Meer aufgetauchten, von der Verwitterung noch fast unberührten, jungen Landes; gerade so, wie der Meeresgrund sich darstellen würde, wenn die darüber befindliche Wasserflut sich verliefe: so erscheint jetzt das Land Schweden. Ursprünglich vom Inlandeis bedeckt, wie heute Grönland, ist es mit Gotland und Finnland in einer Zeit, welche in geologischem Sinne als neu bezeichnet werden muß, von der Eislast durch Schmelzung befreit worden. Denn noch hat das Land seine ursprüngliche Art als Gletscherboden in keiner Weise überwunden. In ungeheuerer Ausdehnung, in unglaublichen Massen tritt hier das blankgeschliffene Urgestein auf und trotzt den zerstörenden Einflüssen des heutigen nordischen Klimas. Während anderswo schon die Felsen zerbröckelt und in Ackerkrume verwandelt sind, in jene weiche Masse, aus welcher die Kultur keimt, starren uns hier die nackten Granit-, die Gneis-, die Porphyrblöcke an und bilden ein Durcheinander, vor welchem die Hand des Menschen erlahmt, den eine wenig gütige Natur nötigt, mit dem unerbittlichen Gestein um sein Dasein zu ringen.
So weit das Auge blickt, zeigt sich ein unermeßlicher Felsen-, Pflanzen- und Baumwirrwarr, jenes seltsame Gemisch, das die Schweden einen skog nennen; denn die Felsbrocken, welche die ganze Erdoberfläche bedecken, sind meist wieder in einen doppelten Mantel gehüllt. Moos und Gräser, Farnkräuter und allerlei kleines Pflanzengestrüpp, Preißel- und Blaubeeren, Porst und Wacholder bedecken die Felswüste wie mit einem einzigen Teppich. Darüber aber erhebt sich der Baumwald, selten aus Eichen, Buchen und anderen Laubbäumen gebildet, meist ein Gemisch von Fichten, Kiefern, Erlen und Birken. Diese drei Stücke, zu unterst das starrende Felsgetrümmer, gehüllt in den Pflanzenteppich, welcher es pelzartig überzieht, und dann der Baumwald: diese drei im Verein bilden den schwedischen skog, den Feind aller Kultur, den Sitz aller Unholde. Gehst du in einen solchen skog, so hast du in wenigen Minuten Pfad und Richtung verloren. Hie und da leitet dich wohl ein von dem weidenden Vieh getretener Gang, immer aber in die Irre; du brichst durch den Pflanzenpelz, welcher die Untiefen überzieht, du zerreißest deine Kleider, deine Haut an Gestrüpp und Felskanten und verzichtest auf jedes weitere Vordringen.
Bevor ich nach Schweden kam, hatte ich das Wort skog vielfach in Volksliedern und anderen Gedichten gefunden, daneben das Wort lund. Beide bedeuten Wald, nach dem Lexikon. Woher aber diese doppelte Bezeichnung für denselben Gegenstand? – Nun wurde mir mit einem Male der Unterschied klar. Skog ist der schwedische Urwald, jenes Gemisch von Fels und Baumwald, lund aber der reine Baumwald, der aus fruchtbarem Erdreich sprießende, in dessen Schatten es sich wandeln läßt. Daher wohnt der schwedische Troll und die Waldfrau (skogsfra) niemals in einem lund, sondern in dem unheimlichen skog. Wollen die Schweden einen heiteren, schattigen, beseligenden Aufenthalt malen, so sprechen sie von einem lund; dagegen lautet der Kehrreim in einem Gedicht von Geijer:
Det är såDas schwedische å immer wie o gesprochen. mörkt långt långt bort i skogen.
Es ist so dunkel weit weit tief im Walde.
und in einem andern von Malmström:
Da suckar det sa tungt uti skogen.
Da seufzt es so schwer in dem Walde.
Der skog ist gleichsam das Kleid des schwedischen Landes, das ursprüngliche, einheimische. Er überzieht das Land von der Hügelebene Schonens ab bis zu jenen Einöden Lappmarkens, in welchen die Mitternachtssonne leuchtet. Alles übrige ist Ausnahme, gleichsam das Zufällige. Als solche Ausnahme treten auf: das Sumpf- und Torfland, die Seen und das Kulturland des Menschen. Auf den Sümpfen, die meist nur verlandete, vertorfte Seen darstellen, wächst dasselbe Pflanzenwerk wie auf ähnlichen Stellen in Deutschland: Porst, Rietgras, Wacholder, verkrüppelte Kiefern. Sie dienen dem Vieh (kreatur) als Weide (gräsgång) und würden von jedem Tiere in Deutschland verschmäht werden. In Schweden werden sie häufig ausgerodet, geebnet und als Wiesen benutzt.
Die Zahl der Seen ist so groß, daß sie nur noch von der der finnischen Granitplatte übertroffen wird; sie nehmen mehr als den achten Teil des ganzen Gebietes von Schweden ein. In Södermanland, wo dieses Verhältnis noch auffallender ist, hat man das Sprichwort: Als Gott einst Wasser und Land geschieden, habe er Södermanland vergessen. Der Fremde möchte diesen Ausspruch auf das ganze weite Reich ausdehnen, das, von der Höhe des Himmels aus gesehen, den Eindruck einer Mondkarte machen müßte. Die Karten verzeichnen natürlich nur größere Seen. Bei einer Fahrt durch Schweden wird die Erscheinung dieser Wasserbecken, die uns anfangs überrascht, allmählich so gewöhnlich, daß wir sie ebensowenig zählen als die Bäume in einem Forste. Immer liegt solch ein See inmitten des meilenlangen Waldes, von Felshöhen umgeben, nicht von Gebirgen; immer den blauen Himmel widerspiegelnd und den prächtigen Laubkranz; immer still und heimlich, verlassen und einsam, wie ein totes Meer. An den Rändern wächst stets Rohr und Schilf, weiter beginnen die Mummeln oder Seerosen (die Nöckrosen, näckrosor), und zwischen den Pflanzen ragen in allen möglichen Größen dunkle Felsblöcke über die Wasserfläche wie ungeheuere, ruhig aus dem Wasser schauende Frösche. Selten erblicken wir an einem solchen See ein Haus, das seine roten Wände in den Spiegel malt, oder ein Segel, das die blaue Flut belebt. Nur hie und da steht ein zerbrechlicher Kahn an dem Gestade, mit welchem die Leute von drüben das frisch gemähte Gras holen, um es in der Nähe ihres Hofes auszustreuen und zu trocknen. An solchen Seen ist es still und einsam. Zuweilen schaukelt sich eine Möwe über der Flut, ein Specht hackt an der Rinde eines Baumes, ein Eichhörnchen springt von Zweig zu Zweig, vielleicht zieht auch ein Habicht vorüber und nötigt die trägen Wildenten zu schwerfälligem Fluge. Ich habe daselbst vergebens auf den Gesang der Vögel, das heitere Spiel der schreienden Schwalben gewartet; die Natur ist hier schweigsam, selbst das geschwätzige Murmeln der Quellen fehlt oder verklingt ungehört in der unermeßlichen Waldwüste.
In diese stille, starre, scheinbar unbezwingliche Natur ist nun der Mensch getreten und hat sich ein Heim geschaffen. Zuerst hat er sich da angesiedelt, wo der Wald weite Ebenen bedeckte, wo dieser ein lund, kein skog war: bei Upsala, auf den reichen Fluren Ost- und Westgotlands. Aber er hat sich auch mitten in dem unheimlichen skog niedergelassen und als Vorkämpfer der Kultur den Unhold angegriffen. Der Boden an sich, der in Kulturländern so hohe Preise erzielt, hat in einem solchen skog anfangs keinen Wert; er erhält ihn erst, wenn der Mensch durch seine Arbeit ihn schafft. Noch jetzt lassen sich Hunderte von Ansiedlern in den einsamen Wäldern nieder, erbauen eine Hütte und dringen von diesem Punkte nach dem Saume vor, den Wald schrittweise bezwingend, ihn rodend und dem Anbau öffnend.
Man denke hinsichtlich der Schwierigkeit hierbei nicht an amerikanische Ansiedler. In der neuen Welt gilt es nur, den Pflanzenwuchs, den Baumwald zu bezwingen; in Schweden ist das Wegräumen der Bäume ein Leichtes – die Axt fällt sie oder das Feuer verzehrt sie; auch die dichte Pflanzendecke, der Filz, welcher den Felsboden einhüllt, wird durch Feuer unschwer entfernt, der Ansiedler sticht mit dem Spaten die Pflanzendecke ab, läßt die Stücke trocknen, häuft sie aufeinander und zündet sie an. So verzehrt das Feuer das hindernde unfruchtbare Pflanzenwerk und läßt es in Asche zerfallen, die wiederum den Boden düngt. Dieses Verfahren heißt svedja, schwenden. Ist der Mensch so weit gekommen, dann erst beginnt die schwerste Arbeit für ihn: er hat den Felswald auszuroden. Hier genügt nicht mehr Spaten und Axt allein; Sprengungen durch Pulver sind erforderlich und unsägliche jahrelange Arbeit, bis endlich das Getrümmer entfernt, der Boden gereinigt und eine Ackerkrume geschaffen ist, in welche die Saat gestreut werden kann. Oft hat es den Ansiedler verdrossen, den durch Feuer zerstörten Urwald ganz zu beseitigen; er läßt die Steinblöcke mitten im Erdreich stehen und streut die Saat oder setzt die Kartoffeln dazwischen; oder er duldet auch die verbrannten Stümpfe und Stubben der Bäume, die nun halb verkohlt mitten unter dem frisch grünenden Getreide stehen und den sonderbarsten Anblick gewähren. Die ausgerodeten Felsbrocken aber häuft er sorgsam in einem Steinwalle (stendige) auf und umgibt damit seine Ackerstücke, wodurch er sie gegen den Einbruch des Wildes oder der weidenden Herden schützt. Oft benutzt er auch die angebrannten Baumstämme zu einem Holzzaune (skidgård) und stellt zuweilen sogar den Holzzaun auf den Steinwall, um sich eines doppelt sicheren Schutzes zu erfreuen. So wohnt der schwedische Ansiedler in seiner Kate auf freiem, selbstgeschaffenem Boden, niemandes Herr, niemandes Knecht; ein beneidenswertes Los, so lange die Reinheit der Sitten währt und die Zufriedenheit des Gemüts.
Eine Fahrt vom Südende Schwedens bis zum Wettersee, in das Herz des weiten Reiches, zeigt uns durchgehends den Charakter des Koloniallandes. Erst das Schonensche Hügel- und Fruchtland, dann den unermeßlichen skog, zuletzt eine Art Gebirgsbildung, mit Wald und Seen, die südliche Barre vor dem Wettersee, welche die Eisenbahn zu übersteigen und zu durchschneiden hat. Doch kommen schon im nördlichen Teile von Schonen echt schwedische Bergzüge vor, die etwa hundert Meter über die mittlere Erhebung des Hügellandes aufragen und aus starrem Granit bestehen.In der Umgebung von Upsala und Stockholm bezeichnet man mit dem Namen Åsar langgestreckte, bisweilen 100 km weit durch die Landschaft hinziehende Hügelrücken aus unverkennbar geschichtetem Sand, Kies und Geröll von mäßiger Korngröße, die aber nicht wie die Erdmoränen dem Rande des zurückweichenden Inlandeises entlang, sondern gerade entgegengesetzt in der Richtung der Eisbewegung, also etwa nordsüdlich, laufen und wohl durch die unter dem Inlandeis in langen Eistunneln kräftig dahinströmenden Schmelzgewässer aufgeschüttet worden sind, die beim Austritt aus dem Eise ihre Last fallen ließen und so mit dem Zurückweichen des Eisrandes den Hügelrücken verlängerten.
Nach J. Partsch, Schwedische Landschaftstypen, Geogr. Zeitschr. 1912 S. 430. Sie werden Åsar (Einzahl ås), Dachrücken genannt. Wer den Dachfirst der schwedischen Häuser gesehen, die mit Rasen bedeckt sind und mit äußerst geringer Neigung zu beiden Seiten abfallen, wird den Vergleich richtig finden. Solche åsar ziehen sich vom Kattegat aus quer durch Schonen nach Südosten hin, unter verschiedenen Namen: Soderåsen, Linderåsen, Stenhufond usw. Der großartigste ist aber jener 200 m aufsteigende, »Kullen« genannte Höhenzug, welcher nördlich von Helsingborg wie ein ungeheuerer Riesenfinger sich ins Meer erstreckt und auf seiner Spitze einen Leuchtturm trägt.
Alle diese Granitrücken, das ganze ungeheuerliche Gemisch des skogs hatte die Eisenbahn zu überwinden. Wer je auf dem Kamme des Riesengebirgs, namentlich auf den mit Granitblöcken bedeckten Spitzen, dem Reifträger, den Sturmhauben usw. gewesen ist, kann sich ungefähr eine Vorstellung von dieser Felsnatur machen, wenn er sich das Wunderlich-Wilde um das Dreifache vermehrt und dazu die ganze Gebirgswüste mit dichtestem Walde bedeckt denkt. Hier waren breite Granitrücken zu durchbrechen, vor allem aber das unendliche – ich möchte sagen: Felsgestrüpp zu entfernen. Hier war ein Fluß zu überbrücken, dort ein Damm aufzuschütten, bald durch ein Tal, bald durch einen der Seen. Wo sollte man aber die ausgerodeten Steinblöcke hinschütten oder gar nützlich verwenden? Wo die Erde hernehmen zu den Schüttungen, da Schweden zwar das an Steinen reichste, aber an Erde ärmste Land Europas ist? Die aus der Bahnlinie gerodeten und gesprengten Steine sind alle zu Steindämmen aufgehäuft, welche in ununterbrochener Linie die Eisenbahn auf beiden Seiten begleiten und nun zugleich einen Schutzwall gegen die angrenzenden Waldweiden der Bewohner bilden. Du fährst stundenlang, meilenweit auf der Bahn weiter, aber diese Steinwälle nehmen kein Ende; sie begleiten dich so stet und ohne Unterbrechung wie der Telegraphendraht. Wo es aber notwendig war, zu den Bahnhöfen, Dämmen usw. Erde zu beschaffen, da blieb nichts übrig, als sie mühsam zwischen und unter den Steinblöcken hervorzusuchen. Wir erblicken oft neben der Bahn ein Gewirr von frisch durchwühlten Steinblöcken, die durcheinander geworfen ganz anders daliegen als das sonstige Steinmeer. Das Unterste dieser Steinblöcke ist nach oben gekehrt, die Pflanzendecke fehlt ganz, und das bißchen Dammerde und Schutt, darauf die Blöcke lagen, ist fortgeschafft. Aus solchen durchwühlten Felsmeeren haben die Erbauer die Schutterde zur Eisenbahn genommen. Wie wir in Norddeutschland die Erde durchwühlen nach Steinen, so hat man hier die Steine durchwühlt nach Erde.
Die Fahrt durch das südliche Schweden ist bei aller Neuheit der Erscheinungen in hohem Grade ermüdend. Es sind stets dieselben Grundzüge: Fels und Wald, zuweilen ein blauer duftiger See. Nirgends jene Großheit der Natur, welche uns in den Alpen, in Norwegen, selbst schon im Harze fesselt; selten ein weiter Blick, eine Umschau über Täler und Höhen. Wie der Natur das Siegel der Herbheit und Verlassenheit aufgedrückt worden ist, so fühlt sich der Geist in dieser Wüste, die nicht Wüste ist, in diesem unentwirrbaren Durcheinander verlassen, gedrückt und zur Schwermut geneigt. In dieser Natur gewöhnt man sich, wie es Humboldt so schön ausdrückt, an den Gedanken, daß der Mensch nicht die Hauptsache in der Schöpfung sei. Und so ist es auch dem eingeborenen Schweden zumute, hier wurzelt der Charakter des Volkes. Der Gebildete, der schreibende Dichter, sie können wohl die Schranke, welche ihnen die Natur gezogen, durchbrechen; sie ringen zum Licht, der Schein einer idealen Welt verklärt ihr Dasein; nicht so das singende Volk. Unendlich schwermütig, herb und unvermittelt klingt es aus seinen Liedern, wie eine einzige, nie verstummende Klage über das kurze, schwere Erdenleben. Wenn jene Mollieder mit ihren strengen Übergängen, ihren eigentümlichen Rhythmen durch den stummen Wald oder über den schweigenden See zittern, so ist es uns, als hörten wir nicht Menschenstimmen, sondern als klinge die Seele dieser tieftrauernden, in sich versunkenen Natur selber: wir glauben, jene klagenden Laute zu vernehmen, welche durch das eintönige Rauschen der Fichten tönen, wie der Seufzer eines gepreßten Herzens. Wir verstehen die Lieder des Volks und die tiefe Klage in dem Kehrreim eines dieser Volkslieder:
»Mir deucht, schwer, schwer ist es, zu leben!«
Aber wie der Geist des Menschen, und umnachtete ihn auch die tiefste Schwermut, doch eine Stelle hat, durch welche das Himmelslicht der Freude dringt, so hat auch der schwedische Wald eine Erscheinung, welche diese düstere Natur verklärt und verschönt, und das ist nichts weiter als eine unbedeutende, in unserem Vaterlande wenig beachtete Blume. Ich meine nicht die schöne Linnaea borealis, die einst ungetauft in diesen Wäldern stand, sondern das einfache Weidenröschen (Epilobium) mit seinen roten, leuchtenden Blüten, bei uns im Mittelgebirge die Sommerzierde der Holzschläge und Schonungen. Wohin wir schauen, überall entfaltet diese Blume ihre schönen, rotvioletten Blüten. Bald prangt sie mitten unter den wüsten Bäumen des skog, bald auf einsamem Felsblock. Sie scheint sich gern dem Menschen anzuschließen; denn sie folgt ihm immer, wohin er auch rodend, brennend, anbauend gekommen ist. Die Blume steht ebenso auf der Eisenbahn wie in dem Gärtchen der Bahnwärter, sie ziert die winzigen Kartoffel- und Bohnenbeete, die alle mit einem Steinwalle umgeben sind. Sie keimt noch aus den Rasenbrocken, welche auf die Steinwälle gelegt werden, sie steht mitten in den kleinen Roggenfeldern, dicht neben den halbverbrannten Stubben und dunkeln Steinblöcken. Wohin du blickst, die rote Blüte leuchtet dir immer entgegen. Aber die Schweden haben der Blume auch ein dankbares Herz entgegengebracht; sie haben sie so hoch geehrt, wie man eine Blume nur ehren kann, indem sie diese nur immer blomman, die Blume, nennen. Die Epilobiumblüte ist also den Schweden der Vertreter der ganzen Blumenwelt. Die anderen nennt er bei ihren mannigfaltigen Namen, das Epilobium aber ist ihm einfach die Blume.
Nach dem Aufsatze von C. W. in der Wissensch. Beilage der Leipziger Zeitung 1898, Nr. 63. Göteborg zeigt in seiner Umgebung, wenn man sich seewärts der Stadt naht, etwas Norwegisches. Ein Schärengürtel, Hunderte von Inseln legen sich auch vor die fjordartige Mündung der Götaelf und halten die gefährlichen Brandungswogen, die der Nordwest heranpeitscht, auf. Nach einer halben Stunde, die der Dampfer flußaufwärts fährt, lenkt er in den Hafen ein mit seinen Schiffen, Docks, Werften, Speichern; denn Gotenburg ist der größte schwedische Handelshafen und hat ungefähr 150 000 Einwohner. Die Götaelf durchschneidet die Stadt, Brücken vermitteln den Verkehr. Draußen auf dem Inselring liegen vielbesuchte Seebäder, z. B. Marstrand, Sarö.
Eigentümlich sind der Stadt, wie Schweden überhaupt, die Einrichtungen der Gasthäuser. Da steht der sogenannte Sexatisch, der Smörgåsbord. Wenn ein Schwede in ein Gasthaus tritt, so geht er jederzeit zuerst an diesen Tisch und ißt dort vom Lachs, Renntierschinken, von der Hummermajonnaise, den Krebsen, Eiern, Sardellen oder Sardinen, der Mettwurst, dem Schinken, dem Knäckespisbrod, der Butter, dem Käse oder wonach sonst sein Herz Gelüsten trägt, soviel er will, und trinkt zwischenhinein einen »Snaps« nach dem anderen, Aquavit, Genever, Korn, Kümmel oder schwedischen Punsch, der auch stets zum Kaffee oder zum Selterser Wasser genossen wird. Der Zutritt zum Sexatisch kostet eine bestimmte Summe, dafür kann man dann essen und trinken nach Herzenslust. Von Gotenburg fährt man durch den berühmten Götakanal nach der Hauptstadt Stockholm. Er verbindet sämtliche große Seen Südschwedens miteinander, den Wener-, den Wetter-, den Mälarsee. Er ist 188 km lang; 100 km davon entfallen auf die Seen, 88 km auf die eigentliche Kanalstrecke. Er ist überall 3 m tief, oben 26 m breit, und das Schiff erklimmt die Höhe, die die Götaelf in den schauerlich-schönen Trollhättafällen herabstürzt, in 58 Schleusen zu je 35,6 m Länge. Dieser Anstieg dauert etwa zwei Stunden. Die ungeheure Kraft der Fälle wird in zahlreichen Fabriken ausgenutzt, die überall in die Steinklippen hineingebaut sind. Diese teilen den Fall in viele Strähne, er stürzt von Stufe zu Stufe schäumend und donnernd nieder; das Weiß der stäubenden Wassermassen wird gehoben durch die düsteren Nadelwälder ringsum.
Nach zweitägiger Wasserfahrt kommt man durch Södertelja nach Stockholm, das auf dem Inselisthmus zwischen der »Saltsjö«, dem Baltischen Meere, und dem Mälarn auf acht Granitinseln erbaut ist und mit seinen Brücken und Wasserstraßen und Palästen den Namen »nordisches Venedig« verdient.J. Partsch (a. a. O. S. 439) macht dazu die Bemerkung: »Schon Jakob Ziegler zieht 1532 diesen Vergleich. Stockholm hat keinen Anlaß, sich dafür besonders zu bedanken. So wenig das lebendige, klare Wasser des Norström mit der trägen trüben Flut der Lagunen sich verwechseln läßt, die doch nicht allein den Gesichtssinn in Anspruch nehmen, so wenig gleicht den auf Pfahlrosten eng zusammengedrängten Palästen und dem auf unsicherem Boden Wellen werfenden Pflaster der Plätze des gealterten Venedig der zu anmutigen Höhen ansteigende Granitgrund Stockholms, überwebt von dem zwischen heiteren Prachtbauten hervorquellenden Grün der Gärten und Parke. Die nordische Stadt richtete sich wohl auch auf Inseln zwischen Wasserarmen ein und erkannte in ihnen ihre Schutzwehr, aber sie ist nicht – wie Venedig – landscheu geworden. Sie ließ sich nicht vom Wasser beengen, sondern überwand es als gebietender Brückenort zwischen Mälar und Saltsjö.« Aus Norremalm, der Nordvorstadt, gelangt man über die belebte Norrebro (= brücke) auf die Staden, eine Schärengruppe inmitten der schmalen Verbindungsstraße zwischen Ostsee und Mälarn, dann hinüber nach Södermalm, der Südvorstadt. Auf den Staden liegt das herrliche Königsschloß; hier entstand in geschützter Lage (denn die räuberischen Finnen machten oft Einfälle) der älteste Teil der Stadt mit seinen engen Straßen, die, oft ohne Fußsteig, nur mit Kieselsteinen gepflastert sind. An den Kais, in den Parks, in den Landgärten herrscht des Sommers reges, fröhliches Leben; denn der Schwede liebt die Geselligkeit und Fröhlichkeit. Die langen Tage – in der Zeit vom 17. bis 21. Juni ist hier die Sonne von morgens 3 Uhr bis abends gegen ½10 Uhr sichtbar – begünstigen diese Neigung außerordentlich, wenn sie sie nicht hervorgerufen haben.
Ein anschauliches Bild solches Stockholmer Sommernachtslebens auf dem Stromparterre, einem Lustgarten unterhalb der Norrebro, folge hier: »An kleinen runden Tischen sitzt das Publikum, Bier oder Kaffee trinkend oder Eiswasser, Selters, Vichy mit schwedischem Punsch schlürfend, während die Husaren aufspielen. Die Damen alle in hellen, leichten, meist weißen Kleidern, luftig und sommerlich, die Herren auch in weißem oder hellem Anzuge mit Strandschuhen oder Strandmützen. Die Abende in Stockholm sind vom Mai bis September so gelinde, daß man sich das gestatten kann. Das Landklima Schwedens macht sich auf diese Weise geltend. Eine Hochsommernacht im Norden ist unvergleichlich schön, lau und warm und hell! Am Himmel eine wunderbar durchsichtige Färbung, ein Helldunkel, das nicht Tag und nicht Nacht ist, sondern nur eine dem Auge wohltuende, friedebringende, klarlichte Dämmerung, bei der auch die zarteste Schrift zu lesen ist und jedes Blatt an den Bäumen unterschieden werden kann. Die sanfte Bläue des Himmels tönt sich gen Nordwesten in ein zartes Rosa, gegen Süden und Osten aber in blasses Grün ab; die Wolkenstreifen schimmern in flüssigem Golde, und ihr Widerschein spiegelt sich in den Gewässern, die leise rauschen und belebt sind von Hunderten von Schiffen, Gondeln, Kähnen, Jachten; die buschigen Ufer verschwimmen im dämmernden Halblicht, und nur der glänzende Abendstern blickt einsam vom Himmel nieder. Der Stockholmer gäbe diesen Zauber seiner Mittsommernacht nicht für alle Pracht des Südens her.«
Seiner glücklichen Lage auf der Brücke zwischen Mälarn und Ostsee hat es Stockholm zu danken, daß seine Sommertemperatur, die bis höchstens 31°C steigt, immer 5-7°C niedriger ist als die der russischen Hauptstadt, desgleichen, daß seine Wintertemperatur, die höchst selten 9°C unter Null sinkt, sich um 9-10° höher stellt als die Petersburgs.
Unstreitig beruht der größte Zauber, den Stockholm auf den Reisenden ausübt, in dem eigenartigen Eingreifen des Wassers in seinen Inselstadtplan, sowie in der Umgebung des Mälarbeckens. Der 1163 qkm große Mälarn ist mit ungefähr 1400 Holmen (Inseln) bedeckt, streckt seine zahlreichen Buchten wie Finger ins Land, die umstarrt sind von tannenbewachsenen Felsen, aber ebenso umkränzt von freundlichen Städten, Dörfern, Schlössern, Kirchen, Ruinen und Wiesen.
An den Buchten und Fjorden, auf den dicht gesäten Inseln und Inselchen finden wir Felsriffe, parkartige Gruppen von Eichen, Linden, Ulmen, Eschen, Pappeln, Birken, Kiefern, Tannen, angebaute Strecken, und die kleinen Dampfer eilen rastlos von Holm zu Holm, oder von der Stadt nach den Landhäusern am Ufer. Eine der Inseln von ziemlicher Größe trägt den Djurgården, den Tiergarten. Natur und Kunst haben sich die Hand gereicht, um dies reizende Stück Erde zu gestalten: Fels und Eichenwald, schattige Fahrstraßen, schön gewundene Fußwege, Seen und Flüßchen, Villen und Wirtshäuser aller Art bringen in ihrem Zusammengreifen eine prächtige Wirkung hervor.
Der Sonntag ist in Stockholm, wenigstens zur Zeit des Morgengottesdienstes, ein Tag der Ruhe; Läden, Fabriken, auch Wirtshäuser sind geschlossen. Sobald die Frühkirche vorüber, sieht man zahllose Leute des Arbeiterstandes in die Sammlungen und Büchereien eilen, um wenigstens einmal in der Woche dem Bildungsbedürfnis zu genügen, während man den Nachmittag meist in einem der gesunden Parke in frischer Luft und fröhlichem Genuß verbringt.
Stockholm ist das Herz Schwedens; wer Schweden kennen will, kann hier genug lernen.Vergl. Alexander Baumgartner, S. J. Durch Skandinavien nach Petersburg. S. 335 ff. Freiburg 1901, Herdersche Verlagsbuchhandlung.
Wer sich zurückversetzen will ins alte Schweden, das durch seine Macht in Europa gefürchtet war bis an den Bosporus, der besucht die alte gotische Riddarholmskirche, die alte Kirche der Grauen Brüder aus der katholischen Zeit, heute mit ihren Kapellen die Grabkirche der protestantischen Schwedenkönige von Gustav Adolf an, dessen Grabschrift heißt: Moriens triumphavit! Auch Karl XII. liegt hier unter einem schwarzen Marmorblock mit einer goldenen Löwenhaut, Krone, Zepter und Schwert. Gottesdienst wird nicht mehr in dieser Grabkirche gehalten.
Wer aber Neuschweden kennen lernen will, Schweden, wie es heute lebt und schafft, der muß die Sammlungen der Stadt besuchen: das Museum der Akademie der Wissenschaften, deren erster Direktor Karl von Linné war, in welchem die Gesteine und Erze des Landes, seine Flora und Fauna in der trefflichsten Übersicht vereinigt sind. Da liegt auch ein riesiger, 490 Zentner schwerer Meteorstein. Das nordische Museum aber erschließt uns das Volksleben des Landes: da ist eine Gruppe aus Lappland dargestellt in dem Augenblicke, als sie die Herbstwanderung antritt, dort blicken wir in eine Bauernstube aus Dalarne und so sind alle Gaue des Landes charakteristisch vertreten mit ihren Holzschnitzereien, mit ihren farbenprächtigen Trachten, ihren Webarbeiten und Schmucksachen usw. Auch die anderen skandinavischen Länder sind gut vertreten. Am meisten fesselt aber im Tiergarten, bei den »Skansen« (Schanzen) das »Freiluftmuseum«, wo auf breitem Raume altschwedische Bauernhäuser aus allen Landesteilen, mit vollständigem Hausrat, dort ein altnordischer Friedhof, da eine Bergmannshütte aus der Gegend von Upsala, hier eine Köhlerhütte und ein Meiler, da ein alter Runenstein, ein hübscher Holzglockenturm und so viele bezeichnende Denkmäler der schwedischen Landschaft zwischen Wäldchen und Wiesen aufgestellt sind. Dazwischen sind in Gehegen Schwedens Tiere: Elch und Renntier, Bär und Fuchs, Adler usw. zu sehen, schwedische Gesteine in gewaltigen Blöcken, zwischen denen des Landes Blumen wuchern. Wenn man des Sommers dieses »Kleinschweden« an den schönen Abenden durchwandert, kann man auch die Volkstänze und Volksspiele der Schweden beobachten oder vom »Bredablick«, dem höchsten Punkt der ganzen Anlage, das Auge weiden an dem Schattenriß der Stadt, die zwischen Himmel, Meer, Felsinseln und Wald zu hängen scheint.
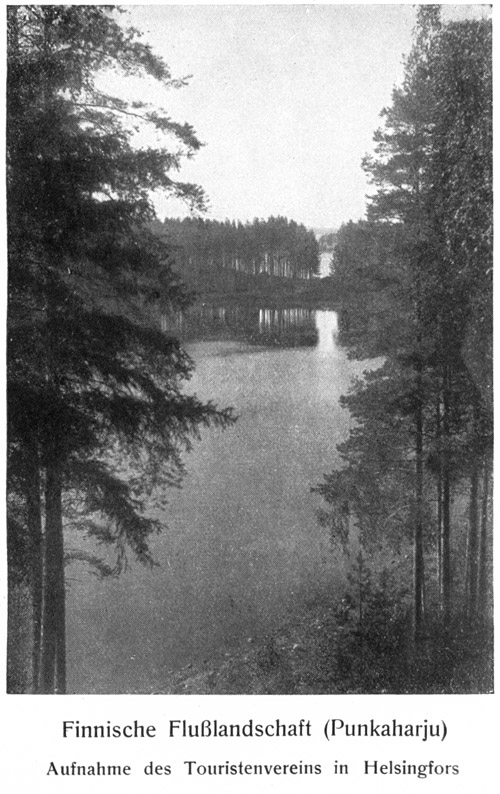
Quelle: A. Baumgartner, S. J. Durch Skandinavien nach Petersburg, S. 471 ff., mit kurzen Entlehnungen aus C. Meißner, Vom Wesen Finnlands. Velh. u. Klas. Monatshefte 1918, 12. Heft. Finnland ist Fehnland, ist Sumpfland – und auch der Name, mit dem die Finnen ihre Heimat selbst nennen, »Suomi« bedeutet nichts anderes. Das Land der tausend Seen wird es genannt; Seen, Wasserfälle, Moore, Wälder und Felsen sind hier ungefähr zu gleichen Teilen gemengt. Dies Land aus Granit, das von den alten Gewalten der Eiszeit die heutige Form seiner Berge und Täler empfing, hebt sich langsam, langsam ohne Erschütterung weiter – im Norden ungefähr 1,5 m, im Süden 60 cm in 100 Jahren! So wird mehr Land, aber manche Häfen müssen gebaggert werden und dem Meere nachziehen, die Flüsse werden reißender, die Wasserkraft wächst noch.
Von Schweden herüber führt in dies skandinavische Land mit den stammfremden Leuten eine Naturbrücke, die Gruppe der Ålandsinseln, zahllose Felsinseln, bald kahl und kaum von Moos übernarbt, bald schwimmenden Tannenwäldern gleich, bald Felsriffe mit Birken, Eschen, Fichten auf jedem Sims, bald bewohnte freundliche Wiesenpläne mit Blockhütten und sogar Feldbreiten. Gerste und Roggen haben hier unter dem starken Licht der langen Sommertage nur 116 Tage zum Reifen. 1808 sind diese von Schweden bewohnten Inseln Rußland überliefert worden, nachdem sich ihre Bauern durch Selbsthilfe der russischen Besatzung schon entledigt hatten. Die Festungswerke, die die Russen hier anlegten, am Eingange zum bottnischen, als besonders zum finnischen Busen, wurden 1854 von einem französisch-englischen Geschwader im Krimkriege zusammengeschossen. Jetzt ist das freundliche Mariehamn mit seinem halben Tausend Einwohnern der einzige größere Ort der Inselgruppe, die wegen ihrer der Maltagruppe im Mittelmeere vergleichbaren Lage auch heute noch ein Zankapfel zwischen den Ostseemächten, besonders Schweden und Finnland, ist.
In Åbo, der alten Hauptstadt im heidnischen Finnenlande, betreten wir das eigentliche Finnland, das stets ein schwedisches Kolonialland gewesen war, bis es 1809 als selbständiges Großfürstentum mit ständischer Verfassung dem Zarenreiche angegliedert wurde. Nach und nach hat man aber diese Selbständigkeit mehr und mehr »vergessen«, und erst im Weltkriege hat Finnland wieder die alte Freiheit mit deutscher Hilfe erkämpft. Neben der altfinnischen Sprache herrscht hier überall noch die schwedische, die russische nur erzwungenermaßen. Die Finnen haben seit ihrem Reformator Michael Agricola, der 1557 als Bischof in Åbo starb, ein eigenes Schrifttum; bekannt und auch erdkundlich bemerkenswert ist das große Volksepos Kalevala, das alte Jäger- und Fischersagen mit manchen asiatisch-schamanischen Lehren, mit germanischen und christlichen Zügen verquickt und an Traumschönheit selbst die nordische Mythe übertrifft. Der Arzt Lönnrot hat es auf jahrelangen Fahrten aus dem Munde der Fischer gesammelt. 1835 erschien es im Druck. Der große finnische Maler Axel Gallen ist der Maler dieser sagenhaften Vorwelt geworden voll Größe und Grausamkeit.
Die finnische Küste hat einen »Skjaergard« wie die norwegische, und das Schiff fährt ruhig in seinem stillen Fahrwasser, während die See sich aufgeregt an den Riffen und Granitbuckeln der Schären draußen bricht. Aber die Küste steigt nicht auf als majestätische Felswand, sie gleicht den Ufern des Mälarn. Dem Schärenkranz ist auch im Urteil der Finnländer der Preis zuerteilt worden. Baumgartner schildert diese Landschaft mit folgenden Worten: »Licht, Luft, Meer, Fels und Wald tragen zur landschaftlichen Schönheit bei. Die Bestandteile bleiben immer dieselben, und doch wird man nicht müde, diese meist vom Wald gekrönten und von dunklem Wald umfangenen Eilande anzuschauen, die wie ein schwimmender Park am Auge vorüberhuschen; jetzt ein verwitterter Felsblock, von sturmzerzausten Tannen überragt, die siegreich auf die im Sonnenlichte strahlende Meeresstraße herabschauen, – jetzt eine schattige, spiegelglatte Bucht, deren Baumstufen mit all ihren dunkelgrünen Wellenlinien sich im Wasser verdoppeln, – jetzt eine zerklüftete kahle Felsenburg, auf der nur zwerghafte Birken und niedriges Gestrüpp die einzelnen Stockwerke, Klüfte, Risse und Adern bezeichnen, – jetzt ein von der Brandung umzischtes langgestrecktes Riff, das wie der Rücken eines gewaltigen Seeungeheuers dunkel aus den Wogen emporstarrt, – jetzt ein freundliches Bauerngut mit Haus, Scheuer und Ställen, Garten und Weideland, von dunkelm Busch umsäumt und ins Meer hinaus versetzt – jetzt wieder hoher Tannenwald, von dem am Ufer nur durch die helle Meerstraße getrennt. An der Küste selbst wechseln prächtige Wälder mit bebautem Lande und öden Felswüsteneien. Buchten ziehen sich weit ins Land hinein, und von bläulicher Ferne her grüßt dann und wann eine Ortschaft mit ihrem Turme den vorüberrauschenden Dampfer. Da und dort öffnet sich wohl auch eine weitere Sicht aufs Meer, das sich nach Süden hin für das Auge unbegrenzt ausdehnt und den Eindruck einer schönen, aber doch etwas schwermütigen Natureinsamkeit verstärkt.«
Wenn auch nur 5 v. H. des Bodens Ackerland ist, Finnland also trotz Borken- und Strohbrotes und großer Genügsamkeit seiner Bauern der Getreideeinfuhr bedarf, so ist die Landwirtschaft doch die Haupterwerbsquelle des Landes: 1912 wurden über 12½ Millionen kg Butter erzeugt. Des Landes Hauptschatz aber ist der Wald: als Rohware, halb oder fertig bearbeitet, vor allem aber in der Gestalt von Papier geht es ins Ausland. Die Wasserkräfte des Seenlandes liefern den Holzschleifereien und Sägemühlen den billigen Antrieb. Dabei benutzt das Großgewerbe von den drei Millionen Pferdekräften in den Stromschnellen des Landes zur Zeit erst etwa 70 000! Um Tammerfors hat sich das Leinen-, Baumwoll- und Tuchgewerbe gesammelt.
Die neue Hauptstadt Finnlands ist Helsingfors, das durch die starke Schärenfestung Sveaborg (d. h. Schwedens Burg) gedeckt ist, das seit 1918 in Suomenlinna (d. h. Finnlands Feste) umgetauft wurde, ein Sinnbild der Selbständigkeit des neuen skandinavischen Staates. Im russischen Eroberungskriege wurde diese sehr starke Inselfestung feigherzig ausgeliefert. Damals war Helsingfors noch eine kleine Stadt. Rußland aber verlegte die Universität von Åbo hierher, führte viele Prachtbauten auf für die Verwaltung des Landes, und so entstand die durchaus modern angelegte Hauptstadt mit ihrer prächtigen lutherischen Nikolaikirche, von dem Deutschen Johann Ludwig Engel in der nachnapoleonischen Zeit entworfen, und ihrer russisch-orthodoxen Kirche, ihrem Rats- und Senatshause, ihren Anlagen und Gasthöfen. Neuerdings entwickelt sich die Stadt im freien Finnland immer mehr zu einem bedeutenden Handelshafen, nachdem Petersburgs Bedeutung so gesunken ist. Eigene bodenständige Baukunst schafft unter Lars Sonck und Elia Saarinen und gestaltet das prächtige Stadtbild.
Wer altfinnisches Leben sucht, der muß ins Innere nach Norden zu vordringen: dort wohnt noch in seiner Pörte, dem schlichten Blockhause, Schloß als Stützpunkt gegen die Seeräuber. Damals war Schonen dänisch, und Absalon gleichzeitig auch Bischof von Roskilde. Er ist der Gründer Kopenhagens – und seines geographischen und politischen Weitblicks wegen verdient er die Verehrung, die ihm Dänemark noch heute zollt. Denn hier stieß Seeland am weitesten gegen den Sund vor, und der schmale Meeresarm des Kalvebodstrand, der durch die vorgelagerte Insel Amager entsteht, bot einen günstigen und geschützten Hafen.
Das älteste Kopenhagen liegt, wie alle alten Festungsstädte, in einem Halbring von Anlagen: Parks und botanischer Gärten – bis zur Zitadelle, die als Rest der Befestigung erhalten ist. Doch zerfällt der davon eingeschlossene Stadtteil in zwei deutlich unterscheidbare Hälften: die eigentliche alte Stadt mit ihren krummen, »gewachsenen« Gassen und Gäßchen – und die einstige Sommerstadt der Könige Rosenborg mit dem Adelsviertel Amalienborg, die im 17. Jahrhundert sorgfältig rechtwinklig angelegt wurden.
Große Wasserbecken, die den Raum der einstigen Gräben einnehmen, schließen den Anlagenring nach außen von den jüngsten Stadtteilen ab.
Den Eindruck der Stadt schildert uns LichtwarkS. 67. mit den Worten:
»Kopenhagen hat etwas Märchenhaftes. Kommt es daher, weil es durch Andersen geweiht ist, oder liegt nicht auch in seiner Anlage und in seinen Bauten ein ganz phantastischer Zug?
Was für eine Märchenidee, den Turm der Börse aus den umeinander geringelten Leibern von vier Ungeheuern zu bilden, oder den Turm der Erlöserkirche mit einer außen umlaufenden Wendeltreppe zu umgeben? Wie fremdartig sondert sich die Burginsel durch den breiten Kanal ab, der sie umgibt, und wie schaurig ragen die Trümmer des gigantischen Königsschlosses auf dieser Burginsel in die Lüfte!
Auch im Hafen hat alles einen phantastischen Zug, die künstliche, befestigte Insel im Meer trägt in Erinnerung an die Zeit, wo der König von Dänemark die drei nordischen Kronen auf seinem Haupte vereinte, den Namen Dreikronen (Trekroner). Weit draußen im Sund ist eine neue Festungsinsel auf dem Mittelgrund aufgetaucht, wo sie das ganze Fahrwasser beherrscht. Dann die alten Hafenanlagen mit ihren gewaltigen alten Speichern, die vielen Meerarme wie Kanäle in der Stadt, bald Hamburg, bald Amsterdam, bald Venedig, der träumerische Park von Rosenborg, die geheimnisvolle Zitadelle – ist es ein Wunder, daß hier Märchen wachsen?«
Wie jede große Stadt Europas, hat auch Kopenhagen die Güter der Kunst und Kultur des Landes und auch des Auslandes planmäßig in Museen gesammelt. Dem größten Bildhauer des Landes, Thorwaldsen, ist auf der Schloßinsel ein Museum geweiht worden, wo seine Werke und seine Kunstsammlungen vereinigt sind, wo er selbst im Hofe unter dem grünen Efeu schlummert. In der alten Frauenkirche steht sein berühmter einladender Christus, wohl sein bekanntestes und tausendfach vervielfältigtes Werk.
»In dem Museum nordischer Altertümer besitzt Kopenhagen einen Schatz, an dem die gesamte germanische Welt Anteil nimmt. Auch dies Museum ist Geschichte und Märchen. Wer steht ohne Schauer vor den wohlerhaltenen Gewändern einer germanischen Fürstin der Urzeit, vor den riesigen Lurenhörnern aus Bronze, die die Feier des Gottesdienstes mit Tönen begleiteten, die heute noch in ihnen schlummern;Sie werden noch heute jedesmal am Johannistage (24. Juni) von zwei kunstgeübten Musikern vom Dache des Prinzenschlosses vor einer großen Menge geblasen und erregen das Staunen vor der Tonkunst der alten Nordgermanen (2000 v. Chr.). vor einem wirklichen Götterwagen, auf dem das Bildnis des Gottes oder der Göttin über Land gefahren wurde; vor den unbeschreiblichen Schätzen an Gold und Silber, zum Teil in einer technischen Vollendung und künstlerischen Schönheit, daß die sämtlichen Schmuckkünstler unserer Tage davor erröten müßten«.a. a. O. S. 82.
In dem malerischen Schlößchen Rosenborg sind die fürstlichen Schätze moderner Kultur sehr gut aufgehoben, darunter ein Königsthron aus Narwalzähnen und Silber, eines Seekönigs Hochsitz – im Schlosse Frederiksborg ist des Volkes Ruhmeshalle. Dem Edelsinn eines Bürgers, des Brauers Jacobsen, verdankt die Stadt wertvolle Ergänzungen dieser Sammlungen in der »Glyptothek«, dem archäologischen, dem Kunstgewerbemuseum usw.
Die Umgebung Kopenhagens ist großenteils Villenlandschaft: immer wieder rote Dächer und weiße Mauern im Grünen, die Sommerhäuser der Städter.
Dort liegt als Ergänzung zu dem Fürsten- und Bürgermuseum der Hauptstadt das Bauernmuseum von Lyngby, ein Freiluftmuseum ähnlich dem Stockholmer. Hier findet auch der Deutsche Heimatkunst. Aus Ostenfeld bei Husum stammt ein sogenanntes »Rauchhaus«, ein sächsisches Bauernhaus ältesten Schlages mit breiter Einfahrt auf die Diele, mit seitlichen Ställen, mit der Wohnung im Hintergrunde und dem schornsteinlosen Herde, wo das offene Feuer brannte. Aber auch dänische, nordholländische, schonische und smaländische Häuser alter Art sind in dem hügeligen Feldgelände Lyngbys vereinigt.