
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1. Böhmen und seine deutschen Randgebirge. – 2. Prag und die tschechische Mitte. – 3. In polnischen Dörfern. – 4. Ruthenische Walddörfer. – 5. In den Pußten – 6. Die Deutschen im Banat. – 7. Ein Heiligentag in Slawonien. – 8. Die Siebenbürger Sachsen einst und jetzt. – 9. Das Leben der sächsischen Bauern in Siebenbürgen. – 10. Nach Rumänien.
Zum Teil nach dem Werke: Die österreichisch-ungarische Monarchie. Bd. XIII. Böhmen ist mit einem Gebirgswall ringsum eingefaßt und tritt dadurch im Kartenbilde Europas seit alters deutlich als ein Ländereinzelwesen hervor. Der alte Geograph Sebastian Münster zeichnete Europa in seiner »Cosmographey« als eine königliche Jungfrau – und Böhmen als Kranz unter ihrer Brust. Die Wasseradern des böhmischen Kernlandes bezeichnen deutlich das Absinken des Stufenlandes gegen Leitmeritz zu: ihre gesammelte Wasserkraft durchbricht dann den Gebirgswall in nördlicher Richtung im Elblaufe. Wo die Gewässer in ihrer waldschattigen Bergheimat rasch und jugendkräftig rauschen, wo sie als Strom vereinigt breit dahin fließen und des Landes Erzeugnisse über die Grenzwälle hinaustragen können, dort hat sich der gewerb- und handeltreibende Deutsche niedergelassen; das Hügel- und Flachland im Innern erkor sich der ackerbauende Slawe zum Wohnsitz. Die eigentümliche Bodenform Böhmens bedingte also auch eine Auslese unter seinen Bewohnern.
Uralte Gneise, Glimmer- und Urtonschiefer, vermengt mit Graniten bauen die südliche größere Hälfte des Landes und die beiden Grenzgebirge auf, die von NW. und NO. her aufeinander zulaufen. An diesem uralten Kern stauten sich später die jungen Falten der Alpen ebenso auf wie am Schwarzwald-Wasgauhorste und dem des mittleren Frankreichs. Durch Senkungen entstand ein Meeresbecken, das von der Moldau bei Prag bis an den Böhmerwald und das Teplergebirge reichte und sich mit kambrisch-silurischen Schiefern, Grauwacken und Kalksteinen füllte, in denen uns Spuren der ältesten Lebewesen der Erde aufbewahrt blieben. Danach muß Böhmen lange Zeit Festland geblieben sein: dann aber wucherten in der Gegend von Schlan-Rakonitz, Pilsen, Raudnitz usw. die üppigen Sumpfwälder der Steinkohlenzeit empor, die unter den roten Sandsteinen und Tonen bis auf unsere Tage die in ihnen aufgespeicherte Sonnenkraft uralter Zeiten bewahrten. Dann wurde der Norden Böhmens vom Kreidemeer bedeckt, das gewaltige Schichten von Kalken, Plänern und Quadersandsteinen absetzte, von denen die berühmten Säulen der böhmischen Schweiz und der Adersbach-Wekelsdorfer Felsen zeugen. Danach kam es in flachen Seebecken längs des Erzgebirges zur Bildung von Braunkohlenmooren; und, während das Erzgebirge im südlichen Teile immer tiefer einsank, quollen gleichsam als Gegengewichte die Basalt- und Phonolithkuppen des sogenannten Mittelgebirges und des Duppauer Stockes empor und wurden bis zu Höhen von fast 900 m hinaufgetrieben. Seit dieser Sturm- und Drangzeit hat Böhmen keine größeren Wandlungen erfahren. Wind und Regen und fließendes Wasser übten ihre zerstörende Kleinarbeit während der Eiszeit, wo Grassteppen den Boden deckten, auf denen Mammute weideten. Dieselben Mächte arbeiten noch heute an der Gestalt des Landes, langsam und unauffällig. Der Mensch hat den Boden unter den Pflug genommen in den sanft gewellten Ebenen: über weite Fruchtfelder schweift der Blick, haftet an einem der zerstreuten baumumringten Dörfer oder Herrensitze, an einem Gehöfte oder den Schloten einer Zuckerfabrik, gleitet den glitzernden Schienenwegen entlang, die von Prag aus nach allen Richtungen das Land durchschneiden, oder folgt den buscherfüllten Flußtälern bis zu den waldblauen Kämmen der deutschen Randgebirge – das ist etwa das heutige Bild Böhmens vom Gipfel des Ladwiberges bei Prag (356 m) oder des sagenberühmten Wallfahrtsberges Řip bei Raudnitz, von dem aus Čech, der Ahnherr des tschechischen Volkes, das Land in Besitz genommen haben soll.
Auch in den Einzelzügen des wirtschaftlichen Lebens, welches sich auf diesem Boden heute abspielt, erkennt man Abhängigkeit von dem geologischen und geographischen Bau des Landes.
* * *
Der Absturz der großen, im wesentlichen aus kristallinischen Schiefern aufgebauten Scholle des Erzgebirges nach Süden und der dadurch entstandene hohe Kamm (im Keilberge 1244 m) bilden im Nordwesten den Grenzwall. Jäh stürzen sich in raschem Gefälle die Gewässer in das tiefer gelegene Vorland, hie und da zu nutzbringender, industrieller Arbeit in Talsperren gestaut. In diesen kurzen Tälern liegen malerisch eingeklemmt alte Bergstädtchen wie Graupen, Joachimstal, mit den alten Fachwerkbauten der Fundgrübner des Spätmittelalters: denn die Adern von Silber, Nickel, Kobalt, Uran, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei sind fast völlig abgebaut; die Bewohner haben sich anderen Beschäftigungen zuwenden müssen; meist bodenfremden Industrien wie Tabak-, Handschuh-, Knopffabrikation oder Spitzenklöppeln und Weißnähen u. a. m. Auch auf den Hochflächen des Kammes liegen solche alte Bergstädte, hier weitläufig um einen viereckigen Marktplatz angelegt, der heute verödet ist, wie z. B. in dem Flecken Platz. Nur wo Industrien der Bevölkerung aufhalfen, herrscht in diesen hochgelegenen Städten (Gottesgab 1028 m!) reges Leben. Vom alten Bergbau zeugen die gewaltigen Halden tauben Gesteins, alte Stollenlöcher, eingestürzte Werke, Bingen genannt. Joachimstal aber erlebt vielleicht eine neue Blüte als Bergbad; denn die alten Grubenwässer bergen die geheimnisvoll wirkenden Strahlenkräfte des Radiums, und in den staatlichen Uranerzgruben wird das neue Element zu einem großen Teil für die Wissenschaft gewonnen.
Die spärlichen Dörfer liegen traurig grau in dem Schindel- und Holzkleide ihrer verstreuten Häuser inmitten weiter Moorheiden oder grüner Hänge, die vom Vieh abgeweidet werden; der Feldbau ist spärlich und mühselig. Nur die gegen Süden in den Tälern hinabstreichenden Siedelungen bieten ein freundlicheres Bild wegen ihrer wärmeren Lage.
Der Paßverkehr über die Kammhöhe führte zur Anlage zahlreicher Burgen, deren Ruinen auf Felspfeilern des Südhanges liegen: Riesen- und Geiersburg, Hassenstein u. a. Der Wald- und Wildreichtum ließ fürstliche Jagd- und Lustschlösser auf den Waldschultern des Südgehänges erstehen, die fensterreich in die Vorebene hinausblicken: so Eisenberg, Rotenhaus u. a. Mönche legten Klöster an, am berühmtesten ist das Cistercienserstift Ossegg, das mit seinen herrlichen Gärten und Fischteichen, mit seinen gotischen und Barockbauten am Fuße des Gebirges liegt, 1199 gegründet.
Das fruchtbare Egerland ist der jüngste Teil des süderzgebirgischen Senkungsfeldes und verrät diese Natur noch durch zahlreiche Kohlensäurequellen, die im Gegensatze zu den »süßen Brunnen« Säuerlinge genannt werden. Der Kammerbühl bei der alten Reichsstadt Eger, der Eisenbühl bei Boden sind Aschenvulkane, die in sehr spätgeologischer Zeit noch tätig waren, Schlacken, Lapilli und Lava auswarfen. Mineralmoore gaben die Veranlassung zur Gründung der Bäderstadt Franzensbad als Zweig von Eger. Die reichen Bauern des Egerlandes haben zum Teil noch ihre alte Art, Sitte und Tracht bewahrt.
Die Braunkohlen des Senkungsfeldes werden in zahlreichen Schächten bei Falkenau, Brüx, Dux und Aussig abgebaut und dienen sowohl der Industrie als dem Hausbedarf bis weit ins Reich hinein. Die Vorräte sammeln sich in Aussig an und werden auf den zahlreichen Eisenbahnen und auf den Zillen verfrachtet. Tetschen, Bodenbach und Aussig sind große Elbhäfen, Umschlagsplätze des Landverkehrs in den Wasserverkehr. Denn alle Landeserzeugnisse: die Zuckerrüben und der Zucker aus den Lößgebieten des tschechischen Innern, der Hopfen aus der Gegend von Saaz wie aus dem Grün- und Rothopfenlande hinter Leitmeritz, das Obst oder die Trauben des Elbtals im Mittelgebirge fließen ebenso hier zusammen wie die Kohlen. Die Werftplätze mit den Lagern von Kieferstöcken, die die Spanten der Zillen hergeben, haben immer zu tun; denn zumeist wird nicht bloß die Fracht, sondern auch der Kahn im Deutschen Reiche verkauft, wenn er seine erste Talfahrt beendet hat. Als Lastkahn fährt er dann noch lange Zeit auf der Havel und Spree und ihren Kanälen.
Zur Zeit der Baumblüte ist das Elbtal von Aussig bis hinauf nach Lobositz ein wundervoller Frühlingsgarten. Die Nachtigallen schlagen noch in den engen Seitentälern mit ihren Quellen und Büschen – und die vulkanischen, sanft geschwungenen Bergdome und ihre steilen Abstürze zur Elbe erinnerten Ludwig Richter an die Schönheiten des Albanergebirges. Rechts der Elbe sind bei Steinschönau Berg und Tal mit Häusern und Hütten bedeckt – hier wohnt eine zahlreiche Industriebevölkerung, die großenteils in den Glashütten ihr Brot findet, die aber auch in den Häusern Glas schleift und zum Antrieb die hübschen kleinen Wiesenwässer benutzt, auch die »Rumburger Leinewand« zu Kragen näht. Die Webindustrie erreicht in der Warnsdorfer, Reichenberger Gegend ihren Höhepunkt bis nach Trautenau; am Südabhange des Jeschken-, Iser- und Riesengebirges überhaupt: sie ist emporgewachsen aus dem Flachsbau dieser Gegenden.
* * *
Das Böhmerwaldgebirge besteht aus mehreren gleichgerichtet streichenden Kämmen – waldblaue Gebirgsfalten und -buckel –, zum Teil mit urwaldartigen Beständen wie am Kubany, mit Wiesen- und Weidewirtschaft, mit Mooren, aus denen schwarze Flüsse hervorquellen, mit tief versenkten Seen und steilen Felsklippen aus Granit, mit Blockhäusern und steinbeschwerten Schindeldächern. Darin wohnt der Waldbauer auf seinem Eigen, oft einsam und sich selbst genug, sein eigner Schmied, Zimmermann, Köhler, Fuhrmann usw. Jetzt ist schon die Holzindustrie in die waldreichen Täler vorgedrungen: Holzstoffabriken nutzen Wälder und Wasserkraft aus – Holzschnitzerei, Wagnerei, Faßbinderei gesellen sich dazu und werden in gewerblichen Schulen gelehrt – und mit der Korbflechterei, der Spitzenklöppelei, Handschuhnäherei hat man auch schon Versuche gemacht, so daß auch dieses Waldgebirge zu einem Industriegebirge zu werden verspricht, wie das Erzgebirge z. B. Glashütten hat der Böhmerwald schon lange; denn überall gibt es reiche Quarzgänge.
Der südliche Landrücken bildet die Wasserscheide zum Donaugebiete, besonders zum Marchsystem; er ist auf weite Strecken hin sehr niedrig, am niedrigsten vor den Sudeten (185 m), wo die Hauptstraßen nach Mähren und Wien hinführen.
Während man in den hochkultivierten Ländern oft lange und vergebens sucht, um einmal etwas Eigenartiges, Naturwüchsiges, von der alles zersetzenden »Aufklärung« noch nicht Aufgelöstes anzuschauen, braucht man in Böhmen nur zuzugreifen, um altertümliche Gebräuche, merkwürdige Sagen, lebendige Volkspoesie bei Tschechen und Deutschen kennenzulernen. Aus dem reichen Schatze sei hier nur ein Beispiel mitgeteilt.
Im Taborer Kreise liegt ein Berg Blanik, aus dem rieselt eine Quelle hervor mit grünlichem Wasser und weißem Schaume. In alten Zeiten, wo ein sehr mächtiger Feind das Tschechenvolk bedrängte und endlich unterjochte, hatten sich aus der letzten unglücklichen Schlacht noch einige Tausend Eingeborene gerettet und, vom Feinde hart verfolgt, im Innern jenes sonderbaren Berges, der sich plötzlich der Reiterschar geöffnet, Schutz und Zuflucht gefunden. Daselbst schlafen sie nun schon viele hundert Jahre samt ihren Pferden, sterben aber nicht, sondern werden wieder hervorkommen, wenn die Zeit erfüllt ist und Böhmen wieder in der größten Bedrängnis sein wird; dann aber werden sie siegen. Zuweilen heben sie die Köpfe empor und fragen, ob es nicht Zeit sei? Dann spitzen die Pferde die Ohren, aber alsbald fällt auch alles wieder in Schlaf. Wer an dem rechten Tage und zur rechten Stunde an den Blanik kommt, dem ist der Anblick der Reiter verstattet.
Am St. Gregoriustage (dem 12. März) halten die Knaben aus der Umgegend noch alle Jahre einen kriegerischen Umzug um den Blanik, indem sie die Sage dramatisch darstellen. Ein Anführer wird gewählt, der läßt Halt machen und fragt, ob es noch nicht Zeit sei? Ein anderer ist der Sendbote, der wird fortgeschickt, um zu erkunden, wie es auf der Oberwelt stehe, und der erzählt darauf, was er weiß, bis der Anführer spricht: »Noch ist es nicht Zeit!« und das kleine Heer sich auflöst.
Wen überrascht nicht die auffallende Ähnlichkeit dieser Sage mit der von unserem Friedrich Rotbart in dem Kyffhäuser? Das dichtende Volksgemüt offenbart sich unter allen Nationen nach denselben Gesetzen, und solche Gesetze sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern bilden sich mit innerer Notwendigkeit aus dem natürlichen Leben des Landes, wie des Volkes und seiner Geschichte.
Der deutsche Wäldler aber pflegt seine alten Bräuche, mit besonderer Neigung stellt er die heilige Geschichte plastisch in Holz – oder noch besser dramatisch in der Kirche oder auf besonderen Volksbühnen dar: Wer hätte nicht schon von den Höritzer Passionsspielen gehört? Und aus altheidnischer Zeit stammt die Sitte des »Sunawendfeuers« auf allen Höhen der Randgebirge. Da werden alte Wagenräder mit Stroh umwunden und mit Pech bestrichen, auf Stangen aufgesteckt und angezündet, während Buben ihre brennenden Besen schwingen und durch das große Bergfeuer springen. Schüsse krachen, Gelächter schallt, und all der Lärm bietet das Volk in den Tälern auf. So wahrt auch der Deutsche seine »völkische« Art.

A. W. Grube, Skizzen böhmischer Kulturbilder. Einen überraschenden und alle Erwartungen übertreffenden Eindruck machte auf mich Böhmens Hauptstadt. Mit Prag möchten sich von den deutschen Städten wenige an Schönheit und Eigentümlichkeit der Lage messen können. Wenn man von dem Rücken des Weißen Berges her in das hochgelegene Burgviertel der Stadt, den Hradschin, vorschreitet auf den Vorsprung, der jäh zum Moldautale abfällt, und dann von dieser Bergstadt herab auf einmal tief unter sich eine noch viel größere Flußstadt erblickt, ein Meer von Häusern und Palästen, aus dessen Wogen eine zahllose Menge von Kirchen, Türmen und Kuppeln wie Schiffe mit ihren Masten hervorragen: so ist das fast ein morgenländisches Bild, großartig und prächtig. Zu den Füßen schlängelt sich die breite, stattliche Moldau, welche tief in die Hochfläche sich hineingegraben und malerische Hügelreihen an den Ufern gebildet hat. Dort erhebt sich der schroffe Ziskaberg, auf welchem die Hussiten 1420 ihren ersten Sieg erfochten, und weit im Hintergrunde der feste Wyschehrad, malerisch das Gemälde begrenzend. Wendet man sich um, so hat man die Ansicht des großen königlichen Schlosses, das die kaiserliche Hofburg zu Wien noch an Größe übertrifft; daneben den prächtigen erzbischöflichen Palast, rechts aber die ehrwürdige gotische Kathedrale, den Dom von St. Veit mit seinem himmelanstrebenden Turme. Auf der entgegengesetzten Seite das reiche Prämonstratenserstift Strahow mit seiner schönen Kirche, und dahinter auf einem mit Wein- und Obstgärten begrenzten Hügel die freundliche Laurentii-Kapelle mit ihren zwei zierlichen Türmen; – eine Mannigfaltigkeit der An- und Aussicht, wie sie dem Auge selten zuteil wird. Steigt man sodann hinunter zwischen den hohen Häusern, die, auf schroffem Abhange erbaut, wie Festungswerke erscheinen, und stellt sich auf die 540 m lange und 17 m breite altertümliche steinerne Brücke, welche die Altstadt mit der Kleinseite verbindet, zwischen die 28 Heiligen und Apostel, die, aus Stein gehauen, auf den Brückenrändern Wache halten, in der Mitte bis vor kurzem das bronzene Standbild des heiligen Nepomuk, Schutzpatrons von Böhmen – so hat man wieder einen Anblick, wie man ihn weder auf der Dresdner, noch sonst einer Brücke finden kann: die Ansicht des Hradschin. Gegenüber der steinernen hängt eine zweite Brücke, kühn über dem breiten Moldauspiegel schwebend, und zu den alten Bauwerken den Gegensatz der Neuzeit bildend; es ist die eiserne Kettenbrücke, ein Denkmal der Baukunst unserer Tage. Neben ihr, in den Strom gelagert, lacht freundlich das baumbekränzte Eiland der Sophieninsel herüber, und weit hinter ihr, in blauer Ferne verschwimmend, erscheinen wieder die schroffen Ufer der Moldau. Man bekommt auf der alten Karlsbrücke zugleich den Eindruck altchristlicher Göttersage, mittelalterlicher Romantik und moderner Kunst. Überall ragt in die Stadt das Land, in die Gegenwart die Vergangenheit, in das weltliche das kirchliche, in das Kultur- das Naturleben hinein, und das macht eben Prag so merkwürdig, so eigentümlich. Es läßt sich kein vollerer Gegensatz denken, als zwischen einer Stadt wie Berlin und einer Stadt wie Prag. Berlin in einer durchaus flachen, einförmigen Sandebene an der unscheinbaren Spree; – Prag in einem wechselreichen Hügellande, zum Teil selbst auf Bergeshöhen erbaut, an den malerischen Ufern der Moldau; um Berlin die Natur des norddeutschen Tieflandes mit Kiefernheide und Erlenmoor – um Prag schon süddeutsche Natur, Wein- und Obstgärten; die Straßen von Berlin alle breit, regelmäßig und geradlinig – in Alt-Prag kaum zwei breite, gerade Straßen, alle anderen krumm und eckig; in Berlin fast alle Häuser modern, freundlich, aber einförmig und nüchtern – in Prag schauen aus dem modernen Leben noch viele rußige Häuser hervor, unregelmäßig, oft seltsam, mit gewölbten Vorbauten und Laubengängen, die Paläste aus ältester Zeit, jeder mit seiner Geschichte ein Zeuge grauer Vergangenheit: kein Haus dem anderen gleich, ein bunter Wechsel; – in Berlin alles fein, abgeschliffen, äußerst zierlich, vornehm – in Prag viel Schmutz, ein ganzes Judenviertel, überall böhmische Bauern, Juden und Pöbel, an allen Ecken und Enden Fleisch- und Semmelbuden, Hökerweiber und dampfende »Würstel«, viel mehr Volkstümliches. In Berlin sind Kirchen und Glocken eine Seltenheit, in Prag ist beides im Überfluß; Berlin die Residenz der Friedriche und Philosophen, Prag die Residenz der Erzbischöfe und einer reich verzweigten Kloster- und Weltgeistlichkeit. Mit dem für den Protestantismus in Österreich so verhängnisvollen Dreißigjährigen Kriege, der dem protestantischen Adel Böhmens Gut und Leben kostete, kamen die Jesuiten wieder zur Herrschaft. Um das Andenken an den tschechischen Volksmann und Märtyrer Johann Huß, wenn nicht ganz auszurotten, doch unschädlich zu machen, erfanden sie die Geschichte vom Martyrium des heiligen Nepomuk, der sich weigerte, das Beichtgeheimnis der Königin an König Wenzel zu verraten und deshalb in die Moldau geworfen wurde. Gleichzeitige Geschichtschreiber und Chronisten wissen von dieser Beichtgeheimnisangelegenheit nichts; wohl aber mag es seine Richtigkeit haben, daß am 21. März 1393 ein Geistlicher auf Befehl König Wenzels in die Moldau geworfen wurde. Die Jesuiten verstanden es aber, aus dem Generalvikar Johann Pomuk, der es mit dem Erzbischof von Prag gegen den König hielt, einen später vom Papst heilig gesprochenen Märtyrer zu bilden, der dann mit fünf Sternen auf dem Haupt und einem Kreuz im Arme auf die Moldaubrücke als Nationalheiliger gestellt wurde und allmählich auch in den Nachbarländern als Brückengott prangte. Im Veitsdome hat der Heilige ein prachtvolles Denkmal aus gediegenem Silber erhalten. Der 16. Mai ist sein Ehrentag, an welchem zahllose Scharen der Gläubigen in Prag zusammenströmen, und sogar im Liede ist der »Nepomuk auf der Prager Bruck« volkstümlich geworden.
Das Leben in dieser alten Stadt steht im Zeichen des Kampfes der beiden Volksstämme Böhmens: der Deutschen, die den Vorteil altererbter Kultur einer großen Volksgemeinschaft auf ihrer Seite haben, und der Tschechen, ihrer Schüler, die das rührigste Glied der Slawenfamilie sind und den Vorteil des jugendlichen Emporstrebens und des Ehrgeizes, eine führende Stellung zu gewinnen, im Angriff auf ihre Lehrmeister ausnutzen. Seit jeher haben sich die beiden Volksstämme feindlich gegenübergestanden, bald in verhaltenem Hasse, bald in zischendem Kampfe. Der tschechische Volksteil schien endlich zu unterliegen; und siehe da! er lebte besonders seit 1867 wieder auf mit neuer, frischer Kraft. Daß die Deutschen in Böhmen, obwohl die geringere Zahl, dennoch lange die Stärkeren geblieben sind, kann nicht wundernehmen, da sie die große westeuropäisch-germanische Kultur zur sicheren Grundlage hatten. Daß aber die tschechischen Slawen, von ihrer Rasse abgerissen, ohne feste völkische und geistige Einheit mit einem größeren Ganzen doch ihr eigentliches Wesen bewahrt haben: dies beweist, daß sie von einem urkräftigen, derben Grundstoffe sind. In Dichtung und Wissenschaft stehen die Tschechen jetzt an der Spitze der ganzen slawischen Rasse; sie haben die europäische Kultur aufgenommen, ohne die Eigentümlichkeit daranzugeben, und haben durch den Weltkrieg auch ihre politischen Ziele erreicht.
Der Tscheche hat weder die kindliche Heiterkeit des Russen, noch die leichtfertige Lebenslust und das ritterliche Wesen der Polen: er ist trüber, verschlossener, weniger beweglich; bei ihm verschmilzt leicht die sittliche Leichtfertigkeit des Slawen und die gemessene Nachdenklichkeit des Deutschen zu einer gewissen Arglist, welche das Vertrauen des Deutschen zu ihm niederdrückt und sein Vertrauen zu dem Deutschen hindert. Ein Erbfehler des tschechischen Stammes ist ferner Rechthaberei und Zanksucht; auch legt man nicht mit Unrecht dem Volke Unbeständigkeit und Vergnügungssucht, geringe Besonnenheit im Unglück und Übermut im Glücke, wie auch große Rachsucht bei; die Geschichte liefert manches Lebensbild zu diesen Zügen. Die Deutschen in Böhmen zeichnen sich dagegen wieder durch größere Berufstreue und Ordnungsliebe, sowie durch größere Reinlichkeit aus.
Der Schulbesuch war von jeher am günstigsten in den deutschen Kreisen, der Einfluß, den die Bestrebungen der deutsch-feindlichen Tschechen in neuester Zeit auf die Schulen Böhmens geäußert haben, ist kein günstiger. Früher lebten Deutsche und Tschechen in Frieden nebeneinander; die deutschen Eltern ließen ihre Kinder tschechisch lernen, und die Tschechen brachten ihre Kinder in deutsche Familien. Vor dem Weltkriege lag die Sache so, daß die Heißsporne unter den Tschechen die Aufrichtung des Königreichs Böhmen, die Krönung des Kaisers mit der Wenzelskrone als ihr nächstes Ziel betrachteten, an dessen Erreichung sich die ausschließliche Herrschaft des Tschechischen in Sprache, Beamtentum usw. anzureihen haben würde. Zwar rührte sich auch in den Deutschböhmen das von dem wärmsten Mitgefühl das deutschen Mutterlandes begleitete Streben nach Erhaltung ihres Volkstums in kraftvoller Weise; doch haben sie nicht zu hindern vermocht, daß das alte deutsche Prag, in welchem in den fünfziger Jahren 75 000 Deutsche neben 50 000 Tschechen wohnten, zum goldnen slawischen Praha geworden ist. Das Verhältnis der Tschechen zu den Deutschen ist heute 5:1 in der Stadt; das Mittelschulwesen ist vollständig vertschecht. Das Deutsche hat als Amts- und Staatssprache seine Bedeutung verloren, man verlangte von jedem Beamten, selbst in rein deutschen Bezirken, die Kenntnis beider Landessprachen, wodurch der Deutsche, der die tschechische Weltsprache sich nicht zu eigen gemacht, von den meisten öffentlichen Ämtern ausgeschlossen wird. Die alte Landeshochschule wurde zunächst in eine tschechische und deutsche zerschlagen. An der Sprachgrenze ist zu dem völkischen Gegensatze noch der des Glaubens getreten; denn die Losung: Los von Rom! wurde von den Deutschen ausgegeben, weil sich das Tschechentum auf den katholischen Klerus stützen konnte.
Obwohl hin und wieder eine Vermischung zwischen deutschem und slawischem Blut eingetreten ist, so hat sich doch die ganze von Tschechen bewohnte Mitte Böhmens in ihrer Eigentümlichkeit erhalten. Sie sind im Gegensatz zu den deutschen Langschädeln meist Rundköpfe. Auch die meist dunklere Farbe des Haares, sowie die unter schärferem Winkel geschnittene, nach unten breitere Nase und der breitere Mund unterscheiden das tschechische Antlitz merklich von dem deutschen.
Die Hauptstadt des Deutschtums ist seither mehr und mehr Reichenberg am Jeschken geworden; schon war der Zwiespalt soweit gediehen, daß eine Teilung Böhmens in ein Tschechovien mit Prag und ein Deutschböhmen mit Reichenberg als Hauptstadt vorgeschlagen wurde. Da führten die Folgen des Weltkrieges den tschechoslovakischen Freistaat herauf, in dem das deutsche Volkstum einen schweren Kampf ums Dasein führen muß.
Nach Reclus: Nouv. Géogr. Univers. T. V. Paris 1881. Grenzboten II. Ausland 1883, Nr. 35-37, und J. J. Kraszewski. 1863 hörten die Polen auf, eine Nation im politischen Sinne zu sein. Hinsichtlich ihrer idealen Güter: ihrer Sprache und Religion waren sie in Deutschland und Galizien am besten daran; in Rußland verfuhr man auch hierin sehr gründlich und verbot sogar in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Aufführung polnischer Dichtungen auf den Theatern.
Der Pole ist von Natur durch Einbildungskraft und Feuer, Anmut und Höflichkeit ausgezeichnet, es gesellen sich aber leichtfertige Genußsucht und Überhebung hinzu, die in dem Willen die Stetigkeit und Gründlichkeit, das Pflichtgefühl unterdrücken. Deshalb hat alles politische Heldentum bisher so wenig Früchte getragen. Das Polenvolk leidet an einer gesellschaftlichen Zweiteilung: der Herr, der Edelmann, achtet den Knecht, den Bauern, gering. In Augenblicken der Gefahr fehlt es an der Einigkeit. Diese Kluft zwischen den Ständen der Edelleute und der Kleinbauern hat sich überall der Jude zunutze gemacht, nicht um zu überbrücken, sondern von hüben und drüben Vorteil zu ziehen durch Schacher und Wucher.
Wenn wir uns einem polnischen Dorfe nähern, sehen wir in der weiten Ebene große Getreidefelder und Kartoffelbreiten. Doch vermissen wir die Sorgfalt der Bestellung. Noch liegen hie und da Felsblöcke auf dem Acker, es ragen auch hie und da Baumstümpfe daraus hervor, Inseln von Schlehengebüsch, wilden Apfel- und Birnbäumen liegen darin – und der Pflug ist zu mäanderartigen Windungen genötigt, weil er diese Hindernisse umgehen muß. Bis 1864 bestand zum Beispiel in Russisch-Polen noch die Leibeigenschaft – die Folgen der Fronarbeit sind die Nachlässigkeit und Schlaffheit der Bevölkerung, die den Fron los ist und dem Wucherer verfällt. Doch zeigen sich überall Ansätze zu kräftiger Selbsthilfe und wirtschaftlichem Aufschwung.
Die Nahrung der Kleinbauern besteht in Schwarzbrot, Grütze, Kartoffeln, Obst – Eier, Butter und Fleisch sind selten auf ihrem Tisch. Denn obwohl in dem wald- und morastreichen Lande die Schweinezucht ziemlich hoch steht, kommt der Bauer doch selten zum Hausschlachten: er macht lieber zu Geld, was er an Vieh entbehren kann, wozu ihm durch die hereinziehenden deutschen und jüdischen Händler jede Woche günstige Gelegenheit geboten ist. Der Branntwein und der Kwaß müssen die Fleischkost ersetzen. Kwaß ist ein in jeder Bauernstube vorhandenes Getränk, das im wesentlichen aus Wasser und Schwarzbrot besteht und durch Holzäpfel oder -birnen zur Gärung gebracht ist.
Die Wiesen ums Dorf sind nicht entwässert: schilfbestandene Lachen und saure Rietgräser überall. Die Rinder, die darauf weiden, sehen auch nicht voll und glatt aus, und ihre Euter sind klein. Die Pferde sind klein und struppig, aber von außerordentlicher Leistungsfähigkeit; die Schafe liefern eine geringwertige Wolle zur Kleidung der Bauern.
Der Wald gehört dem Edelmann. Nach der Ostsee und nach dem Schwarzen Meere trugen die Flüsse zahlreiche Flöße, wenn ihm das Gold ausging. Der Bauer schnitzt sich fast alle Geräte aus Holz; die Häuser werden im Winter nur mit Holz geheizt. Waldbrände sind nichts Seltenes, und die Aufforstungen sind spärlich. So werden breite Flächen verwüstet.
Das Dorf gleicht einem Haufen alter grauer Strohfeimen. Die Blockhäuser mit Moos in den Glinsen stehen dicht beisammen. Die Gärtchen sind deshalb klein, aber voll von hochragenden Malven, Sonnenrosen und rotem Mohn. Eine roh gezimmerte Schranke oder ein niedriger Steinwall friedigt die Gehöfte ein.
Das Wohnhaus hat drei Räume zu ebener Erde: in der Mitte die Wohnstube, auf der einen Seite den Kuh- oder Schafstall, auf der anderen die Futterkammer, die zugleich die Hausflur und der Holzstall ist. Der Dachboden ist Speicher. In der Nähe des Wohnhauses stehen, aus unbehauenen Fichtenstämmen geschichtet, Scheune und Schweinestall.
Die Wohnstube enthält den mächtigen Ofen, der zugleich für Kinder und Gesinde die beliebteste Schlafstätte ist, einen Tisch und eine Wandbank, ein rohgezimmertes Bett, eine an der Decke aufgehängte Korbwiege – und ein mehr oder weniger künstlerisches Muttergottesbild, darunter das ewige Lämpchen. Das einzige Fenster ist nicht zu öffnen und erhellt die Stube nur wenig.
Der schnurrbärtige Bauer trägt einen langen weißwollenen Kittel, hohe Stiefel, in denen die strohumwundenen Füße stecken, eine große Schafpelzmütze und grobe Leinwandhosen. Die ärmliche Frau, deren Augen größere geistige Regsamkeit verraten als die ihres Gemahls, begnügt sich mit einem Linnenhemd, einem weißen Rocke und einer Doppelschürze für Leib und Rücken, deren Bänder sich auf der Brust kreuzen und auf dem Rücken gebunden werden.
Nur in wenigen Dörfern fällt die Kirche als hervorragender Bau auf. Sie ist meist auch nur eine große Bretterbude, vor der das Glockengerüst steht. Doch ist sie für das Landvolk wichtig, weil von hier aus dem Munde des Geistlichen oft die einzige geistige Anregung kommt. Denn Schulen in unserem Sinne fehlen noch vielfach in den Dörfern. Der Russe stellt vielfach neben das römische Bethaus eine weißgetünchte Kuppelkirche; denn das griechische Bekenntnis sollte eingeführt werden. Besser und nötiger wäre das Geld für Landschulen angewendet gewesen.
Neben der Kirche fällt das »Amt«, der Herrschaftshof auf – oft ein prächtiger Bau inmitten von Parkanlagen abseits vom Dorfe. Italienische Pappeln bezeichnen die Einfahrt. Die Aufhebung der Leibeigenschaft hat den Edelhof auch aus seiner früheren Bedeutung fürs Gemeindeleben herausgerückt, so daß der Edelmann nicht bloß in der Erinnerung an die Zeit schwelgen kann, wo er auf Landtagen unter Prügeleien Könige machte, sondern auch auf die Zeit als eine vergangene sehnsüchtig zurückblicken darf, wo der Bauer fünfzig Schritt vor ihm oder besser seiner Fuchtel die Mütze lüftete und den Rücken bis zur Erde krümmte, wo die Bäuerin beim Gruß seine Knie umfaßte und küßte, wo die Kinder der Bauern seine Knechte und Mägde waren, wo Braut und Bräutigam seine Einwilligung zur Eheschließung und seine Gnade zur Verleihung einer Bauernwirtschaft brauchten, wo der veredelte Obstbaum nur im Garten des gnädigen Herrn zu finden sein durfte, wo man dem fleißigen Bauern, der in seiner Wirtschaft etwas vor sich brachte, entweder das Ersparte einfach wegnahm oder ihm das Feld verkürzte, wo der Leibeigene genötigt war, den Ertrag einer glücklichen Viehzucht im Walde den Augen des gestrengen Herrn zu entziehen, wo der Erlös aus dem heimlich zum Wochenmarkte gebrachten Vieh vor der räuberischen Hand des Herrn nicht sicher war, wo man mit der Knute die schwer und ehrlich verdienten Groschen dem Bauer abhenkerte.
Die veränderte Stellung prägt sich auch in den Herrschaftssitzen aus: Eine überdachte Holzveranda dient zum Empfang der Gäste. In weitläufig gebautem Viereck liegen die baufälligen Ställe und Scheunen. Der Edelmann ist selten daheim, meist vergnügt er sich in den großen Städten, besonders zur Winterzeit.
Das Wohnhaus, der sogenannte »Palast«, ist in der Regel nur eine vergrößerte Ausgabe des Bauernhauses; höchstens der Kalkanstrich würde ein Vorzug sein. Die innere Einrichtung berücksichtigt das nach polnischen Begriffen Standesgemäße, indem ihr eine Küche und ein sogenannter Speisesaal nicht fehlen. Diese Räume, sowie die Zimmer des Herrn und der gnädigen Frau sind gedielt; zuweilen zeigen die Wände Kalkbewurf, während Muster und Tapeten selten zu finden sind. Gardinen und Bilder fehlen sehr oft; die Möbel sind meist die rohen Werke axtgeübter Bauern und mit schwarzer Ölfarbe angestrichen. Schreibtische, Kommoden, Spiegel und Sofa vermißt man häufig; Stühle, Tische, plumpe Schränke, einige große Holzkasten, welche den Dienst eines Kleiderspindes verrichten, bilden den unentbehrlichen Hausrat. Die Kammern fehlen dem Palast meistens; man schläft in den Stuben, während man den Gästen auf einer Streu im Speisesaale ihr Lager anweist. Die Anlage des Edelhofes ist ungemein weitläufig, vielleicht verursacht durch die berechtigte Furcht vor Brandstiftung. In der Nähe des Palastes befinden sich die Schweineställe, die man wohl mehr in ihrer dauerhaften Bauart, als ihrer Insassen wegen, deren Fleisch man verschmäht, gewürdigt hat, in der Nähe des Palastes zu stehen. Die Schweinezucht ist der am schwunghaftesten betriebene Teil der Landwirtschaft auf dem Edelhofe. Alle übrigen Wirtschaftsgebäude, wie der Fruchtspeicher, die Branntweinbrennerei machen den Eindruck der Ärmlichkeit und Vernachlässigung. Der Edelmann ist ein Freund des Sports; besonderer Beliebtheit haben sich die Fuchshetzen zu erfreuen: es fehlt darum selten auf dem Hofe ein Fuchsstall.
Die Kirche fehlt oft, der Edelhof ist heruntergekommen, aber der »Krug« fehlt nie – er ist das Herz der Landgemeinde. Hier versammelt sich der Gemeinderat, hier werden alle Hochzeiten gefeiert, hier vertrinkt man seinen Kummer, hier zankt und schlägt und einigt man sich. Der Jude ist der Krugwirt. Er hat eine zahlreiche Familie – und Ziegen, Gänse, Hühner. Ein weißer Schornstein überragt das verfallene Dach. Die größeren Fenster mit Läden, die Türen mit eisernen Klinken unterscheiden äußerlich den Krug vom Bauernhause.
In der Schankstube steht das große jüdische Bett, der Schenktisch und der Schenkschrank; der große Ofen, ein Eimer mit Wasser zur freien Verfügung für den armen Wanderer. Ein nicht zu bezeichnender Geruch, viel Schmutz, viel Lärm dazu! In der Nachbarstube hängt eine geschlachtete Ziege oder ein Hammel, darunter liegt ein Haufen Kartoffeln, in der Ecke sieht man die zehn Gebote, dazu wieder das hochgetürmte Bett, Tisch und Bank. Hier ist die Luft noch dicker, die Menschen sind noch zahlreicher und sitzen gedrängt zusammen – trinken und reißen Witze, und lustig klingt das Volkslied vom toten Matthias durch den schwülen Dunst:
Matthias ist gestorben und steht nicht wieder auf:
Gott sei der Seele gnädig! Verzeih ihm seine Sünde!
Tüchtig war Matthias und leerte manches Glas.
Der Schenkwirt läuft von dannen, dieweil er nicht mehr zecht.
Laßt uns Beileid leisten, Brüder in der Schenke.
Flaschenhälse brechen, weil er ist gestorben,
Aber sucht in seinen Taschen, ob er Kleingeld hinterließ,
Um zu zahlen unsre Zeche . .
Nach Anton Schmitt, Dresdner Anz. 1902, Nr. 255.
Nach Franz v. Löher. Vgl. auch Anton Schmitt, Dresdner Anzeiger 1902, Nr. 255. In den Karpaten, am Fuße der Stry-Gipfel, zog schon unsere Gesellschaft dahin, eine lange schwarze Linie auf grüner Alpenweide, und wir eilten hinab. Stundenlang ging es jetzt auf offenen Gebirgsrücken hin, von denen zu beiden Seiten die Waldtäler abfielen, und eine prachtvolle Fernsicht nach der anderen tat sich auf. Dennoch machte sich nach und nach die große Einförmigkeit des Gebirges geltend. Die Bergzüge sind fast ganz gleich gebildet, fast ganz gleich belaubt und begrast. Die Buche allein herrscht in diesen unabsehbaren Waldungen; nur stellenweise bieten Eichen, Ahorn, Eschen und Birken einige Abwechslung. Unsere Wegkundigen hatten einen Rückweg vorgeschlagen, der weniger steil und beschwerlich war als unser Anstieg in der Nacht. Dafür zog er aber pfadlos durch Wälder ohne Ende, und es konnte nicht fehlen, daß wir uns verirrten. Wer nicht tagtäglich in diesem Gebirge lebt, den muß die ungemeine Ähnlichkeit der Berghänge und Talwindungen täuschen. Es fiel mir auch die große Armut an Gevögel auf. Kein Drosselflöten, kein lustiger Finkenschlag schallte durch den öden Wald; das Hacken der Spechte, das Gepiep der kleinen Meisen war das einzige, was den langen Tag sich hören ließ. Meine Bemerkung wurde von den Landeskundigen bestätigt; diese Wälder sind sanglos, diese Lüfte werden nur von Falken und Adlern durchschifft. Die Ursachen solchen Mangels habe ich nicht ergründen können. Der Auerhahn aber kommt vor; die Ruthenen nennen ihn den wilden Pfau, und die Madjaren den tauben Hahn; beides ist bezeichnend.
Wenn wir abstiegen, um eine Weile zu gehen, so sprangen die Pferdchen frei und ungeleitet gleichwie Katzen um uns her. Lagerten wir, so umstanden sie uns und streckten ihre Köpfe mit dem warmen Atem dazwischen. Niemals machte eines den Versuch, zu entlaufen. Öfter aber wandte ich die Blicke wieder auf unsere ruthenischen Begleiter. Sie hatten etwas bärenhaft Plumpes in ihrem Wesen, und doch für das, was sie verstanden, erschienen sie ungemein flink. Niemals legten sie den groben ledernen Schnappsack, die Torba, niemals, trotz der Hitze, den langzottigen Umhang, die Schuba, ab. Sie redeten wenig untereinander; ihre Gesichtszüge behielten den stumpfen und verschlossenen Ausdruck. Dagegen standen sie, obwohl nur gemeine Hirten, wie die besten Hoflakaien stets auf der Lauer, um mit unterwürfiger Geschicklichkeit herbeizuspringen, wo einem von uns etwas am Sattel fehlte, oder das Pferd einer Dame Leitung nötig hatte. Wiederholt betrachtete ich verstohlen den sonderbaren Ausdruck ihrer Blicke, welchen sie mit den Russen teilen. Man hat diese Augen mit gefrorenem Wasser verglichen, und Fallmerayer meinte, der Name Sarmat komme von Sauromat her, was im Griechischen Leute mit Eidechsaugen bezeichnen sollte. In der Tat behält das Auge der Ruthenen fortwährend etwas Mattes, Unklares, Unbewegliches, selbst wenn man sie fragt oder heftiger anredet. Man weiß nicht, was sich darin spiegelt, bis plötzlich ein heller stechender Blick hervorschießt, der sich gleich wieder verhüllt. Bei den Russen ist diese stechende, fliegende Helligkeit des Blickes noch schärfer. An Chinesen aus dem niederen Volke habe ich Ähnliches bemerkt und möchte wohl wissen, ob dieses russische Auge noch ein kleiner Rest mongolischer Verwandtschaft ist.
In den unteren Waldungen stießen wir auf Dörfer. Sie halten sich gleichsam im tiefen Walde verborgen. Früher muß das Gebirge noch mehr besiedelt gewesen sein. Jüngerer Baumschlag und Reste von regelmäßigen Furchen deuten auf verlassene Ackerfelder. Hört in dieser üppigen Waldung Pflug und Hacke zu arbeiten auf, gleich schießt Gestrüpp auf, aus welchem sich alsbald die Bäume emporheben. Bei Mongolen- und Türkennot oder in den vielen fürchterlichen Bürgerkriegen, die das Land zerfleischten und verheerten, flüchteten auch Madjaren aus der Ebene in die Berge, und wahrscheinlich trieb sie die Hungersnot in die Ebene zurück. Die ganze ungarische Geschichte ist gar oft eine Notgeschichte gewesen.
In den ruthenischen Walddörfern bleibt der Hunger täglicher Gast. Es ist unglaublich, mit welch geringer und elender Kost die armen Leute ihr Leben fristen, besonders in der langen, strengen Fastenzeit. Trockener Haferkuchen und Haferbrei bilden den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr die Hauptnahrung, das Fleisch dazu Kraut, Rüben, Bohnen mit ein wenig Leinöl. Glücklich wird die Familie gepriesen, die ein Schwein kaufen und ernähren kann; allein Schinken und Wurst bleiben ihr unbekannte Dinge – das Schwein wird verkauft, um bares Geld für Steuern, Salz, Schnürsohlen und Kleidung zu gewinnen. Die paar Stücke schwächlichen Rindviehs, die man in den Dörfern antrifft, gehören gar häufig dem Juden oder einem anderen Gläubiger. Das liebste, was der Ruthene tut, ist das Weiden eigener Schafe: Käse und Wolle davon muß er zwar verkaufen, aber er behält doch wenigstens die Schafmolke. Weil der arme Mensch aber weder Winterfutter noch Ställe hat, so muß er im Spätherbst seine Schafe verkaufen und in jedem Frühling in Hast und Not etwas Geld zusammenraffen, um wieder ein paar Stücke von den galizischen Händlern zu erwerben. Äcker und Gärten sind schlecht bestellt, das Ackergerät ist elend, und die Lust zur Arbeit verfliegt in wenigen Stunden.
Man brauchte im Vorüberreiten nur einen Blick in Hof und Garten zu werfen, um die ärmliche Wirtschaft sogleich zu erkennen. Die Ruthenen leben in Not und Schulden von einem Jahr ins andere. Der beste Teil ihres Verdienstes geht beständig in Zinsen auf, welche sie den jüdischen Unterhändlern entrichten. In Hukliva, einem Dörfchen an der Munkács-Stryer Eisenbahn, wohnten 84 Menschen, darunter 41 Juden, und die Gegend ist unfruchtbar. »Aber wie könnt ihr denn alle hier leben?« wurde ein Jude gefragt. »Schauens, gnädiger Herr,« war die lachende Antwort, »wir sind 41 Juden und 43 Christen; wir 41 leben von die 43.« Wahrscheinlich wären ohne den Verstand und Fleiß der Juden die übrigen noch übler daran; sie hätten noch weniger Bedürfnisse und würden noch weniger arbeiten. Der geistige Führer der armen Ruthenen ist der griechisch-katholische Klerus, der sich mehr und mehr regt und die Kinder seines Volkes und seiner Kirche dem Juden wie dem polnischen Schlachzizen gegenüber vertritt.
Durch alle Verhältnisse des einstigen Kronlandes Galizien geht eine Zweiteilung. Es zerfällt gewässerkundlich in zwei Teile; von seinem Flachlande weist der südliche Teil zur Ostsee, der östliche größtenteils zum Schwarzen Meere hin; zwei Hauptstädte hat das Land, und es ist auch völkerkundlich in zwei scharf gesonderte Teile geschieden. Westgalizien ist das Land der Polen, Ostgalizien das Land der Ruthenen, gehört völkisch zur Ukraine. Die Polen sind die Eroberer, die Ruthenen sind die Unterworfenen. Die Polen sind römisch-katholisch, die Ruthenen sind griechisch-katholisch. Das Polentum ist im Vordringen nach Osten zu begriffen, es hat bereits Siedelungen in dem ruthenischen Ostgalizien gebildet und stellt einen großen Teil der städtischen Bevölkerung in diesem Teile des Landes. Die Polen bilden jetzt die Mehrheit der Bevölkerung. Im Gebirge reichen die Ruthenen weiter nach Westen hin; es ist, als ob sie in den Bergen ihre Volksart zäher zu bewahren vermöchten. Im hohen Gebirge reicht das Ruthenentum 100 km, in den niedrigeren Vorbergen noch immer 30 km weiter nach Westen, als in der Ebene. Und es ist auch der Ruthene in den Bergen ein anderer, als der Ruthene in der Niederung. In den Bergen wohnt der Bojko, ein vorzüglicher Viehhirt, der es an Arbeitsamkeit nicht fehlen läßt und der auch das ungünstigste Grundstück auszunützen weiß. In den Bergen wohnen auch die Huzulen, schöne Menschen, die Frauen sogar oft von ganz ungewöhnlicher Schönheit. Sie haben ein südländisches Aussehen, sind von hoher und schlanker Gestalt, gebräunt und schwarzhaarig, und die Adlernase und die tiefen, schwarzen Augen geben dem Huzulen einen feinen Zug. So die Berg-Ruthenen, kräftige, frische, arbeitsame Menschen. Aber die Ruthenen in der Niederung haben einen wesentlich anderen Charakter.
Sie sind ein langsames und schwerblütiges Volk, dessen stärkste Züge die Geduld, die Schlaffheit, der Hang zum Alten und Überlieferten bilden. Auf dürftigem Boden schleppen sie ihr Leben ohne Klage hin, und eben ihre Bedürfnislosigkeit ist einer der tiefsten Gründe, weshalb Galiziens Bodenkultur sich nicht weiter entwickeln kann. Wenn man ihre Dörfer von weitem sieht, wie die stattlichen hölzernen Gebäude mit hohen Schindeldächern, Wirtschaft an Wirtschaft zusammendrängt, sich die Täler entlang ziehen, so ist der erste Eindruck oft recht freundlich; aber sobald man das Dorf näher in Augenschein nimmt, erfährt man die herbste Enttäuschung. Es herrscht die größte Dürftigkeit, die Nahrung ist mangelhaft, die Bewohner sind langsam und schwerfällig. Und es gibt genug ruthenische Dörfer, deren Elend gleich beim ersten Blicke aus allen Fenstern spricht, Dörfer, die sich gleichsam an die Erde zu ducken scheinen, als ob sie vor dem Leben, vor dem Dasein selbst sich fürchteten.
Malerisch aber sind die ruthenischen Walddörfer, wie sie sich da bergen in Tieftal und Laubfülle. Der homerische Schmutz – auf Bildern riecht er nicht. Die Häuser klettern die Abhänge auf und ab, und die beste Straße schien jedesmal das Bett des Waldbaches zu sein, den man reichlich mit Steinen durchlegt hatte. Da es Sonntag war, so war viel junges und altes Volk von den Bergen niedergestiegen. Wo wir herritten, fuhr in jedem Haus ein Dutzend Köpfe in die Tür- und Fensteröffnungen, jedes Gesicht umrahmt von starkem struppigem Haarwuchs, junge Mädchen mit farbig ausgenähten Miedern, Blumen im Haar, Frauen in schmutziggelben Mützen.
Es ist noch nicht lange her, daß dies unterdrückte Volk sich wieder auf sich selbst zu besinnen anfing. Seit jenem furchtbaren Ausbruche der Volksleidenschaften, der im Jahre 1846 sich Luft machte, beginnt das allmähliche Aufwachen des Ruthenentums. Es wurden volkstümliche ruthenische Vereine gebildet, wie zum Beispiel die Rußkaja Rada; es wurden Lehrstühle für ruthenisches Schrifttum begründet, ruthenische Zeitungen ins Leben gerufen. Eine rührige und begabte ruthenische Oberschicht entstand; eine gebildete und geschickte Klasse von ruthenischen Beamten, Schriftstellern, Geistlichen. Auch in dem jungruthenischen Schrifttum, das seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, findet der Haß gegen das Polentum leidenschaftlichen Ausdruck. Der größte der ruthenischen Dichter ist Taras Szewczenko, der noch als Leibeigener geboren wurde und in seinen Kindes- und Jünglingsjahren dasselbe körperliche und geistige Elend durchzumachen hatte, wie alle seine Landsleute. Aus seinen Gedichten, wie zum Beispiel »Tarasnacht« und »Die Haidamaken«, spricht ein blinder Haß gegen den polnischen Adel, und gerade mit diesen Tönen hat Szewczenko die ruthenische Volksseele getroffen; im Jahre 1861 wurde ihm am Dnjeprufer unter völkisch-ruthenischen Kundgebungen ein Grabhügel aufgeschüttet.
Mit allen Mitteln bekämpft das mächtige Polentum die Wiedergeburt des ruthenischen Volkes: es fehlt vor allem an Schulen; hoffentlich gelingt es den Besten des ruthenischen Volkes, seinen ärmsten Brüdern die Segnungen westeuropäischer Kultur trotz des polnischen Widerstandes zu bringen und das Volk der russischen Erschlaffung zu entreißen, die nur in wilden Wutausbrüchen aufsteht, um matter denn zuvor niederzusinken.
Nach eigner Anschauung und nach Franz Woenigs: Hej, die Pußta! Leipzig, Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 3633. Wenn man von Ofenpest gen Osten fährt durch die große Tiefebene Niederungarns, die, über 100 000 qkm groß, sich zwischen Donau und Karpatenkranz ausbreitet und durchflossen ist von der Theiß, so sucht das Auge vergeblich jene großen Weideflächen, wo nach Hörensagen der sonngebräunte Csikos seine Pferde tummelt, wo der Gulyas seine Rinder, der Juháß seine Schafe, sein Borstenvieh der Kanáß zum langarmigen Hebelbrunnen treibt, wo die Délibáb, die Fata Morgana der Steppe, ihr neckisches Spiel in der hitzezitternden Luft treibt, wo in der Csarda, der Schenke, oder vor der Tánya, dem Landhause, der Zigeuner geigt. Das war einmal! Heute trägt diese Tiefebene ganz und gar den Charakter der Kultursteppe. Große Landgüter liegen hier, man nennt sie Pußten. Ihre Grenzmark wird durch den einzigen Baum, der hier gedeiht, durch die Robinia pseudacacia bezeichnet. Hinter diesen dornigen Heckenzäunen, die sich meilenweit über Land hinziehen, liegen riesige, unabsehbare Rapsfelder in leuchtend gelben Breiten; wo sie abgeerntet sind, wird von Mägden Kukuruz, Mais, gepflanzt. Zwischen den langen Ackerbeeten mit ihrer schwarzen Erde wuchern auf breiten Rainen Zeilen von Melonen, Samenhanf, auch Sonnenrosen, aus deren Kernöl man eine feine Seife herstellt. Weite Kleefelder haben im Juli die zweite »Fechsung« schon hinter sich. Öder Flugsandboden ist mit amerikanischen Reben besteckt worden. Wo sie das nötige Alter erreicht haben, hängen sie voller schwerer Trauben. Tabakstauden mit tropisch-üppiger Blattentfaltung und Weizenähren decken die schwarze Erde; die gelbe Erde oder der Löß ist wie zum Beispiel bei Mende, der Pußta des Herzogs von Koburg, meilenweit mit Kartoffeln bestellt. Um die Landhäuser oder Tányen stehen Obstbäume; Aprikosen und Pflaumen beugen in schwerer Fülle die Äste über die Stützen nieder. Unbenutzter Boden ist sehr selten geworden: doch liegt hie und da ein Stück weißlich angehauchter Salpeterboden brach, oder auf großen Schotterflächen wuchern leuchtende Nachtnelken (Oenothera biennis). Heidelerchen schwirren empor, Schwalben umschwärmen die Dörfer, allerhand Raubvögel kreisen beutesuchend über den Feldern, Scharen von Krähen und Elstern sitzen auf den frisch gestürzten Äckern. Auf dem Schilfdache einer Tánya nistet ein Storch, ein Zeichen, daß wir uns der Theiß nähern und ihren Ufersümpfen, in denen unzählige Frösche abends ihren Gesang anstimmen, in denen unzählige Wasservögel ungestört ihr Jagdleben führen.
Die Flächen, die früher als Weideland zahlloser breitgestirnter, großgehörnter, grauweißer ungarischer Rinder oder halbwilder Pferde dienten, sind heutzutage durch den Ackerbau sehr eingeengt worden. Der Pußtenbesitzer hält schon des öfteren nur Schweizervieh, statt der einheimischen Fleischrasse eine Milchrasse. Damit ist die Hirten- und Räuberromantik der »Pußta« auf wenige beschränkte Bezirke eingeengt worden, sie ist aber noch lebendig. Wer sie kennen lernen will, muß nach der weitläufigen Pußtenhauptstadt Debreczin fahren und von dort hinaus wandern in die Hortobagysteppe.
Dort findet er ein Leben ähnlich dem der südrussischen Steppe. Dort kann er noch in der einsamen Heideschenke einkehren, der Csarda, die mit ihren weißgetünchten Wänden schon von weitem aus der schier endlosen Ebene herüberschimmert, deren Brunnenschwengel sich unaufhörlich auf und nieder senken. Sie liegt am Hortobagyflüßchen, wo im Röhricht die Schilfsänger flöten, breit und weitläufig gebaut. Hinter dem Hause stehen Ställe und Wagenschuppen. Dem Garten fehlt der Zaun, er verliert sich in den Kartoffel- und Krautäckern, den Mais- und Weizenfeldern. Dort wuchern Kürbisse und Melonen, dort ranken Feuerbohnen, dort wachsen Zwiebeln, Knoblauch, Paprika (Capsicum annuum), Erdbirnen (Helianthus tuberosus), deren Knollen roh gegessen werden – und viele Blumen: Rosen und brennende Liebe, Gladiolen, tiefviolette Anemonen, Gartenmalven, Frühlingsadonis in bunter Wildnis durcheinander.
Im Innern hinter den dicken Mauern ist es wohltuend kühl. In der von hundert bunt bemalten Tellern behangenen Küche befindet sich seitwärts vom Ofenloche der ganz niedere Herd. In der Mitte sitzt das Gesinde des Wirts zur einfachen Mahlzeit auf ebener Erde nach altmadjarischer Sitte und verzehrt mit hölzernem Löffel seine Lieblingsspeisen. Die geräumige Gaststube ist ungedielt, der mächtige Ofen dient innerlich zum Brotbacken und äußerlich während des Winters als Lagerstätte. Man heizt ihn auch zum Brotbacken gewöhnlich nur mit Schilf, wozu jedoch eine eigene Geschicklichkeit gehört.
An den Wänden der Stube hängen Bilder von Heiligen, berüchtigten Räubern und von Ereignissen aus deren Leben bunt durcheinander. Auf langen Bänken sitzen um den großen Tisch herum Bauern mit der unentbehrlichen kurzen Tonpfeife, der Kiš pipa, im Munde; sie plaudern über die Preise des Korns, Arbeitslöhne, Pferdekäufe, Räuber- und Diebesgeschichten, Schatzgräbereien, Gespenstergeschichten. Es gesellen sich Csikosen und andere Hirten zu ihnen, die in der Csarda vorsprechen, um sich einen guten Tag zu machen. Dem jungen roten Landweine, der in hochhalsigen Flaschen auf dem Tische steht, wird tapfer zugesprochen. Das Gespräch erhitzt sich, Bauern und Hirten geraten aneinander, Knüttel und Fokosen sausen durch die Luft und machen blutige Köpfe, bis etwa der entschlossene Wirt mit seiner Flinte mitten in den Knäuel hineinspringt und mit Donnerstimme ein »Halt« gebietet!
Im Keller liegen große Stückfässer. Im Herrenstübel ist der Boden gedielt, der beste Hausrat aufgestellt; die Fenster sind mit Jalousien beschattet. Im Schenkzimmer sitzen am Ecktische bescheiden die Zigeuner, die Musikanten. Der Primas wiegt sich im Rhythmus eines »Csardas«, den er auf seiner Geige dirigiert; die Hämmer des harfenartigen Zymbals springen, Flöte und Klarinette mischen sich drein, Cello und Baß fundieren diese Musik. Da wechselt blitzschnell pp und ff, süßestes schmelzendes Andante und wildestes überschäumendes Presto, bis sich plötzlich des Primas Geigentöne über ein leises Gemurmel und Gewoge der anderen Instrumente erheben und mit einem straffen schrillen Strich und Stoß und Schlag die Musik verstummt. Draußen aber vor der Csarda unter der Vorhalle schläft des Nachts, in seine Bunda, den Schafpelz, gewickelt, der Hirtenjunge, und die Wagen stehen stumm im Mondenschein. Diese Csarden sind die Oasen der Steppe.
Die Hortobagy-Pußta ist so groß, daß jeden Sommer dort gegen 4000 Pferde und 20 000 Rinder Weide finden, daß gegen 270 Hirten aller Art dort beschäftigt sind.
Wo weißlich schimmernde, scharf begrenzte Salzwassertümpel und Salzlachen den harten ausgetrockneten, rissigen Boden durchsetzen, über den sich allerhand Salzpflanzen in dichten Polstern ziehen, wie der Meerstrands-Dreizack (Triglochin maritima), der Meerstrandswegerich (Plantago maritima) oder das Salzkraut (Salsola Kali), dort wühlt sich gerne die krausborstige Schweineherde ein. Stillvergnügt steht der Kanáß daneben mit seinem durchlöcherten Schlapphute und seinem weißen, aus Kotzentuch verfertigten Mantel, der innen mit rotem Tuch gefüttert ist. Früher hielten die Kanáßen viel auf ihre schwarzen Haarzöpfe an den Schläfen, die täglich mit Schweinsfett gesalbt wurden, auf die Balta, ihr kurzstieliges Beil, das sie mit großer Geschicklichkeit zu werfen verstanden, auf ihre Standesrechte und -sitten. Am zahlreichsten ist ihre Sippe immer noch im Bakonierwalde, wo die Schweine in den Eichwäldern das beste Mastfutter finden.
Auf einigen Sanddünen, wo Brennesseln, Wolfsmilch und mannshohe Kugeldisteln dürftig ihr Dasein fristen, liegen die Anwesen einiger Schafhirten, der Juháßen (juh = das Schaf), niedrige armselige Rohrhütten, Rohrpferche für die Tiere daneben. Vor jeder Hütte ein Holzpfahl mit Pflöcken, auf denen bunte und rote Krüge und Töpfe trocknen. Halbnackte braune Kinder wälzen sich im Sande, draußen weiden die Herden: langsam vorwärts schreitend, dicht aneinander gedrängt, die Köpfe geneigt, erscheinen sie wie ein großes bewegliches Vließ. Voran schreitet der Leit- und Reitesel des Juháß und trägt die zottige Bunda, die zugleich Mantel, Matratze und Deckbett ist, den Vorratssack, den Kochkessel. Auf seinen Stock gelehnt, schaut der Juháß der Herde zu, raucht seine Kiš pipa, strickt Strümpfe oder schnitzt Löffel, derweil die langhaarigen, weißen Schäferhunde, die große Ähnlichkeit mit den sibirischen Hunden zeigen, treulich die Herde umkreisen.
Mitten im hohen Grase weidet weit verstreut eine tausendköpfige Herde weißer langhörniger Rinder. Der Gulyás, der Rinderhirt, mit seinen Hirtenjungen ist eine große, mittelstarke Erscheinung; man traut seinen schwarzbraunen Armen, die aus den flatternden weißen Hemdärmeln hervorstechen, wohl zu, daß sie den Kopf des wütendsten Stieres in den Sand zwingen. Mit ihren 6 m langen Peitschen treiben die braunen Burschen ihre Tiere gegen den weithin sichtbaren Hebelbrunnen. Dann arbeiten Gulyásen und Bojtáren, ihre Knechte, an dem knarrenden Brunnengestänge, daß das Wasser in die langen hölzernen Tränkrinnen aus ausgehöhlten Stämmen fließt und die durstigen Tiere labt. Dabei fallen die mannshohen Schwarzdornknüppel mit harten Schlägen auf die kantigen Rücken und zwischen die leierförmigen Hörner der allzu rücksichtslos vordrängenden Rinder.
Mit dem Gulyásen teilt der Csikós, der Roßhirt, die besten Weideplätze, dieselben Wasserstellen. Er ist auch ein wetterharter Gesell von sehnigem Körperbau, der mit seinen Pferden auf der Steppe aufwächst. Da steht er im dicken schweren Lodenmantel, auf dessen Seitenteile und weite Ärmel sein Liebchen blaue und rote Tulpen als Zierat aufnähte, den rundkrempigen niedrigen Hut tief in die Stirn gedrückt und läßt sich seine halbwilden Pferde vorbeitreiben. In der Hand hält er verborgen die 24 m lange Hanfleine, den Lasso, um ihn plötzlich einem der schnaubenden Renner um den Hals zu werfen. Der Mantel fällt, die Schlinge zieht sich zu, das Tier stürzt, nachdem es sich wütend im Kreise um den am Boden liegenden Fänger gedreht hat. Nun nähert sich der Csikós, nimmt das Tier zwischen die gespreizten Schenkel, lockert die Halsschlinge, faßt die Mähne, es hebt sich, schüttelt sich, um die ungewohnte Last abzuwerfen, und rast davon, die kläffenden Wolfshunde hinterdrein. Jetzt wirft es sich auf die Erde, aber in dem Augenblick, wo es sich bückt, zieht der Reiter seine Beine empor, bleibt dabei immer im Gleichgewicht, und wenn das Pferd wieder aufspringt, trägt es den Mann nach wie vor auf seinem Rücken. Nun schießt es wie ein Pfeil vorwärts, es will der unerträglichen Last entfliehen und bietet seine letzten Kräfte auf, um zu entkommen. Das hat der Csikós eben erwartet. Er schaut nach der Sonne, merkt sich die Richtung, in welcher sein Renner die nackte Steppe durcheilt, und läßt ihn laufen. Ist das Pferd erschöpft, so fällt es nieder; dann legt ihm der Reiter das Gebiß ein, läßt es sich wieder erholen und führt es zahm und geduldig zurück.
Im Frühlinge gleichen auch diese Steppen einem Paradiese. Da erwachen all die Wurzelstöcke, Knollen und Zwiebeln im Boden und senden ihre prächtigen Blumen empor. Anemonen und Iris, Orchideen und Gladiolen und viele andere drängen sich zwischen die aufschießenden Gräser. Unter diesen stehen die Pollinia Gryllus, der Goldbart, das haarförmige Pfriemengras (Stipa capillata) und das Reihergras (Stipa pennata) obenan. Das Reihergras ist der Liebling der Steppenkinder: seine ¾ m langen Halme tragen feingefiederte Haargrannen, Reiherfedern nicht unähnlich, der Roßhirt trägt einen Busch an seinem Hütchen. Waisenmädchenhaar (Arvaleány-haja) nennen es die ungarischen Volkslieder.
Im Juni schon bräunt sich der Grasteppich der Steppe vor der Hitze. Der Boden wird hart und zeigt tiefe Risse. Doch einige Pflanzen bieten auch solcher Unbill Trotz: Trespen, Rispengräser, Liesch- und Bartgräser, Wolfsmilcharten, Sandwegerich, Hornklee und Schafgarbe, Kletten und Disteln harren aus. Dichte Heuschreckenschwärme schwirren daraus auf, um bald wieder in das starre Halmenmeer einzufallen. Dann tanzt und flimmert die Délibáb, die Fata Morgana, über der Steppe, im trügerischen Luftspiegel verschwimmen Brunnen, Tányen, Bäume, Hirten, Herden. Der Steppenadler kreist über dem Luftsee und stürzt herab, um an einem verendeten Zackelschafe im Dorngebüsche sein Mahl zu halten. Dann brechen auch oft die furchtbaren Gewitter los mit ihren Sandstürmen, vor denen Herden und Hirten in den Windfängen, Wänden aus dicken eichenen Bohlen in Form einer Windrose mitten in der Steppe errichtet, Schutz suchen.
Quelle: Adam Müller-Guttenbrunn, Mitteilungen des deutschen Schulvereins. Wien 1886. Unter dem Banat versteht man eine halbinselartige Fläche, welche von den Flüssen Marosch im Norden, Theiß im Westen, Donau im Süden begrenzt und im Osten durch die transsilvanischen Alpen von Siebenbürgen getrennt wird. Es wohnen heute etwa 400 000 Deutsche hier, welche zwar in der Hauptsache aus süddeutschen Stämmen, jedoch auch aus allen deutschen Völkerschaften Österreichs zusammengesetzt sind und vorwiegend die schwäbische Mundart – wenn auch in den verschiedensten Abstufungen – reden. Daher rührt wohl die Bezeichnung »Schwaben« als Gesamtname für sie. Vor der deutschen Einwanderung saßen in jenen Gegenden längst Walachen, die sich gern als die Ureinwohner betrachten und gebärden, ferner die Parias des 19. Jahrhunderts, die Zigeuner, weiter die auf ungarisches Gebiet geflüchteten Serben, »Raizen« genannt, endlich auch Bulgaren und sporenklirrende, schnurrbärtige Madjaren. Um 1550 ergriffen die Türken Besitz von jenem Lande, um erst 1716 dem Schwerte des edlen Ritters Prinz Eugen zu weichen.
Sofort wurde nun die Besiedelung des versumpften Banats in Angriff genommen, und diese Kulturaufgabe bemühten sich die verschiedensten Völker zu lösen. Deutsche aller Stämme, Griechen, Franzosen aus dem Elsaß, Italiener, Spanier und spanische Juden strömten herzu, um aus dem Sumpfland des Banats anbaufähigen Boden zu schaffen. Ein General Mercy leitete das Werk der Besiedelung; doch die Einfälle der Janitscharen und die in ihrem Gefolge auftretende Pest zwangen ihn, das zur Hälfte gediehene Werk abzubrechen. Er fand als Oberbefehlshaber der italienischen Armee den Heldentod, während die Siedler entweder dem schwarzen Tod zum Opfer fielen oder von der Scholle vertrieben wurden. Das saure Werk der Urbarmachung mußte von neuem in Angriff genommen werden. Als man nun genau feststellte, welches Volk sich in der Arbeit wie in der Not am meisten ausgezeichnet, mußte man den Deutschen den ersten Rang einräumen, daher der Beschluß, von nun an nur deutschen Zuwanderern, die zähe Arbeitskraft mit festem Mannesmut vereinigten, die Ansiedelung fernerhin zu gestatten. Besonders in den Jahren 1764-73 kam deutscher Nachschub aus dem Mutterlande, und unter den letzten Orten, welche damals gegründet wurden, befindet sich auch die elsässische Niederlassung Csatad, aus welcher nach einigen Jahren (1802) der Dichter Nikolaus Niembsch, gen. Lenau hervorgehen sollte.
Bei Anlage dieser deutschen Kolonien befolgte man am Hofe Maria Theresias einen bestimmten Grundsatz; man hatte schon damals Furcht vor der Geltendmachung des völkischen Bewußtseins eines einzelnen Volksstammes und machte daher aus dem Banat gewissermaßen ein Kleinbild der vielsprachigen Monarchie, indem man die deutschen Niederlassungen hierhin und dorthin verlegte, jeden Zusammenhang zu hindern suchte und sie mit den Gründungen anderer Völker durchsetzte. Nur durch das gewaltige Wachsen der Volkszahl und des Grundbesitzes gelang es den abgesonderten deutschen Gemeinden, eine gewisse Fühlung untereinander zu gewinnen. Gab es im Jahre 1780 nur 30 rein germanischen Ortschaften im Banat, so ist ihre Zahl gegenwärtig auf 100 angewachsen; in 30 Orten sind sie in der Überzahl und in mehr als 70 in der Minderzahl, doch mit bedeutendem Einfluß. Leider bilden sie auch heute noch keine völkische Einheit, daher der ungeheuere Aufwand von Kraft im Kampfe um die Erhaltung ihres Volkstums.
Die Schwaben des Banats sind noch heutigentags wie zur Zeit der Einwanderung Ackerbauern; ihre Söhne müssen sie, wenn sie eine höhere Bildung suchen, Schulen anvertrauen, die nichts weniger als deutsch-völkisch sind, sondern die sich bemühen, jene Söhne der Mutter Germania und ihrem Volkstum zu entfremden, ja es ihnen verächtlich zu machen. Die Madjaren des Banats wie der ungarischen Tiefebene fassen ihre Verachtung gegen den zähen deutschen Landmann in den Ausdruck »Schwob« zusammen, der leider die in die Stadt versetzten Söhne des ehrwürdigen Geschlechts zu leicht veranlaßt, ihre Zugehörigkeit dazu zu verleugnen. Der deutsche Bauer, der nur seinen sittlichen, wirtschaftlichen und völkischen Wert in die Wagschale zu werfen braucht, um jene Spötter bei weitem aufzuwiegen, ballt voll Ingrimm die Faust über solche Verachtung, und vor Gericht oder wo er sonst in feierlichem Ernst Rede zu stehen hat, gibt er jenen Spott voll zurück, indem er beteuert: »M'r san deutsche Leut«, oder: »M'r san ka Walacha nit.« Was liegt nicht alles in diesem kurzen Satze! Nichts anderes, als daß er der Begründer der Landwirtschaft, des Bergbaues, der Gewerbe und Kunstanstalten jener Gegend ist; denn er kam zugleich mit einem tüchtigen Handwerkerstand aus Deutschland, er brachte seine eigenen Lehrer und Priester mit, und von dem ersten Tage an waren ihre anderssprachigen Nachbarn ihre Schüler und Knechte, wie sie es heute noch sind.
Die deutschen Bauern haben nicht selten durch ihren Fleiß den Grundbesitz ganzer walachischer Dörfer käuflich erworben oder erpachtet, doch zäh haften sie an der Scholle und fahren lieber meilenweit nach den Feldern, als daß sie in das Dorf der Walachen, die meist zu Tagelöhnern herabgesunken sind, ziehen sollten. Und diese Liebe zur Scholle, wo ihre Wiege stand, ist erklärlich; denn sie ist mit manchem Schweißtropfen gedüngt, ehe sie aus dem Sumpflande zu jenem Garten wurde, der Mais, Weizen, Tabak in Fülle gibt, der Akazien und Maulbeerbäume über die friedlichen Wohnungen aufragen läßt, der auch die feurige Rebe reift. Es kann wohl der Fall eintreten, daß ganze Familien nach einem walachischen Dorfe übersiedeln, aber einzelne junge Burschen oder Mädchen aus der Dorfgemeinschaft zu reißen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja sogar wer aus einem deutschen Dorfe in ein anderes übersiedelt, wird beklagt wie ein Verlorener. Welche Gewalt das deutsche Volksleben im Banat auf den einzelnen ausübt, das merkte man besonders an denen, welche die Wehrpflicht einige Jahre aus der Heimat in das Treiben der Großstadt versetzte. Als sogenannte »Herrische« kehrten sie zurück; doch ihre großstädtische Sprache, ihre modische Kleidung, die vornehmen Gewohnheiten und Sitten, sie waren in kurzer Zeit unrettbar verloren, und der Herrische fühlte sich selbst erst wieder recht wohl, wenn der äußere Firnis fremden Wesens wieder weggewischt war; denn jetzt erst war er wieder vollgültiges Glied der Gemeinde.
Ein deutsches Dorf im Banat mit seinen Häusern und Scheunen aus gebrannten Backsteinen, den Dächern von festen Wellenziegeln, den blendend weiß getünchten Wohnhäusern, die in langer Reihe ihre Giebel nach der Straße kehren, den blanken Fensterscheiben, den sauberen Vorhängen, den schattenspendenden Akazien und Maulbeerbäumen, bildet einen schreienden Gegensatz zu den walachischen und madjarischen Dörfern, wo man die Grundmauern der Hütten aus Lehm, die Dächer aus Stroh und die Giebel aus Weidengeflecht herstellt. Der geräumige Hof der deutschen Bauernhöfe wird auf der einen Seite durch die Längsseite des Wohnhauses, im Hintergrund durch die Scheunen, auf der dritten Seite durch die Stallungen begrenzt. Der Garten ist aufs sorgfältigste gepflegt, und zahlreiche summende Bienen zeigen deutlich, daß der Bauer auch im Blumengarten das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Ja, wer an einem Sonntag nachmittags durch die Hauptstraße eines solchen 4-5000 Einwohner zählenden deutschen Dorfes geht, der fühlt sich innerlich gehoben, weil er bemerkt, daß deutsches Leben und deutsche Art sich nie verleugnen. Die Fahrstraße, wie die an den Häuserreihen hinlaufenden Fußwege sind reinlich gekehrt, die Schwäbinnen sitzen im Sonntagsschmuck kichernd und schwatzend unter schattigen Bäumen, und kein Vorübergehender kommt ungeneckt vorbei. Nur wer außer dem Gruße noch etwas Launiges zu sagen weiß, mag ungezaust von dannen kommen. Jeden Sonntag tagt die Versammlung vor einem anderen Hause, daher auch die Bezeichnung die »Reih'«. Manchmal tönt aus der heiteren Gruppe auch Gesang, doch nicht in schwäbischer Mundart, sondern in hochdeutscher Schriftsprache erklingen die Lieder: »In einem kühlen Grunde«, »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten«, »Zu Straßburg auf der Schanz« usw., die auch in der Spinnstube und bei der Feldarbeit zu hören sind. Eigene poetische Blüten hat die Sprache der Banater Deutschen nicht aufzuweisen, dazu ist sie mundartlich zu zersplittert; wird doch sogar die schwäbische Mundart in so und so viel verschiedenen Färbungen gesprochen, und zwei Nachbardörfer machen hinsichtlich ihrer Sprache und Tracht oft den Eindruck, als ob sie 50 Meilen voneinander entfernt lägen.
Ist auch das Leben der Banater Schwaben nicht frei von dunklen Seiten, so überwiegen doch die Lichtseiten ganz entschieden; besonders sind Gastfreundlichkeit und stark ausgeprägter Gemeinsinn hierzu zu rechnen. Dieser zeigt sich in einer Weise, die geradezu Staunen erweckt: Will sich ein Dorfgenosse ein Haus bauen, so ist seine einzige Sorge der Ankauf der Baustoffe und die Bezahlung der Maurer; für die Herbeischaffung von Holz und Steinen, und sollte es sich auch um meilenweite Entfernungen handeln, sorgen die Nachbarn mit Pferd und Wagen; sie stellen ihm auch während der Bauzeit gern Hilfskräfte, ohne daß er nur einen Deut an Tagelohn zu zahlen hätte. Das ist gute, alte Siedlersitte.
Freilich sind die Banater Deutschen bei der Riesenarbeit, aus ihrer versumpften und verseuchten Halbinsel die Kornkammer der Monarchie zu machen, noch wenig zur Pflege höherer Güter gekommen. Ihre Dorfschulbildung ist eng begrenzt, und das Bewußtsein völkischer Zusammengehörigkeit untereinander und mit dem großen deutschen Volke fehlt ihnen oft ganz. Gibt es doch unter ihnen nur sehr wenige, welche die Zahl der Landsleute im Banat kennen, noch weit weniger aber solche, welche die letzten 100 Jahre deutscher Geschichte von der Auswanderung der Ansiedler bis zur Gegenwart überblicken. Sonst würde jedenfalls in dem Ausdruck: »M'r san deutsche Leut'« noch eine ganz andere Bedeutung liegen. Erst in neuer Zeit ist durch Einführung von Zeitungen und durch Zusammenschluß in Vereinen eine Besserung angebahnt, und auch der Weltkrieg, in dem reichsdeutsche Heere ins Land kamen, in dem aber das Banat unter rumänische und südslawische Herrschaft geriet, hat sein Teil dazu beigetragen, den deutschen Sinn auch in dieser Insel unseres Volkstums zu bilden.
Von Roda Roda in der Beilage der Leipziger Neuesten Nachrichten, 11. Mai 1908 (wenig gekürzt). Südlich der Drau breitet sich eine weite, weite Ebene aus, gerade wie der Tisch. Vor Jahren war's ein schier undurchdringlicher Urwald von Eichenriesen. Kaiser Josef II. ließ eine Heerstraße durchziehen und beiderseits der Straße Streifen von zwanzig Klaftern Breite roden, um den Strauchrittern das Handwerk zu legen. Heute sind die Eichen mit Stiel und Stumpf verschwunden. Es war ein großes Stück Arbeit, dieser Raubbau, und trug ein großes Stück Geld ein. Armselige 22 000 slawonische Joch, ein winziges Winkelchen der Erde, kaufte 1870 ein Wiener Bankier für ein Butterbrot und schlug in drei Jahren für sieben Millionen Gulden Eichen heraus. Bruderherz, war das ein Leben in Slawonien! So herrlich wird's nie wiederkommen. Da fuhren die Förster in Viererzügen, und die Oberförster hatten ihre eigenen Zigeunerbanden. Da reisten deutsche Schauspielergesellschaften im Land umher und fanden ihre Gönner. Jetzt ist alles, alles anders. Wo die Hirsche röhrten, schleppen verschmachtende Ochsen ihren Pflug, und wo im Moos die Quellen sprangen, zittert die glühende Luft über den Weizenstoppeln. Unermeßliche Tafeln, die vor Hitze dursten, knietiefer Staub auf den Wegen, und nirgends Schatten, als in den grüngekränzten Dörfern und schmucken Pußten. (So nennt man hierzuland die Meierhöfe.) Das ist die Drauebene.
Aus ihr steigt dann plötzlich das Papukgebirge mit seinen Buchen hinan, Buchen, die zu ästig sind, um Gnade vor den Augen der Holzhändler zu finden. Orahowitza, »Nußdorf«, ein Längenort von fünf Kilometern Ausdehnung, ergießt sich wie ein schmaler Lavastrom vom Berg weit in die Ebene. Es ist ein bescheidenes Städtchen, hieß im Mittelalter »Raholtza«. Mit seinem oberen Ende reicht es bis hart an die Mauern der Rujitza, einer mächtigen Ruine. Efeu und Mythen ranken um ihre Quadern. Die Tempelherren sollen die schöne Serbin Rujitza (»Röschen«) lebendig unter dem Grundstein eingemauert haben. Die Türken kamen, eroberten die schöne Burg und bauten sie noch schöner aus. Eine Stunde Weges weiter südlich, an der Römischen Straße, steht die Alte Burg, eine Römerfeste vielleicht; und an der Spitze eines gleichseitigen Dreieckes über der Römischen Straße als Grundlinie liegt, tief verborgen im Waldkessel, das byzantinische Kloster Dusluk. Dahin habe ich Sie führen wollen.
Rings ums Kloster auf den Kuppen stehen verträumte Schäferjungen und blicken ins Tal hernieder, wo innerhalb und außerhalb der Klostermauern die bunte Menge der Wallfahrer wimmelt, wo die Glocken klingen, die Händler schreien, die Bauern feilschen, wo man singt und spielt und lärmt. Denn heut ist St. Elias, der Tag des Klosterheiligen.
Schon gestern nachmittag sind zu Pferd, zu Fuß und Wagen auf romantischen Waldpfaden die griechisch-orientalischen Bauern aus Gebirg und Ebene herangezogen. Die ganze Nacht über gingen die Karawanen, und heute morgen wurden es wahre Heersäulen. Die kleine Basilika mit ihrer schmutzigen Vorhalle kann nicht ein Hundertteil der Beter fassen. Wie eine Schwarmtraube aus dem Bienenstock hängt noch ein Klumpen frommer Menschen außen an der Kirchentür. Drinnen aber liest an der Bilderwand vor dem Altar der Abt die Messe. Ein schöner Greis mit wallendem, grauem Bart und wohl verdient um den Glauben, sonst hätte ihn der Bischof nicht mit der roten Leibbinde ausgezeichnet. Während er liest, begleiten ihn aus den Seitenschiffen Chöre von bärtigen Mönchen mit den feierlich-getragenen, ewig wiederholten Klängen des »Gospodin pomiluj« (»Herr, segne uns!«). Dann reicht ein junger Bruder das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Die Leute puffen sich zum Altar vor, werfen ihre Gaben hin und empfangen auf silbernem Löffel geweihtes Brot und einen Tropfen Wein aus einem Silberbecher. Ein zweiter Mönch steht daneben und wischt jedermann den Mund ab. Immer höher und höher wächst der Berg der Gaben, gestickte Handtücher, die man später, für zwanzig Kreuzer das Stück, im Klosterhof kaufen kann.
Um elf Uhr tritt ein Mönch aus seiner Zelle, in jeder Hand einen Hammer. Er nähert sich einer mächtigen Eisenplatte, die frei im Säulengang des Hofes hängt, und beginnt sie flink zu hämmern. Das ist das Zeichen zur Predigt. Der Abt wird sie selber halten. Er hat das reiche Meßgewand schon abgelegt und steigt in schwarzem Chorrock, das rote Ehrenband um den Leib, die Stufen zum ersten Stock hinan. Dort, auf luftiger Altun, spricht er zu dem Volk. Kopf an Kopf drängt sich die Gemeinde, kein Apfel könnte zur Erde fallen. Die Weiber bilden natürlich die Mehrzahl. Sie tragen Kopftücher nach Art der Neapolitanerinnen, eine ganze Mitgift von Talern und Dukaten um den Hals, Leinenhemden, bunte Leibchen, Leinenröcke, bunte Schürzen, und alles über und über mit blauer Wolle bestickt. An den Füßen Bundschuhe. Die jungen Mädels haben sich die Haare zu kunstvollen Zopfhauben verflochten. So dünn sind die Strähne, so fein die Frisur, daß man meint, die Hauben wären gewebt. An jeder Schläfe steckt die dunkelgrüne Feder eines Enterichs, im Haar Blumen. »Federn und Blumen«, das ist der vielbesungene Sonntagsstaat. Alle aber haben grell geschminkte Wangen, weiß und rot. Der Brauch des Schminkens soll aus Türkenzeiten stammen. Auch die Männertracht ist reichgesticktes Leinen. Das Hemd fällt unter dem Gürtel bis an die Knie frei heraus. (»Der hat's heraus, wie der Krowot 's Hemed,« sagt der schwäbische Bauer von dem Erzgescheiten.)
Nach der Predigt gehen die Gäste zum Mahl ins Refektorium. Das ist ein einfacher niederer Saal, hier ist ja alles arm und einfach. An den Wänden die Ölbilder des Patriarchen Brankowitsch und seiner Vorgänger, an der Hauptfront der heilige Vater Nikola und St. Elias, der Klosterpatron, mit Weihlichtern davor. Am Tisch aber sitzen die Blüten der Diözese: wohlgenährte Popen mit blauen Bändern, schlechtgenährte Mönche und Brüder mit schwarzen Bändern, alle, wie ihr Abt in langem, ernstem Habit, mit langen, ernsten Bärten. Laien, die man ehren wollte, würgen mühsam die Klosterkost hinab.
Desto lebhafter geht es draußen zu. Von hundert Feuern steigt ein lustiger Rauch auf, Lämmer brutzeln an den Spießen. Vor den Zelten wogen Mädels und Burschen und kaufen Marzipan und giftgrüne Myrtenkränze. Wenn ein Mädel ihren Kranz ins Haar flicht, ist sie des Spenders Braut und wird später auf der Heimfahrt den Arm um den Nacken ihres künftigen Schwiegervaters schlingen. So will's die Sitte. Aus Bosnien ist eine Zigeunerkapelle herübergekommen. Sie fiedelt, singt und trommelt darauf los, die Tamburinschlägerin läßt ihre feurigen Blicke strahlen, der Primgeiger liebäugelt mit dem Stadtfräulein. Er hat sich närrisch aufgeputzt, gekämmt, rasiert – sogar in seinen Strumpfbändern stecken Blumenbüschel.
Die Männer sammeln sich um den Guslar. Das ist ein blinder Alter. Er hockt am Hoftor im Schatten, die Geige senkrecht vor sich aufgestellt, und sägt auf ihrer einzigen Saite mit einem großen Bogen. Klagend klingt sein Lied, eintönig und endlos, vom Zaren Lazar, der auf dem Amselfeld von Türkenstreichen fiel. In den Gesang mischt sich ein anderer, hundertstimmiger, regelloser: das sind die hundert Bettler, die hier im Schatten liegen und hocken, ihre Weisen in Versen jammern und ihre Gebresten zur Schau tragen. Sie rühren ihre Armstummel, winden sich in Krämpfen, verdrehen die entzündeten Augen oder wiegen leblose Kinder.
Nun, da die Beter die Basilika geräumt haben, führt man die Gäste aus der Stadt hinein. Die Bilderwand ist neu, geschichtlich merkwürdig nur die halbübertünchten, rohen, byzantischen Fresken. Den Silberkelch dort hat ein Schwindler »vergoldet«, das heißt mit Bronzefarbe überstrichen und sich für seine Arbeit gut bezahlen lassen. In der Bibliothek stecken ein paar Schweinslederbände, durchwegs glagolitische Meßbücher. Eines enthält auf den Vorlegeblättern in rührend schlichtem Deutsch die Geschichte eines Türkeneinfalls in Slawonien. Es waren schreckliche Tage, im Sturm der Schlachten, im Rauche des Blutes . .
»Wir haben auch ein ganz deutsches Werk,« sagt der Mönch und reicht mir »Werthers Leiden« aus dem Jahre 1803. Der Mönch ist jung, fünfundzwanzig Jahre etwa zählt er. Dennoch hat er schon sein halbes Leben im Kloster verbracht. Die Askese hat seinen Zügen einen scharfen Stempel eingeschnitten. Das lange braune Haar wallt um ein greises Angesicht. Wie wenig weiß er von der Welt und ihren Kämpfen! Er hütet an Wochentagen beschaulich die Klosterziegen, trinkt ihre Milch, ißt ihren Käs mit Ölgemüse und hält Antiochia für die größte Stadt der Erde . .
Vgl. G. D. Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen, Bd. I. Leipzig 1874, S. Hirzel. Charles Boner, Siebenbürgen, Land und Leute. Leipzig 1868, J. J. Weber. Wie eine natürliche Festung liegt Siebenbürgen vor uns. Waldgekrönte Bergreihen durchziehen das Land, Salz und Erze bergend, Heilquellen entsendend. Die Flüsse der Randgebirge spenden Lebenskraft; an den Berghalden reift die Purpurtraube, im Tale wogt das Ährenfeld. Auf den Bergen weidet noch die Gemse, im dichten Bergwald haust noch der Bär. Breitgestirnte Rinder, flüchtige Pferde bemerkt man allerorten in der Nähe meist wohlgeordneter Dörfer und Städte. Vor 750 Jahren war Siebenbürgen ein »desertum«, eine Öde, reich nur an Wald und Wild; kein Eisen öffnete den Boden; keine Stadt mit Steinhäusern, nur Wohnungen aus Holz und Rohrgeflecht deuteten auf die Nähe der Menschen. Um 1150 ließen sich, durch den weitblickenden Ungarnkönig Geisa II. gerufen, die ersten Züge deutscher Männer aus Niederland und der Kölner Gegend in Siebenbürgen nieder. Sie erschienen »ad retinendam coronam«, zur Erhaltung der Krone, deren Rechte von dem madjarischen Adel und den Walachen nicht immer geachtet wurden. Sie wurden ferner gerufen, die Wälder zu roden, der Ähre und Rebe eine Stätte zu säubern, also die Grundlagen aller Kultur durch ihr Beispiel zu lehren. Bald sperren der »Rote Turm« und die Törzburg die Einfallstore der Walachen und Türken; die Axtschläge zerschmettern die hundertjährigen Stämme; der Bogen vertreibt Bären und Wölfe; der Sumpf wird trocken gelegt; die Saat, der Obstbaum, die Rebe geben dem Boden ein neues Kleid; Dörfer mit Erdwällen, Städte mit Mauern, befestigte Kirchen, die »festen Burgen Gottes«, wachsen überall aus der Erde. Korn, Hafer, Hirse, Zwiebel, Flachs, Hanf, Hopfen, Wein liefert der Landbau; Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Honig, Wachs, Talg, Speck, Häute, Felle, Fische, Wolle spendet die Viehzucht; Eisen, Salz, Gold und Silber gibt der Bergbau. Dies sind die Rohstoffe, welche das durch strenge Zunftordnung früh geordnete Gewerbe verarbeitet. Wie vielgestaltig es ist, geht daraus hervor, daß besonders für die Orte Hermannstadt, Kronstadt, Bistritz schon in alter Zeit als Zunftgenossen verbürgt sind: Fleischhacker, Bäcker, Lederer, Weißgerber, Schuhmacher, Schmiede, Nagler, Kupferschmiede, Wagner, Gürtler, Schwertfeger, Schlosser, Kürschner, Handschuhmacher, Mantelschneider, Hutmacher, Seiler, Wollenweber, Weber, Faßbinder, Töpfer, Bogner, Schneider, Beutelmacher, Pfeilschnitzer, Sporer, Glockengießer, Goldschmiede, Steinmetze, Glaser, Maler.
Die Siedler entfalten auf Grund der reichen Natur- und Kunsterzeugnisse eine bedeutende Handelstätigkeit, begünstigt durch die Verkehrserleichterungen der auf ihre Sachsen stolzen Ungarnkönige. In Wardein, Ofen, Wien, Prag, in Polen, Deutschland, Dalmatien, Venedig besuchen sie die Märkte und besitzen sie ständige Niederlagen. Schulen folgten schon den ersten Einwanderern und mehrten sich besonders seit Anfang des 15. Jahrhunderts. Büchereien in städtischen Pfarrkirchen und Klöstern wurden frühzeitig gewürdigt und besonders seit der Erfindung Gutenbergs erweitert. Die Wiener Hochschule und die deutschen Universitäten, besonders Wittenberg und Heidelberg, zeigen in ihren Matrikeln zahlreiche Sachsen aus Siebenbürgen, die mit Ehren die akademische Laufbahn betreten haben. Luthers Lehre fand in Siebenbürgen eifrige Anhänger. Es ist selbstverständlich, daß ein so üppig aufsprießendes Volksleben nur im Besitze größter Freiheit solche Schößlinge treiben konnte. Andreas II. hatte bereits 1224 im »goldenen Freibrief« die Verfassung der Sachsen begründet: Sie sollten ein Volk bilden auf dem Boden, den ihnen Andreas zu vollem, echtem, unbeschränktem Eigentum gab. Daher besitzen sie Flüsse und Wälder mit Fischerei- und Jagdrecht, das Verkaufsrecht, daher fallen die Güter ausgestorbener Familien der Sachsengemeinde, nicht dem Staate zu. Ein selbstgewählter Graf, comes, ist ihr oberster Richter; er entscheidet nach Sachsenrecht, vor dem nicht Adliger und Leibeigener galt, vor dem vielmehr alle gleich waren. Nur wo der Graf zu keinem Entschluß kam, entschied der König ebenfalls nach Sachsenrecht. Als höchste gesetzgebende Behörde, als Landtag auf diesem Sachsenboden tritt uns die sogenannte »Nationsuniversität« entgegen. Die Sachsen wählten nach dem Wortlaute des Freibriefes alle Beamten, auch ihre Pfarrer, und diesen, nicht dem Bischofe, gaben sie den Zehnten. Ihrer für jene Zeit einzig dastehenden Verfassung nach sind sie dem König verpflichtet zur Zahlung von 500 Mark Silbers jährlich, zur Heeresfolge und zur Bewirtung des Landesherrn. Daß die Sachsen diese Verpflichtungen erfüllt haben, kommt für den, der den starren Rechtssinn unserer Brüder kennt, gar nicht in Frage. Daß sie auf den Reichstagen mit ihrem Rate unentbehrlich waren, ist vielfach bezeugt und kein Wunder; denn bereits in früheren Jahrhunderten soll sich der madjarische Adel bei diesen Gelegenheiten durch »Scheltworte und Säbelgeklirr und arge Leidenschaften, durch Ungehorsam gegen die Gesetze« ausgezeichnet haben. »Im Reichrat rauften sie sich am Bart und gaben sich Ohrfeigen. Es hatte eine solche Gestalt, als sollte es nicht lange währen,« fügt unser Gewährsmann hinzu. Daß unsere Sachsen ihrem Könige aber auch mit Besserem lohnten als mit Silber und Bewirtung, beweisen die zahlreichen Zeugnisse der Regenten durch alle Jahrhunderte, von denen wir nur zwei erwähnen, das Sigismunds, der 1427 in Kronstadt seinen Sachsen sagte: »Wie eure Väter in lichtem Tatenglanz strahlten, so habt auch ihr, von der Ahnen hohem Geist getrieben, in des Reiches Nöten Gut und Blut, Leib und Leben nie geschont, also daß an eurer Treue kein Makel haftet, und den Ruhm eurer Taten wird die Zeit nie verlöschen, nie wird ihn die Nacht der Vergessenheit decken« – und das fast noch schwerer wiegende des Feindes Stephan Bathori von 1530: »Es ist doch niemand besser als euch bewußt, von welchen Niederlagen, von wieviel Raub, Mord, Erpressung und großen Übeln jeglicher Art ihr heimgesucht worden, seitdem ihr vom König Johann (Zapolya) abgefallen. Und das alles ist geschehen, weil ihr jenem Fremden (Ferdinand, Bruder Karls V.) anhänget. Wahrlich, es ist ein Wunder, daß ihr allein für jenen so viel leidet, von dem ihr keine einzige Wohltat empfangen. Lasset eure Ehrlichkeit nicht täuschen von Leuten, die nur das Ihre suchen und nicht, was euerem Heile dient.« – Beim Anblick einer solchen Fülle urdeutschen Lebens bricht sich des Dichters Wort von selbst die Bahn über die Lippen: »Mit dem Pfluge, mit dem Schwerte, mit dem Worte, mit der Tat: ruhmvoll über diese Erde geht, Germania, dein Pfad.« Daß dies gesunde Volksleben auf diesem Vorposten europäischer Gesittung in den Jahrhunderten des Kampfes nicht erlosch, sondern in immer frischen, kräftigen Strahlen aufschoß und sich weiter entwickelte, ist kein schlechter Beweis seiner Güte. Wie kommt es nun aber, daß man die Leute, die Siebenbürgen, mit Pflugschar und Egge bekannt gemacht und gehoben haben, sofern man nämlich unter Hebung nicht »städtische Nichtsnutzigkeit«, sondern Sinn für Ordnung und Gehorsam gegen das Gesetz versteht, daß man diese Leute, die das Land von Islam und Türken befreit, die dem Adligen und Leibeigenen zuerst in jenen Gegenden den ehrsamen Bürger zur Seite gestellt, die den Madjaren eine Verkehrssprache und durch diese einen guten Teil ihrer höheren Bildung zugeführt haben: daß man sie in jeder Weise in ihrer völkischen Eigenart bedroht?Vgl. Karl Ludolf, Der Sprachen- und Völkerkampf in Ungarn. Leipzig 1882. Oswald Mutze. Fr. v. Löher, Das Erwürgen der deutschen Nationalität in Ungarn, München 1874, A. Ackermann. Ihre verbrieften Rechte waren dem ungarischen Edelmann von jeher eine Schranke; ihr Fleiß, ihre Sparsamkeit waren ihm ein stiller Vorwurf; ihr Mißtrauen gegen madjarische Ansiedelung auf dem Sachsenboden erregte von jeher des Ungarn Unmut; ihre Treue gegen das Haus Habsburg brachte ihn oft in Wut; ihr ernstes nachdenkendes Wesen ohne tollkühnes Selbstvertrauen und rasches Handeln paßte nicht zu dem blitzartig auflodernden, alles blind an die politische Freiheit setzenden Charakter des Madjaren. Dazu kommt ein durch keine Gründe zu beseitigender Glaube an die Feindseligkeit des Deutschen, endlich und vor allem ein überspannter, ausschließender, hochmütiger Zug des Madjaren; erkennt er doch Österreichs Hoheit kaum an, ist er doch mehr als die Regierung, daher das wegwerfend Hochmütige seines Wesens. Sein Ideal ist die mittelalterliche Lehensherrschaft, die Madjaren als Herren, alle übrigen Stämme Ungarns als Leibeigene gedacht. Durch die Zerschlagung der österreichischen Monarchie wurden die Deutschen der Willkür der Ungarn preisgegeben. »Merzen wir alles aus, was deutsch ist in unserem Leben!« ist fortan die Losung eines Volkes, dessen Sprache außer ihm kein Volk auf der Männererde versteht. »Madjarisierung« nennt man jenes Treiben, welches auf Beseitigung deutscher Namen, deutscher Sprache, deutscher Wissenschaft und Kunst gerichtet ist. In der Verfassung von 1867 waren den Sachsen Siebenbürgens von ihren früheren Rechten folgende fünf gewahrt: die Aufrechterhaltung der Kreisordnung, die Unantastbarkeit des Sachsenbodens, die Besetzung aller Ämter durch freie Wahl, die Belassung des Deutschen als Amts- und Geschäftssprache, die Unantastbarkeit des Volksvermögens. Von diesen damals zugesicherten Rechten ist ihnen kein Jota geblieben. Denn bereits 1873 wollte die ungarische Regierung die elf Kreise der Sachsen zerfetzen und mit madjarischen zusammenwerfen; die sächsische Nationsuniversität erhebt zwar Widerspruch, doch der Minister entzieht ihr das Berufungsrecht. Die 35 sächsischen Abgeordneten legen demzufolge ihr Amt nieder, vom Reichstag Recht und Genugtuung fordernd. Mit dem Worte »Landesverräter« meinte man solche gegeben zu haben. – Ihr Boden sollte unantastbar sein! Doch hinderte dies nicht, daß man 50 000 Walachen zu ihrem Gebiet schlug, zum Teil strafrechtlich Verfolgte, die volles Wahlrecht erhielten. Nun sind die wackeren Kämpfer durch den Trianonfrieden vor eine neue Aufgabe gestellt: ihr Volkstum und ihr Recht gegen die neue Oberhoheit der »Walachen«, der Rumänen, zu wahren. Denn Siebenbürgen ist nun rumänischer Besitz. – Die freie Beamtenwahl war den Sachsen zugesichert. Nun wurde ihnen 1868 statt ihres Grafen ein königlicher Kommissar aufgedrungen, bald die freie Beamtenwahl aufgehoben, ja den Anwärtern der Bildungsnachweis erlassen, obwohl das über alles Wünschen der Sachsen hinausging. – Das Deutsche sollte Amtssprache bleiben! Doch bereits 1879 wurde das Madjarische pflichtmäßiger Unterrichtsgegenstand, und nichtmadjarischen Lehrern wurden Belohnungen aus dem Staatsschatze für leicht zu erratende Dienste zugesichert. – Das Volksvermögen, meist aus Stiftungen bestehend und zum Unterhalt der höheren Bildungsanstalten dienend, wurde ihnen gewaltsam entrissen. Wenn auch mit Füßen getreten, denken die Sachsen wenig an Auswanderung; auch die Zahl der Überläufer ist gering; wenn auch alle übrigen Hoffnungsstrahlen nur schwach am Horizonte aufschössen, so müßte doch die Geschichte ihrer Ahnen sie mit dem unerschütterlichen Glauben durchdringen, daß ihre Vorpostenstellung ein Leidenskelch, aber zugleich der Brunnen ihrer ewigen Verjüngung ist.
Nach Fr. Fr. Fronius, Bilder aus dem sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen (Wien 1879, Karl Graeser) und eigner Anschauung d. H. Der sächsische Bauer Siebenbürgens hat in seinem Haus und Leben eine wahre Schatzkammer uralter, echter deutscher Sitte, die sich bei uns bis zur Unkenntlichkeit verflacht hat. Das sächsische Bauernhaus sieht mit der Giebelseite nach der Straße, mit der breiteren in den Hof, damit der Bauer die Wirtschaftsgebäude und die Arbeit der Hausgenossen besser übersehen könne. An der breiten Hofseite führt eine kleine Treppe zu einem gedeckten Vorsprung. Hier schaut er morgens nach Wind und Wetter, abends nach Pferdedieben aus; hier hält die Bäuerin mit den Nachbarinnen bei Regenschauern Zwiesprach; hier stehen die Blumentöpfe der Tochter des Hauses, und unter dem Dach der Laube hat der Bauernknabe den Taubenschlag. Unter dem Vorsprung befindet sich der Eingang in den Keller, wo zweireihig die Fässer liegen, gefüllt mit dem Blut der siebenbürgischen Rebe, und der eichene Bottich, welcher das Sauerkraut birgt. Von der Laube aus gelangt man in ein Vorhaus, welches den Wohnraum in zwei Hälften zerlegt. Der der Gasse abgewendete, hintere Raum ist das Auszüglerstübchen, der vordere dient dem rüstig schaffenden jüngeren Bauer zur Wohnung. Die in beiden Räumen gleiche Hauseinrichtung zeigt einfache Möbelstücke aus weichem Holz, mit Blumen bemalt: die benutzte Bettstatt und das unbenutzte Himmelbett, auf welchem die sorgende Hausmutter Betten und Polster für die Aussteuer der Söhne und Töchter bis zur Decke häuft; ferner die langen Kleider- und Wäschetruhen mit ansehnlichem Vorrat; gilt es doch als Schande, jährlich mehr als dreimal die »große Wäsche« vorzunehmen. Der Tisch in der einen, der mächtige Lutherofen in der anderen Ecke sind unerläßliches Zubehör der Bauernstube. An der Zimmerdecke laufen an allen vier Wänden herum Rahmen, auf denen Teller von Zinn und Ton stehen, während an Nägeln die schön geordneten Krüge aufgehängt sind. Die Schwarzwälderuhr, die Bildnisse von Luther und Melanchthon bilden den Wandschmuck, während ein Wandschrank, die Almerei, die Bücherschätze der Familie: Bibel, Gesangbuch, Kalender und abgenutzte Schulbücher verwahrt. Auf gleichem Flur mit den Wohnräumen liegt die Speckkammer; denn Speck ist dem sächsischen Bauer ein Leibgericht. Der Hauptvorrat dieses geräucherten Salzfleisches findet sich allerdings auf der festen Burg des Dorfes, hinter den Ringmauern der Kirche, mit Namen und Hausnummer des Eigentümers versehen. Trotz seines Herdenreichtums ißt der Sachse doch nur selten frisches Fleisch des Rindes; denn nicht alle Tage bricht ein Zugochs auf den oft schlechten Wegen oder eine Milchkuh ein Bein; auch wird nicht jeden Tag ein Gemeindestier geschlachtet, so daß der »Ortshann« (Gemeindevorsteher) durch das »Nachbarzeichen« ansagen lassen könnte, wieviel Pfund jeder Hauswirt zu kaufen verpflichtet sei, damit der vom Unglück Betroffene oder das Gemeinwesen nicht schweren Schaden leide.
In solchem Hause wird das sächsische Bauernkind geboren. Ist unter Beihilfe der »Amtfrau« (Hebamme) der kleine Weltbürger ans Licht gebracht, so duldet es die Mutter höchstens zwei Tage auf dem Lager. Vor den »Alfs« (Elfen) muß das unter dem Polster liegende Messer oder der Besen, vor dem »Berufen« (Behexen) die den Zauber bannende Alte das Kind schützen. Die Taufe hat bald nach der Geburt zu erfolgen; in wohlgesetzter, altherkömmlicher Rede sucht der Eheherr um sie beim »Wohlehrwürdigen Herrn Vater«, dem Pfarrer, nach. In derselben feierlich steifen Weise werden die Taufzeugen geladen, und auch beim Taufschmaus sind altherkömmliche rednerische Leistungen keine Nebensache. Das Kind wandert schon frühzeitig mit der Mutter in die Feldarbeit, um Wind und Wetter ertragen zu lernen. War die Zumutung an die gute Natur des Kindes zu groß, so muß die »versprechende« Alte durch Heilmittel und Formeln helfen, die mit dem feststehenden »Im Namen Gottes des Vaters usw.« schließen; denn weit wohnt der Arzt in der Stadt. Vielleicht macht auch die noch von früherer Krankheit übriggebliebene Arznei sein Herbeirufen unnötig. Mit den Haustieren schließt das Kind innige Freundschaft; auf dem Büffelkalb und dem Füllen macht der Bube die ersten Reitversuche. Alle Pferde und Ochsen der Gemeinde kennt er, aber noch keinen Buchstaben. Mit dem sechsten Jahre beginnt für das »Ehezweiglein« die Qual auf der harten Schulbank. Noch ehe man in Deutschland öffentliche Schulen hatte, bestanden sie dort. Mit vollendetem 15. Jahre erst entwächst er der Schule. An Stelle der Schulzucht tritt nun bis zur Verheiratung die der Bruderschaft. Unter der Aufsicht des »Altknechts«, der übrigen frei erkorenen Beamten und aller Glieder dieser Genossenschaft steht seine gesamte sittliche Führung. Beim »Zugang«, das ist dem Gerichtstag der Bruderschaft, fragt man, ob der Jüngling in der Kirche gepoltert, gegähnt, Sträuße gebunden, geschlafen, ob er dem Fremden willig seinen Kirchenplatz eingeräumt, ob er Kirche oder Kinderlehre versäumt, den Mitbruder geschimpft, am Bußtag und in den Fasten rote Bänder am Hut getragen, ob er das beim Tanz ihm zugeführte Mädchen verschmäht, in der Spinnstube geraucht, ob er in Gesellschaft der Mädchen die Ehrbarkeit in Wort und Tat vergessen, im Wirtshaus gewesen oder gar Karte gespielt usw. Die Bruderschaftssatzung bestimmt für diese Vergehen Strafe. In ernster Weise sorgt dieselbe Bruderschaft für gemeinsame Vorbereitung und gemeinschaftlichen Genuß des Abendmahles. Der Austritt erfolgt in der Regel mit der Verheiratung. In der Spinnstube läßt der Bursche seine Augen schweifen und wählt, auch die Mitgift der künftigen Gattin erwägend. Ist ihm das Mädchen geneigt, so ziert es ihm Sonntags den Hut mit mächtigem Blumenstrauß und erhält als Gegengabe einen kunstvoll gearbeiteten Heurechen. Durch einen Vertrauten erfolgt dann die Werbung bei den Eltern der Geliebten. Vor dem »Wohlehrwürdigen Herrn Vater« geschieht die Verlobung. Zur Haferernte folgt die Braut dem auf stattlichem Sattelhengst reitenden Burschen auf seinem Erntewagen, um ihm beim Heimfahren zu helfen. Der Katharinentag (25. November) ist für alle jungen Paare in der Gemeinde der herkömmliche Hochzeitstag. Das Hochzeitsfest erfordert acht Tage. Die Verwandtschaft, ja oft das ganze Dorf hilft mit Rat und Tat; Milch, Butter, Hühner, Eier, Speck als Beiträge zum Hochzeitsmahl fließen reichlich ins Hochzeitshaus; denn die Gemeinde bildet eine Familie. Auch an Brautgaben fehlt es nicht. Der junge Ehemann tritt nun in den Verband der »Nachbarschaft«. Unter einem freigewählten »Nachbarvater« will diese, durch feste Satzung geregelte Genossenschaft dem einzelnen die Hilfe der Gesamtheit gewähren. In der Regel zerfällt die Gemeinde in vier solcher Nachbarschaften; der Beitritt dazu ist Pflicht. Die Nachbarschaftsartikel kennzeichnen als Zweck dieses Zusammenschlusses gegenseitige Hilfeleistung in Freud und Leid, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit, Pflege der Wohlanständigkeit und des kirchlichen Sinnes. Führt ein Nachbar einen Neubau auf, ist er in der Erntezeit erkrankt, so bestellt der Nachbarvater die nötige Hilfe. Ist er in Gefahr, dem Wucherer in die Hände zu fallen, so streckt ihm die Nachbarschaftskasse Geld vor; sind ihm seine Vorräte vor der Ernte ausgegangen, so erhält er aus dem Sparspeicher ein Darlehn an Mundvorrat. Die Nachbarschaft schützt das Dorf vor Dieben, bildet die Feuerwehr, bestattet ihre Toten. An ihrem jährlichen Richt- oder Sittag bestraft sie die Verstöße gegen die Nachbarschaftsartikel.
Der sächsische Bauer verleugnet in Wuchs und körperlicher Kraft den germanischen Ursprung nicht. Er ist wirtschaftlich, sparsam, mäßig. Seine Hauptnahrung: Milch, Käse, Speck, getrocknetes Schweinefleisch ersetzt das nährende Fleisch des Rindes nur unvollkommen. Der Kindersegen in den einzelnen Familien ist durchschnittlich gering; doch ist die Zunahme der sächsischen Bevölkerung immer noch stärker als die der madjarischen. Der sächsische Bauer ist nicht bloß religiös, sondern auch kirchlich gesinnt. Die Wahl eines Pfarrherrn ist eine die Nachbarschaften tief aufregende Frage. Denn der würdige Pfarrherr soll – wiewohl man »guten Ausspruch« von ihm verlangt – weniger ein gelehrter Kanzelredner, als vielmehr ein Mann sein, der dem Bauer in allen seinen Lebensverhältnissen, in Schule, Familie, Wirtschaft, in Krankheit, Schmerz und Freude mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, man legt fast ebensoviel Gewicht auf die Eigenschaften der Frau Pfarrerin; sollen doch diese beiden Menschen im schönsten und schwersten Sinne des Wortes als Vater und Mutter der Gemeindefamilie vorstehen. Des Sonntags erscheint der Hausvater mit Kind und Kegel in der befestigten Kirche, und der Wohlehrwürdige muß auch den kleinen Störenfried, der in der Kirche spazierend umherwandelt, ja wohl gar schreit, mit in Kauf nehmen. Der sächsische Bauer ist konservativ, und wer wollte dem ehrenfesten Geschlecht das fromme Festhalten am bewährten Guten verargen? Mag man ihm immer Trotz vorwerfen, wenn er sich gegen Zusammenlegung von Grundstücken, gegen das Abschaffen des von den Urvätern ererbten Pfluges sträubt. Aber bekanntlich hat er Grund, mehr festzuhalten, als vielleicht gut und nötig, um nur etwas von seiner Eigenart zu behalten.
Nach einem Werbeblatt zur Jubiläumsausstellung in Bukarest 1905 und einem Aufsatze von Paul Lindenberg im Daheim 1906, Nr. 8. Außerdem Simeon Mehedinti, Die rumänische Steppe. Ratzelgedenkschrift S. 250 ff. Leipzig 1904, Dr. Seele & Co. Das junge Königreich Rumänien hat sich unter dem Hohenzollern Karl politisch und wirtschaftlich in staunenswerter Weise gehoben. Als der junge Prinz 1866 seinen Einzug in Bukarest hielt, gab es dort nur niedrige Häuser, keinerlei nennenswerte öffentliche Gebäude, das Schloß befand sich in einem Zustande des Verfalls und der Armseligkeit, daß er verwundert fragte, wozu dort ein Posten aufgestellt sei; die Gassen waren ungepflastert, und selbst die Hauptstraße hatte tiefe Löcher, die den Wagen gefährlich wurden. Heute ist Bukarest ein Klein-Paris: die Straßen sind sorgsam gehalten, die Hauptstraßen und Boulevards elektrisch beleuchtet, es gibt große öffentliche Gebäude, Denkmäler, Brunnen, Kirchen, Parks und Plätze, Villenviertel. Diese bestehen aus lauter Einfamilienhäusern, dadurch bekommt die Stadt eine riesige Ausdehnung; deshalb die vielen raschen Mietskutschen als Verkehrsmittel, der Führer im russischen Samtrocke mit der bunten Schärpe – das ist das heutige Bukarest.
Herrlich sind die tannenduftenden Karpatentäler, wie zum Beispiel das Peleschtal mit dem Königsitze Sinaja, das Jalomitzatal mit seinem Kloster und andere. Dort an der Eisenbahnlinie Kronstadt-Bukarest liegt das rumänische Petroleumgebiet. Zwischen Waldbergen bahnt sich die Prahowa ihren Weg, im Frühling ein ungestümer Gebirgsfluß, der breithin seine Schotter streut. »Campina!« ruft der Schaffner. Ein starker Petroleumgeruch entströmt den auf dem Bahnhofe stehenden »Zisternen«, rundbauchigen Eisenbahnwagen, die der Beförderung des gewonnenen Erdöls dienen. Zu beiden Seiten des Flusses ragen hohe holzverschalte Bohrtürme auf als Vorposten einer Heerschar, die hinter Campina steht. Ein freundliches, walachisches Städtchen mit niedrigen Häusern und blumigen Gärtchen, mit regem Verkehr und zahlreichen Läden; denn seit dem Aufschwung der Petroleumindustrie ist viel Geld unter die Leute und sind viele Leute auf die Petroleumfelder gekommen. Trotzdem ist im Gegensatz zu amerikanischen Beispielen dem Ort seine anheimelnde Eigenart geblieben. Langsam ziehen vier, acht, zehn der prächtigen hellgefärbten Stiere mit den riesigen geschwungenen Hörnern die schwerbeladenen hölzernen Wagen; in buntgestickten Kitteln und Jäckchen schreiten Bauern und Bäuerinnen einher; auf seinem Pferdchen jagt der Postbote in Landestracht heran; Enten und Gänse schnattern in den Nebengassen; etliche Borstentiere tun sich im Tümpel mit ihrer quiekenden Nachkommenschaft gütlich.
Anders ist das Bild allerdings auf dem Arbeitsfelde der Petroleumgesellschaft »Stern von Rumänien« in der Nähe von Campina. Sie beschäftigt jetzt 3000 Arbeiter und arbeitet mit einem Betriebskapital von etwa 20 Millionen. Im Jahre 1905 förderte sie 22 000 Zisternen Petroleum zu je 10 000 kg aus der Erde. Dies nur, um die Bedeutung dieser Petroleumfelder zu zeigen. Die Oberleitung liegt in deutschen Händen, auch unter den Beamten sind so viel Deutsche, daß eine deutsche Schule errichtet worden ist. Die rumänischen Ingenieure verdanken dazu ihre Bildung deutschen Hochschulen.
Vor kurzer Zeit noch war Campina ein rege besuchtes Bad mit Schwefelquellen. Ein hübscher Park lag hier, in dem sich ein buntes geselliges Leben während der Sommermonate entfaltete. An jene Zeit erinnert nur noch das weiße Kurhaus, das nun als Kontor der Petroleumgesellschaft dient. Jetzt ragen in kurzen oder längeren Entfernungen Dutzende von hölzernen Türmen auf, die unten verschalt sind und nach oben in spitze Balkengerüste auslaufen. Die weißen Fichtenbretter sind im Umsehen schwarz wie der Erdboden, den die Petroleumfluten netzen; denn wo sie hindringen, ist's selbst mit dem ausdauerndsten und genügsamsten Pflanzenwuchs vorbei. Zwischen den Türmen zahllose Bretterbuden, Häuschen, Hütten; in der Luft ein Gespinst von Telegraphen- und Telephondrähten, eisernen Röhren, die das innerhalb der Türme gewonnene Petroleum in große Sammeltanks leiten.
Aus den Kesselhäusern sprüht der Feuerschein zu Türen und Fenstern heraus, weißlicher Dampf quillt stoßweise hervor, es surrt und summt, rattert und rasselt, dröhnt und rollt von Maschinen aller Art. Räder drehen sich in sausendem Schwung, und quietschend bewegen sich holzgeformte Winden – eine sorgsam erdachte und vielgestaltige Vorrichtung ist nötig, der Erde ihr flüssiges Feuer zu entringen. Die Dampfkraft wird auf große Entfernungen zu den Bohrtürmen in eisernen Röhren geleitet.
Die Bohrung geht oft durch schweres Gestein, bis in Tiefen von 800-1000 m und kostet für das Meter etwa 100 Fr., der Turm selbst etwa 20 000 Fr. Zuerst wird eine 5-6 m tiefe Grube angelegt durch die obersten Schotterschichten. Dann führt man weite eiserne Rohre ein und untersucht die Lehmschicht. Das Wasser wird nun abgesperrt, das Bohrloch trocken gelegt, und der Eisenbohrer tritt in Tätigkeit, von Dampfkraft angetrieben. Sogenannte Löffel beseitigen den Schlamm.
Sind alle Vorbereitungen zur Erdölgewinnung getroffen, so hebt der 10 m lange eiserne »Schöpflöffel«, der bis zu 500 kg faßt, mit Motorkraft in bestimmten Zwischenräumen das Öl empor in einen Bottich. Hierbei öffnet sich in der Tiefe ein Kugelventil am Boden des Löffels, der Hohlraum füllt sich mit dem Öl je nach dem Stande des Brunnens drunten, das Ventil schließt sich beim Emporziehen, und oben schüttet der Löffel die geförderte Menge in den Bottich, von dem Röhren nach dem Sammeltank laufen. Paraffinreiches Erdöl wird in besonderen Fabriken zu Paraffinöl, Vaseline, Benzin, Paraffin, weiterhin zu Kerzen, Streichhölzern verwendet, paraffinarmes gereinigt zu Brennöl oder verarbeitet als Schmieröl. Die Campinafabrik verarbeitet täglich 150 Ladungen Rohöl, jede zu 10 000 kg. In walzförmigen Versandtonnen aus Eisen befördert die Eisenbahn das Brennöl nach Giurgewo, dem rumänischen Donauhafen, oder nach Constanza am Schwarzen Meere, wo mächtige Eisentanks errichtet sind, aus denen die besonders eingerichteten Ölschiffe gefüllt werden, um nach Deutschland, Frankreich, England, Italien usw. zu fahren. Nicht immer vollzieht sich die Förderung ruhig, oft schießt mit ungeheuerer Macht das mit Sand vermischte Erdöl in Ausbrüchen hervor. Ein solcher 18 stündiger Ausbruch lieferte 450 Ladungen Öl. Dann müssen von allen Seiten Arbeitskräfte herangeholt werden, Gruben werden rastlos ausgehoben, Dämme gezogen. Einmal wurde bei einem solchen Ausbruch das gesamte Bohrzeug von 400 m fünfzölliger Eisenbohrstangen aus dem Boden gerissen und über den Turm geschleudert. Die Sonnenstrahlen zaubern auf den Petroleumlachen die wundervollsten Farbenspiele hervor.
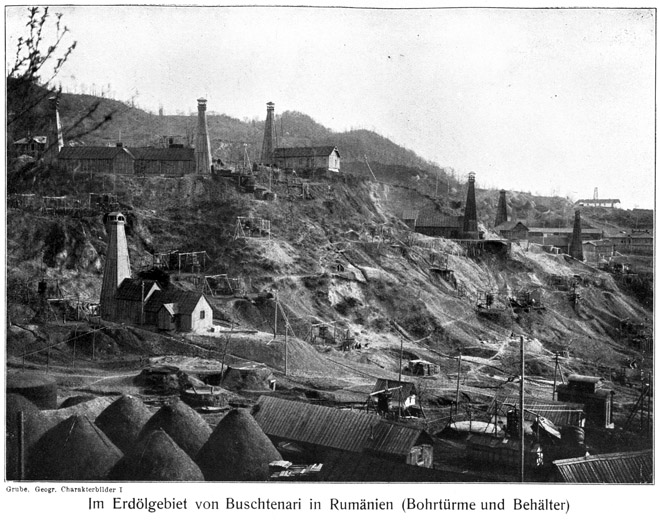
Andere Petroleumfelder liegen bei Buschtenari, zwei Meilen weiter, in wald- und hügelreichem Gelände; dort arbeitet deutsches, französisches, englisches, amerikanisches, holländisches, österreichisches, belgisches und rumänisches Kapital. Hier trifft man auch noch alte bäuerliche Handbrunnen; denn seit Jahrhunderten hoben die Einheimischen hier aus den Erdölquellen Wagenschmiere und Brennstoff aus tiefen Schächten. Den Arbeitern in der Tiefe wurde mit riesigen Blasebälgen frische Luft zugeführt. Sie füllten Fässer mit dem Öl an; diese wurden mit Winden heraufgezogen und in Bottiche entleert.
Das Mais- und Weizenland Rumänien aber wird bald zu den großen Petroleumländern der Erde zählen und reichen wirtschaftlichen Gewinn aus dieser neuerschlossenen Quelle ziehen, die schon Galizien, das ähnlich am Außenbogen der Karpaten liegt, Segen gebracht hat.
Wenn wir den Flüssen aus den Karpaten durch das hügelige Vorland weiterfolgen, kommen wir in die rumänische Steppe, etwa die Baragansteppe an der unteren Jalomitza. Noch vor 40 Jahren waren diese weiten Ebenen nur dem Hirten und seinen Herden, der den Sommer auf den Matten des Gebirgs verbracht hatte, ein wärmeres Überwinterungsgebiet. Hier schlug er seine tirla auf am tiefen Steppenbrunnen. Aber seitdem die Donaumündung reguliert und die Klippen des Eisernen Tores gesprengt worden sind, so daß der Wasserweg als Ausfuhrstraße wieder offen stand, hat der Bauer den Hirten in der Steppe verdrängt, neue Dörfer von fast amerikanischer Regelmäßigkeit sind entstanden – doch die Bauern nennen sich noch immer in Erinnerung an die Hirtenzeit tirlasi. Die Stromauen endlich im Überschwemmungsgebiete sind von wildem Wald erfüllt: dicke Ulmen, um die sich im Herbste gelbe Girlanden der Rebe mit dunkelblauen Trauben schlingen, Weiden und Pappeln und anderes. Wasservögel und Stelzvögel aller Art haben sich die Lungka, den Uferwald, zum Wohnort erwählt, der den Menschen mit seinen Sumpffiebern abstößt.