
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
I
Sie wissen, dass es schlecht mit ihm steht, sagte der Kellner, als er Prometheus einige Tage darauf traf.
Mit wem?
Mit Damokles – o! sehr schlecht steht's mit ihm: – damals, als er aus Ihrem Vortrag ging, hat er es sich zugezogen ...
Aber was denn?
Die Ärzte wissen nichts Genaues; – es ist eine ganz seltene Krankheit ... sie sprechen von einer Schrumpfung der Wirbelsäule ...
Der Wirbelsäule?
Der Wirbelsäule. – Wenn nicht bald ein Wunder geschieht, wird die Sache äusserst schlimm. Er ist sehr herunter, versichere ich Ihnen, sehr herunter, und Sie sollten ihm einen Besuch machen.
Gehen Sie oft zu ihm?
Ich? Jeden Tag. Er bekümmert sich sehr um Kokles; ich bringe ihm Neuigkeiten über ihn.
Warum geht er nicht selbst hin?
Kokles? Der ist zu sehr beschäftigt. Ihre Rede, wissen Sie das nicht? hat auf ihn einen ausserordentlichen Eindruck gemacht. Er spricht von nichts mehr sonst, als von seiner Aufopferung und bringt seine ganze Zeit damit zu, in den Strassen nach einer neuen Ohrfeige zu suchen, die einem neuen Damokles etwas Geld abwirft. Aber er hält umsonst seine andere Backe hin.
Benachrichtigen Sie doch den Müllionär.
Dem berichte ich jeden Tag. Und deshalb gehe ich auch jeden Tag zu Damokles.
Aber geht denn der Müllionär nicht selbst?
Das ist es ja, was ich ihm alle Tage sage, aber er will nicht und will nicht. Er will unbekannt bleiben. Damokles würde auf der Stelle gesund werden, kennte er seinen Wohltäter: ich sage dem das, aber er bleibt dabei, er will sein Inkognito wahren – und ich verstehe jetzt auch was es ist: nicht Damokles interessiert ihn sondern dessen Krankheit.
Sie sprachen davon, mich dem Herrn vorzustellen ...?
Gleich, wenn Sie wollen.
Und sogleich gingen sie hin.
II
Da wir selbst ihn zu kennen nicht das Vergnügen haben, so haben wir uns vorgenommen, ganz wenig von Zeus, dem Freunde des Kellners, zu sagen. Bloss diese einigen Sätze.
Der Kellner: – Nicht wahr, Sie sind sehr reich?
Der Müllionär, halb zu Prometheus gewendet: – Ich bin viel reicher als man sich denken kann. Du gehörst mir; er gehört mir; alles gehört mir. Sie glauben, ich sei Bankier; ich bin was ganz anderes. Meine Tätigkeit über Paris ist verborgen, aber darum nicht weniger beträchtlich. Sie ist verborgen, weil ich sie nicht weiter verfolge. Ja, mein Geist ist der der Initiative. Ich lanciere. Und dann, wenn einmal ein Geschäft lanciert ist, rühre ich keinen Finger mehr daran.
Der Kellner: – Und nicht wahr, Ihre Handlungen sind sozusagen gratis?
Der Müllionär: – Ich allein, der allein, dessen Vermögen unendlich ist, kann mit absoluter Interesselosigkeit handeln; der Mensch nicht. Daher kommt meine Liebe zum Spiel, nicht zum Gewinn, verstehen Sie mich recht – zum Spiel; was könnte ich gewinnen, das nicht schon vorher mein eigen ist? Selbst die Zeit ... wissen Sie, wie alt ich bin?
Prometheus und der Kellner: – Der gnädige Herr scheinen noch ganz jung zu sein.
Der Müllionär: Unterbrechen Sie mich doch nicht, Prometheus. – Ja, ich habe die Spielwut. Mein Spiel ist: den Menschen zu borgen. – Ich borge, aber nur zum Genuss. Ich borge, aber es ist à fond perdu; ich borge – aber mit der Miene des Schenkers. – Ich liebe es, dass man nicht weiss, dass ich borge. Ich spiele, aber ich verberge mein Spiel. Ich experimentiere; ich spiele wie ein Holländer sät, wie er eine unbekannte Zwiebel pflanzt; was ich den Menschen borge, was ich in die Menschen pflanze, amüsiert mich, dass es wächst; ich amüsiere mich damit, es wachsen zu sehen. Der Mensch wäre ohne was so leer! – Lassen Sie mich Ihnen mein letztes Experiment erzählen. Sie werden mir es zu beleuchten helfen. Hören Sie mich erst an, dann werden Sie verstehen. Sie werden verstehen.
Ich ging auf die Strasse und suchte ein Mittel, irgendeinem Schmerzen zu bereiten mit dem Geschenke, das ich irgendeinem andern machen wollte; diesem andern Vergnügen zu bereiten mit dem Übel, das ich diesem einen zufügen wollte. Eine Ohrfeige und ein Fünfhundertfranksbillet genügten mir dazu. Dem Einen die Ohrfeige, dem andern die fünfhundert Franks. Ist das klar? Weniger klar ist nur die Art, wie beides beiden zu applizieren.
Ich kenne die Art, unterbrach Prometheus.
Wie? Sie wissen? sagte Zeus.
Damokles und Kokles sind mir begegnet: und über sie mit Ihnen zu sprechen kam ich gerade: – Damokles sucht Sie und ruft nach Ihnen; er beunruhigt sich; er ist krank; – möchten Sie sich nicht zu ihm begeben, sich ihm zeigen? Aus Mitleid!
Lassen wir das, sagte Zeus; ich habe niemandes Ratschläge nötig.
Was habe ich Ihnen gesagt? sprach der Kellner.
Prometheus erhob sich; aber im Gehen wandte er sich noch einmal plötzlich zurück: Entschuldigen Sie, mein Herr. Verzeihen Sie eine indiskrete Bitte. Zeigen sie ihn mir, ich bitte Sie! Ich möchte ihn so gern sehen! . . .
Wen?
Ihren Adler.
Aber ich habe gar keinen Adler, Verehrtester.
Keinen Adler? Er hat keinen Adler!! Aber . . .
Nicht die Spur! Die Adler (und Zeus lachte) die Adler, ich bin
es ja, der sie gibt.
Die Verblüfftheit des Prometheus war gross.
Wissen Sie was man sagt? fragte der Kellner den Bankier.
Was sagt man denn?
Dass Sie der liebe Gott sind!
Ich habe davon gehört, machte der andere.
III
PROMETHEUS suchte Damokles auf; und besuchte ihn dann öfter. Er sprach nicht jedesmal mit ihm, aber er liess sich vom Kellner berichten.
Eines Tags brachte er Kokles mit.
Der Kellner empfing sie.
Nun, wie geht's? fragte Prometheus.
Schlecht. Sehr schlecht, antwortete der Kellner. Seit drei Tagen kann der Unglückliche nichts zu sich nehmen. Das Schicksal seiner fünfhundert Franks beschäftigt ihn unausgesetzt; überall sucht er sie und findet sie nirgends; er glaubt, er habe sie geschluckt, nimmt Purgantien und sucht dann in seinem Stuhl. Wenn ihm manchmal die Vernunft wiederkommt und er sich seines Abenteuers erinnert, so nur um in noch grössere Verzweiflung zu geraten. Und Ihnen gibt er Schuld daran, Kokles, weil er sich einbildet, dass Sie seine Schuld komplizieren und dass er sich nicht mehr auskennt. Die meiste Zeit deliriert er. Zu dritt sind wir des Nachts bei ihm, aber er vollführt solche Sprünge im Bett, dass wir nicht schlafen können. Kann man ihn sehen? fragte Kokles.
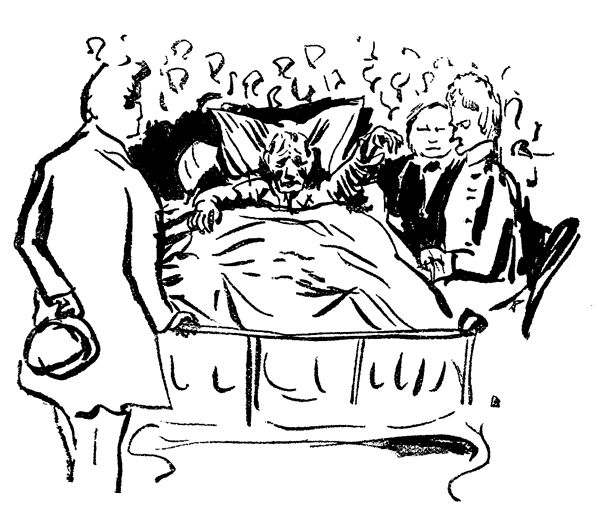
Ja, aber Sie werden ihn sehr verändert finden. Die Unruhe frisst ihn auf. Er ist abgemagert, abgemagert, abgemagert sag ich Ihnen ...! Werden Sie ihn überhaupt wiedererkennen? Und er Sie?
Auf den Fussspitzen traten sie ein.
Das Schlafzimmer des Damokles roch stark nach Medikamenten. Es war ein niedriges und sehr schmales Gemach. Zwei Nachtlampen gaben eine spärliche Beleuchtung. In einem Alkoven sah man undeutlich den Damokles in einer schrecklichen Menge von Kissen und Decken. Er redete auf jemand hin, obwohl niemand da war, der ihn hören konnte; seine Stimme war heiser und verschleiert. Voll Entsetzen sahen Prometheus und Kokles einander an; der im Bett hörte sie nicht herankommen, und fuhr, wie wenn er allein wäre, in seiner Geschichte fort:
Und von diesem Tage an schien mir auf einmal mein Leben einen Sinn zu bekommen und dass ich nicht mehr leben könne. Diese verhassten, schrecklichen fünfhundert Franks – ich glaubte, sie jedermann schuldig zu sein und wagte nicht, sie einem zu geben, weil ich sonst alle andern beraubt hätte. Los wollte ich sie sein, ja, los wollte ich sie sein – aber wie? Die Sparkasse fiel mir ein, aber das hätte mein Übel nur vergrössert; meine Schuld hätte sich um alle Zinsen der Schuld vermehrt; und andrerseits die Summe tot liegen zu lassen, dieser Gedanke war mir unerträglich; so dass ich die Pflicht fühlte, die Summe in Umlauf zu bringen; ich trug sie immer bei mir; regelmässig alle acht Tage wechselte ich das Papier gegen Gold, das Gold gegen Papier. Beim Wechseln verliert man nicht, gewinnt man nicht; circulärer Wahnsinn, ganz einfach.
Und zu alldem kam noch diese Tortur: dank einer Ohrfeige, die ein andrer bekam, habe ich diese fünfhundert Franks!
Eines Tags treffe ich Sie, wie Sie wissen, im Restaurant ...
Er spricht von Ihnen, sagte der Kellner.
Der Adler des Prometheus zerbricht eine Spiegelscheibe, sticht dem Kokles das Auge aus ... Gerettet!! – Für Nichts, glücklich, vorsehungsvoll lasse ich die Fünfhundert in die Lücke dieser Ereignisse gleiten. Keine Schuld mehr! Gerettet!
Ach, meine Herren, welch ein Irrtum ... Es ist seit jenem Tage, dass ich in Agonie hege. Wie soll ich Ihnen das nur erklären? Werden Sie je meine Angst begreifen? Diese fünfhundert Franks, ich schulde sie noch immer und ich besitze sie nicht mehr!
Wie ein Feigling suchte ich mich meiner Schuld zu entledigen, aber ich habe keine Quittung darüber. In den schweren Träumen meiner Nächte wache ich schweissgebadet auf, werfe mich auf die Knie und rufe laut: »Herr! Herr! Wem bin ich schuldig? – Herr! Wem bin ich schuldig?« Ich weiss nichts davon, aber ich schulde. – Die Schuld, meine Herren, das ist eine nagende, beissende Sache; ich habe mir daran zu sterben erwählt. Und jetzt, was mich jetzt am meisten quält, ist, dass ich sie Dir gegeben habe, diese unseligen fünfhundert, die ich schulde, Dir gegeben habe, Kokles ... Kokles, Dein Auge gehört Dir nicht, verstehst Du, es gehört Dir nicht, weil mir das Geld nicht gehört, mit dem ich Dir das Auge bezahlt habe. »Was besitzest Du denn, das Du nicht empfangen hättest«, sagt die Schrift ... empfangen von Wem? von Wem?? von Wem?? – Ich halte es nicht mehr länger aus.
Die Stimme des Unglücklichen wurde harsch und rauh und erstickte in Glucksen, Schluchzen und Tränen. Ängstlich lauschten Prometheus und Kokles; sie hatten sich bei den Händen gefasst und zitterten. Damokles begann wieder; es schien als hätte er die Beiden gesehen:
Die Schuld ist etwas Entsetzliches, meine Herren, aber wie viel entsetzlicher noch ist die Reue darüber, dass man sich um eine Verpflichtung herumschwindeln wollte ... Als wenn die Schuld weniger existierte, wenn man sie von einem andern übernehmen lässt ... Dein Auge brennt Dich, Kokles! – Kokles!! ich bin sicher, es brennt Dich, Dein Glasauge; reiss es aus! – Und wenn es Dich nicht brennt, so sollte es Dich brennen. – Aber es gehört Dir ja gar nicht, Dein Auge ... Und wenn Dir nicht, so gehört es Deinem Bruder ... gehört es, wem nur? wem?? Wem?? –
Der Unselige weinte; er verlor den Kopf und die Kräfte; sah manchmal Kokles und Prometheus an, schien sie zu erkennen und schrie sie an:
Aber, um Gotteswillen, verstehen Sie mich doch! Ich verlange von Ihnen ja nicht die Barmherzigkeit einer Kompresse auf meine Stirne, eines Glases Wasser, einer Limonade, – aber Verstehen! Verstehen! Helfen Sie mir doch, mich zu verstehen, aus Gnade und Barmherzigkeit! – Ich habe dieses, was mir da zukam, ich weiss nicht woher, nicht von wem, von wem?? von wem?? – und eines Tages will ich mich der Verpflichtung entziehen, glaube es zu können, gehe hin und mache damit, damit! anderen Geschenke! Anderen!! – dem Kokles die Guttat eines Auges!! aber es gehört Dir das Auge nicht, Kokles! Gib es zurück, Kokles! Aber wem? wem? wem??
Kokles und Prometheus hielten es nicht länger aus und gingen.
IV
Da sieht man, sagte Kokles, als er die Stiege hinunterschritt, da sieht man, welches das Schicksal eines Menschen ist, der sich an den Leiden eines anderen bereichert.
Aber leiden Sie denn wirklich? fragte Prometheus.
Manchmal, da, an meinem Auge, sagte Kokles, an der Ohrfeige fast gar nicht mehr; das Brennen hat nachgelassen. Und ich möchte auch gar nicht, dass ich sie nicht bekommen hätte: sie hat mir meine Güte offenbart. Ich fühle mich dadurch geschmeichelt: ich bin ganz zufrieden damit. Ich muss immer daran denken, dass mein Schmerz meinem Nächsten zur Vorsehung gedient und dass die ihm fünfhundert Franks eingebracht hat.
Aber dieser Nächste stirbt daran, Kokles, sagte Prometheus.
Sagten Sie ihm nicht, dass man seinen Adler füttern müsse? Was wollen Sie? Damokles und ich, wir konnten uns nie verstehen; unsere Gesichtspunkte sind in allen Stücken die entgegengesetztesten.
Prometheus verabschiedete sich von Kokles und lief zu Zeus, dem Bankier.
Haben Sie Mitleid und zeigen Sie sich! sagte er zu ihm; oder geben Sie sich ihm auf irgend eine Weise zu erkennen. Der Unglückliche liegt in schrecklichem Sterben. Ich verstehe ja, dass Sie ihn töten, weil es Ihnen Vergnügen macht; aber er sollte doch wenigstens wissen, wer ihn umbringt – damit er sich auf diesem Wissen zur Ruhe legen könnte.
Der Müllionär antwortete: Ich will mein Prestige nicht verlieren.
V
Das Ende des Damokles war bewundernswürdig; er fand kurz vor seiner letzten Stunde Worte, die selbst dem Gottlosesten Thränen aus den Augen reissen und die Gläubigen davon bemerken machten, dass sie wahrhaft erhebend waren. Das bemerkenswerteste Gefühl, das er so wohl in diesen Worten ausdrückte, war dieses: Die eine Hoffnung will ich wenigstens haben, dass er sich damit nicht in Verlegenheiten gebracht hat.
Wer denn? fragte man.
Jener, sagte Damokles verscheidend, jener, der mir ... etwas gegeben hat.
Nein! – es war der liebe Gott, tröstete der Kellner mit Geschick. Und über diesem guten Wort starb Damokles.
O! sagte Prometheus zu Kokles, als er das Sterbezimmer verliess – alles das ist entsetzlich! Das Ende des Damokles geht mir sehr nahe. Ist es wahr, dass mein Vortrag Ursache seiner Erkrankung war?
Behaupten kann ich es nicht, sagte der Kellner, aber das mindestens weiss ich, dass das, was Sie über Ihren Adler sagten, ihn ungemein gepackt hat.
Über unsern Adler, fügte Kokles bei.
Ich war ebenso überzeugt, sagte Prometheus.
Deshalb haben Sie auch ihn überzeugt ... Sie sprachen sehr lebendig ...
Ich dachte, dass man mich gar nicht anhört ... und bestand darauf ... hätte ich gewusst, dass er mir zuhört ...
Was hätten Sie da gesagt?
Dasselbe, stotterte Prometheus.
Und?
Aber jetzt, jetzt würde ich es nicht mehr sagen.
Sind Sie denn nicht mehr überzeugt?
Damokles war es zu sehr. Ich habe ganz andere Ideen über meinen Adler.
Wo ist er übrigens?
Haben Sie keine Angst, Kokles, ich lasse ihn nicht aus dem Auge.
Adieu. Ich will Trauer anlegen. Wann sehen wir uns wieder?
Nun ... bei der Beerdigung, denke ich. Ich werde da eine Rede halten, sagte Prometheus. Vielleicht kann ich damit was gut machen. Und nachher sind Sie mein Gast beim Traueressen, in demselben Restaurant, in dem wir zum erstenmal Damokles trafen.
VI
Bei der Beerdigung waren nicht viel Leute; Damokles hatte so wenig Bekannte; sein Tod ging unbeachtet bei all denen vorbei, die sich nicht für diese Geschichte interessieren. Prometheus, Kokles und der Kellner fanden sich auf dem Kirchhof ein; und noch ein paar, die den Vortrag des Prometheus gehört und nichts zu tun hatten. Aller Blicke waren auf Prometheus gerichtet; man wusste, er würde reden; man fragte sich, »was wird er sagen?« denn man erinnerte sich an seine Rede von früher. Das Erstaunen ging aber seinem Worte voran und davon war dieses Ursache, dass man Prometheus nicht wiedererkannte, so fett und rosig war er geworden; und ein Lächeln hatte er auf den Lippen, das man fast unpassend fand; und also lächelnd trat er an den Rand des Grabes, drehte ihm den Rücken und sprach diese einfachen Worte:
Meine Herren, da Sie die Güte haben, mich anhören zu wollen, so sind die Worte der Schrift, die heute meiner kurzen Predigt als Text dienen sollen, diese:
Lasset die Toten die Toten begraben. Wir werden uns deshalb nicht mehr mit Damokles beschäftigen. – Das letztenmal, dass ich Sie um mich versammelt sah, war, da Sie mich von meinem Adler reden hörten; Damokles ist daran gestorben, lassen wir die Toten ... seinetwegen doch oder vielmehr dank seinem Tode habe ich jetzt meinen Adler umgebracht ...
Seinen Adler umgebracht!!! rief jeder aus
Bei dieser Gelegenheit eine Anekdote ... Nehmen wir an, dass ich nichts gesagt habe.
Am Anfang war Tityr.
Und da Tityr allein war langweilte ersieh, weil er völlig von Sümpfen umgeben war. – Doch da kam Menalk vorbei und setzte dem Tityr eine Idee in den Kopf, ein Samenkorn in die Sümpfe vor ihm. Und diese Idee war das Korn, und dieses Korn war die Idee. Und mit Hilfe Gottes keimte das Samenkorn und wurde eine kleine Pflanze, und Tityr kniete sich abends und morgens davor hin und dankte Gott, dass er sie ihm gegeben habe. Und diese Pflanze wurde grösser, und da sie mächtige Wurzeln trieb, hatte sie auch den Boden um sich herum völlig trocken gemacht, derart, dass Tityr einen festen Boden hatte, darauf seinen Fuss zu setzen, sein Haupt zu legen und die Arbeit seiner Hände zu festigen.
Als diese Pflanze die Höhe des Tityr erreicht hatte, konnte Tityr einige Freude daraus gewinnen, ausgestreckt in ihrem Schatten zu schlafen. Doch dieser Baum, der eine Eiche war, sollte ungeheuer gross werden; so dass die Händearbeit des Tityr gar nicht mehr genügte, die Erde um den Baum umzupflügen, zu jäten und zu entsteinen, ihn zu bewässern, von Raupen zu säubern, das Geziefer zu vertilgen und in guter Jahreszeit die oft reiche und mannigfache Ernte seiner Früchte einzuholen. Er fügte sich deshalb noch einen Pflüger bei und einen Jäter und einen Entsteiner und einen Raupenputzer und einen Geziefervertilger und einen Bewässerer und einige Obstjungen zum Früchte sammeln. Und da sich jeder genau an seine Profession halten sollte, war einige Aussicht, dass eines jeden Arbeit gut geleistet würde. Um die Löhnung eines jeden in Ordnung zu halten, war ein Zahlmeister nötig, der zusammen mit einem Kassierer sich in die Sorge um des Tityr Vermögen teilte; dieses wuchs wie die Eiche.
Einige Meinungsverschiedenheiten erhoben sich zwischen dem Geziefervertilger und dem Raupenputzer gelegentlich der gesetzten Grenzen ihrer Machtbefugnisse, und Tityr sah die Notwendigkeit eines Schiedsrichters ein, der sich mit zwei Advokaten versorgte, einen pro, den andern contra; Tityr nahm einen Sekretär, der die Urteile beider gegenzeichnete, und da man nur gegenzeichnet, damit der Akt in Zukunft Regel und Gesetz bleibe, so war auch ein Vogt nötig. Nach und nach entstanden Häuser auf dem Boden Tityrs; man brauchte eine Strassenpolizei und eine andere für die Strassenlizenz. Tityr, von Arbeiten überhäuft, wurde krank; er liess einen Arzt kommen, der ihm riet, eine Frau zu nehmen – und da inmitten so vieler Leute Tityr nicht mehr ausreichte, wurde er gezwungen, sich einen Adjunkten zu suchen, was bewirkte, dass man ihn zum Bürgermeister ernannte. Von da ab blieben ihm nur sehr wenig Stunden der Erholung, in denen er mit der Angel fischen konnte, von den Fenstern seines Hauses aus, die nach wie vor auf den Sumpf hinausgingen.
Weiter setzte Tityr Festtage ein, damit sich sein Volk amüsiere; aber da die Vergnügungen teuer waren und keiner viel Geld hatte, so begann Tityr, um es allen leihen zu können, von einem jeden Steuern zu erheben.
Aber die Eiche in der Mitte der Ebene (denn trotz der Stadt und trotz der Anstrengung so vieler Menschen blieb es doch immer die Ebene), die Eiche in der Mitte der Ebene, sage ich, bot keine Mühe, so gesetzt zu werden, dass ihre Seite im Schatten, ihre andere in der Sonne stand. Und unter dieser Eiche, auf ihrer Schattenseite, hielt Tityr Gericht; auf ihrer Sonnenseite verrichtete er seine natürlichen Bedürfnisse.
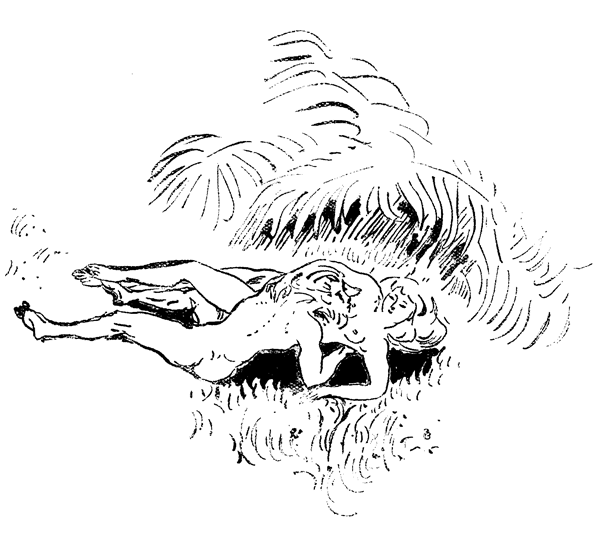
Und Tityr war glücklich, denn er fühlte sein Leben von Nutzen für die andern und ausserordentlich beschäftigt.
Des Menschen Anstrengung ist kultivierbar. Tityrs immer neu ermutigte Tätigkeit schien sich zu vermehren; sein ihm natürliches Genie schuf ihm neue Geschäfte, man sah ihn schreinern, tapezieren, seine Wohnung einrichten. Man bewunderte den Geschmack seiner Tapeten und die Bequemlichkeit seiner Möbel. Geschickt wie er war, excellierte er in allem Empirischen; so konstruierte er, um seine Badeschwämme an der Wand zu befestigen, ein kleines merkwürdiges Gestell, das er nach Ablauf von vier Tagen für ganz unpraktisch befand.
Und neben seinem Zimmer Hess Tityr ein anderes bauen, für die Interessen der Nation; die beiden Räume hatten den gleichen Eingang, um anzuzeigen, dass die Interessen dieselben seien; aber wegen dieses gemeinsamen Einganges, der beiden Zimmern dieselbe Luft gab, konnten die beiden Kamine nicht zusammenziehen, woraus passierte, dass man, an kalten Tagen, in dem einem Zimmer Feuer, in dem andern bedeutenden Rauch machte. Tityr gewöhnte sich an, sein Fenster an den Tagen zu öffnen da man heizte.
Da Tityr sich des Ganzen so annahm und für die Fortpflanzung der Gattung nicht untätig war, kam eine Zeit, da die Schnecken in den Alleen seines Gartens in solcher Überzahl promenierten, dass er aus Angst, eine zu zertreten, nicht wusste, wohin seinen Fuss setzen, was schliesslich damit endete, dass er sich auf wenigste Bewegung ausser dem Hause beschränkte.
Er liess eine Leihbibliothek mit einer Dame, die das Verleihen besorgte, kommen, und nahm ein Abonnement. Und da sich die Dame Angele nannte, wurde es ihm Gewohnheit, jeden dritten Abend bei ihr zu verbringen. Auf diese Weise lernte Tityr die Metaphysik, die Algebra und die Kosmogenie. Tityr und Angele fingen an, zusammen und mit Erfolg verschiedene gesellige Künste zu pflegen, und da Angele besonders Gefallen an der Musik zeigte, mieteten sie einen Flügel, auf dem Angele kleine Liedchen exekutierte, die Tityr von Zeit zu Zeit für sie schrieb. Tityr sagte zu Angele: So viel Arbeit wird mich umbringen; ich kann nicht mehr; ich fühle die Abnützung; diese Gemeinsamkeiten wecken meine Sorgen. Wachsen diese, so nehme ich ab.
Was tun?
Wenn wir fortgingen? sagte Angele zu ihm.
Ich kann nicht, ich nicht: ich habe meine Eiche.
Wenn Du sie liessest, sagte Angele.
Meine Eiche lassen? Wo denkst Du hin!
Ist sie nicht gross genug, um allein weiter zu wachsen?
Aber, ich bin ja daran festgebunden.
So binde Dich los!
Und wenige Zeit später, als er herausbekommen hatte, dass alles in allem weder die Betätigungen, noch die Verantwortlichkeiten und verschiedenen Bedenken, ja nicht einmal die Eiche ihn hielten, lächelte Tityr, nahm guten Wind und reiste mit der Kasse und Angele ab; und stieg mit ihr am Abend des Tages auf den Boulevard herunter, der von der Madeleine zur Oper führt.
An diesem Abend bot der Boulevard einen merkwürdigen Anblick. Man fühlte, dass sich etwas Ungewöhnliches, Feierliches vorbereitete. Eine ungeheure, ernste und erwartungsvolle Menge schob sich hin und her, füllte die Trottoirs und flutete manchmal auf die Fahrstrasse, die frei zu halten die berittenen Polizisten grösste Mühe hatten. Die mit Tischen und Stühlen überfüllten Terrassen vor den Restaurants machten das Chaos komplett und hinderten jedes Durchkommen. Manchmal schwang sich ein Ungeduldiger auf einen Stuhl, aber nur für den Moment, in dem man ihn bat, herunterzusteigen. Alles wartete sichtlich auf Etwas; man fühlte, dass auf der freigehaltenen Fahrstrasse etwas daherkommen müsse. Mit grosser Mühe konnten Tityr und Angele einen Tisch finden, den sie um teures Geld mieteten. Den Kellner, der zwei Bock brachte, fragten sie: Auf was wartet man denn?
Woher kommt der Herr? fragte der Kellner; weiss der Herr nicht, dass man Melibeus erwartet? Zwischen fünf und sechs kommt er hier vorbei ... warten Sie und – hören Sie nicht?
Mir ist, als ob man schon seine Flöten hörte.
Vom Ende des Boulevards herauf kam das schwache Tönen einer Schalmei. Die Menge wurde noch aufgeregter. Der Ton wuchs, kam näher, wurde ganz laut.
O, wie ist das erregend! sagte Angele.
Die sinkende Sonne sandte ihre Strahlen von einem Ende des Boulevards zum andern. Und wie aus diesem Glänze sah man endlich Melibeus herankommen, dem der einfache Ton einer Flöte voranging. Anfangs sah man nichts weiter als so beiläufige Umrisse, als er aber näher kam:
O, wie reizend er ist! sagte Angele.
Als Melibeus vor Tityr gekommen war, hörte sein Flötenspiel auf und er blieb plötzlich stehen; er sah Angele, und da machte man die Beobachtung, dass er nackt war.
O! sagte Angele, indem sie sich an Tityr lehnte, wie ist er schön! wie schlank und behend sind seine Lenden! wie herrlich seine Flöten!
Tityr war ein bisschen verlegen.
Frag ihn doch, wo er hingeht, sagte Angele.
Wohin gehen Sie? fragte Tityr.
Melibeus antwortete: Eo Romam.
Was hat er gesagt? fragte Angele.
Tityr: Sie verstehen es nicht, Teuerste.
So erklären Sie mir's, sagte Angele.
Romam, fuhr Melibeus fort – Urbem quam dicunt Romam.
Angele: – O! wie ist das köstlich, was er sagt! – Was heisst es eigentlich?
Tityr: – Ich versichere Ihnen, Angele, es ist nicht so köstlich wie Sie meinen; es heisst ganz einfach, dass er nach Rom geht. – Rom! sagte Angele träumerisch – O! ich möchte so gerne Rom sehen!
Melibeus ergriff wieder seine Pfeifen und begann von neuem seine einfache Melodie; bei diesen Klängen sprang Angele ganz erregt auf, trat näher und wie gerade Melibeus seinen Arm bog, nahm sie ihn und beide zogen zusammen den Boulevard hinunter, weiter, immer weiter, bis sie sich in tiefster Dämmerung verloren.
Die entfesselte Menge benahm sich nun äusserst tumultarisch. Von allen Seiten hörte man fragen: Was hat er gesagt? – Was hat er getan? – Wer war die Frau? – Und als wenige Minuten später die Abendzeitungen erschienen, bemächtigte sich ihrer die Menge mit wilder zyklonhafter Neugier; und man erfuhr nun, dass diese Frau Angele war und Melibeus irgend ein Nackter, der nach Italien auf dem Weg war.
Als die Neugierde befriedigt war, verlief sich die Menge wie frei gewordenes Wasser und die grossen Boulevards wurden leer. Und Tityr fand sich allein wieder und vollständig von Sumpf umgeben.
Nehmen wir an, ich habe nichts gesagt.
Ein plötzlich losbrechendes Lachen schüttelte eine Weile das Auditorium.

Meine Herren, ich bin glücklich, dass meine Geschichte Sie unterhalten hat, sagte ebenfalls lachend Prometheus. Seit dem Tode des Damokles habe ich das Geheimnis des Lachens gefunden. – Jetzt bin ich am Schluss, meine Herren; lassen Sie die Toten die Toten begraben und gehen wir schnell frühstücken.
Er nahm den Kellner unter den einen, Kokles unter den andern Arm; alles verliess den Friedhof; am Tor zerstreute sich der Rest der kleinen Versammlung.
Verzeihen Sie, sagte Kokles – Ihre Erzählung war charmant und Sie haben es verstanden, uns zum Lachen zu bringen ... nur ist mir der Zusammenhang nicht klar ...
Hätte sie mehr gehabt, so hätten Sie nicht so gelacht, sagte Prometheus; suchen Sie darin nicht allzuviel Sinn; – ich wollte Sie nur ein bisschen zerstreuen und ich bin glücklich, dass es mir gelungen ist; war ich Ihnen das nicht schuldig? ich habe Sie das andere mal so sehr gelangweilt.
Sie kamen wieder auf die Boulevards.
Wo gehen wir hin? fragte der Kellner.
In Ihr Restaurant, wenn Sie nichts dagegen haben, zur Erinnerung an unser erstes Zusammentreffen.
Aber Sie gehen ja daran vorbei, sagte der Kellner.
Ich erkenne ja den Eingang gar nicht mehr wieder.
Weil er jetzt ganz neu hergestellt ist.
Ich vergass! ... ich vergass, dass mein Adler ... Aber seien Sie beruhigt: er fängt nicht wieder an.
Ist es also wahr, was Sie sagten? fragte Kokles.
Was?
Dass Sie ihn getötet haben?
Und jetzt gehen wir ihn verspeisen ... Zweifeln Sie noch daran? sagte Prometheus und haben Sie mich denn nicht angesehen?
Hätte ich mich sonst zu lachen getraut? – Und war ich nicht schrecklich mager?
Das waren Sie wahrhaftig.
Es frass mich schon lang genug; ich fand, dass nun die Reihe an mir ist. – Zu Tisch, meine Herren, zu Tisch! – Kellner ... bedienen Sie nicht: nehmen Sie, ein letztes Zeichen der Erinnerung an ihn, den Platz des Damokles ein.
Das Mahl war lustiger als es hier zu erzählen erlaubt ist, und der Adler wurde delikat gefunden. Beim Dessert trank jeder der Drei auf die Gesundheit des Adlers.
War er denn zu gar nichts gut? fragte man.
Sagen Sie das nicht, Kokles! – sein Fleisch hat uns gespeist.
Wenn ich ihn fragte, gab er keine Antwort ... Aber ich esse ihn ohne irgend ein Gefühl des Grolles: hätte er mir weniger Schmerzen bereitet, so wäre er weniger fett geworden; und weniger fett hätte er uns weniger gut geschmeckt.
Was bleibt von seiner ehemaligen Schönheit?
Ich habe mir alle seine Federn aufgehoben.
Mit einer von ihnen schreibe ich dieses kleine Buch; möchten Sie es, seltener Freund, nicht gar so schlecht finden.