
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
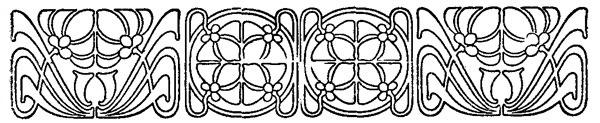
Für den Leser, der noch nicht in der Schweiz gewesen ist und das Bödeli aus eigener Anschauung kennen gelernt hat, glauben wir einige wenige Worte zur Schilderung dieses viel besuchten Ländchens voranschicken zu müssen.
Wenn je ein Stückchen Land es durch seine reizende Lage, seine Fruchtbarkeit und seine Bedeutung für die jetzige Reisewelt verdient hat, daß ihm seine ursprünglichen Bewohner einen wohlklingenden Schmeichelnamen verliehen, so ist es jener, etwa eine kleine Meile lange und breite, ebene Tal boden (davon Bödeli), der sich etwa im Mittelpunkt der Schweiz, im Berner Oberlande, zwischen den schönen Seen von Thun und Brienz befindet, und von der, beide Seen verbindenden grünschimmernden Aare durchströmt wird. Wie jene Wasserbecken aber im Westen und Osten das Bödeli begrenzen, so schließen es im Norden und Süden himmelhohe Bergketten ein, die mit ihren gewaltigen Steinwänden und noch höher hinaufragenden Gipfelspitzen, ewig weiß und glänzend vom frischgefallenen Schnee, über das liebliche Tal fortschauen und ihm seinen eigentümlichen Charakter, seine unübertreffliche Schönheit und seinen unvergänglichen Reiz verleihen.
Vor allen ist es die majestätische Jungfrau, die höchste und schönste Pyramide der Finsteraarhorngruppe, deren schimmernder Pracht dieser Erdenfleck seinen größten Glanz verdankt. Wie ein sich allmählich zuspitzender Turmbau, von zahllosen Nebentürmen gestützt und zusammengehalten, steigt sie von ihrer ungeheuren breiten Basis in den edelsten und reinsten Verhältnissen zu dem im Sonnenschein diamantartig blitzenden Gipfel empor, und damit ihre kolossale Gestalt nicht den staunenden Blick des Wanderers bedrücke und beklemme, hat die Natur vor ihrer eisgepanzerten Brust kleine grüne Bollwerke aufgepflanzt, die das Auge allmählich auf ihre Größe vorbereiten, indem sie ihre starren Felsenrippen hinter üppig grünen Waldungen verstecken und nur in gewissen malerischen Lücken die einzelnen Schneespitzen der Nebenberge der Jungfrau hervorblitzen lassen. So erhebt sie sich von der Südseite des Bödeli langsam von der Talsohle bis zu einem an 14 000 Fuß hohen Felskegel in einer, im ersten Augenblick unfaßbaren, weil wunderbar reichen und mannigfaltigen Gruppe, die immer und ewig, bei sonnenklarem Tage und sternenfunkelnder Nacht das nimmersatte Auge des Reisenden anzieht und seine Brust vor Entzücken und Staunen hoch und voll schlagen läßt.
Blicken wir uns aber in der Ebene des Bödeli selber um, so werden wir durch die mitten zwischen Felsenmauern und wogenden Gewässern ausgebreitete Fruchtbarkeit des kleinen Landes angenehm überrascht. Weitgedehnte Obstgärten, Wiesengründe, Ackerfluren und stattliche Gruppen gewaltiger Wallnußbäume bedecken es ganz und gar, und dazwischen haben sich Menschen in einem Städtchen und mehreren großen Dörfern wohlweislich angebaut, ohne im Anfang ihrer Niederlassung eine Ahnung zu haben, daß dieselbe einst der Mittel- und Zielpunkt Tausender von Reisenden aus allen Nationen und Weltgegenden werden würde.
Das Städtchen ist das schon oft genannte Unterseen, zunächst dem Thuner See gelegen, und von seinem östlichen Ende führt ein breiter Weg, mit uralten, reichbelaubten Kastanienbäumen eingefaßt, nach dem Hauptorte des Bödeli, dem reizenden Interlaken, einem paradiesischen Dorfe und allmählich aus einem Kloster entstanden, das seinen Ursprung längst verschollenen Mönchen verdankt, die zu allen Zeiten und an allen Orten die Schönheiten der Welt zu schätzen und den Vorteil, den sie daraus ziehen konnten, zu nutzen wußten.
Aber auch die späteren Generationen haben es sich nicht entgehen lassen, die reizende Lage des Ortes nach Kräften auszubeuten. Spekulation, im Bunde mit Kunst- und Geschmackssinn, haben es verstanden, aus dem ehemaligen schlichten Dorfe eine Kolonie zu schaffen, die mit ihren strahlenden Palästen und komfortablen Wohnhäusern weithin ihresgleichen sucht und kaum noch eine Spur von ihrer einstigen Einfachheit und Genügsamkeit auffinden läßt. Hierher pilgern denn von allen Seiten die Müden und Schwachen, aber auch die Gesunden und Lebenslustigen aller Völker Europas. Aus den kalten Steppen Rußlands, von Norwegens Fjorden, aus dem romantischen Hochlande der Schotten, aus Londons überfüllten Straßen wie aus dem rauschenden Paris, ja selbst aus Spaniens und Italiens schönen Fluren wandern Menschen jeden Alters und Geschlechts hierher, und Reiche wie weniger Bemittelte finden Unterkommen und Pflege, je nachdem ihr Beutel es ihnen gestattet oder ihre mehr oder minder raffinierte Genußsucht es verlangt. An luxuriöse, strahlende Gasthöfe reihen sich stille, bescheidene Pensionen, hier und da taucht noch an abgelegenen Stellen ein kleiner Privatsitz auf, und wo noch ein unbenutztes Fleckchen frei ist, nistet sich ein spekulativer Kopf ein, der fast niemals seine Rechnung umsonst gemacht hat, denn alle Jahre mehren sich die vergnügungssüchtigen Pilger, und fast alle Tage rauschen die stattlichen Dampfer beider Seen mit gefüllteren Decken heran.
An diesen reizenden Ort – wie und woher? werden wir später erfahren – war auch vor etwa sechs Jahren Doktor Marssen gelangt. Das Glück war ihm günstig gewesen, er hatte eine Niederlassung ausfindig gemacht, die seinen Mitteln und seinem Geschmack entsprach, und so lernen wir ihn jetzt als beständigen Bewohner des Bödeli kennen, das er sich als seine zweite Heimat erwählt, und worin er endlich die lange ersehnte Ruhe gefunden, die ihm seine erste so grausam versagt hatte.
Nicht weit von dem bekannten Hotel zum Jungfraublick entfernt, den Bergen näher als dem Höhewege, lag, wie wir schon gehört haben, sein gemächliches, nach Schweizer Art gebautes Haus, mit weit vorspringendem flachen Dache, die Giebel und Dachfirsten verziert mit geschnitztem Holzwerk, die äußeren Wände mit herzförmigen kleinen Schindeln bekleidet und diese mit einem goldfarbigen Firnis überzogen. So lag es zierlich und einladend mitten in einem prangenden Obstgarten, rings von Wallnußbäumen beschattet und durch eine drei Fuß hohe Weißdornhecke von seinem nächsten Nachbar getrennt, einer stillen Pension, deren Obstgarten so dicht mit dem des Arztes zusammenstieß, daß die Apfelbäume beider sich berührten und ihre Früchte sich gesellig untereinander mischten.
Der Eingang des nur ein Stockwerk hohen Hauses lag auf der schmaleren Giebelseite, an einem Nebenwege, der auf die Straße mündet, welche nach Lauterbrunnen führt. Diese, wie auch die entgegengesetzte Giebelseite, die beide ein langer, schmaler Korridor verband, auf welchen die Türen der Zimmer gingen, faßte eine breite, geräumige, mit Weinlaub reich bedeckte Veranda ein: die acht Fenster beider Längenseiten aber, nur nachts durch grüne Jalousien geschlossen, ließen durch die Lücken der Bäume nach Süden wie nach Norden ungehindert die Herrlichkeiten schauen, die sich, zu jeder Tages- und Jahreszeit, in wunderbarer Fülle und Abwechslung hier den naturliebenden Bewohnern darboten.
Eine unbeschreiblich wohltuende Stille umgab dieses in seinen äußeren Verhältnissen schon, wenn nicht elegante, doch gewiß sehr stattliche Haus. Fern vom Gewühl des rastlosen Treibens in Interlaken selbst, störte seine Ruhe kein Mißlaut, kein Lärm, denn die gewaltigen Donnerstimmen der Natur, die sich von den Eisfeldern der Jungfrau her bei Tage und zumeist des Nachts vernehmbar machten, störten die friedlichen Bewohner nicht; ihnen lautete das Fallen und Brechen der Schneelawinen und der Wiederklang ihres Getöses an den Felswänden wie eine trauliche Musik, die sie nicht oft genug hören konnten, und selbst wenn Doktor Marssens Ohr in der Nacht das krachende Gepolter vernahm, fühlte er sich heimisch und wohl in seinem Bett, denn er sagte sich, daß der nur schwache Mensch der Ruhe und des Schlafes bedürfe, daß der große Weltgeist da draußen aber ewig wachen und tätig sein müsse, um fort und fort zu schaffen und zu wirken an der urewigen Arbeit seiner Schöpfung und die Gesetze buchstäblich sich erfüllen zu lassen, die er den erzeugenden und zerstörenden Kräften der Natur vom unabsehbaren Anfang an bis zum unabsehbaren Ende unwiderruflich vorgeschrieben hat.
Dieses stille und abgelegene Haus nun, das fast unter der Fülle der es umgebenden Blätter verschwand, war dennoch nicht der Aufmerksamkeit der ständigen Bewohner des Ortes entgangen. Früher freilich war es als schmuckloses Privathaus ziemlich unbeachtet geblieben, seitdem es aber Doktor Marssen bewohnte, hatte es für die nähere und fernere Umgebung einen bei weitem höheren Wert erhalten. Obgleich nämlich Doktor Marssen, wie wir bereits aus seinem eigenen Munde wissen, nicht als Arzt und um dem Berufe eines solchen zu leben, nach Interlaken gekommen war, so hatte sich doch sehr bald von dem kleinen Kreise seiner Hausgenossen und Diener aus die Kunde verbreitet, daß er geschickt in der Heilkunst und sehr erfahren in der Anwendung heilsamer Kräuter sei. Verschiedene Unglücksfälle in der nächsten Umgebung und einige plötzliche schwere Erkrankungen, denen er zufällig seine Beachtung schenkte oder zu denen er freiwillig ging, weil er vernommen, daß augenblicklich kein anderer Arzt gegenwärtig sei, hatten seine Kunst und sein Vertrauen erweckendes Verfahren am Krankenbett bald in den Mund der Leute gebracht, und so kam es, daß er schon im Laufe des zweiten Jahres seines Aufenthaltes im Bödeli häufig von Kranken verlangt wurde, die gerade von seinem Rat eine besondere Hilfe erwarteten. Willig und gern unterzog er sich diesen Anforderungen, seine ihm angeborene Menschenfreundlichkeit wie das Interesse für seine Wissenschaft nötigten ihn in gleicher Weise dazu, und da er, wie bekannt, nicht des Verdienstes oder Gewinnstes wegen seine Besuche machte, blieb er mit den in Interlaken ansässigen Ärzten stets auf gutem Fuße, und niemand lebte in der Nähe, der mit neidischen oder vorwurfsvollen Augen auf den still wirkenden Mann geblickt hätte.
Allein noch ein anderer Umstand oder vielmehr eine andere Person trug dazu bei, das Haus des Doktor Marssen in einen gewissen Ruf zu bringen, so daß ihm viele schon im stillen den Namen »das Hospiz« beilegten, und das war die unverheiratete Schwester des Arztes, die ihm das Hauswesen führte, in jeder Beziehung in Übereinstimmung mit ihm lebte und alle seine Neigungen teilte, mochten sie die Wissenschaft oder die Natur in ihrem großen und kleinen Walten betreffen. Sehr bald hatte sich die Kunde von der Milde, dem Wohltätigkeitssinn und dem echt weiblichen Herzen dieser Dame in der Umgebung verbreitet, und da sie zu jeder Stunde arme Kranke mit einem Heilmittel zu versehen, Hungrige zu speisen oder überhaupt Hilfsbedürftige zu unterstützen bereit gefunden wurde, so hatten groß und klein, alt und jung sie aus ähnlichen Gründen wie ihren Bruder liebgewonnen, und die beiden einsam lebenden Menschen sahen sich ohne ihr Zutun in eine Tätigkeit versetzt, die ebenso ihr eigenes Gemüt befriedigte, wie sie andern eine nicht zu verkennende, aber auch nirgends geläugnete Wohltat war.
*
Die Schwester hatte den Bruder in der letzten Hälfte des verflossenen Tages mit wachsender Unruhe erwartet. Er war lange vor Tagesanbruch bei ungünstigem Nebelwetter fortgeritten und konnte, wenn keine ungewöhnlichen Verhältnisse vorlagen, mit Beginn des Nachmittags längst von Mürren zurück sein. Wenn sie auch daran gewöhnt war, ihn tagelang zu entbehren, falls er, wie oft geschah, mit einem zuverlässigen Begleiter einen kühnen Berggang unternahm, so war sie dann doch stets auf eine längere Abwesenheit vorbereitet worden; ein einfacher Krankenbesuch in Mürren aber, und weiter lag ja nach ihrer Meinung nichts vor, der am Nachmittag des Tages noch nicht beendet war, schien ihr bei dem gewöhnlichen schnellen Reiten des Bruders doch zu lange zu dauern, als daß sie nicht irgend eine Befürchtung wegen des bösen Weges den Schiltberg hinauf und hinab hätte hegen sollen. Daß der Bruder, da er einmal unterwegs war, den Aufenthalt in Mürren zu einem weiteren Ausfluge benutzen könnte, das anzunehmen, lag ihr fern, denn das tat er niemals, ohne es vorher zu sagen, um sie bei ihrer bekannten Reizbarkeit nicht in unnötige Unruhe zu versetzen.
Den trüben Morgen des Tages, denn die Nebel der Berge waren auch bis ins Bödeli hinabgestiegen, hatte sie dazu benutzt, das ganze Haus und namentlich die beiden Zimmer, die der Hausherr bewohnte, mit ihrer gewohnten Ordnungsliebe in den Zustand höchster Sauberkeit zu versetzen, da sie ja wußte, wie lieb ihm selbst Ordnung und Reinlichkeit in allen Dingen war. So sah denn alles blank und glänzend in dem freundlichen Wohnzimmer aus, das mit dem Schlafkabinett nach dem südlichen Gebirge hin lag; die Gläser der schönen Kupferstiche und Aquarellen, sämtlich ausgezeichnete Schweizerlandschaften darstellend, blitzten, ebenso die modernen Möbel von dauerhaftem Nußbaumholz. Jeder Sessel, jeder Stuhl behauptete seinen Platz, jedes aufgeschlagene Buch auf dem großen Schreibtisch hatte seine richtige Stelle wieder eingenommen, wie es der im Hause stets studierende Mann hingelegt, und was sonst noch zu seiner Bequemlichkeit vorhanden war, stand und lag bereit, seinem Auge wohlgefällig und seiner Hand erreichbar zu sein.
Von mittag an aber, wo sie längst mit ihren häuslichen Verrichtungen zustande gekommen und das einfache Mahl für den Rückkehrenden vergebens bereitet war, begann ihre Unruhe, und da er immer noch nicht kam, ging dieselbe in den späteren Nachmittagsstunden in Besorgnis über, so daß sie es nicht mehr im Hause, kaum noch in dem kleinen Blumengarten aushielt, der sich dicht um das Haus zog. Gegen sechs Uhr endlich, gerade als Doktor Marssen mit seinem Patienten in Beausite angekommen war und ihn zu Bett brachte, ging sie eilfertig die Straße nach Lauterbrunnen hinab, als sie aber den so sehnlich Erwarteten auch da nicht wahrnahm, kehrte sie mit höher schlagendem Herzen in das Haus zurück und befahl der Magd, das Abendessen jeden Augenblick bereit zu halten und den Tisch vor der Haustür unter der Veranda zu decken, wo man gewöhnlich an stillen warmen Abenden das Nachtessen einzunehmen pflegte.
Als die junge Magd, in der Oberländer Tracht einhergehend, die einer wohlgewachsenen Person immer so vorteilhaft steht, in das Zimmer von Fräulein Karoline trat und meldete, daß der Tisch gedeckt und alles Erforderliche bereit sei, begab sich letztere selbst nach der Veranda, um die letzte ordnende Hand anzulegen, und hier, während sie mit ihren feinen Fingern bald dieses, bald jenes Gerät zurechtrückt, haben wir die günstigste Gelegenheit, einen Blick auf ihre Gestalt und ihr Gesicht zu werfen, um die angenehme Persönlichkeit der fürsorgenden Hausfrau dem Leser auch von dieser Seite näher zu führen.
Karoline Marssen zählte fast fünfzig Jahre, sah aber, wie ihr Bruder, um zehn Jahre jünger aus. Sie war schlank gewachsen und eher groß als klein zu nennen. Gekleidet war sie in ein dunkelbraunes, leichtwollenes Gewand, das ihr bis an den Hals hinaufging, die Taille eng umschloß und eine Büste zeigte, deren noch immer schöne Formen eine bedeutendere Jugendlichkeit verrieten, als die Inhaberin sie wirklich besaß. In ihren Bewegungen war sie zwar rasch und entschieden, wie der Doktor, aber sie führte sie mit ungleich größerer Anmut aus, wie sie dem weiblichen Geschlecht leider nicht immer von der Natur vergönnt ist.
Einen ebenso vorteilhaften Eindruck, wie ihre Gestalt, machte auf den Beschauer der feine Kopf und das kluge, wenngleich bleiche Gesicht, das offenbar das Gepräge eines tiefen stillen Leidens trug, welches mehr geistiger als leiblicher Natur zu sein schien. Die blonden Haare trug sie ganz einfach in kaum die äußeren Augenwinkel berührenden glatten Scheiteln, und da sie noch üppig und reich wie in ihrer Jugend waren, bedurfte sie keiner sonstigen verschönernden Kopfverzierung, wenn wir nicht einen kleinen netzartigen Schleier dazu rechnen, den sie über die hinteren Flechten zu schlagen pflegte und bis in den wohlgerundeten Nacken herabhängen ließ.
Mit jener mattbleichen Hautfärbung stimmte der sanfte Ausdruck des ganzen Gesichts überein, und namentlich aus den hellblauen, verständigen Augen schimmerte ein tiefes, inniges Gefühl, aber von einem festen Willen, den besonders die häufig zusammengepreßten Lippen verrieten, gleichsam im Hintergrund gehalten, als bemühe sich Karoline, dasselbe zu verhüllen, oder als gebe es eine dunkle geheime Gewalt in ihrer Seele, die es nie zum Durchbruch habe kommen lassen wollen.
Außerdem hatte sie den Ausdruck der Güte und Menschenfreundlichkeit, den wir schon an ihrem Bruder gerühmt, mit diesem gemein, und hierin bestand wohl die größte Ähnlichkeit zwischen beiden, da die männlichen und entschlossenen Züge des Arztes bei weitem charakteristischer entwickelt waren und sein gewichtiges Studium, seine von jeher ernsten Beschäftigungen, und vor allem eine viel höhere Intelligenz denselben ein bedeutenderes Gepräge verliehen hatten, als das ruhige Nachdenken es einer Frau, die eben im Nachdenken ihre süßeste Beschäftigung findet, jemals zu geben imstande ist.
Im ganzen also besaß Tante Karoline, wie sie von den Hausgenossen gewöhnlich genannt wurde, eine angenehme und Vertrauen erweckende Persönlichkeit, und wenn der bisweilen etwas stark hervortretende leidende Zug um den Mund und um die sanften, fast melancholisch blickenden Augen nicht gewesen wäre, der einen Kenner weiblicher Physiognomie hier sehr bald auf ein verfehltes Jugendleben schließen ließ, so würde der Eindruck, den sie auf den Beschauer machte, ein entschieden wohltätiger und zufriedenstellender gewesen sein. –
Als an dem zierlich besorgten Abendtische nichts mehr zu ordnen und zu regeln war, trat Tante Karoline von dem zwei Stufen hohen Balkon unter der Veranda herab und schritt seufzend und kaum noch ihrer Besorgnis Herr in den dicht belaubten Garten, und nachdem sie auch hier keine Beruhigung gefunden, ging sie langsam und fest unwillkürlich auf die Straße hinaus, die nach Unterseen führte.
Die Sonne war in diesem Augenblick schon so tief gesunken, daß sie von dem Garten aus nicht mehr sichtbar war, nur füllten ihre schrägen Strahlen noch die ganze Gegend mit einem allmählich ermattenden Lichte an, und auf den höchsten Kuppen der Schneeberge begann sich eine sanfte Rosenfarbe zu zeigen, die wie ein lieblicher hauchartiger Schatten erschien, der immer länger, breiter und dunkler wurde und zuletzt alle sichtbaren Gipfel wie mit glühender Lohe bemalte.
Von dem prachtvollen, nicht gar zu häufig sich zeigenden Naturbilde lebhaft angezogen, wollte die einsame Dame eben ihre Blicke tiefer in die unermeßlichen Schneefelder der Jungfrau senken, als sie plötzlich zu ihrer freudigen Überraschung das wohlbekannte Schnauben des wackeren Rappen vernahm. Doch gleich darauf blieb sie erstaunt stehen, denn sie bemerkte, daß ihr Bruder von Unterseen und nicht von Lauterbrunnen her kam: bevor sie sich aber noch selbst darüber eine Meinung abgelegt, trabte der Rappe stolz an sie heran, und gelenkig wie er war, schwang sich der Bruder sogleich aus dem Sattel, den lauten Zuruf der Schwester mit herzlichem Gegengruß erwidernd.
»Leo!« rief sie, des Bruders dargereichte Hand hastig und warm drückend, worauf beide ohne Zögern der nahen Veranda zuschritten und es dem Rappen überließen, sich in Abwesenheit des Knechtes seinen Stall selbst zu suchen, »Leo, ich habe mich recht geängstigt. Du bleibst so lange aus, wie nie; hat dein Krankenbesuch den ganzen Tag fortgenommen?«
»Den ganzen Tag, Karoline, ja!« erwiderte der Bruder und ließ seinen gewichtigen Körper auf einen Stuhl nieder, der am Tische unter der Veranda stand. »Ja, den ganzen Tag hat er mir genommen, und er hätte leicht noch mehr Zeit in Anspruch nehmen können. Aber ich bin zufrieden, daß ich hier bin, und ebenso froh, daß ich dich wiedersehe.« Und dabei nahm er seinen Strohhut vom heißen Kopf und trocknete sich die Stirn mit einem seidenen Tuche ab.
»War es denn ein so schwerer Fall?« fragte Karoline weiter, »und wer ist der neue Patient?«
Doktor Marssen berichtete Namen und Stand desselben, erzählte die Art und Weise seines Unfalls und fügte schließlich die jüngst in Beausite erlebte Szene hinzu, die ihm hierbei wieder lebhaft in Erinnerung kam.
»Das muß ja schrecklich für die arme Frau gewesen sein!« fuhr die Schwester fort, der das Mitgefühl schon Tränen zu erpressen begann. »Ach, nun kann ich mir dein langes Ausbleiben sehr gut erklären. Aber hat sich der Herr denn schwer verletzt?«
»Nun, wenn nicht gerade schwer, doch ernstlich genug. Der ganze Körper ist ihm fast zerschunden, Kopf und Gesicht haben tüchtige Schrammen davongetragen, das schlimmste aber hat er an den Extremitäten erlitten. Der linke Fuß ist im Gelenk arg gequetscht und der linke Arm über dem Ellbogen gebrochen. Das ist alles, Karoline.«
»Mein Gott, das ist genug, denke ich. Aber du wirst ihn doch wieder herstellen?«
»Mit Gottes Hilfe ohne Zweifel; ich habe schwerer Verletzte vortrefflich genesen sehen. Nur den Arm wird er auf seiner Vergnügungsreise dieses Jahr nicht gebrauchen können.«
»Der arme Mann! – Aber nun, da ich ihm doch nicht helfen kann, laß mich an dich denken. Du bist müde?«
»Ja, herzlich!«
»Und hungrig?«
»Tüchtig, laß mich bald essen und füge meiner gewöhnlichen Portion Milch und Brot auch noch etwas Fleisch hinzu.«
»Gern, gern, das Abendbrot ist auf der Stelle bereit. Soll ich dir auch eine Flasche Burgunder heraufholen lassen?«
»Allerdings, meine Liebe, und du wirst hoffentlich ein Glas mit mir auf die baldige Genesung des armen Senators trinken.«
Karoline hatte die Veranda schon verlassen, und wenige Minuten später trug die flinke Magd das begehrte Essen herbei, und zugleich brachte die Tante selbst eine bestäubte Flasche alten Burgunders, die sie mit eilfertiger Hand entkorkte, worauf sie ein schönes Kelchglas mit dem blutroten Weine füllte.
Doktor Marssen sprach zuerst mit langem Zuge dem feurigen Getränk zu, dann griff er rasch nach der Fleischspeise, ohne in den ersten Minuten ein Wort zu sprechen, vielmehr überließ er sich ganz seinem gesunden Appetit, wobei seine langsam mitessende Schwester ihn liebevoll ansah, ihm eine Schüssel nach der andern zureichte und das bald geleerte Glas von neuem füllte.
Da machte der mit sichtbarem Behagen Essende endlich eine kurze Pause, lehnte sich in seinen Stuhl zurück, und während die Magd eine Lampe auf den von Weinlaub dunkel beschatteten Tisch stellte, sagte er: »Ah, es schmeckt mir trefflich, Karoline.«
»Ich glaube es, du hast auch dein Abendbrot wohl verdient.«
»Ja, freilich; aber nun sprich du und erzähle mir, wie du den Tag zugebracht hast.«
»Wie immer, mein Lieber. Doch nein, nicht ganz wie immer. Ich habe deine Abwesenheit benutzt, um das Oberste zu unterst zu kehren.«
»Will aber hoffen, daß alles wieder auf seinem Platze steht –«
Karoline lächelte dem ebenfalls lächelnden Bruder freundlich zu, der den Reinigungseifer der Schwester schon aus Erfahrung kannte. Darauf begab er sich zuletzt an seine Lieblingsspeise, einen Teller mit duftenden Waldbeeren, und unterdessen erzählte sie ihm, wie sie den Tag verbracht und zuletzt ihn sehnlich erwartet habe.
Als sie mit ihrer kurzen Erzählung fertig, war auch der Essende mit der Speise zu Ende gekommen. Er lehnte sich gemächlich im Stuhl zurück und, bereits nach der Zigarrentasche greifend, fragte er wie zufällig:
»Briefe sind wohl nicht angekommen?«
Es entstand eine Pause, die, so kurz sie war, dem aufmerksamen Hausherrn nicht entging, der auch sogleich den Kopf erhob, die schon ergriffene Zigarre beiseite legte und seine Schwester fragend anblickte.
»O doch!« sagte sie endlich mit merklicher Befangenheit und, wie es schien, innerer Selbstüberwindung. »Aber es ist nur ein Brief gekommen.«
»So. Nun, ein Brief ist oft besser als zehn. Woher und von wem ist er?«
Karoline wandte das bleiche Gesicht etwas vom Bruder ab und dem Schatten zu, als suche sie irgend etwas; dann sagte sie leise, vielleicht um das Erbeben ihrer Stimme weniger hörbar werden zu lassen: »Er ist aus Hamburg, Leo, und, wie mir scheint, von deinem guten Freunde, dem Bankier Eversen. Ich will ihn holen, er liegt schon auf deinem Schreibtisch.«
Sie verließ den gedankenvoll vor sich hinblickenden Bruder leise wie ein Schatten, und ebenso leise und den Brief schweigend auf den Tisch legend, kam sie nach kurzer Zeit wieder.
Doktor Marssen nahm den Brief auf, betrachtete Adresse und Siegel und nickte stumm mit dem Kopfe. Dann brach er das Siegel und zog den aus zwei Bogen bestehenden Inhalt heraus. In diesem Augenblick hatte sich Karoline wieder entfernt, um die Magd zum Abtragen des Tisches zu veranlassen, und das war zu rechter Zeit geschehen. Denn kaum hatte Doktor Marssen den ersten Bogen aufgeschlagen, so las er:
»Diese Zeilen sind für dich allein geschrieben, guter Leo!«
Und sich rasch umblickend, ob auch die Schwester sein Tun nicht bemerkte, faltete er das engbeschriebene Blatt zusammen und steckte es hastig in seine Brusttasche. Als Karoline gleich darauf wieder zu ihm trat, fand sie ihn unbefangen den Brief des Freundes lesend, der wider ihr Erwarten sehr kurz war.
Bald hatte sich auch der Leser mit dem Inhalt vertraut und legte nun das Blatt vor sich auf den Tisch, ohne daß seine Schwester das geringste Verlangen hätte blicken lassen, zu erfahren, was in den Zeilen enthalten sei. Sie saß dem Bruder gegenüber, strickte an einem Strumpf und warf erst nach geraumer Zeit, da Leo schwieg, einen Blick nach dem offenen Schreiben, wobei sie sich versicherte, daß die Zeilen wirklich nur eine Seite bedeckten.
»Nun,« begann sie zu reden, »du bist ja so still? Und Herr Eversen hat sich ja diesmal sehr kurz gefaßt?«
»Er wird mir nichts langes und breites zu sagen haben, und der Mangel an Raum ist unter Umständen ganz erwünscht, denn das Neue ist selten gut. Willst du aber nicht wissen, was er in diesen Zeilen schreibt? Sie betreffen am meisten dich selber.«
»Ich kann es mir denken, es wird die alte, halbjährig sich wiederholende Geschichte sein.«
»Die Geschichte!« wiederholte der Bruder sinnend. »Ja, die alte Geschichte, hm! Du hast es erraten,« fuhr er lebhafter fort. »Eversen teilt mit, daß er die Zinsen deines Kapitals am ersten dieses Monats erhoben und wieder wie sonst zum Kapital geschlagen. Übrigens könntest du jede beliebige Summe zu jeder beliebigen Zeit von ihm oder irgend einem Bankier in Bern durch Wechsel auf ihn beziehen. Brauchst du Geld?«
Die Schwester sah ihn verwundert, ja, halb erschrocken an, dann wurde sie, eine bei ihr sehr ungewöhnliche Erscheinung, dunkelrot. »Wozu sollte ich Geld gebrauchen?« fragte sie mit fast heiser gewordener Stimme. »Heute so wenig wie früher, und künftig so wenig wie heute –«
»Das kann man nicht wissen!« versetzte der Doktor sehr ernst. »Und wie lange soll das viele Geld denn unbenutzt – von niemandem benutzt – tot daliegen, wie? Mach' ein Ende, Karoline, und entschließe dich zu irgend etwas. Dein langes Zögern, einen vernünftigen Entschluß zu fassen, wird peinlich, dir selbst am meisten, ich sehe es –«
»Leo!« bat Karoline mit zärtlich ihn anblickendem Auge und streckte dem Bruder die Hand bittend über den Tisch entgegen.
Er legte seine Rechte in die ihre und drückte die Linke mit einem bedeutsamen Blick gegen seine Lippen, worauf er sagte: »Still, ich schweige schon. Doch – ich mag nicht von allen Dingen und Personen schweigen – so will ich denn von anderen reden, was du gewiß lieber hören wirst. Ja, Karoline, ich habe heut auf dem ganzen Wege, als ich die schönen Felsen und Wasserbäche sah, recht lebhaft an Franz gedacht, und wenn nur solches begegnet, dann folgt in der Regel die Erfüllung meiner bescheidenen Wünsche. Ich entbehre den Jungen gerade jetzt ganz außerordentlich und wünschte, er wäre erst von seinem Kunstausfluge nach den Eisfeldern des Montblanc wieder zurück.«
Karoline blickte rasch und freudig empor, so daß man sah, wie wohl ihr die Wandlung des Gesprächs tat. »Jawohl,« sagte sie lebhafter als zuvor, »je eher er kommt, um so lieber soll er auch mir sein. Sein Zimmer steht zu seinem Empfange bereit, und sein kleines Atelier läßt in seiner Anordnung nichts mehr zu wünschen übrig.«
»Das glaube ich, dafür wirst du schon gesorgt haben – er ist ja dein Liebling. Und doch weiß ich eigentlich nicht, wer den braven Jungen, meinen einzigen Sohn, lieber hat, du oder ich. Und das verrät sich am meisten in meiner Sorge um ihn.«
»In deiner Sorge? Wie soll ich das verstehen?«
»Ja, in meiner Sorge. Ich denke an seine Gesundheit und an die Rastlosigkeit in seinen künstlerischen Bestrebungen. Kein Wesen in der Welt, selbst das begabteste nicht, darf seine Fähigkeiten zu rasch entwickeln, ohne Schaden an irgend einem leiblichen oder geistigen Organ zu nehmen. Und Franz hat sich von Kindheit an in allem und jedem zu rasch entwickelt. Zuerst in seinen leiblichen Verhältnissen, dann in seinen geistigen Studien, zuletzt in seiner schönen, von ihm über alles geliebten Kunst. Ich habe in den letzten Jahren, je höher man seine Leistungen zu schätzen begann, eine wahre Angst um ihn ausgestanden. Er ist mit sechsundzwanzig Jahren zu jung, um schon den Ruhmesgipfel zu erreichen, nach dem er, ohne sich je genug zu tun, ohne Halt und Rast jagt, wie von einer inneren Furie getrieben.«
»Oho! So arg ist es doch wohl nicht!« schaltete Karoline besänftigend ein.
»Vielleicht nicht ganz so arg, mag sein. Aber zu hastig strebt er mir doch vorwärts. Wenn ich ihn erst hier habe, soll er einmal ruhen, denn auch die wichtigste Arbeit muß durch ein zweckdienliches System der Ruhe geregelt werden. Je größer sein Talent ist – und darin stimmen ja alle Kenner überein – umsoweniger darf er es abnutzen, ohne den Verbrauch von außen her zu ersetzen. Er soll mir also nicht tagelang und den ganzen Tag ohne Unterlaß an der Staffelei sitzen, wie sonst, hinaus in die Berge soll er, in die frische, kalte, belebende Luft, mit mir, ohne mich, mit wem er will, mir ist es einerlei, aber er soll, – wahrhaftig, er soll es nicht – seine ganze Jugend versitzen, wie er bisher getan.«
»Er kommt ja eben erst aus den Bergen und aus einer hübsch kalten Luft, denke ich!« entgegnete die Schwester lächelnd.
»Ja, freilich, aber glaubst du denn, daß er da die Augen zu seinem Vergnügen aufgemacht und mit allen Poren den stärkenden Äther eingesogen hat? Nur um seine Skizzenblätter zu füllen, hat er sie aufgemacht, und von der eigentlichen Welt, außer der, die sein Auge wahrnimmt, hat er nichts, gar nichts gesehen.«
»Nun, mit diesen seinen Augen die Dinge zu sehen, wie sie sind, das ist ja gerade sein höchstes Vergnügen, lieber Leo, darin findet er ja nur allein seinen irdischen Genuß.«
»Ja doch, ich weiß es, aber man muß in allen Dingen Maß und Ziel halten. Er soll Friedrich Lessings Worten glauben, der ihm voriges Jahr geschrieben: »Ruhe, Franz, keine Überstürzung! Wenn Sie sich noch etwas Ruhe aneignen können, haben Sie alles, was ein großer Maler und Künstler der Jetztzeit besitzen muß, denn alles übrige, wenigstens die Anlagen dazu, hat Ihnen in reichlichem Maße die Natur verliehen.«
Die Schwester lächelte überglücklich. »Ich weiß wohl,« sagte sie »daß sein Lehrer und sein Freund Lessing, der große Lessing, ihm das geschrieben hat, aber der, scheint mir, ist auch seine eigenen Wege gegangen, ist seinem Naturell gefolgt, und daran hat er gewiß gut getan, er sollte also auch andere die ihrigen gehen lassen.«
»O gewiß, gewiß, Karoline, versteh' mich nur recht. Aber einen guten Rat muß er von einem Meister immer annehmen, ich stelle mich in diesem Punkte ganz auf dessen Seite. Mir ist es wahrhaftig nicht gleichgültig, daß mein Sohn sich frühzeitig zu einem geachteten Manne macht: aber auf Kosten seiner Gesundheit soll er es nicht, nein, gewiß nicht. – Was gibt es, Resi?«
Diese Worte richtete er an die Magd, die soeben vom Garten her unter die Veranda trat.
»Herr Doktor,« sagte sie, »es ist soeben ein Bote aus den Bergen gekommen, der des jungen Herrn große Mappe und einen Brief bringt und Sie gleich sprechen möchte.«
Doktor Marssen wie seine Schwester sprangen von ihren Sitzen wie elektrisiert in die Höhe. Ersterer aber rief frohlockend: »Der Wolf in der Fabel! Wahrhaftig, das alte Lied! Laß den Mann heraufkommen, sogleich, Resi!«
Der Bote war so schnell bei der Hand, daß die Geschwister kein Wort mehr über das freudige Ereignis wechseln konnten. Es war ein fremder, noch junger Mann, in der gewöhnlichen Tracht der Bergbewohner, der unter dem linken Arm eine große, vorsichtig in Wachsleinwand geschlagene Mappe und in der andern Hand einen Brief hielt, den er dem Doktor Marssen hinreichte und dann den Hut abnahm, nachdem die Magd zu ihm gesagt: »Hier, Mann, ist der Herr Doktor!«
»Woher kommt Ihr?« fragte der Hausherr eilig, aber freundlich, indem er ihm den Brief, wie Tante Karoline die Mappe abnahm.
»Ich komme vom Rhonegletscher, und zwar aus dem neuen Gasthof am Fuß desselben, wo ich der zweite Hausknecht bin. Der Herr, der diesen Brief geschrieben, hat mich gedungen, ihn hier abzugeben, und mich beauftragt, mit den Pferden und deren Führer, die sie ihm schicken werden, morgen wieder dahin zurückkehren.«
»Mit den Pferden, die ich ihm schicken werde?« fragte Doktor Marssen verwundert.
»So ließ doch nur erst den Brief,« ermahnte Karoline, »der wird dir ja besseren Aufschluß geben, als dieser Mann es kann.«
»Ja, du hast recht. Resi, nimm den Boten mit dir und laß ihn essen und trinken. Nachher will ich weiter mit ihm reden.«
Resi hatte sich mit dem Boten entfernt, und die beiden Geschwister saßen jetzt eng beieinander vor der Lampe, um den noch immer unerbrochenen Brief zu lesen. Karolinens Hände, mit denen sie nach ihm griff, zitterten, und so sagte Doktor Marssen gelassen, indem er den Brief mit seiner breiten Hand bedeckte:
»Ruhe, Karoline! Man soll jede neue Nachricht, die angenehme wie die befremdliche, ja auch die traurige, mit Ruhe lesen. So setze dich geduldig auf deinen Stuhl da und höre mir zu, ich will dir vorlesen.«
Die Schwester gehorchte sogleich, Doktor Marssen aber, nachdem er noch einen Blick auf die mit kräftiger, wiewohl flüchtiger Hand geschriebene Adresse geworfen, öffnete den Brief und las zu seiner Verwunderung, die Karoline womöglich noch in höherem Grade teilte, folgende Worte:
»Mein lieber guter Vater! Zuerst grüße ich Dich und Tante Karoline herzlich und melde Euch, daß ich ganz gesund und in fröhlicher Stimmung bin. Meine kleine Kunstreise in diesem Frühjahr ist zu Ende, und ich kehre zu Euch zurück, um hoffentlich bald eine große – Ihr wißt, wohin? – anzutreten. Es lag ursprünglich in meiner Absicht, von Chamouny direkt über Martignly, Lausanne und Bern zu Euch heimzukehren, allein ich ließ mich von dem guten Wetter und einer Anwandlung von Laune verführen, den ergiebigen Umweg über den Monte-Rosa, an den Lagomaggiore einzuschlagen und von da über den Gotthardt durch das malerische Reußtal ins Oberland einzutreten.«
»Das ist recht, das ist recht!« unterbrach sich der Vater im Lesen, und Karoline nickte beistimmend mit dem Kopfe zu. Dann aber las er weiter:
»Ganz wider Erwarten aber bin ich hier an den Rhonegletscher gefesselt worden, wo mir ein kleines Abenteuer begegnet ist, das zu hören, wenn ich zurück bin, Euch Vergnügen machen wird.«
»Ein Abenteuer?« unterbrach jetzt Karoline den Leser. »Er wird doch kein Unheil erlebt haben?«
»Bewahre! Das geht ja ganz und gar nicht aus der Einleitung hervor. Höre nur weiter, und unterbrich mich nicht!«
»Ich befinde mich augenblicklich in einer größeren Gesellschaft im neuen Gasthaus am Rhonegletscher, und das Wetter ist so bös, daß wir nicht fortkönnen und förmlich eingeschneit sind. Wir haben uns also geduldig vor Anker gelegt, wie wir vor Zeiten sagten, und warten eine Wendung zum Besseren ab. Nun aber habe ich eine Bitte, um deren Erfüllung ich, wenn es irgend in Deiner Macht steht, Dich herzlich ersuche. Sende mir Jürgen und die drei Pferde, wenn Du sie entbehren kannst (mein Schimmel wenigstens hat jetzt nichts zu tun und Tante Karoline wird ihre sanfte Fuchsstute gern auf einige Tage leihen); der Bote, der Dir diesen Brief bringt, kann ja dann mit Jürgen zugleich auf dem kürzesten Wege hierher zurückkehren.«
Doktor Marssen hielt im Lesen inne und sah seine Schwester groß an. »Was will er denn mit den drei Pferden zugleich?« fragte er.
»So lies doch nun weiter, Leo, du wirst es gewiß gleich hören.«
»Gut,« sagte der Doktor und las:
»Aber nun kommt die Hauptsache, die Euch gewiß auffallend erscheinen wird, aber sie muß ausgesprochen werden. Alle drei Pferde müssen mit guten Damensätteln versehen sein, und da nur Tante Karoline einen besitzt, so wirst Du die anderen wohl bei einem Bekannten in Interlaken leihen müssen.«
Karoline schlug die Hände zusammen und Doktor Marssen lachte laut. »Drei Damensättel!« rief sie. Der Doktor aber gebot durch einen Wink mit der Hand Stillschweigen und fuhr fort zu lesen:
»Ich zweifle keinen Augenblick, daß Du meine Bitte erfüllen wirst, wenn es Dir möglich ist, da Du immer so gütig gegen mich warst, aber wisse, ich will, sobald die Pferde auf der Grimsel eingetroffen sind, bis wohin sie nur zu gehen brauchen, mit der Gesellschaft, die ich hier gefunden, durch das Haslital nach den Reichenbachfällen gehen und von da über Brienz nach dem Bödeli zurückkehren. In der Hoffnung, daß meine Wünsche erhört werden, verheiße ich Euch eine recht umfassende Schilderung meiner Erlebnisse und freue mich schon jetzt unendlich, Euch gesund und froh wieder zu sehen.
Euer dankbarer und treuer Sohn und Neffe
Franz Marssen.«
*
Der Brief war zu Ende gelesen und den Gesichtern der beiden Geschwister, die sie jetzt längere Zeit schweigend auf einander richteten, sah man die innere Verwunderung, aber auch zugleich die Liebe zu dem Schreiber des rätselhaften Briefes an.
»Nun, das muß ich sagen,« rief der Doktor, der sich zuerst von seiner Verwunderung erholt hatte, »das scheint ein hübsches Abenteuer zu sein. Drei Pferde und noch dazu mit Damensätteln –«
»Ja, und gleich mit dreien!« unterbrach ihn Tante Karoline, die sich gar nicht fassen zu können schien.
»Nun, das ist weniger gefährlich, als wenn er nur einen verlangte, wie mir däucht,« entgegnete ihr Bruder. »Aber es müssen in der Tat interessante Damen sein, die unsern ernsten Jungen fesseln und zu solcher Galanterie bewegen können. Haha! Allein ein Vergnügen gönnen wir ihm gewiß und wollten ihn ja noch soeben wider seinen Willen dazu zwingen. Sieh, wie die Vorsehung, der wir selbst in ihr Handwerk pfuschen wollten, unserer guten Absicht zu Hilfe gekommen ist!«
»Das tut sie immer, mein Lieber, wir haben täglich Beweise davon, wenn wir die Ereignisse unseres Lebens mit aufmerksamem Geiste verfolgen. – Du wirst ihm also unsere und sein Pferd schicken, nicht wahr?«
»Natürlich, und mit den Damensätteln sogar. Jürgen soll sogleich nach Interlaken gehen. Ich weiß, wo sie zu haben sind.«
»Soll ich ihn rufen?« fragte die Tante, schon von dem Stuhle sich erhebend.
»Ja, sei so gut.«
Wenige Minuten später erschien, von dem fremden Boten begleitet, Jürgen, das Faktotum des Hauses, denn er war Pferdeknecht, Gärtner und Laufbursche in einer Person, ein kleiner, gedrungener Bursch, mit schwarzem Krauskopf und gelber Haut, aber einem intelligenten Gesicht, dessen wohlgenährte Fülle bewies, wie gut er gepflegt ward, wofür er dem Hausherrn und den übrigen Familiengliedern von ganzer Seele ergeben war.
»Jürgen,« redete ihn Doktor Marssen an, »mach dich fertig, mit diesem Manne morgen früh aufzubrechen. Auch unsere drei Pferde werden dich begleiten, und du magst sie in guten Stand zu der Reise setzen. Um morgen abend noch auf der Grimsel einzutreffen und ihre Kräfte für die Bergtour zu schonen, kannst du das erste Dampfboot nach Brienz benutzen. Bescheid weißt du, und da dieser Mann bei dir ist, wird dir die Arbeit nicht zu schwer werden. Auf der Grimsel wirst du meinen Sohn treffen und mit ihm und seiner Gesellschaft den Rückweg antreten. Zehrung für die Reise und einige Batzen für einen frischen Trunk wird dir meine Schwester geben. Das gleiche sollt auch Ihr für Eure pünktliche Bestellung erhalten, mein Freund. Nun aber geh zum Sattler Silberstein nach Interlaken, Jürgen, und borge auf meinen Namen zwei gute Damensättel nebst Zubehör, denn alle drei Pferde sollen Damen hierher tragen. Hast du mich verstanden?«
Der junge Krauskopf lächelte verschmitzt und nickte bejahend. »Das soll mir genug gesagt sein, Herr,« erwiderte er, »den jungen Herrn werde ich auf der Grimsel treffen und ihn und seine Gesellschaft gesund nach dem Bödeli zurückbringen. Es wird eine ganz hübsche Partie werden und ich freue mich darauf.«
»So geht in Gottes Namen und setzt alles in den besten Stand. Ich komme nachher noch nach dem Stall, um mich zu überzeugen, ob alles in Ordnung ist. Wenn du die Sättel hast, Jürgen, benachrichtige mich davon.«
Die beiden jungen Männer verließen die Veranda und Doktor Marssen blieb mit seiner Schwester allein. Aber sie nahmen ihren Platz am Tische nicht wieder ein, sondern spazierten nach dem Garten, über den sich bereits abendliche Dunkelheit gesenkt hatte. Hier schritten sie noch lange im traulichen Gespräch über den abwesenden Sohn und Neffen auf und nieder und tauschten ihre Hoffnungen und Erwartungen über seine Zukunft miteinander aus. Gegen zehn Uhr endlich, so lange waren sie im Garten gewandelt, kam Jürgen wieder und berichtete seinem Herrn, daß die Sättel zur Hand und alles übrige zur bevorstehenden Reise geordnet sei –
Jetzt wünschte Doktor Marssen seiner Schwester eine gute Nacht, um sich mit Jürgen nach dem Stalle zu begeben, wo er in einem benachbarten Verschlag den Boten vom Rhonegletscher schon im tiefen Schlafe fand, der von seiner weiten und anstrengenden Fußreise herzlich müde war. Nachdem er dann die Pferde besichtigt und Jürgen einige Verhaltungsregeln gegeben, trat er noch auf kurze Zeit in den Garten zurück, betrachtete den funkelnden Sternenhimmel, warf einen bewundernden Blick auf die bei Nacht in bleichem Licht strahlenden Schneeriesen und suchte dann sein Zimmer auf, nachdem er sich überzeugt, daß seine Schwester bereits zur Ruhe gegangen sei.
Doktor Marssen war in seinem Zimmer allein, einem geräumigen, mit soliden Nußbaummöbeln verzierten Gemach. Auf dem offenen Schreibpult brannte die Lampe hell und freundlich, und ringsum herrschte die tiefste Stille, die dem heute so viel beschäftigten Manne außerordentlich wohl tat. Er ließ sich auf einen vor den Schreibtisch gerückten Sessel nieder, nicht, weil die vorher geäußerte Müdigkeit ihn dazu nötigte, denn die verschiedenen aufeinander folgenden Gemütserregungen hatten ihn wieder ziemlich munter gemacht, sondern um sich seinem Nachdenken hinzugeben, welches dem geistig begabten und für das Wohl anderer sorgenden Menschen so süß und unentbehrlich ist.
»So,« sagte er nach längerem stillen Sinnen zu sich, »da wäre denn wieder ein Tag den übrigen angereiht, und ich kann mit meinem Werke zufrieden sein. Nun steht mir noch eine Unterhaltung bevor, und ich fürchte fast, sie wird von keinem so angenehmen Resultat begleitet sein, wie die eben beendete. Doch, was könnte Eversen mir aus Hamburg schreiben, was mich zu beunruhigen imstande wäre, wie? Aber daß er an mich allein einen ganzen Bogen voll schreibt, muß doch etwas zu bedeuten haben. Still, Herz, die unruhigen Zeiten sind vorüber, und du brauchst nicht mehr ungestüm und bang zu schlagen. Heraus also mit dem geheimnisvollen Boten, und was er auch bringen mag, er soll mir keine fünf Minuten meines guten Schlafes rauben.«
Und er griff rasch in die Brusttasche seines Rockes, nahm den zusammengefalteten Briefbogen heraus, schlug ihn auseinander und las ruhig folgende Zeilen, die mit einer kleinen Handschrift und vielen Abkürzungen geschrieben waren, deren Entzifferung oft einige Mühe verursachte:
»Mein lieber Leo! Ich habe schon lange keine Gelegenheit gehabt, Dir über die Vorgänge in unserm Vaterlande und die Verhältnisse einiger Personen Mitteilung zu machen, deren Handlungsweise Dir, wie mir sowohl bekannt, früher das Herz oft warm und bisweilen sogar sehr heiß gemacht hat. Wie es in den Herzogtümern aussieht, wirst Du im allgemeinen aus den öffentlichen Blättern erfahren haben, die Du ja auch, wie Du mir schreibst, in Deinem Schweizer Asyl zu lesen fortfährst. Ich kann Dir daher nur all' das Trübsal aus eigener Anschauung bestätigen, welches die Vorsehung über die armen deutschen, unter dänischer Fuchtel stehenden Lande auszugießen für gut befunden hat.
Auf den Beistand des großen Deutschlands, das, wenn Einigkeit unter den törichten Menschen herrschte, unüberwindlich und fast allmächtig in Europa wäre, hoffen wir wenig mehr, der schöne Traum ist ausgeträumt, wir sind einst zu bitter getäuscht worden. Auf die übrigen Großmächte aber hoffen wir noch viel weniger, denn Dänemark hat seine Karten zu schlau gemischt, um ihre Augen nicht blind und ihre Ohren nicht taub für unser Herzeleid gemacht zu haben. Sie, die Großmächte, betrachten uns noch immer als unruhige Köpfe, und doch sind wir nur gemißhandelte Menschen, und täglich werden wir ärger gemißhandelt, so daß das Maß menschlicher Duldsamkeit einmal überlaufen muß.
Nur eins auf der Welt kann uns retten, und dies eine steht allein in Gottes Hand. Auf zwei Augen beruht Dänemarks jetziger scheinbarer Triumph und unsere Niederlage. Schließen sich einmal diese Augen, dann tun sich vielleicht andere und gerechtere auf, und Hände erheben sich aus dem Dunkel rätselvollen Welttreibens, die jetzt noch ruhen oder sich nicht zu regen wagen. Doch bis dahin ist der Weg noch weit, und wir Elenden wandeln im Dunkeln und Trüben.
Fürs erste aber scheint der Berg des Unheils, der sich auf unsere Brust gewälzt, dem Geschicke noch nicht hoch und schwer genug zu sein. Ich habe sichere und völlig glaubhafte Nachrichten aus Kopenhagen erhalten, daß man daselbst das Maß der Schmach und des bittersten Unrechts, welches man auf uns gehäuft, noch lange nicht für hinreichend gefüllt hält, daß man – höre es ruhig an – damit umgeht, die Kette noch fester um unsere Hände und Füße zu legen, die schon mehr als schmerzlich drückt. Es bereiten sich, sagt man mir, ganz in der Stille wunderbare und fast unglaubliche Dinge vor. Man hat uns, nach gewisser Danebrogmänner Meinung, bisher nur sanft auf die Wange geklopft, jetzt erst will man uns heftig ins Gesicht schlagen, so daß uns Hören und Sehen vergehe, weil man hofft, uns damit auch mitten ins Herz zu treffen. Mit einem Wort, das himmlische kluge Ministerium hat den tollen Gedanken ausgeheckt, das Herzogtum Schleswig mit einem Schlag in Dänemark zu inkorporieren, und das scheint mit den beginnenden Wahnsinn anzudeuten, der sich schon lange in den von Dünkel und Übermut strotzenden Köpfen der Gewalthaber Kopenhagens bemerkbar gemacht hat. Denn daß dies wirklich und auf die Dauer gelingt, bezweifle ich stark. Es gibt doch wohl noch in irgend einem Winkel der Welt ein Stück Rechtsgefühl und männliche, ehrenhafte Tatkraft, und dieses wird gewiß einmal zur rechten Zeit wie eine leuchtende Flamme ausbrechen, wenn es auch jetzt nur wie ein kleines Fünkchen kaum sichtbar glimmt.
Wann der große Schlag gegen uns geführt werden soll, weiß kein Mensch, aber er soll bevorstehen; die Vorbereitungen sind getroffen, die Fanale stehen überall zum Anbrennen bereit, und die kleinen Bedenklichkeiten, die vielleicht der letzte Rest des großstaatlichen Gewissens hegt, kann ein kleiner Luftzug auslöschen, der irgendwoher anregend und aufstachelnd bläst. Du glaubst nicht, welcher Mittel und Triebfeder sich das edle Dänemark bedient, um zum Beispiel auf die Presse und die Meinung gläubiger Menschen zu wirken und so zu seinem eingebildeten Rechte zu gelangen, und wie es denkende Männer gleich Maschinen benutzt, um durch die kleinen Räder monomanischer Günstlinge das große Rad nationaler Monomanie in Bewegung setzen zu lassen.
Von unsern Verhältnissen zu den außerdeutschen Großmächten will ich nicht reden, Du kennst sie: aber daß England, das große, stolze, kluge, der menschlichen Aufklärung immer vorangehen wollende England sich selbst blendet, um das so klare Licht der Wahrheit und des gesunden Menschenverstandes nicht zu sehen – das, das macht mich schamrot über meine eigene Verblendung, denn ich habe dies für so edel gehaltene England einst geliebt.
So viel von Dänemark. Jetzt will ich von einem Menschen sprechen, der Dir Dein liebes Vaterland einst zur Folterbank gemacht hat.«
Der Lesende hielt einen Augenblick inne, hob den Kopf in die Höhe, seufzte laut und wandte sich dann wieder zu dem Blatt.
»Ich will von Deinem Pflegebruder, dem Baron Rolf Juell Wind sprechen,« las er weiter. »Du weißt, wie und auf welche Weise dies dänische Glückskind Karriere gemacht hat und daß er noch vor kurzer Zeit ein helleuchtendes Licht unter den Ratgebern der Krone war. Allein die Nemesis, die oft lange wie eine düstere Wolke über den Häuptern der Menschen schwebt, ist endlich wie ein Blitzstrahl auch auf ihn niedergefahren und – der Stern hat sich in eine kleine Funkenschnuppe aufgelöst, die mit einem lauten Krach und Knall ohnmächtig zu Boden gestürzt ist.«
»Wie,« unterbrach sich der Lesende, höchlichst erstaunt – »ist das möglich!?«
»Höre, wie das zugegangen ist,« las er wieder, »und schließe daraus auf die Stimmung in den dänischen Regierungskreisen. Der früher so radikale Deutschenfresser, der Urdäne, Rolf Juell Wind, hat aus dem Ministerium scheiden müssen, weil er dem jetzt herrschenden Winde nicht Sturm genug war, mit einem Wort – und nun lache einmal – weil er, wie man sich in die Ohren tuschelt – im Grunde genommen ein zu großer Freund der Deutschen ist, das heißt, weil er die Henkermaschinerie, die man in Arbeit setzen will, zu leiten sich geweigert hat. Damit will ich nicht behaupten, daß er seine Ansichten gewandelt und die glatte dänische Aalhaut abgeworfen hat, o nein, er ist dem herrschenden Regime vielmehr zu ehrlich, zu milde, zu gerecht, das heißt, zu wenig fanatisch, nicht dänisch genug, und will die Deutschen nicht mit Stumpf und Stiel ausrotten, wie seine Herren Kollegen es möchten.
Kurz und gut, nach langen Verdächtigungen, geheimen und offenen Angriffen von allen Seiten, hat er endlich das Feld räumen müssen, ist seines einträglichen Amtes entsetzt und hat sich, laut Befehl, nach Schleswig begeben, wo ihm irgend ein verlorener Posten noch aus purer gottköniglicher Gnade anvertraut werden soll. Wie ich aber höre, setzt der hochmütige, im Grunde aber immer geschmeidige Herr alle Segel bei, wieder in den richtigen Wind zu kommen, um vielleicht, zu halben Gnaden angenommen, durch eine diplomatische Sendung nach außerhalb seine gesamtstaatliche Abtrünnigkeit wenigstens in Kopenhagen vergessen zu machen. Wie tief gedemütigt der liebe Rolf durch alle diese Vorgänge ist, kannst Du Dir denken, umsomehr, als seine Vermögensverhältnisse nicht die besten sein sollen und das bisherige reiche Einkommen seiner Frau durch Familienmachinationen, die man nicht so genau kennt, bedeutend geschmälert sind.
Ich habe diese Mitteilungen auf einen besonderen Bogen geschrieben, weil ich Deiner guten Schwester den alten Stachel nicht noch tiefer in das Herz drücken wollte. Mag ihre wolkenlose Gegenwart ihr die stürmische Vergangenheit aus der Erinnerung gelöscht haben! Dies wünscht, Dir herzlich die Hand schüttelnd, die sich ehrliche Männer ja über das Weltmeer reichen können,
Dein Freund
R. Eversen.«
Der Lesende faltete den Brief mechanisch zusammen und legte ihn langsam auf den Tisch. Seine immer ruhige Miene zeigte auch jetzt keine Veränderung, kein Muskel regte sich in dem ausdrucksvollen Gesicht, nur sein helles Auge schien etwas umflort zu sein, als er gerade vor sich hinblickend im leisen Selbstgespräch sagte:
»Ja, daran hat er recht getan, daß er diese Mitteilung an mich allein richtete, um den alten Stachel nicht noch tiefer in ihr Herz zu drücken; er ist so schon tief genug eingedrungen und der Schmerz wühlt im stillen giftig fort und fort. – Und Rolf? Ist die Nemesis also wirklich endlich aus dem Schlummer erwacht und hat mit ihrem rächenden Finger in das goldene Leben dieses zehnfach gepanzerten Mannes gegriffen? Nun, ich freue mich darüber nicht, aber ich bekümmere mich auch nicht darum. Ich hasse ihn nicht, wie ich ihn eigentlich nie gehaßt habe, nur gleichgültig ist er mir im Laufe der Zeit geworden. Gut. Aber ich will nicht hoffen, daß er wirklich unglücklich und bedürftig ist. So wehe er mir und uns getan, ich wünsche ihm das nicht, nein, wahrhaftig nicht. Er versteht nicht zu leiden, zu entbehren, zu entsagen, wie wir es verstanden. Das bräche ihm das stolze Herz, und keinem Menschen auf der Welt, mag er sein, wer und wie er will, mag ich ein solches Unheil aufgebürdet sehen.
Aber was soll ich zu Dänemarks neuem Fortschritt in der Kunst, die Weltgeschichte zu illustrieren, sagen? Ist der Schemel Schleswigs von dem Fuße Dänemarks noch nicht tief genug in den Kot getreten? Will es ihn hineinstoßen in die Erde, ihn gleichsam begraben, wie man einen Toten begräbt? Dänemark sehe sich vor, was es tut, es ist auch sterblicher und vergänglicher Natur, und die große unsichtbare Hand da in den Wolken: Vorsehung, Schicksal, Gott, wie man will, hat nicht allein ihm das Leben und die Herrschaft der Welt gegeben. O nein, und endlich kann kommen ein Tag – o Priamus, Priamus, ich will dich nicht zitieren, aber es liegt mir etwas im Blut, was mir sagt: so oder ähnlich, wie es einst dem stolzen Troja erging, wird oder kann es auch dem stolzen Dänemark gehen. So, und nun sause zu, Rad des Verhängnisses, vollende schnell deinen zerstörenden Umschwung, denn je schneller du sausest und damit mein armes Vaterland erdrückst, um so schneller wirst du an das Ende deines Zieles laufen, denn auch dir ist ein letztes Ziel gesteckt und es wird die Zeit kommen, wo irgendwer spricht: Bis hierher und nicht weiter, Dans unsterblicher Sohn!«
Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück und senkte das Haupt auf die Brust. Dann aber erhob er sich plötzlich wieder und sagte ruhig gefaßt, ja fast freudig: »Es sind trübe Zeiten jetzt da oben, ja, aber den Trost haben wir, daß es nicht immer so bleiben kann. Einmal kommt doch die Sonne wieder und – und bringt den Völkerfrühling mit. Doch still, laß das Phantasieren, Leo, denke nicht an etwas, was geschehen kann, sondern an etwas, was geschehen wird. Und was wird mir zunächst geschehen? Etwas Angenehmes! Mein Sohn, mein Franz, mein einziges Kind kehrt in mein Haus zurück und – ich werde wieder mit ihm glücklich sein. Aber wie dann? Ja, so ist es und so muß es sein. Er kommt mir diesmal doppelt zu rechter Zeit. Ich will endlich ausführen, was ich so lange im Herzen getragen, aus Furcht, mir und ihm zugleich wehe zu tun; ich will die Spanne Zeit, die mir noch gehört, benutzen, denn auch ich bin sterblich und kann meine Augen schließen, ehe mein Mund gesprochen hat, was er hören soll. Karoline würde ihn an meiner Statt, wenn ich nicht mehr wäre, nicht so ruhig über unsere Verhältnisse Aufschluß geben, und sein Urteil könnte durch ihre Auffassung und Darstellung getrübt, ja verdunkelt werden. Nein, er soll endlich von mir allein erfahren, warum ich in diesem Lande, in diesem Hause wohne. Vermuten mag er es längst, aber vom Wissen ist er weit entfernt. Er hat von seiner Kindheit an fern vom väterlichen Hause gelebt, leben müssen, jetzt soll er den Grund davon kennen lernen, damit er nicht denke, ich sei unväterlich gegen ihn gewesen. So ist es denn beschlossen. Am ersten stillen Abend, wenn er hier bei mir sitzt, will ich ihm den Vorhang meines Lebens lüften und er soll ein Stück Menschenschicksal lebendig vor sich sehen. Dazu hat Eversens Brief mich gebracht und ich bin ihm dankbar dafür.«
Er stand vom Stuhle auf, ging einige Male mit leicht gebeugtem Kopfe im Zimmer hin und her und öffnete dann ein Fenster, durch welches die balsamische Nachtluft sogleich erfrischend hereinströmte. Wie geblendet blieb er hier stehen und blickte mit einer Art andachtsvoller Bewunderung in die Ferne hinaus, wo sich die unter dem Sternenglanz strahlende Schneemasse der Jungfrau und ihrer Nebenberge deutlich erkennen ließ. Eine Weile schaute er nach den funkelnden Lichtaugen des blauen Firmaments empor, dann sagte er still in sich, sein Nachtgebet sprechend:
»Ihr Sterne, ihr flackert und leuchtet so friedlich da oben in euren reinen Höhen! Und ihr, urewige Berge, ihr stehet so fest auf euren Granitmauern und wanket vor keinem Sturme, mag er kommen, woher er will. O gebet, was ihr so reichlich, fast in Überfülle habt, auch dem schwachen Menschenherzen – gebet ihm Frieden und gebet ihm Festigkeit und Standhaftigkeit, daß auch er seine Bahn ruhig walle und daß auch er dem Sturme trotze, von wannen er kommen mag! Vater, da oben, Allgütiger, rufe meine Seele, wann du willst, aber in meinem Hause laß immerdar, wie jetzt in meinem Herzen, den Frieden herrschen, und alle, die meinen Namen führen, laß in diese Gnade mit eingeschlossen sein. Amen!«