
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

131. Phallische Illustration einer altenglischen Ballade
Keine Auffassung über die öffentliche Sittlichkeit des Mittelalters ist irriger als die, sich unsere biederen Altvorderen »züchtig und in Ehren« in dem Sinne vorzustellen, der uns bei diesen Worten vorschwebt. Im Gegenteil, je derber und ungeschlachter wir uns das mittelalterliche Leben ausmalen, um so näher kommen wir der Wirklichkeit. Und das ist ganz folgerichtig, denn das Abendland rang sich ja eben erst aus den Urzuständen heraus. Primitiv war alles, primitiv konnte alles nur sein. Und primitiv heißt in Dingen der geschlechtlichen Moral nichts anderes als ungezügelt sein. Der Begierde waren erst die alleräußersten Schranken errichtet.
Die Weite des geistigen Horizontes bestimmt die Summe der Interessen, darum: je weiter der Horizont, um so vielgestaltiger sind des Lebens Reizungen; je enger der Horizont, um so dürftiger, auf um so weniger Gebiete sind die Möglichkeiten des Dranges, sich auszuleben, beschränkt. Eine Zeit, in der die übergroße Mehrzahl der Menschen nur eine ganz unklare Vorstellung davon hat, ob einige hundert Meilen hinter ihrem Gesichtskreis undurchdringliche Wälder sind, Gebirge sich türmen oder Ströme sich wälzen, kurzum für die die Welt rings mit Brettern vernagelt ist, – eine derart unkultivierte Zeit kann, wie schon in der Einleitung dargelegt ist, ihren Witz und ihre Interessen nur an das Allernächstliegende knüpfen, und das sind immer und überall die derb-sinnlichen Freuden. Fröhlichkeit bedeutet darum in primitiven Zeiten nichts anderes, als in roher Form dem Gaumen und den Instinkten des Geschlechtstriebes zu frönen. Es kommt hinzu, daß sich im Mittelalter das Leben jedes einzelnen meistens unter ganz barbarischen Gesetzen vollzog. Der direkte Kampf ums Dasein war hart, es gab keine Schonung und wenig Erbarmen, es herrschte ein steter Krieg aufs Messer. Das Leben des einzelnen galt wenig; heute rot, morgen tot. Überall lauerte der Tod. Als Wegelagerer, wenn man die kleinste Reise machte, als immer drohender Feind am Tore der Stadt und als steter Gast in der gesundheitsschädlichen Enge der Gassen der Städte. Einem solchen Leben entsprach naturgemäß ein zügelloses Genießen und Auskosten dessen, was die Kultur und Natur als Erholung von den lebensgefährlichen Strapazen des Daseins bot: je weniger Schranken man sich aufzuerlegen gebraucht hatte, um so schöner war es. Dadurch wurde das Essen und Trinken von selbst zum Schlemmen, die Erotik häufig zur robusten Derbheit, der Witz zur handgreiflichen Zote.
Die Beweisstücke hierfür finden sich überall sehr reichlich, sobald man sich die Mühe nimmt, bis zu den Quellen vorzudringen. Wir finden überreiche Belege in der Sprache, in der Kleidung, im privaten und gesellschaftlichen Leben, in den Ergötzungen des Tages, in der Religion, in den Rechtsanschauungen und nicht weniger reiche und drastische in der Kunst und in der Literatur. Durch alles pulsiert die Derbheit als der echte Atem der Zeit, und es ist dabei nicht allzu viel des Unterschiedes zwischen den Höhen und den Tiefen der Gesellschaft, zwischen heiligen und profanen Orten.
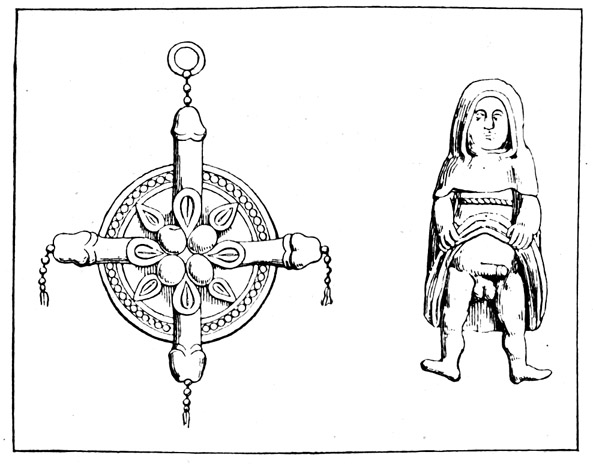
132. Phallisches Bischofskreuz und Karikatur auf die geilen Mönche. Aus Biel
Über die Genüsse des Gaumens herrschte im Mittelalter eine geradezu absolute Einmütigkeit: so viel als nur möglich und so lang als nur möglich, das war der einzige Wahlspruch. Taufen und Hochzeiten an Fürstenhöfen, wie bei reichen Bauern, dauerten nicht selten wochen- und monatelang. Welche Quantitäten bei einem solchen ununterbrochenen Fressen und Saufen verschlungen und hinabgespült wurden, davon geben uns noch verschiedene Berichte genaue Kunde. Es wurde aufgetragen, daß die Balken sich bogen, und der größte Freßwanst genoß die meiste Ehre. Und wie zünftig wurde dabei erst gebechert! Selten wurde aufgehört, ehe nicht der größte Teil der biederen Gesellschaft unter dem Tische lag, und das ging, wie gesagt, mitunter wochenlang so fort. Als Beleg mag man im Liederbuch der Klara Hätzlerin das Gedicht »von Mayr Betzen« nachlesen, das uns breit und ausführlich die Schlemmerei bei einer Bauernhochzeit schildert, ebenso das Gedicht »von des Metzen Hochzit« in Laßbergs Liedersaal. Diese Freude an der Schlemmerei, für die die Naturalwirtschaft die ökonomischen Voraussetzungen und Möglichkeiten bot, hat übrigens nicht nur im Mittelalter geherrscht, sondern noch weit ins 16. und 17. Jahrhundert hinein. Bei dem ehrlichen Schweinichen kann man nachlesen, wie »oft ein großes Gefresse und Gesäufte« war und wie zünftig die Räusche waren, mit denen man unter die Tische sank. In Zürich rechnete man bei dem alljährlichen Sechseläuten auf den Trinkstuben der Zünfte auf jeden Mann 16 Maß Wein. Zu welchem Nüchternheitsfanatiker wird daneben der trinkfesteste Münchener von heute! Ein Triumph der Mäßigkeit war es schon, als an dem Hof Ernst des Frommen von Sachsen-Gotha in der Hoftrinkordnung vom Jahre 1648 als Tagestrunk festgesetzt wurde »vors gräffliche und adelige Frauenzimmer aber vier Maaß Bier und des Abends zum Abschenken drei Maaß Bier«. Diese allgemeine Unmäßigkeit im Essen und Trinken war ein Hauptnährboden für den skatologischen Witz. Denn daß die Verdauung prompt vonstatten ging, war bei der Dauerbeschäftigung mit Fressen und Saufen das wichtigste Erfordernis. Auch dies belegen die beiden vorhin genannten Gedichte.
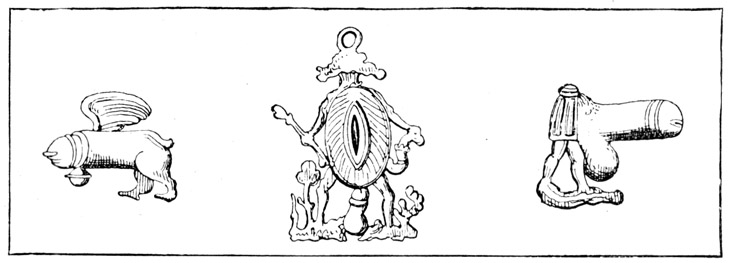
133. Phallische Broschen aus Blei
Mit derselben Derbheit und demselben Anmaße wurde im Mittelalter der Wollust gefrönt. Ebenso frühe wie klassische Dokumente der derben erotischen Auffassung jener Zeit sind die sechs christlichen Schauspiele der sächsischen Nonne Roswitha, die um das Jahr 980 lebte. Die Tendenz, die diese Nonne bei ihrem Dramenschreiben verfolgte, war, dem damals am meisten gelesenen antiken Autor Terenz das Feld abzugraben. Nach der Meinung der Zeit konnte man das nur, wenn man nach demselben oder wenigstens nach einem ähnlichen Rezept, dem der heidnische Terenz sein Ansehen verdankte, arbeitete. Und Roswitha ist denn auch so ehrlich, in der Vorrede dies zuzugestehen: Die Süßigkeit des Ausdruckes sei das, was die Leute verlocke; sie habe sich deshalb nicht gescheut, den römischen Dichter nachzuahmen, »damit auf eben die Art wie bei Terenz die Geilheit unzüchtiger Weiber erzählt wird, auch die löbliche Keuschheit christlicher Jungfrauen nach meines kleinen Witzes Vermögen gerühmt werde.« Und sie hat wahrlich wacker dieses erfolgversprechende Rezept angewandt! Zu den Hauptpointen ihrer Dramen gehören Notzuchtsszenen, die an glaubensstarken christlichen Jungfrauen teils vorgenommen, teils versucht werden; in dem Stück Callimachus kommt es sogar beinahe zu einer Leichenschändung. Daß es sich bei Jungfer Roswithas Dramen um ein vollgültiges Zeugnis der öffentlichen Sittlichkeit handelt und nicht etwa um die exaltierte Phantasie einer hysterischen Nonne, wird schon durch die eine Tatsache belegt, daß diese Schauspiele von den anderen Nonnen zu gegenseitiger christlicher Erbauung aufgeführt wurden. Von größter Wichtigkeit über die erotische Derbheit des Mittelalters sind auch verschiedene Stellen des Parzial. Von dem Zwange der Prüderie fühlte sich die ritterliche Gesellschaft, die der große Realist Wolfram von Eschenbach schilderte, allem Anscheine nach nicht allzu sehr beschwert. Man lese als Beispiel nur die Stelle über Gavans Besuch im Hause des Königs Vergulast. Gavan trifft dessen Schwester, die jungfräuliche Königin Antikonie, allein zu Haus, er bittet sie um einen Kuß, und dann begab sich folgendes:
Zu dem Mägdlein ungehemmt
Setzte sich der werte Degen.
Sie durften süßer Rede pflegen
Beiderseits mit Treuen.
Oft mußten sie erneuen:
Er sein Gesuch, sie ihr Versagen;
Herzlich wollt' er das beklagen.
Am Gewährung bat er viel …
Die Magd, die ihnen eingeschenkt,
Hatte schon den Schritt hinaus gelenkt;
Die Frauen, die erst bei ihr gesessen.
Mochten länger nicht vergessen.
Was sie draußen mußten pflegen;
Auch der Ritter war nicht mehr zugegen,
Der ihn der Königin vorgestellt.
Da gedachte der Held,
Da sie alle waren draußen.
Daß oft den großen Straußen
Fangen mag ein kleiner Aar.
Er griff ihr unter den Mantel gar.
Die Hüfte rührt' er ihr, ich glaube:
Da ward er großer Pein zum Raube.
Von der Liebe solche Not gewann,
So die Magd wie der Mann,
Daß schier ein Ding da wär' geschehn,
Hätten's üble Augen nicht ersehn.
Sie waren beide fast bereit:
Sieh, da naht ihr Herzeleid!

Der Jungbrunnen. Deutsche Karikatur vom Meister mit den Bandrollen
Kaum war also der Gast mit der jungfräulichen Königin, die er eben zum erstenmal sah, allein, so greift er ihr keck und kühn unter das Kleid! »Die Hüfte rührt er ihr«; mit anderen Worten: er fand eine Form der Liebeswerbung für angemessen, wie sie heute etwa ein roher, brutaler Stallknecht, dessen einziges Argument seine sexuelle Erregung ist, bei einer dummen, ungeschlachten Bauernmagd anwenden mag. Aber der Degen Gavan hatte das richtigste Verfahren angewandt, denn die jungfräuliche Königin findet seine Gründe überzeugend, sie ist schon in der nächsten Minute bereit, dem geilen Ritter das zu gewähren, wonach ihn bei ihrem Anblicke verlangt hatte. Daß es nicht dazu kam, wurde nur durch das unvermutete Hinzukommen anderer verhindert. Nun vergegenwärtige man sich nur noch, daß dieser sofort handgreiflich werdende Gavan das Muster eines Ritters in Eschenbachs Dichtung ist. Belügen wir uns also nicht über die Moral des höfischen Ritterdienstes. Wichtig ist bei dieser Frage, daß es sich bei dem geschilderten Vorgang nicht um etwas Außergewöhnliches, sondern um eine allgemein übliche Form der Galanterie handelte. Die höfische Poesie enthält zahllose Belegstellen dafür: »Er greif ir under das Kleid, daz war der Junkfrawen leid« – heißt's bei einem anderen Minnesänger. Freilich, als der kecke Ritter schwört, die züchtige Jungfrau zu heiraten, da ist ihr gekränkter Stolz auch gleich wieder besänftigt. Die Burgfrau verargt einem liebeshungrigen Gaste selten derartige handgreifliche Scherze, und ist man gar auf der Reise, so gehört es fast zu einem Rechtstitel des ritterlichen Begleiters, sich solche Galanterien bei der Dame, der man den Schuh leiht, zu erlauben. Die Königin Ginovar rastet mit ihrem Ritter unter einer Linde. Dieser ist nun besonders wohlerzogen und bittet daher erst um die Erlaubnis zu solchen Scherzen. Diese wird ihm verweigert, aber nur kurze Zeit, dann willigt die Königin darein und »gibt ihm die Vorwerke preis«, wie der Chronist sagt. Selbstverständlich sind solche derben Galanterien meistens nur die Einleitung zu ebenso derben Fortsetzungen, und selbstverständlich kam es auch in den meisten Fällen zu diesen Fortsetzungen. Als Lanzelet den Iweret erschlagen, reitet er mit dessen Tochter Iblis davon. Kaum haben sie eine Meile zurückgelegt, so rasten sie unter einer Linde: »Sie wurden gesellen, als ihnen die Minne geriet.« Auch mancher gefangene Ritter verdankte seine Erlösung aus dem Burgverlies einzig der Dankbarkeit der Burgfrau für genossene Liebesfreuden. Nach den Schilderungen der Dichter und Chronisten ist die Zudringlichkeit nicht selten sogar auf seiten der Frau größer wie auf der des Mannes. Die Burgherrin vertauscht gerne das Lager an der Seite des Gatten mit dem an der Seite eines ritterlichen Gastes, und blöde zu sein wird diesem dann als ein größeres Verbrechen angerechnet, und ist mitunter sogar auch gefährlicher, als wenn er keck jede günstige Situation ausnützt. Zu Galazandreiz kommt Lanzelet, von zwei Rittern begleitet; sie werden gut aufgenommen und gehen zur Ruhe. Da erscheint die Tochter des Wirtes im Schlafsaal, von zwei kerzentragenden Jungfrauen geleitet, und bittet die Ritter um Minne, bietet ihnen sogar einen goldenen Ring als Lohn an. Die tugendhafte Meliur schleicht des Nachts zu dem ihr bisher völlig unbekannten Partonopier: »Sie wurde da geschieden Von ihrem magetume … Daz sie ward Weib und er ward Mann.« So könnte man noch Dutzende von Beispielen anreihen, denn die Geschichte des Minnedienstes ist eine einzige Kette derartiger Abenteuer, ein einziger fortlaufender Kommentar derbster Erotik. Sie muß das auch sein, weil eine solche Geschlechtsmoral in den wirtschaftlichen Bedingnissen der damaligen höfisch-aristokratischen Kultur und in der noch unverschleierten Basis der Ehe, die bei den herrschenden Klassen nichts als Konvenienz war, gegründet ist. Wenn daher an den üblichen Schilderungen des Minnezeitalters Einschränkungen zu machen sind, so vor allem gegenüber der angeblichen Sprödigkeit der Frauen. Jede ernsthafte Nachprüfung des Minnedienstes widerlegt diese. Man denke nur an eine einzige Institution dieses Zeitalters, an den Gebrauch des Keuschheits- oder Venusgürtels und an die logischen Konsequenzen, die sich aus seinem Gebrauche ergeben.
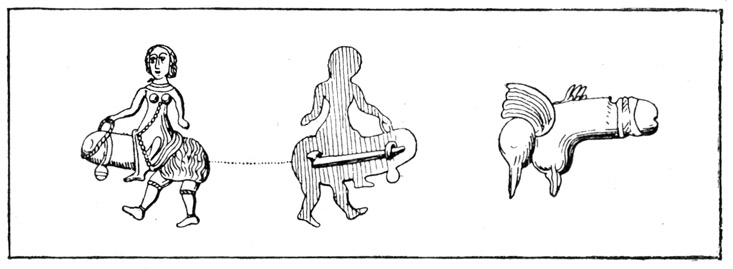
134. Phallische Broschen aus Blei

135. Phallische Amulette aus Blei
Entscheidend für die moralische Bewertung dieser Institution ist allein die Frage: Bei welchen Gelegenheiten sollte die geschlechtliche Intaktheit einer Frau gesichert werden? Die Antwort auf diese Frage kann gar nicht zweifelhaft sein, denn sie ist in diesem Falle zu einfach und zu selbstverständlich. Trotzdem ist die Antwort, soweit uns das einschlägige Material bekannt wurde, stets eine irrige gewesen. Die landläufige Behauptung geht dahin, daß das Rittertum zu diesem eisernen oder silbernen Schutzgitter gegriffen habe, um die Burgfrauen in solchen Zeiten vor brutalen Vergewaltigungen zu schützen, in denen der Hausherr längere Zeit von Haus abwesend war, namentlich wenn er sich auf einem Kreuzzuge befand, oder auch wenn die Ritterfrauen über Land reisten. Wäre diese Annahme richtig, so würde selbst von unserer heutigen Moralanschauung nichts gegen den damaligen Gebrauch dieser Keuschheitswächter einzuwenden sein. Aber diese Annahme ist sicher falsch, denn um die Frauen in solchen Fällen vor Vergewaltigungen zu schützen, dazu reichte dieses Gitter nicht aus. Wegelagernden Rittern, die reisende Frauen überfallen, um ihnen Gewalt anzutun, oder feindlichen Rittern, die nach der siegreichen Erstürmung einer Burg die Gelegenheit benützen wollten, auch die Frauen zu vergewaltigen, war ein noch so massiver Venusgürtel das allergeringste Hindernis. Zwischen den klobigen Fingern eines Ritters, der im schweren Eisenpanzer die Turnierlanze zu führen wußte, war dieser silberne Verschluß wie ein Seidenfaden, den er mit zwei Fingern spielend entzwei brach. Und darüber war sich die ritterliche Gesellschaft sicher keinen Tag im Zweifel, denn um dies einzusehen, dazu genügte das Mindestmaß von Erfahrung. Wenn die Ritter ihren Frauen trotzdem einen Keuschheitsgürtel anlegten, so verfolgten sie damit also einen anderen Zweck. Dieser war: Er sollte ein Schutz gegen die gelegentliche, gegen die jeden Tag mögliche Verführung der Gattin oder Geliebten sein. Der Ritter kannte sich und seine Genossen, er wußte, daß vor ihrer Brunft keine Frau sicher war. Er kannte aber nicht nur sich und seine Genossen, er kannte auch seine Frau. Er wußte, daß die Widerstände der Burgherrin gegenüber den Verführungsversuchen eines sympathischen Gastes, eines wohlgelittenen Knappen oder sonst eines verwegenen Gesellen nicht allzu ernstlich gemeint sind, und daß sie manchen sehr gerne mit ihrer Minne zu beglücken geneigt ist, sobald dieser es nur versteht, ernstlich und geschickt die Gelegenheit zu nützen. Gegen solche gelegentliche Verführung und Untreue sollte der Venusgürtel schützen, und dagegen schützte er auch einigermaßen. Ein zerknittertes Gewand ließ sich glatt streichen, das mit Gewalt gesprengte komplizierte Schloß eines Venusgürtels war aber nicht leicht und unsichtbar zu reparieren, damals wenigstens nicht, auch wenn der Gatte oder Geliebte wochenlang abwesend war. Die Anwendung des Venusgürtels war also auch ein Schutz der Frau vor sich selbst. Damit aber wird diese Institution für die Zeiten, da sie im Gebrauch war, zu einem überzeugenden Beweisstück für die in ihr herrschende wilde, zügellose Erotik.
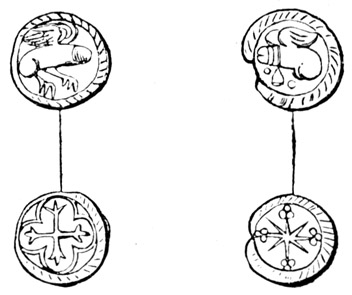
136. Phallische Münzen
Diese Art handgreiflicher »Ritterlichkeit« ist übrigens lange im Gebrauch gewesen. Den Ausgang eines Festes am mecklenburgischen Hofe beschreibt der Ritter Hans von Schweinichen in seinem Tagebuch also:
»Die einheimischen Junkern verloren sich, sowie die Jungfrauen, daß auf die Letzte nicht mehr als zwo Jungfern und ein Junker bei mir blieben, welcher einen Tanz anfing. Dem folget ich nach. Es währet nicht lange, mein guter Freund wischt mit der Jungfer in die Kammer so an der Stuben war; ich hinter ihm hernach. Wie wir in die Kammer kommen, liegen zween Junkern mit Jungfrauen im Bette; dieser, der mir vorgetanzet, fiel mit der Jungfer auch in ein Bette. Ich fragte die Jungfrau, mit der ich tanzet, was wir machen wollten? Auf Mecklenburgisch, so sagt sie: ich soll mich zu ihr in ihr Bette auch legen; dazu ich mich nicht lange bitten ließ.«
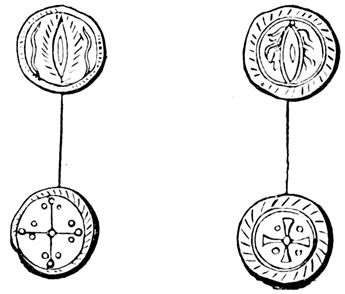
137. Phallische Münzen
Kam ein mächtiger Kaiser oder König zu Gast gegen eine Stadt geritten, so zog ihm die Bürgerschaft »in Züchten und Ehren« entgegen. Die Zucht und die Ehre der mittelalterlichen Moral gestattete aber, daß dem Zug eine Anzahl »schöner Frauen« vorangingen, die der Einfachheit halber nur geziert waren durch – die Pracht ihres nackten Leibes. Es waren die Schönsten der »gelüstigen Fräulein«, über die die Stadt in ihren Frauenhäusern verfügte, und die aller Welt zur Schau nackt dem Gaste das Geleite durch die Straßen gaben. So war's bekanntlich noch zu Dürers Zeiten, wie wir aus dem Bericht erfahren, den er über den Einzug Kaiser Karls V. in Antwerpen nach Hause schrieb. War der Gast und sein Gefolge von der Reise Mühsal durch Trank und Speise erquickt, so war es das erste, daß die ehrsamen Stadtväter dem hohen Besuch und seinem Gefolge die »sämtlichen gelüstigen Fräulein« der Stadt für die Zeit ihres Besuches kostenlos zur Verfügung stellten. Eine größere Freude glaubte man einem hohen Gaste nicht machen zu können. Den dafür fälligen Hurenlohn übernahm die Stadt auf den Stadtsäckel. Auch das war sehr lange Gebrauch, wie wir an einer Reihe Geschichtsquellen nachprüfen können. 1414 dankte Kaiser Siegismund öffentlich dem Berner Stadtmagistrat, daß dieser dem kaiserlichen Gefolge drei Tage unentgeltlichen Besuch des Frauenhauses gestattet hatte. 1434 beleuchtete man in Ulm die Straßen, wenn der Kaiser Siegismund oder sein Gefolge in das gemeine Töchterhaus gingen. Als Kaiser Friedrich III. 1471 in Nürnberg war, »da er vom Kornhaus ging, da fiengen ihn zwu Huren mit einer dreiklafteren silbernen Ketten und sprachen: ›Eur Gnaden muß gefangen sein!‹; er sprach: ›wir sind nit gern gefangen, wir wollen uns auslösen‹ und er gab ihnen einen Gulden; item reitet er fürbaß vors Frauenhaus, da fiengen ihn andere vier, gab er aber ein Gulden« (nach den Nürnberger Jahrbüchern des 15. Jahrhunderts). Daraus ergibt sich also, daß die öffentliche Sittlichkeit der Zeit es zuließ, daß »die Stadthuren« mit dem kaiserlichen Besuch ihre Kurzweil trieben, und daß Seine Römische Majestät sich in dieser Gesellschaft ganz wohl fühlte.

138 und 139. Fenstergesimse am Schlosse von Blois
Dieselbe derb-erotische Auffassung verrät auch der »Turnierdank«, der mannigfach üblich war. Lockt heute den Sieger am Kampfplatz ein goldener Pokal, so damals nicht selten ein schönes »gelüstiges Fräulein«, das der Magistrat unter den Bewohnerinnen des Frauenhauses ausgesucht hatte, – sie fiel dem Sieger als Preis zu. Natürlich nicht, um mit ihm etwa über die metrischen Regeln der Dichtkunst zu debattieren, sondern »daß sie ihn des Nachts mit der Minne kunstvollen Spielen wollüstig ergötze«. Noch eine andere, feudale Art des Turnierdankes ist aus der Zeit des Minnedienstes bekannt. Unterlag der Ritter einer Dame, so wurde diese alsbald die Geliebte des Siegers, und sie fand es dann ganz in der Ordnung, die Gunst, um die eben noch der Unterlegene gekämpft hatte, nun ohne weiteres dem Sieger zu gewähren. Aus Parzival erfahren wir, daß die Dame, deren Bewerber von Elidus besiegt worden war, unaufgefordert des Nachts in das Bett des siegreichen Helden kommt. Eine derbere Auffassung der erotischen Moral ist wohl kaum denkbar. Aber es sind das die Zeugnisse dafür, wie gering entwickelt die individuelle Geschlechtsliebe zu jener Zeit noch war. Darum aber ist durch alle diese Zitate nichts anderes bewiesen und belegt als das, was in der Einleitung theoretisch ausgeführt ist: daß diese »direkten« Scherze eben der damaligen Kulturhöhe entsprachen. Andere, »bessere« konnte man nicht machen, denn dazu war eben das Räderwerk der damaligen Moral noch zu einfach konstruiert, noch nicht kompliziert genug ausgestaltet.
Auch die geistige Kost der höfisch-aristokratischen Kreise ist ein vollgültiger Beweis für die derb-erotische Auffassung dieser Zeit: die Fabliaux und die Schwänke hörte man mit Wonne an, die minnigliche Frau mit dem gleichen Eifer, obgleich ihr Hauptinhalt von den bedenklichsten erotischen Abenteuern handelte. (Über die höfische Geschlechtsmoral des Mittelalters vgl. auch »Die Frau in der Karikatur« 66-69.)
Daß die Sitten der Bürger und Bauern, bei denselben Voraussetzungen einer noch rohen, unentwickelten Kultur, ebensowenig das sein können, was sich mit dem modernen Begriff von keusch und züchtig deckt, und daß sie nur eindeutiger, noch weniger kompliziert gewesen sind, das ist ebenso eine innere Notwendigkeit der mittelalterlichen Kultur. Auch hier begründen schon wenige Beispiele dieses Urteil.
Die Volksbelustigungen zählen in allen Zeiten und Kulturen zu jenen Dingen, von denen man am allerdeutlichsten auf den jeweiligen Höhegrad der öffentlichen Sittlichkeit schließen kann. Im ganzen Mittelalter war bei Bürger und Bauer die wichtigste Volksbelustigung der Tanz, ihm frönte man in jeder freien Stunde. Der Hauptspaß beim mittelalterlichen Tanzen bestand aber darin, die Tänzerin so hoch wie möglich zu heben und so wild wie möglich zu schwenken. Das heißt: die Röcke der Tänzerin mußten womöglich bis über den Kopf empor flattern, wenn man als ein flotter Tänzer gelten wollte. Da die Frauen keine Unterkleider trugen, so ist der Zweck, der dabei verfolgt wurde, sonnenklar, es handelte sich in erster Linie um die möglichst unzüchtige Entblößung der Tänzerin vor den Augen der Zuschauer. Den Begriff »unzüchtige Entblößung« muß man aber richtig auffassen; man muß sich klar darüber sein, was entblößt werden soll. Daß es sich dabei nicht bloß um solche Kleinigkeiten handelte, zu zeigen, daß eine Maid stramme, pralle Waden hat, solches ergibt sich schon aus der Harmlosigkeit, mit der das ganze Mittelalter einer teilweisen Nacktheit gegenüberstand. Den Busen und die Waden der Frauen und Mädchen zu sehen, war etwas Alltägliches. Man wollte Interessanteres sehen. Diese auch die ganze Renaissance hindurch andauernde allgemeine Freude der Frauen am Entblößtwerden beim Tanzen bestätigen zahlreiche Zeitgenossen. Geiler von Kaisersberg sagt z. B. an einer Stelle seiner geharnischten Moralpredigten:
»Darnach findet man Klötze, die tanzen also säuisch und unflätig, daß sie die Weiber und Jungfrauen dermaßen herumschwenken und in die Höhe werfen, daß man ihnen hinten und vornen hinauf sieht bis in die Weichen, also, daß man ihre hübschen weißen Beinlein sieht … Auch findet man etliche, die haben Ruhm davon, wenn sie Jungfrauen und Weiber hoch in die Höhe können schwenken, und haben es bisweilen die Jungfrauen sehr gern und ist ihnen mit Lieb gelebt, wenn man sie also schwenkt, daß man ihnen, ich weiß nicht, wohin siehet.«
Diese erotische Tendenz des Entblößens hat sich übrigens ziemlich urwüchsig bis auf den heutigen Tag in dem oberbayrischen Schuhplattler erhalten. Hui! wenn die Röcke derart fliegen, daß man nicht nur etwas, sondern alles sieht! Wie kann man da die Nebenbuhlerin ausstechen! Also: Heute wie damals.
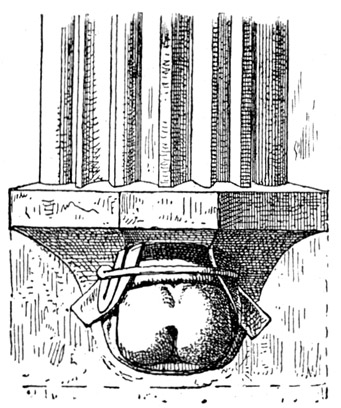
140. Säulenbasis in der Kathedrale von Burgos
Es ist bezeichnend, freilich aber auch logisch, daß die raffinierteste Form der grotesken Dekolletage von unten nach oben als Spielzweck wiederum beim Adel im Schwange war. Beweis dafür ist das bei den adeligen Damen beliebte Spiel des »Umbstoßens«. Ein aus dem 14. Jahrhundert stammender, im Germanischen Museum in Nürnberg aufbewahrter Teppich enthält ein Bild, das uns eine Vorstellung von dieser mittelalterlichen Belustigung gibt. Es handelt sich um eine Art von komischem Turnier zwischen Herren und Damen. Das Spiel vollzog sich folgendermaßen: Die kämpfende Dame sitzt auf dem Rücken eines am Boden knieenden Mannes, der Mann steht frei. Beide haben ein Bein erhoben und suchen mit gegenseitigen Stößen einander zu Fall zu bringen, »umbzustoßen«. Da die Frau auf dem Rücken eines knieenden Mannes saß, so konnte sie nur nach rückwärts fallen, also in die denkbar hilfloseste Lage. Gelang es dem Manne, seine Dame derart aus dem Gleichgewichte zu bringen, daß sie nach rückwärts auf den Boden kollerte, so war er Sieger, und der Beifall und die Freude steigerte sich in dem Maß, in dem es ihm gelang, die Dame so umzustoßen, daß sie dabei vollständig entblößt wurde und ihre geheimsten Reize recht lange die Augenweide der Zuschauer wurden. Gewiß war es der Ehrgeiz der Dame, ihren Partner nicht nur nicht zum Ziele kommen zu lassen, sondern selbst Siegerin zu werden. Aber es liegt im Wesen der Sache, daß wenn man sich der Gefahr des Besiegtwerdens aussetzt, daraus die selbstverständliche Folgerung sich ergibt, daß die »so der Herrgott sauber gedrechselt« es trotz allen schlauen Widerstandes häufig nicht ungern gesehen haben werden, wenn der Mann Sieger blieb und ihre intimste körperliche Schönheit dadurch zum Augenschmaus der Zuschauer wurde. Dies folgt auch daraus, daß die Männer, die als Meister im geschickten Umstoßen galten, die begehrtesten Partner waren … Daß solches keine eigenmächtigen Folgerungen sind, ergibt sich aus den Worten, die der Künstler des Teppichs im Germanischen Museum seiner Dame in den Mund legt, er läßt sie zu ihrem Partner sagen: »Din stosen gefelt mir wol, Lieber stos als es sin sol.« In den Reihen der Frauen herrschte natürlich auch ein lautes Hallo, wenn es der Dame gelang, den Herrn umzustoßen. Und auch hier spielte das Erotische eine Rolle; gelang es der Dame, den Mann umzustoßen, so wurde der Mann infolge der damaligen Männertracht nämlich auch schamlos entblößt. Die weibliche erotische Neugier spielte also ebenfalls eine Rolle bei den Spielen und Tänzen und suchte auf ihre Rechnung zu kommen. In welch ungeheuerlicher Weise es mit diesen »Enthüllungen« mitunter getrieben worden sein mußte, geht auch sehr deutlich aus den Verordnungen der Obrigkeiten hervor. Unter diesen befinden sich solche, welche bestimmen, daß die Männer nicht so ungebührlich tanzen, »daß man ihre Scham sehe«. Ja, es waren sogar Verordnungen nötig, welche den Männern das Tanzen »bei nacktem Leibe« verboten! Genützt haben diese Erlasse trotz aller Strafandrohungen anscheinend nie viel, das ergibt sich aus den immer von neuem wiederholten Ermahnungen und Hinweisen auf diese Verbote. Solche Spiele wie das »Umbstoßen« wurden natürlich auch von den Bürgern und Bauern eifrig nachgeahmt.

141. Obszöne Steinfigur am Stadthause von Noyon 15. Jahrhundert
Was bei den unzüchtigen Spielen und Tänzen in Bewegungen und Handgreiflichkeiten zum Ausdruck kam und sich manifestierte, war der Angelpunkt der meisten Volksbelustigungen, bei denen sich beide Geschlechter beteiligten. Es sei hier nur noch an die Narren- und Eselsfeste erinnert, die eigentlich eine Umformung der antiken Saturnalien darstellten. Ihr Charakter war durchaus erotisch. Die auffällige Demonstration des Phallus spielte bei den männlichen Verkleidungen fast immer eine Hauptrolle.
Solche erotische Handgreiflichkeiten haben auch den Mittelpunkt all der literarischen Produkte gebildet, die zur höheren Feier dieser Vergnügungen verfaßt wurden. Die wertvollsten literarischen Beweisstücke in dieser Richtung und überhaupt die wichtigsten Belege des Wesens der öffentlichen Sittlichkeit im Mittelalter, sind die zahlreichen Fastnachtsspiele, die tief in das Mittelalter zurückreichen und noch weit in die neue Zeit hinein im Schwange waren, und von denen eine ganze Reihe sich erhalten hat. Ihr Gegenstand war immer derbe Erotik; gereimte Diskussionen über die Technik der Liebe, über die Leistungsfähigkeit der Männer in den Kämpfen der Venus, über ihre körperlichen Qualitäten, über den Grad der Ansprüche, die eine Frau an die physische Liebesfähigkeit ihres Mannes stellen kann usw. Der Witz und die Pointen dieser Spiele sind ausschließlich Zoten, und zwar Zoten allerstärksten Kalibers. Nicht unwichtig ist, daß die Dichter den Frauen ebenso derbe Zoten in den Mund legen wie den Männern. Bezeichnend gerade für das letztere ist gleich das folgende Stück, in dem sich eine Frau beim Richter über einen allzu lässigen Geliebten beklagt:
Lieber Herr, vernehmet mein Antwort auch:
Ich hab' einen jungen, törichten Gauch,
Der ist vier Wochen bei mir gelegen,
Doch tät er sich des nie verwegen,
Daß er mich tat pfeffern mit Adams Gerten,
Nun will ich gar darinnen erhärten,
Und doch nie an mir gebrochen.
Ich hab' wohl des Nachts im Bett gesprochen:
Ich hab' mich heut' so satt nicht gegessen,
Ich wollt' noch ein' Wurst mit einem Bart essen,
Doch konnt sein der Ganslöffel nicht verstahn.
Wohl griff er mit der Hand daran,
Und machet uns beiden eine große Lust,
Daß ich ihn drückte an meine Brust,
Und halse und küsse an die Backen
Und tat ihn dann in seinen Hintern zwacken,
Und sprach: ich lasse dich durchaus nicht schlafen,
Du tust mich denn mit Adams Gerten strafen,
Und spielt ihm vor mit schimpflichen Sachen,
Doch konnte ich ihn nie brünstig gemachen,
Daß er aufsitzen wollt' und lernen reiten,
Und wie man sollt mit Frauen streiten.
Den ungetreuen Gatten, der gerner auf anderen Wiesen grast und darob die eigene Frau vernachlässigt, behandelt das Spiel »Das ist die Ehefrau wie sie ihren Mann verklagt vorm Hochgericht«. Dieses Spiel hebt folgendermaßen an:

142. Säulenträger in einer Kirche 12. Jahrhundert
Ehefrau klagt:
Herr Richter, mein Klag' sollt Ihr verstahn,
Die ich zu klagen hab' von meinem Mann!
Er trägt mir mein Nachtfutter aus,
Und ich bedürft sein selber wohl im Haus;
Denn wenn ich des Nachts schlafen geh',
So tut mir der Nachthunger so weh,
Daß ich des Nachts hab' wenig Ruh'.
Er trägt es den andern Frauen zu.
Laßt ihm ein Urteil hierum sprechen,
Wie man ein solches an ei'm soll rächen,
Der zu andern Frauen geht naschen aus
Und sein selber genug hat in sei'm Haus.
Nach dieser Anklage fragt der Richter die Schöffen um ihre Meinung, und ein jeder der zehn Schöffen gibt seine Ansicht breit und ungeschminkt kund. So erklärt z. B. der zweite Schöffe:
Ich urteil': einer, der sein Weib läßt darben
Und hat ein' unausgedroschene Garben,
Und drischet sie aus in fremden Scheuren,
Damit er sein Weib wohl mag verteuren,
Und bringet ihr erst heim die Spreuen
Und läßt sie an dem Fressen käuen,
Der soll zehen Jahr von der Erden essen.
Die Buß' darf ich ihm nicht kürzer messen.
Wird in diesem Spiel über den Mann diskutiert, der seiner Pflichten sträflich versäumt, so in einem anderen gleich eifrig und gleich deutlich darüber, was zu geschehen habe, wenn ein Mann allzu eifrig bei seiner Pflicht ist:
Die Anklägerin spricht:
Herr Richter, hört mich etwas, mich armes Weib!
Ich hatt' einen stolzen Frauenleib;
Jung und auch Stolz ist mir verschwunden,
Das macht, daß ich mei'm Mann verbunden
All Nacht' muß sein zu achtzehn Malen,
Des ich nicht länger mag veralen (erdulden).
So andre Weiber ihr Nachtruh' haben,
So hat er ein schinden und schaben
Und zieht mich um die ganze Nacht.
Wie stark ich hin auch wiederfacht (sträubte).
So hat es weder End' noch Ziel.
Das ist mir armen Weib zu viel.
Die Heilmittel, die von den zwölf Schöffen der Reihe nach vorgeschlagen werden, sind sehr drastisch; um nur eines anzuführen, sei »der acht schopf« zitiert:
So urteil' ich, als ich gedenk':
Und daß man ihm ein Gewicht anhenk
Zuvorderst an sein Wasserstangen,
Daß er's gewöhn', unter sich zu hangen,
Und es ein Jahr also versuch' …

143. Obszöne Schnitzerei an einem Chorstuhle der Kirche Saint-Gervais
Aber die klägerische Frau kommt von ihrer Klage plötzlich wieder zurück, weil der Mann nämlich erklärte, sich dann in anderen Gärten schadlos zu halten:
Ja, eh' ich das von dir wollt' haben,
Daß du mir aus dem Weg sollst traben,
da will sie es lieber zweimal so oft erleiden, also – sechsunddreißigmal jede Nacht!
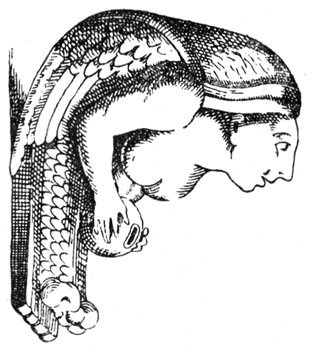
144. »Wendische Venus«. Erotische Karyatide aus einer wendischen Kirche
Aus » Die Fastnacht von der Müllerin« seien die folgenden beiden Ausschnitte als charakteristisch und besonders amüsant angeführt. Der erste, der seinen Spruch sagt, hält folgende Rede:
Mich hat eine junge Frau gezilt (bestellt),
Sie wollt' mir leihen ihren Schild,
Darein man mit bloßen Speeren sticht
Und auch mit Degen darinnen ficht.
Da kam ich und ward zu ihr erkecken
Und zeiget ihr meinen Wasserstecken;
Da erschrak sie, daß sie fiel auf'n Rück'.
Da erzeigt ich ihr so heimlich Tück',
Daß sie so ernstlich zu mir spricht:
Ich wollt', es wär' an ein' Wasser gericht,
Daß man es sollt' Tag und Nacht antreiben.
Ich will nie mehr so lang bei einem Buhl'n bleiben.
Der sechste spricht:
Ich bin ein starker Witwen Stolz
Und hab' nach unten ein gut voll Holz,
Womit ich ein Frauen wohl will strafen,
Daß sie mich an ihr'm Arm läßt schlafen,
Darum ich ungern ein Witwer bleib'.
Nun rat't und helft mir zu einem Weib,
Denn ich des Nachts keine Ruhe kann gehaben;
Der Schelm hat mir die Deck' beinah durchgegraben,
Wenn ich dann bei Tag ein Weib anblick',
So geschwillt er mir und wird so dick,
Daß ich dann nirgend mit ihm kann auskommen,
Ich hab' mir denn wieder ein Weib genommen.
Wie mögen die Weiber verständig gekichert haben, wenn diese Witze an ihre Ohren klangen! Und welch hanebüchene Nutzanwendungen werden nach rechts und nach links gemacht worden sein. Wie oft mag der Nachbar die dralle Nachbarin in die Seite gestoßen und eine gleich derbe Zote, auf sie gemünzt, hinzugesetzt haben! Denn jung und alt, Männlein und Weiblein waren da beieinander; es waren doch keine geschlossenen Herrengesellschaften, denen man diese Fastnachtsspiele vorgetragen hat. Keusch, züchtig und in Ehren ist man nach solchen Spielen wohl auch nicht nach Hause gegangen und hat etwa sinnig von der Poesie der reifbedeckten Bäume geschwärmt, sondern man hat sicher im gleichen Tone weiter geschäkert. Handgreiflichkeiten sind natürlich auch nicht verargt worden. »Lise greif ich dort hin, da die Weiber so stundig sind« und »Seiner Augen Weide greift er an den Fudenol,« heißt's bei Neidhart. Manch Jüngferlein wird auch bereitwillig ihr Kränzchen preisgegeben haben, und von mancher »Nothumpft« werden die Chronisten bei ihren Schilderungen der verflossenen Fastnacht zu melden gehabt haben. Das ist die unerbittliche Logik, – von der es kein Entrinnen gibt, und es wäre nichts anderes als direkte Fälschung eines Zeitbildes, wenn man trotzdem viel von minniglicher Sittsamkeit im modernen Sinne faseln wollte.
Wenn man die Geschichte durchblättert, findet man ohne Mühe die Belege dafür, wie diese ungezügelte Erotik mitunter ausartete. Im Jahr 1267 waren eine Menge Edelleute nach Basel gekommen, um die Fastnacht mitzufeiern. Aber bei der Art, wie sie es taten, wurde die Basler »Jungmannschaft« eifersüchttig und es kam zur Rauferei zwischen den Bürgern und den Edelleuten. Von den letzteren wurde, wie die Chronik erzählt, eine große Zahl verwundet und getötet. Die Wut der Baseler Bürger hatte freilich ziemlich begründete Ursache. Die Baseler Maideli sind den Zärtlichkeiten der Edelleute in etwas rascher und eindeutiger Weise entgegengekommen, denn, meldet die Chronik weiter: »Etliche wurden den Jungfrawlein in dem Schoß zerhawen.« Von den Wienerinnen des Mittelalters wird von einem Zeitgenossen gemeldet, »nur wenige lassen sich an einem Manne genügen. Häufig kommen Edelleute zu schönen Bürgerfrauen. Dann trägt der Mann Wein auf, den vornehmen Gast zu bewirten, und läßt ihn hierauf mit der Frau allein.« Viele Wiener Kaufherren fühlten sich sogar hoch geehrt von dem unzüchtigen Umgang ihrer Ehefrauen mit den Edelleuten, denn »mancher achtet gar sorgsam, daß sein Gast nicht gestört werde, wenn er mit der schönen Hausfrau der wollüstigen Liebesspiele treibt«. Aber die Baselerinnen und Wienerinnen sind beileibe nicht besondere Ausbünde von Unsittlichkeit gewesen. Was die Chroniken von ihnen speziell melden, das wird von Johannes Sarisberiensis (Polycraticus III Kap. 13) als das Merkmal der ganzen Zeit hervorgehoben:
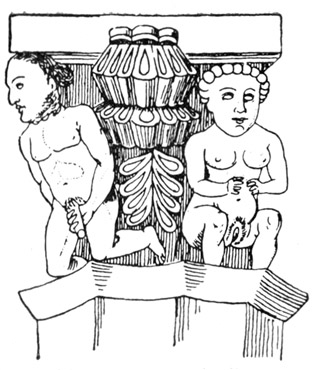
145. Adam und Eva. Erotische Pfeilerfiguren aus einer böhmischen Kirche
Wenn die junge Frau aus ihrem Brautgemache schreitet, sollte man den Gatten weniger für den Gemahl als für einen Kuppler halten. Er führt sie vor, setzt sie den Lüstlingen aus, und wenn die Hoffnung auf klingende Münze winkt, so gibt er ihre Liebe mit schlauer Heuchelei preis. Wenn die hübsche Tochter oder sonst etwas in der Familie einem Reichen gefällt, so ist sie eine öffentliche Ware, die ausgeboten wird, sobald sich ein Käufer findet. Und wenn auch ein gerechter Schmerz diejenigen einigermaßen foltert, die Teilnehmer in ihr Ehebett zulassen oder heranziehen, so wird doch das Unbehagen durch den Nutzen ausgewogen und gelindert …
Läßt sich von den Fastnachtsspielen mit einem gewissen Rechte sagen, daß sie die ehemaligen Saturnalien sind, die Ausnahmetage des Austobens, so fällt eine solche mildernde Erklärung gegenüber einer anderen mittelalterlichen Eigentümlichkeit, dem Badehausleben, völlig fort. Die Geschichte des Badelebens im Mittelalter ergibt, daß das Derb-Erotische den unverschleierten Mittelpunkt alles gesellschaftlichen Lebens bildete, und nichts ergänzt daher besser und vollkommener das Wesen der öffentlichen Sittlichkeit im Mittelalter. Das Badehausleben war nicht in erster Linie eine Frage der Gesundheit, sondern der Geselligkeit. Das Badehausleben war deshalb öffentlich, und es kannte sehr häufig keinerlei Scheidung der Geschlechter: Männer, Frauen, Mönche, Nonnen, Einheimische und Fremde badeten beliebig durcheinander, und zwar in verhältnismäßig engem Raume. Die Badekleidung war dabei so frei als möglich. Dem Baden waren nicht nur ein oder zwei Tage der Woche und ganz bestimmte Stunden gewidmet, sondern der Aufenthalt im Bad erstreckte sich häufig über den ganzen Tag. Fremde kehrten im Badehaus ein und belustigten sich dort so ungeniert wie heute auf einem beliebigen Korso. Der päpstliche Sekretär Poggio schreibt in seiner 1538 erschienenen Schilderung der Schweizer Mineralbäder von dem Züricher Badehausleben u. a.:
»Es ist Sitte, daß die Frauen, wenn die Männer von oben zuschauen, spaßeshalber um ein Geschenk bitten. So werden ihnen, und zwar den schönsten, Geldstücke zugeworfen, die sie mit der Hand oder mit den ausgebreiteten Hemden fangen, sich einander fortstoßend, und bei diesem Spiele werden zuweilen geheimere Reize enthüllt. Ich habe durch die unbeschränkte Freude zu sehen und Scherz zu treiben gelockt, da ich nur zweimal täglich badete, die übrige Zeit damit hingebracht, die anderen Bäder zu besuchen, und sehr oft Geldstücke und Kränze wie die anderen hinabgeworfen.«
Das heißt mit anderen Worten: Die Bürgerinnen und wohl auch die Hübscherinnen, denn diese waren mehr als sonst jemand imstande, ihre Zeit zu längeren Besuchen der Bäder zu benützen, reizten Freunde und selbst Fremde dazu an, ihnen Gelegenheit zu geben, vor ihren Augen ein erotisches Schauspiel zu entfalten. Und wenn die Männer das Geld den schönsten zuwarfen, so geschah es natürlich, um gerade diese zum möglichst häufigen Aufheben des Hemdes und Preisgeben ihrer geheimen Reize zu veranlassen. Also Männer und Frauen trieben vereint Tag für Tag in größter Öffentlichkeit Spiele, deren Hauptzweck der war, Nuditäten zu sehen und Nuditäten zu zeigen. Diese Scherze waren übrigens der Gesundheit sehr förderlich. Das Badehausleben konnte, wie zahlreiche Zeitgenossen uns melden, als das zuverlässigste Mittel gegen die Unfruchtbarkeit der Frauen gelten.
Diesen weltlichen Sitten und Gepflogenheiten entsprach ganz naturgemäß die geistliche Moralauffassung der Zeit. Wild und unbändig war das Leben selbst an den Orten, die nach unserer modernen Vorstellung »einem heiligmäßigen Leben« geweiht sein sollen. Ein Zeitdokument allerersten Ranges sind in dieser Richtung die berühmten adresselosen Briefe, die Petrarca etwa um 1370 aus Avignon, dem damaligen Sitze der Päpste, schrieb:
»Wisse,« so spricht Petrarca zum Leser – »daß auch die Feder eines Cicero den hiesigen Zuständen nicht gewachsen wäre. Alles, was du über Assyrien, Ägypten, Babylon gelesen, was du von den vier Labyrinthen gehört, von den Schrecken des Hades, von den tartarischen Wäldern und schwefligen Sümpfen, ist gegen diesen Tartarus nur eine schwache Fabel. Hier ist der trotzige und schreckliche Nimrod, hier die grausige Semiramis, hier der gefürchtete Minos, hier Rhadamanthus, hier der alles verschlingende Cerberus, hier die mit dem Stiere sich vermischende Pasiphaë, und hier findest du die zweigeschlechtige wie Minotaurus vertierte Menschenrasse, die Produkte einer scheußlichen Geschlechtswahl.«
Gewiß sprach Petrarca im übertreibenden Pathos des sittlich entrüsteten Moralisten, aber wenn man der sittlichen Entrüstung auch noch so viel zugute schreibt, so bleibt doch noch so viel übrig, um zur Überzeugung zu kommen, daß man heute schon in den Zuchthäusern Umschau halten müßte, um eine Menschenkollektion zusammenzustellen, die es mit der Creme der Gesellschaft von Avignon würdig aufnehmen könnte.
Durchaus falsch wäre, wenn wir unsere heutige Vorstellung vom Klosterleben kurzweg auf die mittelalterlichen Klöster übertrügen. Dort wurde geliebt und gelebt, und das mit durstigen Zügen. Und häufig sogar bis zur viehischen Ausschweifung. Es ist das aber auch eine natürliche Begleiterscheinung der historischen Entwicklung. Alle Institutionen, die ihres ursprünglichen Inhaltes verloren gehen, entarten. Aus einem Hebel der wirtschaftlichen Entwicklung war aus den Klöstern allmählich ein ungeheuerlicher Parasit am sozialen Organismus geworden. Man kann satirische Schilderungen wie die des berühmten Aretin über das Leben der Nonnen ganz beiseite lassen und sich mit den sachlichen Berichten der zeitgenössischen Chronisten begnügen, denn es ist uns mancher seltsame Bericht überkommen, der gar nicht erst der satirischen Übertreibung bedarf. In der Chronik des Grafen Zimmern liest man z. B. folgende Zustände beschrieben, die in dem württembergischen Kloster zu Oberndorf im Tale herrschten:

146. Mittelalterliche Miniatur aus einem Heiligenwerke
»Haben sich bis in die vierundzwanzig KIosterfrauen, mehrteils alle von Adel, darin enthalden kinden und haben kein Mangel, sondern wie man spricht, genug gehabt. Was für gut Leben, sofern anders das für gut Leben zu achten, in diesem Kloster gewesen, ist sonderlich bei dem abzunehmen, daß viel Adels ab dem Schwarzwald und am Neckar in diesem Kloster den Ufritt gehabt, und hätt damals mit guten Ehren und der Wahrheit, vielmehr des Adels Hurhaus, denn des Adels Spital mögen genennt werden. Vor andern haben die von Ow, Rosenfeldt, Brandegk, Stain, Neuneck viel Gelds darin vertan, und hat diese hohe Schul bös Ehemänner und unnütze Kindsväter geben. Bescheint sich an dem. Es sein einmal auf ein Zeit viele vom Adel und gute Gesellen im Kloster gewesen, die haben den Abendtanz ziemlich spät gehalten. Hat sich dabei mit Fleiß von ohngefähr begeben, daß in allem Tanz die Lichter sein verlöscht worden. Da ist ein wunderbarliches Blatterspiel entstanden und sich männiglich anfahen zu paren. Unter anderem ist versehen worden, daß die Thüren versperrt und kein brennend Licht in Saal kommen noch gelassen. Und gleichwohl allda niemand ist verschonet worden, so hat sich doch niemand ob dem andern beklagt, allein ein Edelmann unter dem Haufen, dem ist in seinem Sinn ein widerwärtiger Casus begegnet, dann er in einer Ungeduld, da er vermeint, die Zeit sei ihm zu kurz und man werde vielleicht bald ein Licht einhertragen, überlaut geschrieen: ›Lieben Freunde, eilet nicht, lassets noch einmal umher gehen! ich habe meine Schwester erwischet!‹ Nicht mag ich wissen, was er hernach für eine Gästin überkommen. Es ist keine Eile bei ihnen gewesen, sondern sie haben ihnen gleich wohl der Weil gelassen.«

147. Mittelalterliches Leben. Federzeichnung aus dem mittelalterlichen Hausbuche

148. Erotische Gruppe an der Fassade des Stadthauses von Saint-Quentin
Eine viehischere Ausschweifung läßt sich wohl kaum denken! In demselben Kapitel führt der gewissenhafte Chronist dann noch eine Menge Beispiele von Ausschweifungen der Mönche und Nonnen an. Der Nürnberger Hans Rosenplüt sagt in den »XV klagen«:
Die gemeinen Weib klagen auch ir orden, Ihr Weide sei viel zu mager worden. Die Winkelweiber und die Hausmägde, die fressen täglich ab ihr Weide … Auch klagen sie über die Klosterfrauen, die können so hübschlich über die Schnur hauen, wenn sie zu Ader lassen oder baden, so haben sie Junkher Conraden geladen.
Die »gelüstigen Fräuleins« beschweren sich also über den unlauteren Wettbewerb der Klosterfrauen auf dem Liebesmarkte! Daß diese Klage mit allem Recht erhoben worden ist, wird dadurch bestätigt, daß die Obrigkeit den »Hübscherinnen« gestattete, Repressalien zu üben. Geiler von Kaisersberg malt also nicht tendenziös schwarz, wenn er in seinen 1517 erschienenen »Brösamlein« sagt: »Ich weiß nicht, welches schier das Best wär, eine Tochter in ein semlich Kloster tun, oder in ein Frauenhaus. Wann, warum? Im Kloster ist sie eine Hur, so ist sie dennoch eine Gnadfrau dazu …?« Noch häufiger sind freilich die Beschwerden, die die Ehemänner über die Mönche führen. Was die Erzählungen des Boccaccio für Italien belegen, das belegen die Faiblaux für Frankreich, die Schwänke und Fastnachtsspiele für Deutschland. Und was sie belegen, ist, daß in zahllosen Burgen, Bürgerhäusern und Bauernhütten der Mönch ein von der Hausfrau gerne gesehener Gast war. Und eben nicht nur wegen des geistlichen Zuspruches, sondern auch wegen des leiblichen Trostes. Ritterfrauen bevorzugten häufig den Mönch vor dem armen Ritter im Minnedienst, denn da war es der Mönch, der Geschenke brachte. In zahlreichen Dörfern, bei denen ein größeres Kloster in der Nähe lag, mag es nicht eine einzige mannbare Frau gegeben haben, die den Verführungen der Mönche entgangen ist. »Mönchskutten decken alles zu«, »Weiber decken sich am gernsten mit einer Mönchskutte zu«, »Weil die Männer ziehen nach Compostell, ihre Weiber sich legen auf Pumpernell«, »Der bloße Schatten eines Klosterturmes ist fruchtbar«, »Nur auf der Kanzel sind die Mönche keusch« – in Hunderten von solchen Sprichwort-Sentenzen hat so das Volk sein Urteil gesprochen. In dem mittelalterlichen Fragment » de rebus Alsaticis« schreibt der unbekannte Verfasser: »Um das Jahr 1200 hatten auch die Priester ziemlich allgemein Beischläferinnen, weil die Bauern sie gewöhnlich selbst dazu antrieben. Dieselben sagten nämlich: Enthaltsam wird der Priester nicht sein können; es ist darum besser, daß er ein Weib für sich hat, als daß er mit den Weibern aller sich zu schaffen macht.« –
Alles dies sind unanzweifelbare Dokumente für die Wesensart der öffentlichen Sittlichkeit des Mittelalters.
*
Entschleiert man in dieser Weise das mittelalterliche Leben, so ist es nicht mehr als eine ganz selbstverständliche Konsequenz, daß diese Auffassung einen ebenso unverblümten Ausdruck in der zeitgenössischen Karikatur gefunden hat, daß diese also zum großen Teil von derb-erotischen Elementen durchsetzt ist. Zu dieser Ansicht müßte man gelangen, auch wenn man noch kein einziges bestätigendes Dokument davon zu Gesicht bekommen hätte, weil es eben die, übrigens schon mehrmals betonte, innere Notwendigkeit der Karikatur ist, den Zeitton nicht nur nicht zu dämpfen, sondern ihn nach Möglichkeit zu steigern und zu übertreiben.

149. Obszöne Steinfigur an der Klosterschule von Champeaux 15. Jahrhundert
Ihren bezeichnendsten Ausdruck fand die derb-erotische Auffassung des Mittelalters figürlich wohl in den Grotesken, mit denen die Mehrzahl aller monumentalen Bauten des Mittelalters geziert war, vornehmlich die festen Schlösser und die Kirchen. Man nahm nirgends auch nur den allergeringsten Anstoß daran, daß bei diesen symbolischen Beigaben häufig in allergrößtem Realismus und Naturalismus gemacht wurde, kotig und zotig. Was unser modernes Schamgefühl aufs gröblichste verletzen würde, wurde mit vollster Unbefangenheit vor aller Augen gestellt. Wie die unzüchtigen Entblößungen der Hauptspaß bei allen Vergnügungen waren, so stand auch ihre Darstellung als symbolisches Beiwerk an Bauten in erster Reihe. Sehr bezeichnende Beispiele sind die Verzierungen an der Basis einer Säule der Kathedrale von Burgos (Bild 140), die Mauerskulptur an dem Metzer Turme »Desch« (Bild 150), der Mann über dem Südportale der Nürnberger Lorenzerkirche, der seinen eregierten Phallus präsentiert, und vor allem die ebenfalls noch heute vorhandenen beiden Steinfiguren am Schlosse von Blois (Bild 138 und 139). Der erotische Charakter dieser letzteren Darstellung tritt deutlich in der verschmitzten Neugier des Mannes hervor (vgl. auch Bild 142). Von höchster Derbheit ist die Darstellung des seine Notdurft verrichtenden Mannes an einem Chorstuhle der Kirche von Saint-Gervais; auch hier ist der weiblichen Neugier gedacht (Bild 143). Noch hanebüchener aber ist eine Chorstuhlverzierung aus der Klosterkirche von Champeaux (Bild 149). Der Sinn dieses Bildes ist ganz offenkundig, nämlich das, was mit der grotesken Öffnung, in die der kleine Kerl seine Notdurft verrichtet, symbolisiert sein soll. Ein ähnliches Motiv an einem profanen Orte, dem Stadthause von Noyon, zeigt das Bild 141; ein Narr hofiert in die Hand eines Mönches. Diese Gruppe hat der Bildhauer als Karyatide verwendet. Unzuchtsszenen zwischen Mönchen und Nonnen, Priestern und Frauen findet man heute noch an Kirchen und profanen Bauten (Bild 148). Häufig begegnet man auch dem Teufel in erotischen Kombinationen. »Wie der Teufel eine Nonne reitet«, ist ein mehrfach dargestellter Vorwurf. »Zu Wetzlar auf dem Dom reitet der Teufel auf der Nonn.« Außer diesen Darstellungen mit leicht ersichtlicher satirischer Tendenz gibt es noch eine ganze Reihe naiver erotischer Darstellungen, wie z. B. die des Adam und der Eva. Ein Beispiel dafür sind zwei Steinfiguren, die sich an der Säule einer Kirche in Eger in Böhmen befanden (Bild 145). In böhmischen Kirchen hat ein älterer Forscher übrigens eine ganze Reihe ähnlicher erotischer Grotesken gefunden, ebenso in italienischen Kirchen. Die Kirche von Schöngräber in Österreich besaß ehedem eine Menge erotischer und obszöner Skulpturen. Den alten Götterfiguren, vornehmlich Venus, begegnet man ebenfalls nicht selten in erotischer Behandlung. Bild 144 zeigt eine derartige aus einer wendischen Kirche stammende Figur. Das, wovon Demokritos-Weber singt: »Vivat, was die Eva hat Unter ihrem Feigenblatt!«, läßt der naive Künstler als eine Art Sparbüchse präsentieren. Das ist jedenfalls ein ganz köstlicher grotesker Witz. Ob vielleicht das Kirchenalmosen dort hinein gelegt werden sollte?
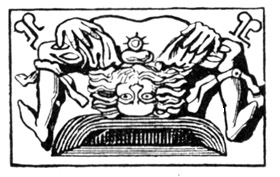
150. Skulptur an dem Turme »Desch« in Metz
Die Zahl solcher architektonischer erotischer Grotesken muß, den Resten nach zu urteilen, eine ganz respektable gewesen sein – eine ganze Reihe solcher und ähnlicher Stücke findet sich auch in dem Kapitel »Mittelalter« des ersten Bandes der »Karikatur der europäischen Völker« registriert –, aber eine geschämige Nachwelt hat hier ganz barbarisch gewütet, sie hat verständnislos das weggehauen, dessen tiefen Sinn sie nicht verstand und worin sie nur die erotische Formel sah. Nicht nur eine Unsumme wertvollster Kulturdokumente ist dadurch vernichtet worden, sondern sicher auch sehr viele bedeutsame Kunstschöpfungen einer derbfrohen Zeit. Was die im Dienste der Kirche stehenden Künstler mit diesen symbolischen Grotesken bezweckten, haben wir bereits im ersten Bande der »Karikatur der europäischen Völker« ausgeführt (S. 36). Es handelte sich beileibe nicht bloß um willkürliche, gedankenlose »Architektenscherze«, sondern zumeist um ernste Mahnungen.
Gar manches interessante Material zur Illustrierung der derben Erotik des Mittelalters findet sich auch in den Miniaturen der alten Handschriften und Bibeln; mancher derbsatirische Witz ist dort in irgendeiner kleinen Illustration oder einem Initial eingeschoben. Hier dürfte es noch viele ungehobene Schätze geben. Eine Probe aus einer Handschrift zeigt die Flagellationsszene zwischen einem Bischof und einer Nonne, die wir in Bild 146 reproduzieren; eine Probe aus einer moralisierenden Bibel zeigt das Bild 151. Aus einer Breslauer Handschrift stammt die satirische Darstellung des Badehauslebens, die Bild 152 zeigt; in dem mittelalterlichen Hausbuch ist das Badeleben ebenfalls in dieser Weise charakterisiert (Bild 147). Mantegna hat Skizzen von Badehausszenen hinterlassen, die die erotischen Ausschweifungen, die an diesen Orten getrieben wurden, in ihrer ganzen Zügellosigkeit widerspiegeln. Von ähnlicher Deutlichkeit ist der Meister mit den Bandrollen in seinem berühmten »Jungbrunnen«. Hier triumphiert die ganze erotische Derbheit des Mittelalters, köstlich und naiv. Nur um wieder »lieben« zu können, nützt man den Jungbrunnen, einzig zu diesem Zwecke will man ein zweites Leben leben. Der Liebe Spiele sind darum das erste, wenn die wiedergewonnene Jugend die Sehnen von neuem strafft, mit Stolz weist die Frau ihre jetzt wieder strotzenden Brüste, und nur wenig wehrt sie die Werbungen des ebenfalls wieder zum geschlechtskräftigen Jüngling gewordenen Mannes ab. Dieser kennt natürlich keine andere Methode, als die, so Gavan bei der jungfräulichen Königin Antikonie geübt hat (s. Beilage).

151. Miniatur aus einer mittelalterlichen Bibelhandschrift
Wenn die Kirche auf ihren Säulen und von den Dächern herab ihre satirischen Predigten an das Volk gehalten hat, so gab dies auf seine Weise die Antwort. Die unwürdigen Vertreter der Kirche waren der ewige Vorwurf der erotischen Satire schon in den Zeiten, die nur über eine ganz primitive Kunst verfügten. Eine Satire auf die Unzüchtigkeit der Mönche ist die zweite Figur auf Bild 132. Diese Karikatur ist gewiß einfach und deutlich und läßt keinen Irrtum zu. Etwas komplizierter ist das in demselben Bilde dargestellte, aus phallischen Symbolen zusammengesetzte Kreuz. Es mag wohl einem unzüchtigen Bischofe gewidmet gewesen sein; vielleicht als »Scherzartikel«. Als die Schilderungen und Berichte von den Ausschweifungen an den päpstlichen Höfen alle Welt erfüllten, entstand bekanntlich die Fabel von der Päpstin Johanna; das Papsttum wurde dadurch förmlich als Dirne personifiziert. Diese Fabel bot schon den Stoff zur ältesten kirchlichen Komödie »Frau Jutta«; derb und deutlich heißt es dort:

152. Badehausleben. Spottbild aus einer mittelalterlichen Handschrift
Dieweil der Papst uns hat belogen
Und uns all miteinander betrogen,
Daß er ist gewest ein Frauen,
So müssen wir wohl zuschauen,
Daß solchs nicht mehr geschehe.
And uns Hohn und Spott übergehe.
Darum wollen wir keinen zum Papst hab'n.
Wir sind es denn gewiß, daß er sei ein Mann,
Wir wollen einen Stuhl lassen machen,
Der da dienet zu solchen Sachen,
Da soll sich der neu Papst begreifen la'n,
Wie es ist um ihn getan,
Daß man da erkenne,
Ob er sei ein Hahn oder eine Henne.
Als die Renaissance die Kunst beweglicher gemacht hatte und man keck und kühn zu allem griff und alles künstlerisch meisterte, da wurde all das und vor allem der Mönche Lüsternheit mit Begier aufgegriffen und auf zahlreiche Arten satirisch kommentiert und variiert. In der Zeit der Renaissance waren die Dinge schließlich reif geworden, und der historische Konflikt forderte seine Lösung. –
Eine besondere, wenn auch nur kurze Würdigung muß den Bildern 133-135 und 136 und 137 noch geschenkt werden. Beim ersten Blicke glaubt man, es mit phallischen Grotesken aus dem Altertume zu tun zu haben. Dem ist jedoch nicht so, es handelt sich hier um groteske Schöpfungen des Mittelalters; die Abbildungen 133-135 sind Nachzeichnungen von Bleifiguren resp. Broschen aus dem 6.-10. Jahrhundert, die von Frauen zum Schmucke getragen wurden. Bild 136 und 137 dagegen sind Münzen mit grotesk erotischen Symbolen, männlichen und weiblichen Charakters. Der Sinn dieser Stücke ist durchweg augenscheinlich, daraus erweist sich aber eine sehr interessante Tatsache: Diese Stücke sind nichts mehr und nichts weniger als Belegstücke für die Tatsache, daß der Phalluskultus von dem Christentume nicht überwunden wurde, sondern daß er lange weiter blühte, und daß seinen Symbolen derselbe Fetischcharakter eignete wie im Altertum. Sie dienten denn auch sämtlich denselben Zwecken, es sind Amulette, Opfergaben usw., denen man dieselben mysteriöse Wirkungen wie im Altertum zuschrieb: Fruchtbarkeit bei Frauen, Verleihung einer gesteigerten Potenz beim Geliebten, Wiedererlangung geschwundener Potenz beim Gatten, Schutz gegen bestimmte Krankheiten usw. Der häufig groteske Charakter dieser Stücke reiht sie, gleichwie die entsprechenden Stücke des Altertumes, in den Rahmen dieser Arbeit ein.

153. Groteske phallische Illustration aus einer altenglischen Ballade
Aber nicht nur die Tatsache der Fortexistenz dieses Kultus ist interessant – und er blühte nicht nur im »dunkeln« Mittelalter, seine Spuren reichen bis zu uns herauf! –, sondern noch mehr, daß er in den verschiedensten Ländern weiterlebte, und das beweisen die verschiedenen Fundorte solcher Stücke: Frankreich, Italien, Deutschland, England (Bild 131 und 153). Schließlich ist noch ein dritter Umstand interessant: Hat das Christentum nicht vermocht, diesen heidnischen Kultus zu überwinden, so hat wohl aber dieser die Kraft besessen, die christliche Kirche zu unterjochen, indem er ihr seine Götter als Heilige aufgezwungen hat. Cosmos und Damian in Italien, Saint-Foutin in Frankreich, Vitus oder Veit in Deutschland sind nur der verchristlichte Heilige Priap. Das ist einer der Beweise für die Anpassungsfähigkeit der christlichen Kirche an die alten Naturreligionen, aber auch einer der Schlüssel für einen nicht unwesentlichen Teil der Siegkraft der christlichen Kirche.