
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
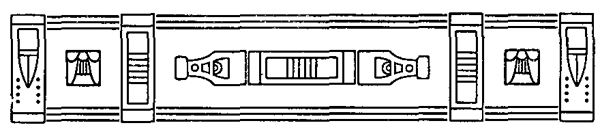
![]() Die »Dresden« schoß durch die Wellen, leicht nur senkte sich ihr Kiel und hob sich ihr Bug, wenn eine stärkere Woge, stärker als ihre Mitschwestern, ihr den Weg zum Silberstrom verbarrikadieren wollte.
Die »Dresden« schoß durch die Wellen, leicht nur senkte sich ihr Kiel und hob sich ihr Bug, wenn eine stärkere Woge, stärker als ihre Mitschwestern, ihr den Weg zum Silberstrom verbarrikadieren wollte.
Hundert Augen blickten angestrengt gen Südwesten, Land mußte kommen, jeden Augenblick mußte er auftauchen aus dem salzigen Bade, er, dessen Anblick schon Hunderttausende von seemüden Reisenden entzückt hatte, der Cerro von Montevideo, und Monte video erscholl es: 'nen Berg sehe ich! Und die Wogen mehrten sich und mehrten sich, je mehr der Steamer sich der Bucht von Maldonado näherte, aber sie wurden durchschnitten und durchstampft, siegreich drang die »Dresden« vor. Aus den fernen, grauen Küstenlinien wurden saftige, grüne Abhänge. Jetzt die Stadt selbst, eine neue Welt! Eine scharfe Wendung, die Einfahrt in den Hafen, rechts die Stadt, vor uns die Landungsbrücke, links der Cerro mit dem Fortgekrönten Gipfel, Niederrasseln der Ankerketten, Aufsteigen der Flaggen, Herabgleiten der Landungstreppen, die Sanitätskommission, das Zollkommando: »Station Montevideo!«
Hunderte von Barken und Kähnen umschwärmen das Schiff, leichtfüßige, gebräunte Burschen in mehr oder weniger pittoreskem Anzug, mit roten oder blauen Schärpen und offenem Hemdkragen stürzen die Treppen hinauf, eine Phalanx von barfüßigen Jungens klettern an den Seiten des Schiffes empor, gewandt über die Reling springend und » La grande, la grande, Señor« ertönt es aus fünfzig jugendlichen Kehlen, und Hunderte von kleinen weißen Zettelchen leuchten in ausgestreckten Händen dem verdutzten Auge des Fremden entgegen, dem gringo, der die Bedeutung von » la grande« noch nicht zu schätzen versteht.
In der Calle 25 de Mayo, der langgestreckten Geschäftsstraße der uruguayischen Hauptstadt, liegt das Hospital de la Caridad, ein mächtiger, gen Himmel strebender Quaderbau, das Krankenhaus für alle Klassen und alle Rassen, für Fremde und Einheimische. Und keinen Pfennig kostet es, um dort hinein zu kommen, um kuriert zu werden und seine Genesung abzuwarten, keine lästigen Fragen, werden gestellt, jeder Kranke und Hilfsbedürftige ist willkommen und Tausende machen von dieser Wohltätigkeit größten Stils jährlich Gebrauch. Und frägt man »Wer erhält dies alles, wer bezahlt die Ärzte und Lebensmittel und Erfrischungen und alles das, was solch eine Riesenanstalt erheischt«, so kann jeder Abcschütze dieses Schmuckkästchens aller Städte darüber Auskunft erteilen, und diese Auskunft wird lauten: la grande ...!
La grande ist die Königin von Montevideo. La suerte grande, oder kurz: la grande, das große Los. Mit la grande steht der Montevideaner auf, nach la grande späht er in seiner Zeitung, mit la grande geht er zu Bette und nur in dem Augenblicke, da der Tod sein Auge bricht, hört bei ihm die Hoffnung auf la grande auf.
Die große Loteria de la Benificiencia – die Wohltätigkeitslotterie, deren Ziehungen beinahe das ganze Jahr hindurch währen, erhält alle Anstalten der öffentlichen Wohlfahrt. Und sie hat einen Überschuß, trotzdem sie liberaler ist als der liberalste Milliardär, einen Überschuß so groß und mächtig, daß sie Straßen von Häusern bauen kann und den Mietzins einheimst und in Land spekuliert und Rinderherden züchtet und Geld verdient, unmenschlich viel Geld, und alle aussaugt, ohne daß sie es merken, und trotzdem Reichtümer verteilt, hier und da, wie eine wahrhaftige Königin: la grande!
Montevideo ist keine fromme Stadt, man sieht keine Mönche oder Priester in ihren Straßen; die Religion ist verpönt. Der Staat will nichts von ihr wissen. Und doch ist Montevideo die Stadt der Kirchen. Die mächtige Kathedrale und Hunderte von anderen Tempeln, dem Lobe Marias und fünfhundert anderer Heiligen geweiht, strecken ihre mächtigen Kuppeln und Kreuze gen Himmel empor. Der Staat kennt die Kirche nicht. Aber die Priester beherrschen die Frauen, und die Frauen ihre Männer und Söhne, und wenn auch auf Umwegen, regiert auch hier Rom, mächtig und allgebietend. – Der Zweck heiligt das Mittel.
Der Tag war heiß und schwül, als ich vor einem kleinen Café der Plaza de la Constitucion sitzend, das »Echo« las. Da ging ein Mann vorbei, ein langer, hagerer Mann, in dürftigem bürgerlichen Gewande, einen schäbigen Hut auf dem Kopfe. Sein Blick streifte das Blatt, das ich in den Händen hielt. Er ging einige Schritte weiter, dann drehte er sich wieder um und ging nochmals vorbei, zweimal, dreimal. Der Mann hatte irgend einen Wunsch, einen heißen Wunsch auf dem Herzen und zwischen den Lippen. Als sein Blick zum fünften oder sechsten Male den meinen, der fragend an seinen Augen hing, streifte, sagte er herantretend in einem merkwürdig gebrochenen Deutsch, das verzweifelt wie Schwyzer Ditsch klang und doch nicht jenes »herrliche« Idiom war, das in der freien Schweiz verzapft wird: »Guten Tag, mein Herr, dürfte ich Sie um die Zeitung bitten?« Ich lud ihn ein, an dem Tischchen Platz zu nehmen und etwas zu genießen. Das Getränk lehnte er dankend ab. Jetzt verstand ich ihn schon besser. Er sagte, er heiße Franz Scheible und wäre aus Schwaben, aber schon lange von zu Hause fort, wäre in Irland gewesen und jetzt seit ein paar Jahren hier. Ich schenkte ihm die Zeitung und gab ihm meine Adresse, damit er sich das Blatt alle Wochen holen könne. Das war der Anfang meiner Bekanntschaft mit Franz Scheible, Hochwürden und Pfarrer des Domes von St. Patrick, der großartigsten, prächtigsten und schönsten Kathedrale südlich von St. Peter, dem Wahrzeichen der ewigen Stadt.
Franz Scheible hatte Hunger, viel Hunger; schon seit langem hatte er sich nicht so recht satt gegessen, und er kam oft zu mir und verzehrte mein Abendessen mit mir, und berichtete mir, wie die Sachen sich weiter entwickelten. Sie entwickelten sich schlechter und schlechter. Seine Kleider wurden fadenscheiniger und sein Gesicht abgehärmter, sein Priestergewand verlor immer mehr und mehr den sammtenen und seidenen Glanz, der ursprünglich von einer reichgeschmückten Kanzel herabgeleuchtet hatte, der Kirchengeräte waren schon weniger geworden und dem unentbehrlichsten, allernotwendigsten Minimum bedenklich nahe gerückt, die Marmorsäulen leuchteten nicht mehr so recht, ihr wunderbares Rot, das einst der Stolz des Bauherrn und des Domherrn gewesen war, sah recht blaß aus, das Dach und der Dachstuhl zeigten nach jedem Sturme und Unwetter immer bedenklichere Lücken; und wenn der Himmel all dies sah und hineinschaute in all diese schwindende Pracht und Herrlichkeit dieses wunderbaren, zu Ehren Gottes erbauten Tempels, dann weinte er große Lachen von Tränen, und die standen dann auf dem prächtigen Mosaikfußboden und verunzierten und ruinierten diesen bis Seine Hochwürden, der Herr Pfarrer, mit einem alten Scheuerlappen auf den Knieen rutschend sie wieder aufgetrocknet hatte.
Es ist eine wundersame Geschichte, die mir Franz Scheible zu erzählen hatte.
Da war ein mächtiger Herr gewesen, ursprünglich ein armer Schlucker, irischer Schafhirt, der nach Uruguay gekommen war, um Geld zu verdienen, etwas Geld um zu essen und zu trinken und um dem Mütterchen daheim in Kilkenny monatlich ein paar Schillinge zu senden. Was er da in diesem Weidelande par excellence mit seinen knochigen Arbeitshänden angegriffen, war zu Gold geworden. Die Tiere liebten ihn; sie schnüffelten und errieten sofort in ihm den Hirten, der schon als Kind im Vaterlande da drüben zwischen ihresgleichen aufgewachsen war und nur Schafe, und Hammel und Kühe geatmet, gelebt, gedacht und geträumt hatte. Sie bekamen keine räudigen Krankheiten, sie setzten ein prächtiges Fell an, ihre Wolle und ihre Haare waren reich und glänzend, sie vermehrten sich mit einer Sicherheit und Schnelligkeit, die fast ans Übernatürliche und Unglaubhafte grenzte. Hugh Corcoran wurde reich und reicher, sein lebender Reichtum bevölkerte Quadratmeilen des saftigen Weidelandes, der Überschuß seines mächtigsten aller Tierparke bevölkerte die kühlen Räume von Hunderten von stolzen Schiffen und füllte Millionen von Zinnbüchsen in Gestalt von Fleischextrakt und eingemachten Ochsenzungen. Sein Bankkonto wuchs ins Unendliche; sein Mütterchen in Irland wohnte bereits in einer Villa der schönen Stadt Cork; er selbst war der Besitzer eines Palais an der 18ten Julistraße. Aber sein Sinn und seine Gewohnheiten waren einfache, sein Anzug blieb der eines irischen Landmannes, nachts streckte er seine müden Glieder auf den denkbar einfachsten Leinenlaken aus, so wie er sie in der alten Truhe, vom Mütterchen selbst gewebt, vor Jahren mit nach der neuen Welt gebracht hatte.
Er war fromm, wie alle Irländer. Der Papst in Rom, der gottähnliche und unfehlbare Vater in Rom, war für ihn das Orakel. Wo er konnte und wann er konnte, ging er in ein Gotteshaus, um zu knieen und um zu beten. Es war dies selbstverständlich für ihn. Sein Mütterchen da drüben in Irland hatte es ihm so gelehrt und ihm aufs Herz gebunden, als er in die weite Welt gezogen. Aber er empfand es als ein großes Übel, daß keiner der vielen katholischen Tempel einen englischsprechenden Geistlichen hatte, damit er beichten konnte oder sonstwie sich mit dem Reverend Pater aussprechen und diesem sein Herz ausschütten konnte.
Da kam er auf die Idee, eine Kirche zu bauen, einen großen, mächtigen Tempel, der Mutter Gottes und seinem Schutzheiligen, St. Patrick, geweiht. Darin sollte in seiner Muttersprache, in Englisch, gepredigt werden. Baumeister mußten kommen, die berühmtesten und tüchtigsten Baumeister, die das Land und Argentinien da drüben aufweisen konnte, und Pläne wurden gezeichnet und Material herangeschafft, große mächtige Quadern von den Felsen am Meeresstrande und Schiffsladungen von Marmor aus Carrara und Mosaik aus Venedig und Holzschnitzereien aus Padua und Verona. Eine Armee von Steinmetzen, Mosaikarbeitern, Bildhauern, Malern, Zimmerleuten, Ebenisten und Dachdeckern arbeiteten drei Jahre lang zur Ehre Gottes, des heiligen Vaters und seines Mütterchens. Geld spielte keine Rolle; die kostbarsten Kirchengeräte, Priestergewänder, samtene Altardecken, die wunderbarsten Gemälde, Statuen, Deckenmalereien und Mosaikfenster, vom Besten das Beste, das wollte Hugh Corcoran, und er rieb sich die Hände, wenn er die Fortschritte sah, und er schrieb Checks, so viel Checks, ganze Bücher von Checks, daß sogar sein Riesenbankkonto eine große Masse Zahlen auf der falschen Seite bekam.
Er hatte dem heiligen Vater in Rom von seiner Riesenidee nichts mitgeteilt; das hob er sich auf, bis die Kirche ganz fertig wäre, und er rieb sich die Hände und lächelte und pfiff verschmitzt ein irisches Liedchen zwischen seinen dünnen Lippen, wenn er daran dachte, wenn alles fertig sein würde und er den Dom, diesen wunderbaren Dom, diese seine ureigenste Schöpfung, dem heiligen Vater, der Mutter Gottes, seinem Schutzheiligen und seinem Mütterchen zu Füßen legen würde.
Der Moment kam: Die Mutter Gottes und der heilige Patrick nahmen das Geschenk an ohne sich weiter darüber auszulassen oder zu bedanken; sein Mütterchen wußte nicht recht, was sie dazu sagen sollte, sie hatte die vielen Checks, aus denen der Dom bestand, nicht gesehen und wußte wohl überhaupt nicht recht, was ein Check war. Aber eine Wirkung erzielte die Nachricht doch, beim heiligen Vater in Rom. Als dieser von der Kirche und den vielen Checks hörte und wieviel Zinsen dieses Kapital abwerfen könnte und sich die Sache einmal zusammen rechnen ließ, da war er böse, sehr böse über den guten Hugh Corcoran, von dem er bis dahin noch nie etwas gehört hatte. So eine Masse Geld in einen toten Bau zu stecken, anstatt die hübschen Checks als Peterspfennige in die päpstliche, ewig hungrige Kasse zu befördern, und anderen guten Pfarrern, von Gott, dem Herrn Erzbischof und einem hohen Klerus in Amt und Würden und Pfründe eingesetzt, so und mit so viel Aufwand Konkurrenz zu machen, das war gemein, das war unlauterer Wettbewerb, das durfte er nicht erlauben, dazu durfte er seinen Segen nicht geben.
Hugh Corcoran war wie vom Blitz getroffen, der heilige Vater, der Gott ähnliche und unfehlbare Vater war nicht mit ihm zufrieden. Er erteilte nicht seinen Segen und sandte ihm nicht einen Gott wohlgefälligen und gelahrten Priester, um seinem Tempel die höhere Weihe zu geben und ihr geistigen Odem einzuhauchen.
Wie ein geschlagener Mann, ohne Energie, lebte er sein Leben weiter. Dann fuhr er nach Irland zu seinem Mütterchen, um sich von dieser Rat und Trost zu holen. Auch diese wußte keinen und wandte sich an den Herrn Pfarrer, damit dieser einen Ausweg aus der Schwierigkeit anrate. Auch Hochwürden wußten keinen. Er kraute sich hinter den Ohren und riet Hugh Corcoran, sich an den Herrn Bischof zu wenden. Hugh Corcoran nahm einen großen Check mit für die bistümliche Kasse, aber alles, was er für das gewichtige Stückchen Papier erzielte, war die Adresse eines Geistlichen, der in Cork weilte, ohne Amt und Würden war und sich nach einer Pfründe sehnte. Dieser Geistliche war Franz Scheible. Ein glaubenstreuer Katholik, das war er, aber das war auch alles. Er hatte kein Talent, um zu scharwenzeln, um im gegebenen Augenblicke das Richtige nach oben hin zu tun, war kein guter Redner, seine Predigten entbehrten des Salzes und des Höllenpfuhls, sein Deutsch war schlecht, sein Englisch noch schlechter und sein Irisch unter aller Kanone. Dann war er in der Wahl seines Geburtsortes sehr unvorsichtig gewesen. Wäre er in Rom oder sonst wo im heiligen Lande Italien auf die Welt gekommen, dann hätten ihn sicher die hohen Herren in Rom, die den Stuhl Petri umgaben, nicht im Stiche gelassen. Aber so, ein deutscher Pfaffe ohne Protektion, pah, man hatte wirklich keine Zeit für ihn.
Mr. Corcoran nahm als einziges Ergebnis seiner Reise unseren Franz Scheible mit nach dem Rio de la Plata. Er installierte ihn, erlaubte ihm ein reichliches Taschengeld, aber das war auch alles, was er für ihn tun konnte. Napoleon konnte Armeen aus dem Boden stampfen, aber Hugh Corcoran mit allem seinem Reichtum keine Gemeinde. Der Traualtar, das Taufbecken als solche, blieben fromme Wünsche. Der Beichtstuhl hatte es etwas besser. Hugh Corocan war oft darin, manchmal um zu beichten, aber als er nichts mehr zu beichten hatte, zum Mittagsschläfchen. Er fühlte jetzt sehr oft das Bedürfnis nach Alleinsein und Mittagsschläfchen. Jetzt, wo der Traum seines Lebens erfüllt war, machte ihm das Leben keinen Spaß mehr, er hatte nichts mehr zu erstreben. Und als ob die Lämmlein, Schäflein, Kühlein und Öchslein da draußen sämtlich dem großen Krummstab des großen Hirten in Rom in magischer Unterwürfigkeit ergeben gewesen, so machten sie, seitdem ihr Brotherr bei jenem in Ungnade gefallen war, nicht mehr mit. Der fruchtbare Boden um sie herum bewirkte nur das Gegenteil bei ihnen. Sie legten sich trotz Schiffsladungen von Patentmedizinen alle möglichen und unmöglichen neumodischen veterinärischen Krankheiten zu, starben mit einer Wollust, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre, wie die Fliegen, kurzum, so wie Hughs Glücksstern bis zu jenem unglückseligen Tage, wo das Kreuz auf der Kuppel seines Domes sein frommes Werk krönte, wie eine Rakete heraufgezischt war, mit eben so großer »Volupticität«, wie wir in Quarta sagten, raste er, dem Gesetze der Schwerkraft folgend, wieder dem platten Boden zu, dem platten Boden der Gleichheit, der Armut und des mühseligen Erwerbs.
Als Hugh Corcoran so in unglaublich schneller Zeit sein Giro- und Bankkonto unter dem mächtigen Radier-Gummi einer nicht endenwollenden Krise verschwinden sah, als die platten Dächer seiner Häuser die Hypotheken nicht mehr tragen konnten und der Subhastation anheim fielen, als sein letzter Ochse in einer Zinnbüchse verschwunden war und als er nicht einmal mehr seinem Mütterchen die monatliche Rimesse und Hochwürden Herrn Scheible nicht mehr das wöchentliche Taschengeld in den Klingelbeutel werfen konnte, sich also faktisch eines häßlichen Tages vis-à-vis de rien sah, da ging er nochmals schwankenden Schrittes in seine Kirche, befahl diese Hochwürden, seinem Mütterchen und sich selbst, seinem Schutzheiligen, St. Patrick, ging auf einen großen Schnürboden, wo in glücklicheren Tagen Tausende von Hammelpelzen gehangen hatten und – hängte sich auf, mit dem Bewußtsein, selbst der größte Hammel seiner Zeit gewesen zu sein.
Hochwürden suchte seinen Herrn auf, schnitt ihn ab und begrub ihn in geweihtem Boden mit einem Segenswunsch. Er log zum ersten Mal in seinem Leben, und diese fromme Lüge war schöner und heiliger, als alle seine Litaneien, die er vorher manchmal, oft gedankenlos, heruntergemurmelt hatte, er erzählte den Leuten, daß sein guter Herr, vom Schlage getroffen, gestorben sei.
Der Hirte ohne Herde, denn das war unser guter Franz Scheible, fand sich also als Waise vor. Der heilige Vater in Rom wollte nichts von ihm wissen, sein guter irdischer Papa war nicht mehr. Er hatte einen großen Dom mit viel Inhalt, eine schöne Amtswohnung mit allem, was dazu gehört, aber er hatte auch einen hungrigen Magen, eine leere Speisekammer und ein noch leereres Portemonnaie.
Von den wenigen Engländern in der Stadt war nichts zu holen, denn diese waren sämtlich protestantisch und hatten Mühe genug, ihren eigenen Pastor durchzufüttern, also mußte er auf die Katholiken, auf die Eingeborenen, zurückgreifen, und für diese waren schon zirka 50 Kirchen zu viel da.
Die wirklichen Pfarrherren hatten es sehr gut, und die anderen, die vielen jüngeren Italiener und Spanier, die noch keine eigene Pfarre hatten, wurden zusammen bei einem großen gemeinsamen Mittags- und Abendtisch so mit durchgefüttert. Aber um unseren braven Schwaben kümmerte sich keiner. Man betrachtete ihn als einen ungebetenen Eindringling, man »schnitt« ihn und hätte ihn am liebsten vor ein kirchliches Gewerbegericht gestellt. Der hungrige Franz kam auf die Idee, den spanischen Kindern englischen Unterricht gratis zu geben, um auf diese Art nach und nach eine englisch-katholische Gemeinde aufzuziehen. Aber von den 30 oder 40 Knäblein und Mägdlein, die anfangs seinen Hörsaal bevölkerten, blieben die meisten und schließlich auch die letzten weg. Dann suchte er sich eine Gemeinde von alten Mütterchen und Betschwestern zu bilden, um wenigstens ein kleines, wenn auch nicht zahlungsfähiges Auditorium für seine Messen zu haben. Die Mütterlein kamen auf sein Ersuchen und blieben wieder weg, da sie sein scheußliches Spanisch nicht verstanden. Dann stellte er einen äußerst niedrigen Tarif für Trauungen, Taufen und Begräbnisse auf, schrieb ihn mit der Hand ein paar Hundertmal ab und verteilte ihn unter die Nachbarschaft; auch das zog nicht. Die Mäuse in seiner Kirche waren noch zehntausendmal ärmer, als die proverbialsten Kirchenmäuse, und das Hungertuch, an dem er nun bereits seit Jahr und Tag nagte, war so in Fetzen gegangen, daß es nur noch ein einziges großes Loch bildete.
Wenn ich auch den besten Willen hatte, diesem ärmsten aller armen Teufel zu helfen oder zu raten, so erschien dies schier unmöglich. Daß er seinen Posten, auf den ihn der gute Hugh Corcoran gestellt hatte, nie und nimmermehr bis zum letzten Atemzuge verlassen würde, lag auf der Hand. Dazu oder zu etwas ähnlichem zu raten, wäre eine Dummheit, eine Beleidigung, eine Gemeinheit gewesen. Reich war ich selbst nicht, und ihm Geld anzubieten, hätte nur dazu geführt, mir seine mir sehr lieb gewordene Freundschaft verlieren zu machen. Also mußte eine List benutzt werden, und dazu konnte nur und sollte der Klingelbeutel herhalten, der Klingelbeutel, der wie sein Vetter, der andere Beutel, den die Zauberkünstler auf der Bühne so geschickt und so niedlich benutzen, um in ihm ihre Taschenspielerkünstlein vor den Augen des Zuschauers zu verbergen.
Ich hatte ein paar Freunde, die keine Katholiken waren, aber des guten Zweckes halber gern als solche paradierten. Denn eine kleine Gemeinde mußte gebildet werden, denn wenn ich allein des Sonntags zu Scheibles Predigt erschienen wäre, so würde er ja doch sehr bald erkannt haben, wer das Goldstücklein in den Gabenstock getan hatte, das Goldstücklein, das den Leib und die Seele von Hochwürden zusammenzuhalten bestimmt war. Eine Zeitlang ging dies auch ganz gut. Der gute Wille war stark, aber das schlechte Fleisch noch viel stärker in seiner Schwäche. Nach und nach blieben die deutschen jungen Herren, die diese künstliche Gemeinde bildeten, wieder weg, den Sonntagmorgen unter molligen Decken hinzuträumen und die Belohnung eines süßen Schlafes nach einer stark angebrochenen Sonnabend- zu Sonntag-Nacht mit schwerer Sitzung im »Gambrinus« wurde von ihnen als dazu berechtigt bedeutend dem Anhören einer holprigen Predigt aus den Lippen meines Schwaben vorgezogen.
Und so geschah es, daß mein frommer Betrug, denn Franz Scheible sollte und durfte nicht erfahren, daß ich aus Mitleid die einzige Quelle geworden war, aus der sein Dom und er ihren Unterhalt schöpften, ihm furchtbar klar wurde und eine tiefe Traurigkeit in sein Herz zog.
Er war zu gut, um ärgerlich auf mich zu sein, aber er schrieb mir einen langen Brief, in dem er mich bat, nicht mehr zur Messe zu kommen, da er keine Almosen annehmen könne. Er ließ sich auch nicht mehr bei mir sehen und öffnete mir, als er mich durch das Schiebefenster seiner bereits klapprigen Kirchentüre erkannt hatte, diese nicht. Da war guter Rat teuer. Ich befürchtete eine Katastrophe. Wollte er auf seinem Posten wie ein braver Soldat sterben, in einem Lande vor Hunger sterben, wo der ärmste Bettler, der frech genug war zum Betteln, ein verhältnismäßig angenehmes Dasein führte?
Umso überraschter war ich, als ich ihn eines Tages in freudigster Stimmung traf. Seine Augen glänzten, sein Blick schweifte siegestrunken vor sich hin, er sah niemand, denn sein körperliches Auge war fast untätig, aber sein geistiges Auge war in Funktion und zwar augenscheinlich in sehr angenehmer Funktion, denn es weilte in höheren Sphären und sah einen irdischen Himmel offen. Obgleich ich ihn laut begrüßte, mußte er sich erst einen Augenblick sammeln, um mit seinen Gedanken zur Erde zurückzukehren und mich zu erkennen und mir meinen Gruß zurückzugeben. Bald, so klärte er mich auf mein erstauntes Fragen auf, würde alle Not ein Ende haben, bald würde er Reichtümer, unermeßliche Reichtümer sein Eigen nennen können, nicht um sie für sich zu verwenden, sondern um mit diesem irdischen Mammon seinem Dome wieder den alten Glanz zu verleihen, seinen Glanz und seine Herrlichkeit zu Ehren Gottes und seines allergnädigsten Herrn Schutzheiligen, St. Patrick. Ich starrte ihn sprachlos an. Er erriet mein Befremden über seine Worte und erklärte: Er hatte die wenigen Habseligkeiten und seine kleine Bibliothek, die er noch von Europa mitgebracht hatte, an einen Trödler veräußert und von dem Erlös ein Los gekauft. La grande, wirklich la grande! wie ihm der Junge versichert hatte, und es war die Nummer gewesen, ein großes göttliches Wunder war geschehen, dieselbe Nummer, die ihm der heilige Patrick mit himmlischem Lächeln und sanften Trostesworten, als er verzweifelt dessen Hilfe angefleht, gesagt und gezeigt hatte.
Für den nächsten Tag war schon die Ziehung angesagt. Also nur noch 24 Stunden hatten in die Ewigkeit zu wandern, bis daß alle Not, alles irdische Elend für seinen Dom und für sich ein Ende hatte. – – – – – – – – – –
Vierundzwanzig Stunden gingen ins Land und la grande wurde gezogen. Schreiend und johlend zogen Hunderte von Jungen und halbwüchsigen Burschen durch die Straßen, wie dies immer der Fall war, und schrien jedem, der es wissen oder nicht wissen wollte, die Nummer zu, die diesmal aus einem armen Teufel einen reichen Mann gemacht hatte. Klopfenden Herzens ließ ich mir die Nummer sagen und von zehn, zwanzig Jungen bestätigen, um leider zu erfahren, daß der heilige Patrick meinen guten Scheible im Stich gelassen hatte.
Die Nummer la grande war nicht die Nummer, die Franz Scheible tags zuvor in seinen zitternden Händen gehalten hatte, sondern wie die Abendzeitungen meldeten, war es ein bereits als Millionär und Wucherer verschriener alter Halunke, dem die Heiligen auch diese Perlen in den Trog geworfen hatten. Eulen nach Athen tragen!
Hatte sich St. Patrick verguckt, hatte sich Franz Scheible verhört oder war der Schutzheilige Irlands, Hugh Corcorans und so auch Franz Scheibles in den Dienst des heiligen Vaters zu Rom getreten, um mit diesem letzten Streiche dem ungeweihten Dome, diesem Stachel im Auge des heiligen Vaters, den Todesstreich zu versetzen?
Franz Scheible wurde am nächsten Tage in der Sakristei tot aufgefunden. Ein Herzschlag hatte dem bereits von Entbehrungen äußerst schwachen Manne ein Ende gemacht. In seinen erstarrten Fingern hielt er ein Stückchen Papier, ein verfallenes Los, la grande, das nicht la grande war.
