
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
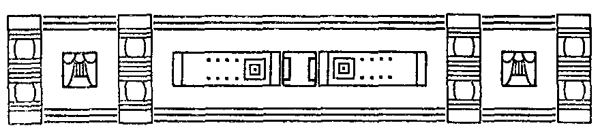
![]() Weihnachten nahte mit Siebenmeilenstiefeln: es lag in der Luft, es schimmerte aus tausenden von Schaufenstern, es schlummerte in Millionen von erwartungsvollen Kinderherzen und es bangte in aber und aber Millionen von väterlichen Portemonnaies, es rasselte auf unzähligen Lastwagen durch die Geschäftsstraßen, es drückte Flotten von Schiffen tiefer in die salzige Flut, es durchquerte in »Elektrischen« Plätze, Straßen und Vorstädte und es surrte auf zahlreichen öffentlichen und Privatautos die Verkehrsadern tutend und hupend, als riefen sie höhnisch der Welt zu: Wir sind die Herren der Stadt und von allem, was so drum und dran hängt. Auf den Trottoirs, da schob es sich, da wogte es, daß sie brausenden Bergbächen glichen, die einen schoben und die anderen wurden geschoben. So geht es auf der Welt, und die, die es verstehen zu schieben, das sind die, die da vorwärts kommen und an die Spitze gelangen,
an der immer noch Platz ist. Deutschland schiebt auch und treibt, und es ist gut so, daß es immer noch Rivalen hat, die sich schieben und treiben lassen, und wo man hinkommt in der Welt, da findet man Deutsche, sei es im entferntesten, im verborgensten Handelsplätzchen
up the river, und da schiebt er die Konkurrenz beiseite und treibt Handel und Industrie, Gewerbe und Nächstenliebe, und wieder ihn treibt ein unwiderstehlicher Unternehmungsgeist, der ihm angeboren – und so weiter
ad infinitum.
Weihnachten nahte mit Siebenmeilenstiefeln: es lag in der Luft, es schimmerte aus tausenden von Schaufenstern, es schlummerte in Millionen von erwartungsvollen Kinderherzen und es bangte in aber und aber Millionen von väterlichen Portemonnaies, es rasselte auf unzähligen Lastwagen durch die Geschäftsstraßen, es drückte Flotten von Schiffen tiefer in die salzige Flut, es durchquerte in »Elektrischen« Plätze, Straßen und Vorstädte und es surrte auf zahlreichen öffentlichen und Privatautos die Verkehrsadern tutend und hupend, als riefen sie höhnisch der Welt zu: Wir sind die Herren der Stadt und von allem, was so drum und dran hängt. Auf den Trottoirs, da schob es sich, da wogte es, daß sie brausenden Bergbächen glichen, die einen schoben und die anderen wurden geschoben. So geht es auf der Welt, und die, die es verstehen zu schieben, das sind die, die da vorwärts kommen und an die Spitze gelangen,
an der immer noch Platz ist. Deutschland schiebt auch und treibt, und es ist gut so, daß es immer noch Rivalen hat, die sich schieben und treiben lassen, und wo man hinkommt in der Welt, da findet man Deutsche, sei es im entferntesten, im verborgensten Handelsplätzchen
up the river, und da schiebt er die Konkurrenz beiseite und treibt Handel und Industrie, Gewerbe und Nächstenliebe, und wieder ihn treibt ein unwiderstehlicher Unternehmungsgeist, der ihm angeboren – und so weiter
ad infinitum.
Ich stand am Fenster und »starrte« auf die Straße hinab. Ach, wie gerne hätte ich es geschaut, dieses freudige Getümmel auf den Straßen, die vor Aufregung und Erwartung glühenden Kindergesichter und die glückstrahlenden Mienen der reich mit Schätzen beladenen Mütter, Tanten und Schwestern.
Es war nun das dritte Mal, daß es mir versagt war, freudig zu sein mit den Freudigen. Aber nicht der Gedanke war es, leer auszugehen bei dem großen Freudenfeste, sondern die beklemmende Tatsache, nicht auch die erfreuen zu können mit einer Überraschung, einer Aufmerksamkeit, einer Gabe, welche im verflossenen Jahre Aufopferung, Nachsicht, Freundlichkeit und Güte dem Blinden erwiesen hatten. Ja, die Finanzen – wenn die nur besser wären. Wie gerne hätte ich Fräulein Martha zum heiligen Abend eine kleine Freude bereitet für alle die Zeit, die Geduld, die treue Pflichterfüllung und die stete Bereitwilligkeit, die die ganze Zeit auch nicht einen Augenblick gewankt hatte, immer gleich gütig bereit, dem Blinden sein trauriges Dasein zu erleichtern.
Ich werde eine Weihnachtsgeschichte schreiben, dachte ich bei mir, das ist aktuell und ewig neu, beliebt bei Alt und Jung, Hoch und Niedrig. Ich werde mir Mühe geben, vielleicht hilft mir meine Phantasie, Gestalten und Szenen heraufzuzaubern, die die Herzen rühren. Man wird die Geschichte lesen und man wird sie mir bezahlen und dann werde ich Geld haben und ich werde Fräulein Martha etwas Schönes kaufen und sie wird sich freuen und ich werde auch meine Weihnachtsfreude haben. Der verflixte Optimismus, der wieder mit mir davon lief. Aber rasch ans Werk, gesagt, getan; keine Zeit verlieren, ehe die Gedanken fliehen und die strenge, frische Weihnachtsluft einem trüben Matschwetter trostloser Gedankenversumpftheit Platz macht.
»Fräulein – bitte, kommen sie doch herein, wenn Sie Zeit haben und bringen Sie einen großen Konzeptbogen mit und das große Tintenfaß und eine neue Feder und vergessen Sie nicht das Linienblatt, denn Sie wissen, sonst geht es abwärts mit meiner Literatur«, und Fräulein Martha erschien gleich darauf, lachend, mit den gewünschten Utensilien und fragte: »Na, was soll ich denn schon wieder schreiben, wahrscheinlich wieder so eine dumme Geschichte von Mexiko oder dem Pfefferland, voll von alten Hexen, Giftmischern, Haifischen und kahlköpfigen Aasgeiern.«
»Nein«, sagte ich, »heute mache ich in besserer Literatur, ich habe eine Idee, eine sehr gute Idee, ein Weihnachtsmärchen, wie es noch nicht gedruckt ist, etwas ganz Neues; also bitte, Fräulein Martha, rücken Sie das Linienblatt zurecht, tauchen Sie ein und schreiben Sie.« –
Dabei fing ich an, energisch im Zimmer auf und ab zu gehen, so gut meine Blindheit eine Stabilität dabei möglich machte und drehte die Kurbel in meinem Phantasiekasten auf und ließ die Gedanken surren und surren und öffnete die Lippen und schluckte und schwieg.
»Nun,« interviewte mich Fräulein Martha, »ich bin bereit, die Tinte trocknet mir ja auf der Feder ein, fangen Sie doch endlich an.« Da kam mir die Idee zurück und ich diktierte frisch darauf los: Es war einmal – und da blieb ich stecken, und nach einer Minute oder so fragte sie schalkhaft: »War es wirklich einmal?« und ich versicherte ihr ernsthaft, daß dem wirklich so sei, und dann gestand ich ihr kurz, daß alle die schönen Gedanken wieder weggeflogen waren oder vielmehr nicht aufkommen konnten bei der Konkurrenz auf der Straße mit ihrem frohen Lachen, ihrem Scharren und Trampeln, ihrem Surren und Pfeifen, Fauchen und Tuten, die lebende Weihnachtsbilder schuf, wirkliche und wahrhaftige, neben der meine Phantasie ein blasses Daguerrotyp blieb. –
»Wissen Sie was, Fräulein,« sagte ich, um mir aus der Verlegenheit zu helfen, »wir wollen hinunter auf die Straße gehen und uns in das frohe Gedränge da unten mischen und horchen und lauschen und uns drängen und schieben lassen und so selbst mitwirken in dem großen lebenden Bilde, das sich da abspielt und das sich Weihnachtstrubel nennt, und da werden mir die Gedanken wieder kommen, denn mit den frohen Kinderstimmen und mit dem Knarren der Waldteufel und den Witzen der Hampelmänner wird die Kindheit wieder wach in mir werden und die Weihnachtsfeen, die mir im Laufe der Jahre in dem wirren Getriebe der Welt fremd geworden sind, werden meinem Geiste wieder näher kommen und mir Ideen und Gedanken zuflüstern, Weihnachtsgedanken, und die wollen wir festhalten und sie schnell hinaufbringen in unser Stübchen und Sie werden sie niederschreiben und der Drucker wird sie drucken und das weite Publikum, Groß und Klein, wird sie lesen mit Erstaunen, daß das Weihnachtsmärchen noch nicht ausgestorben ist, daß es noch Platz hat und lebt und gedeiht in dem großen Babel, in dem wir leben, der großen Handelsstadt, der man nur den einen Gedanken zuschreibt, Geld zu verdienen, Geld, Geld und immer wieder Geld! Und nun, liebes Fräulein, laufen Sie schnell und setzen Sie ihr Pelzbarettchen auf und ziehen Sie den Silbergrauen an, der zwar schon etwas alt aber mollig ist, denn es scheint recht kalt draußen zu sein.« Ich tappte nach meinem Hut und Parapluie, und ehe ich noch diese beiden notwendigen Appendice zusammen hatte, war sie auch schon wieder da, fix und fertig und meinte: »Nun aber schnell und halten Sie sich heute recht fest an meinem Arm, damit Sie mir in dem Gedränge nicht abhanden kommen.«
Das Lärmen und das Getöse unten war so groß, daß an eine Unterhaltung kaum zu denken war und einem das eigene Wort fremd vorkam, so klanglos verschwand es in dem Tohuwabohu der großen Verkehrsader. Zwei, drei, vier Übergänge von Seitenstraßen wurden glücklich genommen, wenn auch das Lavieren in den Wogen des Riesenverkehrs nicht ganz leicht war. Da, an einer Ecke nicht weit vom Hauptbahnhof kam der erste Chok und zwar ein so heftiger, daß die Leeseite unseres Schiffleins Havarie erlitt. Ein Frachtdampfer in Gestalt eines schwerbeladenen glücklichen Vaters, der wahrscheinlich noch schnell einen Zug erwischen wollte, war in der Hitze seiner Bestrebungen mit seiner Ladung, einem großen harten Pakete, mit dem Teile meines Gesichtes kollidiert, in welchem sich mein linkes Auge befand. Ich hatte entschieden Pech mit meinen Augen, das war klar, früher mit den echten und jetzt mit der Ersatzreserve. Ein heftiger Schmerz in der Augenhöhle sowie ein gewisses nasses Gefühl darin, wie es nur das Quellen von Blut mit sich führt, belehrte mich, daß der Anprall nicht ohne unangenehme Folgen geblieben war. Glücklicherweise war der gläserne Augapfel nicht zerbrochen, was ich erst befürchtet hatte. Davon überzeugte sich Fräulein Martha. Aber da das Blut langsam weiter hervorsickerte, wollte sie die Sache nicht so ohne weiteres auf sich beruhen lassen und sagte: »Wir wollen gleich zu einem Arzt gehen, damit er die Wunde ordentlich untersucht und verbindet.« Und sie strengte ihre Augen rechts und links an, um die Platte des nächsten besten Äskulap zu entdecken, zu entziffern.
»Eureka,« frohlockte sie schon nach wenigen Schritten, »da hätten wir schon einen und«, nähertretend, »sogar einen Augenarzt, da haben wir ja verhältnismäßig noch Glück«. Das Mädchen oben wollte uns, da die Sprechstunde bereits vorüber war, nicht hereinlassen, aber als sie das blutige Taschentuch sah, wurde sie doch weicher gestimmt und meinte, sie wolle doch nachsehen, ob der Herr Doktor noch im Studierzimmer sei. Der Herr Doktor war noch im Studierzimmer und wir wurden hineingeführt.
Der Arzt, eine hohe Erscheinung in den Fünfzigern, wie die Richtung und der Tonfall seiner Stimme mir verrieten, – ich bin nämlich seit meiner Erblindung so eine Art Sherlock Holmes geworden – war sichtlich perplex, als er seine Untersuchung begann: Ein Mann mit beiden Augen aus Glas, das wäre ihm in seiner langen Praxis doch noch nicht vorgekommen, meinte er. Er stillte das Blut und verband die kleine Wunde, dann sagte er: »Die Sache hat nichts auf sich, in wenigen Tagen wird es nur noch eine Erinnerung sein, aber erzählen Sie mir doch, wie sind Sie eigentlich zu diesem furchtbaren Zustand gekommen, wie haben Sie beide Augen verloren?«
Ich berichtete ihm kurz, wie ich an Bord eines Schiffes, kurz vor der Ankunft in Amerika, durch die Messerstiche eines Irrsinnigen mein linkes Auge eingebüßt hatte und wie nach vielen Jahren auch die Sehkraft des rechten Auges verloren gegangen, sodaß auch dieses dem Operationsmesser des Arztes zum Opfer fallen mußte.
»Wer hat die Exkulpationen gemacht?« forschte er weiter. »Die erste führte Professor Knapp in New-York, die zweite Professor Silex aus.« Der Doktor ließ eine kurze Pause in der Unterhaltung eintreten, er überlegte sichtlich, dann bemerkte er: »Und wann sagen Sie, wurde die erste Operation ausgeführt?« – »Im Mai 1882.« – Der Arzt schien diese Auskunft erwartet zu haben. Dann frug er weiter: »Und besinnen Sie sich noch auf Ihre Pflegerin im Hospital auf Wards Island?« Das Herz stand mir einen Augenblick still. Die Frage war mir zu unerwartet gekommen. Dann sagte ich stockend und mit etwas zitternder, unsicherer Stimme: »Meinen Sie Fräulein Clara, unsere Clara oder »Schwesterchen«, wie sie von den Deutschen in der Ward allgemein genannt wurde, Herr Doktor?« – »Dieselbe!« antwortete er mit etwas heiserer Stimme.
»Ja, glauben Sie, Herr Doktor, daß ich die vergessen hätte, oder auch nur einen Augenblick vergessen könnte, die mir damals mein junges Leben, an dem ich gar sehr hing, gerettet und, was mehr, viel mehr ist, mir den Glauben an Gott, die Menschheit und eine Gerechtigkeit in den schwersten Stunden meines Daseins wiedergegeben und dies in einer Stunde, wo ich voller Verzweiflung an allem, was einem Menschen heilig sein kann, nur den einen Gedanken hatte, mein unglückseliges Ich ohne viel Aufhebens in die Ewigkeit einzuschmuggeln!« Ich hielt einen Augenblick inne, da ich nicht recht wußte, ob mein Erzählen den Herrn derart interessierte, daß ich seine Aufmerksamkeit fesselte. Er sagte kurz: »Fahren Sie fort!«
Es war am Tage meiner Einlieferung in das Hospital, als die Sache sich ereignete. Die amtierenden Ärzte hatten meine Wunden frisch verbunden und kopfschüttelnd Bemerkungen über den schlechten Verband des Schiffsarztes gemacht, Der Blutverlust war ein ungeheurer gewesen und der Pulsschlag äußerst schwach. Nach einigen Anordnungen verließen mich die Herren wieder, nur die Nurse blieb noch kurze Zeit bei mir. Es war ein junges deutsches Mädchen mit äußerst gutmütigem Gesicht, mit wahren Madonnenzügen.
Ich blieb allein. Der erste Elan nach der ungeheuren Aufregung der Einfahrt in den Hafen und der ganzen Affäre war einer großen Abspannung gewichen. Die Reaktion war eingetreten. Gleichgültig für alles, was um mich her war, döste ich vor mich hin. An Hause dachte ich wenig. Ich hatte zu wenig Gutes dort erfahren, um mit tieferen Gefühlen daran zu hängen. Seitdem der Vater nach kurzer Witwerschaft die rote Schauspielerin als zweite Frau ins Haus geführt hatte, war das Wort »Heim« für mich nur noch ein leerer Begriff gewesen. Einzelne Gedanken kamen und gingen, aber es war mir unmöglich, sie festzuhalten. Selbst die Tatsache, daß ich mit 20 Jahren ein Krüppel geworden, auf Lebenszeit entstellt war und nun in diesem Zustande den schweren Kampf ums Leben in einem fremden Lande auszufechten hatte, war mir in diesem Augenblicke nur unklar und verschwommen und beunruhigte mich wenig. Ein Meer von Stumpfsinn hatte sich meiner bemächtigt und ich hatte das Bewußtsein dieses Stumpfsinnes. So ernst wie die Situation war, verließ mich auch hier der Humor nicht und unwillkürlich lächelten meine Lippen, als mir die alte Melodie aus der Studentenzeit einfiel, die ich vor mich hinsummte:
»Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen,«
»Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust!«
Fremde Laute tönten hier an mein Ohr, man sprach englisch mit starkem irischen Accent, interessiert lauschte ich den Worten. Hier war eine Gelegenheit, meine Sprachkenntnisse zu bereichern und die durfte ich nicht vorübergehen lassen. Es waren zwei Wärter, die an das Fußende meines Bettes getreten waren, Männer mit rohen breiten Bulldoggengesichtern, mehr Fleischergesellen, denn Krankenwärtern gleichend.
» I say, Jimmie«, sagte der eine, » the doctor 's said this 'ere dutchie is a sure goner. He won't pass the night. I've been to a surprise party last night and I need my night's rest. Give 'm a something into his »nightcap«, so that I won't have to run after the doctor«.
» All right, Charlie«, antwortete Jimmie, und die beiden Edlen entfernten sich, um beim Schichtwechsel noch schnell a drop o' »Old Scotch« hinter die Binde zu gießen, den wievielten heute, war wahrscheinlich schwer zu sagen.
Ich hatte das Gespräch, das im breitesten Brogue gesprochen worden war, wohl verstanden. Ich sollte, um den gemütvollen Charlie, die Nachtruhe nicht zu stören, mittels einer Dosis »Etwas«, vielleicht Laudanum in meinem Nachttrunk geräuschlos ins Jenseits befördert werden, da doch nicht mehr viel an mir zu retten war. Eigentlich amüsierte mich die Sache im ersten Augenblick, dann übermannte mich wieder die bleierne Apathie. Ich schloß die Lider. Ohne das Bewußtsein zu verlieren, hatte ich doch nicht mehr die Kraft, einen richtigen Gedanken zu fassen und den Ereignissen entgegenzuhandeln. –
Stunden vergingen. Ich hörte die Glocke auf dem Turme 5 Uhr schlagen. Unwillkürlich zählte ich die Schläge nach, die Ewigkeit rückte mit Schnellzugsgeschwindigkeit näher, und doch wähnte ich jede Sekunde eine Ewigkeit. Die Schatten der hohen Bäume vor den Fenstern der »Ward« wurden länger und länger und hatten Teile des Raumes, in dem ich lag, bereits in graues Dunkel gehüllt, während zwischendurch auf den Dielen sich noch der helle Sonnenschein spiegelte und die Luft darüber in Myriaden von Atomen pirouettierte.
So groß auch die Apathie und Lethargie, die von meinem Körper Besitz ergriffen, war, hatten doch die Glockenschläge eine Wirkung auf meinen Geist hervorgebracht. Der Nachttrunk der den Abgrund zwischen Dasein und Ewigkeit in leichtem Bogen überbrücken sollte, war nun so nahe gerückt, daß seine Existenz doch nicht mehr so ganz von mir ignoriert werden konnte. Meine Gedanken wurden wieder rebellisch. Warum mir dies alles? Warum sollte ich mit meinem Leben dafür büßen, daß ich eine gute Tat begangen hatte? Warum? Warum? Die Doktrin von der göttlichen Vorsehung wollte mir in diesem Augenblicke absolut nicht einleuchten. Ich begann gegen sie zu eifern und eiferte mich, wenn man bei meiner damaligen minimalen Willenskraft es so nennen kann, in eine gewisse auflehnende Gereiztheit gegen die Gottheit hinein. Dann erinnerte ich mich der Auferstehung. Da wurden ja wohl die guten und bösen Taten gewogen. Ich schauderte. Nur eine gute Tat? Nicht mehr? Ich begann hastig Inventur zu machen. Ich zermarterte mein Hirn und suchte. Ich fand auch noch einige mehr, die eventuell dafür gelten konnten, wenn der Herrgott nicht so genau hinsah, aber dann kamen die Bösen. Sie kamen herangerückt, ohne daß ich es hindern konnte, mit viel Halloh, und Pauken und Trompeten. Und sie kletterten und purzelten übereinander und stürzten sich in die Wagschale, daß sie schwer herniedersauste und das Zünglein ganz schief stand und die andere Wagschale mit dem winzigen Häuflein meines Habens ganz oben in der Luft baumelte und hin- und hertanzte, so leicht war es. Und das Soll des Fazits meines Lebens wälzte sich wie eine Riesenlawine auf meine Brust, daß sie schwer atmete und kämpfte und ich die Last kaum tragen konnte. Ich zitterte vor Schreck und namenloser Angst. Der kalte Schweiß rann, strömte mir aus den Poren und in weniger denn keiner Zeit war ich wie in einem Eismeer gebadet. Um des Himmels willen, stand es so um mich? War da keine Rettung, keine Schiebung möglich? Mein geistiges Auge überflog blitzschnell, schreckensvoll die Sündenlast, hier die kleinen, dort die großen. Da schien es mir, als ob plötzlich ein gütiges Auge die ganze Bescherung mit freundlichem Blicke musterte, und die Sündenschale flog pfeilschnell in die Höhe, sodaß das Zünglein senkrecht stand. Ja die Kreditschale senkte sich noch ein wenig mehr, so daß sogar ein kleines Saldo zu meinen Gunsten sich ergab. Und wie Schuppen fiel es von meinen Augen und ich urteilte mit denselben Augen wie die Gottheit selbst und staunte. Die großen und die kleinen Sünden zerflossen wie in nichts vor der großherzigen Kritik eines Gottes, der weder der König der Philister noch der Präses einer universellen »Spießer«-Vereinigung ist.
Das Rascheln von Frauenröcken und leise Fußtritte riefen mich aus meiner Gottähnlichkeit in die rauhe Wirklichkeit zurück.
Es war die deutsche Nurse, die gekommen war, mir meinen Abendgruel zu bringen.
Sie sagte: »Hier, mein Herr, ist Ihr broth, es ist mutton broth, es ist sehr gut, ich habe es selbst probiert, essen Sie nur tüchtig, damit Sie recht bald wieder zu Kräften kommen. Und dann habe ich Ihnen auch noch ein Körbchen mit frischen Erdbeeren mitgebracht. Die habe ich eben eigens für Sie gepflückt, da ich heute Nachmittag in der Office Ihre Geschichte gehört habe und wie Sie zu Ihrer Verwundung gekommen sind. Die Erdbeeren dürfen Sie erst morgen früh essen, wenn Sie aufwachen, dann bekommen Sie Ihnen besser. Und nun wollen wir beten.«
Damit kniete sie nieder, den Kopf gen das kleine Kruzifix gewandt, das an der Wand zu meiner Linken hing und betete. Es war keine Litanei, kein auswendig gelerntes Gebet, keine abgedroschenen Verse. Es waren nur einfache Worte ohne Phrasen, keine Gottanhimmelei und doch jedes Wort Gott gefällig, wohl angebracht und ohne Ziererei, geraden Wegs zum Herrgott gehend und rückwirkend geraden Wegs zu meinem Herzen. Ich hatte die Hände gefaltet und betete mit. Es war ein Gebet, wie es in jedem Menschenleben vorkommt, aber auch nur einmal, au moment du sublime et du suprême!
Als eine halbe Stunde darauf der gemütvolle Charlie mit seinem » nightcap«, dem präparierten Whisky kam, stieß ich seine Hand energisch zurück und weigerte mich entschieden, das Höllenbräu zu trinken. Schwester Claras Erdbeeren sollten doch gegessen werden und dazu mußte ich doch noch leben. –
Acht Tage später war ich wieder auf, nach weiteren acht Tagen wurde ich operiert und vier Wochen nach Fräulein Claras glücklicher Intervention war ich bereits an der Arbeit, mir mein Brot in der Neuen Welt, wenn auch als Krüppel und unter recht schwierigen Verhältnissen zu verdienen.
Der Doktor hatte mir, ohne mich zu unterbrechen, zugehört, dann bemerkte er kurz: »Und erinnern Sie sich des jungen Assistenzarztes, der immer bei den Visiten mit dem Oberarzt kam und der Sie dann auch nach der Klinik zu Professor Knapp begleitete? Das war ich.« Und damit stand er auf, wandte sich der Tür zu und diese öffnend, fügte er bei: »Und Schwester Clara ist nunmehr seit beinahe 24 Jahren meine liebe Frau und so Gott will, feiern wir nächstes Jahr unsere silberne Hochzeit.« Damit öffnete er die Tür und rief in das nächste Zimmer: »Clärchen, komm doch mal herein, hier ist ein alter Bekannter aus unsrer New-Yorker Zeit, von Wards Island«. Und er erwähnte kurz die Begebenheit. Die Frau Doktor erinnerte sich meiner allerdings nur dunkel. Sie mochte wohl viele solcher Szenen erlebt haben. Aber sie freute sich doch herzlichst über dies Wiedertreffen.
In diesem Augenblick ertönte eine helle Stimme im Vorzimmer, ein Hin- und Widerreden. »Aber, bitte, schicken Sie mich doch nicht den weiten Weg zurück und die schönen Rosen würden doch sicherlich erfrieren, wenn ich sie in der grimmigen Kälte wieder mit wegnehmen müßte.«
Damit klopfte die Sprecherin resolut selbst an die Tür, und ohne ein »Herein« abzuwarten trat sie stürmisch ins Zimmer, wo sie in ein konvulsivisches Schluchzen ausbrach.
Der Doktor beruhigte sie so gut er konnte.
»Ach, Herr Doktor, ach, ich bin so rasch hierher geeilt, um Ihnen die Rosen zu bringen und Ihnen zu sagen, daß unser liebes gutes Lieschen seit heute Mittag wieder etwas sehen kann, sie kann schon einzelne Gegenstände genau unterscheiden und das Tageslicht tut ihr schon garnicht mehr so weh, und da bin ich schnell hierher gelaufen, den weiten Weg, um Ihnen zu danken, daß Sie Lieschen das Augenlicht gerettet haben, und da wollte mich das Mädchen nicht herein lassen und sagte, Sie wären nicht mehr zu sprechen – und – – –«, alles dies von Schluchzen unterbrochen.
* * *
Ich war ausgegangen, um das Weihnachtsmärchen zu finden, und ich hatte es gefunden. Aber nicht so, wie ich es mir gedacht hatte, im schimmernden bunten traditionellen Flitterkleide der Theater- und Pantomimenfee, sondern im ernsten praktischen Gewande der Wissenschaft, der stetig vorwärtsstrebenden, unermüdlichen, die nur ein Ziel im Auge hat, zu wirken im Dienste und zum Heile der Menschheit!
