
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
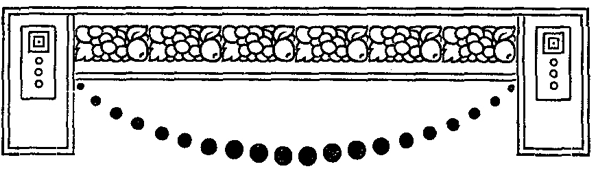
![]() Basel. – Dort wo die letzten Häuser stehen. Das Findelhaus,
l'hôtel des enfants trouvés. Ein langgestreckter, öder Bau, an der rechten Ecke unter einem Muttergottesbilde das
tourniquet.
Basel. – Dort wo die letzten Häuser stehen. Das Findelhaus,
l'hôtel des enfants trouvés. Ein langgestreckter, öder Bau, an der rechten Ecke unter einem Muttergottesbilde das
tourniquet.
Ein frostiger, windiger Novembernachmittag. Eine junge Frauensperson kommt eiligen Schrittes, denn sie friert, die Pappelallee herunter. In dem Körbchen liegt Dolores Honesta. Ein zartes, schmächtiges Püppchen mit dunklem Haar. Zehn Tage alt. Dolores friert auch, aber sie hat trotz ihres kurzen Daseins schon so viel des Elends erfahren und ahnt mit ihrem kleinen, klugen Köpfchen wohl die zu kommende ungeheuere Lawine von Misere, daß sie ein wenig Kälte wohl nicht beachtet, sondern starr und ruhig gen Himmel schaut.
Ein Totenglöcklein, es schallt übers Feld herüber, von der Stadt her. Schrei! schrei auf gen Himmel, Dolores Honesta, das ist dein Mütterlein, das sie jetzt da drinnen begraben, die fremden Menschen!
Dolores Honesta schreit nicht, sie schaut gen Himmel, dort ist jetzt ihr Mütterlein, und dann schaut sie wieder wie suchend in die Augen ihrer Trägerin.
Diese ist jetzt am tourniquet angelangt. Sie stellt den Korb hinein, zieht zwei, dreimal energisch an der Glocke und wendet sich stracks der Stadt wieder zu. Nicht einmal wendet sie den Blick zurück. Sie glaubt, es würde dem Kinde Unglück bringen. Und das will sie doch nicht. Die Schwester, die sich gerade in der Nähe befand, hatte inzwischen das tourniquet gedreht und den Korb mit dem Kinde hineingenommen. An dem Deckchen, das über das Kind gebreitet war, stak ein Zettelchen. Darauf stand in kritzlicher, schlecht leserlicher, fremdländischer Handschrift, in Spanisch: »Mein Kind soll Dolores Honesta heißen. Es ist das Kind rechtschaffener Liebe, und sie soll Dolores die Rechtschaffene heißen, und sie soll ihrem Namen immer Ehre machen.«
* * *
Drinnen in der Stadt bewegte sich ein ärmlicher Leichenzug, wenn man so sagen darf, dem Armen-Kirchhof zu. Zwei alte, von Kälte schlotternde Weiber, die Wirtin und die Leichenwäscherin, folgten dem Sarge. Die Wirtin zählte mit der linken Hand die Silberstückchen in der Tasche, die sie der Toten abgenommen hatte, nach und kalkulierte etwas langsam, da das Rechnen nicht ihr Forte war, ob sie für die vierzehn Tage Kost und Logis auch genug rausgeschlagen hatte. Links, auf dem Trottoire, etwas hinter dem Sarge ging ein hochgewachsener, blonder noch junger Mann, die Hände in den Rocktaschen, den Mantelkragen in die Höhe geschlagen, mit gekünsteltem gleichgültigen Gesicht und bestrebt, den Anschein zu erwecken, als ob er mit der ganzen Geschichte in gar keinem Zusammenhange stünde. Das war Dolores Honestas Vater.
Ernst Boos war mit bis in die Nähe des Friedhofes gegangen. Dann blieb er stehen und überlegte; mit auf den Gottesacker zu gehen, erschien ihm gefährlich, das konnte zu Gerüchten Anlaß geben und das mußte auf alle Fälle vermieden werden. Er sah dem Sarge noch eine Weile nach, wie dieser im Torweg des Friedhofes verschwand.
Concha konnte auch ohne ihn begraben werden. Hu, wie kalt es war. Und der ekelhafte Wind. Arme Concha, dachte er, dann holte er ein Schnupftuch aus der Tasche, wischte sich einen Tropfen von der Nase, knöpfte sich den Überzieher wieder sorgfältig zu, steckte die Hände in die Taschen und trollte in einer Art Hundetrab, der Kälte wegen, der Stadt wieder zu.
In der Nähe des Bahnhofs, in einer Seitenstraße, war eine kleine spanische Bodega von einem alten Catalanen gehalten, wo Ernst Boos öfters einen Schoppen trank und wo er seine spanischen Sprachkenntnisse und spanischen Reminiszenzen auffrischen konnte. Die Laune zum Plappern war ihm jedoch heute vergangen und nach einem hastigen » Buenas tardes, Don Faustino«,setzte er sich auf einen Eckplatz, bestellte eine Flasche Vino del Rivero, nippte am Glase und döste vor sich hin.
Jetzt waren es gerade zwei Jahre her, daß er sie kennen gelernt hatte. Dummes Ding, die Concha. Überhaupt ...
Dann überlegte er. Sollte er für die Kleine im Findelhause da draußen etwas Geld, vielleicht hundert Franken, hinaussenden? Das war immerhin ein Notpfennig, wenn sie mal hinausginge in die Welt, nach 16 Jahren oder so. Ja, das wollte er tun, das wäre eine gute Tat. Er knöpfte die Weste auf, nahm aus der Innentasche ein Bündelchen Banknoten, löste eine Hundert-Frankennote ab und steckte diese in die äußere Westentasche.
Dann überlegte er weiter. Er war sehr zufrieden mit sich. Arme Concha? Aber warum war sie ihm auch hierher gefolgt? In Spanien wäre sie sicher nicht gestorben, sonderbare Idee und muy atrevido, ihm hierher zu folgen. Wenn nur sein Vater ihn nicht nach Malaga geschickt hätte, um den faulen Spaniern Seidenband aufzuhängen.
Dann wäre die ganze dumme Geschichte nicht passiert. Daß ihm das dumme Ding alles geglaubt hatte! Und wenn man in Spanien ist, will man doch auch eine spanische Liebe haben. Das war doch selbstverständlich. Und die Alte hätte sie nicht so oft allein lassen sollen. Überhaupt ...!
Aber wie hatte die pícara nur herausbekommen, daß er aus Basel war, und daß Basel in der Schweiz lag? Von Geographie hatte sie doch gar keine Ahnung. Und so ganz ohne Geld. Da mußte ihm sicherlich der Hans Mahlmann, der aus Zürich war und seine Verhältnisse kannte, einen gemeinen Streich gespielt und der Kleinen alles verraten haben. So ein gemeiner Kerl!
Dann rief er den Wirt, bezahlte die Flasche Wein, benutzte dazu den Hundert-Frankenschein und steckte das Wechselgeld ins Portemonnaie.
Die Kleine konnte auch ohne die Hundert Franken fertig werden; er hatte genug Kosten mit dem Begräbnis gehabt.
»
Buenas noches, Don Faustino! –
Muy Buenas noches, Don Ernesto! –«
* * *
Mit acht Jahren wurde Dolores den Ursulinerinnen in Zug überwiesen und mit 15 Jahren kam sie zu den Schwestern vom Heiligen Herzen nach Sion. Sie war aufgeweckt und äußerst lernbegierig, sie sprach ein gutes Deutsch und ein noch besseres Französisch mit einem ganz kleinwenig Schweizer Accent. Von Gestalt war sie schmächtig, doch wohlgebildet. Ihr Knochenaufbau war äußerst zierlich, sodaß die ganze Gestalt wie ein reizendes Püppchen erschien. Ihre rosigen Wangen, ihre Rehaugen, ihr volles, dunkles, nicht zu dunkles Haar, ihre Lebhaftigkeit, gepaart mit jungfräulicher Reserve, alles entzückte an ihr. Sie war der Liebling der frommen Schwestern, der Abgott ihrer Mitschülerinnen. Sie war nicht wortkarg, für all und jeden hatte sie ein freundliches, passendes Wort. Als sie 17 Jahre alt war, kam ein Brief aus Paris von einer vornehmen, reichen Dame, einer geborenen Schweizerin, die auch im Sacré-Coeur zu Sion erzogen worden, und bat um eine Demoiselle für ihre beiden kleinen Mädchen von sieben und neun Jahren.
Die Wahl der Oberin fiel auf Dolores Honesta. Unter den Habseligkeiten, die sie mit sich nahm, war auch das Körbchen und die Wäsche, worin sie vor ungefähr 17 Jahren ihren Einzug in das Findelhaus gehalten hatte. In einem Beutelchen auf der Brust trug sie neben einer Denkmünze das Vermächtnis und die Mahnung ihrer Mutter, das Zettelchen, das ihren Namen und ihren Weg durchs Leben bestimmte. Ihr Aufenthalt in Paris bot nichts des Denkwürdigen, ein ruhiges, frommes Leben zwischen frommen und anständigen Menschen. So vergingen zwei Jahre, da erhielt sie einen Brief von einer Mitwaise, mit der sie mehrere Jahre bei den Ursulinerinnen in Zug in besonders anhänglicher Freundschaft gewesen war. Die Freundin, mit der sie während des Getrenntseins im steten Briefwechsel geblieben war, lud sie ein, nach Luzern zu kommen, wo sie sich, nachdem ihr ein kleines Erbteil zugefallen war, als Schneiderin etabliert hatte.
Dolores sollte bei ihr wohnen und ihr im Haushalt helfen und das Schneidern lernen, und so würde die alte Freundschaft in gemütlicher Umgebung unter mächtigen Trieben wieder neu aufblühen. Dolores hatte immer eine gewisse Sehnsucht nach dem Schweizerlande in sich getragen und nahm das Anerbieten an. Und nun beginnt die Geschichte von Dolores Honesta, beginnt der Kampf um das, was sie fortwährend im Herzen und im Sinne trug, was ihre Mutter im Sterben ihr als ein heiliges Losungswort gelassen hatte: »Und sie soll ihrem Namen immer Ehre machen!«
Sie, die bis jetzt in reinem Äther unverdorbenster Jungfräulichkeit ihr junges Leben verbracht hatte, kam mit einem Schlage in den tiefsten Sumpf verpesteter moralischer Verderbtheit. Und die Gefahr kam nicht von den jungen Leuten, die die junge und rosige Landsmännin umschwärmten, nicht von den fremden Herren und Schweiz-Reisenden, die das anmutige Kind mit Entzücken, aber auch mit Achtung begrüßten, nein, die schreckliche Gefahr, die ihr makelloses Dasein umgarnte und für ewig zu verderben drohte, nistete in unheilvoller Nähe am Busen der Freundschaft, unter dem Deckmantel schwesterlicher Liebe, am eigenen Herde ihrer neugefundenen Häuslichkeit.
Dolores Honesta ist sich selbst nie klar geworden, ob die bösen und widernatürlichen Instinkte in dem Sinnen und Trachten ihrer Jugendfreundin derselben angeboren waren, oder ob diese erst durch das innige Zusammenleben mit ihr und durch einen unwiderstehlichen, immer wieder neu aufflammenden Liebestaumel entfacht wurden. Von ernster Arbeit war bei ihrer Hausgenossin seit dem ersten Tage ihrer Ankunft schon keine Rede mehr. Von einer wahrhaft teuflischen Fleischeslust für die an Leib und Seele kerngesunde Herzensfreundin erfaßt, wich sie fast keinen Augenblick von ihrer Seite, verfolgte jede Bewegung, jeden Blick Dolores mit den eifersüchtigen Augen eines unbefriedigten, feurigen Liebhabers, überschüttete sie immer und immer wieder mit unwillkommenen, von lüsterner Zärtlichkeit strotzenden Liebkosungen, hatte überall an ihrer Toilette etwas auszusetzen, verbrachte täglich stundenlang damit, dem widerstrebenden Mädchen die üppigen Haare so und so und wieder so zu scheiteln und aufzubauen. Sie verschwendete eine Menge der nicht übermäßig vorhandenen Frankenstücke, um dem Liebchen Bijoux, Bröschchen und Ringelchen, Schleifen und Bändchen zu kaufen, um diese täglich von neuem wie ein Bräutchen zu schmücken. Und wenn der qualvolle Tag vorüber war, begann für Dolores die noch gräßlichere Nacht. Allein in der Wohnung mit ihrer Peinigerin mußte sie sich tausend Listen ausdenken, um den tausend und abertausend lüsternen Liebesangriffen ihrer Freundin, ohne diese zu verletzen, zu entgehen. Sie war ihrer Freundin Dank schuldig und würde es für elend empfunden haben, deren Liebe ein direktes abweisendes Wort entgegen zu stellen.
Nach und nach fühlte sie doch ihre Kräfte erlahmen, immer schwieriger wurde es ihr, den lesbischen Gelüsten ihrer Freundin auszuweichen, da erschien der rettende Engel in Gestalt einer wohlhabenden Waliser Dame, die im Sommer eine Villa in der Churer Gegend bewohnte und in der deutschen Reichshauptstadt ein großes Café-Etablissement besaß.
Diese Dame, deren Bekanntschaft Dolores in ihrer Eigenschaft als Modistin machte, bot der hübschen und jugendfrischen Landsmännin eine Stellung in ihrem Haushalte an, und Dolores reiste trotz Bitten ihrer sich wie verzweifelt gebärdenden Hausgenossin mit ihr nach der norddeutschen Metropole.
Hier war es, wo ich Dolores Honesta kennen lernte. Ich gab zu jener Zeit spanischen und englischen Unterricht und von dem Augenblicke an, wo Dolores mit einem von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden lieblichen Ton in der Stimme »Guten Tag, mein Herr« bot, bis zu dem, als ich der Sterbenden erstarrende Hand endlich loslassen mußte und darüber hinaus bis zu eben dem Augenblicke, wo ich diese Zeilen diktiere, war sie, ihre so unendlich beruhigende Anwesenheit und das Gedenken an sie, eine läuternde, dem Guten, Wahren, Schönen einzig und allein lebende und mit hinan ziehende Erscheinung! Sie war meine gelehrigste Schülerin, ich fühlte es, daß ihre Blicke an meinen Lippen hingen, daß sie jedes Wort, das ich lehrend sprach, verschlang und für ewig als einen Schatz in ihrem kleinen Köpfchen barg. Es war eine Freude, zu hören, wie sie schon nach einigen Wochen englische und spanische Sätze und Redewendungen geläufig verwandte und wie die Geheimnisse der Konjugation für sie keine Schwierigkeiten mehr boten. Das »Guten Tag, mein Herr,« war längst verschwunden und hatte einem herzlichen good afternoon, sir oder einem graziösen muy buenas tardes, Señor, Platz gemacht. Sie war mir im Laufe der Zeit mehr als Schülerin geworden, eine aufmerksame Vorleserin und zart fühlende Führerin. Es war nach den Stunden. Dann gingen wir an schönen Nachmittagen in den nahen Tiergarten oder wenn es regnete oder schneite in ein Café. Da laß sie mir Zeitungen und Zeitschriften vor, unermüdlich, politische Leitartikel, die sie offenbar gar nicht interessierten, alles mit gleicher Geduld, gleicher Liebenswürdigkeit und reizender, richtiger Accentuirung. Und jetzt tritt der Schriftsteller in Aktion. Denn was ich jetzt erzähle oder skizziere, habe ich nicht vom Hörensagen, und ich habe es auch niemanden an den Augen ablesen können, denn das ist mir versagt.
Alles ist ein langes Ahnen, ein seelisches Erraten und ein sensitives unwillkürliches Mitempfinden. Ein Mitempfinden mit einem himmelhoch jauchzenden und dabei in qualvollster Betrübnis bangenden Herzen, dem lähmenden, furchtbaren Kampfe einer aus eigenster innerer Wahl reinster jungfräulichen Seele mit der Liebe, mit einer überwältigenden, fordernden, streng fordernden Liebe eines Mannes, eines wirklichen Mannes.
Das alte und ewig wiederkehrende Puppenspiel vom Gretchen und vom Faust. Gretchen war gegeben, und Faust alias Mephisto schnellte aus der Versenkung. Und was sich da vor zwanzig Jahren oder so zwischen den Orangenbüschen und Olivenhainen von Malagas reizvoller Umgebung abgespielt hatte, wiederholte sich jetzt an den trüben Fluten der Spree. Mephisto erschien in Gestalt eines ritterlichen, hochgewachsenen blonden Oberleutnants mit kurz gestutztem, etwas dunklen Schnurrbärtchen, der, wie man mir sagte, wunderbare blaue Augen besaß, die von einer Seelentiefe sein sollten und die einen so angucken konnten – so ... so ... so ...
Rolf von Rolframstein war Oberleutnant bei einem preußischen reitenden Artillerieregiment, nach Jüterbog zur Schießschule kommandiert und verbrachte seine Nachmittage und Abende von 4 Uhr ab dort, wo man sich in Berlin nicht langweilt. Da plötzlich erfaßte ihn, wie er mir detaillierte, ein Ekel, ein unabweisbarer, sich ihm täglich mehr und mehr aufdrängender Ekel an einem Leben, das ihm nutzlos und zugleich ein verworfenes erschien. In Wahrheit war es wohl, wie ich zwischen den Zeilen seiner kurz hingeworfenen und in knapper Leutnantsform incoherent vorgebrachten Satzwendungen leicht herausphilosophierte, die Erkenntnis einer unverschämt niedrigen Leutnants-Gage mit den obligaten vorschriftsmäßigen Abzügen neben einer minimalen Aussicht auf ein irgendwie nennenswertes Avancement. Eine leichte Verletzung des Schienbeines, die er sich bei Gelegenheit eines Rittes nach den fliegenden Scheiben zugezogen hatte, hatte ihm einen Vorwand geboten, einen sechsmonatlichen Urlaub zu bekommen.
Kaum hatte er das Einerlei des Dienstes abgestreift, fing er an, Pläne zu machen. Die Uniform wollte er, so schwor er sich zu, nur in dem alleräußersten Falle wieder anlegen, wenn alle seine Pläne scheiterten. Im vergangenen Sommer hatte er in Wiesbaden den Gesandten einer exotischen südamerikanischen Republik kennen gelernt und mit ihm im Drange der Langeweile über Politik, Armee-Organisation, südliche Frauen-Schönheits-Spezialitäten, Maschinengewehre, Stiergefechte und Schnellfeuergeschütze geradebrecht. Dabei hatte der Herr Leutnant Gelegenheit gehabt, dem Herrn Gesandten mit seinen taktischen Fähigkeiten zu imponieren und dieser hatte ihm bei einer vierten Pulle Kupferberg Gold so ziemlich sicher den Posten eines kommandierenden Generals an den Ufern des Rio Azul in Aussicht gestellt. Zwar hatte der Minister unserm Rolf von Rolframstein bei dessen wiederholten Besuchen auf der Gesandtschaft am Maria-Augusta-Platz bis dato nur ausweichenden Bescheid auf seine angelegentlichen Erkundigungen gegeben, ob das betreffende Ernennungsdiplom noch nicht eingetroffen sei; aber unser Held sah trotzdem immer den Federbusch und die 9000 Pesos jährlich als angenehmen Appendix in rosigem Zukunftsbilde winken und beschloß auf alle Fälle spanischen Unterricht zu nehmen. »Denn Spanisch müssen Sie wenigstens soviel können,« hatte der Gesandte gesagt, »daß Sie die Kerls gelegentlich mit einem Caramba oder Carajo anschnauzen können.« Und dann, falls die breiten Goldstreifen versagten, war ja noch immer Krupp da. Der nahm ja alle dienstmüden Offiziere an, besonders die Herren von der Artillerie, und sandte sie als Garde-Commis-voyageurs in alle Himmelsrichtungen. Da war ihm ein guter Posten, sei es am Popocatepetl oder am Rio de la Plata auf alle Fälle sicher. Aber Sprachen mußte er dazu lernen, Sprachen, wie sie in den Affenländern dort unten gebraucht wurden. Also »rin« in die moderne Philologie!
Und so kam es, daß ich eines Abends bei der Rückkehr von einem Spaziergange auf der Schreibtafel an meiner Studio-Tür die etwas burschikos klingenden Worte fand:
»Wann sind denn eigentlich hier die Dienststunden?
Rolframstein.«
Eine Stunde später öffnete sich mit militärischem Rucke die Türe und ein hochgewachsener Herr betrat mit energischem Schritt, dem man das Sporenklingen noch nachempfand, das Zimmer und meldete sich mit einem kräftigen: »Rolframstein«, als Schreiber jener merkwürdigen Worte.
Dolores Honesta war gerade anwesend, als dies geschah. Ihre Lektion war beendet, aber sie zögerte zu gehen, als der Besucher eintrat. Das schickte sich doch nicht. Auch konnte sie mir wohl helfen, den Namen des neuen Schülers eintragen und mir sonst über die Verlegenheiten, die einen Blinden stets bei einem ersten Besuche befallen, weghelfen. Sein Blick streifte wohl den ihren, war es Liebe auf den ersten Blick? – Ich habe mir diese Frage später öfters gestellt und auch Dolores darüber befragt, aber nie eine rechte Antwort darauf erhalten.
Sie war sich wohl selbst nicht klar darüber. Der junge Oberleutnant belegte einen spanischen Kursus, später nahm er auch englischen Unterricht. Dolores war meistens bei den Stunden zugegen. Sie war eine viel gelehrigere Schülerin als der junge Mann. Oft, wenn seine Zunge bei einem etwas schwierigen Aussprach-Problem stockte, half sie ihm mit einem lustigen Worte und silberhellen Lachen über seine Verlegenheit hinweg. Manchmal kam es mir vor, als wenn sein Blick mehr in die lachenden dunklen Augen Dolores tauchte, als daß er in sein Buch sah oder mich anschaute, wie es für den Zweck des Unterrichts gebotener gewesen wäre. So recht vorwärts kam er nicht. Sein Sprachtalent war ein recht beschränktes. Auch sein Interesse erkaltete, da der Federhut und die Generalstressen sich immer mehr in blauer Ferne verloren. Aber im Herzen Dolores hatte er sichtlich große Fortschritte gemacht.
Je unbeholfener und kindlicher er sich beim Studium benahm, desto mehr schlug ihm das nachsichtige und weiche Herzchen des früheren Kinderfräuleins, das viel, sehr viel Geduld gelernt und sich zu eigen gemacht hatte, entgegen.
Nach den Lecciones oder Lessons begleitete sie oft den jungen Offizier bis zum Fahrstuhl und blieb dabei meistens länger aus, als unbedingt notwendig gewesen wäre. Die jungen Leutchen hatten sich jedenfalls sehr viel, so viel zu sagen, Sachen und Sächelchen, die doch nicht in das ernste Studierzimmer und an das Ohr des gestrengen Herrn Professors gehörten. Das Verhängnis ging seinen Weg. Mephisto-Faust machte seine verschiedenen Metamorphosen durch. Denn wenn auch Goethe auf der Bühne notgedrungen den Faust und den Teufel als zwei besondere Personen auftreten läßt, so beabsichtigte er damit doch nur die beiden Seelen, die in jedem Menschen hausen, die schwarze und die dunkelweiße, zu zeichnen. Ich sage die dunkelweiße, denn schneeweiße existieren wohl überhaupt nicht, denn selbst da, wo scheinbar die größte Selbstlosigkeit irgend eine Tat diktiert, ist dem Individuum selbst unbewußt doch irgendwo ein kleines Interesselchen vorhanden.
Faust-Rolframstein meißelte kräftig an dem kleinen butterweichen Herzchen Dolores. Der Meißel arbeitete schmerzlos, war von Rosenblüten umwoben und in Gestalt von Cupidos süßem, bekanntem Pfeil. Oft bangte mir vor dem, was sich da, mir unsichtbar, sicherlich hinter den Kulissen vollzog. Sollte sich das Schicksal der armen Spanierin bei ihrer Tochter wiederholen? Und doch hatte ich weder das Recht noch die Macht, Amor in die Arme zu greifen.
Eine der nächsten Stunden, als ich mit Dolores allein war und mit ihr die Sprache Cervantes' studierte, bot mir die Gelegenheit, einen Blick in ihr Herz zu tun und zu erfahren, ob ich nicht mit einer Warnung zu spät käme. Wir waren bei den spanischen Verben und nahmen die Konjunktive durch. Ich bat Fräulein Dolores, einen Satz zu bilden, in dem ein solcher vorkäme. Das junge Mädchen stockte. Und wie es öfters in solchen Fällen vorkommt, zermarterte sie ihr Gehirn vergebens, eine geeignete Phrase zu bilden. Auf dies hatte ich gewartet: »Wie lauteten doch die Worte, die Ihre Mutter Ihnen als ihr letztes Vermächtnis mit auf den Lebensweg gab?«
Dolores zögerte, aber die wenigen inhaltsschweren Worte waren doch zu tief in ihr Gedächtnis eingegraben, als daß sie auf meine schnelle Frage eine Antwort verweigern konnte, obgleich sie in ihrem klugen Köpfchen wohl erriet, warum ich gerade diese kurzen Sätze als passendes Beispiel einer spanischen Konjugationsschwierigkeit wählte.
» Que llamen á mi hija Dolores Honesta. Es el fruto de amores honestos y por esto su nombre debe ser Dolores la honesta. Y que haga siempre honra á su nombre!« –
Ich fühlte, wie das Mädchen bei der leisen Wiedergabe dieser für sie so bedeutungsvollen Worte unwillkürlich errötete. »Und nun,« frug ich, vielleicht etwas zu scharf, »haben Sie, Dolores Honesta, Ihrem Namen immer Ehre gemacht? Haben die letzten Wochen keine Bresche in Ihre guten Vorsätze geschlagen? Können Sie, Dolores Honesta, beim Nachtgebet Ihrem Mütterchen noch immer klar in die Augen schauen?«
Ein minutenlanges Schweigen folgte diesen meinen Fragen. Nur wenigemale seit meiner Erblindung hatte ich wohl so sehr meine Machtlosigkeit empfunden, die Unmöglichkeit, ihr in diesem Momente in die Augen zu blicken und in ihrer Seele zu lesen, um die Wahrheit, die volle Wahrheit mit einem Blicke zu erhaschen, und ihr so vielleicht eine unendlich peinliche in Worte gekleidete Erklärung zu ersparen. Aber ich wußte, daß Dolores Honesta nie und nimmer lügen würde, selbst auf die Gefahr hin, vor dem einzigen Mitwisser des Geheimnisses ihrer Geburt als eine Gefallene und Wortbrüchige erscheinen zu müssen.
»Noch bin ich Dolores Honesta,« kam es bebend, aber bestimmt über ihre Lippen, »aber wie lang noch, das weiß der Himmel. Der Kampf ist zu schwer, und ich fürchte, ich fürchte, ich werde unterliegen.« Und dann schluchzte sie lange, sehr lange. Ich schwieg und ließ sie ruhig sich ausweinen.
Nach zirka einer Viertelstunde, als sie ihre Fassung allmählich wiedergewann, sagte ich: »Sie brauchen mir nichts zu erzählen, ich weiß, oder vielmehr ahne alles. Es ist die alte Geschichte und wie sie endet, ist mehr oder weniger gleichgültig. Unglücklich hat er sie doch gemacht. Aber wir wollen einmal überlegen. Was sind seine Versprechungen, seine Pläne?«
»Rolf,« und diese Bezeichnung des Leutnants bei seinem Vornamen seitens Lolas sagte mir Bände, – »beabsichtigt, nach Südamerika zu gehen, wo er einen Freund hat, einen früheren Kameraden, und der ihn eingeladen hat, zu ihm zu kommen. Er schrieb ihm, daß er eine Schafzüchterei am Fray Bentos-Flusse betreibe, und daß dort auch gute Aussichten für Rolf beständen, falls dieser sich in ähnlicher Weise in der Nähe oder in einer sonstigen günstigen Gegend der Republica Oriental niederlassen würde. Ich soll mit ihm ziehen und dort unten in Uruguay, aller konventionellen Fesseln ledig, will er mich heiraten.« Ich schwieg und dachte nach. Abgesehen davon, daß ich, nachdem ich in den Monaten unserer Bekanntschaft Gelegenheit gehabt hatte, den Charakter und die Fähigkeiten des jungen Mannes zu studieren, diesen Leutnant kaum für den richtigen Mann hielt, in jenen mir wohlbekannten Urgegenden der Natur und der Menschheit Reichtümer abzujagen, kam mir überhaupt die ganze Idee als ein in zu weite Lüfte gebautes Familienschloß vor. Besonders die so hinausgeschobene Heirat behagte mir garnicht. Standesämter und evangelische Geistliche sind in der Gegend dort unten so seltene Artikel – scarce and far between, wie der Amerikaner sagt.
Ich fühlte und wußte, daß lange Ermahnungsreden in Deutsch über diesen Punkt wenig oder gar keinen Eindruck auf die verliebte Lola machen würden. Derartige Tiraden sollen in solchen Fällen gewöhnlich das Gegenteil der gewünschten Wirkung hervorbringen.
Ich sagte daher nur kurz und auf spanisch: »Nun Doña Dolores, Sie werden ja wissen, was Sie sich schuldig sind!« Und dann setzten wir die Konjugation der spanischen Verben fort.
Während Lola zu den nächsten Stunden ruhig weiter erschien, blieb merkwürdigerweise der Leutnant fort. Entschuldigungsschreiben hielt er scheinbar nicht für nötig. Ich zauderte, Lola darüber zu befragen. Dann erzählte sie mir einmal von selbst, daß sie ihn seit sechs Tagen nicht gesehen habe und daß ihm seine vier Reitpferde viele Unannehmlichkeiten bereiteten. Diese vier Reitpferde bildeten neben dem öfteren Portemonnaieverlieren, an dem Rolf von Rolframstein offenbar laborierte, einen Schmerzenspunkt in der aktuellen Lebensperiode des jungen Mannes. Er hatte nämlich einen Wechsel ausgeschrieben, einen Wechsel auf 10 000 Mk., mit seinem schönen Namen darunter und für dieses kostbare Papierchen, das sechs Monate laufen sollte, hatte er 500 Mk. in bar, vier Reitpferde nebst Zubehör und eine sehr hübsche Reitpeitsche mit vergoldetem Knopf, der aber schon zu dunkeln anfing, erhalten.
Diese vier Renner waren ebenso viele »weiße Elefanten« für ihn geworden. Kaufen, wenigstens zu einem annehmbaren Preis, wollte sie niemand. Sie fraßen viel und taten wenig, bei Mutter Grün wollten und konnten sie nicht kampieren, alle Augenblicke bekamen sie eine neue moderne Pferdekrankheit oder zogen sich eine Verletzung zu.
Kurzum, sie gaben dem Leutnant zu tun und dieser hatte einen Lebenszweck wenigstens während seines Aufenthaltes in der Reichshauptstadt. Inzwischen machte der Sommer und die heiße Jahreszeit reißende Fortschritte, die Reihen meiner Schüler lichteten sich unheimlich, die Berge und das Meer waren zu Riesenmagneten geworden und Dolores Honesta war beinahe das einzige Wesen, das mein Zimmer, wenn auch nicht so regelmäßig wie früher, aufsuchte. Sie und ein junger Ingenieur, der sich für die Vereinigten Staaten vorbereitete und nur abends Zeit hatte, waren meine einzigen Schüler. Ein Spaziergang mit Lola im Tiergarten, eine Tasse Kaffee mit Konzertbegleitung im Kaiser Wilhelmzelt und ein Glas Schultheiß am Abend mit dem jungen Elektriker in einem Biergarten der Sadowastraße waren meine Zerstreuungen.
Eines Abends so zwischen zehn und elf, als einem furchtbar schwülen Tage ein noch schwülerer Abend gefolgt war, saß ich mit meinem jungen Schüler in besagtem Biergarten, als eine ungewöhnliche Aufregung unter den zahlreichen Gästen bemerkbar wurde und sogar mir, dem Blinden, auffiel. Stimmengemurmel, das Wort Feuer. Der Himmel hatte sich in unglaublich kurzer Zeit blutrot gefärbt. Das Feuer mußte sehr nahe sein. Jetzt rasselten auch die Löschzüge vorüber, die Dampfspritzen fauchten, eins, zwei, drei, noch mehr. Großfeuer! Die ersten Neugierigen, welche beim ersten Alarm auf die Straße hinausgeeilt waren, kamen zurück und meldeten: Feuer im Café Vizedomini am Sanssouciplatz. Kurzschluß an den elektrischen Reklameschildern auf dem Dache. Der ganze Dachstuhl des riesigen Hauses stand in Flammen. Andere kamen hinzu: Aus dem Fenster des vierten Stockes schlügen bereits die Flammen. Mein Herz stand still. Bei den Vizedominis im dritten Stock des brennenden Hauses wohnte Dolores Honesta. Sie hatte mir oft erzählt, daß sie früh zu Bett gehe und im Bette zu lesen pflege. Meine Phantasie malte mir schreckliche Szenen vor. Das rasche Umsichgreifen des Feuers. Die engen Treppen des alten Hauses. Es war mir unmöglich, ohne mir Gewißheit über die Sicherheit Lolas zu verschaffen, ruhig sitzen zu bleiben, und ich drängte meinen jungen Freund, mir den Arm zu geben und mich nach dem Sanssouciplatz zu führen.
Im Eilschritt ging es dahin, aber dichtgedrängte Menschenmassen versperrten den Weg, lange Kolonnen von Straßenbahnwagen hatten sich angesammelt. Der Platz war polizeilich abgesperrt. Von dieser Seite war der Zugang unmöglich. Mein Herz pochte fieberhaft. Ich drängte meinen Begleiter zurückzueilen, um es von einer anderen Straße aus zu versuchen. Im Sturmschritt ging es zurück, durch die Sadowa-Straße, den weiten Umweg durch die Prinz Albert Straße nach der Reipziger Straße zurück nach der Brandstätte. Auch hier der riesige Menschenstrom, dieselbe Massenansammlung von Straßenbahnen und Vehikeln aller Art. Dieselben Absperrungsmaßregeln. Aber von hier aus hatte man einen vollständigen Überblick des brennenden Hauses. Wie mir mein Begleiter sagte, war bereits der ganze dritte Stock ein einziges Flammenmeer. Vorwärts zu kommen oder irgend welche Gewißheit über die Sicherheit der Bewohner zu erlangen, war unmöglich. Die Schutzmannsposten wußten nichts. Wieder lange Umwege und fruchtlose Versuche von der Belvederestraße aus. Nach stundenlangem Warten drängte mein Freund trotz meines Bittens, zum Nachhause gehen, da er bereits um sechs Uhr auf seiner Arbeitsstätte in Moabit sein mußte. Da ich als Blinder gänzlich von ihm abhing, mußte ich einwilligen, verbrachte jedoch eine schlaflose Nacht, die nur gegen Morgen einem kurzen Schlummer wich.
Sobald ich abgeholt wurde, eilten wir nach dem Café Vizedomini, wo eine furchtbare Verwüstung herrschte. Dolores Honesta hatte sich glücklich gerettet und war bereits auf sicherem Boden unten, als eines der kleinen Vizedominischen Kinder vermißt wurde, wieder die von Qualm erfüllten Treppen hinaufgelaufen und oben angelangt von einem herabstürzenden Balken am Kopfe und an der Schulter verletzt worden. – –
— — — — — — — —
Wehe – Wehe – Wehe –
— — — — — — — —
Eine furchtbare, an Gewißheit streifende Ahnung stieg in mir auf, daß Lola verloren sei. Ein zum Himmel schreiendes Weh durchschnitt mein Herz. Was mir in den Monaten unserer Freundschaft nur unklar im Herzen geschlummert hatte, und das ich immer wieder und immer wieder nieder gekämpft hatte, wenn es hervorbrechen wollte, das Gefühl, daß ich Lola Honesta liebte, mit der ganzen großen egoistischen Liebe eines alternden, vereinsamten Blinden, die sich an das Herz des jungen blütenreinen Mädchens angeklammert, mit der letzten Hoffnung eines Schiffbrüchigen, der wieder festen Boden unter sich zu fühlen beginnt. Dieser Boden sank nun unter mir!
Ich bin hier, um die Geschichte Dolores Honestas zu erzählen und nicht, um meine Gefühle zu schildern. Wir eilten schwankenden Schrittes, und doch so rasch, wie uns unsere Füße tragen konnten, nach dem Elisabeth-Krankenhause, wohin man Lola gebracht hatte. Dort sagte man uns, daß wir nachmittags um drei Uhr zur Besuchszeit wiederkommen müßten. Eine Gewißheit über den Zustand der Verunglückten war nicht zu erlangen. Wie der lange Tag bis zu dieser Stunde verging, ist mir heute noch ein Rätsel. Ein ununterbrochenes Hin- und Herirren zwischen dem Tiergarten und meinem Studio, ein rastloses Auf- und Abschreiten, den Kanal herauf und hinunter, ein fortwährendes fast unbewußtes Umkreisen der Leidensstätte Lolas, so war endlich die dritte Nachmittagsstunde herangekrochen.
Als wir vielleicht zum zehnten Male die Sanssouci-Brücke passierten, sagte meine Begleiterin: da ist ja der Leutnant. Rolframstein stand an der Haltestelle der Straßenbahn am Brückengeländer. Ich trat auf ihn zu und berichtete ihm, der noch von garnichts wußte, das Geschehene. Er schloß sich uns schweigend an und ging den ganzen Weg bis zum Krankenhause lautlos neben mir her.
Dolores Honesta war gegen Mittag aus einer langen Bewußtlosigkeit erwacht, klaglos erduldete sie die furchtbaren Schmerzen, ihr Zustand war ein sterbender, die Auflösung war stündlich zu erwarten. Dies der Bericht der Schwester. Die nun folgende Szene am Bett der Sterbenden zu beschreiben, ist mir, dem Blinden, versagt. Gesprochen wurde wenig, außer den Erwähnten war, glaube ich, Frau Vizedomini anwesend. Ich selbst war wie von einem Traum befangen. Ich besinne mich, daß man mich an das Bett Lolas führte, daß ich an ihrer Seite wie gebrochen auf die Knie sank, nach ihrer lieben, kleinen Hand tastete und sie fand, wie ich diese wieder und wieder mit Küssen bedeckte, während ein unaufhaltsames Schluchzen meine Kehle fast zuschnürte und wie ein leises Zucken, ein Druck ihrer Hand mir sagte, daß ihre Seele mit der meinen sprach.
— — — — — — — —
» Vengo, madrecita mia, vengo; yo, Dolores Honesta, y no hé deshonrado mi nombre.«
— — — — — — — —
Dolores ist noch am selben Nachmittag vor ihr Mütterchen getreten.
