
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Gebhard Truchsess von Waldburg war nach der Abdankung des Kurfürsten Salentin von Köln durch die Fürsprache des Grafen Hermann von Nuenar zum Erzbischof von Köln gewählt und vom Papst bestätigt worden. Als er bei einer Prozession die schöne Gräfin Agnes von Mansfeld erblickte, erwachte in ihm, dem erst dreißigjährigen Manne, unpriesterliche Leidenschaft. Der Wunsch ihres Besitzes konnte nur eine Zeit lang unter einem verbotenen Umgange verborgen bleiben. Von den Brüdern der Geliebten gedrängt und von seinen Freunden, den Grafen Nuenar von Solms, ermutigt, beschloß er, den Wünschen seiner Agnes nachzugeben, sich mit ihr zu vermählen, jedoch nach dem Beispiel des brandenburgischen Prinzen Joachim Friedrich, Erzbischofs von Magdeburg, die Verwaltung des Erzstiftes auch ferner fortzuführen. Der Entschluß kam bald zur Ausführung. Im Dezember 1582 schied Gebhard öffentlich aus der katholischen Kirche aus, und einige Monate nachher ward ihm zu Bonn durch einen reformierten Geistlichen die schöne Gräfin Agnes angetraut. Am 1. April 1583 aber erfolgte von Rom aus gegen ihn der Bann und zugleich die Entsetzung aller seiner Ämter und Würden. Sein früherer Mitbewerber, Prinz Ernst von Bayern ward an seine Stelle gewählt. Der Schritt des Papstes, die Absetzung eines Kurfürsten, erregte in Deutschland gewaltiges Aufsehen, und als es dem Neuerwählten durch Beihilfe des spanischen Feldherrn, Herzogs von Parma, von den Niederlanden aus gelang, seinen Gegner aus dem rheinischen Teil seines Erzstiftes zu verdrängen, traten die drei Kurfürsten von Brandenburg, Sachsen und der Pfalz am kaiserlichen Hofe mit einer Klage auf über das verfassungswidrige Eingreifen des päpstlichen Stuhles in die Rechte des Kurfürsten-Kollegiums und über die Einmischung Spaniens in die deutsche Sache. Dessenungeachtet zeigten sie wenig Bereitwilligkeit, den Erzbischof Gebhard gegen seine Widersacher zu halten, weil es der protestantischen Gesinnung der Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen nicht zusagte, daß Gebhard die ihnen verhaßte Lehre Calvins der lutherischen vorzog. Nur der eifrige Anhänger des Calvinismus, Pfalzgraf Johann Kasimir, rüstete einen Heerhaufen und sandte ihn im August 1583 unter der Führung seines Feldmarschalls, des Grafen Fabian von Dohna, seinem Glaubensgenossen zu Hilfe. Allein er war der Gegenmacht nicht gewachsen, und da Geldmangel den Pfalzgrafen nötigte, nach einigen Monaten seine Truppen wieder zu entlassen, blieb Gebhard völlig hilflos; er lebte noch 16 Jahre zu Straßburg als Dechant des dortigen Domkapitels, jedoch ohne dem Titel eines Kurfürsten, an den er seine Anrechte knüpfte, zu entsagen.
Wenige Jahre nachher war es wieder die Religionssache in Frankreich, welche die Teilnahme der drei Kurfürsten von Sachsen, Brandenburg und der Pfalz, sowie anderer deutscher Fürsten und Reichsstände, lebhaft in Anspruch nahm. Eine von ihnen an den König Heinrich III. ergangene Aufforderung, den seinen reformierten Untertanen bewilligten, von ihm feierlich beschworenen Frieden wiederherzustellen, war von ihm so zweideutig beantwortet worden, daß sich der Pfalzgraf Johann Kasimir, damals Regent der Pfalz, für seinen Neffen, den Kurfürsten Friedrich IV., bewogen fand, zum Schutz seiner Glaubensgenossen in Frankreich mit dem König Heinrich von Navarra am 11. Januar 1587 über die Werbung eines Hilfsheeres einen Vertrag zu schließen. Durch die Gelder des Königs, der deutschen Fürsten und der Königin Elisabeth von England gelang es bald, aus dem Elsaß, der Schweiz und einigen Ländern Deutschlands ein Heer von 29 000 Mann aufzubringen, welches mit den in Frankreich gesammelten Heerhaufen des Herzogs von Bouillon, des Grafen La Mark und anderen freiwillig herzuströmenden Scharen eine Streitmacht von 40 000 Mann bildete. Der Oberbefehl war vom Pfalzgrafen abermals dem kriegskundigen Grafen Fabian von Dohna anvertraut; denn kein anderer kam ihm an Mut und Kühnheit gleich. König Heinrich, in seinen Streitkräften viel zu schwach, um sich der feindlichen Macht entgegenstellen zu können, sah die Deutschen unter Dohnas Führung durch Lothringen und Burgund verheerend und plündernd bis an die Loire vordringen, wo er die Übergänge besetzt und befestigt hatte. Dies und der Mangel an Lebensmitteln in den ausgeplünderten Gebieten der Loire nötigten das deutsche Heer, sich in nördliche, wohlhabendere Gegenden zu wenden. Schon war Paris bedroht. Da folgte allerlei Ungemach. Niederlagen einzelner Heeresteile, Uneinigkeit unter den Befehlshabern, Ungehorsam unter den Truppen, die Weigerung der Schweizer, gegen ihre Landsleute im königlichen Heere zu streiten, der Mangel aller Hilfe und Teilnahme von Seiten des Königs von Navarra, ungesunde Witterung bei herannahendem Winter und Unmäßigkeit im Genuß: alles dies schwächte und entmutigte das deutsche Heer in dem Maße, daß es seiner völligen Vernichtung entgegensah. Gern nahmen daher die Führer einen vom König ihnen dargebotenen Vertrag an, in dem ihnen freier Abzug über die Grenze des Reiches bewilligt ward, wogegen sie versprechen mußten, nie wieder ohne des Königs Befehl in Frankreich zu dienen.
Unmutig ging Graf Dohna in die Pfalz zurück und begab sich noch 1588 in sein Geburtsland Preußen. Hier fand er im Hause seines Bruders, des Grafen Achatins von Dohna, einen Knaben, der bald seine volle Liebe auf sich zog. Christoph, der jüngste von dreizehn Geschwistern, deren mehrere aber schon in früher Jugend gestorben waren, zählte damals erst fünf Jahre. Allein schon in diesem Kindesalter zeigte er eine Wißbegierde, die über seine Jahre ging. Wenn der Oheim von seinem Hofleben in der Pfalz, den Burgen am Rheinstrom oder den vielfältigen Widerwärtigkeiten erzählte, die er in Frankreich selbst erduldet oder als Augenzeuge wahrgenommen, hing der Knabe an seinen Lippen und unterbrach ihn jeden Augenblick durch neue Fragen.
Wohl mochten es diese Erzählungen sein, die den regen Geist des aufgeweckten Knaben aus dem engen Kreise der heimatlichen Umgebung in die Welt schweifen ließen. Der Vater aber förderte, was der Oheim angeregt. Graf Achatius, der mehrere Jahre am Hofe des Kaisers Maximilians II., dann als Gesandter am polnischen Hofe gelebt, mit Auszeichnung im ungarischen Kriege gedient und auf dem Reichstage zu Speyer das Reichstagsleben kennen gelernt hatte, liebte es, von den Erfahrungen und Schicksalen seines früheren Lebens zu erzählen. Er unterhielt eine ausgedehnte Korrespondenz und pflegte daraus der Familie die wichtigsten politischen Zeitereignisse mitzuteilen. So gewannen die Söhne nicht nur Kunde von allein, was in der Welt vorging, sondern sie mußten auch häufig die dem Vater zugekommenen Zeitungen, die damals meist nur geschrieben wurden, abwechselnd abschreiben, wenn er sie Freunden oder Verwandten senden wollte.
Christoph zählte das sechste Jahr, als sein Vater die Stadt Mohrungen, seinen bisherigen Aufenthalt, verließ und das alte Stammschloß seiner Ahnen, Schlobitten im Preußischen Oberlande, bezog, mit ihm eine Tochter und sieben Söhne, Friedrich, Heinrich, Fabian, Abraham, Dietrich, Achatius und Christoph. Bis 1597 genossen sie sämtlich häuslichen Unterricht. Die zwei ältesten, Friedrich und Heinrich, bezogen darauf die Universität; jener ging nach Jena, dieser nach Wittenberg und dann nach Heidelberg. Der dritte Bruder, Graf Fabian, lernte zuerst auf einer Reise mehrere Länder Deutschlands kennen, begab sich darauf nach Ungarn, wo er in Kriegsdienste trat und einer der ersten war, die das feste Gran erstürmten. Später, in den Niederlanden, wo er mehrere Reiterkorps befehligte, stand er in hoher Gunst bei dem Prinzen Moritz von Oranien. Auch die drei übrigen Brüder blieben nur noch kurze Zeit im elterlichen Hause, wo sie von einem Lehrer den nötigen Unterricht in Sprachen und Wissenschaften erhielten. Er wurde ihnen in einer kleinen Kammer eines abgelegenen Hauses erteilt, deren Wände sie ringsum mit vielen aus der Bibliothek ihres Vaters entnommenen Bildern von orthodoxen Theologen beklebt hatten, worunter aber auch Beza, Zwingli und verschiedene Calvinisten waren, wobei es ihnen viele Mühe kostete, die unter den Bildern befindlichen lateinischen Verse zu verstehen. Graf Christoph wunderte sich späterhin selbst darüber, wie es die streng orthodoxen Eltern hatten dulden können, die Bilder der ihnen verhaßten Calvinisten unter den ehrwürdigen Orthodoxen aufgereiht zu finden.

Solis, Narrentanz. Federzeichnung vom Jahre 1542. Donaueschingen, Fürstl. Fürstenberg'sches Kupferstichkabinett
Nachdem sich bald darauf die jungen Grafen Dietrich und Achatius in Begleitung ihres Oheims Fabian, der noch in kurpfälzischen Diensten stand, nach Heidelberg begeben, befand sich Christoph allein im väterlichen Hause; denn sein Bruder Abraham war nach Rostock gegangen, wohin ihn der bisherige Lehrer der jungen Grafen, David German aus Riga, hatte begleiten müssen. Da Christoph mit vielem Eifer schon in seinem vierzehnten Jahre die Reden Ciceros gelesen und sein neuer Lehrer, Engelbrecht aus Kolberg, »ein guter Poet« war, so mußte er sich täglich nun in lateinischen Versen üben. Damals schon pflegte er alles, was ihm merkwürdig schien, so genau wie möglich aufzuzeichnen, wobei ihm die Kalender als Tagebücher dienen mußten; eine Gewohnheit, die auch für sein späteres Leben von bedeutendem Einfluß war.
Als der junge Graf sein fünfzehntes Jahr zurückgelegt hatte, verließ auch er das väterliche Haus, um in Begleitung seines Bruders Heinrich, der auf kurze Zeit nach Preußen zurückgekehrt war, im August 1598 die Universität Altdorf zu beziehen. Nicht ohne Absicht hatte der Vater diesen jüngsten seiner Söhne, der trotz der Aufsicht im elterlichen Hause schon manche Untugend kennengelernt, dem religiös gesinnten Bruder Heinrich anvertraut. Dieser sollte auf der Universität sein Führer sein und seine Studien leiten. Er benutzte schon auf der Reise jede Gelegenheit, auf seinen Bruder wohltätig einzuwirken. Nach alter Sitte versäumten sie nie, jeden Morgen mit dem Gebete eines Psalms zu beginnen, wie es schon im elterlichen Hause herkömmlich war. Beide Brüder erreichten indes das Ziel ihrer Reise nicht; denn in Nürnberg angekommen, erkrankte Graf Heinrich sehr gefährlich. Sie setzten zwar die Reise fort, die Krankheit aber wiederholte sich und nahm so bedeutend überhand, daß der Leidende schon nach wenigen Tagen in einer Dorfschenke starb. Dadurch in die traurigste Lage versetzt, eilte Christoph nach Altdorf, wohin sich, nach kurzem Aufenthalt zu Rostock, auch sein Bruder Abraham begeben und bald zum Rektor der Universität erwählt worden war. Auch der Bruder Achatius fand sich dort aus Heidelberg ein, um die nötigen Anstalten zur Beisetzung des Verstorbenen zu treffen. Die drei Brüder verweilten den Winter über in Altdorf; denn die dortige hohe Schule stand damals in großem Ruf; besonders glänzten die Namen mehrerer Professoren der Rechtsgelehrsamkeit, bei denen die Grafen Vorlesungen hörten.
Indessen stand das Studentenleben in Altdorf damals nicht im besten Ruf: Ein großer Teil der Studierenden vergeudete die Zeit bei Trinkgelagen und mit Mummereien auf Schlittenfahrten oder ähnlichen Ergötzlichkeiten.
Da Graf Abraham im Frühling 1599 sich nach Frankreich begab und Achatius nach Heidelberg zurückkehren wollte, so konnte es nicht der Eltern Wille sein, den jungen Sohn Christoph in Altdorf sich selbst zu überlassen. Auf des Vaters Befehl begleitete er seinen Bruder nach Heidelberg. Sie nahmen den Weg über Nürnberg, wo sie, dem obersten Ratsherrn Hieronymus Baumgärtner empfohlen, die Ehre hatten, vom Rat zu einem stattlichen Mittagsmahl auf dem Rathause eingeladen zu werden. Sie verweilten mehrere Tage in der interessanten Stadt; ihre eigentümliche Physiognomie, die große Zahl ihrer Kunstschätze, das rege industrielle Treiben ihrer Bürgerschaft, – alles nahm Christophs Wißbegierde in Anspruch; es machte auf ihn einen Eindruck, dessen er sich auch in den spätesten Jahren seines Lebens noch mit Freuden erinnerte.
Der Name Dohna stand am kurpfälzischen Hofe im besten Klang. An ihn knüpften sich viele Verdienste, die sich Fabian von Dohna um das kurpfälzische Haus erworben, und während der ganzen Regierung des Kurfürsten Friedrich IV. hatte er als Geheimer Rat bedeutenden Einfluß auf die gesamte Verwaltung des Landes. Durch ihn wurden die beiden jungen Neffen, bald nach ihrer Ankunft in Heidelberg, am Hofe eingeführt, und der junge Kurfürst Friedrich, damals erst 25 Jahre alt, schenkte ihnen seine Gunst. Es fand kein Hoffest statt, bei dem sie nicht als Gäste erschienen, kein fürstliches Vergnügen, an dem sie nicht teilnehmen mußten. Der junge Kurfürst liebte es, zur Waffenübung seiner Untertanen kriegerische Kampfspiele anzuordnen. Dann wurden etwa 90 mit langen Spießen oder Piken bewaffnete Bürger einigen 30 von Adel, mit großen Schilden oder Tartschen bewehrt, gegenübergestellt. An ihrer Spitze standen bald Graf Johann von Nassau und Graf Otto von Solms, bald auch der Kurfürst selbst und ein Graf von Dohna; gerieten die Haufen aneinander, so gab es in der Hitze des Kampfes harte Stöße. Bei diesem ersten Eintritt in das Hofleben zu Heidelberg lernte Graf Christoph auch den Fürsten Christian von Anhalt kennen, mit dem er später, durch Freundschaft verbunden, soviel zusammen lebte. Mitunter erlaubte sich der junge Kurfürst am Hofe allerlei Schwänke. Als er eines Tages dem Markgrafen Ernst Friedrich von Baden-Durlach einen Besuch abstattete, kamen sie beim Trinkgelage auf den Einfall, allen Leuten die Bärte abschneiden zu lassen, und es wurde dies auch sogleich an allen Gästen vollführt, »was,« wie Dohna sagt, »sonderlich an den alten, vornehmen geheimen Räten ein großer Übelstand gewesen, denn man sie kaum noch kannte«.
Bei diesen Zerstreuungen des Hoflebens vergaßen die Grafen jedoch ihre Studien nicht. Sie hatten – was auf ihre Ausbildung wohltätig einwirkte – ihren Tisch bei dem berühmten calvinistischen Theologen Magister Abraham Scultetus, einem Schlesier, der, nachdem er in Wittenberg und Heidelberg seine Studien vollendet und sich durch mehrere Reisen ausgebildet, vom Kurfürsten Friedrich IV. als Gehilfe seines Hofpredigers Bartholomäus Pitiscus angestellt wurde. Bei ihm hörten sie Vorlesungen über Logik, über Ethik und übten sich unter seiner Leitung im lateinischen Stil, wobei ihnen die Briefe und Reden Ciceros zur Nachahmung dienten. Besonders aber war der tägliche Umgang mit diesem gelehrten Mann auf ihre Bildung von großem Einfluß. So freundlich er sie auch behandelte, so sah er ihnen doch keinen Fehler ohne Rüge nach. »Ich«, sagte Graf Christoph von sich selbst, »der ich immer alles mit Eile und Gewalt ausrichten wollte und dabei von Natur auch geneigt war, viel zu schwatzen und schnell zu urteilen, wurde deshalb von Scultetus nicht selten durch lateinische Kernsprüche gewarnt und zurechtgewiesen.«
In Heidelberg, wo Graf Christoph auch mit mehreren Professoren persönlichen Umgang hatte, verweilte er zwei Jahre. Nachdem er, wahrscheinlich nicht ohne Einfluß des Scultetus, das reformierte Glaubensbekenntnis angenommen, trat er mit seinem Bruder Achatius 1600 eine Reise nach Italien an. Sie besuchten zuerst Venedig, wo sich für Dohnas empfänglichen Geist eine ganz neue Welt eröffnete. Dann gingen sie über Ferrara und Bologna nach Florenz. Hier hielten sie sich längere Zeit auf, teils, um sich in der italienischen Sprache möglichst zu vervollkommnen, teils, um die dortigen Kunstschätze gründlich kennen zu lernen; vorzüglich fesselte sie auch der nähere Umgang mit mehreren deutschen Fürsten, die damals in Florenz verweilten. Am interessantesten war für die jungen Grafen die Bekanntschaft mit dem wissenschaftlich gebildeten Fürsten Ludwig von Anhalt, dem Begründer der nachmals so weit verbreiteten »Fruchtbringenden Gesellschaft«, als deren erstes Oberhaupt er von seinem Sinnbild, einem gut ausgebackenen Weizenbrot, den Beinamen des »Nährenden« führte. Seine große Vollkommenheit im Lautenspiel gab Anlaß, daß sich Graf Christoph bei dem damals berühmten Florentiner Musiker Lorenzo Allegri auch bedeutende Fertigkeit auf der Laute erwarb.
Von Florenz eilten die beiden Grafen im September 1601 zunächst nach Neapel und begaben sich von dort nach Rom, wo sie im November ankamen. Auf Christophs Seele machte die Weltstadt den gewaltigsten Eindruck; alles übertraf seine gespannten Erwartungen. Höchst günstig für ihre Belehrung und den Genuß alles Großartigen und Schönen, war es für die Grafen, daß sie an dem Herrn Fabian Konopatzki, der in des Papstes Clemens VIII. Diensten stand, einen Verwandten fanden, durch dessen Vermittelung ihnen die Bekanntschaft mit allen Merkwürdigkeiten außerordentlich erleichtert wurde. Alles, was Graf Christoph an interessanten Gebäuden, Denkmälern aus dem Altertum, schönen Gemälden oder Kunstwerken sah, zeichnete er mit großer Genauigkeit in einem Itinerarium auf. Dabei versäumte er auch die Leibesübungen nicht, die damals zur Ausbildung eines Kavaliers gehörten, lernte Fechten, Voltigieren, Fahnenschwingen und ähnliche Künste. Vielen Fleiß verwandte er bei dem berühmten Meister Nanino auf die Musik.
Die unerwartete Nachricht vom Tode ihres Vaters, der gegen Ende 1601 gestorben war, veranlaßte sie zu einer früheren Abreise von Rom als ursprünglich in ihrem Plane lag. Sie hatten während ihres Aufenthaltes, durch mannigfache Verhältnisse begünstigt, für ihre Ausbildung in aller Hinsicht viel gewonnen. Auf der Rückkehr besuchten sie Genua, Mailand, Verona, Brescia und Bergamo, auch Venedig und Florenz wieder; hier ließ sich Graf Christoph den Platz zeigen, wo der berühmte Mönch Geronimo Savonarola seine begeisternden Reden gehalten, das Kloster, wo er gewohnt, und den Ort, wo man ihn auf dem Scheiterhaufen verbrannt hatte. »Noch heute«, schrieb Dohna in sein Tagebuch, »halten viele gelehrte Leute in Florenz hoch auf ihn.« Von da nahmen die beiden Grafen die Rückreise durch die reizenden Gegenden Tirols, über den Comersee, durch Graubünden in die Schweiz, wo sie aber so lange verweilten, daß sie über Straßburg erst im August in Heidelberg ankamen.
Hier hatten sie früher lehr- und genußreiche Tage verlebt, die Stadt war ihnen so lieb geworden, das Leben und Treiben an dem heiteren Hofe des Kurfürsten, wo sie bei Staatsmännern, kurfürstlichen Räten und fremden Gästen lehrreiche Unterhaltung fanden, – dies alles fesselte sie so sehr, daß sie ihren Aufenthalt von Monat zu Monat verlängerten. Graf Christoph lernte damals mehrere fürstliche Personen kennen, mit denen er später in Berührung kam, den Herzog von Bouillon, der, einer verbrecherischen Verbindung gegen den König Heinrich IV. angeklagt, aus Frankreich entflohen war, den Markgrafen Johann Georg von Brandenburg, damals Administrator in Straßburg, und den Landgrafen Moritz von Hessen. Es ergab sich bald Gelegenheit, den Grafen mit dem höheren Staatsleben bekannt zu machen. Um das Getriebe auf einem Reichstage kennen zu lernen, begleitete er 1603 seinen Oheim, Fabian von Dohna, den der Kurfürst zu seinem Bevollmächtigten ernannt hatte, auf den Reichstag nach Regensburg, und des Oheims ausgebreitete Geschäftskenntnis und diplomatische Gewandtheit waren für ihn ebenso lehrreich, wie sein stets heiteres Wesen anziehend und gewinnend. Die Nachricht von dem am 26. April 1603 erfolgten Tode des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach, des bisherigen Administrators von Preußen und Vormunds des blödsinnigen Herzogs Albrecht Friedrich, machte für Fabian von Dohna eine Reise nach Preußen notwendig, wohin ihn sein Neffe Christoph begleitete.
Nachdem er bis zum März 1604 dort verweilt hatte, trat er mit seinem Bruder Achatius eine Reise nach Frankreich an. Die Fahrt ging über Dessau, wo der Fürst sie mehrere Tage aufs Schloß nahm, über Frankfurt, Heidelberg, Straßburg und Basel, wo sie den gelehrten Johann Jakob Grynäus kennen lernten, zunächst nach Genf. Hier fesselte sie auf längere Zeit der Umgang mit vielen Fremden von Adel, die sich zahlreich in Genf aufhielten, und vorzüglich die Bekanntschaft mit mehreren Gelehrten, mit denen Graf Christoph auf seinen Reisen vor allen gern in nähere Berührung zu kommen suchte. Unter diese gehörte in Genf der ehrwürdige Theodor Beza, zwar schon ein Greis von 85 Jahren, aber frischen Geistes. Unter dessen Leitung vervollkommnete Graf Christoph seine Kenntnisse in der griechischen Sprache; außerdem wurde auch das Französische mit dem größten Fleiß betrieben, sodaß er in wenigen Monaten der Sprache völlig mächtig wurde. Neben diesem Gewinn für seine Bildung sprach ihn auch das Volksleben an. »Ich muß bekennen«, schreibt er in sein Tagebuch, »daß der fromme und eingezogene Wandel, den man zu Genf führt, wie auch die gute Ordnung und Disziplin, so allda gehalten wird, mir sehr wohl gefiel und mir großen Nutzen gebracht. So hat man im Monat Mai an den Stadtgraben und Bollwerken zu Genf zu bauen angefangen. Damit nun aber das Volk zur Arbeit desto williger wäre, hat man die Fremden von Adel aufgefordert, mit dem Volke auszuziehen und sich in Ordnung mit ihm nach dem Ort hin zu verfügen. Als man nun dahin gekommen, wohin auch mein Bruder Achatius mit deutschen und niederländischen Studenten gegangen, hat man zuerst Gebet gehalten; hernach hat ein jeder seinen Spaten genommen und etliche Stiche gegraben; darauf das Volk, so zur Arbeit verordnet, fröhlich zu schanzen angefangen.«
Da es Hauptzweck der Reise war, Volk und Land genau kennen zu lernen, so eilten sie nicht sofort der Hauptstadt zu. Sie sahen, von Genf aus, über Chambéry, Grenoble und Lyon durchs südliche Frankreich eine große Menge von Städten bis nach Bordeaux hin, wo sie einen Teil des Sommers verlebten. Was sie auch jetzt noch von Paris fern hielt, war die Nachricht von dem Tode der einzigen Schwester des Königs Heinrichs IV., Katharina, Gemahlin Herzogs Heinrich von Lothringen, die am 30. Juli 1604 gestorben war. Dieser Todesfall versetzte den König, der seine Schwester innigst liebte, in tiefste Trauer. Graf Christoph bemerkt darüber in seinem Tagebuch: »Obwohl die Herzogin einen päpstlichen Herrn gehabt, ist sie ihrer Religion doch beständig geblieben und als sie nun gestorben war, hat der ganze königliche Hof groß Leid getragen, wie auch die fremden Gesandten, unter welchen der päpstliche Nuntius sich anfangs lange bedacht, ob er auch trauern solle; hat jedoch endlich schwarz angelegt und dem König das Leid geklagt, mit Vermelden: Andere beweinten den Leib, sein Herr aber, der Papst, und er müßten auch die Seele beklagen. Der König hat darauf geantwortet: ›Er stehe in keinem Zweifel, daß seiner Schwester Seele der ewigen Seligkeit teilhaftig geworden.‹ Diesen Tod hat der König so tief betrauert, daß seine Majestät sich anfangs gar nicht hat wollen trösten lassen, sondern begehrt, man solle ihm Zeit geben, sich des Schmerzes zu erholen.«
Unsere Grafen setzten hierauf ihre Reise über La Rochelle, Poitiers, Bourges, Orléans, Blois, Tours bis Saumur fort. Hier fesselte sie der Umgang mit einem der gebildetsten und einflußreichsten Staatsmänner Frankreichs. Es war Philipp von Mornay, Herr du Plessis-Marly, damals königlicher Rat und Gouverneur von Saumur. Schon in seinem dreiundzwanzigsten Jahre hatte er auf Colignys Antrag ein wichtiges Memoire verfaßt, worin er seine Ansicht über den Krieg gegen Spanien für den König Karl IX. aussprach. Als strenger Reformierter verfocht er die Sache seiner Glaubensgenossen immer mit solchem Feuereifer, daß man ihn häufig den protestantischen Papst nannte. Dies entfernte ihn auch vom königlichen Hofe, als Heinrich IV. zur katholischen Kirche übertrat, und er lebte längere Zeit in Saumur, wo er für Reformierte eine Universität gestiftet hatte. In der Unterhaltung mit diesem Staatsmann fanden die Grafen Dohna mehrere Wochen die gründlichste Belehrung über die damaligen Zustände in Frankreich.
Erst gegen Ende des Mai 1605 kamen sie, von Chartres aus, in Paris an, wo sie zwei Vettern aus Böhmen, die Grafen Wladislaw und Otto von Dohna und einen dritten Verwandten, Karl Hannibal von Dohna, anwesend fanden. Da jene beiden Lutheraner, dieser Katholik, Christoph und Achatius Reformierte waren, so sah man in ihnen drei Religionen vertreten. Außer der Bekanntschaft mit dem alten Grafen Ludwig von Wittgenstein, die Graf Christoph schon in den ersten Tagen machte, war besonders die mit dem berühmten Geschichtsschreiber Jacques Auguste de Thou (Thuanus) für ihn von großer Wichtigkeit. Von ihm, der früher Präsident im Parlament gewesen, erhielt Dohna über viele Zeitverhältnisse Aufklärungen und Mitteilungen, wie er sie von keinem anderen erwarten durfte. Während des Aufenthalts der Grafen in Paris war in der vornehmen Welt Hauptgegenstand lebendigster Unterhaltung die Rückkehr der ersten, im Jahr 1600 verstoßenen Gemahlin Heinrichs IV., Margarethe, der Tochter des Königs Heinrich II. von Frankreich. Der König hatte damals diese seine Gemahlin, um seine Geliebte Gabrielle d'Estrées zur Königin zu erheben, als Gefangene in ein entferntes Schloß verbannt. Da aber Gabrielle bald darauf gestorben war, hatte sich der König mit der florentinischen Prinzessin Maria von Medici vermählt. Jetzt hatte Margarethe, wie Dohna berichtet, die Erlaubnis erhalten, an den Hof zurückzukehren, wo sie von der Königin stattlich empfangen wurde. Dies gab Anlaß, den König zu beschuldigen, er habe zu gleicher Zeit drei Frauen gehabt. In Paris liefen damals die Verse um:
Le plus grand Roy, qui ait jamais été,
C'est le mari de trois femmes en estre
L'une qui l'est, l'autre qui l'a esté
Et une encore, qui a tout droit de l'estre.
Ein anderes wichtiges Ereignis, von dem Graf Christoph berichtet, war ein Angriff auf des Königs Leben: Als dieser, eines Tages von der Jagd nach Paris zurückkehrend, an eine Brücke kam, stürzte ein Mensch auf ihn zu und hielt ihn am Mantel fest. Auf die Frage des Königs, was er wolle, antwortete der Verwegene »Euer Leben« und griff alsbald nach dem Dolch. Ehe es aber zur Tat kam, fielen Hofleute über ihn her und nahmen ihn gefangen. Die Untersuchung ergab, daß der Mensch, schon mehrmals von Wahnsinn befallen, einmal sogar seinen Bruder habe ins Feuer werfen wollen, um ihn, wie er angab, schon auf Erden durch Fegefeuer von seinen Sünden zu reinigen. Der König schenkte ihm das Leben, verurteilte ihn jedoch zu lebenslänglichem Gefängnis. Indes ging bald das Gerücht, der Verbrecher sei ein heimlicher Jesuit, oder, wie andere behaupteten, von versteckten Jesuiten zu seinem Mordanfall gewonnen.
Nichts aber hielt gegen Ende des Jahres 1605 die Unterhaltung mehr in Bewegung als die englische Pulververschwörung, wozu die Zeitungen reichen Stoff boten. »Aus England«, so schrieb man damals, »haben wir Nachrichten, daß zu London man an dem Tage, als die Versammlung der Stände des ganzen Königreichs hat gehalten werden sollen, ein Impressa wider den König und alle Räte, sie umzubringen, hat vornehmen wollen, welches aber dergestalt entdeckt worden ist: Ein guter Freund hat einem Herrn vom Lande ein Brieflein zugeschickt, so aber von niemand unterschrieben, darin er ihn ermahnt, es werde heutiges Tags ein Anschlag auf den König und seine Räte gemacht; er bitte und rate ihm, er wolle sich nicht dabei finden lassen. Der Autor werde sich selbst auch abwesend halten. Dieser zeigt das Brieflein dem Könige stracks morgens um 7 Uhr. Der König aber will anfänglich solchem keinen Glauben geben; letztlich jedoch läßt er den Saal der Zusammenkunft, den man Whitehall nennt, nächst bei der großen Kirche Westminster, untersuchen. Daselbst findet man, daß ein großer Keller daran stößt, darin ein Hartschierer des Königs etliches Holz und Stroh gehalten; man findet dort 33 Tonnen und zwei große Weinfässer mit Pulver, auch ein Meßgewand, Weihwasser und ein Kruzifix, auch einen Knecht, der mit Stiefel und Sporen herausgeht, welcher alsbald ergriffen wird und, da man ihn examiniert, bekennt er, daß man den Saal, darin der König, die Königin und ihre junge Herrschaft, samt über 700 Herren vom Rate und 4000 vom Lande hätten sein sollen, habe in die Luft sprengen wollen. Alsdann wird ein Aufruhr in der Stadt. Der Profoß wird ausgeschickt, welcher 18 Personen, die wie der Hartschierer dieses Handels teilhaftig und Päpstische gewesen sein sollen, so auch den Grafen von Northumberland gefangen genommen. Man hat alsbald den Spaniern, die zu Dover gelegen, ihre Waffen abgenommen und dem spanischen Gesandten eine Guardia in sein Losament gelegt. Man hat auch Schreiben aus London, daß noch viele Herren und Grafen, an 200, gefangen worden seien und daß von des Königs wegen ein Edikt publiziert worden: es solle sich niemand unterstehen, etwa ausheimische Könige, Fürsten, Herren und Gemeinden mit diesem Werke zu bezichtigen, bis zu der Zeit, da ihre Majestät und deren Räte von allem wohl informiert, solches selbst ans Licht bringen wollen.
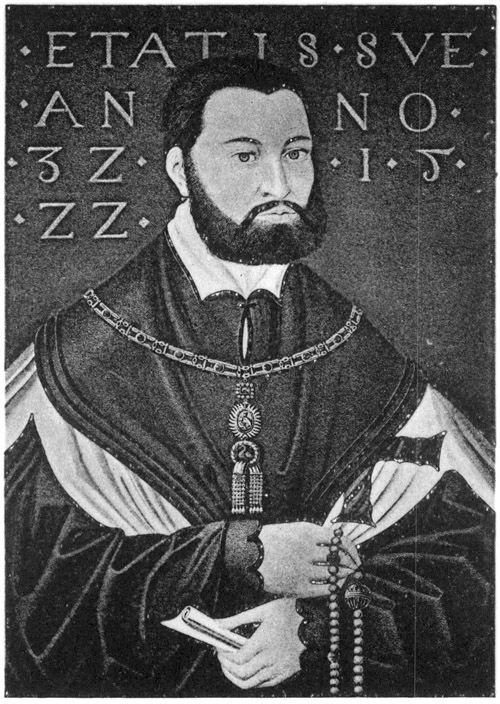
Unbekannter Meister des 16. Jahrhunderts nach einem verschollenen Gemälde von Hans Henneberger, Albrecht, Hochmeister des deutschen Ordens. Kloster Alsheim bei Ansbach
Das Edikt, welches der König am 15. November 1605 hat publizieren lassen, lautet also:
»Kund und offenbar, daß ein Edelmann und Pensionär Ihrer Majestät, genannt Thomas Percy, die gräulichste und erschrecklichste Verräterei unternommen hat, die nie erhört und erdacht worden, nämlich, daß er hat wollen in die Luft sprengen den König, die Königin, seinen Sohn, den jungen Prinzen, alle Edelleute und Kommittirten mit einer großen Menge Pulver, die er heimlich gebracht hat in einen Keller unter einer Kammer des Parlaments, da die Versammlung sein sollte, welches Pulver diesen Morgen gefunden worden; dazwischen hat sich der Percy davon gemacht. Ist darum unser Wille und Begehren an alle unsere Offiziere und Untersassen, daß sie wollen williglich vollbringen, daran wir nicht zweifeln, nämlich, daß sie fleißige Nachforschungen haben sollen, den Percy durch alle möglichen Mittel zu bekommen, auf daß seine anderen Konspiratoren mögen offen bar werden. Der gedachte Percy ist ein langer Mann mit einem großen, breiten Bart, von einer bequemen Statur, die Gestalt seines Hauptes und sein Bart sind vermischt mit greisen Haaren; sein Haupt ist weißer als sein Bart; er ist etwas breitschulterig, seine Augen goldfarbig, hat lange Füße und dünne Beine. Gegeben in unserem Palast Westminister im Jahre unserer Regierung von Großbritannien im V.«
Bald darauf lasen die Grafen Dohna in den Pariser Zeitungen: »Thomas Percy, ein naher Verwandter des Grafen von Northumberland, solle gefangen worden sein. Derjenige aber, der bei den Fässern mit Pulver, mit einem falschen Licht im Gewölbe unter dem Palast, da man das Parlament halten wollte, gewesen, ist auch ergriffen und des Percy Diener, de Huson genannt, hat sich höchlich beklagt, daß sein heilsam Fürnehmen, welches ihm der Allmächtige inspiriert hätte, durch den Teufel ans Licht gebracht worden sei. Als ihm durch den königlichen Rat vorgehalten worden, daß er doch wohl gewußt, daß in solchen Versammlungen auch viele Herren erscheinen würden, die der römischen Religion zugetan, und man gerne wissen wolle, mit welchem Gewissen er denselben das Leben hätte nehmen können, hat er geantwortet: Da es vollzogen worden, wäre es unmöglich gewesen, daß nicht auch viele gute Katholische solches hätten entgelten müssen; aber man sollte bedenken, daß dieselben als Märtyrer oder Zeugen Gottes nachmals kanonisiert und für Heilige sollten gehalten sein. Als man ihn weiter gefragt: wer seine Mitgesellen wären? hat er nichts anderes bekennen wollen, als daß er vor zwei Monaten in Brabant, Flandern und Frankreich gewesen und mit etlichen jesuitischen Patres Konversation gehalten hätte, hat aber nicht gestehen wollen, was ihre Kommunikation gewesen, ja noch dazu gesagt: wenn man ihm auch die größte Marter antäte, wolle er doch nichts davon bekennen. Aus London wird auch an eine vornehme Person des Hofes allhier geschrieben, dort gehe die Sage, daß die Verräterei mit Vorwissen und aus Anstiftung der holländischen Staaten verursacht und bestellt gewesen und daß der Prinzipaltäter Thomas Percy alsbald nach Holland geflohen sei und daselbst noch zur Zeit seinen Aufenthalt habe. Die abwesenden Stände in England, die auf dem bestimmten Tag des Parlaments in Westminster nicht erschienen, entschuldigen sich damit, daß sie etliche Tage zuvor durch ein unbekanntes Schreiben gewarnt worden, welches sie auch dem Könige überschickt, ehe der Anschlag hat ins Werk sollen gerichtet werden; dadurch aber machen sie sich noch mehr verdächtig und man will es für eine genugsame Entschuldigung ihres Abwesens nicht passieren lassen. In Summa, die Vermutung geht stark, auch sind erhebliche Ursachen zu glauben, die ganze Verräterei sei eine holländische Praktik mit vielen malcontenten Ständen in England gewesen.«
Das Leben in der Hauptstadt fesselte die Grafen ein ganzes Jahr. Sie hatten die Freude, im Frühling 1606 auch den Herzog von Bouillon, den sie schon in Heidelberg kennen gelernt und dessen nähere Bekanntschaft besonders dem Grafen Christoph später von großer Wichtigkeit wurde, in Paris begrüßen zu können. Der Herzog nämlich hatte sich aus Deutschland nach Sedan begeben. Der König wünschte eine Versöhnung mit ihm; allein die angeknüpften Unterhandlungen blieben ohne Erfolg; denn der Herzog erklärte sich zwar bereit, den König, wenn er mit seinem Hofgefolge nach Sedan komme, dort aufnehmen zu wollen, weigerte sich aber standhaft, ihm den Platz zu übergeben, bevor er durch eine feste Zusage der königlichen Gnade gesichert sei. Der König brach im April 1606 mit einem Heere nach Sedan auf, um, wie man meinte, den Herzog mit Gewalt zur Ergebung zu zwingen. Als er sich der Stadt näherte, leitete der kluge Staatssekretär de Villeroi eine Zusammenkunft mit dem Herzog ein, versicherte diesen der wohlwollenden Gesinnungen des Königs, worauf jener sofort in die vorgeschlagenen Bedingungen einwilligte und dem Könige bis Donchery entgegenzog. Hier kam es zur völligen Versöhnung. Der König zog in Sedan ein, verweilte dort einige Tage, übergab die Stadt vorläufig einem Gouverneur, der sie nach einem Monat dem Herzog wieder einräumen mußte. Dieser begleitete den König nach Paris zurück, wo er am Hofe als welterfahrener Staatsmann mit außerordentlicher Auszeichnung behandelt wurde. In die Gesellschaft der vornehmen Welt, die sich häufig bei ihm versammelte, lud er regelmäßig die jungen Grafen von Dohna ein; denn mit ihnen unterhielt er sich besonders gern. Aus seinem früheren Leben erzählte er dem Grafen Christoph einst folgende, sonst unbekannte Tatsache: er sei, von katholischen Eltern abstammend, in seiner Jugend Katholik gewesen. Eines Tages sei er in Montauban in eine reformierte Kirche gegangen, um in jugendlichem Übermut den Prediger auf irgend eine Weise in Verlegenheit zu setzen. Allein die Rede des Geistlichen habe auf ihn den gewaltigsten Eindruck gemacht, sodaß er über sich und seinen Glauben zu ernster Gesinnung gekommen und endlich auf diesem Wege der Selbstbekehrung zur reformierten Kirche übergegangen sei. Durch Vermittelung dieses Staatsmannes glückte es den Grafen Dohna, in einer Audienz dem König Heinrich IV. vorgestellt zu werden. Sie wurden in ein Lusthaus an den Tuilerien eingeladen, wo sich der König in der großen Galerie befand. Er hatte, wie Christoph in seinem Tagebuch bemerkt, ein Kleid von braunem, gewässertem Tobin an, trug einen schwarzseidenen Mantel, um den Hals eine Kröse und auf dem Kopf einen schwarzen Hut. Als der Herzog von Bouillon ihm die beiden Grafen vorstellte, nahm der König den Hut ab und begann seine Unterredung mit den artigen Worten: »Je serai bien aisé de vous faire plaisir.« Während der Unterhaltung ging er mit den Grafen im Garten spazieren. Bald darauf, noch im Frühling 1606, kehrten die Grafen, um auch das nördliche Frankreich kennen zu lernen, über Soissons, Laon, Sedan, Nancy und Saarbrück nach Heidelberg zurück, wo Graf Achatius die Stelle eines Gouverneurs des zehnjährigen Kurprinzen Friedrich, ältesten Sohnes des Kurfürsten Friedrichs IV., erhielt.
Am Kurpfälzischen Hofe befand sich der Fürst Christian I. von Anhalt, dem bei der Teilung der anhaltischen Lande der Anteil von Bernburg zugefallen war. Er hatte bisher aber wenig in seiner heimatlichen Herrschaft gelebt. Reiselust trieb ihn schon als Jüngling in die Türkei. Nach seiner Rückkehr gewann er seine Hofbildung an den Kurhöfen von Brandenburg und Sachsen. Von beiden aber schreckte ihn die damals dort herrschende Sauflust hinweg; denn diese haßte er ebenso sehr, wie er dem Kriegshandwerk ergeben war. Im Kriegswesen hatte er sich früher schon einen reichen Schatz von Kenntnissen erworben, und so stand er jetzt als ein Mann da, der wegen seiner Entschlossenheit im Handeln, seiner Gewandtheit in Staatsgeschäften und seiner kriegerischen Tapferkeit überall Achtung und Vertrauen genoß. Er hatte soeben, als die Grafen Dohna nach Heidelberg zurückkehrten, vom Kurfürsten Friedrich den Auftrag erhalten, eine Gesandtschaft an König Heinrich IV. zu übernehmen, und war bereits mit einer Instruktion versehen, worin die wesentlichsten Bestimmungen zur Einrichtung eines Bündnisses aller protestantischen Fürsten in Deutschland zur Abwehr gegen katholische Anmaßungen in Sachen des Glaubens und der Kirche vorgezeichnet waren. Seine Aufgabe war, den König Heinrich zur Unterstützung dieses Bündnisses zu gewinnen.
Er wünschte, bei seinem wichtigen Auftrage einen Begleiter zu haben, der die Verhältnisse des französischen Hofes aus eigener Anschauung kannte, und sein Auge konnte kaum auf einen anderen fallen als auf den Grafen Christoph von Dohna. Dieser zählte damals zwar erst 23 Jahre; allein seine genauere Bekanntschaft mit de Thou, mit Mornay du Plessis, der eine Zeitlang in Paris lebte, mit dem Herzog von Bouillon und anderen Staatsmännern empfahl ihn vor allen. Der Fürst teilte seinen Wunsch dem Grafen Fabian von Dohna mit, auf dessen Anraten Graf Christoph, dessen Reiselust auch längerem Besinnen nicht Raum ließ, das Anerbieten sofort annahm. So trat Graf Christoph im Juni 1606 seine zweite Reise nach Frankreich an, durch die er ins diplomatische Leben eingeführt wurde. Der Fürst, begleitet von seinem Schwager, dem Grafen von Bentheim, kam mit seinem Gefolge am 21. Juli in Paris an und ließ sich alsbald durch ein Handschreiben beim Könige anmelden. Da dieser indes in der Hauptstadt nicht anwesend war, benutzte er die erste Woche, um sich in Begleitung des Grafen Christoph mit den merkwürdigsten Lokalitäten, Gebäuden und Sammlungen von Kunstgegenständen bekannt zu machen. Nachdem der König am ersten August nach Paris zurückgekehrt war, ließ er den Fürsten aufs freundlichste willkommen heißen und zugleich am anderen Tage zu sich in die Tuilerien einladen, wohin diesen ein kostbarer königlicher Wagen abholte. Achtzehn deutsche Edelleute, die seinen Hof bildeten, begleiteten ihn. Vom König mit außerordentlicher Freundlichkeit empfangen, unterhielt sich dieser mit ihm ganz allein über eine Stunde, und der Zweck der Sendung des Fürsten war erreicht; denn der König sagte Unterstützung des beabsichtigten Bündnisses bereitwillig zu. Nachdem darauf dem Könige mehrere Begleiter des Fürsten vorgestellt waren, unter denen er besonders den ihm schon bekannten Grafen von Dohna freundlich ansprach, unterbrach die Messe bei den Kapuzinern, die der König hören wollte, die weitere Unterhaltung. Fürst Christian verweilte in Paris noch bis gegen Ende August. Als sein Begleiter machte Dohna die interessantesten Bekanntschaften mit den ersten Staatsmännern Frankreichs. Zu diesen gehörte der im höchsten Ansehen stehende Marquis von Rosny, Maximilian von Béthune, den der König soeben zum Pair und Herzog von Sully erhoben hatte. Seit seiner Jugend Waffengefährte des Königs und in die geheimsten Pläne der französischen Politik eingeweiht, war er für Graf Dohna Gegenstand schärfster Aufmerksamkeit. Da Fürst Christian das Arsenal kennen zu lernen wünschte, so führte ihn Sully, der Großmeister der Artillerie und Oberintendant der Festungen war, selbst umher. Damals machte auch Graf Dohna nähere Bekanntschaft mit ihm, an die sich später vielfache Geschäftsverhältnisse knüpften. Auch mit Villeroi, einem der bedeutendsten Staatsmänner, kam Dohna damals schon in nähere Berührung. Nicht minder wichtig war für ihn die Bekanntschaft mit Jeannin, der sich aus dem Handwerkerstande – er war der Sohn eines armen Lohgerbers – bis zur Würde eines Parlamentspräsidenten emporgehoben hatte und jetzt am Staatsruder saß, von seinem König mit dem vollsten Vertrauen beehrt, besonders in der Geschäftsverwaltung der auswärtigen Angelegenheiten. Alle diese und zahlreiche andere Bekanntschaften, namentlich auch mit den am französischen Hofe damals accreditierten Gesandten von England, den Niederlanden und Florenz, waren für Dohna späterhin von größter Wichtigkeit. Im übrigen brachte seine amtliche Stellung den jungen Grafen in angenehme Verhältnisse. Er nahm an allen Hoffesten teil; denn der König fand Gefallen an seiner Unterhaltung. Er erhielt auch eine Einladung, als in der königlichen Familie eine dreifache Kindertaufe, nämlich die des ältesten Sohnes des Königs, des Dauphin Ludwig und der beiden Prinzessinnen Isabelle und Christine zu Fontainebleau stattfand, wobei es dem Grafen auffallend war, daß bei der königlichen Tafel, an der auch er als Gast saß, der königlichen Familie Fürsten von Geblüt, dem päpstlichen Legaten aber, der für den Papst Paul V. Patenstelle vertrat, sowie den anderen Gevattern, die Fürsten des Hauses Lothringen und andere großen Herren aufzuwarten hatten und ausdrücklich angeordnet war, daß Religionsverwandte nur von Religionsverwandten, zum Beispiel der päpstliche Legat vom Sohne des Duc de Sully, bedient werden durften. Wenn sich hier die Religionsspaltung nur in mildester Form zeigte, so sah sie Graf Dohna damals in den Provinzen an vielen Orten weit schärfer hervortreten. Zu Montauban in Gascogne, las er im Dezember 1606 in den Pariser Zeitungen, ist der Bischof samt seiner Klerisei ohne einige Ursache weggezogen, vorgebend, er könne Gewissens halber nicht neben den Ketzern und Hugenotten sein Amt verrichten. Man will dafür halten, es sei eine jesuitische Finte, auf einen neuen Lärm und auf ein Blutbad abgesehen. Allhier in Paris lassen sie noch nicht nach, diejenigen Evangelischen, die zu dem Exercitium gehen, zu verfolgen, auszulachen, ja auch mit Kot zu bewerfen, nur damit sie Ursache zum Tumult erlangen möchten, und also wird es in die Länge keinen Bestand haben, wo der König nicht selbst wehrt. Der gemeine Pöbel sucht nichts anderes als Aufruhr. Also läßt sichs gar zu einem Blutbade ansehen und haben etliche, fügt Dohna hinzu, schon soviel Luft von den Praktiken, daß sie dem Wetter nicht trauen, sondern ihre Sachen richtig machen und von Paris sich gen Straßburg zu begeben Vorhabens sind.
Erst im Anfang des Oktober 1607 konnte Graf Dohna an die Rückkehr denken. Er hatte am 8. dieses Monats im Garten der Tuilerien zuvor noch eine Audienz beim Könige, um sich bei ihm zu verabschieden. Dieser entließ ihn nach einer längeren Unterhaltung mit den freundlichen Worten: »Vous allez trouver Mr. le Prince d'Anhalt; dites lui, que je le prie de se souvenir de ce qu'avons traité emsemble et de poursuivre. Je lui suis toujours bien affectionné; et pour vous en votre particulier je vous serai toujours bien affectionné.«
Um auch das mittlere Frankreich kennen zu lernen, schlug Dohna auf der Rückreise den Weg über Chalons, Verdun und Metz ein und kam über Kaiserslautern und Mannheim nach Heidelberg, wo er seinen Bruder Achatius als Prinzen-Instruktor des jungen Pfalzgrafen Friedrich, des nachherigen Kurfürsten und späteren Königs von Böhmen, am Hofe fand. Er verweilte in Heidelberg den größten Teil des Winters, oft an den kurfürstlichen Hof geladen; denn der kränkliche Kurfürst liebte es, zu seiner Erheiterung unterhaltende Gäste zu versammeln. »Zum Abendessen«, bemerkt Dohna in seinem Tagebuch, »haben Sr. Kurfürstliche Gnaden mich sehr oft lassen erfordern; da hat jedermann müssen Historien erzählen, um Ihro Kurfürstlichen Gnaden, welche am Podagra und Stein litten, die Zeit zu kürzen, da es denn allerhand gute Historien und Discours gegeben.«
Dennoch bemächtigten sich in einsamen Stunden der Seele Dohnas trübe Stimmungen. Wer, wie er, die Erscheinungen der Zeit beobachtete und mit so richtigem Urteil in ihren möglichen Ausgängen und Folgen erwog, konnte nicht verkennen: die drückende Gewitterluft drohe eine Katastrophe herbeizuführen, die alles Bestehende in Staat und Kirche um so schrecklicher erschüttern werde, je mehr der unheilvolle Zündstoff Zeit gewann, sich nach allen Richtungen hin in seiner furchtbaren Masse aufzuhäufen. Zwar suchte Dohna, fromm wie er war, im Worte Gottes Halt und Trost. Der Gedanke an eine göttliche Vorsehung kehrte darin in seine bekümmerte Seele zurück. Er nahm in solchen Stunden, wie er selbst erzählt, gern die Bibel zur Hand und schlug sie auf, ob ihm vielleicht ein Trostspruch in die Augen falle. Und wenn er dann las: »Euere Haare auf dem Haupte sind alle gezählt« oder »Gott sind all' unseres Herzens Sorgen samt den Gedanken unverborgen«, so kehrte in seine Seele wieder Ruhe zurück. Allein neue drohende Ereignisse verscheuchten sie auch immer wieder.
In solchen Stimmungen wurden die Gedanken an die väterliche Heimat immer lebendiger. Die Sehnsucht, die Seinigen im elterlichen Hause wiederzusehen, drängte sich so unüberwindlich auf, daß er den Fürsten von Anhalt, in dessen Dienst er noch stand, um Urlaub zu einer Reise nach Preußen bat. Er erhielt ihn, jedoch nur auf kurze Zeit, und trat mit seinem Bruder Dietrich, der aus den Niederlanden nach Heidelberg gekommen war, zu Ende Januar 1608 bei sehr strenger Kälte die Reise an. Erst nach vier Wochen sahen sie ihr geliebtes Stammschloß Schlobitten wieder. Der erste Besuch galt dem hochbejahrten Oheim Fabian, damals Oberburggraf zu Königsberg, nach dem sich König Heinrich von Frankreich oft aufs angelegentlichste erkundigt hatte. Graf Christoph wurde wiederholt von der Herzogin Maria Eleonore von Preußen zur Tafel geladen, wo sie viel mit ihm in französischer Sprache konversierte; denn die Fürstin, eine Rheinländerin, liebte diese fast mehr als ihre Muttersprache. Auch in Preußen fand Dohna alles in Aufregung und Parteiung; denn nachdem Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg nach vielen Schwierigkeiten und Hindernissen die Kuratel über den blödsinnigen Herzog Albrecht Friedrich vom polnischen Hofe zugesprochen erhalten, trat ein großer Teil des preußischen Adels, der den günstig scheinenden Moment zur Erweiterung seiner Rechte nicht vorübergehen lassen wollte, mit einer Unzahl von Klagen und Beschwerden auf, die man abgestellt wissen wollte, bevor man die übertragene Kuratel anerkenne. Die Familie Dohna stand in dieser Parteiung auf der Seite des Kurfürsten. »Es ist damals«, berichtet Graf Christoph selbst, »im ganzen Herzogtum große Unruhe gewesen; weil auf einer Seite mein Herr Vetter (Graf Fabian, der Oberburggraf) nebst meinen Brüdern und anderen Gutherzigen auf des kurfürstlichen Hauses Brandenburg als des Landesfürsten Hoheit gesehen und sich bemüht, solche zu des Vaterlandes Besten zu erhalten; die anderen aber, die sich die klagenden Räte genannt, allein auf ihre Privilegien und Freiheiten drungen und darüber in großen Zwist, Unkosten und Widerwillen geraten sind.«
Dieses verderbliche Parteiwesen erleichterte dem Grafen Christoph den Abschied von Preußen. Er trat die Rückkehr nach Amberg zum Fürsten von Anhalt schon zu Ende April an. Ehe indes der Graf beim Fürsten anlangte, war ein wichtiges Ereignis erfolgt, wobei auch seine Tätigkeit von neuem in Anspruch genommen ward. Wir hörten bereits, daß schon früher der Gedanke eines Bündnisses der protestantischen Fürsten die wichtigste Veranlassung zur Sendung des Fürsten von Anhalt an den französischen Hof gewesen. Heinrich IV. hatte längst den Plan verfolgt, unter den protestantischen Fürsten Deutschlands eine Union gegen das habsburgische Haus zustande zubringen und ihm die Kaiserkrone zu entziehen. Schon 1602 hatte er darüber mit dem Landgrafen Moritz von Hessen bei dessen Besuch in Frankreich vieles unterhandelt und 1606 hatte er zunächst den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz für den Plan einer Union zu gewinnen gesucht, indem er ihm vorstellen ließ, wie notwendig eine Vereinigung der deutschen Fürsten und namentlich derjenigen sei, die Ansprüche auf die jülich-cleveschen Länder machten, damit nicht die immer steigende Macht des spanisch-österreichischen Hauses sich durch ihren Besitz vergrößere. Der Plan einer solchen Verbindung wurde wahrscheinlich zwischen dem König und dem Fürsten von Anhalt näher verabredet, indes erst die Bedrückungen der Protestanten in Deutschland, das immer gewalttätigere Auftreten des Kaisers und endlich auch der Tod des alten Herzogs Friedrich von Württemberg, der jeder Verbindung gegen den Kaiser widerstrebt hatte, mußten hinzukommen, um den Plan wirklich zur Ausführung zubringen. Am 4. Mai 1608 traten der Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg, der Markgraf Johann Friedrich von Baden-Durlach, der Herzog Johann Friedrich von Württemberg und die Markgrafen Christian und Joachim Ernst von Brandenburg-Kulmbach und Ansbach im Kloster Ahausen im Ansbachischen zur Sicherung des evangelischen Gemeinwesens in einen Bund zusammen, nach der Überschrift des darüber lautenden Rezesses die Union genannt. Der Fürst von Anhalt hatte sich damals dem Bunde noch nicht angeschlossen; er trat ihm, nebst anderen Fürsten, erst im folgenden Jahre für sein ganzes Haus bei und noch später (1610) nahmen auch der Kurfürst von Brandenburg, der Landgraf von Hessen und vier Reichsstädte an der Union teil. Doch wurde 1608 schon bestimmt, daß in Friedenszeiten das Bundesdirektorium vom Kurfürsten von der Pfalz geführt werden solle.
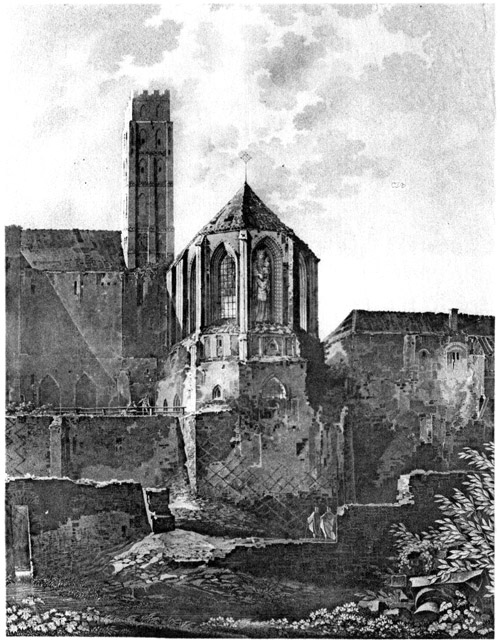
F. Gilly, Marienburg. Schloßkirche. Geätzt von F. Frick
Vor allem aber erforderte der Zweck des Bundes, unter möglicherweise bald eintretenden Umständen auf sichere Geldmittel rechnen zu können. Es sollten wegen des von der Krone Frankreich zu zahlenden Geldes Wechsel auf einige reiche Kaufleute in Venedig ausgestellt werden. Es kam darauf an, einen Mann dahin zu senden, der, außer der italienischen Sprache, auch Umsicht und Gewandtheit besitze. Man fand keinen mehr geeignet als den Grafen Christoph von Dohna. Er erhielt von den Mitgliedern der Union den Auftrag zu einer Gesandtschaft nach Venedig, indem er zugleich angewiesen wurde, sich über den Stand der Streitigkeiten zu unterrichten, die seit einigen Jahren zwischen Papst Paul V. und der Republik obwalteten.
Die Republik hatte bisher mit staatsmännischer Klugheit die Rechte der Geistlichkeit in politischen Dingen in festen Schranken gehalten. Geistliche wurden, wenn es das Wohl des Staates erforderte, ohne weiteres festgenommen und mit weltlichen Strafen belegt. Ein altes Gesetz untersagte der Kirche jede Erwerbung von Grundstücken und gebot zugleich, daß jedes Grundeigentum, das ihr durch letztwillige Bestimmungen zufiel, sofort von ihr wieder verkauft werden solle. Nach den Ansichten des Papstes Paul V. widersprach dies den Freiheiten der Kirche; er verlangte nicht nur die Aufhebung dieses Gesetzes, sondern auch die Freigebung zweier Geistlichen, die schwerer Verbrechen wegen gefangen gesetzt worden waren. Der Doge Leonardo Donato, erst seit dem 10. Januar 1606 erwählt, machte dagegen am römischen Hofe Vorstellungen, jedoch ohne Erfolg. Der Papst schleuderte gegen den Dogen und den gesamten Senat den Bann und belegte Venedig mit dem Interdikt. Da diese Strafen nicht schreckten und die venetianische Geistlichkeit, mit Ausnahme einiger Mönchsorden, die das venetianische Gebiet verließen, ihren Gottesdienst nach wie vor fortsetzte, so ließ der Papst, der sich Hülfe von den spanischen Statthaltern in Italien versprach, Truppen werben. Die Republik rüstete ebenfalls, und Heinrich IV. versprach ihr Beistand, sobald der König von Spanien feindlich gegen sie auftreten würde. Nun kam es zwar dahin, daß der Papst das Interdikt aufheben ließ und in die Vertreibung der Jesuiten willigte, während der Senat die gefangenen Geistlichen frei gab. Allein der Papst konnte es der Republik nicht vergessen, daß er seine übrigen Forderungen hatte zurücknehmen müssen; denn als gegen Ende des Jahres 1607 der Patriarch von Venedig starb und der Senat seinem Recht gemäß einen Nachfolger ernannte, glaubte der Papst an jenem dadurch Rache üben zu können, daß er eine alte Verordnung zur Geltung bringen wollte, nach welcher die von einer weltlichen Macht ernannten Bischöfe sich einer Prüfung unterwerfen sollten. Er verlangte, gegen die bisherige Gewohnheit, daß diese Prüfung in Person zu Rom abgehalten werden müsse, und als man endlich nach langen Verhandlungen in seine Forderung willigte, rächte er sich noch dadurch, daß er zum Examinator des Patriarchen einen Jesuiten bestellte, wodurch er den Venetianischen Senat von neuem gegen sich erbitterte.
So fand Graf Dohna die Verhältnisse, als er in der zweiten Hälfte des Juli 1608 in Venedig ankam. Seine erste Bekanntschaft knüpfte er mit dem französischen Gesandten, einem Herrn von Champigny, an und unterhandelte mit ihm wegen der französischen Hilfsgelder. Dieser erbot sich, auch, ihn in einer Audienz dem Dogen vorstellen zu wollen; er sah dies umsomehr als seine Pflicht an, weil der Fürst von Anhalt ihn mit einem schmeichelhaften Schreiben beehrt hatte. Graf Dohna nahm das Anerbieten an, obgleich er sich durch einen anderen berühmten und damals beim Dogen vielgeltenden Mann, den er schon früher kennen gelernt, seine Audienz hatte verschaffen wollen. Auch der englische Gesandte Wotton, dem Dohna durch den Fürsten von Anhalt ebenfalls empfohlen war, wollte sich die Ehre nicht nehmen lassen, ihn beim Dogen einzuführen und zugleich Gelegenheit zu nehmen, diesen mit der Persönlichkeit des Fürsten von Anhalt bekannt zu machen. Dohna aber konnte zu ihm kein rechtes Vertrauen gewinnen und lehnte das Anerbieten durch eine feine Entschuldigung ab.
Am 23. Juli ward der Graf durch den französischen Gesandten in einer Audienz beim Dogen eingeführt. Am Mittwoch morgens, berichtet er darüber selbst, ging ich nach St. Marcus, um des Ambassadors von Frankreich Ankunft zu erwarten. Er kam, und als er nach dem Audienzsaal hinaufging, sagte er mir: ich würde sogleich gerufen werden. Bald wurde ich auch von einem Sekretär einberufen. Als ich hineintrat, fand ich den Dogen in der Mitte sitzend, den französischen Ambassador zu seiner Rechten und um ihn her dreißig Signori. Ich machte eine dreimalige Verbeugung. Darauf redete mich der Doge mit folgenden Worten in italienischer Sprache an: »Der Ambassador des christlichen Königs hier hat mir Kunde gegeben von Euerer Ankunft in dieser Stadt und daß Ihr Briefe habet vom Fürsten von Anhalt an diese Signorie. Wir wünschen, sowohl aus Liebe zum christlichsten König als auch zum Fürsten von Anhalt, daß wir in dem, was Ihr in Eueren Geschäften nötig haben möchtet, Gewährschaft leisten könnten. Wir wollen gerne die Briefe sehen, die Ihr habet.« Dohna antwortete: »Durchlauchtigster Fürst, Exzellenzen und Hochedelste Signori! Ich bin von dem erlauchtigsten Fürsten von Anhalt, meinem Herrn, in gewissen Angelegenheiten hierher gesandt, wie Euere Durchlaucht aus dem Schreiben ersehen werden, das ich überbringe. Mein Fürst hat mir aufgetragen, Euerer Durchlaucht, Eueren Exzellenzen und Euch, Hochedelsten, ihn aufs ergebenste zu empfehlen und dieselben der Gewogenheit zu versichern, die er zu Euerer Größe und Euerer Wohlfahrt hegt, indem er bittet, meinen Auftrag zu befördern, den Euere Durchlaucht aus diesem Schreiben ersehen wird.« Nachdem ein Sekretär das Schreiben eröffnet und laut vorgelesen, sprach der Doge: »Es ist uns sehr angenehm, die wohlwollende Gesinnung des erlauchten Fürsten zu vernehmen. Ihr könnt Euere Geschäfte, die Ihr habt, in Ordnung bringen. Diese Signorie hier wird Euch gern jegliche Unterstützung gewähren und wir werden auf das Schreiben bei Euerer Abreise Antwort geben.« Hierauf machte der Graf wiederum eine dreimalige Verbeugung vor den hohen Herren und entfernte sich. Am anderen Tag benachrichtigte er den englischen Gesandten von dem Ausfall seiner Audienz, der sich darüber sehr zufrieden äußerte.
Drei Tage darauf hatte Graf Dohna beim Dogen eine Privataudienz. Hier setzte er ihm die politischen Verhältnisse Deutschlands, den Zweck der Union, ihre Stellung zu Frankreich und England, auseinander und schilderte ihm vorzüglich auch die Persönlichkeiten des Kurfürsten von der Pfalz und des Fürsten Christian von Anhalt. Während er die Machtstellung des Kurfürsten, seinen Einfluß auf den Reichstagen, seinen Eifer für die Religion, seine bedeutende Militärmacht hervorhob, um den Dogen zu überzeugen, wie wichtig die Freundschaft dieses Fürsten auch für die Republik werden könne, ergoß er sich über die Eigenschaften des Fürsten von Anhalt im vollsten Lobe, sprach von seiner wichtigen Verwandtschaft mit den ersten Fürstenhäusern Deutschlands, seiner Gunst bei den Königen von Frankreich, England und Dänemark, von seinem hohen Ansehen bei allen deutschen Fürsten, von seiner Geltung bei dem Kurfürsten von der Pfalz und von dem unbedingten Vertrauen, das alle seine Glaubensgenossen, wie in Deutschland so in Frankreich und England, ihm schenkten.
Die meiste Zeit, die Graf Dohna von seinen Geschäften erübrigen konnte, widmete er dem lehrreichen Umgange mit dem Pater Paolo, »dem frommen Mönch«, wie er ihn nennt, »mit welchem ich«, wie er hinzufügt, »damals gute Gelegenheit gehabt, vieles insgeheim und unvermerkt zu reden, und in große Vertraulichkeit mit ihm geraten bin«. Es war dies kein anderer als der berühmte Servitenmönch Fra Paolo Sarpi, aus Venedig gebürtig, »einer der seltenen Heroen in der Geschichte des menschlichen Geistes«, damals ein Mann von 56 Jahren, gleich ausgezeichnet durch seine Kenntnisse in der Theologie und Philosophie, im kanonischen Recht, in den alten Sprachen und in der Mathematik, wie nicht minder bewandert in den Naturwissenschaften und der Arzneikunde. Er stand damals als mutvoller Verteidiger der Sache der Republik gegen den Papst zu Venedig in hoher Achtung. Beim Dogen und im Senat war sein Rat stets von außerordentlichem Gewicht. Für Graf Dohna hatte die Unterhaltung mit diesem anspruchslosen Mönch eine magnetische Kraft; er fühlte sich immer stärker zu ihm hingezogen; so oft er konnte, suchte er ihn in seinem dunkeln Kloster auf und unterhielt sich mit ihm stundenlang. Gegen ihn sprach er sich offen und frei über den Streit der Republik mit dem Papst aus; nach der Ansicht der protestantischen Fürsten Deutschlands sei das, was die Republik gegen den Papst verfechte, nicht blos ihre Sache allein, sondern eine gemeinsame Sache aller derer, die sich gegen solche Tyrannei aufrecht zu erhalten suchten; denn sie sähen wohl, daß der Papst solche Pläne gegen alle hege; darum freuten sie sich sehr, daß die Republik erkannt habe, daß solche schrankenlose und tyrannische Herrschsucht dem Worte Gottes widerstrebe, und sie hofften, daß diese Erkenntnis der Republik heilsam sein solle. Auch über die jüngst erfolgte Union der deutschen Fürsten und über die etwaige Teilnahme der Republik an diesem Bündnis teilte der Graf manches mit, empfahl jedoch vorerst Geheimhaltung der Sache. Wie Dohna, so sprach sich auch gegen ihn Fra Paolo immer mit Offenheit über Sachen des Staates und der Kirche aus, und dies war es vorzüglich, was den Grafen zu dem interessanten Mönch so gewaltig hinzog. Außer dieser Bekanntschaft wurde er durch den französischen Gesandten auch in das Haus des reichen Senators Francesco Morosini eingeführt, wo er eine ausgezeichnete Gemäldesammlung, Werke der ersten italienischen und deutschen Meister, fand.
Dohna hatte in Venedig einen Monat zugebracht und trat, nachdem er beim Dogen eine Abschiedsaudienz gehabt, am 26. August die Rückreise an. Er fand den Fürsten von Anhalt mit dem Kurfürsten zu Alsheim in der Unterpfalz mit den Fürsten der Union in Unterhandlungen begriffen; denn man hatte auf einem zweiten Unionstage (27. Juli 1608) zu Rotenburg a. d. Tauber den Markgrafen Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach zum General der Union, außerhalb der unirten Lande, ernannt und den Fürsten von Anhalt als General-Oberstleutnant ihm beigeordnet. Um die Verhandlungen mit dem französischen Hofe in betreff der nötigenfalls zu leistenden Beihilfe zum Schluß zu bringen und Bestimmungen darüber festzustellen, übertrug der Fürst von Anhalt dem Grafen Dohna im Anfang des Jahres 1609 eine neue Gesandtschaft nach Paris, wohin ihn abermals sein Bruder Achatius begleitete. Seine Aufgabe war mit manchen Schwierigkeiten verbunden; denn im Königlichen Rat herrschten damals in Beziehung auf die auswärtige Politik entgegengesetzte Ansichten und Bestrebungen. Villeroi, Jeannin und Sillery, katholisch-spanisch gesinnt, hielten ein enges Anschließen an Spanien und eine Verbindung mit dem Papst und dem Kaiser für das zweckmäßigste Mittel, den französischen Einfluß auf das Ausland zu sichern. Der König dagegen und mit ihm Sully hielten Spanien und Österreich für Frankreichs gefährlichste Feinde. Graf Dohna konnte unter solchen Umständen nur beim Könige für die Union etwas zu bewirken hoffen. Da dieser bei seiner Ankunft in Paris eben im Begriff war, sich nach Meaux zu begeben, so schloß sich der Graf dem königlichen Gefolge an, um ihm dort seine Aufträge vorzutragen. Bevor er aber noch um eine besondere Audienz gebeten, bemerkte ihn der König unter den ihn umgebenden Edelleuten, ließ ihn sogleich rufen, reichte ihm die Hand und ergoß sich in großes Lob über seinen Oheim, den Grafen Fabian; da bald auch der Herzog von Mayenne hinzutrat, sagte der König: »Voici le neveu du Baron de Dohna, qui a fait tête à votre père au combat de Vimory.«
Da der König ihn zur näheren Verhandlung über seine Angelegenheiten auf eine spätere Audienz verwies, so trat Dohna zuerst, gleichfalls in diplomatischen Aufträgen der Union, eine Reise nach dem Haag an, setzte aber nach kurzem Aufenthalt nach England über, stets von seinem Bruder Achatius begleitet. Der Besuch Englands hatte keinen politischen Zweck. Sie fanden indes Gelegenheit, auch den König Jakob und die Königin kennen zu lernen, machten dem Prinzen von Wales ihre Aufwartung und sprachen damals auch die Prinzessin Elisabeth, nachherige Gemahlin des Kurfürsten Friedrichs V. und später Königin von Böhmen, freilich nicht ahnend, daß sie ihr einst so nahe stehen würden.
Nach Paris zurückgekehrt, ließen sich die Grafen beim Könige anmelden, der sie in einer Audienz zu Fontainebleau aufs freundlichste empfing. »Der König«, schreibt Graf Christoph, »hat uns gar gnädig angeredet und den Bruder Achatius viel über den Zustand in England gefragt, dann auch seinem Premier valet de chambre anbefohlen, uns das Schloß und alle Kammern zu zeigen.« Da Graf Achatius bald nachher nach Sedan abreiste, so blieb Christoph allein zurück. Kaum von einer Krankheit, die Folge der anstrengenden Reisebeschwerden, genesen, wurde er auch vom Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg in diplomatischen Geschäften in Anspruch genommen.
Bekanntlich trat dieser Kurfürst mit Ansprüchen auf den Besitz der Jülich-Cleveschen Erblande auf; ein zweiter Bewerber war der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg; ihnen gegenüber aber behaupteten auch die beiden Linien des sächsischen Hauses Ansprüche an die Erbschaft. Während nun Sachsen die Gültigkeit seiner Ansprüche im ordentlichen Wege durch den Ausspruch des Kaisers erwartete, schlossen die beiden anderen Fürsten im Juni zu Dortmund einen Vertrag, worin sie sich gegenseitig versprachen, bis zum Austrage der Sache auf gütlichem oder rechtlichem Wege als nahe Verwandte freundlich zusammenzuhalten und zur Verteidigung der Lande allen anderen Ansprüchen entgegenzutreten. Was Heinrich IV. aber schon früher geahnt, war bereits erfolgt. Der Kaiser hatte einen Befehl erlassen, durch den er Prätendenten vorlud, binnen vier Monaten ihre Ansprüche an seinem Hofe auszuweisen. Während Brandenburg und Pfalz-Neuburg sich beeilten, von den Ländern Besitz zu ergreifen, wurde vom Kaiser der Erzherzog Leopold, damals Bischof von Straßburg, bevollmächtigt, sie in Sequestration zu nehmen, und die Festung Jülich wurde ihm durch Einverständnis mit dem Befehlshaber geöffnet. Die Absicht des Kaisers, sich als obersten Lehnsherrn die Länder als ihm heimgefallen zuzueignen und einem ihm gefälligen Fürsten zu verleihen, war nicht zu verkennen. Aber es war ebenso gewiß, daß Heinrich IV. auf dieses Verfahren des Kaisers nicht gleichgültig hinsehen werde. Um so mehr durften Brandenburg und Pfalz-Neuburg von ihm nötigenfalls Hilfe erwarten. Beide sandten Abgeordnete an ihn, der Pfalzgraf einen Grafen von Hohenzollern, der Kurfürst zwei Grafen von Solms, beide mit dem Auftrage, den König zur Unterstützung ihrer Ansprüche Zugewinnen. Der Kurfürst ließ überdies dem Grafen Christoph von Dohna ein Schreiben überbringen, worin er ihn ersuchte, seine Gunst beim Könige zu benutzen, um bei diesem für seine Sache zu wirken. Da nun die kurfürstlichen Gesandten wünschten, Dohna möge zuvor, ehe sie eine Audienz erhalten würden, dem Könige die Verhältnisse des Kurfürsten in betreff seiner Ansprüche ins rechte Licht setzen, so beschloß dieser, sich nach Fontainebleau zu begeben, wo sich Heinrich damals aufhielt.
Nach einem freundlichen Empfang am königlichen Hofe wurde er zur Tafel geladen. Als der König ihn erblickte, rief er ihn zu sich, und »viele große Herren«, sagt Dohna, »mußten weichen und mir Platz machen, damit ich zu des Königs Stuhl kommen konnte«; der König sagte zu ihnen: »C'est le neveu du Comte de Dohna, qui a été en nos armées«, wobei er sich mit großem Lob über den alten Grafen Fabian von Dohna aussprach.
Graf Dohna benutzte bald darauf eine Audienz, die Sache des Kurfürsten von Brandenburg dem Könige angelegentlich zu empfehlen. Er vernahm zu seiner Freude, daß Heinrich sich ungleich mehr für den Kurfürsten interessiere als für den Pfalzgrafen. Er meldete daher sofort dem Kurfürsten: Der König habe in der Audienz ihm offen mitgeteilt, daß er dem Kurfürsten stets sonderlich zugetan gewesen, noch sei und auch allezeit bleiben wolle; denn die große Freundschaft und die guten Officia der Vorfahren des Kurfürsten seien bei ihm noch in gutem Andenken. So habe der König zu verstehen gegeben, daß er den Kurfürsten ganz besonders hochachte. Dabei gibt Dohna dem Kurfürsten den Rat: Wenn er in dieser oder einer anderen Sache am französischen Hofe etwas betreiben wolle, sei es nötig, nicht allein an den König, sondern zugleich auch an den Kanzler, Duc de Sully, Monsieur de Villeroi und Monsieur de Puissieux zu schreiben; die seien die geheimsten Räte; dem Duc de Sully aber dürfe man nicht weniger als »Illustrissimus«, den übrigen nur »Illustris« geben. Es seien nun einmal große Herren, auch werde es zuträglich sein, wenn der Kurfürst an den obersten Rat und Kammerherrn von Beringen schreibe, »ihn desto affectionirter zu machen«. Die Bevorzugung des Kurfürsten gab der König auch dadurch zu erkennen, daß er dem pfälzischen Gesandten, dem Grafen von Hohenzollern, geraume Zeit keine Audienz gewährte, während er die brandenburgischen mit ganz besonderer Huld empfing. Man schrieb damals aus Paris: »Ein Abgesandter vom Herrn Kurfürsten von Brandenburg ist beim König angelangt und von Ihrer Majestät ganz stattlich mit vielen Caressen empfangen worden, hat seiner Werbung halber allen guten Bescheid und Satisfaction von derselben erlangt, darauf er sowol Ihrer Majestät als der Königin herrliche Geschenke im Namen seines Herrn Principalen verehrt. Vom Grafen von Hohenzollern weiß man nichts von Audienz und was seine Werbung gewesen. Ihre Majestät war und bleibt dem Kurfürsten als dero Aliirten und Befreundeten ganz und gar gewogen und zugethan und will sich, ihm gegen diejenigen, welche ihn in seiner Possession und Prätension in und auf die jülichschen Lande turbiren würden, alle Hülfe und Beistand zu leisten, keineswegs abschrecken lassen, gleichwie Ihre Majestät sich vor diesem gegen ihre kurfürstliche Gnaden, wie auch gegen andere Potentaten und noch neulich auch gegen den Erzherzog Leopold genugsam erklärt hat.« Erst später hatte auch der pfälzische Gesandte eine Audienz beim Könige, reiste aber schon bald darauf von Paris wieder ab; doch empfing dieser eine zweite pfälzische Gesandtschaft, die kurz nachher ankam, mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit.
Die angenehmsten Stunden, die Graf Dohna von seinen diplomatischen Geschäften erübrigen konnte, verlebte er im Umgang mit den berühmtesten Staatsmännern. Auch jetzt war es vor allem der berühmte Geschichtschreiber, der Präsident de Thou, den er immer am liebsten aufsuchte. Wir lesen in seinem Tagebuch: »Unter anderen gelehrten vornehmen Leuten habe ich am öftersten den Präsidenten de Thou gesprochen, welcher eine schöne lateinische Historie geschrieben. Er war nicht abergläubisch, papistisch, haßte die Jesuiten, verstieß die Religionsverwandten nicht, hat seine Freiheit im Schreiben sich nicht nehmen lassen, derwegen man seine Bücher in Rom verbrannte.« Es wirft ein schönes Licht auf Dohnas Geist und Gesinnung, daß er sich zu diesem aller Frömmelei abholden Manne ganz besonders hingezogen fühlte. Auch im Hause des Herzogs von Bouillon brachte er manche für ihn sehr lehrreiche Stunde zu; denn dieser hohe Gönner schenkte ihm fortwährend großes Vertrauen und teilte ihm oft und gern vieles über geheime Verhältnisse des Hofes mit. »Er hat zwar«, sagt Dohna von ihm, »nichts studiert, ist aber mit einem großen Verstand begabt und hat in Kriegs- und Regimentssachen eine gewaltige Erfahrung, nebst einer Scharfsinnigkeit, die allzu hoch und ihm fast selbst schädlich ist, also daß man von ihm sagt: ›C'est un couteau qui coupe sa gaîne‹.« Unter den fremden diplomatischen Personen, die er näher kennen lernte, war ihm der Gesandte des Herzogs von Mantua, Traiano Guiscardi, der interessanteste, ein ebenso gelehrter und durchgebildeter Staatsmann als auch in seinem Charakter höchst achtungswert. Dohna besuchte ihn oft, besprach sich mit ihm über Dinge des Staates und die Ereignisse der Zeit. Häufig war auch die protestantische Glaubenslehre, die Guiscardi, obgleich Katholik, sehr richtig beurteilte, Gegenstand ihrer Unterhaltung. Wie mit dem geistreichen Mönch Paolo Sarpi in Venedig blieb Dohna auch mit Guiscardi, als dieser Großkanzler zu Casale geworden, fortwährend im Briefwechsel.
Dohna hatte während seiner Anwesenheit in Paris oftmals Gelegenheit, am Hofe den außerordentlichen Glanz und die verschwenderische Pracht zu bewundern, womit sich der König umgab, besonders, wenn er vor dem Volk erschien. Er beschreibt einen glänzenden Einzug, den der König nach einer Abwesenheit von einigen Monaten in Paris hielt: Der König saß auf einem weißen Roß, der Sattel von schwarzem Samt mit reicher Stickerei von Silber, bekleidet mit einem weißen Wams, die Beinkleider von schwarzem Samt mit silberner Stickerei niedlich verziert, auf dem Hut eine glänzend weiße Feder. Ihm zur Linken der Herzog von Sully zu Fuß, den Hut in der Hand, während der König lange mit ihm sprach. Nach ihnen zwanzig Prinzen und Herzöge und eine große Schar von Grafen und Edelleuten, alle stattlich ausgerüstet und prachtvoll geschmückt, ihre Kleidung glänzend von Gold und Silber, das Geschirr ihrer Rosse, ihre Federbüsche so reich als möglich. Die Zahl der Edelleute konnte wohl 5 bis 600 sein, sämtlich aufs prächtigste gerüstet; dann eine unzählige Volksmasse, die den König mit Jubel empfing, aber alles dies so »pêle-mêle« unter- und durcheinander, daß es zwei Stunden währte, bis der König vom Tore St. Antoine bis nach dem Louvre kam.

F. Frick, Marienburg. Fassade des Kapitelsaales. Zeichnung und Ätzung von F. Frick
Während Dohnas Abwesenheit hatte sich in Deutschland der Stand der Dinge bedeutend verändert. Der Union waren nun auch der Kurfürst von Brandenburg, der Landgraf Moritz von Hessen, die Fürsten von Anhalt, der Graf von Öttingen, die drei »ausschreibenden Städte« Straßburg, Nürnberg und Ulm, nebst mehreren kleineren Reichsstädten, Speier, Worms, Hall in Schwaben, Heilbronn und andere beigetreten. Ihr gegenüber aber standen bereits seit dem 10. Juli 1609 der Herzog Maximilian von Bayern, der Erzherzog Leopold von Österreich, die Bischöfe von Würzburg, Augsburg, Regensburg, Salzburg und Konstanz nebst mehreren schwäbischen Reichsprälaten unter dem Namen der Liga in einem Gegenbündnis, an das sich bald auch die drei geistlichen Kurfürsten und mehrere katholische Stände anschlossen. Der Zweck dieses Bundes war die Aufrechterhaltung des Friedens und der Reichsordnung gegen die Unternehmungen der Union und Schutz der katholischen Kirche und der ihr zugewandten Stände. An seiner Spitze stand als Haupt und Urheber der Herzog von Bayern, der seine Stiftung mit großem Eifer betrieben hatte. Jetzt aber entwickelte auch der Fürst Christian von Anhalt für die Sache der Union eine ungemeine Tätigkeit. Er war es, der (18. Juli 1609) an der Spitze einer Gesandtschaft der Unirten an den Kaiser Rudolf zu Prag den Vortrag über die Beschwerden des Bundes hielt und in einer Privataudienz, die ihm der Kaiser gestattete, mit solcher Schärfe und so eindringlichem Ernste sprach, daß diesen für den Augenblick die Furcht übermannte. Jetzt schien es an der Zeit zu sein, den König Heinrich von Frankreich zu tätiger Hilfe für die Union aufzurufen, und Fürst Christian war es wieder, der im Dezember 1609 nach Paris eilte. Er fand den Grafen Dohna dort noch anwesend, wurde vom König aufs freundlichste empfangen, erhielt auch Zusage einer kräftigen Unterstützung und kehrte darauf in Eile nach Deutschland zurück, mit ihm Graf Dohna, der am 1. Januar 1610 in Heidelberg anlangte.
Im Januar 1610 traten die Bundesverwandten der Union zu einem Beratungstag in der Bundesstadt Hall in Schwaben zusammen. Er war zahlreich von Fürsten und Gesandten besucht; außer den älteren Bundesgliedern war auch der Kurfürst von Brandenburg erschienen. Den Fürsten von Anhalt hatte Graf Dohna dahin begleitet. Die Beratung galt zunächst der Jülichschen Erbschaftsache der possidirenden Fürsten, denn so hießen jetzt Kur-Brandenburg und Pfalz-Neuburg. Da man Kunde erhielt, daß ein französischer Gesandter, Johann von Thumery, Herr von Boissise, im Anzuge sei, der die Gesandtschaft des Fürsten von Anhalt erwidern solle, so bekam Graf Dohna den Auftrag, mit einigen anderen Räten ihm entgegenzuziehen, ihn ehrenvoll zu empfangen und in seine Wohnung zu begleiten. Nachdem man zuvörderst über die vom Kaiser dem Fürsten von Anhalt gegebenen, aber unerfüllt gebliebenen Zusagen Bericht erstattet, wurde beschlossen, man wolle sich im Jülichschen Erbschaftstreit der evangelischen Interessenten gegen jede ungerechte Gewalt annehmen, die Union über den ganzen Norden Deutschlands verbreiten und mit den Evangelischen in Österreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, selbst mit denen in England, Dänemark, Holland, Venedig und der Schweiz in nähere Verbindung treten. Um die Freiheit Deutschlands gegen die Kaisermacht zu sichern, versprach der König von Frankreich seinen Beistand in betreff der Jülichschen Sache jenen Fürsten, denen die Erbfolge in den Jülichschen Landen zustehe. Man kam am 11. Februar 1610 mit dem Gesandten überein, daß diesen Fürsten sowohl die Union als der König mit 4000 Mann zu Fuß und 1200 Reitern zu Hilfe kommen sollten.
Graf Dohna erhielt sofort von den versammelten Unionsfürsten den Auftrag, als Unionsgesandter nach Paris zu gehen, dem König für sein bereitwilliges Erbieten »zur Erhaltung der deutschen Libertät als fürnehmlich zur Manutenirung der interessirten Fürsten in ihrer Possession« zu danken, ihn gleicher Willfährigkeit von Seiten der Union zu versichern, teils ihm auch über die gefaßten Beschlüsse Bericht zu erstatten und ihn um deren Genehmigung und Bestätigung zu bitten. Auch sollte er ihm vorstellen, daß Hilfsleistung große Eile erfordere, weil die Gegenpartei bereits stark rüste, weshalb der König zu bitten sei, seine zwei in den Niederlanden stehenden Regimenter unter dem Herrn von Chatillon nach den Jülichschen Landen ziehen zu lassen. Endlich sollte er den König um seine Genehmigung ersuchen, daß »zur Verhütung vieler Inconvenienzen, die unter unterschiedlichen Generalen im Felde leicht eintreten«, der oberste Feldherrnbefehl und das Direktorium über das gesamte, also auch über das königliche Kriegsvolk, dem Fürsten von Anhalt übertragen werden könne.
Nach einer höchst beschwerlichen Reise bei strenger Kälte, sehr erschöpft und fast erkrankt, kam Graf Dohna in der Mitte des Februars in Paris an. Von Herrn von Villeroi beim König angemeldet, erhielt er sogleich Audienz. »Ich ging«, so berichtet er selbst, »stracks zum Könige; er war in der Königin Cabinet und stand bei ihr am Fenster; als ich hereintrat, hatte ich die Ehre, daß er mich mit Affection umarmte; dann sprach er zur Königin: ›Madame, le voilà, le prendriez vous bien pour un Allemand?‹ Darauf hörte er mein Anbringen ganz gnädig an und als ich bat, mich in vier oder fünf Tagen abzufertigen, antwortete er: ›Ich will Euch in drei Tagen Bescheid geben; die übrigen könnt Ihr in Eurer Lust zubringen.‹ Das Gespräch gab dann, daß man von dem Zustand der jülichschen Lande zu reden kam. Da fragte Ihre Majestät: ›Was da vorfiele?‹ Ich erzählte von der Belagerung des Schlosses Bredenbend. Als der König durch das Fenster sah, daß es schneite und böses Wetter war, antwortete er: ›Das ist wohl ein schön Wetter zur Belagerung.‹ Sodann fragte er nach dem Markgrafen von Anspach und fügte hinzu: ›Der Gesandte hätte der Fürsten gute Affection gegen Ihre königliche Majestät sehr gerühmt.‹ Hierauf befahl er mir, ins Logement zu gehen.«
Dohna benutzte die wenigen Tage zu Besuchen bei den königlichen Räten, um ihre Ansichten auszuforschen. Alle aber verhielten sich sehr schweigsam oder gaben nur allgemeine Antworten; so der Kanzler, Jeannin und Villeroi. Selbst Sully hielt mit seiner Meinung zurück. »Der König werde Wort halten und er werde helfen, daß alles gut gehe«, war fast alles, was er sagte.
Nun war während des letzten Aufenthalts Dohnas in Paris folgendes Ereignis vorgefallen: Der Prinz Heinrich II. von Condé hatte sich mit dem ausgezeichnet schönen Fräulein von Montmorency, einer Tochter des Connetable Heinrich von Montmorency, vermählt. Er war ein Neffe des Königs; denn Heinrichs IV. Vater und des Prinzen Großvater, Ludwig von Bourbon, Prinz von Condé, waren Brüder. Der Prinz fand indes in der heftigen Neigung des Königs zu seiner jungen Gemahlin und in dem beleidigenden Benehmen des Königs gegen ihn hinreichend Ursache, sich mit seiner Gemahlin auf seine Güter in der Picardie zu begeben. Der König folgte dieser nach und suchte sich ihr verkleidet zu nähern. Der Prinz aber, davon unterrichtet, entfloh heimlich, worüber Heinrich sich so entrüstete, daß er den Flüchtlingen einen Reiterhaufen nachsandte, um sie aufgreifen zu lassen. Allein es war zu spät; sie waren bereits, nicht ohne viel Beschwerden, bei strenger Kälte in den Niederlanden angekommen, wo sie in Brüssel ehrenvolle Aufnahme und spanischen Schutz fanden.
Der König hatte sich in seinem Zorn auch jetzt noch nicht beruhigt; denn, als Graf Dohna nach drei Tagen zur Audienz beschieden wurde, brachte jener sogleich das Gespräch auf das erwähnte Ereignis. »Ich hatte«, erzählte Dohna in seinem Tagebuch, »eine gnädige Audienz beim König, indem er mich ganz allein ins Cabinet kommen ließ, wo er eine gute Zeit mit mir auf und abging und sonderlich des Prinzen Condé erwähnte, daß er mit seiner Gemahlin entwichen sei. Er entrüstete sich sehr heftig über ihn, nannte ihn einen Undankbaren und befahl mir, ich sollte in Deutschland ihm nacheilen und etwa 20 Reiter zu mir nehmen, ihn zu ergreifen. Dann gedachte er auch unserer Handlung zu Hall, ließ sich dieselbe aber nicht gefallen, deshalb, weil zuviel Conditionen und zu viel ›si‹ darin wären. Er sagte: ›Il y a trop de si. Il n'y a que les fols, qui s'y fient. Toutefois j'ai tout ratifié, pour aìgréer à ses Maîtres.‹ Darauf ließ mir der König durch Mr. de Villeroi sagen: Ihre Majestät wolle mir eine Verehrung oder Recompenz tun für meine Reise; allein ich wollte solche nicht annehmen und bedankte mich.« Am 24. Februar hatte der Graf eine Abschiedsaudienz; der König brachte das Gespräch wieder auf den Prinzen von Condé und schloß mit den Worten: »Dans deux ou trois mois je ferai que mes ennemis se repentiront du tort qu'ils me font d'avoir debauché le Prince de Condé.«
Dohna kehrte nach Heidelberg zurück. In Wimpfen, wo er mit dem Fürsten von Anhalt zusammentraf, machte er ihm ausführliche Mitteilung über seine Unterhaltung mit dem Könige. Da der Fürst ersah, daß Heinrich mehr Interesse für den Jülichschen Erbstreit als für die Sache der Union gezeigt und seine Äußerungen über die Unionsverhandlungen zu Hall seine Unzufriedenheit an den Tag gelegt hatten, so entschloß er sich schnell zu einer Reise nach Paris, um den König über die Bedeutung der Union aufzuklären und für sie zu gewinnen. Er durfte dies um so mehr hoffen, da der König zu Dohna in der Audienz geäußert hatte: »Pour Mr. le Prince d'Anhalt I. il est tout à nous. Je ne lui fierois pas tant seulement mon secours, mais tontes les troupes que je ferois.« In Paris angelangt, wurde er ausgezeichnet empfangen. Der König ließ ihm nicht nur prachtvolle Gemächer im Louvre einräumen, sondern erwies ihm auch alle mögliche Aufmerksamkeit und vielfache Ehrenbezeugungen. So zeigte er selbst im Louvre ihm das Gemach, wo er in der Bartholomäusnacht unter fünf in Blut schwimmenden Leichen sich verborgen gehalten. Der Fürst war wahrscheinlich auch noch an dem Tage (14. Mai) in Paris, an dem Heinrich auf offener Straße dem Mordmesser Revaillacs erlag. Am anderen Tage scheint er die Stadt verlassen zu haben.
Höchstwahrscheinlich brachte er die erste Nachricht von dem Königsmord nach Deutschland. Gewiß ist, daß der französische Gesandte, Herr von Boissise, sie durch den Grafen Dohna zuerst erfuhr. Sie machte auf die Unirten, welche immer noch große Hoffnung auf Heinrichs Hilfe gebaut, erschütternden Eindruck. Dohna erhielt alsbald den Auftrag, nach Paris zu gehen, um der Königin-Regentin Maria von Medici wegen des Todes ihres Gemahls zu kondolieren und zugleich in betreff der von Frankreich zu leistenden Hilfe neue Unterhandlungen anzuknüpfen. Laut seiner Instruktion mußte er sich zuerst nach dem Haag begeben, um dort dem Prinzen Moritz von Oranien Mitteilungen über die Stärke der Liga, über ihre Rüstungen, über die seit dem Tode des Königs Heinrich drohenden Gefahren, über die unzureichenden Kriegskräfte der Union zu machen und ihn zu bitten, in möglichster Eile das bewilligte Hilfsvolk nach Xanten oder Berg ins Feld zu schicken. Dohna vollführte diesen Auftrag und eilte dann über Vlissingen und Boulogne nach Paris. Hier erhielt er schon am 6. Juni eine Audienz bei der Königin. Inbetreff seiner Kondolenz bemerkte er: »Die Wahrheit zu sagen, so habe ich äußerlich keine große Betrübniß an ihr sehen können, obwol ihr Herr der König kaum drei Wochen todt gewesen. Man gab vor, sie habe befürchtet, man würde sie verstoßen und die von Condé oder eine andere nehmen.«
Dohna hatte in seiner Instruktion den Auftrag, die Königin und den jungen König an die unter dem verstorbenen König aufgerichteten und bestätigten Verträge, zu erinnern und sie namentlich zu ersuchen, die in Holland liegenden französischen Regimenter mit dem Kriegsvolk der Generalstaaten nach Düsseldorf ziehen zu lassen. Er fand es jedoch geraten, sich in dieser Angelegenheit auch an den Connetable von Montmorency, die Herzöge von Epernon, von Guise und Mayenne zu wenden, deren Einfluß von Gewicht war. Die Königin sicherte dem Grafen die Hilfsleistung ohne weiteres zu, fügte jedoch hinzu, man könne sich über die Wahl des Anführers der Hilfstruppen noch nicht vereinigen. Ihre Aufforderung, er möge selbst einen Herrn, der den deutschen Fürsten genehm sein werde, auswählen, lehnte er mit kluger Vorsicht ab und stellte die Wahl der Königin anheim, indem er versicherte, die Fürsten würden mit jeder von der Königin getroffenen Wahl zufrieden sein. Sie wählte hierauf den alten Marschall de la Chatre, der auch sofort die Hilfstruppen zum Auszuge rüstete.
Von allen Seiten her, durch die Herzöge von Sully, von Bouillon, von Guise, Nevers, Villeroi, auch von de Thou, den er oft besuchte, mit den festesten Zusicherungen der kräftigsten Unterstützung der Union erfreut, kehrte Dohna nach Deutschland zurück. Die possidirenden Fürsten waren mit dem Erfolg seiner Sendung außerordentlich zufrieden. Sie hatten einen solchen unter den obwaltenden Umständen kaum noch erwartet. Der freigebige Pfalzgraf von Neuburg, der kein Verdienst unbelohnt ließ, beehrte den Grafen zum Zeichen seines Wohlwollens mit der Auszeichnung einer Medaille auf den Hut. Die Hoffnungen der Fürsten wurden noch mehr gefestigt, als es in einem Schreiben aus Paris vom 15. Juni hieß: »Die königliche Hülfe soll binnen vier oder fünf Tagen aufbrechen und ist in Allem 15,500 Mann stark, darunter 2000 zu Roß. Monsieur le Maréchal de la Chatre ist Commandator. Es sollen auch sonst sehr viele Vornehme von Adel und Herren auf ihre eigenen Kosten mit fortziehen, und wird das schönste und beste Volk aus der ganzen Armada ausgelesen. Der papistische Nuntius hätte solches gern verhindert, sodaß die Hülfe gar keinen Fortgang hätte nehmen sollen. Er hat aber nichts bewirken können und ist darüber sehr übel zufrieden.«
Graf Dohna ward bald darauf, während man zum Kriege rüstete, nach Köln gesandt, um bei der Stadt eine Geldanleihe aufzunehmen. Er erfreute sich zwar auf dem Rathause dort einer sehr ehrenvollen Aufnahme; man entließ ihn dann aber mit einer höflichen Entschuldigung, daß es nicht möglich sei, sein Gesuch zu erfüllen. Ehe aber noch die französische Hilfe herankam, brach zwischen den beiden possidirenden Fürsten ein Zwiespalt aus, der von den verderblichsten Folgen hätte sein können. Es kam zwischen ihnen so weit, daß sie sich zum Duell forderten. Der Fürst von Anhalt trat als Vermittler dazwischen, indem er noch um Mitternacht den Grafen Dohna zum Pfalzgrafen schickte, um ihn durch Vorstellungen zu beruhigen. Am folgenden Morgen begab sich auch der Fürst selbst mit dem französischen Gesandten zu ihm. Dieser drohte mit dem nachdrücklichsten Ernst: Wenn sich beide nicht sofort versöhnten, werde er bewirken, daß die bereits heranziehende Kriegshilfe sich wieder zurückziehe und selbst seine Rückreise antreten. Er war so kühn hinzuzufügen: »J'ai vu plusieurs princes; mais j'en ai vu de plus sages que vous.« Die ernste Drohung hatte den Erfolg, daß beide Fürsten sich wieder versöhnten.
Mittlerweile hatten sich die Kriegskräfte der Union ansehnlich verstärkt. Nicht bloß der kühne Parteigänger Graf Ernst von Mansfeld hatte sich ihr angeschlossen, sondern auch der Prinz Moritz von Oranien war zur Beihilfe gewonnen. Der Krieg hatte im Frühling begonnen. Es galt, das Jülichsche Gebiet von feindlichen Truppen zu säubern und namentlich die befestigte Stadt Jülich zu gewinnen, die der Feind besetzt hielt. Nachdem sich der Prinz Moritz am 28. Juli mit dem Fürsten von Anhalt vereinigt, warfen sich beide, in Verbindung mit den brandenburgischen und neuburgischen Truppen vor die Stadt. Im Lager befanden sich auch die beiden Grafen Dohna. Bevor man indes einen ernsten Angriff wagte, erwartete man die bereits gemeldete Ankunft des französischen Hilfsvolkes. »Als nun«, so erzählt Graf Christoph als Augenzeuge, »der Marschall de la Chatre mit 8000 zu Fuß und 2000 zu Pferd angezogen kam, hatten wir vier kleine Feldgeschütze auf einer Höhe aufgestellt, sie damit zu empfangen. Als diese aber losgebrannt wurden, wußten die Franzosen als neue Kriegsleute nicht, was das zu bedeuten habe, und fielen auf die Knie, damit die Kugeln über sie weggehen sollten, weil sie meinten, es wäre des Feindes Geschütz. Sie wurden darüber sehr ausgelacht; doch wollten wir sie nicht beschämen, sondern wir halfen es vertuschen, so gut wir konnten. Ein Franzose, der neben mir hielt, schalt schändlich auf seine eigene Nation. Wäre es uns Deutschen widerfahren, so würde man uns gräulich verachtet und übel nachgeredet haben.«
In drei Heerlagern standen vor Jülich Deutsche unter dem Befehl Christians von Anhalt, Engländer unter dem Obersten Cecil, Holländer unter der Führung des Prinzen von Oranien und Franzosen unter dem Marschall de la Chatre. Ungeachtet dieser starken Streitmacht aber dauerte die Belagerung länger als man erwartet hatte; denn die Besatzung, hinreichend mit Munition und Proviant versehen, verteidigte sich mit rühmlichster Tapferkeit und brachte den Belagerern vielen Verlust. Auch die Brüder Dohna waren, wie wir aus einer genauen Beschreibung der Belagerung ersehen, mehrmals in Lebensgefahr. Als am 10. August Fürst Christian, begleitet vom Grafen Abraham, ins Zelt des Prinzen von Oranien reiten wollte, schlug zwischen beiden eine aus der Stadt geschossene Stückkugel mit solcher Gewalt in die Erde, daß beide mit Staub bedeckt wurden. Am nämlichen Tage nachmittags ritt Graf Abraham unmittelbar hinter dem Fürsten, als eine Kugel dem Oberst-Wachtmeister Sednitzky das Bein zerschmetterte und dem Fürsten das Pferd unter dem Leibe tötete. Erst nachdem in der Stadt Mangel an Munition eintrat, ergab sie sich am 10. September 1610 und der Krieg ruhte in diesen Landen.
Kurze Zeit darauf (19. September) starb zu Heidelberg der Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz eines frühzeitigen Todes, für die Union ein großer Verlust. Ihm folgte in der Regierung sein erst vierzehnjähriger Sohn Friedrich V., der sich damals im Hause des Herzogs von Bouillon zu Sedan befand, wo er erzogen wurde. Zwischen den Kriegsparteien trat Waffenstillstand ein, Graf Dohna wurde inzwischen mehrmals mit Gesandtschaften der Union beauftragt; im Anfange 1611 begleitete der Graf den Fürsten von Anhalt nach Berlin, wo sich in einer wichtigen Unionssache viele Fürsten versammelt hatten. Kaum dort angelangt, ließ ihn der Kurfürst Johann Sigismund zu sich einladen und machte ihm den Vorschlag, eine Gesandtschaft in seinen Angelegenheiten an den Kaiser Rudolf II. nach Prag zu übernehmen. Der Graf erklärte sich bereit, bat jedoch, der Kurfürst möge zuvor wegen seines Dienstverhältnisses den Fürsten von Anhalt befragen. Dies geschah auch; allein der Fürst lehnte den Auftrag geschickt ab, aus welchem Grunde, konnte Dohna nicht erfahren.
Graf Dohna trat hierauf eine Reise nach Preußen zum Besuch seiner Verwandten und Freunde an. Allein wenn er, wie er sagt, sich auch freute, in der Nähe von Königsberg wieder einmal die Nachtigall schlagen zu hören, so ekelten ihn desto mehr die Verhetzungen und widerwärtigen Zänkereien an, die damals unter dem Adel in Preußen im Schwunge waren, weil eine Anzahl adeliger Hauptleute und Landräte nicht dulden wollten, daß den Baronen und denen vom Herrenstande in manchen Dingen ein gewisser Vorrang eingeräumt werde.
Im August (1611) kehrte Dohna nach Heidelberg zurück. Ohne dort lange zu verweilen, begleitete er den Fürsten von Anhalt nach Nürnberg, wohin Kaiser Rudolf im Oktober einen Kurfürstentag ausgeschrieben hatte. Es war für ihn nicht bloß von großem Interesse, die bedeutende Zahl von Fürsten, Bischöfen, Staatsmännern und Gesandten aus allen Teilen Deutschlands kennen zu lernen und mit vielen auch eine nähere Bekanntschaft anzuknüpfen, sondern, ein genauer Beobachter des Hoflebens, tat er auch manchen Blick in die damaligen Fürstensitten. Er zeichnet sich jeden Tag auf, was er davon gesehen und gehört. Er bemerkt es, wie der Kurfürst von Sachsen die Fürsten verschieden behandelt: bei einer Einladung zu seiner Mittagstafel sei dieser bei der Ankunft des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm nicht aus seinem Zimmer gegangen und habe ihn nur von zwei Edelleuten empfangen lassen; hingegen dem Administrator Pfalzgrafen Philipp Ludwig sei er aus der Türe heraus bis auf die Gasse entgegengeeilt. Er zeichnet es auf, daß die Stadt Nürnberg wie andere Fürsten so auch den von Anhalt mit vier Zober Fischen, zwei Wagen mit Hafer und einem Wagen mit süßem und rheinischem Wein beschenkt habe. Aber er vergißt auch nicht zu bemerken, wie die Fürsten den edeln Saft genossen haben: »bei einem Frühmahle im Hause des Pfalzgrafen sind sie alle toll und voll gewesen; sie haben nit getrunken sondern nur gesoffen«. An einem anderen Tag, bei einem Mittagsmahl beim Kurfürsten von Mainz, wobei auch gewaltig getrunken wurde, beschwerte sich der Erzbischof von Köln über seine Schwachheit und sein Alter, die es nicht mehr ertragen wollten. Da entgegnete ihm aber der von Mainz mit Stichelworten: »O, dieses Trinken geht noch wohl hin, kann Euern Liebden nicht schaden; aber die Schlaftrünke, die Schlaftrünke, die man bisweilen thut, die machen schwach und matt.« Dazu hat der Kölner gelacht. Allein es blieb nicht immer bei solchen Scherzen. Waren die hohen Herren voll Wein, so kam es auch oft zu ärgerlichen Streithändeln. So kam es bei einem Mittagsmahle zum Streit über die kurpfälzische Administration, indem sich der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm darüber beschwerte, daß Sachsen dem Philipp Ludwig beigestanden habe. Da antwortete der Kurfürst: es wäre ohne ihn so weit gekommen; nun sei es nicht zu ändern. Darauf jener: aber es müsse anders werden. Der Kurfürst wieder: es müßte ein schlechter Doktor sein, der die Sache nicht verzögern könnte, bis der junge Kurfürst seine Jahre erreicht habe; interea ist Philipp als Administrator in der Possession. Und ich, sagt der Pfalzgraf, bin in der Possession von Jülich! Dem entgegnet der Kurfürst: Was? So einen Pfalzgrafen kann ein Kurfürst von Sachsen doch wohl auch noch herausbringen. Der Streit würde noch heftiger geworden sein, wenn ihn nicht der Mainzer gestillt hätte.
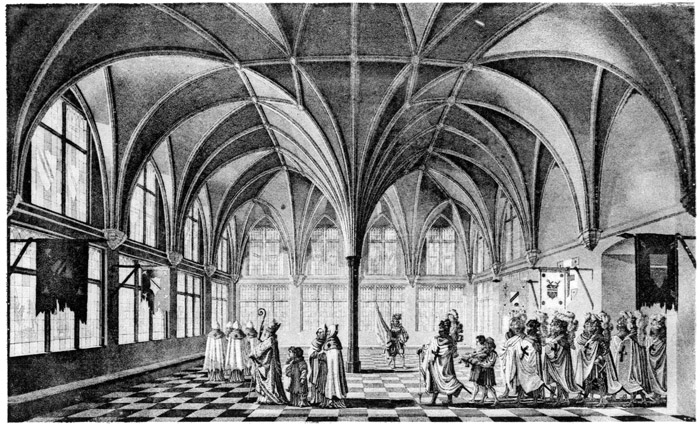
F. Frick. Marienburg. Kapitelsaal im vormaligen Zustand. Zeichnung und Ätzung von F. Frick. Die Figuren von Catel
In Nürnberg übernahm Graf Dohna in Aufträgen des Fürsten von Anhalt eine abermalige Gesandtschaft nach Paris. Sie betrafen die Forderungen an die französische Krone wegen der noch nicht entrichteten Kriegsgelder. Er fand, dort angelangt, in den staatlichen Verhältnissen fast alles verändert. Der Kriegsplan des verstorbenen Königs zur Demütigung des habsburgischen Hauses war längst aufgegeben. Man hatte die letzte Beihilfe den Erben der Jülich-Kleveschen Länder nur deshalb geleistet, weil sich Heinrich IV. einmal dazu verpflichtet, weil es die Ehre Frankreichs erfordert und die Nichterfüllung Schwäche verraten hätte. Sully stand auch nicht mehr an der Spitze der Verwaltung. Von seinen Feinden am Hofe gedrängt, hatte er schon seit Anfang des Jahres 1611 seinem Amte eines Oberintendanten des Finanzwesens entsagt. Die Leitung der Finanzverwaltung war jetzt in den Händen des Präsidenten Jeannin, dem als Direktoren der Präsident de Thou und der Marquis de Chateauneuf zur Seite standen. Mit ihnen hatte auch Graf Dohna die Verhandlungen zu führen und es glückte ihm, schon im Anfang des Jahres 1612, darin so weit vorzuschreiten, daß in betreff der Abzahlungen ein Abkommen auf sechs Jahre zustande kam.
Es herrschte während Dohnas Anwesenheit in Paris eine aufgeregte Stimmung. Das Tagesgespräch war lange Zeit der heftige Streit der Sorbonne mit den Jesuiten, an dem auch der Graf das lebendigste Interesse nahm. »Schon im Jahre 1611«, heißt es in einem seiner Berichte aus Paris, »haben die Jesuiten beim Parlament angehalten, daß sie bei der Universität zu Paris möchten einverleibt werden. Da hat man ihnen aufgegeben, sie sollten schriftlich bezeugen, daß sie mit der Universität und Sorbonne einerlei Lehre in folgenden Punkten führten: daß die Concilien mehr seien als der Papst und über dem Papst; daß der Papst in weltlichen Sachen keine Gewalt habe; daß ihm nicht zugelassen sei, die Könige von Frankreich zu excommuniciren, auch nicht die Unterthanen ihres Eides zu entbinden. Bei diesen Verhandlungen haben sich damals auch der Prinz von Condé und zwei Bischöfe beteiligt. Anjetzt, im Anfang Januar 1612, haben die Doctores der Sorbonnisten und die Jesuiten dreimal in voller Versammlung öffentlich wider einander disputiert und der Rector der Sorbonnisten alle drei Mal seine Streitsache selbst angezeigt, aber die Jesuiten nur durch ihren Advocaten, der in den ersten Audienzen allein erschien; jedoch bei der letzten Audienz haben die Jesuiten Schande halber in eigener Person erscheinen müssen; gleichwol aber ist der Pater Cotton, der Königin Beichtvater, nicht erschienen. Ein Doctor der Sorbonnisten hat eine kurze, aber herrliche Oration gehalten und der Jesuiten Lehre, List und Falschheit mit Grund und Beweis ihrer eigenen Bücher herausgestrichen und sie öffentlich ›perturbatores reipublicae et justitiae‹ genannt, sodann auch sonderlich sie angeklagt, daß sie ihre beiden letzten Könige Heinrich de Valois und Heinrich de Bourbon ums Leben gebracht, und endlich ihre Lehre verdammt. Als der Doctor seine Oration beschlossen, verhofft jedermann, die Jesuiten als gelehrte Leute würden stattlich widersprechen, aber sie waren ganz erschlutzt und erstummt, gingen davon, ohne Antwort zu geben, weshalb die Zuhörer so verhaßt auf sie geworden, daß wenig gefehlt, man hätte sie gar aus dem Palast verjagt. Endlich hat das Parlament einhellig ein Urtheil ergehen lassen, welches der oberste Präsident Mr. de Vertun, obwol ein Discipel der Jesuiten, wider seinen Willen hat aussprechen müssen und lautet also: 1) Daß der Papst den Concilien unterworfen sein soll; 2) daß er über Kaiser, Könige, Fürsten und Herren nicht zu commandiren haben soll; 3) daß die Jesuiten keine Universitäten oder öffentliche Schulen haben sollen; 4) daß sie sich der Justitia unterwerfen müssen; 5) was sie für Geheimnisse wider die Krone Frankreich durch Berichte oder andere Mittel erfahren, sollen sie offenbaren. Diese Punkte sollen die Jesuiten in drei Monaten von ihrem General aus Frankreich unterschrieben bringen.« Bald nachher, im Februar, meldet ein anderer Bericht aus Paris, das Parlament habe den Jesuiten geboten, alle Schüler aus Clairmont auszuschaffen, damit nicht unter dem Schein der Theologie sich fremdes Volk einmische, welches dem König nach dem Leben stelle, wie mit dem König Heinrich geschehen sei. Endlich schreibt Graf Dohna seinem Bruder Dietrich im März: »Die Königin ist perturbirt, daß die Sorbonnisten und das Parlament so heftig wider die Jesuiten sind. Auch der Papst ist sehr erzürnt. Wenn ers könnte gen Rom bringen, so würden alle auf dem Scheiterhaufen braten müssen. Nun möchte die Königin gern dem Papst und den Jesuiten zu Willen sein, darf aber wider die Sorbonne und das Parlament nichts vornehmen. Die Bischöfe halten neben dem Cardinal du Peron oft Rath, wie sie der Sorbonne begegnen oder sie mit den Jesuiten wieder vereinigen möchten. Aber bei Hofe ist sonst kein Fürst, der sich unterstünde, zu Gunst der Jesuiten zu reden als der duc de Epernon, der ist ihrer Aller Patron und hat auch der Königin remonstriert, daß man nicht gestatten solle, die Büchlein wider des Papstes Macht und die wider die Jesuiten in der Stadt feil zu tragen und auszurufen.«
Nach Heidelberg kaum zurückgekehrt, erhielt der Graf vom Fürsten von Anhalt wichtige diplomatische Aufträge an verschiedene vornehme Personen in Böhmen und Mähren. In Brünn, wo er beim Erzherzog Maximilian, damaligen Hochmeister des Deutschen Ordens, eine sehr freundliche Aufnahme fand, hatte er an diesen im Namen seines Fürsten eine vertrauliche Mitteilung abzustatten. In Prag war seine interessanteste Bekanntschaft der Graf Heinrich Matthias von Thurn. Als Haupturheber des Majestätsbriefes stand er in ganz Böhmen im höchsten Ansehen und das ganze Volk huldigte ihm mit vollem Vertrauen. Auch an ihn hatte Dohna Aufträge vom Fürsten von Anhalt. Von Prag ging er auf kurze Zeit zum Besuch der Seinigen nach Preußen. Auf der Rückkehr nahm er den Weg über Danzig, wo er gerade ankam, als der Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg und der Fürst Radziwill, die sich einige Tage dort aufhielten, sich bei einem glänzenden Bankett bei einer reichen Frau Schwarzwald befanden. Sobald der Kurfürst des Grafen Ankunft erfahren, ließ er ihn zur Tafel laden. Man machte sich dabei im Gespräch sehr lustig über eine lächerliche Verordnung des jüngst verstorbenen Kurfürsten Christian II. von Sachsen, daß alle Junker fortan lange Stiefel tragen sollten, wobei der Kurfürst erzählte: Ein kleiner Edelmann habe auf den Befehl geantwortet: »Ich werde und kanns nicht tun, denn da ich ein kurzer Kerl bin und keine langen Beine habe, kann ich auch keine langen Stiefel tragen.«
In Amberg zu Ende des Jahres 1612 angekommen, erhielt Dohna den Auftrag zu einer neuen Gesandtschaft zuerst nach Wien, und dann an den Hof des Kurfürsten von Brandenburg. Auf seiner Reise durch Böhmen machte er Bekanntschaft mit Albrecht von Wallenstein, der schon damals, mit der reichbegüterten Lucretia Nikessin von Landeck vermählt, für einen der angesehensten Standesherren in Böhmen und Mähren galt. Erst im Februar kam Dohna wieder in Preußen an; denn der Kurfürst von Brandenburg hielt sich damals einige Zeit in Königsberg auf. Als Gesandter empfangen und im Auftrage des Kurfürsten von einem kurfürstlichen Geheimen Rat, »gar cortesisch« bewillkommt, erhielt er eine Wohnung im Schloß. Dies hatte für ihn die üble Folge, daß er jeden Abend mit dem Kurfürsten, einer Prinzessin Elisabeth Sophie und dem reichen Fürsten Radziwill, der damals um die Hand dieser Prinzessin warb, Karte spielen mußte, wobei er wenig Glück hatte, weil er vom Spiel wenig verstand. Überall aber hörte er Klagen über die schlechte Landesverwaltung, den traurigen Zustand der Finanzen, die Verwahrlosung der Ämter durch faule, untaugliche und gewinnsüchtige Beamte und Verwalter und dabei dennoch die Verschwendung und Vergeudung der Landeseinkünfte am kurfürstlichen Hofe. Man brachte eben damals in Königsberg eine Komödie auf die Bühne, »Der ungerechte Haushalter« genannt, worin dessen Weib alle möglichen Mittel häuslicher Zucht und Ordnung anwendet, um den verschwenderischen Gemahl zur Sparsamkeit zu bekehren. Jedermann deutete das Stück auf den anwesenden Kurfürsten. Graf Dohna bekam auch selbst hinreichende Beweise von den traurigen Finanzverhältnissen des Kurfürsten in die Hände. Sein Auftrag ging nämlich dahin, den Kurfürsten an den Rest seines Geldbeitrages für die Union an und eine Summe von 14000 Talern zu erinnern, die er dem Fürsten von Anhalt als Besoldung in dem Jülichschen Krieg schuldete. Um nur etwas von dieser Forderung zu erhalten, ließ der Fürst dem Kurfürsten das Anerbieten machen, er möge ihm sofort 4000 Taler auszahlen lassen, auf die übrigen 10 000 Taler wolle er dann Verzicht leisten. Allein so dringend auch der Fürst seine Geldbedürfnisse vorstellen ließ und so unermüdlich Dohna, wie er selbst sagte, »alle Tage sollicitirte«, konnte er doch keinen Bescheid erhalten und ward immer nur vertröstet. Vom kurfürstlichen Kanzler endlich ganz abgewiesen, mußte er dem Kurfürsten nach Berlin nachfolgen und wurde auch dort erst nach einiger Zeit von jenem mündlich dahin beschieden: »Er möge es beim Fürsten dahin richten helfen, daß diese seine magere Abfertigung nicht sinistre aufgenommen werde. Er, der Kurfürst, habe gar große Ausgaben, stecke überall in Schulden, habe auch den König von Polen nicht bezahlen können, wäre noch gar nicht gefaßt, wolle nunmehr erst gute Ordnung und Verfassung machen und den Fürsten nicht in diesem allein, sondern in mehrerem künftig contentiren. Er bitte aber, der Fürst wolle deshalb die Hand nicht abziehen, sondern bei ihm und seinem Hause, wie bisher löblich geschehen, umtreten.« So trat Dohna unverrichteter Dinge seine Rückkehr nach Heidelberg an, wo man schon Festlichkeiten und Vergnügungen aller Art vorbereitete. Der junge Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz befand sich nämlich seit Januar 1613 in England, wo er sich mit der liebenswürdigen, nicht minder durch hohe Bildung als durch Schönheit ausgezeichneten, damals erst siebzehnjährigen Prinzessin Elisabeth, des Königs Jakob I. einziger Tochter, im Februar vermählte. Am königlichen Hofe hatten bei dieser Vermählung keine besonderen Festlichkeiten stattgefunden, weil nicht lange zuvor der Prinz von Wales, Heinrich Friedrich, des Königs ältester Sohn, gestorben war und der Hof Trauer trug. Desto glänzender und festlicher sollte der Empfang der Fürstin auf deutschem Boden sein. Der junge Kurfürst kehrte früher zurück. Schon anfangs April traf man zu seiner Aufnahme in Holland und am ganzen Rheinstrom große Vorbereitungen. Er hielt jedoch erst am 29. Mai seinen Einzug in Heidelberg. In den ersten Tagen des Juni landete Elisabeth an der Küste bei Haarlem. Ihre Aufnahme in Amsterdam war äußerst glänzend. Alle Schiffe im Kanal bewiesen ihr Ehrerbietung. Am Rathaus begrüßte sie der Magistrat auf einer prachtvoll ausgestatteten Tribüne, worauf sie durch zwei Triumphbogen unter dem Klang von Zinken und Schalmeien, Trompetenmusik und Glockengeläute in den festlich geschmückten Prinzenhof fuhr, während von den Wällen und Mauern das grobe Geschütz und von den Brücken und Schiffen die Geschosse von 18 Fähnlein Bürger und zwei Fähnlein Kriegsleuten in den Jubel des Volkes hineindonnerten. »Es war so lustig zu hören, als wenn eine der allergrößten Victorien im ganzen Lande gewonnen wäre.« Am anderen Tage ergötzte sich die Fürstin an einem lustigen Wasserturnier, wobei die Matrosen ihre außerordentliche Kunst im Schwimmen zeigten. Eine ausgesuchte Gemäldesammlung, verbunden mit einer reichen Ausstellung von Edelsteinen aller Art, stellte ihr die Meisterwerke der holländischen Schule und andere ausgezeichnete Kunstschätze zur Schau. Dann führte man die Fürstin ins ostindische Gewürzhaus, wo ein glänzendes Bankett stattfand. So oft neue Speisen aufgetragen wurden, verkündigten, der Sitte nach, Trompeten den veränderten Tafelsatz. Die Stadt Haarlem hatte der Fürstin eine Wiege nebst einem Korb mit köstlichen Windeln im Wert von 50 000 Gulden verehrt. Die Stadt Amsterdam beschenkte sie mit einem goldenen Becken, angefüllt mit neugemünzten goldenen Triumphpfennigen, über 50 000 Gulden an Wert, ohne die kostbaren Geschenke, die ihr vom Ostindischen Hause und sonst noch gespendet wurden.
In gleicher Weise erfreute sich die Fürstin auf ihrer weiteren Reise, überall des festlichsten Empfanges. Am 3. Juni kam sie, begleitet vom Prinzen Moritz von Oranien, Don Antonio di Portugal und vielen anderen vornehmen Herren, bei Köln an, von einer ihr entgegenkommenden Gesandtschaft im Namen des Kurfürsten feierlichst bewillkommt und in dessen Schutz und Geleit genommen. Am Tage nach ihrem Einzuge gab ihr der Rat »ein schönes Bankett von Zuckerwerk und vielen anderen Lieblichkeiten«, wogegen sie den ganzen Rat dreimal zu ihrer Tafel lud. Er beehrte sie hinwieder mit einem goldenen Handbecken, mehreren anderen kostbaren Geschenken, nebst einem Fuder des besten Weines. Hierauf setzte sie ihre Reise nach Andernach fort, unter dem Donner des schweren Geschützes und »herrlicher Triumphmusik«, von der Kölner Ritterschaft und dem gesamten Rat begleitet.
Mittelerweile war man in Heidelberg mit Vorbereitungen aller Art zum festlichen Empfang der schönen Fürstin beschäftigt. Man übte Ritterspiele zu Roß in voller Waffenrüstung, Turniere zu Fuß, freie Wettrennen, Tänze und ähnliche Belustigungen ein, und Graf Dohna nahm an allem teil. Architekten bauten Triumphbogen, Feuerwerker arbeiteten an brillanten Kunstfeuern zu Wasser und zu Land, Schöngeister sannen möglichst geistreiche Devisen aus. Am 17. Juni langte endlich die gefeierte Königstochter in der Nähe von Heidelberg an. Dort zog ihr der junge Kurfürst, umgeben von zwölf Fürsten, einer großen Anzahl Grafen und edler Herren, unter ihnen auch Graf Dohna, mit einer Schar von 2000 Pferden von der Ritterschaft und 38 Fähnlein Fußvolk bis zum Städtchen Ladenburg entgegen, die Gemahlin feierlich zu empfangen. Gegen Abend hielt die Fürstin an der Seite ihres Gatten, mit ihrem englischen Geleite, dem Herzog von Lenox, dem Grafen von Arundel, dem Vicomte von Lesley, dem Grafen von Harrington und dem General Cecil, unter festlichem Glockengeläute in Heidelberg ihren Einzug, wo sie am Schloß von der verwitweten Kurfürstin im Kreise vieler Edeldamen aufs herzlichste bewillkommt wurde. Nach einigen Tagen der Ruhe und Erholung von den Beschwerden der Reise begannen die glänzenden Festlichkeiten. Jeder Tag wechselte mit anderen Spielen und Vergnügungen, mit Turnieren, Ringelrennen, Freirennen, Tänzen, kurzweiligen Mummereien, Feuerwerken und allerlei lustigen Aufzügen. Als unter diesen eines Tages auch ein sogenannter Jasons-Zug vorüberzog, flüsterte ein kurfürstlicher Rat dem Grafen Dohna die Worte zu: »Diese Historie bringt eine böse Vorbedeutung, denn der Ausgang mit Jason ist eben gar nicht glücklich gewesen« Und die böse Ahnung ging wirklich in Erfüllung.
So glänzend war der Empfang der englischen Königstochter auf deutschem Boden und in der Residenz ihres glücklichen Gemahls. Sie ahnte in den jubelvollen Tagen noch nicht, welchem Schicksal sie auf diesem Boden entgegengehe und daß sie einst, als hilfloser Flüchtling, heimatlos Haus und Hof werde verlassen müssen. Indes lag damals schon auf manches edeln Mannes Brust bange Besorgnis. Graf Dohna schrieb in jenen Tagen in sein Tagebuch: »Es kamen mit der Ankunft der Engländer auch viele neue, ungewöhnliche Muster und Moden zu uns nach Deutschland, darunter sonderlich auch eine Art von kleinen Sätteln, die wie Bauersättel aussahen. Da sagte zu mir der alte Cölbinger, als wir eines Tages den Schloßberg zu Heidelberg hinabgingen: Merkt's wohl, diese Bauersättel bedeuten, daß wir alle zu Bauern und Bettlern gemacht werden sollen. Und so ist's endlich auch ergangen.«
Im Herbst 1613 änderte sich auf einige Zeit Dohnas bisheriger Wirkungskreis, indem er vom Fürsten von Anhalt den Auftrag übernahm, dessen ältesten Sohn Christian von 14 Jahren auf einer Reise nach Italien zu begleiten. Er begab sich zuerst mit diesem Prinzen auf den Reichstag nach Regensburg, wo er seinen Bruder Abraham als kurfürstlich-brandenburgischen Gesandten fand. Dort sah er das merkwürdige englische Mädchen, das kein Fremder in Regensburg zu sehen versäumte, eine Jungfrau von 16 Jahren von einem enormen Körperbau: ihr Fuß hatte das Gewicht von 52 Pfund, die Dicke des Knies einen Umfang von zwei Fuß und vier Zoll, der Umfang der Wade betrug zwei Fuß, die Breite ihres Schuhes vier Werkschuhe; am rechten Fuß hatte sie sechs, am linken nur drei Zehen, von denen die große acht Zoll dick; »sonst ein schönes, lustiges Weibsbild, an Verstand völlig gesund, sprach auch geläufig mehre europäische Sprachen.« Ohne in Regensburg lange zu verweilen, trat Dohna hierauf mit dem jungen Prinzen die Reise nach Italien an. Glücklich in der Nähe Veronas angelangt, wurden sie dort an der weiteren Reise gehindert, bis sie, wegen der in Deutschland herrschenden Pest in einem Dorfe neun Tage eingesperrt, unter allerlei Ungemach die angeordnete Quarantäne gehalten. In Venedig besuchte Dohna wieder seinen alten Bekannten Fra Paolo Sarpi fast jeden Tag in dessen Kloster und hatte, so lange er in Venedig war, mit ihm sehr interessanten Umgang. Ihm beschrieb er »die sonderlich admirirte hebräische punktirte Bibel«, die er vor einiger Zeit in der Heidelberger Bibliothek gesehen und von der er sagt, daß jeder Jude, der sie sehe, auf die Knie falle und sie küsse. Merkwürdig war ihm, aus des Mönches Munde die Äußerung zu hören, die meiste Unruhe und Empörung in der Welt werde von den Geistlichen durch ihr leidenschaftliches, ungestümes Predigen gegen Ketzerei veranlaßt. Er verweilte in Venedig bis Anfang 1614. Den übrigen Teil des Winters brachte er dann in Florenz zu. Hier besuchte er die überaus reiche Kapelle von San Lorenzo, deren Wände sämtlich mit kostbaren Edelsteinen besetzt und getäfelt waren, so daß, wo man hinblickte, man lauter Edelsteine sah. Der Großherzog Ferdinand II. ließ eben damals einen großen Diamanten schneiden und polieren, der ihm 80 000 Scudi gekostet hatte. Der Polierer, der die Arbeit übernommen, hatte damit schon zwei Jahre zugebracht; man zahlte ihm jeden Monat 50 Scudi. Nach vollendeter Arbeit war ihm überdies ein Geschenk von 1000 Scudi zugesagt. In der Rüstkammer zeigte man ein Schlachtschwert Karls des Großen, worauf die Worte: Domine da mihi (victoriam). Auch die Kunstkammer bot einen außerordentlichen Schatz von bewunderungswürdigen Gegenständen dar. Von Florenz begab sich Dohna nach Padua, wo er seinen jungen Prinzen in die hohe Schule aufnehmen ließ. Sie kamen dort eben an, als die Akademie ein festliches Ringelrennen veranstaltet hatte.
Dohna kehrte bald darauf allein nach Heidelberg zurück. Er fand am dortigen Hofe ein wildes wüstes Leben. Fast jeden Tag war er mit Jägern, Hunden und Jagdgeräten angefüllt, und an der fürstlichen Tafel blieben kühne Weidmannskämpfe mit wilden Ebern und ähnliche Geschichten oft stundenlang die einzige Unterhaltung. Als Intermezzo trat in diese Hof- und Tafelgespräche damals zuweilen der wunderliche Unfall ein, der nicht lange zuvor einem Grafen von Schwarzenberg am Rhein begegnet war. Dieser hatte sich mit einem schönen Fräulein von Dallenbroch verlobt. Auf dem Schlosse zu Hambach sollte eben die Hochzeit sein. Alles war schon vorbereitet, eine große Zahl von Hochzeitsgästen auch bereits anwesend und von Stunde zu Stunde erwartete man die Mutter mit der Braut. Aber es ward Abend und Mitternacht und sie kamen nicht. Sie waren auf dem Wege nach Hambach von einem Freiherrn von Luith, der ihnen an der Spitze eines Reiterhaufens in einem Busche aufgelauert, überfallen, aus dem Wagen genommen und auf das feste Schloß Altenkirchen auf der anderen Seite des Rheins gebracht worden. Von dort schrieb nun der Freiherr dem Grafen von Schwarzenberg: das Fräulein sei seit vier Jahren schon seine Braut; um sie sich zuzueignen, habe er, der Graf, das Gerücht verbreitet, er sei in Moskau gevierteilt worden. Jetzt, da er, wie er ihm bewiesen, noch lebe, habe er sich seine Braut geholt und werde sie nun behalten, sollte es auch Blut und Leben kosten. Der Graf, durch diese Nachricht aufs bitterste ergrimmt, beschloß alsbald die blutigste Rache und rüstete sich zur Fehde. Alles, was ihm verwandt und befreundet, wurde von ihm zu Hilfe gerufen. Ehe es aber noch zum Ausbruch kam, trat der Kurfürst von Trier vermittelnd dazwischen, um den Freiherrn durch dringende Vorstellungen zu bewegen, die Braut nach Koblenz zu bringen, bis die Sache rechtlich entschieden sei. Da indes die Entscheidung des kurfürstlichen Offizials dahin lautete: Die Braut müsse dem Grafen von Schwarzenberg ausgeliefert werden, der Freiherr stehe im Unrecht, daß er seine Prätension mit Gewalt und nicht auf dem Wege des Rechts auszuführen gesucht, so glaubte dieser, mit dem Bescheid unzufrieden, nun zu neuen Gewalttaten schreiten zu dürfen. Es kam zur förmlichen Fehde, in deren Folge aber der Prinz Georg Wilhelm von Brandenburg, der seinen Hof zu Düsseldorf hatte, wo in der Nähe der Freiherr angesessen war, diesen als Räuber für vogelfrei erklärte. Zugleich brachte es der Graf von Schwarzenberg beim Erzherzog Albrecht von Österreich auch dahin, daß alle Güter des Freiherrn in Beschlag genommen und 12 000 Goldgulden, die er auf den Zoll zu Bonn gelegt, konfiszirt werden sollten. Da legten sich endlich die beiden Grafen von Nassau und Wittgenstein ins Mittel und es gelang ihnen, zwischen dem von Schwarzenberg und dem Freiherrn auf eine gewisse Abstands- und Entschädigungssumme einen gütlichen Vergleich zustande zu bringen.
Das Jahr 1614 verlief für Dohna ohne wichtige Ereignisse. Es gefiel ihm nicht lange an dem wüsten und geräuschvollen Hofe zu Heidelberg, wo an ernste Geschäfte kaum gedacht wurde. An der Art von Vergnügungen und Lustbarkeiten, wie sie dieser Hof damals liebte, hatte er nie Gefallen gefunden. Er trat eine Reise nach Preußen an. Von seinem Aufenthalt am Hofe zu Berlin weiß er indes nichts weiter zu berichten, als daß bei dem Verlöbnis des Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel mit des Kürfürsten Johann Sigismund von Brandenburg ältester Tochter Anna Sophie ein etwas wildes Bärenfangen angestellt wurde, wobei es sehr lustig herging.
Erst im Anfang 1615 kehrte Graf Dohna nach Heidelberg zurück. Es war dort wieder mehr Ernst in das Leben am Hof gekommen. Seit dem 16. August 1614 hatte der junge Kurfürst das achtzehnte Jahr erreicht und als vollmündig die Regierung nun selbst übernommen. Ihm standen Männer zur Seite, die es mit dem Wohl des Landes redlich meinten und vollkommen ersetzten, woran es dem jungen Fürsten gebrach; an der Spitze dieser Räte der Fürst Christian von Anhalt, der durch vieljährige Dienste der Pfalz schon weit mehr als seinem eigenen Geburtslande angehörte, dann der ruhig-besonnene Graf Johann Albrecht von Solms als Großhofmeister, die Grafen Johann von Nassau, Ludwig von Wittgenstein, Reinhard und Otto von Solms, Fabian und Achatius von Dohna; außer ihnen mehrere Herren von Adel. Zur Beratung über Angelegenheiten der Kirche, der Universität und in Gerichtssachen saßen die angesehensten Theologen, akademische Lehrer und Rechtsgelehrte, die beiden Hofprediger Pitiscus und Scultetus, der Historiker Gruter und Marquard Freher, die Professoren Paräus und Plato mit im kurfürstlichen Rat. Man wünschte allgemein, daß auch Graf Dohna in diesen aufgenommen werde und nie mehr als jetzt entsprach das auch seinen Wünschen, denn nie weniger als gerade jetzt verlangte er, nach Preußen zurückzukehren. »Es ist in diesem Jahr (1615)«, schreibt er selbst, »und auch noch in den folgenden in Preußen große Uneinigkeit und ein sonderlicher Haß wider meine Brüder und unser ganzes Haus herrschend gewesen, weil meine Brüder Friedrich zum Landhofmeisteramt und Fabian zu der Hauptmannschaft zu Brandenburg befördert wurden.« Dazu kam noch der im ganzen Land verbreitete Haß gegen die Reformierten, der so weit ging, daß die Verordnung erneuert wurde, kein Reformierter solle ein Amt erhalten dürfen. So nahm Graf Dohna gern im März 1615 die ihm vom Kurfürsten angetragene Stelle eines kurpfälzischen Rates an und trat sofort ins Ratskollegium als Mitglied ein, freilich als jüngster Rat nur mit einer Besoldung von zweihundert Gulden.
Bald darauf erhielt Dohna wieder einen Auftrag zu einer Gesandtschaft an den französischen Hof.
Sie machte ihm indes wenig Freude. Er sagt selbst: »Ich habe dabei mehr Widerwärtigkeit als Glück und mehr Verdruß als Vergnügen gehabt.«
Der königliche Rat bestand jetzt ausschließlich nur aus katholisch-spanisch gesinnten Männern. Jeannin, Villeroi, der Kanzler Sillery und dessen Sohn Puisieux saßen noch am Staatsruder, und mit ihnen kam Dohna in seinen Angelegenheiten am meisten in Berührung. Die Königin indes, die Regentin, ließ sich noch weit mehr durch den Einfluß des päpstlichen Nuntius, des spanischen Gesandten, des Jesuiten Pater Cotton und besonders des Marschalls von Ancre (Concini) und dessen Frau, die ihren geheimen Rat bildeten, beherrschen. Schon der erste Empfang Dohnas bei Puisieux war für ihn wenig erfreulich; er erhielt von diesem nur einsilbige, nichtssagende Antworten. Der König und die Königin ließen ihn zwar durch einen Hofmann, wie herkömmlich, freundlich bewillkommnen, allein eine Audienz konnte Dohna nicht erhalten, angeblich wegen der eintretenden Feste. Der Grund davon lag jedoch anderswo. Er hatte in seiner Instruktion die ausdrückliche Weisung bekommen: bei der Audienz vor dem König und der Königin als Gesandter der Union nicht anders als mit bedecktem Kopfe zu erscheinen. Über diesen Punkt hatte er sich sogleich nach seiner Ankunft mit dem Herzog von Bouillon besprochen, der kein Bedenken geäußert, daß man dies am Hofe ihm als Gesandten gestatten werde, da es einem früheren Gesandten der Union ebenfalls schon zugestanden worden sei, den König in der Audienz mit bedecktem Kopfe anzureden. Villeroi aber, der davon bereits Nachricht erhalten, hatte, wie Dohna erfuhr, erklärt, er werde unter keiner Bedingung zugeben, daß der Graf vor dem König mit bedecktem Kopfe erscheine. Wie Puisieux diesem mitteilte, hatte man vorlängst schon eine Veränderung in jener Sitte vorgenommen. Indes ließ der König den Grafen als Gesandten nach üblichem Gebrauch durch seinen Oberhofmeister mit einer Sendung von Brot, Wein und Fisch beehren, alles von ausgezeichneter Güte. Der Herzog von Bouillon riet daher auch, der Graf möge, als anerkannter Gesandter, im Betreff der früheren Sitte in keiner Weise nachgeben. Wenige Tage nachher versicherte Villeroi in einer Unterredung dem Grafen zwar, daß der König stets bereit sei, den Fürsten der Union seine Freundschaft zu beweisen. Als indes Dohna erwähnte, er könne in einer Audienz beim Könige nur mit dem Hut auf dem Kopfe erscheinen und er hoffe, der König werde den Fürsten diese Ehre vergönnen, entgegnete der Minister in aufbrausender Hitze: Das wäre beispiellos! So was hat man noch nie verlangt! Wir werden unsere Sitten um eueretwillen nicht ändern. Dohna erwiderte, er habe die bestimmte Weisung, nur mit bedecktem Kopfe eine Audienz anzunehmen. »Mag sein«, antwortete der Minister, »aber dann hättet Ihr vor Euerer Reise hierher schreiben oder mit unserem Geschäftsträger bei Kurpfalz darüber verhandeln sollen.« Endlich brummte er noch die Worte durch die Zähne, man werde darüber im Conseil sprechen. Nicht lange nachher erhielt Dohna von Villeroi den Bescheid, die Königin sei nicht gesonnen, während des Königs Unmündigkeit in der Sitte etwas zu ändern. Und er, ließ Dohna ihm sagen, könne und werde anders keine Audienz weder verlangen noch annehmen. Er müsse sich darüber an die Fürsten der Union wenden.
Die Sache wurde in Paris bald Tagesgespräch. Als nun Dohna dem Minister Villeroi ein Schreiben der Unionsfürsten an den König einhändigte, kam noch ein neuer Streitpunkt hinzu. Die Fürsten nämlich hatten sich in der Unterschrift der Ausdrücke: »très-humbles et très-affectionnés« bedient. Der Minister aber nahm auch hieran Anstoß, verlangend, inoffiziellen Schreiben an Seine Majestät gezieme es sich, daß die Fürsten sich als »très-humbles et très-obéissants« unterzeichneten. Graf Dohna erwiderte zwar, man könne solches doch mir von dem Könige untertänigen Fürsten verlangen und es scheine fast: »Ihr behandelt uns wie euere Untertanen.« Allein der Minister beharrte bei seiner Ansicht und forderte in künftigen Schreiben der Fürsten durchaus diese Ausdrücke.
Ueber beide formellen Streitpunkte stritt man sich ohne Erfolg von einer Woche zur anderen. Villeroi schien es, wie Dohna endlich einsah, absichtlich darauf anzulegen, es überhaupt zu keiner Audienz kommen zu lassen. Er äußerte auch mehrmals, er glaube gar nicht, daß Dohna in seiner Anmaßung der Kopfbedeckung eine wirkliche Anweisung von den Fürsten in Händen habe, und es sei wahrscheinlich, daß der Graf entweder nach eigener Willkür oder auf Antrieb anderer handele. Zu dieser Annahme bewog den Minister sowohl der Umstand, daß Dohna wirklich nichts Schriftliches darüber aufzuweisen hatte, als auch die ihm zugekommene Nachricht, daß außer dem Herzog von Bouillon, auch mehrere Gesandte, namentlich die von England und den vereinigten Niederlanden, sich dem Verlangen des Grafen beifällig erklärt hätten. Vergebens setzte der Graf dem Minister die Gründe seiner Forderung sowie die Folgen der Verweigerung auseinander. Nachdem sechs Wochen unter nutzlosen Verhandlungen hingegangen waren, beschloß Dohna, seine Aufträge schriftlich am Hofe übergeben zu lassen und ohne Audienz abzureisen. De Thou, Jeaunin, Boissise und mehrere Gesandte, denen er diesen Entschluß mitteilte, billigten ihn nicht nur, sondern nannten es eine rohe Behandlung, daß man ihn ohne Audienz gehen lasse. Villeroi war höchst aufgeregt und äußerte sich nur im Ton des Zornes über Dohnas Abreise, als dieser sie ihm persönlich anzeigte.
So verließ Graf Dohna Paris am 25. Mai sehr verstimmt und unzufrieden; es war die erste seiner Gesandtschaften, die gar keinen Erfolg gehabt. Er begab sich, seiner Instruktion gemäß, zunächst nach dem Haag. Allein auch hier fand er die Verhältnisse für den Zweck seiner Sendung nicht günstiger. Sein freundlicher Empfang beim Statthalter Prinz Moritz und bei dessen Bruder, dem Prinzen Friedrich Heinrich von Nassau-Oranien, sowie die nähere Bekanntschaft mit dem großen Staatsmann Oldenbarneveldt ließen ihn zwar in den ersten Tagen bessere Hoffnungen fassen. Allein nachdem seine schriftlich übergebenen Anträge der Versammlung der Generalstaaten vorgelegt und beraten worden waren, berichtet er als Resultat dieser Beratung: »Alles, was ich sowol aus des Prinzen, als aus Barneveldts Relation vernommen, geht fast dahin, daß die Staaten, obwol sie wegen ihrer Verheißung, auch aus obliegender unumgänglicher Notwendigkeit den versprochenen Succurs billig leisten sollten, doch sich ziemlich kalt und nachlässig erzeigen, teils weil sie die Kosten fürchten, teils auch weil sie über ihre Tresure ganz fest und steif halten. Sonderlich aber könne der verheißene Succurs auch deshalb so bald nicht vor sich gehen, weil sie sich nie anders erklärt, als nur ›coniunctim‹ mit Frankreich und nicht ›separatim‹ zu helfen.«
So kehrte Dohna auch aus dem Haag ohne Erfolg nach Heidelberg zurück. Der junge Kurfürst Friedrich gab ihm jedoch wiederholte Beweise seiner Gunst und seines Vertrauens. Er nahm ihn als Begleiter mit, als er mit seiner jungen Gemahlin die Oberpfalz bereiste, um verschiedene Unordnungen im Kirchenwesen abzustellen, und Dohna bewies sich auch hierbei so tätig und einsichtsvoll, daß ihn der Kurfürst zum Präsidenten des Kirchenrates zu Amberg ernannte.
Bereits aber rüsteten sich beide Bündnisse zum drohenden Kampfe. »Man ist um diese Zeit«, schreibt Dohna in seinem Tagebuch, »in Deutschland sehr mit Kriegsgedanken umgegangen und insonderheit haben die Unirten viele Zurüstung und Kriegsbereitschaft im Werke gehabt; zumal hatten Kurpfalz, Ansbach und Durlach schöne Zeughäuser, Geschütz und Zubehörung. Aber die mehrsten Fürsten sahen doch mehr auf Putz und Pracht als auf Verteidigungsmittel, mehr auf schöne Kleider und krause Haare als auf Waffen, sodaß einmal ein fürnehmer Fürst zu mir sagte: Vor diesem rühmte man die Edelleute, welche schön zu Roß saßen und eine schöne Lanze führen konnten, auch ihre Waffen wohl zu brauchen wußten. Anjetzt aber lobt man diejenigen, welche ihre Überschläge und Krößen hübsch anzustechen und ihre Haare wohl zu kraußen wissen. Es ist wol wahr: Wir haben mehr Wissen, aber weniger Gewissen; die alte Kirche hat mehr Gewissen, aber weniger Wissen.«
»Man pocht auf die Union«, fährt Dohna fort. »So ging man damals damit um, auf Kosten der Venetianer unter einem anderen Vorwand ein Heer von 15,000 Mann zu werben. Fürst Christian sollte es führen. Die Sache war in einer Versammlung der Räte der Unirten beraten worden. Nun hatte man unter Anderen aber auch den Prinzen Heinrich von Oranien, des Prinzen Moritz Bruder, genannt, welches jedoch die unirten Fürsten, besonders Ansbach, Baden und Anhalt verdrossen, weil sie nicht gemeint, daß ihnen Jemand in solchem Amte sollte vorgezogen werden. Außerdem hat man unter die Evangelischen auch mit der sächsischen Prätension auf Jülich den Zankapfel der Uneinigkeit geworfen, und so war, wie es überall zugeht, auch bei der Union viel Eigennutz, Rachgier und Geiz.«
Das Jahr 1615 beschloß Dohna mit einer Reise nach Waldsassen in der bayrischen Oberpfalz, wo er wegen einer diplomatischen Verhandlung eine Konferenz mit dem kaiserlichen Abgesandten Oberst Lucan haben sollte. Er fand an ihm einen stattlichen Mann von vielem Verstand und reicher Erfahrung. Weil er im Krieg einen Arm verloren hatte und auf einem Beine hinkte, so sagt Dohna von ihm: er sei ein treues Abbild des damaligen Deutschen Reichs gewesen, welches ebenso an allen Gliedern gelähmt sei.
Seit Anfang 1616 hatte die Liga ihr Oberhaupt, ihren Mittelpunkt verloren. Herzog Maximilian von Bayern hatte die Oberleitung des Bundes aufgekündigt, weil man österreichischerseits immer mehr Bundesmitglieder an sich zu ziehen suchte, die Kräfte der Liga dadurch mehr und mehr geschwächt wurden, und auch, weil viele Bundesstände überhaupt alle ernsten Anstrengungen scheuten. Bald wurde es kund, daß man am österreichischen Hofe bemüht war, die Liga, so viel nur möglich, zu beseitigen. Der Erzherzog Maximilian trug in einer Vorstellung beim Kaiser Matthias darauf an, mit Beihilfe aus Spanien und den Niederlanden eine bedeutende Kriegsmacht im Reiche aufzustellen, um widerspenstige Reichsstände zu schrecken und nötigenfalls zu züchtigen oder parteilose zu ihrer Schuldigkeit für das Interesse Österreichs zu bringen. Der Erzherzog hatte dem Kaiser ferner angeraten, er solle sich bei der bevorstehenden römischen Königswahl unbedingt die Designation vorbehalten, um unter allen Umständen Succession des österreichischen Hauses zu sichern. Dieser Vorschlag kam noch vor der Zeit zur Kenntnis der weltlichen Kurfürsten. Er erregte bei allen die größten Besorgnisse, die selbst der Herzog Maximilian von Bayern teilte; er lud daher den Fürsten Christian von Anhalt zu einer Zusammenkunft ein, um sich mit ihm über Mittel und Wege vertraulich zu beraten, wie unter den Reichsständen feste innere Einigkeit zur Aufrechterhaltung sowohl des Friedens als der Freiheit, den gefährlichen Plänen des österreichischen Hauses gegenüber zu bewirken sei. Fürst Christian konnte der Einladung des Herzogs nicht sogleich folgen; um jedoch in einer Sache von so großer Wichtigkeit nichts zu verabsäumen, sandte er den Grafen Dohna nach München. »Wir versehen uns«, sagt Fürst Christian in der dem Grafen Dohna gegebenen Instruktion, »der Herzog werde unsere geschehene Eröffnung nicht nur im Besten aufnehmen, sondern auch mittels seiner großen Liebe zu allem friedlichen, geruhigen Wesen, seiner Erfahrung und besonderer Geschicklichkeit auf nützliche Mittel bedacht sein, damit das alte krachende Haus dieser Maschine nicht auf einmal vollends über den Haufen falle, sondern wiederum durch gutes Vertrauen gestützt und wol erhalten werden möge.«
Von dem sehr ernst gestimmten Hof zu München, wo Graf Dohna an der herzoglichen Tafel mit dem im Dreißigjährigen Krieg so berühmt gewordenen General Tilly Bekanntschaft machte, begab er sich als Gesandter in denselbigen Angelegenheiten an den geräuschvollen und vergnügungslustigen Hof des Kurfürsten von Brandenburg. Nachdem er zuvor in einer Audienz zu Küstrin sich seiner Aufträge entledigt, verlebte er in Berlin einige Zeit in sehr angenehmen Verhältnissen am dortigen Hofe. Da die Vermählung des Kurprinzen Georg Wilhelm mit der Schwester des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, Elisabeth Charlotte, nahe bevorstand, so befanden sich damals am Berliner Hofe viele fürstliche Gäste. Kein Tag ging ohne Festlichkeiten und Vergnügungen hin. Bald findet ein glänzendes Bankett statt, wobei die lustige Herzogin von Braunschweig nach aufgehobener Tafel mit zwölf schönen Jungfrauen einen Aufzug hält und einen zierlichen und künstlichen Ballettanz aufführt; bald veranstaltet der Kurfürst zu Ehren des eben am Hofe angekommenen Landgrafen Otto von Hessen auf der Spree ein prachtvolles Feuerwerk; bald begeben sich die Herrschaften zu einer lustigen Mummerei nach Spandau, bald zu einer großen Jagd nach Schöneberg, und an allen diesen Lustbarkeiten nahm auch Graf Dohna teil. Aber er macht dabei auch seine Bemerkungen über manche tadelnswerte Sitte der Zeit. Es mißfällt ihm, daß die Frauen am Hof sich eine gewisse jugendliche Frische durch starke Schminke erkünsteln wollen und das Gesicht mit Pflästerchen belegen, die sie »lustres« nennen. Er findet es ferner auffallend, daß an den fürstlichen Höfen viel stolze Hofleute sich im Kleiderschmuck noch weit prachtvoller und stattlicher halten als selbst die Fürsten, und daß es sogar manche gibt, die ebenso viel oder noch mehr Edelsteine auf dem Hute tragen, als die größten Potentaten. Überhaupt ist es eben kein günstiges Urteil, das Dohna über die damaligen deutschen Fürstenhöfe fällt. »Auch auf den Unionstagen und anderen Zusammenkünften der Fürsten«, bemerkt er in seinem Tagebuch, »ist immer viel Aufwand getrieben worden, weil die Herren jeder Zeit viel Volk und großen Staat mit sich brachten. Fürst Christian dagegen hatte stets nur sehr wenig Leute um sich. Als er einmal zu Heidelberg der Kurfürstin seine Reverenz machte, zeigte er dann auf den hinter ihm stehenden jungen Fürsten Christian, seinen Sohn, und auf mich, sagend: ›Voilà mon train‹, und die Fürstin lachte.«
Im Sommer des Jahres 1617 erhielt Graf Dohna vom Fürsten Christian von Anhalt das Anerbieten, seinen Sohn Christian auf einer Reise durch Savoyen, Frankreich und England zu begleiten, und der Graf, stets reiselustig, nahm es gern an. Schon im Juli trafen sie in Turin ein. Der Herzog Karl Emanuel, wie ihn Dohna schildert, ein unruhiger, ehrgeiziger, rachgieriger und wankelmütiger Fürst, der es jedoch wohl verstand, die Menschen mit süßen Worten für seine Absichten zu gewinnen, lag damals gegen Pietro di Toledo, den Governatore von Mailand, im Kriegsfeld. Graf Dohna und der junge Prinz begaben sich zu ihm ins Lager und nahmen an mehreren Gefechten teil. Für Dohna hatte indes das Kriegsgetümmel niemals Reiz. Viel interessanter war es ihm, an der herzoglichen Tafel und wo sich sonst Gelegenheit bot, den alten Marschall Lesdiguières, die Herzoge von Rohan, von Angoulème, von Candale und den jungen feingebildeten Markgrafen Karl von Baden, die sich damals beim Herzog von Savoyen im Lager befanden, näher kennen zu lernen.

Johann Andreas Graf, Das Haus des deutschen Ordens in Nürnberg 1681. Kupferstich
Als es im Herbst in Savoyen endlich zur Waffenruhe kam, trat Dohna mit seinem Prinzen die Reise nach Paris an. Er versprach sich keine besonders freundliche Aufnahme. Die Art, wie man ihn am Hofe bei seiner letzten Gesandtschaft vor zwei Jahren abgefertigt, war ihm noch in frischer Erinnerung. Überdies stand der Marschall von Ancre noch an der Spitze der Verwaltung und bei der Königin in höchster Gunst. Villeroi, bei Dohnas letzter Anwesenheit in Paris sein hartnäckigster Gegner, war zwar jetzt von der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten verdrängt, hatte jedoch immer noch Anteil an den Verwaltungsgeschäften. Der dem Grafen ungleich freundlicher gesinnte Jeannin hatte nur noch den Titel eines Oberintendanten der Finanzen, die Geschäfte waren einem anderen übertragen. Der Herzog von Bouillon, der alte Freund Dohnas, war vom Hofe verwiesen und einer von Ancres unversöhnlichen Feinden. So konnte sich der Graf auch schon nach diesen Verhältnissen am Hofe nicht die freundliche Aufnahme versprechen, wie er sie früher bei Heinrich IV. gefunden. Dazu kam noch, wie ihm der Herzog von Rohan mitgeteilt, daß, weil sein Bruder Dietrich mit einem deutschen Reiterhaufen gegen Frankreich gedient hatte, er mit diesem verwechselt und von den königlichen Räten die Meinung verbreitet worden war, er sei es, der die Waffen gegen das Reich geführt habe. Dieser Irrtum klärte sich indes bei Dohnas Ankunft bald auf und alle seine Besorgnisse wurden beseitigt; »denn«, sagt er in seinem Tagebuch, »Gott hat es also geschickt, daß man mir überall große Ehre angetan und Alles wohl abgelaufen ist. Auch der junge Fürst Christian, der dem Könige die Reverenz getan, ist sehr gnädig gehalten und hernach zum Abschied mit einer Medaille von Diamanten beehrt worden. Es hat aber sehr dazu gedient, daß wir so wohl empfangen wurden, weil der Herzog von Rohan und andere Herren, die uns zuvor im savoyischen Lager gesehen, zuvor von dieser Kundschaft berichtet hatten. Besonders hat der Herzog von Rohan darin viel Gutes gethan.«
Nach einem Aufenthalt von einigen Wochen in Paris begab sich Dohna mit dem jungen Fürsten über Calais nach London, wo diesen besonders der König und die Königin mit ausgezeichnetem Wohlwollen empfingen. Die großen Verdienste des Vaters um das pfälzische Haus fanden am Sohne vergeltende Belohnung. Sie verweilten am königlichen Hofe bis Mitte Dezember und kehrten dann durch die Niederlande nach Deutschland zurück.
Hier fand Dohna die Lage der öffentlichen Verhältnisse vielfach verändert. Den Herzog Maximilian von Bayern hatte das Verfahren des Kaisers zur Auflösung der von ihm geleiteten katholischen Liga dem österreichischen Interesse ganz entfremdet. Er hatte bereits mit den fränkischen Bischöfen ein neues Bündnis geschlossen »zu vertraulicher, nachbarlicher Versicherung«. Der nun offen vorliegende Plan des alternden Kaisers, die römische Königskrone auf das österreichische Haus zu bringen, hatte die Unirten und Ligirten in ihrem gemeinsamen Interesse einander näher geführt. Kurpfalz an der Spitze der Unirten mochte am liebsten die Königskrone auf dem Haupte seines Vetters, Maximilians von Bayern, sehen. Seinerseits aber verfolgte auch der Kaiser sein Streben, die Krone seinem Hause erblich zu sichern. Obgleich die protestantischen Stände in Böhmen alles aufboten, um ihr Wahlrecht zu behaupten, und Graf Dohna nach Böhmen gesandt wurde, um besonders den Grafen Andreas von Schlick, einen der Angesehensten der protestantischen Partei, zum kräftigsten Widerstand gegen des Kaisers Plan zu gewinnen, so gelang es diesem doch, seinen Vetter, den Erzherzog Ferdinand zum designirten König von Böhmen gewählt und gekrönt zu sehen. Jetzt aber kam es vor allem darauf an, für die Wahl Ferdinands zum römischen König den Kurfürsten Johann Georg von Sachsen zu gewinnen. Der Kaiser begab sich deshalb selbst von Böhmen aus zu Ende des Jahres 1617 nach Dresden, und der Kurfürst fand sich dadurch so geehrt, daß er den Kaiser nicht nur mit den glänzendsten Banketten, Jagden, Tanzfesten und allen möglichen Vergnügungen erfreute, sondern auch für sich und den Kurfürsten von Brandenburg das erwünschte Versprechen gab, bei der römischen Königswahl dem Wunsche des Kaisers gemäß zu stimmen.
Inzwischen buhlten um den Herzog von Bayern beide Parteien. Der Kurfürst Ferdinand von Köln bot bei einem Besuch, den er dem Herzog, seinem Bruder, abstattete, alles auf, um ihn von der Annäherung zu den Unirten zurückzuhalten. Anderseits begab sich im Anfang des Jahres 1618 der junge Kurfürst von der Pfalz ebenfalls nach München, um Maximilian für die Union zu gewinnen. Da dieser indes immer noch schwankte, so traten die Unirten im Frühling zu einem neuen Unionstag zu Heilbronn zusammen. Graf Dohna war in Begleitung des Kurfürsten von der Pfalz dort anwesend. Man fand ratsam, über die Verhältnisse am kursächsischen Hofe und was dort jüngst vorgegangen war, genauere Kundschaft einzuziehen. Man beschloß, einen Mann dahin zu senden, der mit diplomatischer Gewandtheit die Gesinnung des Kurfürsten auszuforschen verstehe, und die Wahl fiel wieder auf den Grafen Dohna.
Gegen Ende Juni in Dresden angelangt, wurde ihm am 30. eine Audienz beim Kurfürsten angesagt. Zwischen zwei und drei Uhr, so berichtet er darüber, holten ihn fünf vom Hofe an ihn abgesandte Edelleute in einer Kutsche mit sechs schönen Pferden aufs Schloß ab. Drei von den Edelleuten mußten neben der Kutsche zu Fuße gehen; nur die beiden Vornehmsten, einer von Ködritz und einer von Ende, begleiteten ihn im Wagen. Auf dem Schlosse in ein prachtvolles Gemach geführt, ward er nach einer Stunde zur Audienz eingeladen und von einer Anzahl aufwartender Trabanten in das Gemach des Kurfürsten geleitet, wo er verschiedene Geheime Räte anwesend fand. Seiner Instruktion gemäß hatte der Graf dem Kurfürsten vornehmlich über zwei Punkte einen ausführlichen Vortrag zu halten. Der eine betraf die Befestigung des Fleckens Udenheim in der Nähe von Speyer, die der Bischof Philipp Christoph von Speyer unternommen, der Kurfürst von der Pfalz aber in seinem Interesse hatte niederreißen lassen. Der Graf mußte dem Kurfürsten den ganzen Vorgang der Sache, weil sie in Deutschland viel Aufsehen erregt, genau auseinandersetzen: der Bischof habe vor zwei Jahren dem Kurfürsten angezeigt, er beabsichtige seine Residenz zu Udenheim durch Graben an umliegenden sumpfigen Orten mit einigen Fischwassern zu versorgen und sie zugleich vor Überfällen zu sichern. Der Kurfürst, nichts Arges ahnend, habe auf des Bischofs Bitte ihm dazu auch seinen Baumeister geschickt. Bald habe er aber erfahren, daß der Bischof um Udenheim einen Bau von sieben Real-Bollwerken habe anlegen lassen wollen. Aus Besorgnis, daß von einem solchen, nur drei Meilen von der Residenz Heidelberg entfernten befestigten Orte dem Kurfürstentum großer Schaden geschehen könne, habe der Kurfürst den Bischof von dem Festungsbau abmahnen lassen, jedoch ohne Erfolg. Dieser vielmehr, erklärend, es sei auf keine Festung, sondern nur auf »eine kleine Verwahrung« abgesehen, habe den Bau mit um so größerem Eifer fortgesetzt und nicht einmal so lange damit einhalten wollen, bis Schiedsrichter darüber gehört worden seien. Jetzt habe der Kurfürst ernstere Mittel zur Hand nehmen wollen, um sein Land gegen den gefährlichen Bau zu sichern. Da habe sich zwar der Bischof zu einem Vergleich verstanden; allein das Domkapitel habe diesem nicht nur die Ratifikation verweigert, sondern sich dabei auch so übermütig, trotzig und halsstarrig benommen, daß nun der Kurfürst auf andere Mittel habe denken müssen, denn »mit einer Generalcaution von Feder und Tinte« habe er sich nicht abfertigen lassen wollen. Er habe sich entschließen müssen, den Bau durch seine Beamten und das Landvolk demolieren zu lassen, doch mit dem Befehl, dem Bischof, den Bürgern und Untertanen nicht den geringsten Schaden zuzufügen. So sollte Graf Dohna dem Kurfürsten den wahren Verlauf der Sache vortragen, um jeder Mißdeutung zu begegnen, »zumal«, heißt es »in dieser Zeit, da das eingerissene Mißtrauen unter den Ständen sonderlich durch diejenigen, die nach ihrem Beruf mehr ihr Breviarium abwarten, als sich um den Bau starker Festungen bekümmern sollten, in aller Weise gemehrt und von ihnen nur dahin gesehen wird, wie den evangelischen Ständen des Reiches je mehr und mehr Abbruch geschehe und sie allgemach gänzlich unterdrückt werden möchten.«
Der zweite Punkt, über den der Graf dem Kurfürsten eine Mitteilung zumachen beauftragt war, betraf den bereits im Mai (1618) erfolgten Ausbruch der Unruhen in Böhmen. Kurpfalz habe auf sicheren Wegen in Erfahrung gebracht, daß die evangelischen Stände in Böhmen wegen ihrer in Religionssachen erlittenen Drangsale gleiche Beschwerden führten wie die Kurfürsten und Reichsstände schon seit vielen Jahren. Um so mehr halte Kurpfalz dafür, daß man auch in Deutschland auf der Hut sein müsse; denn wenn Böhmen um seine Religion komme und wieder unter den Papst gebracht werde, so sei wohl Grund, ähnliches auch für die Stände im Reiche zu fürchten. »Weil nun aber, wie Kurpfalz gerne vernommen habe, die böhmischen Stände nicht gemeint seien, sich der kaiserlichen Majestät Gehorsam zu entziehen, sondern sich zu aller schuldigen Submission erbieten, so würde es ein sehr gefährlicher und Ihrer Majestät schädlicher Rat sein, wenn wider sie solche Maßregeln gebraucht werden sollten, wodurch sie zur Desperation gebracht würden, woraus dann ein Feuer angezündet werde, welches sehr weit um sich greifen möchte, auch wol das Reich selbst damit impliciert werden könnte. Könne daher Kurpfalz mit den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg zur Abwendung von Gewaltschritten beim Kaiser etwas Gutes wirken, so sei es dazu sehr bereit, damit die Stände in Böhmen im Gehorsam gegen den Kaiser, aber auch bei ihren Freiheiten in der Religion und ihren stattlichen Concessionen blieben.«
Nachdem Graf Dohna diese Punkte dem Kurfürsten vorgetragen, bat er diesen um seine Meinung in der Sache. Der Kurfürst indes wies ihn damit an seine Räte, und so fand Dohna auch hier wieder eine Erfahrung bestätigt, die er schon oft in seinem diplomatischen Leben gemacht hatte, indem er sagt: »ich bin bei vielen deutschen Höfen als Gesandter gewesen, habe aber fast überall gesehen, daß die Fürsten ihre schwersten Geschäfte von sich weisen und auf ihre Räthe und Diener legen.«
Während Dohnas Anwesenheit in Dresden wurde er jeden Tag zur kurfürstlichen Tafel geladen und zwar allein obenan gesetzt. »Man hat aber damals«, schreibt er, »am kursächsischen Hofe über alle Maßen sehr getrunken und sonderlich an der kurfürstlichen Tafel, welches ich mit Verwunderung und mit Schmerz angesehen. Von dem von Schulenburg, wie auch sonst erfuhr ich, daß sich beim Kurfürsten wegen des starken Trinkens etwan heftiger Zorn und harte Worte zeigen, also daß es schwer ist, allda zu dienen. Es waren zur selbigen Zeit auch von den böhmischen Ständen Gesandte da, nämlich Herr Leonhard Colonna von Fels, Feldmarschall, nebst zwei anderen, die mit mir in einer Herberge lagen. Wir haben auch an der kurfürstlichen Tafel zusammen gesessen. Da man einmal stark zu saufen angefangen, habe ich gethan, als wenn ich entschliefe, um das viele Saufen zu vermeiden, und weil man sah, daß ich mich nicht erwecken könne, hat man mich endlich weggehen lassen müssen. Einstmals beim Weggehen aus dem kurfürstlichen Gemach fiel mir ein Gemälde in die Augen, worauf man allerhand unfläthiges Vieh, Schweine und Hunde an einer Tafel sitzend abgemalt hatte, mit den Versen:
›Quid mirare, tuos hic aspicis, helluo, frates;
Qui toties potas, talis es ipse pecus.‹
Unter dem Gesundheitstrinken:
›Una salus sanis; nullam potare salutem
Non est in poto; vera salute salus.‹«
Größeres Interesse als diese meist unerwünschten Freuden der kurfürstlichen Tafel hatten für Grafen Dohna seine ernsten Unterhaltungen mit dem erwähnten böhmischen Gesandten, dem Feldmarschall von Fels; von dem erfuhr er auch, daß, obgleich der Kaiser erklärt habe, er werde mit aller seiner Macht die Ungehorsamen in Böhmen zu bestrafen und seine getreuen katholischen Untertanen zu schützen wissen, der sächsische Hof in seiner Gesinnung ebenso entschieden auf Seite des Kaisers als den böhmischen Ständen abgeneigt sei. In dieser Lauheit der Gesinnung für die Sache der Böhmen war auch die Antwort abgefaßt, welche Dohna dem Kurfürsten von der Pfalz zu überbringen hatte. Es hieß darin nur: man wünsche von seiten Kursachsens ebenfalls, daß man in Böhmen mit Moderation verfahre; man sei daher auch einer Teilnahme an einer Intervention zwischen den böhmischen Ständen und dem Kaiser nicht abgeneigt.
Am Tage darauf, nachdem Graf Dohna diese Antwort erhalten, kehrte er nach der Oberpfalz zurück, wo er am 5. Juli zu Waldsassen ankam. Einige Wochen nachher begann in Böhmen der Krieg. Man hielt unter den obwaltenden Verhältnissen vor allem eine Erneuerung des Bündnisses zwischen der Union und England für notwendig und Dohna ward beauftragt, zu diesem Zweck wieder als Gesandter nach London zu gehen. Er wäre dessen, wie er selbst gesteht, gern überhoben gewesen. In verhältnismäßig kurzer Zeit hatte er, wie er berechnete, auf verschiedenen Reisen 912 deutsche Meilen zurückgelegt und fühlte, daß die ununterbrochenen Reisebeschwerden seine sonst so feste Gesundheit mehr und mehr zu erschüttern anfingen. Der Kurfürst Friedrich hatte ihm auch eben erst die Verwaltung des Amtes Neuenburg in der Oberpfalz übertragen, wo er sich bereits die Fischbach'schen Güter gekauft. Außerdem hatte er soeben beim Grafen Johann Albrecht von Solms, der ihm schon seit vielen Jahren sein volles Vertrauen schenkte und in dessen Haus in Heidelberg Dohna immer mit größter Freundlichkeit aufgenommen worden, um dessen Tochter Ursula angehalten und sehnte sich jetzt mehr als je nach stiller häuslicher Ruhe. Allein wie ihm stets in seinem Leben die Pflicht eines höheren Berufes über alle seine Wünsche ging, so auch jetzt. »Ein ehrlicher Mann«, schreibt er um diese Zeit, »muß sich stets deß freuen, daß er seinem Beruf gemäß treu und aufrichtig handelt; den Ausgang mag er Gott befehlen. Ich muß bekennen, daß ich in dieser Zeit voll guter Hoffnung bin, die Sache der Evangelischen in Deutschland werde auf einen guten Grund gebracht und recht befestigt werden.« Und dieser Gedanke war es besonders, der über alle seine Wünsche nach Ruhe siegte.
Er trat die Reise nach England im Winter bei strenger Kälte an. Im Haag beim Prinzen von Oranien, an den er ebenfalls Aufträge hatte, sehr freundlich aufgenommen, mußte er ihm ander Tafel die Kriegsereignisse in Böhmen auseinandersetzen; denn der Prinz nahm an der böhmischen Sache das lebendigste Interesse. Im Anfang Januar 1619 kam Dohna in London an. Hören wir ihn hier selbst über den Erfolg seiner Gesandtschaft sprechen: »Nachdem ich bei dem Könige Jakob I. Audienz gehabt, haben Seine Majestät mich an die Räte gewiesen, mit denselben in Unionssachen wegen Prolongation des Bündnisses zu tractiren, sintemal die Zeit des ersten Verbündnisses zu Ende gelaufen. Es sind sechs der königlichen Räte zu der Handlung verordnet worden: Der Erzbischof von Canterbury, der duc de Lenox, der duc de Buckingham, welchen man Marquis genannt, nebst drei Gelehrten (conseillers d'état), welche, als sie versammelt gewesen, mir eine Stunde benannt, bei ihnen im königlichen Palaste zu erscheinen. Als ich in den Rat gekommen, haben sie sich an eine Tafel niedergesetzt, mir aber die Oberstelle allein zu silzen angewiesen, und hat man also (in Abwesenheit des von Buckingham, welcher nicht bei der Hand sein können), die Handlung angefangen. Sie wurde bald verrichtet, und erklärte sich der König, er wolle das Bündniß mit den Unirten noch auf einige Jahre verlängern, also daß ich meinen Zweck und was mir befohlen war, erlangte. Daneben aber waren mir noch andere Sachen übertragen, belangend den Zustand von Deutschland, und daß es sich ansehen ließe, als ob nach Kaiser Matthias Tod die Stände in Böhmen, Mähren und benachbarten Landschaften einen anderen Herrn erwählen möchten, dabei denn etliche Leute sich die Einbildung machten, als ob solche Wahl auf einen evangelischen Reichsfürsten und namentlich auf den Kurfürsten Pfalzgrafen, Seiner Majestät Eidam, sollte gebracht werden können. Dies Alles ist zwar Seiner Majestät mit gebührendem Grund und mit Bescheidenheit vorgebracht, aber doch allerdings nicht wohl aufgenommen worden. Denn obwol Seine Majestät sich dahin erklärte, daß sie, wenn auf gemeldetem Todesfall eine electio legitima vorginge, alsdann ihres Eidams sich anzunehmen nicht unterlassen wolle, so gab dennoch Seine Majestät zu verstehen, er wolle von einem Kriege nichts hören. Er sehe wohl, wir gingen damit um, einen Krieg anzuheben, aber er, der König, wolle damit nichts zu thun haben; denn er merke, daß sich etliche Fürsten in Deutschland damit groß zu machen suchten. Es wäre sein Rath, daß sich sein Eidam wohl in Acht zu nehmen hätte, ehe er einen Krieg anhöbe; er solle als ein junger Herr seinem Schwiegervater folgen, wie die Verse Virgil's lauteten, welche Ihre Königliche Majestät mir vorhielten und vorsagten:
›O praestans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtute exsuperas, tanto me impensius aequum est
Prospicere atque omnes volventem expendere casus.‹
»Ich blieb am königlichen Hof«, fügt Dohna hinzu, »den ganzen Januar und in dem Anfang des Februar, um London kennen zu lernen; den König begleitete ich oft zur Kapelle wie die anderen Hofleute; häufig folgte ich ihm auch in die Gerichtssäle, zuweilen auch auf die Jagd und bei anderen Gelegenheiten, wobei mich der König mit einem Platz in seinem Wagen beehrte und sich von mir über Alles belehren ließ. Auch von der Königin wurde ich sehr wohlwollend aufgenommen. An der königlichen Tafel fand ich oft Gelegenheit zur Unterhaltung mit dem Erzbischof von Canterbury, einem klugen und kenntnißreichen Prälaten.«
Bei der Abreise wurde der Graf vom Könige mit verschiedenen Geschenken, einem sehr schön gearbeiteten Geschirrbecken, einem Becher und eine Gießkanne von Silber, sein Sekretär mit einer goldenen Kette beehrt. Auf der Rückreise in Briel landend und im Haag angelangt, hatte er Audienz bei den Generalstaaten und stattete dem Prinzen Moritz von Oranien Bericht von seiner Gesandtschaft ab. In Heidelberg fand er beim Kurfürsten eine äußerst gnädige Aufnahme; denn man war mit dem Erfolg seiner Sendung sehr zufrieden.
Jetzt drängte aber mehr und mehr die Frage einer Entscheidung entgegen, wem die deutsche Kaiserkrone und wem die böhmische Königskrone zufallen sollten? Zu dieser hatte Kurpfalz längst ein geheimes Gelüste, worauf schon Dohnas Verhandlungen in London hindeuteten; denn gewiß nicht ohne Auftrag hatte er des Königs Jakob Meinung darüber auszuforschen gesucht. Um so eifriger war man am kurpfälzischen Hofe bemüht, die Kaiserkrone nicht auf das Haupt dessen kommen zu lassen, der sich für den rechtmäßigen König von Böhmen erklärte.
Mittlerweile hatten sich die drei geistlichen Kurfürsten und die Gesandten der weltlichen zu dem bestimmten Wahltage in Frankfurt versammelt, waren indes über die Wahl uneinig.
Während man in Frankfurt verhandelte, verfolgten der Pfalzgraf Friedrich, der seit des Kaisers Matthias Tod das Reichsvikariat führte, und der Fürst von Anhalt auch jetzt noch ihren Plan. Da es von größter Wichtigkeit war, den Kurfürsten Johann Georg von Sachsen auf ihre Seite zu ziehen, so erhielt von ihnen Graf Dohna in den letzten Tagen des Juli den Auftrag, als Gesandter eiligst an den sächsischen Hof zu gehen. Nach der ihm vom Kurfürsten Friedrich und dem Fürsten von Anhalt erteilten Instruktion sollte er dem Kurfürsten von Sachsen vorstellen, ob es nicht besser sei, daß man sich, bevor man zur Kaiserwahl schreite, über Stillung der in Böhmen und im ganzen Reiche entstandenen Unruhen und über die Mittel zur Wiederaufrichtung eines allgemeinen Vertrauens berate und vergleiche, »denn obwol von den geistlichen Kurfürsten einzig und allein auf die Erlangung eines Hauptes durch die Wahl des Römischen Königs gedrungen wird und sie erhoffen, daß Alles darnach gleichsam wohl gehen werde, so möchte es doch sehr bedenklich und dem Reiche nicht wenig gefährlich sein, sich mit einem Haupte zu beeilen, das bei der böhmischen Kriegsunruhe mehr als kein anderer mit interessirt sei. Der Kurfürst von der Pfalz wolle sich gegen den von Sachsen mit Herz und Gemüt aussprechen, nämlich daß, weil wir vermerken, daß bei den Geistlichen auf König Ferdinand ein großes Auge geschlagen wird, wir in unserem Gewissen nicht befinden können, ihn gleicher Gestalt unser Votum so pure und simpliciter zu geben, in Ansehung, daß derselbe, mit dem wir sonst in Ungutem nichts zu thun haben und dem wir seine Prosperität und Dignität auch ganz gern gönnen, doch jeder Zeit bei allen Evangelischen gar wenig beliebt gewesen, sondern für einen starken Persecutor der evangelischen Religion gehalten worden. Kurmainz werde es selbst nicht in Abrede stellen, daß Ferdinand noch als Erzherzog den Jesuiten zu viel eingeräumt und auch dadurch bei den Evangelischen sich unwert gemacht habe. Dazu komme, daß er mit seinem Königreich und Erblanden nicht allein in großem Widerwillen, sondern in offenem Krieg und Aufruhr stehe und das Reich und die Stände je länger je mehr mit darein verwickeln werde. Vor Allem aber gehe dem Kurfürsten sehr zu Gemüt, daß hierdurch die hereditaria successio imperii bei dem östreichischen Hause confirmirt, unsere libertas eligendi in eine bloße Verjahung und Confirmation Desjenigen, was von Anderen beschlossen sei, verwandelt und die Dignität und das Ansehen des kurfürstlichen Collegii zum Höchsten geschmälert würde.«

Matham, Burggraf Christoph von Dohna. Kupferstich
Am 2. August in Dresden angelangt, ließ sich der Graf sogleich bei Hofe melden und wurde sofort am folgenden Tage, in eben der Weise, wie bei seiner vorigen Gesandtschaft, von mehreren adeligen Herren in einem sechsspännigen Staatswagen ins Schloß geleitet. Weil er dem Kurfürsten hatte anzeigen lassen, sein Auftrag sei von großer Wichtigkeit, so wurde ihm sogleich Audienz erteilt. Nachdem er seiner Instruktion gemäß Vortrag gehalten, antwortete der Kurfürst, er müsse die Sache überlegen. Die darauf erfolgende Aufforderung des Kurfürsten, sein Anbringen schriftlich einzureichen, mußte Dohna, seiner Instruktion gemäß, ablehnen. Schon am Abend hatte er eine zweite Audienz beim Kurfürsten, bemerkt dabei aber, »Il me sembloit qu'il était bien yvré.«
In beiden Audienzen erwähnte der Kurfürst des Königs Ferdinand mit keinem Worte. Seine gereizte Stimmung schrieb Dohna zum Teil dem Umstande zu, daß er schon am Mittag und ebenso am Abend »einen starken Trunk zu sich genommen«. Deshalb mußten auch am anderen Morgen die zu Hofe bestellten Räte wieder heim gehen, weil der Kurfürst wegen des vielen Trinkens am Abend und am anderen Morgen sehr lange geschlafen.
Am Mittag des anderen Tages wurde Dohna wieder zur Audienz und dann zur kurfürstlichen Tafel geladen, wo er obenan allein saß. Es wurde wieder stark getrunken und dabei dem ganzen Kurfürstenkollegium, sowie dem Kurfürsten von der Pfalz auch besonders Gesundheiten ausgebracht. Dabei gefiel dem Kurfürsten ganz vorzüglich ein Gesandter des Bischofs von Bremen, ein Doktor, weil er unter allen an der Tafel immer der erste war, der seinen Becher wieder geleert hatte. Der Kurfürst knüpfte ein neues Gespräch mit Dohna an. »Was die unterschiedlichen Subjecte anlangt,« äußerte er, »die Euer Herr mir im Vertrauen eröffnet, darauf wollte ich mich gern weitläufiger erklären; aber erstlich so weiß ich nicht, wozu es nunmehr dienen soll, dieweil es so weit gekommen, und dann so gehört so etwas nur vor uns Kurfürsten mündlich und auch nur kurz zuvor, ehe man ins Conclave geht. Ich sehe die Motive wohl, die wegen König Ferdinands in der Wahl zu betrachten wären. Aber man muß es nunmehr dahingestellt sein lassen, wie es Gott schicken wird. Was die Böhmen anlangt, so ists nicht zu loben, daß sie den Herrn, den sie einmal anerkannt, nun wieder verstoßen wollen. Es ist ein bös Exempel. Auf diese Weise könnte man es überall so machen, auch in meinen Landen, da Gott vor behüte, und ich will es wohl verhüten. Man gibt mir Schuld, ich bekümmere mich um nichts. Ich weiß aber wohl ein anderes. Meine Räte dürfen nichts tun ohne mein Wissen. Was wollen wir nun machen bei der Wahl? Was wollen wir nun tun? Was ich nicht lieben kann, das lasse ich liegen. Was soll ich allein tun? Ein Mann kein Mann!«
So sind die Äußerungen des Kurfürsten. Es hätte kaum der Bemerkung Dohnas bedurft, daß, als er sich so aussprach, der Wein ihn schon etwas erhitzt hatte. »Man bemerkte aber bald«, so schließt der Graf seinen Bericht über diese Gesandtschaft, »daß diejenigen, welche beim Kurfürsten die eigentliche Leitung dieser Angelegenheiten in den Händen hatten, auch bereits Partei genommen, und man konnte auch bald bemerken, daß man bei Hofe sehr gern hörte, wenn es den böhmischen Ständen übel ging. Man ist insgemein an diesem Hof sehr ruhmredig und doch wird gemeinhin schier mehr von Saufen und Fressen und von Jagden als von andern Sachen discurrirt.«
Bald nach Dohnas Rückkehr wurde zu Frankfurt trotz der Protestation der Böhmen die Kaiserwahl am 28. August vollzogen und Ferdinand als römischer Kaiser ausgerufen. In dem Augenblick, als die Wahl öffentlich verkündigt ward, traf die Nachricht ein, daß Ferdinand von den Böhmen des Königtums entsetzt und bald darauf die böhmische Krone in einer Versammlung der Stände zu Prag dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zuerkannt worden.
Graf Dohna verweilte während dieser Tage zu Amberg, um die Verwaltung seiner Besitzungen zu regulieren, seine Angelegenheiten zu ordnen und sich vom diplomatischen Geschäftsleben zurückzuziehen. Bereits war seine Vermählung mit der jungen Gräfin von Solms beschlossen. Da erhielt er vom Kurfürsten Friedrich die Aufforderung, nach Heidelberg zu kommen. Dort angelangt, wurde er vom Fürsten von Anhalt von der Nachricht über die böhmische Königswahl in Kenntnis gesetzt und ihm mitgeteilt, es sei infolgedessen eine eilige Gesandtschaft nach England notwendig; der Kurfürst sei überzeugt, der Graf werde ihm bei dieser Angelegenheit zu Diensten stehen, obgleich er nicht verkenne, welch große Beschwerden ihm diese Sendung verursachen werde. Dohna erklärte sich bereit, obwohl ungern. Er wurde in Eile mit der nötigen Instruktion versehen. Auch die Kurfürstin händigte ihm ein Schreiben an ihren Vater ein, »worin sie als eine gehorsame Tochter Seiner Majestät die böhmische Sache zu Gemüte führte, weil er früher unter gewissen Bedingungen sich seinen Kindern zum Beistand erboten und diese Bedingungen jetzt fast alle erfüllt seien«.
Dohna trat am 29. August die Gesandtschaftsreise an. In Haag benachrichtigte er den Prinzen Moritz von Oranien, wie es mit der Königswahl zu Prag zugegangen sei und die Nachricht davon den Kurfürsten mehr betroffen und betrübt gestimmt, als erfreut habe. Der Prinz dagegen schien zufrieden, forderte den Grafen auf, seine Reise aufs möglichste zu beschleunigen, und versprach, er wolle selbst die Sache schon aufs beste und in gebührenderweise bei den Generalstaaten anbringen. Auf seine Frage, ob auch alle Stände in die böhmische Wahl wohl eingewilligt? antwortete Dohna: Nicht nur die böhmischen Evangelischen, sondern auch etliche katholische Stände, nebst denen in Mähren, Schlesien und in der Lausitz hätten eingestimmt. »Cela est quelque chose«, entgegnete der Prinz. Als er dann fragte: Was die Prinzessin-Kurfürstin dazu gesagt habe? und der Graf erwiderte, die Prinzessin habe geäußert, sie wolle für die Sache alle ihre Kleinodien versetzen und verkaufen, lachte der Prinz und sagte: »Cela n'est pas assez.«
Der Graf ging dann in Rotterdam zu Schiff. Schon bei Briel aber ließ es der betrunkene Schiffskapitän auf eine Sandbank laufen, und Dohna geriet dabei in große Lebensgefahr, langte jedoch glücklich in London an. Er ließ sich sofort beim König melden. Hören wir ihn selbst: »Ich fand den König zu Bagshot. Er gab mir zwar gnädige Audienz; wie er aber von der Wahl seines Eidams hörte, war er ganz heftig wider uns gesinnt, also daß er sich nicht wollte erbitten lassen, sich der böhmischen Sache anzunehmen. Seine ersten Worte waren: ›N'espérez pas de retourner sitot en Allemagne.‹ Ich brachte vor, daß Ihrer Königlichen Majestät Eidam wegen der Wahl sich nicht resolviren könnte ohne Seiner Königlichen Majestät Rat und um denselben bäte. Des Königs Antwort war: Er wolle sich bedenken.«
Dohna war wegen der nichtssagenden Antwort, noch mehr aber wegen der Kälte und kurzen Abfertigung, womit der König die Sache aufgenommen, höchst verstimmt und mißmutig, umsomehr, da er sicher gehofft hatte, eine so wichtige Gelegenheit, seinen Kindern und der ganzen evangelischen Lehre so treffliche Beförderung zu erweisen, werde der König als »Protector fidei« nicht aus den Händen lassen. Zu dieser trüben Stimmung kam noch der Unfall, daß er auf der Jagd im vollen Rennen vom Pferde stürzte, weil er sich auf den losen englischen Sätteln nicht erhalten konnte. Nach seiner Heilung begab er sich mit dem König nach Windsor und bat abermals um Entscheidung wegen Hilfe für seinen Herrn, jedoch wiederum ohne Erfolg. Der Herzog von Buckingham, beim König von großem Einfluß, gab zwar tröstende Worte, allein sie blieben erfolglos. »Ich habe bald gesehen,« sagt Dohna, »daß ich anfangs des Königs Natur nicht genug erkannt, weil er teils aus Furcht der Gefahr und wegen der großen Kriegskosten das Haus Oesterreich nicht wollte vor den Kopf stoßen, teils auch aus Eifer gegen den Eidam und die Tochter Bedenken trug, dem Werk unter Augen zu gehen. Ich fand auch bei dem Minister wenig Unterstützung, außer bei einigen Freunden, die mir nach Möglichkeit beistanden. Übrigens nannte man bei Hof und überall meinen Herrn König von Böhmen und der Fourier schrieb auf die Thür meines Zimmers: ›Ambassador from the King of Bohemia.‹ Allein beim König konnte man nichts erhalten. Er hatte am spanischen Hofe anzeigen lassen, England habe mit den Böhmen keine Gemeinschaft.« Am 22. September erhielt Graf Dohna von seinem Hofe die Nachricht, der Kurfürst habe auf dringendes Anhalten der böhmischen Stände die Krone Böhmens angenommen, ohne die Genehmigung und den Rat des Königs von England abzuwarten. Es kam ihm zugleich der Befehl zu, dies dem König anzuzeigen und ihm ein zugesandtes Schreiben des Kurfürsten zu überreichen. Dieses Schreiben übersandte Dohna zuerst. Da es aber vom kurfürstlichen Sekretär in deutscher Sprache abgefaßt war, so kamen der König und seine Räte auf die Vermutung, nicht der Kurfürst, sondern Dohna selbst habe das Schreiben abgefaßt und dazu ein Blankett des Kurfürsten benutzt. Diese völlig ungegründete Annahme und der Umstand, daß sein Eidam ihn erst wegen Annehmung der Krone um Rat gefragt und sie nun dennoch ohne seinen Rat angenommen, hatte den König mit solcher Erbitterung erfüllt, daß er den Grafen bei einer von diesem erbetenen Audienz lange Zeit wie ganz unbeachtet im Garten stehen ließ, während er den erst später angekommenen sardinischen und spanischen Gesandten Zutritt gestattete. Diesem ließ er ein neues Schreiben an den König von Spanien überreichen, worin er abermals erklärte: England habe mit der böhmischen Sache durchaus nichts zu schaffen; er habe seinem Schwiegersohn genug abgeraten; jetzt, da er nicht gefolgt, sei es seine Sache, seine Handlungen zu verantworten.

Axell, Nürnberg im 17. Jahrhundert. Kupferstich
Graf Dohna ging inzwischen im Garten auf und ab, wie er sagt, »mit Scham und Verdruß«. Endlich wurde er in eine Galerie gerufen, wo sich der König mit mehreren seiner Räte befand. Kaum war er eingetreten, so fuhr ihn dieser mit barschen Worten an, beschuldigte ihn geradezu einer unverantwortlichen Unredlichkeit in betreff des deutschen Schreibens und fügte dann hinzu: Wenn man seinen Rat mit Ernst begehrt hätte, so würde man ihn ja wohl haben abwarten können; nun aber sehe er, sein Eidam habe sich übereilt und ihm als seinem Vater die gebührende Ehrerbietung mit Erwartung seiner Meinung nicht erwiesen, und so möge er nun sich selbst helfen, wie er könne. Endlich fand am 26. September noch eine letzte Audienz statt, worin Dohna an die Vorgänge bei seiner letzten Anwesenheit in England und an die Bedingungen erinnerte, die damals der König in betreff seiner Unterstützung gestellt, an die sich der Kurfürst bisher auch gehalten und wonach er gehandelt habe. Allein der König antwortete darauf nichts von Bedeutung; er trug dem Grafen nur auf: »Er solle nach seiner Rückkehr dafür sorgen, daß ihm, dem Könige, die Fundamenta der böhmischen Stände, worauf sie ihre Wahl gegründet und was zur Beweisung diene, daß sie eine rechte Sache hätten, aufs allererste zur Hand gebracht und überschickt würden.« Darauf verabschiedete er den Grafen, jedoch auf milde und ehrenvolle Weise.
Dohna reiste über Calais und Laon nach Sedan, wo er dem ihm befreundeten Herzog von Bouillon, in dessen Familie der Kurfürst Friedrich erzogen worden, einen Besuch abstattete. Der Herzog riet ebenfalls, der Kurfürst möge sich, wenn er die böhmische Krone auch schon angenommen habe, mit der förmlichen Krönung nicht übereilen. Während aber Dohna noch dort verweilte, überbrachte ein Postreiter aus Heidelberg ein Schreiben des Kurfürsten an den Herzog mit der Nachricht, der Kurfürst habe sich, durch eine Aufforderung nach der anderen von den böhmischen Ständen gedrängt, entschließen müssen, möglichst bald mit seinem Hofe nach Böhmen abzugehen. Dohna beschleunigte jetzt seine Rückkehr nach Heidelberg. Hier angelangt, fand er alles wegen des bereits erfolgten Abgangs des Hofes in großer Trauer, besonders Friedrichs Mutter, die Kurfürstin Luise Juliane, die vergebens ihren Sohn mit Tränen gebeten, das gefährliche Geschenk der Königskrone zurückzuweisen, und nun in bangen Sorgen über die Schritte ihres Sohnes auf einer so schlüpfrigen Laufbahn sich nicht trösten konnte, so daß sie bedenklich erkrankte. Selbst die Kurfürstin, die ihr England mit trockenem Auge hatte verlassen können, hatte der Abschied von Heidelberg viele Tränen gekostet.
Nach kurzem Aufenthalt eilte Dohna nach Böhmen, wo er den Kurfürsten nun als König mit dem ganzen Hofstaat auf dem Schlosse Wischerad in der Nähe von Prag fand und vom Könige sehr huldvoll empfangen wurde. Dieser ließ ihm noch am Tage seiner Ankunft durch den Oberstkämmerer Herrn von Ruppa den goldenen Kammerherrenschlüssel überbringen. Auch die Königin gab ihm Beweise ihrer freundlichen Gesinnung; doch macht Dohna bei dieser Gelegenheit die Bemerkung: »Die königliche Prinzessin hat unter anderen auch den Mangel gehabt, daß sie immer zu viel mit Hunden und Meerkatzen umgegangen ist.«
Er wohnte am 4. November der mit vielem kostbaren Gepränge vorgenommenen Krönung des Königs in der Domkirche zu Prag bei und am 7. November auch der der Königin. Man hat es nachmals bemerklich gefunden, daß an seinem Krönungsfest der König bei Tafel die Krone auf dem Haupte gehabt, weil sie ihm aber zu schwer geworden, habe er sie neben sich auf die Tafel setzen lassen. Viele Aufmerksamkeit erregte bei dem Feste der kostbare Kleiderschmuck des Grafen Erdödy, den der Fürst Bethlen Gabor von Siebenbürgen, dieser Erbfeind von Österreich, als Gesandten zur Begrüßung Friedrichs geschickt hatte. Dieser Fürst, nach der ungarischen Krone lüstern, hatte vorzüglich auch Friedrich zur Annahme der böhmischen Krone ermuntert, sich bereits in Mähren mit dem böhmischen Kriegsvolk unter den Grafen von Hohenlohe und Thurn vereinigt und, nachdem er sich in Oberungarn schon fast aller festen Plätze bemächtigt, war er in Österreich eindrungen und stand in denselben Tagen, als Friedrich in Prag gekrönt wurde, beinahe vor den Toren von Wien.
Der glanzvolle Krönungstag zu Prag war aber der Höhepunkt von Friedrichs trügerischem Glücksstern und seit diesem Tage schon begann sein Niedergang.
Dohna spricht sich über die damaligen Verhältnisse in Böhmen also aus: »Man hat damals immer fleißig Rath gehalten über die schweren Sachen der Zeit; aber besser, man hätte mehr Freigebigkeit und weniger Sorge in Haussachen bewiesen; denn ich habe wohl erfahren, daß verständige Leute nicht die geringste Ursache all' ihres Unglücks dem Geiz und der Kargheit zugeschrieben. Des Königs Volk wurde nicht bezahlt und fing bald an, sich sehr zu beklagen. Die böhmischen Stände, von denen wenig oder keine Bezahlung erfolgte, wollten dies Alles dem Könige aufbürden; dieser aber wollte mit der Bezahlung auch nichts zu tun haben, sondern nur besondere Regimenter, die er durch den Herzog von Weimar, den jungen Fürsten von Anhalt und andere anwerben lassen, besolden. Der ältere Fürst von Anhalt hielt auf eigene Kosten besondere Truppen und hatte dabei das Generalkommando in Böhmen, opferte Alles der böhmischen Sache auf und hat Land und Leute, Gemahl und Kinder in die Schanze geschlagen, sodaß es wol nicht zu verwundern, wenn er hernach andere Rathschläge gefaßt und nicht allein mit Kurpfalz und dem König von Böhmen alle Correspondenz abgeschnitten, sondern sich auch ganz zum Kaiser gewandt. Aus dem Mangel an Bezahlung aber und aus der Unordnung bei den böhmischen Truppen ist späterhin alles Unheil entstanden. Die Compagnien wurden schwächer, die Befehlshaber unwillig, das ganze Lager verdrossen und mehr zu Aufruhr als zum Dienst oder Kämpfen geneigt. Die Böhmen meinten, sie hätten genug getan, daß sie einen König erwählt; der möge nun zusehen, wie er sich und das Volk erhalten könne. Die beiden Generale aber, die Grafen von Hohenlohe und von Thurn hatten nicht allein kein Vertrauen zueinander, sondern einer haßte den anderen und einer redete dem anderen übel nach. Der von Thurn war bei dem Volke geliebt, sonderlich bei den Böhmen und Mähren, weil er die Sprache kannte und nebst seinem Sohn unter ihnen geboren und erzogen war. Der von Hohenlohe hatte mehr Ansehen bei den Deutschen und Niederländern im Lager und ging dem von Thurn vor, weil ihm der Vorzug gegeben worden, welches zwar der von Thurn geschehen lassen, aber wie gern er es gesehen, kann Jeder denken. Die Landoffiziere, deren in allem elf waren, sieben vom Herrenstand und vier von der Ritterschaft, hatten auch die Erfahrung und den Eifer nicht, der zur Sache nötig, und erinnere ich mich, daß, als ihnen einmal zur Bezahlung des Kriegsvolkes nicht allein mit barem Geld, sondern auch mit Kleidern, Tuch, Schuhen und dergleichen von wohlhabenden Kaufleuten annehmliche Vorschläge geschahen, einer von ihnen, den man für den Verständigsten gehalten, dies Alles abwies, also daß man sah, diese guten Leute hatten zwar die Hand an den Pflug gelegt, wiesen aber Alles auf die Seite; denn sie hatten mit halbem Gelde geistliche Güter an sich gebracht, wollten wol Krieg führen, jedoch ihre eigenen Mittel und Schätze dabei nicht angreifen. Unterdessen lebte man am Hofe zu Prag in Saus und Wohlleben und ließ den General, Fürsten von Anhalt, sich mit dem unwilligen und unbezahlten Kriegsvolk plagen und abmatten. Ich für meine Person hatte zwar die Ehre, daß seine königliche Majestät mich in ihren Geheimen Rath berufen ließ, wo ich denn den angelegensten Geschäften beigewohnt habe und bei dem Könige und der Königin in Gnaden gewesen; aber ich konnte die Gefahr, in der wir alle waren, doch nicht ganz ermessen.«
Im Januar 1620 trat Friedrich, um sich die Huldigung leisten zu lassen, eine Reise nach Mähren und Schlesien an, auf der ihn Dohna begleiten mußte. Er machte jedoch auch hier wenig erfreuliche Erfahrungen. Überall fand er laue Gemüter, die Ämter mit Menschen ohne Kenntnisse und Ansehen besetzt, die wichtige Stelle des Oberlandeshauptmanns von Mähren in den Händen eines heftigen, unbesonnenen und unwissenden Mannes, der, dem Trunke ergeben, ein wüstes, ruchloses Leben führte. In Brünn angelangt, beschloß der König an die Generäle und Stände eine Ansprache zuhalten. »Als nun Seine Majestät«, so berichtet Dohna, »eines Morgens bereit war, die Herren anzureden, und ich bei ihm im Gemach allein, hat Seine Majestät versucht, die Rede auswendig mir vorzusagen, ob er auch Alles wohl behalten. Hierauf hat er die gemeldeten vornehmen Herren mit einer so guten und auf diese Zeit accomodirten Rede angesprochen, daß sie solche nicht genug loben konnten. Allein die mährischen Herren sahen bei der Annehmung des Königs nur auf die äußerlichen Dinge, auf die Union, des Königs von England Verwandtschaft, auf der Staaten Bündnis und hingen ihm nur so lange an, als sie glaubten, er habe englische Unterstützung zu erwarten. Jeder sah nur auf seinen eigenen Nutzen, hoffte auf Belohnung vom Könige und die evangelisch waren, auf Gelegenheit, den Päpstlichen etwas abzuzwacken, um sich groß zu machen.«
Aus allen diesen Verhältnissen erkannte Friedrich immer mehr, daß er, um sich in seiner Stellung zu behaupten, fremde Hilfe suchen müsse. Er hoffte immer noch auf Unterstützung von seinem Schwiegervater und rechnete auf den Beistand des Fürsten von Siebenbürgen. Er beschloß, von Brünn aus an beide Gesandte zu schicken. Bethlen Gabor hatte im Anfang November des vorigen Jahres seine Truppen, mit denen des Grafen von Thurn vereinigt, bis in die Nähe von Wien vorrücken lassen, dann sich aber unerwartet von Thurn getrennt, und nachdem er mit dem Kaiser einen Waffenstillstand abgeschlossen, war er nach Oberungarn zurückgezogen. An Friedrichs Hof erregte dies großes Befremden; niemand begriff, was den Fürsten zu diesem Verfahren bewogen habe. Graf Dohna fand den Grund darin, daß der Fürst, mit Friedrich unzufrieden, es besonders übel aufgenommen habe, daß ihm dieser, da er ihm doch den Grafen Erdödy zur Gratulation gesandt, nicht einen Gegengesandten zugeschickt habe, was er als eine Ehrenkränkung angesehen. »Außerdem«, fügt er hinzu, »gab es am kaiserlichen Hof Leute, die des Fürsten Natur und seine Räte kannten und mit Geschenken und Verheißungen zu gewinnen gewußt, sonderlich weil er von Natur zum Geiz geneigt und auch wohl gesehen hat, daß er bei uns wenig zu erlangen, vom kaiserlichen Hofe aber großen Nutzen und Freigebigkeit würde zu erwarten haben.« Ob Friedrich die versäumte Höflichkeit jetzt noch nachholen wollte? Er beschloß jedenfalls, von neuem seine Hilfe anzusprechen und übertrug die Gesandtschaft dem Grafen Dohna.

Nützel, Kurfürstlicher Ornat. Johann Georg Markgraf von Brandenburg. Kupferstich
Noch in strenger Winterszeit, bei heftiger Kälte trat dieser sogleich von Brünn aus die Reise nach Ungarn an. Die ungarischen Magnaten, meist Reformierte, nahmen ihn überall sehr freundlich auf. Vor allen zeichnete sich durch Gastfreundschaft der ungarische Palatinus Graf Thurso auf dem Schlosse Besiercze in der Gespanschaft Trentschin aus, wo er einen wahrhaft fürstlichen Hofstaat hielt. Er beschenkte den Grafen mit einem kostbaren Pelz und riet ihm, auf seiner Reise durch Ungarn, seiner eigenen Sicherheit wegen, seine deutsche und französische Kleidung abzulegen und sich nur im ungarischen Pelz ohne Kröse und Überschläge sehen zu lassen. Auf seiner Reise über Rosenberg, Leutschau und Eperies fand Dohna überall, daß man nicht dem Kaiser, sondern dem Fürsten Bethlen Gabor und den Ständen Gehorsam erzeigte und überall sprach man von jenem mit höchster Achtung, Stolz und Begeisterung, nannte ihn als Oberherrn von Ungarn »Hungariae et Transsylvaniae Principem«, welchen Titel er sich auch selbst beilegte; allenthalben priesen ihn die ungarischen Großen als den tapfersten Kriegshelden und erzählten von seinen 42 Schlachten und Gefechten, denen er beigewohnt habe. Am 20. Januar kam Dohna in Kaschau an, wo der Fürst damals seine Hofhaltung hatte. Nachdem er ihm seine Ankunft gemeldet, wurde er am folgenden Tage zur Audienz gerufen und in einem prächtigen Staatswagen mit sechs weißen, mit rotem Samt bedeckten Pferden, begleitet von 500 in Blau gekleideten Schützen von der Leibgarde, in das fürstliche Schloß abgeholt. »Nachdem ich«, so berichtet Dohna, »dem Fürsten meine Reverenz bezeigt, brachte ich Lateinisch meine Werbung an, zuerst einen Glückwunsch, dann die Einladung zur Gevatterschaft bei einem Sohn, der dem König geboren war, und endlich wegen Hülfe und Beistand in der böhmischen Sache. Der Fürst hatte in seinem Gemach Niemand mehr bei sich als seinen Bruder Graf Stephan, einen anderen Herrn, der seiner Gemahlin Bruder und ein Papist war, und seinen Kanzler, seines Glaubens ein Arianer, durch welchen er mir in lateinischer Sprache antworten ließ, mit Erbietung, von den Sachen ferner noch mit mir zu deliberiren und zu communiciren, wie auch nachmals geschah. Er ließ mich darauf nicht allein an seiner runden Tafel mit sich essen, sondern auch in seine Kammer kommen, wo er selbst in lateinischer Sprache oder durch seinen Hofprediger Petrus Alointus, wenn ihm das Latein zu schwer wurde, mit mir vernünftig discurirte.«
Der Fürst sprach viel und gern von seinen zahlreichen Schlachten und schilderte dabei auch die vornehmsten ungarischen Magnaten, besonders den päpstlich gesinnten Esterhazy, den er aber sehr schmähte. Dohna erfreute sich während seines Aufenthaltes am fürstlichen Hofe großer Auszeichnung und wurde täglich beim Fürsten zur Tafel geladen. Bei seinem Abschied am 26. Februar erhielt er vom Fürsten als Ehrengeschenk einen mit Türkissen besetzten türkischen Säbel.
Über den Erfolg seiner Gesandtschaft hat Dohna nichts weiter mitgeteilt. Sie hatte auch keinen wesentlichen Einfluß auf Friedrichs fernere Schicksale.
In Prag folgten bald nach Dohnas Rückkunft und nachdem im März auch der König von seiner Huldigungsreise aus Schlesien zurückgekehrt war, ein Freudenfest nach dem anderen und Hofvergnügungen aller Art, wie der König und die Königin sie liebten. Nachdem noch im März (1620) ein Generallandtag in Prag gehalten war, wo ein Bündnis zwischen Böhmen einer- und dem Königreich Ungarn andererseits, mit dem vom Fürsten Bethlen Gabor gesandten Grafen Thurso abgeschlossen wurde, fand zuerst die feierliche Taufe des am 27. Dezember 1619 geborenen Prinzen Ruprecht mit großem Aufwand statt. Der Graf, der seines Fürsten Patenstelle dabei vertrat, übertraf fast alle Fürsten durch seinen überaus glänzenden, reichen Schmuck. Dann folgte Dohnas Hochzeit mit der Gräfin Ursula von Solms im königlichen Schloß, an der auch der König, die Königin, der Herzog von Lauenburg, der Markgraf Johann Georg von Jägerndorf, Herzog Wilhelm von Weimar, Fürst Ludwig von Anhalt, des Königs Bruder Pfalzgraf Ludwig Philipp, der ungarische Magnat und der ganze übrige Hof teilnahmen. Auch dieses Fest war ebenso glänzend als freudevoll. Wenige Tage darauf wurde des Königs ältester Sohn Heinrich Friedrich zum böhmischen Thronfolger designiert oder, wie sie es nannten, als »Crekanetz«, Erwarter oder Expektant der Krone angenommen. Da dem König zuvor gemeldet wurde, die Stände würden ihm dies persönlich anzeigen, erhielt Graf Dohna den Auftrag, dem erst sechsjährigen Prinzen an die Hand zu geben, was er bei der Feierlichkeit zu sagen und zu antworten habe. So konnte man unter Festlichkeiten und rauschenden Vergnügungen am Hofe ganz vergessen, welch' drohende Gefahren aus schweren Gewitterwolken bevorstanden und wie ernst die Zeit mahnte.
Graf Dohna hatte mit seiner jungen Gemahlin einen Teil des Frühlings und den Sommer hindurch auf seinen Gütern in der Oberpfalz gelebt. Erst im August nach Prag zurückgekehrt, ward er zum Oberkammerherrn ernannt. Aber schon zog das Ungewitter immer näher. »Der kaiserliche General Bouquoi«, erzählte Graf Dohna, »rückte mit der österreichischen Armee vor und man erhielt Nachricht, daß das kaiserliche Lager sich näher nach Prag heranziehe. Dies bestimmte den König Friedlich mit seinen Truppen aus Prag aufzubrechen (am 28. September) und den Oesterreichern entgegenzugehen. Er begab sich zunächst nach Cochowitz auf das dortige schöne Schloß. Hier erhielt er Nachricht, daß sein Lager in der Nähe sei. Da sandte er mich an den Obergeneral Fürst Christian von Anhalt, um zu ermitteln, wo am füglichsten eine Vereinigung der Armee zu bewirken sei. Ich habe das Lager im Fortziehen angetroffen, aber den Fürsten nicht so bald sprechen können, weil das Lager groß und der Zug zwei Meilen lang war. Erst gegen Abend habe ich den Fürsten gefunden und bin dann in der Nacht zum König zurückgekommen. Wir brachen nun auf, haben uns aber von unserem Troß ganz verirrt, sodaß der König in der Nacht in einem Dorfe bleiben mußte, und da sein Bette und anderes Geräte nicht bei der Hand war, mußte er sich behelfen, wie er konnte. Nachdem wir darauf bei Stenkwitz ins Lager gekommen, zogen wir weiter und kamen am 9. Oktober mit dem Lager nach Rokizan. Die böhmischen Landoffiziere wollten nichts Anderes hören als von Sieg und verlangten, man solle doch schlagen. Man hat da lange gelegen. Am 21. Oktober sind wir mit dem Könige und unserer Reiterei durch viele Wälder, Berge und Täler nach dem feindlichen Quartiere geritten, um dem Feinde einen Einfall zu thun, haben aber den Weg verfehlt und mußten unverrichteter Dinge wieder zurückziehen. Der Zustand unseres Lagers und die große Macht des Feindes, der auf eine Stunde von uns lag, waren Ursache, daß wir unsere Schanze wohl wahrnehmen mußten. In unserem Lager aber hatten wir böse Bezahlung; daher kam es, daß man Niemand strafte und weil keine Strafe erfolgte, wurde das Volk mutwillig. Hingegen hielt der Feind in seinem Lager strengen Gehorsam und war mit Waffen gut versehen. Unsere Reiter warfen oft die Waffen aus Feigheit und Ungeduld weg; die kaiserlichen aber waren gut armirt und uns überlegen.«
»Bald darauf ging der König nach Prag zurück und ich mit ihm. Er begab sich aber kurz nachher wieder ins Lager bei Rakonitz näher bei Prag und ich wiederum mit ihm. Da war der Feind schon ganz nahe bei uns, sodaß unser Volk mit ihm zu scharmützeln anfing. Wir hatten unsere Stücke auf einer Höhe und gaben Feuer auf das feindliche Volk. Am 29. Oktober schickte mich der König nach Prag, um mit den königlichen Landoffizieren dort wegen der Provision und der nötigen Geldmittel zur Bezahlung der Truppen zu verhandeln, zugleich aber auch, um die Königin zur Abreise nach Schlesien zu bewegen, weil die Gefahr täglich überhand nehme, der Feind sich mit aller seiner Macht der Stadt Prag nähere und diese sperren könnte. Allein die böhmischen Stände wollten die Königin nicht abreisen lassen, und sie selbst ward auch unwillig, daß von einer Flucht die Rede sei« ...
Über die Ereignisse nach der Schlacht bei Prag gibt Dohna folgenden Bericht: »Am 8. November geschah die Schlacht vor Prag, da unser Volk die Flucht ergriffen. Der König war eben hinaus nach dem Lager geritten, kam aber bald wieder zurück, weil er schon am Stadtthor den Verlust vernommen. Ich war etlicher Geschäfte halber im Schlosse geblieben. Da kam des Königs Stallmeister Obentraut und zeigte mir an, daß ich der Königin anzumelden hätte, daß sie sich hinüber in die alte Stadt über das Wasser in sicheren Verwahrsam begeben solle. Die Königin aber wollte sich dazu nicht bewegen lassen. Bald darauf kamen der König, der Fürst Christian und alle die Herren ins Schloß, und man zog nun hinüber in die alte Stadt, der Hoffnung, daß man da sicherer sein könnte. Die Nacht über ritt ich oft zum Fürsten Christian und auch oft zum König. Krone und Scepter wurden diesem in die alte Stadt gebracht, der sie den Landoffizieren wiedergab. Des Morgens (9. November) zogen wir von Prag aus nach Nimburg hin an der Elbe. Da wurde über den Verlust der Schlacht viel discurirt. Hierauf kamen wir nach Jaromierz. Daselbst wollten die Soldaten des Königs Rüstwagen und Schatz anhalten, um sich ihre Bezahlung zu verschaffen. Man mußte ihnen eine Schrift ausfertigen, daß sie in Breslau Geld erhalten sollten; deswegen lag man einen Tag still. Hernach reisten wir nach Glatz. Die Königin und der ganze Hof haben den großen Schrecken mit vieler Standhaftigkeit ertragen, auch hat jene nie ein ungeduldiges Wort hören lassen, obgleich sie auf der Reise sehr großes Ungemach ausgestanden. Weil sie aber in ihrer letzten Zeit ging, hat man für gut geachtet, sie solle nach der Mark Brandenburg oder auf Halle zu ihrer Base ziehen, um da ihr Kindbette abzuwarten. Mir wurde anbefohlen, der Königin aufzuwarten. Man gab uns 60 Reiter zu.«
»Am 17. November zogen wir weiter nach Breslau zu, wo wir wohl empfangen und logirt wurden. Dann ging die Fahrt in großem Schnee auf Neumarkt, Liegnitz, Polkwitz, Reuthen, Grünberg und Krossen nach Frankfurt an der Oder, wohin ich überall vorausgeschickt und Alles so bestellt hatte, daß wir ziemliche Herberge fanden. Nach Berlin hatte ich, weil der Kurfürst und die Kurfürstin damals in Preußen waren, an die Räte geschrieben mit der Bitte, daß die Königin zu Küstrin eine Wohnung haben möchte, um ihr Kindbette da abzuwarten. Man schlug es zwar gar höflich ab, aber ich ließ ein deutsches Schreiben in der Königin Namen an die Räte abgehen, wie daß Ihre königliche Majestät nicht anders könne, sondern ziehe gerade auf Küstrin zu. Dies geschah auch, also daß wir am 8. December zu Küstrin wohlankamen, wo die Räte durch etliche Abgeordnete die Königin willkommen heißen und ihr allerhand gute Beförderung tun ließen. Der König hielt sich noch einige Zeit in Breslau auf, kam dann ebenfalls nach Küstrin und fertigte den Grafen von Hohenlohe ab, auf Dresden zu ziehen. Fürst Christian von Anhalt zog nach der Mark Brandenburg.«
Graf Dohna blieb noch eine Zeitlang in Küstrin, weil er nicht wußte, ob der König seiner Dienste ferner noch bedürfe. Er unterhielt auch einige Zeit noch fleißige Korrespondenz mit ihm und begab sich hierauf nach Preußen zu seinen Verwandten. Damit endigt sein vieljähriges Hof- und Gesandtschaftsleben. Er war zuletzt Gouverneur zu Oranien, starb am 13. Juli 1637 und hinterließ sieben Söhne und fünf Töchter.
Verzeichnis der Tafeln. [Als Bildunterschriften eingepflegt. Re. für Gutenberg]
Die Abbildungen sind nicht eigentlich als Illustrationen des Textes gedacht, sondern wollen durch Darstellung typischer Repräsentanten, von Baulichkeiten und Gesellschaftsszenen der deutschen Renaissance ganz im allgemeinen die Atmosphäre um Fürsten und Fürstenhöfe des sechzehnten Jahrhunderts schildern.