
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Pour bien mourir il ne faut que
bien vivre.
Aus Clerichs ungedrucktem Stammbuch auf der Bibliothek zu Weimar
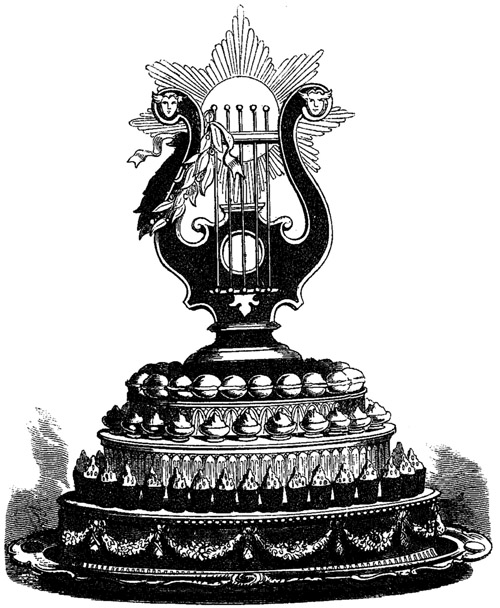
Die Peripatetiker und die Akademiker haben sich nicht soviel Mühe gegeben, die Sitten zu verbessern, wie die Köche zur Befriedigung des Gaumens. Immer neue Soßen, immer neue Ragouts! Die Franzosen, durch das ewige Fleischessen ennuyiert, haben die Mittel gefunden, die Knochen zu mahlen, die Tiere zu trocknen und zu dörren und daraus neue Gerichte zu bereiten.
Welche Wege hat die Kochkunst gemacht, um dahin zu gelangen! Ich möchte wohl eine Geschichte der Kochkunst von Homer bis zur gegenwärtigen Zeit schreiben, fehlte es mir nicht an fast allen dazu notwendigen Kenntnissen.
Von welcher Einfachheit in Speisen die Alten überhaupt waren, erfahren wir aus Homer, wo Achill und Patroklus die Mahlzeit bereiten, wenn sie Ulysses und Ajax empfangen.
In der Heiligen Schrift findet man auch, daß Sarah Brot buk und Abraham kochte, obgleich sie eine große Anzahl von Knechten und Mägden hatten. So herrschte bei den Römern lange Zeit die Sitte, daß die vornehmsten Römerinnen in ihren Häusern ihr Brot selbst bereiteten. Aber von dieser Einfachheit gingen sie nach und nach so weit ab, daß sie zuletzt bei Tische sechserlei Brot hatten, ja dieses sogar im Felde nicht gern entbehren wollten, wie Vegetius (in den »Institutiones rei militaris«) nachweist. Von den Hebräern erfahren wir, daß Davids Soldaten getrocknete Feigen und Rosinen (1. Samuel, 30. Kap., 12. Vers) mit sich führten; ebenso, daß Abigail außer Brot, Wein und Fleisch, welches sie dem David bestimmte, dem Heere fünf große Maß Polenta, Rosinen und Feigen gab. David selbst bringt seinen im Felde stehenden Brüdern Polenta und Brot, dem Hauptmann aber zehn Käse mit, was bei mir zu Lande höchstens dem Feldwebel geboten werden kann. Die Polenta war getrocknetes Gerstenmehl, von welchem Ruellius sagt, es sei das gewesen, was die Griechen Alphita nannten. Plinius beschreibt dies Gericht, welches der italienischen Polenta ganz gleich ist. Von den Römern sagt Lipsius (in seiner Abhandlung De re militaria), daß jeder römische Soldat einen Beutel mit sich führte, worin er für dreißig Tage Speise hatte. Dies wird unserem Militär, welches höchstens für fünf Tage Brot, sogenannten eisernen Bestand, mit sich führen kann, unglaublich vorkommen. Indes sagt Cäsar, daß Soldaten oft für zweiundzwanzig Tage Lebensmittel mit sich trugen. Im 29. Buche des Livius finden wir, daß die römischen Soldaten eine Art Zwieback hatten, welcher, wie wir aus anderen Schriftstellern wissen, einen Finger groß war, im Wasser aber zwei Fäuste groß wurde. Plutarch erzählt, daß eine Armee des Antonius viel Entbehrungen litt, weil ihr dieser Zwieback ausgegangen war, und sie auf keine andere Weise sich im Felde zu ernähren verstand. Merkwürdig ist, daß Prokop erzählt, daß die Vandalen, diese sehr rohen Völker, sich einer Art Zwieback bedienten, welcher sich monatelang hielt und nicht der Verderbnis ausgesetzt war.
Die Kochkunst stammt ursprünglich aus Asien; bei den Griechen war sie zuerst nur das Geschäft der Frauen, bei den Römern das der Leibeigenen. Nonius (De re cibaria veterum) bemerkt, daß mehr als drei Fünftel von den Freigelassenen, die zu Ehren und Würden gelangt sind, der Kochkunst – so wußte man sie zu schätzen – ihr Glück verdankten. Erst nach den Siegen in Asien lernte man in Rom den Luxus der Tafel kennen. Nun erst erhielt, nach Livius, der Koch, früher im Preise und im Gebrauche der schlechteste Sklave, einen Wert; was Knechtschaft gewesen war, ward nun eine Kunst. Bald bestand die Tafel der Römer aus drei Gängen. Der erste aus Eiern, Austern und anderen die Eßlust reizenden Dingen; dann kam das Haupttreffen, welches die Schlacht, Pugna, Proelium, hieß; endlich das Dessert, Mensae secundae, Obst und Backwerk. Eine Mahlzeit im Saale des Apollo beim Lukullus kostete 50 000 Drachmen (mehr als 10 000 Taler).
Dichter und Philosophen zürnen vergebens dagegen. Wie schwer ist es, zum Bauche zu reden, der keine Ohren hat! ruft der ältere Cato, und fügt hinzu: Ich wundere mich, wie ein Staat bestehen kann, in welchem ein Fisch teurer als ein Ochse verkauft wird. Virgil nennt den Koch (in der »Aeneis«) den boshaften Verführer; Quinctilian – den Magister aller Sünde, und Philo in seinem Buche vom Leben Moses' nennt Hunger und Durst die beiden schweren und gewaltigen Herren des Lebens. Er hatte im Sinne, daß bei der Belagerung von Samaria eine jüdische Frau eine andere anklagte: sie habe mit ihr ihre Kinder gekocht und gespeist, und nun wolle jene nicht die ihrigen zu gleichem Zwecke hergeben.
Virgil sagt in seiner »Georgica«, daß die Menschen früher Eicheln, wie die Schweine, gegessen (und noch besteht die schweinische Gewohnheit der Menschen, aus Eicheln Kaffee zu machen), bis Bacchus und Ceres Wein und Körner eingeführt. Wenn wir Plinius glauben, gab es noch zu seiner Zeit Eicheln fressende Völker, wozu er die Portugiesen rechnet, was Strabo bestätigt. Indes sind diese Nachrichten zu bezweifeln, wenigstens nicht zu buchstäblich zu nehmen, da zu vermuten ist, daß ebenso, wie der Name Pirus sich über alle Arten Äpfel und Birnen erstreckt hat, auch Glans für alle Arten Nüsse, Kastanien, Eicheln gegolten habe; daher noch heute Juglans (Jovis glans), Walnuß, vorzugsweise für die bessere Eichel im Gebrauch ist.
Der Übermut der römischen Großen überschreitet allen Glauben. Ein furchtbares Heer gegen den Feind aufzustellen, bemerkte schon Ämilius Paullus, kostet ebenso viele Geschicklichkeit, als seinen Freunden ein fröhliches Gastmahl zu geben. Vitellius verschwendete bloß mit Essen in einer Zeit von ungefähr sieben Monaten 42 Millionen Taler. Tacitus nennt ihn ganz deutlich ein Schwein. Aber er tut es, indem er statt eines sehr groben Wortes ein sehr schönes Bild setzt (Tacitus, Histor. III, 36). Vitellius ließ unter anderm für ein einziges Diner 7000 Vögel und 2000 Fische zurichten. Kaiser Verus gab (nach dem Julius Capitolinus) ein Abendessen für zwölf Personen, welches nach unserm Gelde eine viertel Million Taler kostete. Jeder Gast bekam den Vorschneider, den schönen Knaben, der ihn bei der Tafel bedient hatte, ja selbst die Schüsseln, auf denen ihm die Speisen vorgesetzt wurden, zum Geschenke. Jedem wurden von den hundert Arten durchaus seltenster Tiere, von denen er bei Tische auch nur gekostet hatte, ein lebendiges Exemplar nach Hause geschickt. Sooft getrunken wurde, erhielt jeder einen frischen Becher von alexandrinischem Kristall oder einen goldenen oder silbernen Pokal, reich mit Edelsteinen besetzt. Die zahlreichen Salbengefäße waren alle von gediegenem Golde; die Blütenkränze der Gäste aus Blüten anderer Jahreszeiten, mit goldenen Bändern umwunden. Als die Nacht mit Würfelspiel hingebracht war, erhielt jeder Gast, um nicht nötig zu haben, zu Fuß nach Hause zu gehen, einen prächtigen Wagen zum Geschenk, samt Kutscher und den Maultieren, deren Geschirr von Silber strotzte.
Heliogabalus begnügte sich damit nicht, seinen Gästen die kostbarsten Gerichte vorzusetzen, sondern ließ auch die Speisen mit den seltensten Steinen und Perlen bestreuen, die den Gästen verblieben. Der Speisesaal war mit den köstlichsten, wohlriechendsten Wassern besprengt und mit ausländischen Blumen ausgeschmückt. Von der Decke regnete es eine so große Menge dieser Blumen, daß einige Gäste erstickten. Es wurden Lose verteilt, wodurch ein Gast zehn Kamele, der andere ebenso viele Bären oder Strauße, ein dritter zehn Pfund Gold erhielt. Seine gewöhnlichsten Leckerbissen bestanden im Gehirn von Flamingos, Pfauen oder Papageien, und Seefische speiste er nur, wenn er von dem Meere sehr weit entfernt war. Vögel, Murmeltiere Die Kunst, Murmeltiere zu mästen, wurde auf den römischen Landgütern als ein vorteilhafter Wirtschaftsartikel betrieben. Die außerordentliche Begierde, mit welcher man sie für die verschwenderischen Tafeln der Reichen suchte, wurde durch ein Verbot der Zensoren nur noch vermehrt. Wie man sagt, sollen sie noch gegenwärtig in Rom geschätzt und als Geschenk von dem Fürsten Colonna ausgeteilt werden. Unter Pompejus erfand Aufredius die Kunst, Pfauen zu mästen, und machte sich binnen einem Jahr damit ein Vermögen von 60 000 Sesterzien. und Fische von ungewöhnlicher Größe wurden an den Tafeln auf Waagschalen gewogen, um die Schwere außer Zweifel zu setzen; Notarien schrieben dies sogleich auf. Plinius bemerkt, daß die Küchen in den Palästen römischer Großen von der Ausdehnung waren wie sonst das Erbgut eines Bürgers. Die Erfindung einer neuen Soße ward unter Heliogabalus auf das freigebigste belohnt; fand sie aber keinen Beifall, so zwang man den Erfinder, die Soße so lange zu essen, bis er eine andere erfunden hatte, die mehr nach dem kaiserlichen Geschmack war. Die Sybariten gaben sogar ein Gesetz, daß, wenn ein Koch ein neues Gericht erfand, es niemand als er im ersten Jahre der Erfindung präparieren dürfe, damit ein Wetteifer unter den guten Köchen nach neuen Gerichten entstände.
Man erzählt sich mit immer frischer Bewunderung von dem Perlenschmuck, womit Kleopatra die Wette von Antonius gewann, der es für unmöglich hielt, daß sie hei einer einzigen Mahlzeit zehn Millionen Sesterzien – 600 000 Taler – verschwenden könnte. Sie hatte in jedem Ohre eine Perle, die beide durch ihre Größe und Vollkommenheit unschätzbar, einzig und mehr als ein Königreich wert waren. Kaltblütig warf sie jetzt die eine davon in eine Schale mit Essig und trank sie aus. Zum Glück war Antonius schon mit dieser Probe zufrieden, sonst wäre die Reihe auch an die andere gekommen. Doch dieser war ein besseres Schicksal bestimmt. Sie kam nach dem unglücklichen Ende ihrer Besitzerin in die Hände Agrippas, des Lieblings von Augustus, der sie in zwei gleiche Teile zerschneiden ließ und dem Venus-Bilde im prächtigsten Tempel Roms, im Pantheon, als den köstlichsten Ohrenschmuck, der in der alten Welt anzutreffen war, anhing. Diese halbierte Perle blieb die Bewunderung Roms.
In Konstantinopel bereitet man für die kaiserliche Tafel ein Konfekt – Djewardir madjonin –, wozu auch Rubinen- und Diamantenstaub genommen wird. Dies Zuckerwerk stammt aus Afrika, und unbezweifelt hat die aufgelöste Perle der Kleopatra die erste Idee dazu gegeben. Dieser geschmacklose Luxus (denn dies Gericht schmeckt schlechter als tausend andere Sorbets und Zuckerwaren, worin die Türken Meister sind) erinnert an das alte Wort: da er es nicht gut machen konnte, so machte er es wenigstens teuer.
Nach dem kindischen Luxus, dem Übermut der Römer des Kaiserreichs, mußte naturgerecht die Barbarei einbrechen – eine neue Ära für das Menschengeschlecht. Wenden wir uns zu den barbarischen Tafelfreuden, so sehen wir, daß schon Mohammed nichts weniger als gleichgültig dagegen ist. Er pries Damaskus, wohin er zwar nicht als Eroberer, aber in seiner Jugend als Kaufmann gekommen war; er nannte es dreimal glücklich, und als ihn seine Jünger um die Ursache fragten, antwortete er: weil die Engel Gottes ihre Fittiche über dasselbe ausgebreitet haben. Aber Damaskus war berühmt wegen seiner Thunfische, Quitten, Zitronen, Feigen und Pflaumen; auch schwört im Koran Gott bei der Feige Sinai, bei der Olive, d. i. Damaskus und Jerusalem. Brussa, vor der Eroberung von Konstantinopel Hauptstadt der Osmanen, war berühmt durch seine Trauben, Maulbeeren, Birnen, von denen es vierzig Arten gab, seine Aprikosen, Kirschen und Kastanien, davon manche allein bis vierzig Drachmen wiegt; Angora durch vortreffliche Äpfel, von denen der Berg Adoreus – Äpfelberg – genannt ist. Datteln und Mehl kamen in vorzüglicher Qualität von Jemame, von Trapezunt Birnen, von Sinope Kirschen. Große Feigen und kleine kernlose Zibeben werden in der Türkei so geschätzt, daß sie Sultaninen genannt werden. Soghd, das Thebasion der Alten, Sitz und Begräbnisplatz des Ertoghrul (des Begründers der osmanischen Dynastie) auf der Straße der Pilgerkarawanen von Konstantinopel nach Mekka, ist durch das Grabmal Ertoghruls nicht berühmter als durch seine sauer eingemachten Weintrauben und seine Knackwürste.
Laut der Vorschrift des Islams wird das Mittagsgebet nicht in dem Augenblick, wo die Sonne in den Meridian tritt, sondern einige Minuten darauf verrichtet, weil, nach einer bekannten Überlieferung des Propheten, im Augenblick des astronomischen Mittags alltäglich der Teufel die Sonne als die Krone der Weltherrschaft zwischen seine Hörner nimmt und damit als Pantokrator der Erde stolziert, dann aber dieselbe wieder abgibt, wenn der Gebetsruf: »Gott ist groß« ertönt.
Die Tochter der Rebe, sagen die Türken, ist die Mutter der Niederträchtigkeit, und von einem Weinliebhaber sagen sie: er sei in diese Tochter verliebt. Ein europäischer Gesandter brachte 1681 unter anderem dem Großwesir Gartenerdbeeren zum Geschenk, von denen der Großherr Mohammed IV. begehrte; sie waren damals ganz unbekannt im Orient.
Der Großsultan gab im Jahre 1700 dem österreichischen Gesandten ein Diner in zahlreichen Schüsseln von gekrülltem vielfarbigen Reis, von klein geschnittenem, in Weinblätter oder Kürbis gefülltem Fleische, von eingemachten Tauben, von Zuckermandeln, Pasteten und Ringelbäckerei, von Mandelsülzen und Honigkonfekt, eingesottenen Robben und Sorbetten. Und bei einem anderen Feste bewirtete der Großwesir mit 200 gesottenen und 300 gebratenen Hammeln, 400 Schüsseln gekrülltem Reis für die Janitscharen, die nach gegebenem Zeichen auf die Beute fallen. In diesem Augenblicke fliegt eine Menge Tauben, welche zwischen den Hörnern der Hammel verborgen gewesen, auf und vermehrt durch ihr Geflatter den Tumult des Speisenraubes. Die Zeugschmiede führen einen ehernen Drachen vorüber, der Feuer speit, die Kanoniere eine künstliche Festung, von einem Elefanten bewacht, die Leute des Arsenals eine Galeere mit ausgespannten Segeln und wehenden Wimpeln, und von allen Seiten steigen Raketen in die Luft.
Eine schlimme Einrichtung in der Türkei ist die vom sogenannten Zahngeld – Disch-Kirasi –; so wird die Summe genannt, die ein Ort dafür entrichten muß, daß der Pascha an den ihm umsonst gelieferten Lebensmitteln sich die Zähne abgenutzt hat.
Als Vorbedeutung reichlicher Verpflegung der Janitscharen wurden die Namen ihrer Offiziere von den Bedürfnissen der Küche genommen. Der Oberst der Kämmerer, d. i. des Regiments, hieß Tschorbaschi, d. i. der Suppenmacher; der nach ihm angesehenste Offizier der Aschdschibaschi, der oberste Koch, und der Sakabaschi, der Wasserträger. Das Heiligtum des Regiments war der Fleischkessel, um den sie sich nicht nur zum Essen, sondern auch zum Beraten versammelten. Der Versammlungsplatz – Etmeidan, d. h. Nahrungsplatz – der Janitscharen lag in der Mitte von Konstantinopel. Durch ein prächtiges Gitter gelangte man an ein großes Gebäude, welches die Inschrift führte: Hier ist der Ort, wo man den Janitscharen ihre Lebensmittel gibt. Der Kessel galt ihnen als Fahne.
Augerius Busbeque – niederländischer Gesandter in Konstantinopel im siebzehnten Jahrhundert – erzählt, daß, wenn der Großherr ins Feld zieht, ihm mehr als 40 000 Kamele und ebensoviele Maultiere mit Lebensmitteln folgen. Diese Provision wird aber nicht unter die Armee verteilt, die davon leben muß, was sie in Freundes und Feindes Land findet; sie darf nur auf dem etwaigen Rückzug davon Gebrauch machen. Es ist daher nichts ehrenvoller für das türkische Heer, als wenn es nach dem Feldzuge nichts von diesen Vorräten angegriffen hat. Jeder Türke führt einen Beutel mit sich, der mit Mehl gefüllt ist und mit gekochtem Fleische, dessen Fasern von der Sonne getrocknet wurden, eine Art von Tafelbouillon. Die Türken essen mäßig, weil der Gebrauch des Opiums den Hunger mindert.
Von feiner Küche im modernen Europa schweigt die Geschichte lange. Karl dem Großen verdanken seine weiten Reiche, durch seine weisen Gesetze, sehr viel: durch seine Verordnungen zum Anbau der Gartenfrüchte und Gemüse, durch das vortreffliche Beispiel auf seinen Kammergütern.
Den Juden bietet der Lebensbaum im Paradiese zwar 500 000 köstliche Früchte; dagegen ist ihnen hienieden verboten, Fleisch und Butter zugleich zu essen. Auch darf drei Stunden nach dem Genusse von Käse keine Fleischspeise genossen werden; ebensowenig sechs Stunden nach dem Fleischessen Käse. Adam wurde (nach dem Talmud) aus dem Paradiese gestoßen, und Gott sprach zu ihm: Du sollst essen das Kraut des Feldes! Adam antwortete: Gern will ich das Gras essen mit dem Esel aus einer Krippe. – Durch diese Demütigung wurde Gott wieder besänftigt und änderte seinen Fluch dahin ab, daß er dem Adam das Grasessen wieder erließ und ihm nur auferlegte, im Schweiße seines Angesichts sein Brot zu essen.
Unsere biederen Vorfahren hatten ihre Büffelochsen, Elentiere, Renntiere, Bären, Luchse, einen köstlichen Storch, Wasserhühner, Rohrdommeln, Pastinaken, Holzbirnen und Holzäpfel – freilich bei Strömen von Bier nach dem Kampfe; auch wurden Seefische zum Fasten sehr lange aufbewahrt.
Venedig, im Verkehr mit dem Orient und dem luxuriösen Hofe des abendländischen Kaiserreichs, lehrte die Italiener zuerst feinere Tafelfreuden. Die Bürger der lombardischen Städte aßen (was als unerhörter Luxus galt) dreimal wöchentlich Fleisch mit Gemüse, aber abends nie warme Speisen. Im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts setzte man bei den Festen zuerst gekochtes Fleisch, dann Gemüse und andere wohlschmeckende Dinge auf; das meiste davon war stark gepfeffert. In Venedig lebte man aber natürlich am luxuriösesten, und doch erzählt Dandolo am Ende des elften Jahrhunderts: der Doge von Venedig heiratete eine Frau von Konstantinopel, welche sich so sehr der künstlichen Wollust hingab, daß sie ihr Bett mit wohlriechenden Sachen durchräucherte, sich nicht mit gewöhnlichen Wassern wusch und die Speisen nicht mit den Fingern, sondern mit gewissen goldenen Zweizacken und Gabelchen in den Mund steckte. Vierzig Jahre später besaß der Koch des reichen Gegenpapstes Anaklet schon Gefäße mit doppelt durchlöchertem Boden, so daß die Speisen in die einen, kostbare Gewürze und Räucherwerk in die zweiten getan wurden, und der Dampf der letzteren jene durchzog und den Geschmack veredelte. Diese Üppigkeit galt auch für einen Grund, Anaklet zu verdammen. Viel einfacher lebte Innozenz III., und so streng Ludwig IX. gegen sich war, hielt er doch einen anständigen Hof. Am Tage vor seinem Aufbruch zum ersten Kreuzzuge wurden bei dem Abschiedsfeste gegessen: frische Bohnen, in Milch gekocht, Reis mit Milch, Mandeln und Zimt, Fische, Torten, gebratene Aale mit einer trefflichen Brühe und Aalpasteten.
Kaiser Friedrich II. war sogar Gourmand. Er bestellte sich einmal 200 Stück Schinken. Er verbot, seine Weinberge zu verpachten, damit er den besten Wein selbst bekomme. Er verlangte die besten Fische von Resina, um Gallerte davon machen zu können; ja, der Magister der Philosophie, Theodor, mußte für ihn Sirupe und Veilchengurken verfertigen.
Feineres, überhaupt besseres Essen wurde gleichsam als ein Privilegium für die vornehmeren Stände angesehen und den anderen Ständen fast als Sünde angerechnet. Andreas Tiraquellas (im 20. Kapitel seiner Abhandlung vom Adel) schlägt ein Staatsgesetz vor, welches sowohl den Adeligen verbieten sollte, schlechte, als den gemeinen Leuten ausgesuchte Speisen zu essen. Er beruft sich auf ein Gesetz des Kaisers Gratian, nach dem es niederen Leuten bei Todesstrafe verboten wird, vornehme Speisen zu verzehren. Selbst der heilige Augustinus (im »Sermo de Sanctis«) zählt es zu den Todsünden, wenn Arme ihnen nicht zukommende Speisen genießen. Tiraquellas führt die Stelle aus dem 14. Gesänge der Odyssee an, wo Eumäus den Odysseus einladet, mit ihm zu essen:
Iß nun, fremder Mann, so gut wir Hirten es haben,
Ferkelfleisch; denn die Schweine der Mast verzehren die Freier.
Auch Diogenes Laertius erzählt im Leben des Pythagoras, daß dieser Philosoph zu sagen pflegte, es müsse wohl einen Unterschied geben zwischen Speisen, mit denen man Sklaven füttere, und denen, welche Freie und edle Männer genießen.
Die Kreuzzüge, die zuerst nach so langer Zeit Morgen- und Abendland wieder in vielfache Berührung brachten, verbesserten den Küchenzustand Europas auf das bedeutendste: viel Obst und Früchte kamen uns zu dieser Zeit aus dem Morgenlande; doch blieb noch lange das Derbe vorherrschend, und große Gastmähler zeichneten sich nicht durch das Gute, sondern durch das Viele und allerlei meist barocke Spielereien aus.
Noch zur Zeit der Königin Elisabeth war ein Stück sehr hartes Pökelfleisch und ein Krug Bier das gewöhnliche Frühstück ihrer Hofdamen. Zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts genoß in England selbst die Gentry monatelang kein frisches Fleisch, außer Wild und Fisch, was daher weit wichtigere Artikel in der Wirtschaft waren als gegenwärtig. Dieser große Übelstand war Folge des mangelhaften Zustandes des Ackerbaues. Man hatte wenig Futter und wußte nicht Schafe und Rinder den Winter durchzufüttern, weshalb sie zu Anfang der kalten Witterung in großen Massen geschlachtet und eingesalzen wurden, so daß man im ganzen Winter nur dies und großen Mangel an frischem Fleisch hatte. Unter Heinrich VII. aßen die Gentlemen im Gefolge der Großen niemals frisches Fleisch, außer in der kurzen Zeit zwischen der Mitte des Sommers und Michaelis. Im Laufe zweier Jahrhunderte waren erst einige Verbesserungen eingetreten, und unter Karl II. legten die Familien nicht vor Anfang November ihren Vorrat eingesalzener Lebensmittel an, den man damals Martinsrindfleisch nannte. Das Fleisch war aber auch damals im allgemeinen in England noch so teuer, daß höchstens die Hälfte der Bewohner zweimal in der Woche animalische Nahrung genossen, die übrigen gar keine, oder höchstens einmal die Woche.
Der Gebrauch der Messer und Gabeln wurde erst sehr spät allgemein. Aus unendlichen Stellen der Bibel geht hervor, daß man zu Christus' Zeit den Gebrauch des Messers nicht kannte: allenthalben ist vom Brotbrechen, nie vom Brotschneiden die Rede. Bei der außerordentlichen Sittlichkeit des Herrn läßt sich mit Recht voraussetzen, daß er das Brot geschnitten haben würde, wenn er den Gebrauch des Messers gekannt hätte. In Frankreich – wenn ich recht unterrichtet bin – ist bei einem Gastmahle, welches Philipp der Schöne gab, zum ersten Male von Messern und Gabeln die Rede, jedoch so, daß jeder Herr ein Messer, die neben ihm sitzende Dame eine Gabel bekam. Zu dieser Zeit wurde daher auch das Messer Mönch und die Gabel Nonne genannt. Es ist bekannt, daß sich die Türken nicht des Messers und der Gabel bei Tische bedienen. Jeder hat bei Tische fünf oder sechs Servietten neben sich, und Sklaven mit Rosenwasser, um die Hände nach jedem Gericht zu begießen, stehen zahlreich umher. Der Wirt legt nach einem vielleicht zehnfachen Waschen mit zwei Fingern vor. Immerwährend wird ihm und allen Rosenwasser präsentiert, und darauf, damit die Speisen keinen Rosengeruch bekommen, gewöhnliches Wasser; der Wirt trennt die Stücke mit den Fingern, die ganze Prozedur sieht äußerst appetitlich aus. Beefsteak wird in kleinen Dreiecken gereicht.
Das vierzehnte, fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert zeichnete sich durch prächtige Feste und Gastmähler und durch sehr wenig Geschmack aus.
Zur Hochzeit des Herzogs Eberhard I. von Württemberg (1474) kamen 14 000 Personen. Ein Ehrengeschenk zur Hochzeit war ein Becher, fast einen Viertelzentner schwer. Aus drei Röhren eines Brunnens lief Wein für jedermann.
Noch prächtiger ging es auf der Hochzeit Karls von Burgund mit Margarete von England (1468) zu. Der Saal, in welchem der Hochzeitsschmaus vor sich ging, war ganz mit goldenen Tüchern dekoriert. Auf den Tafeln standen dreißig köstliche Schiffe, beladen mit allerlei Braten. Jedes Schiff trug vier Boote, in welchen sich Gemüse zu den Braten befanden. Zwischen jedem Schiffe stand ein Tabernakel; unter demselben befanden sich die Pasteten. Als die Gäste saßen, kam ein Pferd, auf dem ein Knabe saß, verkleidet in einen Leoparden mit dem Panier Englands und einer Perle. Unter dem Klange der Instrumente ging ein Einhorn um die Tafel, blieb dann vor dem Bräutigam stehen und gab ihm die Perle mit einer Anrede. Nach diesem kam ein Löwe, in welchem vier Hofsänger saßen, die mit lieblichen Weisen sich hören ließen; auf seinem Rücken saß eine Schäferin. Der Hochzeitsschmaus erforderte täglich 16 Ochsen, 10 Schweine, 600 Pfund Speck, 100 Pfund Ochsenmark, 250 Hammel, ebenso viele Lämmer, 50 Stiere, 100 Hasen, 800 Kaninchen, 200 Fasanen, 200 Wasservögel, 800 Rebhühner, 400 Tauben, 200 Schwäne, 100 Pfauen, 400 Hühner, 1000 Hühnchen, 500 Kapaunen. Als dieser Herzog einige Jahre darauf nach Trier auf den Reichstag zog, waren alle Tischgeräte von Silber, die Becher mit Perlen und Edelsteinen besetzt. Vierzehn üppige Gerichte eröffneten die Tafel, worauf zwölf und dann zehn ebenso köstliche folgten. Der vierte Gang bestand aus den seltensten Arten von Konfekt, das in dreißig goldenen Schüsseln aufgetragen wurde. Vor den Trachten gingen sechzehn Grafen in Goldstoff gekleidet einher, zwanzig Trompeter, vier Pfeifer und zwei Heerpauker. Serviert wurde von mehr als 200 kostbar ausgestatteten Bedienten und als Tafelwache dienten 200 Trabanten.
Als Herzog Georg zu Landshut mit einer polnischen Prinzessin sein glänzendes Beilager hielt, waren auch Kaiser Friedrich und sein Sohn Maximilian gegenwärtig. Während der acht feierlichen Tage wurden 3000 ungarische Ochsen verzehrt, 62 000 Hühner, 5000 Gänse, 75 000 Krebse, 75 wilde Schweine, 162 Hirsche, 170 Fässer Landshuter und 270 ausländischer Wein. Die Kosten beliefen sich auf 70 760 Dukaten!
Auf der Vermählung des Kurfürsten Christian II. zu Sachsen (1602) wurde nebst einer ungeheueren Menge vornehmer Hochzeitsgäste an 180 Tischen sogar »das gemeine Gesindel« acht Tage lang gespeist. Dem Bräutigam schwamm auf der Elbe ein Walfisch und Neptun und Glaukus in ihrem Muschelwagen entgegen, um ihn zu salutieren.
An dem so berühmten luxuriösen altfranzösischen Hofe ging es um diese Zeit zuweilen sehr wild, unordentlich und genau zu. So gab Anna von Österreich (1645) den polnischen Gesandten bei der Gelegenheit der Vermählung der Prinzessin von Nevers mit ihrem Könige ein großes Souper; aber schon im ersten Service fehlten mehrere Schüsseln, und als sich endlich die Fremden ziemlich spät zurückgezogen hatten, mußte man eine lange Reihe von Zimmern, die man zu beleuchten vergessen hatte, im Finstern durchwandeln. Ich erinnere mich, bei einem sehr schönen Feste, wo man sicherlich nicht an Ersparnisse gedacht hatte, etwas ähnliches erlebt zu haben. Chateaubriand gab es als Ambassadeur in Rom zu Ehren der Großfürstin Helena in der Villa Medici im Jahre 1829. Das Mahl sollte im Garten unter Zelten eingenommen werden, die aber ein heftiger Wind zerstörte. Leider war die Möglichkeit eines so natürlichen Ereignisses nicht berechnet. Alles brach in wilder Eile nach der Villa auf; mich führte der Weg durch ein dunkles Souterrain, spärlich beleuchtet von einigen eiligst auf Flaschen gesteckten Talglichtern. Maurerhandwerkszeug, Gerüste, Schutt überall. Das schöne Fest war aufs unangenehmste unterbrochen; obgleich Chateaubriand, der in seinen «Mémoires d'outre-tombe« von diesem Feste spricht, der Meinung ist, alles schnell repariert zu haben. Für mich war dieses Fest doppelt merkwürdig; denn ich spielte eine sehr bemerkbare Rolle dabei. Nach dem Gouter ließ sich nämlich zuerst eine berühmte Improvisatrice hören, und dann wurden einige französische Vaudevilles zum besten gegeben. Ein Gast, der eine ganz unbedeutende Ansagerrolle hatte, war krank geworden; man ersuchte mich, das Dutzend Worte zu sagen. Aber kaum machte ich den Mund auf, als die zahlreich versammelten französischen Gäste, in dem nationalen Vorurteil, ein Fremder könne nicht fehlerfrei zwei Worte aussprechen, in ein lautes Gelächter ausbrachen, welches bald allgemein wurde. Anstatt mit zu lachen, ärgerte ich mich darüber und doppelt, als Chateaubriand mir nachher einige tröstliche Worte sagte. Ich hatte offenbar doppelt Unrecht, mich über Dummheit und Güte zugleich zu ärgern. Noch toller ging es bei einem Feste für die spanischen Gesandten zu. Die Tafel für des Königs Tisch war geplündert, und zwar von Leuten, die zum Hofe gehörten, so daß viele Schüsseln nur halb voll waren, als man sie den Majestäten vorsetzte. Diese Anordnungen hatten ihre Quelle in Mazarins Geiz, der durch schmutzige Ersparnis die meisten Chargen unbesetzt und die besetzten unbesoldet ließ. Der Premierminister verwendete täglich oft mehrere Morgenstunden dazu, um die Louisd'ore zu wiegen, die er des Abends im Spiele gewonnen hatte, damit er wieder diejenigen zum Spiel bringen könne, die nicht vollwichtig waren. Mit seinen italienischen Fingerchen, die nicht zu den ungeschicktesten gehörten, wußte er mancherlei Vorteile zu ziehen. Am ganzen Hofe übertraf ihn nur der berüchtigte Chevalier de Gramont in Fingerfertigkeit, und man sagt, daß dies der eigentliche Grund der Verbannung des Chevaliers aus Frankreich gewesen sei. Die Franzosen der damaligen Zeit scheinen in solchen Fingerfertigkeiten geübt und nicht sehr skrupulös gewesen zu sein. Gramont erzählt (in seinen vortrefflich geschriebenen Memoiren) ganz harmlos, daß er dieses Talent angewendet und wie und wo er davon Gebrauch gemacht hat. – Herr von Cosnac, Erzbischof von Aix, erlebte noch die Heiligsprechung des François de Sales, seines früheren Bekannten. Wie, rief er aus, Herr von Genève (wo der neue heilige Bischof gewesen war), mein alter Freund, ich bin erfreut über die glänzende Karriere, die er noch jenseits macht. Es war ein liebenswürdiger, honetter Mann, ob er gleich im Pikett gerne betrog; ich habe es oft bitter erfahren. – Monseigneur, entgegnete man ihm, wie ist es möglich, daß ein Heiliger stiehlt! – O ja, antwortete er, man hat der Beispiele; erinnern Sie sich nur des heiligen Krispin. Übrigens, fügte der Erzbischof hinzu, rechtfertigte sich auch mein verstorbener Freund damit, daß er sagte, seinen Spielgewinn erhielten die Armen, und für die müsse er sorgen.
Die Zeiten Ludwigs XIV. brachten, wie der Literatur, so auch der französischen Küche große Fortschritte: erst jetzt suchte man nicht mehr im Barocken und in der Übertreibung, nicht mehr in der Menge und dem Gewichte, sondern im Ausgezeichneten und Besten sich hervorzutun. Man nannte das Diner des Königs: La viande du roi. Zwei Garde du Corps begleiteten die Küchenoffizianten, die es in verschlossenen Körben trugen; auf dem Wege in die königlichen Gemächer mußte sich jedermann, wenn es ankam, vom Sitz erheben. Des Abends brachte man, immer eskortiert, der Königin eine große Terrine Bouillon, ein gebratenes kaltes Huhn, eine Flasche Wein, ein Orgeat, eine Limonade und einige Konfituren. Ludwig XVIII. fand es höchst sonderbar, daß Napoleon sein Diner nicht auf gleiche Weise von der Küche in den Salon mit Begleitung der Garde bringen ließ, und führte den alten Gebrauch wieder ein.
Die Zeiten Ludwigs XIV. sind der ganzen gebildeten Welt, besonders durch die große Memoirenliteratur dieser Epoche, zu bekannt und in zu lebendiger Erinnerung, als daß sich besonders Interessantes und Neues darüber sagen ließe. Trotz aller Bestrebungen der Küche dieser Zeit ließ dieselbe noch sehr viel zu wünschen übrig; als Voltaire sagte: Un cuisinier est un être divin, glaubte er gewiß nicht, daß die französische Kochkunst zu seiner Zeit noch in der Kindheit läge. Man gab große Repräsentationsdiners; von den kleinen, feinen hatte man keine Idee. Die vornehmsten Herren lagen den ganzen Tag in den Wirtshäusern, und selbst bei den Diners reichte man vor, während und nachher Liköre und stark gewürzte Getränke dar. Erst seit 1735 verdrängte diese der Kaffee nach dem Diner, und unter dem Minister Maurepas, der unter seinem ersten Ministerium die Tee-Einfuhr begünstigte, wurde dieses milde Getränk eingeführt. Dasselbe änderte die Sitten von Grund aus, es milderte sie; man fing an, es unanständig zu finden, ins Kabarett zu gehen. Der Herzog von Ferté-Senectère war der letzte der französischen Großen, dem man den Beinamen Le pair des cabarets gab.
Unter dem Regenten kamen, durch die Sitte des Hofes veranlaßt, die Soupers an die Tagesordnung; der Rauch der Küchen würzte alle Nächte die Atmosphäre der Hauptstadt. Der Prinz von Rohan, unter Ludwig XV. französischer Gesandter in Wien, wollte dort die gleiche Mode einführen. Er schrieb nach Paris: Große Diners sind hier in der Mode; aber man sagt, meine Soupers täten ihnen schaden – weshalb der Minister der auswärtigen Angelegenheiten eine sehr lebhafte Note an den Prinzen schrieb und ihn im Namen der Kaiserin einlud, keine Soupers mehr zu geben.
Zur Zeit der französischen Revolution gab der Herzog von Bedford dem emigrierten Herzog von Gramont ein splendides Mahl; es war eines jener fürstlichen, fast königlichen Feste, welche der Stolz der englischen Großen zuweilen Fürsten gibt. Man brachte zum Dessert eine wunderbare Flasche von Constanzwein, eine Flasche ohne Vergleich, ohne Alter, ohne Preis. Es war flüssiges Gold aus geweihtem Kristall, ein geschmolzener Schatz, ein Sonnenstrahl, es war Nektar, das letzte Wort von Bacchus selbst. Der Herzog von Bedford ließ es sich nicht nehmen, dem Gaste selbst das Glas zu reichen; dieser kostete das Getränk und erklärte es für unübertrefflich. Der Herzog, um seinem hohen Gast Bescheid zu tun, schenkte sich das zweite Glas ein; aber kaum hatte er es an die Lippen gebracht, als er es mit Schauder halb ohnmächtig fallen ließ. Man eilte hinzu, untersuchte die Flasche des Göttergetränks – es war Bibergail. – Der Herzog von Gramont hatte von dieser infernalen Flüssigkeit getrunken, ohne eine Miene zu verziehen. Diese stoische Selbstverleugnung machte ihm große Ehre und gab eine hohe Idee von französischer Artigkeit, die sich so heroisch gezeigt hatte.
Bonaparte aß mit Appetit und sehr rasch; er liebte vieles und starkes Gewürz. Eines seiner Lieblingsgerichte war ein Gigot de mouton, der sehr braun gebraten sein mußte, auch Hammelkotelett liebte er. Er trank selten mehr als eine halbe Flasche Bordeaux, seinen Lieblingswein; aber er mischte viel Wasser dazu. Als erster Konsul speiste er fast alle Morgen ein Huhn, auf italienische Art, in Öl und mit Zwiebeln, und ein bescheidenes Ragout, welches man Poulet à la Provençale nannte, und welches noch immer auf allen Speisezetteln französischer Restaurateure zu finden ist, aber den stolzen Namen Poulet à la Marengo angenommen hat. Zur Zeit des Kaiserreichs wurden die Diners Napoleons regelmäßig um sechs Uhr serviert; aber der Kaiser vergaß das Essen öfter. Einmal ließ er sogar bis des Abends um elf Uhr warten. Die einzige Maßregel, die man bei solchen Gelegenheiten anwendete, war, daß man die Rechauds von Viertel- zu Viertelstunde aufs neue mit kochendem Wasser anfüllte. An dem Tage mußten (denn man erwartete ihn jeden Moment) nach und nach für ihn 23 Hühner an den Spieß gesteckt werden. Im Felde lagen, wie mir General Montholon erzählte, in einer dünnen silbernen Maschine immer einige Hammelkoteletts auf Butter. Sobald er die stets in Bereitschaft gehaltene Suppe verlangte, wurden einige in Öl getränkte Bogen Papier unter die Kotelett- Maschine gebracht, und die Koteletts waren in wenigen Minuten fertig, bevor der Kaiser im eigentlichen Sinne des Wortes die Suppe (er liebte die Julienne) verschlungen hatte.
Als Bonaparte zur Zeit des Konsulats erfuhr, daß alle Kabinettskuriere mit Paketen, die besonders Delikatessen für die Großen des Reichs enthielten, belastet wurden, so gab er Befehle dagegen. Abends kam Cambacérès, der zweite Konsul, sehr verlegen zu ihm und bat um eine Ausnahme für sich, weil man sich gar nicht Freunde erwerben könne, wenn man nicht eine ausgesuchte Tafel führe, und daß es bekannt sei, daß man zum großen Teil durch die Tafel regiere. Bonaparte beruhigte seinen Kollegen: die Kuriere durften fortfahren, ihm Pasteten aus Straßburg, Schinken von Mainz, Poularden aus der Normandie und Trüffeln aus Perigord zu bringen.
Cambacérès glaubte allen Ernstes nicht, daß man gut regieren könne ohne exzellenten Tisch, und sein Ruhm war, zu hören, daß man in Paris, ja in ganz Europa, seinen Tisch als einen der vorzüglichsten lobe. An der Spitze seiner Freunde stand d'Aigrefeuille, die Hauptstütze seines sybaritischen Hofes. Dieser aß so gern und so viel, daß er die ihm etwa noch übrigbleibende Zeit während der Verdauung damit zubrachte, über das, was er gegessen hatte, nachzudenken. Zu diesem gastronomischen, zu seiner Zeit in Paris hochberühmten Kreise gehörten ferner de Lavollée, Monvel, Fesquet, Noël und der Marquis Villevieille. Eine Dame wurde bei Tafel in Gegenwart Aigrefeuilles wegen ihrer Schönheit sehr gelobt. »Ja«, sagte er, »sie ist so schön wie dieser Auerhahn mit Trüffeln, der eben präsentiert wird.« Einst beklagte er sich über Unwohlsein bei seinem Arzte. »Sie müssen«, sagte dieser, »weniger essen, wenn Sie länger leben wollen.« – »Weniger essen!«, antwortete er erschrocken, »nein, lieber früher sterben! Der Tod scheint mir weniger schmerzlich als das Fasten.« Jemand fragte ihn, ob er zuweilen bete. »Ja«, antwortete er, »um dem Himmel für die Erfindung der Kochkunst zu danken. Das Paradies«, sagte er, »ist der Ort, wo man ewig zu Tische sitzt, ohne sich jemals den Magen zu überladen.«
Grimod de la Reynière (sein wirklicher Name ist Alexander Balthasar Laurent), der Verfasser des ersten »Almanach des Gourmands « zur Zeit des Konsulats, dedizierte denselben dem Koch des Cambacérès. Für die Emporkömmlinge, die nicht wissen, wie sie ihrem Vermögen Ehre machen sollen, schrieb er sein »Manuel des Amphitryons«. Sein Eifer für die Beförderung der Wissenschaft des Gaumens ging so weit, daß er eine Jury von Feinschmeckern (dégustateurs) sich monatlich einmal im Rocher de Cancale versammeln ließ, die mit schwarzen und weißen Kugeln über ein und das andere neue Gericht ballotierten. Grimod de la Reynière ist der Corneille der französischen Gastronomie, d. i. der Vorläufer des klassischen Geschmacks, aber seine Küche ist so wenig korrekt wie die Sprache Corneilles; beide sind glänzend, erhaben, aber nichts weniger als frei von argen Fehlern gegen den guten Geschmack. Beide hatten viel Verstand, aber nur la Reynière ließ ihn im Gespräch glänzen. Nach dem ersten, wohlverdienten, glänzenden »Almanach des Gourmands « ließ er noch sieben andere gleichen Inhalts mit gleichem Beifall folgen.
In derselben Epoche schrieb Berchoux sein interessantes Gedicht über die Küche. Berchoux war kein solider Gastronom, selbst nicht einmal Kenner. Sein Werk ist aber interessant und voll tausend witziger Pointen. Der geistreiche Dichter, der gesagt: »Qui me délivrera des Grecs et des Romains?« konnte nicht ohne Einfluß bleiben auf die allmählich sich Raum machende Küchenreform, vielmehr Küchenrevolution. Aber Berchoux kehrte, wie Grimod, im Alter zu der veralteten klassischen Küchenliteratur zurück, indem er in beißenden Epigrammen die Rudera seines Geistes unnütz verpuffte. Nach ihm zeichnete sich auf eine vorzügliche Weise in allem kulinarischen Wissen mein verstorbener, sehr verehrter Freund, der Marquis de Cussy, aus. Er ist der eleganteste Typus der Gastrosophie, der allen Franzosen von Geschmack und Gourmandise unvergeßlich ist und lange bleiben wird. Sein ungeheures Vermögen schmolz nach und nach unter seinen liebenswürdigen und großmütigen Händen. Napoleon machte ihn zum Baron und zu seinem Hofmarschall. Nach dem Sturze des Kaiserreichs sah er sich vis-à-vis de rien und erhielt unter den Bourbons eine unbedeutende Sinekure; aber er gab bis an sein Lebensende die ausgezeichnetsten und gesuchtesten Diners der Hauptstadt. Von ihm öfter in kleinen Gesellschaften von acht bis zehn Personen eingeladen zu werden, was mir recht oft zuteil geworden ist, galt für ein Glück. An seinem Tische zeigte sich nicht das Seltenste, sondern das Beste, nicht bunteste Mannigfaltigkeit aller Zonen und Länder, aber das Zeitgemäße in möglichster Güte.
Einer der ausgezeichnetsten Köche Frankreichs, den er nur mittelmäßig bezahlen konnte, wollte ihn, trotz des Zuredens des liebenswürdigen Marquis, niemals verlassen, weil ihm die tägliche Belehrung mehr wert war als alles Geld. – Cussy schrieb »La Gastromanie historique«, und sonst wenig; aber seine geistreichen Tisch- und Küchenbemerkungen leben in der Pariser guten Gesellschaft.
Der Freund des Marquis Cussy, berühmt wie er, war Brillat-Savarin, Rat am Kassationshof. Er schrieb die »Physiologie du goût«, ein unentbehrliches Handbuch für alle Gastrosophen, obgleich er eigentlich selbst kein Gastronom in der besten Bedeutung des Wortes genannt werden kann; er war eigentlich mehr ein starker Esser, dessen kräftige Gesundheit in einem athletischen Körper allen Folgen des oft Zuvielen bis ins Alter widerstand. Brillat-Savarin gab keine weltberühmten Diners und war außerhalb des Gerichtshofes und der Gesellschaft bei Madame Recamier wenig bekannt in Paris; sein historisches Leben beginnt mit seinem lesenswerten Buche.
Einer der berühmtesten französischen Köche der neueren Zeit, der sich diesen Heroen würdig anschließt, ist Montmireil. Er wurde nach Verona zum Kongreß berufen und hieß seit dieser Zeit der Kongreßkoch. Lange war er in Wien bei dem Herzog von San Carlos, spanischem Ambassadeur, in Rom und Paris bei Chateaubriand, der sogar in seinen Memoiren von ihm spricht. In Rom verwandelte er in 24 Stunden ein abbestelltes Diner von 80 Personen in ein Souper von 120 Personen. Dies ist sein Meisterstück. Er reiste, wie er sich ausdrückt, nie anders als mit seinem Generalstabe, wie er sein zahlreiches Küchenpersonal nannte. Er ist der Erfinder zweier Speisen; man sagt ihm aber, wie anderen berühmten Köchen, nach, daß er keine Omelette machen könne, aber in den Juliennen läßt er seine ganze Kunst spielen: jenes ist ihm verächtlich. Hierher gehört auch Ude, der berühmte Koch des Herzogs von York, den er ruinieren half. Als man nach dem Tode dem Herzog ein Denkmal auf einer hohen Säule errichtete, meinten die Engländer, sie sei deshalb so hoch, damit ihn seine Gläubiger nicht erreichen könnten. Ude wurde vor einigen Jahren in das berühmte Spielhaus von Crockford in London als erster Koch engagiert mit einem jährlichen Gehalt von 30 000 Franken.
In Anton Carême endlich erreichten die französischen Köche ihren Gipfel- und Glanzpunkt. Carême hatte schon in der Kaiserzeit ein großes Ansehen erworben. Er war der ausgezeichnetste aller Oberköche, in den ersten Häusern der Hauptstadt gesucht, ja auf den Händen getragen.
Bei Talleyrand lernte ihn 1814 der Kaiser Alexander kennen, der sich ihn vom Fürsten ausbat. Bei dem Kaiser hatte Carême monatlich 2400 Franken Gehalt; seine Ausgaben für die Köche beliefen sich monatlich zwischen 80 000 und 100 000 Franken. Aber er wollte dem Kaiser nicht nach Petersburg folgen; ein kostbarer Brillantring belohnte seine Dienste. Nun ging er mit Lord Stuart, englischem Gesandten, nach Wien. Hier wurde er mehr als Freund denn als Koch behandelt. Mylord kam täglich in die eleganten Küchen, um mit Carême Rücksprache zu nehmen. Das Anerbieten Ludwigs XVIII., in seine Dienste zu treten, schlug er rund ab, weil dasselbe in einer Weise geschehen war, die ihm nicht zusagte. Er zog die Stelle bei Rothschild in Paris vor, nachdem er durch seinen alten Gönner, den Prinzen Louis Ronan, demselben in gehöriger Form präsentiert worden war. Seit dieser Zeit verschmähte er alle anderen Anerbietungen sowohl von König Georg IV., der ihn sehr hochschätzte und oft nach ihm fragte, um ihn zu gewinnen, als von vielen anderen hohen Häuptern. Carême hat viel geschrieben, als: »Projets d'Architecture«, dem Kaiser Alexander gewidmet; »Le pâtissier royal«, »Le cuisinier parisien«, »La table de quelques souverains, et grands seigneurs«, »Un déjeuner de l'Empereur Napoléon«, »La table du prince Cambacérès«, »L'art de la cuisine française au dix-neuvième siècle «. Er ist so groß als Schriftsteller wie als Koch, und man kann von ihm, wie von Cäsar, sagen: wenig Taten gleichen seinen Worten. Die eigentlichen Helden Carêmes sind unbezweifelt Talleyrand und Rothschild. Von dem Tische des ersten hat man tausend Anekdoten. Fürst Talleyrand war einer der ersten, der überzeugt war, daß eine gute Küche die Gesundheit befestigen müsse, und die letzten vierzig Jahre seines Lebens haben diesen Grundsatz bestätigt.
Von der süddeutschen Küche verstehe ich nichts. In einem Augsburger Kochbuch finde ich den Unterschied der gemeinen Seelen und der vornehmen darin angegeben, daß die ersteren aus gemeinem Semmelteig bestehen, bei den letzteren aber dieser mit Mandeln, Rosinen und feinen Gewürzen angewendet wird.
Von der ungarischen Küche verstehe ich aber ganz und gar nichts, obgleich ich die Literatur derselben bis auf das neue »Pester Kochbuch« (Pest 1835) kenne; hier fand ich unter anderen folgende Speisen: Kaisergerstel, Kaulisuppe, Griesnockerln, Leberschöberl, Maurachen, ausgebackene Kipfeln, Schinkenwandeln, Eierpflanzel, Hendeln mit Kauli, Kälbernes Brüstel in der Glaß, Schill mit Sardellen, Hecht in der Kackelsoße, Rutten mit ausgelösten Müscherln, Krebsmeridon, Raizische Bitta, abgetriebenes Nudelpflanzel, Zuckerstrauben, Böhmische Dalkerln, Mandelhippen, Eislebzelteln, Mandelbusserln, Zuckerzelteln, Weinschirlsulz, Erdbeerenfaum, Schmankerlgefrornes, Hetschepetsch. Bei einigen dieser Speisen ist dem Ungelehrten das Material kennbar, bei anderen aber wohl ein Lexikon notwendig; ich bekenne meine Unwissenheit mit Schmerz- und Schamgefühl.