
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Sage mir, was du trinkst und ißt,
Und ich sage dir, wer du bist.
Das Sprichwort: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen hat viel mehr Menschenverstand, als viele Menschen Verstand haben. Willst du, daß eine Lampe brenne, so lasse es nicht an Öl fehlen, sagte ein alter Philosoph, den sein reicher Freund so vernachlässigt hatte, daß er auf dem besten Wege zum Verhungern war. Wer freilich seinen Magen zu Gott macht, der macht auch seinen Kopf zum Schornstein. Wer sehr viel ißt, der ißt in der Regel ohne Wahl. Die Schlechtheit des Gastmahls nimmt sehr oft mit der großen Zahl der Gerichte gleichmäßig zu. So tafelt ein braver Krähwinkler bei einem Fest, dem ich schicklicherweise gar nicht ausweichen kann, so auf, daß die Tische knacken unter der Last der gewichtigen Speisen, und ich, gleich ihnen, ängstlich seufze, weil mir nur die Wahl geblieben ist, dem gutmütigen Mann von Wirt oder meinem Magen wehe zu tun – durch ein Zuwenig oder Zuviel.
In früheren Zeiten hat man bei uns viel essen gut essen genannt; mehr den Leib als den Geist der Kochkunst beachtet. Eine notwendige Folge davon war, daß sich der Unwissenheit die Trägheit beigesellte: Vielfraß und Faultier sind nahe verwandt, geistige Cousins, wenn auch Buffon anderer Meinung ist.
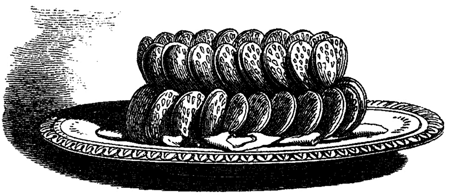
Es steht für die Verdauungskunst des Straußes mit seiner Dummheit in gleichem Verhältnisse: dumme Geschöpfe verdauen besser als kluge; der Strauß frißt bekanntlich ohne Schaden Steine. In diesem Sinne gab der Feldmarschall Seckendorff eine sehr verständige Antwort. Derselbe hatte sich gegen einen großen, aber dummen Fresser über schlechte Verdauungswerkzeuge beschwert. »Da wünschte ich«, sagte der Fresser, »Euer Exzellenz meinen Magen, der verträgt alles.« »Danke«, war die Antwort, »mag keinen Saumagen.«
Mäßigkeit fördert Verdauung: der Mäßige ist unbelastet vom Gewichte der Speisen; ihm ist der Kopf frei, seine Ideen sind demnach klar, und hat er die trockensten Akten zu schreiben, so bekommen sie aus seinem nicht umwölkten Geiste einen netten Stil zu und angehaucht, und können ein Beispiel werden von witzigen Akten. Mit Lust geht der Mäßige an seine Geschäfte; er wird alt ohne Krankheit und genießt das Gute im Wohlsein. So gewährt ihm die großmütige Natur für eine einzige Tugend tausendfache Belohnung.
Eine beständige Freßbegierde macht dumm. Die alten ägyptischen Ärzte leiteten alle Krankheiten von den Speisen her und verordneten daher mehrenteils Brechmittel und Fasten. Je besser wir verdauen können, um so feiner wird der Nahrungssaft, desto stärker der Geist. Cheyne sagt, daß man einen reinen Magen haben muß, wenn man einen aufgeheiterten Geist haben will. Ein Blinder war imstande, durch das Gefühl die Farben zu unterscheiden; aber er hatte dies Gefühl nur, wenn er einen leeren Magen hatte. Karneadas wünschte so sehr den Stoiker Chrysippus in einem gelehrten Wettstreite zu überwinden, daß er sich mit Nieswurz purgierte, damit sein Geist freier sei und das Feuer seiner Einbildungskraft mit mehr Nachdruck wirke.
Protogenes lebte die ganze Zeit hindurch, als er mit dem Gemälde des Jalysus beschäftigt war, ungemein mäßig, damit er durch allzu häufige und allzu grobe Speisen die Feinheit seiner Empfindungen und seines Geschmacks nicht abnutze. Die Therapeuten haben (nach Philo) vor Untergang der Sonne nicht speisen dürfen, weil sie geglaubt, die Bestrebung nach Weisheit sei allein des Tages würdig, und man müsse für den Körper nur im Dunkeln sorgen. Die Paulaner verdankten den Ruf ihrer vorzüglichen Heiligkeit ihrem unaufhörlichen Fasten. Der bekannte Law aß in seiner Jugend nur täglich etwas von einem Hühnchen, damit er zum Spielen den Kopf frei hatte.
Fett und Dummheit werden (nach Chesterfield) als unzertrennliche Gefährten betrachtet. Die Luft, welche die Böotier einatmeten, wurde wegen der Dummheit der Leute eine fette genannt.
Boerhave sagte, er wundere sich allemal, wenn er höre, daß Philosophen glauben, es hänge von ihnen ab, wenn sie denken sollen, da doch schon die Speise der Seele göttliches Licht auslösche, und da der Mathematiker, der vor Tische das schwierigste Problem aufgelöst hatte, nach einem großen Gastmahle dumm und schläfrig war. Lamettrie starb an einer bei dem Lord Tyrconnel genossenen Pastete. G. van Swieten sagt: Leute, die unmäßig leben, fallen sehr oft von Schlagflüssen getroffen hin. Gelehrte und alle viel sitzenden Personen versinken, wenn sie viel essen, in Schwermut, und in dem rohen Lande der Biersuppen, des rohen Specks, der Knackwürste, der Neunaugen und der Butterbröte in Verzweiflung, welche den Menschen am geschwindesten vernichten muß, weil sie die Heilige Schrift mit dem ewigen Feuer vergleicht (Zimmermanns Erfahrung).
Die Inder haben recht, den Teufel (Lerense, »Reise nach Indien«) einen großen Fresser zu nennen. Ich gehe vielleicht zu weit, indem ich jeden großen Fresser für einen dummen Teufel halte; indes geht doch mit der Völlerei und Gier die Dummheit gern Hand in Hand, und noch ein viertes Übel gesellt sich meist zu ihnen. Wenigstens frißt gerade dasjenige Tier, welches wegen seiner Unreinlichkeit sprichwörtlich geworden ist, alles ohne Wahl, was ihm, artig zu reden, vor den Schnabel kommt, ohne auch nur, wie sich die Fabel darüber ausdrückt, zu dem Eichbaume dankend emporzugrunzen, der ihm seine Früchte spendet. Blumenbach zählt die unglaubliche Zahl der Kräuter auf, von denen es ohne allen Schaden genießt. Nach Linné fressen aber die Schweine nur 72 Gewächse und lassen 171 stehen.
Indes soll selbst dem verächtlichsten unserer Haustiere Gerechtigkeit widerfahren, da seine hier gerügten Fehler aus seiner ihm von uns aufgedrungenen Sklaverei kommen. Wenig Tiere werden durch die Kultur so verändert wie diese, bilden so mannigfache Varietäten, und wenige sind so bildsam. Sie folgten dem Menschen in alle Himmelsstriche, die Eiszone allein ausgenommen; und da sie im Norden eines Obdaches bedürfen, so haben sie nicht nur gelernt, Stroh zusammenzutragen, sondern auch, wenn der Wind kalt weht, ihre Gesellschafter herbeizurufen und dieselben durch ein wiederholtes Geschrei aufzumuntern, daß sie an dieser Arbeit teilnehmen mögen. Man kann ihnen überhaupt großen Scharfsinn nicht absprechen; aber das kurze Leben, welches wir ihnen zugestehen, und ihre allgemeine Einkerkerung bei wenig Luft und Licht verhindern ihre Vervollkommnung, die sonst (nach Darwin) wahrscheinlich noch größer sein würde als die der Hunde.
Die Ente aber ist ein recht schlagendes Beispiel meiner obigen Behauptung, und dieser Vogel ist auch wiederum, und das von Rechts wegen, dümmer und unempfänglicher als die meisten unserer Haustiere, namentlich die bei uns so verschriene Gans, deren Klugheit die Römer anerkannten. Pferd und Elefant, die edlen Tiere, beweisen die Lichtseite meiner Behauptung. Klugheit wie Reinlichkeit und Mäßigung vereinen sich auch in ihnen, wie so oft, mit Wahl und Maß.
Des mäßigen Hindu stärkster Fluch ist: »Daß du die ganze Woche nur einerlei Geschirr gebrauchen mögest!«, so sehr ist Reinlichkeit seine zweite Natur. Der gefräßige Südsee-Insulaner dagegen flucht: »Daß du deines Vaters Gebeine ausgraben müßtest zur Suppe!«
Unter allen Wesen war dem Menschen allein die Erfindung gemischter Speisen vorbehalten, und die Götter Griechenlands kannten, wenigstens bei den älteren Dichtern, nichts als Nektar und Ambrosia. Sie waren fast so übel daran im Olymp wie die Juden in der Wüste mit Manna vom Himmel, Wachteln aus der Luft und Wasser aus Felsen, wenn nämlich Moses gerade einen bei der Hand hatte.
Über das, was in unserem Himmel genossen wird, habe ich zwar zur Zeit noch keine Kenntnis, es wird aber dort gegessen, denn Elias und Henoch fuhren lebendig zum Himmel und starben nicht – essen ist aber Bedingung des Lebens. Einer meiner gelehrten, aber sehr spitzfindigen Freunde bestreitet das und meint: da fromme Menschen bekanntlich in dem Maße ihrer Frömmigkeit der Speisen leicht und leichter entbehren können, so würden solche, die ganz im Himmel leben, auch der irdischen Nahrung sich füglich entschlagen können. Wenn ich auch das zweifelhafte »füglich« nicht weiter untersuche, so kann ich doch meine Behauptung, daß im Himmel gegessen und getrunken wird, nicht aufgeben; denn selbst die Engel, die Abraham einen Besuch abstatteten, aßen Kalbfleisch und Kuchen und Butter und tranken Milch dazu. Ja, es ist mir gesagt, im Urtext heiße es, daß Abraham zur Bewirtung der drei Engel drei Rinder geschlachtet habe, nicht aber eins, wie es in der Lutherschen Bibelübersetzung heißt. Wozu in aller Welt für so wenig Gäste drei Rinder? Wenn wir nicht plumphin behaupten wollen, jeder Engel habe ein Rind gegessen, gleich einem berühmten Fresser, der auf dem Reichstage zu Worms ein junges Kalb verzehrte, so müssen wir zur Ehre der Engel annehmen, daß diese Stelle auf feine Wahl zielt. Es mag wohl von feiner Küche, von Delikatessen die Rede gewesen sein. Ein so verständiger Mann wie Abraham mochte das Beste vom Guten zu unterscheiden wissen. Ich glaube fast, er setzte ihnen die Zungen vor – im Orient eine Delikatesse, wie jedem Leser bei Erinnerung an den Heliogabalus beifallen wird.
Es ist falsch, daß im Urtexte von drei Rindern die Rede ist; ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Im 1. Buch Moses, 18. Kapitel, 7. und 8. Vers, heißt es nach wörtlicher Übersetzung: »Und zur Rinderherde lief Abraham und nahm einen Rindersohn (
![]() was Luther richtig mit Kalb übersetzt) zart und gut, und trug auf Butter und Milch und von dem Kalbe.« Aber im Hebräischen heißt es: »Und er nahm Butter und Milch und den Rindersohn, den er bereitet hatte, und setzte ihnen vor.«
was Luther richtig mit Kalb übersetzt) zart und gut, und trug auf Butter und Milch und von dem Kalbe.« Aber im Hebräischen heißt es: »Und er nahm Butter und Milch und den Rindersohn, den er bereitet hatte, und setzte ihnen vor.«
Es handelt sich daher nicht um ein Kalb, nicht um drei Kälber, sondern um das ganze Kalb oder um einen Teil desselben. Der Urtext redet immer nur vom Ganzen, während das Luther zuviel erscheint, und er übersetzt deshalb unbezweifelt: »von dem Kalbe«. Indes ist das letztere wohl grammatisch, aber nicht hebräisch unrichtig. Denn die hebräische Ausdrucksweise ist so ungenau, daß oft der Teil für das Ganze, und umgekehrt, gesetzt wird. Selbst wenn man von einem Kalbsbraten reden wollte, könnte man es nicht anders ausdrücken, als daß man »Kalb« sagte. Man muß daher die, bei der Unbehilflichkeit der Sprache, zu allgemein gehaltene Ausdrucksweise mit Berücksichtigung des Sinnes oft ergänzen, beschränken, spezialisieren. In diesem besonderen Falle ist aber der Lutherschen Übersetzung nicht beizustimmen. Denn bei den Hebräern, wie im Altertum überhaupt, ehrte man den Gast nicht bloß durch die Qualität, sondern auch durch die Quantität, wie man dies ja auch noch jetzt bei den ungebildeteren Volksklassen findet. Auch wissen wir, daß man damals wirklich ganze Kälber, Schafe, Schweine zum Mahle zubereitete. Es dürfte daher nach Abrahams gastfreundlicher Gesinnung anzunehmen sein, daß er seinen Gästen das ganze Kalb vorgesetzt habe. Dazu kommt, daß gerade der von Luther gewählte, auch noch sehr allgemeine Ausdruck »vom Kalbe« sich im Hebräischen sehr gut wiedergeben läßt durch Vorsetzung der Präposition:
![]() welche gerade dazu dient, um einen Teil einer Sache zu bezeichnen, und hätte es daher hier, wenn Luthers Übersetzung gerechtfertigt sein sollte, heißen müssen:
welche gerade dazu dient, um einen Teil einer Sache zu bezeichnen, und hätte es daher hier, wenn Luthers Übersetzung gerechtfertigt sein sollte, heißen müssen:
![]()
Der Erfindung der gemischten Speisen folgte die Verfeinerung derselben, und die Menge der Gerichte nahm durch die Erfindung des Feuers von selbst zu. Denn einige Vegetabilien werden erst durch die zu ihrem Kochen angewendete Hitze heilsame Speisen, während sie in ihrem rohen Zustande schädlich oder doch schwer zu verdauen sind, wie Veitsbohnen, Zwiebeln und Kohlgewächse beweisen. Die Erdnuß wird bloß durch Hitze, welcher sie im Kochen ausgesetzt ist, mild und eßbar, nicht aber, wie man gewöhnlich glaubt, durch das Ausdrücken ihres Saftes. Auch die Wurzeln des Arums und der weißen Zaunrübe verlieren ihre Schärfe durch das Kochen.
Obst, Pflanzen und Kräuter waren der Menschen erste Nahrung, und erst Noah und seine Nachkommen erhielten nach der Sündflut die Erlaubnis, Fleisch zu essen und alles, was sich regt und lebt, mit der Bemerkung, sich des Blutes der Tiere zu enthalten. Im hebräischen Text heißt es: denn das Blut ist die Seele des Fleisches. Weil Eis Blut zersetzt, so verdirbt das Fleisch auf Eis. Es behält sein frisches Aussehen, verliert aber seine Vitalität – ist organisch zerstört. Man sollte aus diesen Gründen das Fleisch im Eiskeller aufhängen, so bliebe es kräftig, würde sich indes allerdings nicht so lange halten, als unmittelbar auf Eis. Am zweckmäßigsten aber wird das Fleisch in freier, womöglich Zugluft aufbewahrt. Diese kann sehr stark sein. In geschlossener Luft, also im Eiskeller, verliert es immer, auch wenn es über dem Eis aufgehängt wird, wegen der Einwirkung der Feuchtigkeit, die stets im Eiskeller herrscht. Die Oberfläche des Fleisches wird schliefig; und wenn sich auch das Innere notdürftig erhält, so verliert es doch alle Kraft und allen Wohlgeschmack. Nur frische, d. h. sich stets erneuernde, recht kalte Luft, am besten starke Zugluft, in welcher die Insekten sich nicht aufhalten, erhält das Fleisch gut. Man hängt das Fleisch in einem mit Gaze bespannten Garde-manger in einen unterirdischen langen Gang, der von Osten nach Westen geht und so angelegt ist, daß er nach Westen zu immer enger wird, wie ein Trichter, damit sich stets ein lebhafter Zug erzeuge. Das Blut ist aber eine schwere, höchst irdische, Melancholie erregende und zum Teil giftige Speise. Vor einigen zwanzig Jahren hatten sich mehrere Familien in der Gegend von Würzburg durch Wurst vergiftet, bei welcher Gelegenheit das giftige Prinzip der Blutsäure näher bezeichnet wurde.
Blut macht Menschen und Tiere grausam, was schon Tertullian (im »Apologeticus«) auseinandersetzt. Er läßt ängstliche Soldaten dadurch Mut gewinnen, daß man vor ihnen das Blut frisch geschlachteter Tiere ausgoß. Rousseau bemerkt (im »Emil«), daß der Genuß von Blut die Menschen rachgierig und zornig mache, Kräuter hingegen sanft. Ein Monarch, der Salat gespeist hat, würde also etwa danach einen Verbrecher begnadigen, aber nach einer frisch genossenen Blutwurst sein Todesurteil unterzeichnen.
Moses schränkte die allgemein gegebene Erlaubnis, Fleisch zu essen, wieder sehr ein, und Schildkröten, Hummern, Krabben und Austern bekamen einige Ruhe, denn er gebot, das nicht zu essen, was ohne Floßfedern und Schuppen im Wasser lebt. Daß aber Moses ausnahmsweise das Schwein als unrein und ungenießbar bezeichnet, das finde ich überaus liebenswürdig, und hätte mich, ein zweiter Lord Gordon, beinahe zum Juden gemacht, aber zu meinem Heil fielen mir noch zur rechten Zeit die Veroneser Salami und Braunschweiger, Lyoner und Jauerschen Würste ein, und Pied de cochon à la Sainte- Ménéhould und Côtelettes de porc-frais, Sauce Robert und Bayonner Schinken.
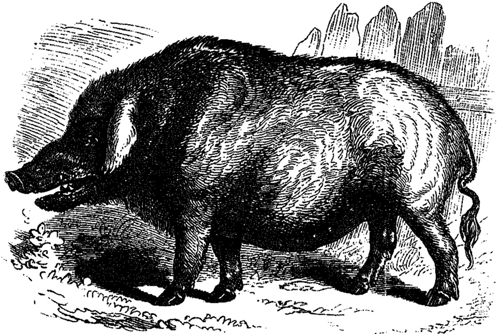
Daß das Verbot des Schweinefleischessens sich sogar aus den frühesten Zeiten des Menschengeschlechts herschreibe, wo man den Menschenfressern die Lust zum Menschenfleisch verleiden wollte, indem man ihnen das Schweinefleisch verbot, welches jenem überaus ähnlich schmeckt, behauptet der heilige Polykarp (in dem Briefe an die Philipper); Makrobius erzählt, daß Augustus, als er den Kindermord des Herodes gehört, gesagt habe: bei den Juden sei es besser, ein Schwein als ein Kind zu sein. Ein anderer Kirchenvater behauptet, daß deshalb Schweinefleisch verboten gewesen, weil das Schwein das einzige Tier sei, das immer nach dem Irdischen trachtet und durch den Beginn der jüdischen Religion der Sinn des Menschen nach dem Himmel gerichtet wurde. Als Beweis führt er an, daß die wildesten Schweine zahm und ruhig gemacht werden, wenn man sie auf den Rücken legt, weil sie nur erst dann den Himmel zu sehen bekommen, den sie vorher nicht sehen konnten.
Plutarch meint, die Ägypter hätten das Schwein verehrt, weil sie das Bearbeiten der Erde von ihm erlernten, und nicht aus Abscheu, sondern aus wirklicher Verehrung hätten sie davon nichts gegessen, woher sich auch bei den Römern die Sitte schrieb, daß sie im Monat April, beim Aussäen, der Ceres ein Schwein opferten, wie aus Ovid zu ersehen. Früher glaubte man, das arme Schwein habe aus Dankbarkeit sterben müssen, weil es den Menschen gelehrt, die Saat in die Erde zu vergraben.
Im 2. Buch der Makkabäer, 6. Kap., 18. Vers, wird von Eleazar erzählt: daß er vorzog, des grausamsten Todes zu sterben, ehe er das Stück Schweinefleisch, welches man ihm mit Gewalt in den Mund steckte, verzehren wollte. Einem König der Goten in Kastilien wurde vorgeschlagen, die Juden aus seinem Lande zu vertreiben. Er lehnte es ab, ließ aber in alle Brunnen Speck werfen; viele Juden starben (nach Fonseca) lieber vor Durst, als daß sie aus diesen Brunnen tranken. Der Kardinal Baronius erzählt (in seinen »Annalen der christlichen Kirche«), daß der Kaiser Hadrian nach der Empörung der Juden, zu ihrer Demütigung, an alle Tore ihrer Städte habe Schweine von Marmor setzen lassen, was zur Folge hatte, daß sie monatelang innerhalb der Mauern blieben.
Homers Beschreibung von den Gastmählern der Griechen zeigt doch etwas gar zu derbe Sitten. Die Könige schlachten selbst die Ochsen, sie ziehen ihnen die Haut ab, schneiden den Ochsen in Stücke, was doch bei uns die Funktionen eines Schlächtergesellen sind. Agamemnon legt dem Ajax den Rücken von einem Ochsen vor, und die höchsten Herrschaften und Halbgötter essen wie unreinliche Vielfraße. Des Herkules Gefräßigkeit ist ein sehr bekannter Gegenstand der griechischen Komödie. So sagt Aristophanes (in den »Fröschen«):
Teurer Herkules, kommst du? Tritt herein,
Die Göttin hat, als sie erfahren deine Kunst,
Gleich Brot gebacken, Brei von Hülsenfrüchten gekocht,
Zwei oder drei Töpf', einen ganzen Ochs geschmort,
Viel Kuchen gebacken, Pläze.
Dieser Gegenstand ward bis zum Überdruß von den Komikern behandelt, so daß Aristophanes, ob er es gleich außer den »Fröschen« noch in den »Vögeln« und den »Wespen« tut, sagen durfte, er habe die schluckenden Herkulesse und die hungrigen von der Bühne vertrieben, und ebenso die um das Essen betrogenen oder bestohlenen. Von solchen hat man noch Spuren auf altgriechischen Monumenten. Herkules, dem der ungeheure Becher in seiner Hand diebisch ausgeleert wird (Zoega, »Antike Basrelifs«, Taf. 69, 72). Selbst in der Tragödie hat Euripides dem Herkules etwas von diesem populären Charakter gegeben (in der »Alcestis«). Epicharmus sagt: »Hättest du den Herkules essen sehen, du würdest gestorben sein vor Angst! Aus seiner Kehle kam ein Gebrüll, seine Kinnbacken knackten laut; er fletschte mit den Augenzähnen, seine Backzähne knirschten; der Atem kam pfeifend aus dem Munde und den Nasenlöchern, und die Ohren bewegte er gleich einem vierfüßigen Tiere«; und Jon sagt (in der »Omphale«): seine erstaunenswürdige Gefräßigkeit ließ ihn das Fleisch verzehren samt den glühenden Kohlen, auf denen es gebraten war; und Pindar: er wendete auf den feurigen Kohlen zwei Ochsen, daß die helle Flamme emporschlug. Ein anderer griechischer Fresser wünschte sich, den Hals eines Kranichs zu haben, um länger genießen zu können. Ebensogut hätte er sich wünschen können, Ochs, Pferd, Kamel oder Elefant zu sein, wenn er glaubte, daß der Genuß mit der Größe der Gliedmaßen wächst.
Homer spricht weder von Geflügel noch von Fischen, weil er diese Speisen als Leckereien betrachtet, deren Zubereitung er unter der Würde der Helden hält; doch spricht er von kochendem Fleische. Aber unbezweifelt kannten die Helden Homers Gemüse. Die Gartenbeete, die wir in den Gärten des Alkinous finden, die mit soviel Sorgfalt gepflegt waren, lassen das mit Recht glauben. Auch aßen jene Helden, nachdem sie getrunken hatten, Zwiebeln; sie kannten selbst Obstbäume: Birnen reiften unaufhörlich auf Birnen, und Feigen auf Feigen. Homer spricht selbst von schönen Granatbäumen; er unterscheidet also. Der Genuß von Obst, selbst vor der Belagerung von Troja, ist aus der Strafe des Tantalus zu ersehen. Auch Fische aß man. Sarpedon vergleicht die Einnahme von Troja mit einem Fischgarne, welches man mit Fischen aus dem Meere zieht; aber Homer spricht nirgends von der Zubereitung der Fische.
Was mußte indes alles geschehen, ehe wir von den Homerischen und Ossianischen Rinderkeulen und der zwei-, ja mehrdeutigen spartanischen Suppe bei der Potage à la reine, der Coquille à la financière, bei dem klassischen Suprême de volaille anlangten!
Auch hier war die Natur Lehrmeisterin, und drei Sinne: Sehen, Schmecken und Riechen, waren, mehr als sie es jetzt sind, unsere ersten Wegweiser. Der Mensch in einem nicht verfeinerten natürlichen Zustande hatte schärfere Sinne als jetzt; alle Nomadenvölker, die Wilden, geben noch heute den Beweis davon. So mochte er, wie alle Tiere, das Schädliche vom Dienlichen durch jene Sinne zu unterscheiden wissen. Instinkt leitet so gut als Reflexion; die Natur gab verständige Winke. Geschmack und Geruch waren und sind noch die an- und absagenden Boten, welche uns zum Genusse laden oder davon abraten. So sind die schmackhaften und wohlriechenden Pflanzen gut, z. B. Jasmin, Lilie und Krokus, während die übelriechenden widrig und scharf sind, als: Koriander, Opium, Helleborus; endlich sind die ekelhaften mehr oder minder schädlich: Aloe, Senna.
So deutet dem Auge die düstere Farbe von allerlei Früchten und Blumen auf ein giftiges Prinzip, z. B. bei allen Gattungen von Nachtschatten, Blüte und Kraut vom Erdapfel, selbst die Frucht, solange sie grünt, sind giftig. Schafe und Ziegen werden über blühende Kartoffelfelder getrieben, um sie zu jäten; sie rühren sicher weder Kraut noch Blüte an. vom Erd- bis zum Paradiesapfel, die leichenfarbige Bilsenkrautblüte, der toddrohende Wüterich, die tückischrote Tollkirsche, der Finger- und Eisenhut, so daß jener spanische Dichter recht hat, wenn er sagt: die Farbe ist die Seele der Blumen. Linné will nicht bloß die dunkle Farbe der Blumen, sondern überhaupt das traurige Wesen einer ganzen Pflanze verdächtig machen, und daß man deshalb niemals von den schwarzen Beeren einer unbekannten Pflanze essen solle, weil er überhaupt die schwarze Farbe für das Zeichen eines heimlichen Giftes hält.
Der Geschmack aber, während das Gesicht gar mannigfachen Täuschungen unterworfen bleibt, ist ein zuverlässiger Führer. Das sich erhaben dünkende Auge, poetisch durch alle Himmel schweifend, wird von der Perspektive kindisch getäuscht; der Geschmack aber steht auf sicheren Füßen. Das Auge konnte allenfalls, gereizt von einer geleckten Katze, einer niedlichen Maus, einem glänzenden Eidechschen, lüsterner werden als von einer watschelnden Ente, oder gar von dem ekelhaften Krebs.
Man hat behauptet, es habe viel Mut dazu gehört, den ersten Krebs zu essen; ich glaube aber nicht Mut, sondern Lüsternheit führte ebenso sicher dazu, als nach der verbotenen Frucht im Paradiese. Eine schöne Hand, meine ich, ergriff zum ersten Male einen Krebs in jener Zeit, in der man die Gelüste der Schönen nicht nur entschuldigt, sondern ihnen sogar entgegenkommt.
So sahen die Spanier in Amerika lange mit Abscheu die Eingeborenen eine Schlangenart essen, die diese Guana nannten, eine in ihren Augen so delikate Speise, daß es dem gemeinen Volke nicht erlaubt war, davon zu genießen. Als aber die schöne Kazikin Anacouna bei einem Feste den spanischen Offizieren davon vorlegte, ließen sie sich zu dem Genusse verführen und fanden das Fleisch so vortrefflich, daß es von dieser Zeit an sich unter den spanischen Gastronomen einen bleibenden Ruf erwarb. So waren es in aller Welt und zu allen Zeiten immer Frauen, die uns des Lebens Genüsse kennen lernten oder dazu anreizten, und es sind Frauen, die sie uns verschönen und verfeinern. Indessen ist's doch nicht übel, den unglücklichen Untersuchungen der biederen Altvordern durch Wald, Feld und auch durch den Sumpf nicht ausgesetzt zu sein! Ich lebe viel lieber in einem überfeinerten Zustande, als roh, nach allerlei Gewürm laufend, im lieben Naturzustande.
Im allgemeinen widerstehen nicht nur scharfe Gifte dem Geruche, sondern die Mehrzahl derselben beleidigt die Zunge, die, beiläufig gesagt, nicht das einzige einer Geschmacksempfindung fähige Organ ist; denn der Gaumen, die Wände des Schlundkopfes, der tiefere Teil der Speise- und Luftröhre, teilen diese Eigenschaft. Das Sodbrennen z. B. ist eine Geschmacksempfindung. Die Zunge ist nicht allein Sinnorgan, sie ist das Werkzeug der Prehension, des Ergreifens und Anziehens äußerer Körper. So, wie wir nach einem Körper die Hand ausstrecken, so empfangen wir den Bissen mit der vorgeschobenen Zunge und ziehen ihn in die Mundhöhle zurück. Dies Anziehen ist ein innerliches, die Substanz dem Verdauungskanal zuführendes. In manchen Tiergattungen tritt die Bedeutung der Zunge zurück, oder verschwindet gänzlich, und die Prehension waltet vor. Dies gilt von der Zunge der meisten Herbivoren, weil dieselbe vorzüglich zum Abrupfen bestimmt ist; weniger gilt es von der stachligen Zunge des Katzengeschlechts, und in noch geringerem Grade von der zum Aufschlürfen bestimmten Zunge der Hunde und anderer Raubtiere. Bloßes Ingestionsorgan ist sie bei manchen zahnlosen Säugetieren, wie dem Ameisenfresser, den Schuppentieren und den meisten Vögeln, bei welchen sie eine hornartige Bildung hat.
Auf gleiche Weise besitzen – die Geschlechter der Affen ausgenommen – die meisten Säugetiere an den Vorderpfoten ein Tastorgan; dieses dient lediglich zur Ortsveränderung und Hantierung. Bei dem Elefanten ist der Rüssel Geschmacks- und Tastsinn, bei den Würmern die Fühlfäden, beim Kaninchen die Barthaare. Diese Organe gehören sämtlich zum fünften Nervenpaar, sind also von demselben Stamme, dessen einer Zweig, der Nervus lingualis, den vornehmsten Nerven des Geschmacks ausmacht.
Seh-, Tast- und Hörsinn sind mathematische oder Quantitätssinne, Geschmack und Geruch Qualitätssinne. Der Mund ist bei den Insekten mannigfacher gestaltet als bei dem Menschen; dagegen besteht ihr Herz nur aus einem langen Kanal, aus dem keine Adern entspringen, weil sie weißen, kalten Saft statt des Blutes haben. Die meisten sind im Larvenzustande große Fresser. Eine Raupe verzehrt jeden Tag fast achtmal soviel als sie schwer ist; dagegen nimmt sie nach ihrer Veredlung als Schmetterling auch edlere Grundsätze an und lebt fast nur vom Blumenduft.
Groß und mächtig ist das Gebiet des Geschmacks; alles, was auf Geruch wirkt, liegt in seinem Bereich. Die in der Luft aufgelösten ätherischen Öle, alle gewürzten, aromatischen Substanzen, die versüßten Säuren, die Gasarten sind sämtlich schmeckbar, wenn sie in indifferenten Flüssigkeiten aufgelöst werden. Tourtual, »Die Sinne des Menschen«. Eine Umkehrung aber gestattet dieser Satz nicht. Alle Kalien, Natron und Mittelsalze, alle Metalle, welche keiner gasförmigen Darstellung fähig sind, sind durchaus geruchlos, obgleich sie den Geschmack affizieren. Selbst das nach dem Lichte feinste Fluidum, nämlich das elektrische, ist nicht nur durch den Geschmackssinn wahrnehmbar, sondern einzig und allein durch ihn. Der Geschmack, gewissermaßen von der Natur dem Magen und dem Menschen zum Schutz auf den verlorenen Posten gestellt, ist nicht nur schärfer als der Geruch, sondern auch der einzige Sinn, in welchem wir nicht von den Tieren, ja von keinem einzigen Tiere übertroffen werden.
Gestützt auf die Analogie der verstandlosen Tiere, welche keiner anderen Leitung als der sinnlichen anvertraut sind, müssen wir bei dem engen Zusammenhang von Geruch und Geschmack mit dem Reproduktionsgeschäft als unbestreitbar festsetzen, daß es die Erhaltung und Förderung des Lebens ist, welche diesen Sinnen Bedeutung gibt. Nach dieser Voraussetzung tragen wir kein Bedenken, dem Geschmacke den Vorzug vor dem Geruche zu geben, da die Verdauungsorgane, welchen er zum Schutze dient, vielfältigeren Einwirkungen ausgesetzt sind als das Respirationssystem. Die Mehrzahl der Gifte erregt eine Geschmacksempfindung. Die Zunge besitzt für sie eine spezifische Empfänglichkeit; daher ist die Nützlichkeit dieses Sinnes ausgedehnter als die des Geruchs. Der Geschmack hat endlich vor dem Riechsinn voraus, daß er sein Urteil über die Salubrität des Gegenstandes bei seiner Berührung mit dem assimilierenden Organ abgibt, letzterer aber nicht eher, als bis ein Teil des zu beurteilenden Stoffes bereits durch den Atemzug in den Kreislauf überging. Geschmack und Getast haben vor den übrigen Sinnen das wichtige, sie charakterisierende Merkmal, daß keiner ihrer Nerven ausschließend die Sinnesempfindung oder die Bewegung des Organs vermittelt, sondern ein jeder von ihnen an und für sich schon sensitiver und bewegender Nerv zugleich ist.
Ein Mensch ohne Geschmack wäre das unglücklichste der Tiere. Das Gegenteil hat bekanntlich seine mannigfache Bedeutung, und dennoch konnte ein Geschmackslehrer – Bouterwek, noch obendrein in seiner »Ästhetik« – behaupten, der Geschmack sei, wegen seiner Unfähigkeit, geistige Gebilde anzunehmen, gar kein Sinn. Er sei nimmermehr imstande, uns in ästhetische Situationen, in höhere Regionen des Denkens zu versetzen. Wahrlich, er hatte seinem Geschmack enge Grenzen gesetzt! Was mag ihm wohl ein geistreich geordnetes, ästhetisches Mahl gewesen sein? und was die Küche? Doch gewiß nicht viel mehr als eine Häckselkammer, ein Heuboden oder eine Krippe. Fiel er, so läßt sich mit einigem Übermute fragen, über das Essen tierisch her, und wußte er sich keinen Genuß zu verkleiden, zu verschönern, zu reizen?
Viel weiser stellt dagegen Aristoteles die Empfindungen der Zunge denen des Auges gleich, indem er sieben Farben und ebensoviele Arten des Geschmacks bestimmt. Schwarz und weiß sind ihm die Grenzfarben; jenem entspricht das Bittere und Salzige, dem Weißen das Süße. Als Mittelfarben stellt er Gelb, Purpurrot, Grau und Blau; so liegt zwischen dem Bitteren und Süßen das Fette, Scharfe, Gewürzhafte, Herbe und Saure. Bei uns Deutschen, wie bei den Engländern und Franzosen, umfaßt das Wort Geschmack – taste, goût – das ganze Gebiet der Ästhetik. Diese Sprachphilosophie oder die Philosophie, die in diesem Worte sowohl unserer und der englischen, als den germanischen, doch auch ebensosehr in allen romanischen Sprachen: der französischen, spanischen, italienischen liegt, ist die beste Widerlegung von Bouterweks alberner und unschmackhafter, unverdauter und unverdaulicher Behauptung.
Aber auch der Geruch ist, wie gesagt, von großem Gewicht. Nur unserer Gewohnheit, die Künsteleien einer oft zweifelhaften Küche zu genießen, ohne sie durch den Geruch vorher zu untersuchen, haben wir es zuzuschreiben, daß unser Geruchssinn weniger vollkommen ist. Übrigens gibt es gar keinen Geschmack ohne Geruch, wie man sich ganz einfach durch ein festes Zuhalten der Nase überzeugen kann. Ich habe durch dies einfache Hausmittel mir sonst sehr widerliche Medizin ohne alle Unbequemlichkeit genießen lernen.
In der Regel hat ein Gourmand eine sehr feine Nase – die Aristophanes (in den »Fröschen«) die »feinausspürende« nennt – und sollte auch schon deshalb, aus einer Art von Dankbarkeit, die im Leben so oft verkannte Nase in Schutz nehmen. Wie ich denn auch keinen Augenblick zweifle, daß das von der Nase, diesem herrlichsten und wichtigsten Partikel des Gesichts, schändlich hergenommene Spitzwort »naseweis« von irgendeinem alternden Dummkopf zuerst gebraucht wurde gegen einen witzblitzenden, sich fühlenden Jüngling. Wenn es aber im Reiche der Nasen poetische Gerechtigkeit gibt, so muß derjenige, welcher für den Ausdruck »Vorwürfe erhalten« das Synonym »Nasen bekommen« gebraucht, die seinige verlieren, was ich selbst meinem Erzfeinde nicht wünschen kann.
Geistreiche Menschen haben sehr empfindliche Geruchsnerven, gleich den Göttern Griechenlands, die sich am lieblichen Geruch gern, wie alle Dichter behaupten, weideten. Abels Dankopfer steigt gen Himmel, »Das Feuer auf dem Altare soll brennen und nimmer verlöschen«, heißt es im 3. Buch Moses, 6. Kap., 13. Vers, und überall. Wenn Mahavida den Amru sucht, so folgt sie dem Hauche des Windes, der ihr den Duft zuträgt. Der feine Kardinal Alberoni hatte eine so feine Nase, daß er durch sie im Alter, als er das Gesicht verloren hatte, eine junge Dame von einer alten unterscheiden konnte. Rousseau hatte einen so feinen Geruch, daß er eine Geruchsbotanik hätte schreiben können, wenn die Zunge soviel Ausdrücke hätte, als es Gerüche in der Natur gibt. Kant konnte keine dürftigen Studenten im Auditorium leiden, weil die Exhalationen von mit schlechter Kost genährten Menschen ihm unleidlich waren; er nannte Leute, die viel Brot essen, gemeine Menschen. Napoleons Geruch war so fein, daß ihn der Teer und Schiffgeruch bei seiner Überfahrt nach Helena, wie ich von Augenzeugen weiß, krank machte; er fürchtete das neue Haus, welches man dort für ihn bauen wollte, bloß wegen des Geruchs der frischen Farbe so sehr, daß er vorzog, unbequem im alten Haus zu bleiben. Aber König Philipp II. von Spanien hingegen roch gar nichts.
Der allgemeine Grundsatz, daß eine Tafel die Sinne reizen, aber keinen Sinn auf Unkosten des andern schmeicheln oder gar beleidigen soll, gilt besonders für die so oft verkannte Nase, von der zu reden es fast unschicklich geworden ist. Ich lasse jedoch gern eine billige Ausnahme gelten; als solche z. B. das Biskuit für den starken Trinker, ich meine den Käse, wegen seiner vielfachen gastronomischen Vorzüge, die so groß und anerkannt sind, daß ein geistreicher französischer Schriftsteller ein Diner ohne Käse einer Schönen vergleicht, der ein Auge fehlt. So vergißt man etwa bei einer sehr braven Sängerin ausnahmsweise die Häßlichkeit. Ich vergleiche einen holländischen, einen Schweizerkäse, einen Fromage de Gruyère einer solchen Sängerin.
Mehr als unsere Sinne und unser Verstand leitet uns gegenwärtig die lange Erfahrung der Jahrhunderte, so daß wir eines Apicius Man muß den Apicius, welcher die Kunst erfand, die Schweine mit Feigen zu mästen, sowie ein anderes Gericht aus der Leber der Fische, als auch mehrere sehr nützliche Küchengeschirre, nicht mit dem Schriftsteller verwechseln, welcher, außer daß er ein Kochbuch schrieb, noch einen Kuchen und besonders die wichtige Kunst erfand, die Austern sehr lange frisch zu erhalten. im Altertum so hoch gepriesene Vorschriften lächerlich finden; seine berühmten Leberklöße von Honig und Käse mögen die Fliegen locken; ich würde mich dabei immer an das schöne Wort des Moses erinnern: »Du sollst keinen Greuel essen.«
Jedes Zeitalter, jede Erfindung war der Vorläufer eines Gerichts; mehr als das Pulver mußte erfunden, ja eine neue Welt entdeckt werden, damit uns durch Columbus von Guadeloupe die köstliche Ananas geholt wurde, diese Zierde jeder Tafel. Welche Hindernisse, ehe wir zu den Truthühnern kamen!
Die Gelehrten haben unendlich über das Vaterland der Truthühner gestritten. Französische Schriftsteller, allerdings nicht die gediegenen, behaupten, Meleager, nicht der berühmte Jäger, sondern der König von Mazedonien, habe 524 v. Chr. den ersten Truthahn nach Griechenland gebracht, und das dankbare Vaterland habe den Namen des Königs diesem Vogel gegeben, der Meleagride genannt, aber zuletzt so selten geworden sei, daß man ihn, gleich den Papageien, in Käfige gesetzt habe. Seit dieser Zeit schweige die Geschichte über die Truthühner, die erst unter Karl VI. wieder in Europa erschienen sein sollen. Jakob Cœur, Silberarbeiter des Königs, habe sie nach Frankreich gebracht. Darnach sei es unrichtig, daß man dies große Verdienst den Jesuiten zuschreibe. Diese seien erst 1562 nach Frankreich gekommen, Jakob Cœur schon 1456 gestorben. Diese Schriftsteller fügen hinzu: Diejenigen, welche behaupten, die Truthühner seien durch die Jesuiten nach Frankreich gekommen, wollen diese Behauptung dadurch rechtfertigen, daß man noch gegenwärtig in einigen Provinzen Frankreichs die Truthühner Jesuiten nennt. Man liest auf Departemental-Einladungskarten: Venez dîner chez-moi, nous aurons un jésuite gras et dodu. Man fragt an solchen Tafeln auch wohl: Dites-moi, s'il vous plaît, ce jésuite est-il tendre?
Alles das scheint unkritisch und gerade den Jesuiten möchte die bestrittene Ehre gehören. Erst seit der Entdeckung von Amerika sind – wie schon Buffon bewiesen hat – die Truthühner bekannt, und haben daher weder eine griechische noch eine lateinische Benennung. Eine Stelle des Ptolemäus soll auf Truthühner zielen, aber sie beweist nichts, auch abgesehen davon, daß dieser Schriftsteller sich besser auf die Gestirne als auf Puter verstand. Das Hauptargument wird aus dem 14. Buch, 20. Kap., des Athenäus genommen. Aber hier ist offenbar von Perlhühnern die Rede. Die Ätolier waren die ersten, welche diesen Vogel in Griechenland erzogen; es wurden alle Jahre auf dem Grabe des Meleager Kämpfe der Perlhühner gehalten. Die Fabel sagt: die Schwestern des Meleager wären in Verzweiflung über den Tod ihres Bruders in Meleagriden verwandelt worden, deren Tränen noch auf ihren Federn sichtbar wären, was auch nur auf Perlhühner paßt.
Aldobrand und viele ältere Schriftsteller behaupten, daß die Truthühner die wahren Meleagriden der Alten wären, die sonst afrikanische oder numidische Hühner genannt würden; dies sind aber wiederum keine anderen als unsere Perlhühner. Selbst Linné und, durch ihn verführt, Adelung fällt noch in jenen Irrtum, indem er sich bei den Truthühnern des Namens Meleagris bedient. Der Name numidischer Vogel ließ einen afrikanischen Ursprung voraussetzen, aber bloße Namen, oft von unerfahrenen Leuten erfunden, können nicht als Beweise dienen. Es ist unrichtig, daß die Alten unter Meleagris Truthühner verstanden haben, und in neueren Schriften geschieht ihrer immer erst nach Entdeckung Amerikas Erwähnung. A. W. Schlegel (»Über den Zustand und den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von Indien«) bestätigt neuerdings, daß die Truthühner vor dem 16. Jahrhundert in Europa unbekannt waren, daß es ausgemacht sei, daß sie nur in Amerika im wilden Zustande einheimisch und den drei alten Weltteilen fremd seien. Sie müßten frühzeitig, ohne Zweifel durch die Portugiesen, aus Indien gebracht worden sein, dies beweise schon der Name kalikutischer Hahn, von der Stadt Kalikut an der Küste Malabar, wohin der Verkehr der Portugiesen zuerst gerichtet gewesen sei. Die volksmäßige Verwirrung der Begriffe, welche sich in den sehr abweichenden Benennungen ausspräche (portugiesisch Peru, spanisch Pavo, französisch Coq d'Inde, Dindon, Dinde, holländisch Kalkoen, englisch Turkey), sei auch auf die Naturforscher übergegangen, und man habe sich über die eigentliche Heimat hin und her gestritten.
Ganze Wissenschaften, sich hoch brüstend und prahlerisch verkündend, der Natur alle Geheimnisse abgelauscht zu haben, leisteten am Ende der Küche allein reelle Dienste. Selbst die ob ihrer Feinheit und Eleganz hochgerühmte französische Philosophie verfiel in diesen angenehmen Materialismus. Als Lavoisiers großes Verdienst aller Augen auf die Theorie der Verbindungen und Zersetzungen richtete, ward Chemie, zum wahren Heil aller Küchen, Modewissenschaft; allein der Glaube, daß aller Erscheinungen letzter Grund in ihr gefunden, die Fiktion, daß alle Weisheit aus den Retorten komme, konnte sich doch nur in den Küchen halten.
Ein Werk, das aus den Fortschritten der Kochkunst und an ihnen den Maßstab der fortschreitenden Kultur entwickelte und die verschiedenen Völker klassifizierte, ist eine wünschenswerte Aufgabe für einen geistreich wissenschaftlichen Kopf. Wer ein Gläschen Seihing einem feinen Bordeauxwein vorzieht, oder wilden Katzenbraten, frikassierte Frösche, getrocknete Würmer und andere chinesische Delikatessen lieber will als Fasanen und Haselhühner und Straßburger Gänseleber, Perigordsche Trüffel- und rote Rebhühner-Pastete, der hat freilich Geschmack wie ein Chinese; mag man mir von ihm noch soviel Artiges erzählen, ich werde ihn immer vorsichtig aus einer zweckmäßigen Entfernung betrachten und beachten, und Scheu und Abscheu werden sich teilen zwischen ihm und seiner Tafel. Ich werde ihn jenem Lappländer an die Seite stellen, den man ganz zahm glaubte, bis er sich einfangen ließ, wie er heimlich eine Tranlampe an den Mund setzte, um in Behaglichkeit seinen Tran zu schlürfen.

Welche glückliche Revolution auf allen Herden seit der französischen Revolution! Ihr haben wir zu verdanken, daß so manche Hausmannskost verschwunden ist, mit welcher wir der Einquartierung nicht kommen durften. Sie sind verschwunden – die fetten Dampfnudeln, die grauen Erbsen mit Speck und andere für gebildete Magen unüberwindliche Gerichte, allenfalls gut, wenn man durch Wüsten zieht oder um die Welt segelt. Gut für Matrosen- und Kamelmagen und für den, der ackernd und pflügend und wirklich – nach dem alten Fluche, dem man aber artigerweise, wie aller Grobheit, aus dem Wege geht – im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen müßte. Ihr seid, sage ich, verwiesen, hinausgestoßen zum Pöbel, wo ihr hingehört; unwiderbringlich ist euer Ruf verloren; denn die Fortschritte der Wissenschaften und der Kochkunst laufen gleich zwei Parallellinien nebeneinander, und sie laufen schnell. So viel ist zu wissen und zu kochen, so viel zu lernen, daß ein guter Koch selten zu haben ist, trotz aller Kochbücher, deren Verfasser, beiläufig gesagt, von den Buchhändlern niemals so kurz abgefertigt werden als die Dichter, selbst die von Sonetten und anderen zartesten Blüten der Empfindung.
Wenn ich aber Küche und Köche mit Gedichten und Dichtern vergleiche, so finde man das nicht zu kühn. Goethe (im »Wilhelm Meister«) vergleicht eine Tragödie, und noch dazu eine von Shakespeare und noch obendrein den »Hamlet« mit einem Diner. Auch liefern freilich Dichter ebenso willig Sonette als Oden und Lieder, während man, um bei einem Gleichnis zu bleiben, einen besonderen Koch für das Rindfleisch, das Kalbfleisch, das Schöpsenfleisch haben sollte, und wiederum für Gemüse, Ragouts usw. Und selbst dies ist nicht genügend, wie ich durch einen einzigen flüchtigen Blick noch obendrein auf das Kalbfleisch beweise.
Wie heißt, wo wohnt, wer ist der Koch, der sich rühmt, und nicht bloß rühmt, gleich gut zuzubereiten: die Ohren, sowohl farcierte als marinierte; den Kopf, sowohl en matelotte als en tortue; die Zunge, en papillote und eine dito à l'Italienne; das Gehirn, sowohl à la poulette als en matelotte; ferner die Filets, sowohl gebraten als à la gelée; ein Frikandeau, aux laitues, à l'Espagnole oder dans sa glace; die Tendrons à la ravigote oder à l'oseille; die Ris piqués à la financière oder à la chicorée; die verschiedenen Coquilles und Attereaux, und wiederum die Füße und die Blanquettes und Croquettes; endlich die Kotelette nach ihren verschiedenen Klassen, Gattungen, Arten, Spiel- und Unterarten, als: au naturel, en papillote, à la maître d'hôtel, pané aux truffes, au champignons, au jambon, à l'écarlate, aux tomates, à la minute oder à la diable, oder à la Soubise, oder à la jardinière, oder à la Chartres? Hunderte umschweben meine Sinne, ich atme ihr Aroma; ich sehe sie vor mir in eigentümlicher Gestalt, Tracht und Farbe, »halb dämmernd wandeln sie zusammen in traulicher Eintracht«, sagt Fingal im Ossian – nicht von Kotelettes, sondern von seinen Kindern – und in ihrem duftigen Gefolge umwittern mich als Geister die angenehmen Saucen, und ich folge den weißen am liebsten, sowohl den Geistern als den Saucen.
Doch ich komme zu mir selbst. Es ist zwar ein Tisch, aber nur der Schreibtisch, hinter dem ich sitze und bemerke, noch keinen Koch gefunden zu haben, der sich in allen Kalbfleisch-Verhältnissen klassisch auszeichnete. Philosophisch gesprochen erfordert die beste Tafel den besten Koch für jede Schüssel; nur muß er eine recht praktische Kenntnis von allem übrigen haben. Denn wie man mit Recht von jedem bedeutenden Menschen nicht nur etwas Ausgezeichnetes verlangt, sondern eine weitumfassende, allgemeine Bildung voraussetzt, so sei es auch mit jedem bedeutenden Koche.
Aber es ist Zeit, daß ich Küche und Köche verlasse, um mich ernst und bedächtig dem Keller zuzuwenden. Das Sprichwort: »Küche und Keller verträgt sich nicht«, oder: »Wo der Koch liegt, kann der Kellner nicht liegen«, ist eines von den unwahrsten, das sich im Munde des Volkes herumgetrieben hat. Ich wette, daß es nicht vaterländischen Ursprungs ist, da man doch unseren Vorfahren die allzu große Nüchternheit weder bei ihren Gastmählern noch sonstwo vorgeworfen hat.
Schon zu Tacitus' Zeiten tranken die Deutschen viel, und mit einem gesteigerten Kulturzustande nahm diese uralte Sitte eben nicht ab. Zur Zeit der Turniere stieg in Deutschland das Trinken bis zur äußersten Höhe. Man trank nach gewissen Gesetzen, nach Kunstregeln, um die Wette. Wer den andern zu Boden getrunken hatte, daß er halb tot vom Schlachtfelde getragen werden mußte, war stolzer, als wenn er eine Schlacht gewonnen habe. Man brachte sich gemessene und ungemessene Gesundheiten zu, und da der Trunk für einen Beweis der Hochachtung und Freundschaft galt, so glaubte man nie zuviel trinken zu können.
Die Spuren der Trinkterminologie haben sich in vielen Ausdrücken bei den neueren Schriftstellern erhalten. Schlözer bemerkt: Noch schelten deutsche Kritiker alle Tage auf trockene, wässerige Werke; die Schriftsteller erschöpfen ihre Materie; der glühende Patriot klagt über die Großen, welche die Länder aussaugen. Seinem Freunde klaren Wein einschenken; ein erlittenes Unrecht dem Feinde eintränken; dem Fasse den Boden ausstoßen; in Liebe, in Lastern ertrunken; vom Glücke berauscht; jemandem das Maß voll geben. Lichtenberg führt (»Patriotischer Beitrag zur Methyologie der Deutschen« in den vermischten Schriften) mehr als hundertundfünfzig Redensarten an, womit wir Deutschen die Trunkenheit bezeichnen.
Luther hielt dafür, das Vollsaufen würde Deutschlands Plage bis an den Jüngsten Tag sein; jede Nation habe ihre eigenen Teufel; Deutschlands Teufel müsse ein Saufteufel sein. Noch aus einer späteren Zeit wollte ein Witzkopf aus der Art, wie man sich bei einer in ein Weinglas gefallenen Fliege benehme, gleich die Nationalität erkennen. Der Engländer, behauptete er, werfe den Wein samt der Fliege weg; der Franzose nehme die Fliege aus dem Wein, den er dann austrinke; der Deutsche stürze den Wein samt der Fliege hinunter.
Essen und Trinken verhalten sich nach meiner Überzeugung wie Raum und Zeit in der Philosophie, und wie Kraft und Last in der Mechanik, so daß sie gerade erst in geregelter und lebendiger Beziehung zueinander ihre eigentliche Integrität erhalten.
Doch halt! – Ich vergesse mich schon vor der Kellertüre, ja, was noch schlimmer ist, meine Begleiter bis hierher. So wende ich mich denn zu dieser zahlreichen, ausgesuchten und liebenswürdigen Gesellschaft, bitte zugleich um Entschuldigung, daß ich meinen Hut aufbehalten muß, nicht wegen der Kühle und Zugluft hier unten, sondern, weil ich durch den rostigen Kellerschlüssel und diese Lampe in meiner Rechten und durch den Weinheber in meiner Linken verhindert werde, ihnen meinen Kratzfuß in aller Form Rechtens zu applizieren. Ich wollte nur vor der ersten Kellerstufe Abschied nehmen von den Schönen, die mich bisher begleiteten. Schon der Kirchenlehrer Origenes schloß aus einer Stelle des Alten Testaments – deren genauere Bezeichnung ich zurzeit vergessen habe –, daß im hohen Altertume den Frauen bei Trinkgelagen der Zutritt verwehrt war.
Daß den hebräischen Frauen Wein trinken erlaubt sei, beweist eine negative Stelle im Moses (4. Buch, 6. Kap., 3. Vers). Anders war es mit den römischen Frauen, denen es durchaus verboten war. Valerius Maximus erzählt, daß Metellus seine Frau tötete, weil sie Wein getrunken hatte. Wenn wir dieses strenge Bewachen der Sittlichkeit in früheren Schriftstellern kennen lernen, so erfahren wir schon die Milderung dieser Regel in der mittleren Zeit römischer Geschichte, in der es den Frauen vergönnt war, Wein mit Wasser zu trinken, ein Getränk, welches sie Lora oder Lorea nannten, und zwar deshalb, weil die Römerinnen dieser Zeit auch Wein in das Wasser mischten, welches sie zum Waschen nahmen, wie wir aus Plinius ersehen, welcher erzählt, daß schon Cato dies Lora den römischen Frauen erlaubte. Auch Varro erzählt: Frauen im vorgerückten Alter war es gestattet, Lora zu trinken, aber weder Mädchen noch jungen Frauen. Aulus Gellius glaubt, daß dies Getränk deshalb Lora geheißen habe, weil zärtliche Männer, wenn sie ihre Weinbecher geleert hatten, den Becher für ihre Frauen mit Wasser füllten und nicht selten dabei vorher Wein darin ließen. Aus späteren Schriftstellern ersehen wir die Unmäßigkeit der römischen Weiber. So klagt Seneka: Unsere Frauen trinken mit männlicher Freiheit und durchwachen die Nächte mit gefüllten Bechern.
Aber es ist der Wein, meine Herren – denn nun sind wir hoffentlich unter uns –, ein zu wichtiger Gegenstand und ein zu geistvoller, als daß mir nicht einiger Ernst zugute gehalten werden sollte. Wenn man schon mit Schonung und christlicher Liebe auf die schweren Zungen und Füße sieht, welche so oft das gegenwärtige Auditorium verließen, so mache auch ich vertrauungsvoll auf Nachsicht Anspruch. Lagern, setzen Sie sich geduldig auf und neben die Stückfässer; nehmen Sie Tinte und Feder, ich meine Glas und Heber, und lassen Sie sich durch mein Beispiel zum Fleiß ermuntern. Schonung, Duldsamkeit lassen Sie uns üben, die ich von jeher negligierte, da sie zwar das Schaf und das bekannte Müllertier kennen, nicht aber Adler und Löwe. So war ich früher so gewiß eine übermütige, als ich jetzt und hier eine gutmütige Seele sein will; denn Tränen und Trinken passen immer zusammen, und Weine und weine scheint Ihnen sogar dasselbe, solange ich Sie nicht auf den Unterschied von Haupt- und Zeitwort aufmerksam mache.
Es ergibt sich, liebe Zuhörer und Mittrinker, daß Noah der erste gewesen ist, der den Wein getrunken hat. Das folgt aus meiner Kellerdevise: »Duldung und Nachsicht«, nach welcher ich annehmen muß, daß er sich der Wirkung dieses Getränks nicht so hingegeben haben würde, wenn er sie gekannt hätte. Diese Voraussetzung wird um so richtiger sein, wenn ich seine Frömmigkeit, die nicht mit Trunkenheit in Harmonie steht, im Auge habe. Ich folgere sogar, daß er nicht viel Wein getrunken haben wird; denn er war schon alt, als ihm das Familienunglück begegnete, und da kann man denn nicht so viel vertragen als in jüngeren Jahren. Auch läßt sich zu seiner Entschuldigung hinzufügen, daß er seinen Wein ebensowenig mit Wasser mischte als Sie, meine Herren.
Noah kannte den Gebrauch der Weinmischung mit Wasser noch nicht; diese ist eine Erfindung der Inder, in deren Leben allenthalben die Mäßigkeit vorwaltet. Bei ihnen läßt die Fabel den Bacchus von einer Nymphe mit Wasser nähren, was ganz offenbar auf die Vermischung des Weins mit Wasser hindeutet. Im Athenäus finde ich einen griechischen Tempel mit der Aufschrift: Bibe quinque et duo. Er war dem Gotte geweiht, der das humane Gesetz einführte, das Getränk zu fünf Teilen zu mischen, zu drei Teilen Wasser zwei Teile Wein zu trinken. Plato bezieht sich in seinem Dialog über die Gesetze auf jene Gottheit, indem er sagt: »Du mußt die Flamme nicht löschen, wenn sie auflodert; sondern mische Wasser zum Wein und du wirst nicht in Flammen geraten.« Wenn ich aber das Gesetz human nenne, welches so entsetzlich viel Wasser dem Wein zumischt, so gedenke ich des vielen Gewürzes, des dichten Einkochens der altgriechischen Weine, welches jenes Verfahren notwendig machte. Niemand wird uns und unseren Weinen ein Gleiches zumuten. Nur gewöhnliche, schlechte Weine mischt man mit Wasser. Unsere edlen Weinsorten mit Wasser zu mischen, wäre fast sündlich; aber schlechten Wein – den soll man nicht trinken.
Die schöne Sitte des Südens, zum Trinken einzuladen und durch Trinkgelage zu glänzen, hat sich mit den Fortschritten des Luxus im Orient ausgebildet, und während wir bei den Griechen und Ägyptern bloß von Speisegastmählern, sowohl im Hesiod als im Homer hören, so erfahren wir von südlicheren Nationen, von Persern und Indern, wie sie bei Trinkmählern zu glänzen suchten. So bewirtet der König Ahasverus (Buch Esther, 1. Kap.) unter bunten Tüchern, gehalten von scharlachenen Seilen in silbernen Ringen, und die Gäste sitzen auf bunten marmornen, goldenen und silbernen Bänken, und jedem wird nach eigener Wahl der Wein gereicht. Aber bloß vom Trinken ist die Rede; der Mahlzeit wird nicht gedacht.
Von den Indern hat sich diese Sitte, und erst in den späteren Zeiten, auf die Römer verpflanzt, da nur Juvenal und Martial und andere spätere Dichter Trinkgelage erwähnen, oft mit besonderem Eifer. Unendlich oft wird aber des Trinkens im Alten Testament erwähnt; das Taumeln (Psalm 60, und Jeremias, 51. Kap.) mag noch hingehen. Das Hefen austrinken (Psalm 75) ist etwas bäuerische Manier; den bitteren Trank, von dem im Jeremias (Kap. 8) die Rede ist, werde ich Ihnen, meine lieben Mittrinker, nicht zumuten; daß Sie aber Holz und Steine anreden sollten, wie bei dem Garzuvielen wohl geschehen sein mag, wie Sie namentlich aus dem Habakuk (Kap. 3) mit noch ärgeren Dingen ersehen werden, ist bei einiger Urbanität nicht zu erwarten; so wenig wie das Scherbenwerfen, von dem Hesekiel (Kap. 23) spricht. Rein unmöglich aber ist's, daß einem von uns das geschehen könnte, wovon im Habakuk (Kap. 3, Vers 16) die Rede ist. Diejenigen Wißbegierigen, welche die angezogene Stelle nachschlagen, werden mir beipflichten.
Bei den Griechen ward nur einmal der Becher herumgereicht, was sie Philotesia, Freundschaftstrank, nannten, wie aus Pindar zu ersehen ist, der eine seiner Oden Philotesia überschreibt. Dieser Sitte schließt sich der Gebrauch der Italiener an, den letzten Becher Brindisi, oder den Trank des heiligen Johannes zu nennen. Zu den Zeiten, wo von Brindisi aus die lebendigste Überfahrt nach den asiatischen Besitzungen der Römer war, gab es besondere Matrosengesänge, die man Brindisi nannte, und von denen mehrere diesen Refrain hatten. Ich habe von deutscher Jugend gehört: das Wort Brindisi komme her von: ich bringe sie dir, die Gesundheit nämlich, habe aber niemals daran glauben wollen.
Kaiser Domitian war ein abgesagter Feind des Weins. Bei einer momentanen Hungersnot – im Jahre 92 nach Christi Geburt –, wo fast kein Getreide, aber der Wein sehr gut geraten war, behauptete er, der Wein sei Ursache dieser Mißernte. Er ließ deshalb in einigen Provinzen des römischen Reichs einen Teil der Weinberge zerstören; in anderen Provinzen gänzlich, z. B. in Gallien. Die verkehrten Gesetze der Weinbeschränkung dauerten zweihundert Jahre, und erst Probus hob sie auf. Er verabschiedete seine Legionen zu Köln, und erlaubte den fremden Legionen Wein anzubauen. Schon hundert Jahre später – obgleich es zu Tacitus' Zeiten noch keinen Wein in Deutschland gab – waren die Moselufer reich an Weinstöcken. Am Rhein aber ward wohl der Weinbau vorzüglich durch Karl den Großen betrieben.
Karl IX. erließ auch strenge Befehle gegen den Weinbau; die Religionskriege hinderten aber ihre Ausführung, und Heinrich III. hob sie elf Jahre später wieder auf. Von den beiden Verfolgern des Weinbaus gab der eine das furchtbare Zeichen zum Blutbade in der Bartholomäusnacht, während der andere einer der größten Tyrannen war, unter dessen Joch die Menschheit jemals seufzte, und – wenig Wein trank. Gute Herrscher haben nie Gesetze zur Beschränkung der Tafelfreuden gegeben. Nur Tyrannen maßen sich Rechte über unsere Mahlzeiten zu. Der fürchterliche Karl IX. gab 1563 ein Gesetz, welches verbot, mehr als drei Gänge bei einem Festmahle zu geben: Entrée, Braten und Dessert. Er trieb die Barbarei so weit, bei Strafe von zweihundert Livres zu befehlen, daß Fleisch und Fisch nicht bei demselben Mahle gegeben werden durften. Karl VI. verbot durch ein Edikt von 1420, bei einem Mahle, außer der Suppe, mehr als zwei Schüsseln zu geben. Karl VI. starb als Narr.
Niemand sollte zweifelhaft sein, was leichter zu entbehren ist: guter Wein oder gutes Essen. Wer wollte nicht lieber etwas von dem schweren materiellen als dem edleren, geistigen Genuß entbehren? Jenes läßt sich mit einem schlechten Koch, dies gar nicht entschuldigen. Mit gutem Weine ist überhaupt schon die Idee des Mahles gerettet. Sehr richtig sagt das Sprichwort: der Hunger ist der beste Koch; aber daß der Durst der beste Mundschenk sei, hat noch niemand gesagt. Der zartfühlende Horaz entschuldigt sich bei seinen Gästen, wenn er ihnen nur leidliche Gerichte vorsetzte; er mutet ihnen aber nicht zu, ähnlichen Wein zu trinken; sein edler Falerner wird von dem Alter, sein Ligurier von unserer Jugend vergebens gewünscht.
Es ist eine unerklärliche Erscheinung, daß zu Horaz' Zeiten sehr wahrscheinlich in Italien besserer Wein erzeugt wurde als heute. Wahrscheinlich sind dieselben Weinsorten an denselben Stellen vorhanden wie zu Zeiten des Horaz. Bei Verona, und noch häufiger im Neapolitanischen, möchte man behaupten, noch dieselben Weinstöcke zu sehen; sie sind oft von der Dicke unserer Bäume, von Mannesstärke. In den allerneuesten Zeiten hat man angefangen, den Wein in Sizilien und Italien, z. B. dort den Marsala, den ich dem Madeira sec vorziehe, und hier in Toskana den Montepulciano, der vielen mit Recht gerühmten Bordeauxsorten an Blume und Geschmack, besonders an innerer Wärme vorzuziehen ist, auf verbesserte Art zu behandeln, wodurch diese Weinsorten allerdings besser und insbesondere dauerhafter geworden sind, was man früher nur durch das Kochen zu erreichen suchte. Lange hat man behauptet, das freie, halb wilde Wachsen der Reben zwischen Ulmen, Maulbeerbäumen, Getreide und Oliven, was vielen italienischen Landschaften ein so lustiges und festliches Ansehen gibt, habe dem Weinbau Schaden getan; die Weinfabrikation sei weit zurück gegen die des benachbarten Frankreich. Aber oft wiederholte und vielfache Versuche durch geschickte französische Weingärtner und Chemiker haben diese ganz wahrscheinlich aussehende Voraussetzung längst widerlegt. Andernteils hatten auch wiederum die Gallier zu den Zeiten des Posidonius nur in der Gegend von Marseille leidlichen Wein, weshalb sie den größten Teil ihres Bedarfs aus Italien kommen ließen, da doch gegenwärtig die italienischen Weine sich so selten ohne Gefahr versenden lassen. Es scheint, daß hier Luft und Licht, Gestirne und Gewölke ihre Eindrücke geltend gemacht haben.
Im tiefen Grunde der Flaschen und Fässer ruht Verborgenes! Aber von dort aus wird auch manches Rätsel gelöst, mancher Zweifel gehoben.
Durch scheinbare Kälte verbirgt der edle Rheinwein sein inneres Feuer, und läßt sein echt germanisches Herz nur durch die Blume ahnen, während der Witzbold Champagner, sprudelnd, ohne Vorrede, sein ganzes Herz öffnet und uns, wie ein alter Bekannter nach langer Abwesenheit, an den Hals springt.
Seitwärts, in bescheidener Entfernung, lächelt der Bordeaux, dieser vollendete Hof- und Weltmann, und der feurige Naturmensch Ungar, in ungarischen Beinkleidern, gestiefelt und gespornt, tritt stolz heran, um seine kostbare Freund- und Brüderschaft anzubieten; aber der Madeira steht als Mohr hinter dem Suppenteller, und obgleich sein blitzendes Auge sich daran erinnert, daß er dreimal die Linie passiert ist, so sagt mir doch sein ganzes Wesen – denn ich glaube, der Mensch ist Mohammedaner –, daß er eigentlich ganz nüchtern sei von Religions wegen. Ernst, selbst wenn etwas schwerfällig für seine bartlose Jugend, nähert sich der Burgunder, der sich zu dem Bordeaux verhält wie eine schwere Bravourarie von Portugallo zu der Rossinischen Kavatine.
Aber – – – ich denke, es ist Zeit, unsere Keller zu verlassen, um zur Oberwelt zurückzukehren! Lassen Sie uns bedenken, daß der erste Grad von Trunkenheit, dessen luftige Vorhallen wir eben berühren, nur allein derjenige ist, der verzeihlich, ja zuweilen wünschenswert. Aber es hat die Grazie, hier wie überall, mit leichtem Finger die Grenze gezogen. So laßt uns denn, liebe Freunde, in Furcht, sie auch nur leicht zu berühren, lieber einige Schritte zurück als einen Zoll vorwärts tun, und gönnt mir das Vergnügen, den ersten Grad von Trunkenheit zu schildern. Orfila: »Toxicologie générale.«
Dieser gibt sich durch einige Röte des Gesichts zu erkennen; die Augen werden feurig, die Stirn heiter, die Physiognomie wird freudiger und nimmt eine liebenswürdige Fröhlichkeit an. Der Geist ist freier, lebhafter, die Ideen fallen leichter zu; die Sorgen verschwinden; witzige Einfälle, süße Ergüsse der Freundschaft, zärtliche Geständnisse nehmen ihren Platz ein; man spricht viel, man ist unbedachtsam; die Reden sind etwas verwirrt; schon fängt man an zu stottern.
Freilich werden sich die verschiedenen Trinker anders zeigen. Der Schmecker ist in sich zusammengebogen, der Schritt der Füße ist enge; die freie Hand ist sanft, ohne Spannung der Muskeln, zusammengezogen und gern nahe unter der andern, die das Glas hält; die Augen sind klein, aber nicht so geschärft wie etwa bei dem auskostenden Kenner; zuweilen sind sie völlig geschlossen, zusammengekniffen; der Kopf steckt zwischen den Schultern. Der ganze Mensch ist, wie es scheint, in der einen Empfindung beisammen.
 Ganz anders der begierige, der durstige Trinker; denn hier nehmen die anderen Sinne alle an der Gier Anteil. Die stieren Augen stechen hervor, die Hände schlingen sich fest um das Glas oder, wenn sie es noch nicht halten, greifen sie schon darnach, ehe es erreicht ist; die Brust tut schnellere, lautere Atemzüge, und in dem Falle, daß der Mensch erst auf das Glas zustürzt, ist der Mund offen; die lechzende, schon einschlürfende Zunge erscheint auf den Lippen. – Ich beschreibe freilich den höchsten Grad von Durst, die anhela sitis, wie sie Lucrez nennt. Allein was sich hier in seinem höchsten Grade zeigt, das wird sich in geringerem Maße bei jedem schwächeren
Durste und überhaupt bei jeder nach außen gehenden Begierde finden; jede verwickelt die sämtlichen äußeren Kräfte des Menschen in ihr Interesse und ermuntert auch diejenigen, die zum Erlangen des Gegenstandes nur wenig beitragen und bei seinem künftigen Genüsse nichts mitempfinden.
Ganz anders der begierige, der durstige Trinker; denn hier nehmen die anderen Sinne alle an der Gier Anteil. Die stieren Augen stechen hervor, die Hände schlingen sich fest um das Glas oder, wenn sie es noch nicht halten, greifen sie schon darnach, ehe es erreicht ist; die Brust tut schnellere, lautere Atemzüge, und in dem Falle, daß der Mensch erst auf das Glas zustürzt, ist der Mund offen; die lechzende, schon einschlürfende Zunge erscheint auf den Lippen. – Ich beschreibe freilich den höchsten Grad von Durst, die anhela sitis, wie sie Lucrez nennt. Allein was sich hier in seinem höchsten Grade zeigt, das wird sich in geringerem Maße bei jedem schwächeren
Durste und überhaupt bei jeder nach außen gehenden Begierde finden; jede verwickelt die sämtlichen äußeren Kräfte des Menschen in ihr Interesse und ermuntert auch diejenigen, die zum Erlangen des Gegenstandes nur wenig beitragen und bei seinem künftigen Genüsse nichts mitempfinden.
Die Natur, sagt Fontenelle, ist nicht präzis, und dieser Ausdruck, so paradox er erscheint, ist sehr richtig. Da ich aber gern präzis bin, so laßt uns von hier aus, liebe Leser und werte Trinker, mit dem Bewußtsein der Selbstbeherrschung hinaufwandern an das Tageslicht, und wenn man uns, was nicht ausbleiben wird, dort kurzweilt und mit allerlei Geschichten über unsere Weinzüngelei neckt, so bietet sich wohl schickliche Gelegenheit zur ergötzlichen Rache.
Immer artig erscheint mir jene alte Anekdote, dem etwas streng prüfenden Weinkenner unterlegt, welcher Jahrgang und Ort jedes Weins herausschmeckte, bis er einmal nach langem Zweifel und vorsichtigem Schlürfen versicherte, der Wein schmecke etwas nach Eisen und Leder, was sich erklärt haben soll, als sich in der geleerten Tonne ein Schlüssel an einem ledernen Riemen fand.
Wo ist nun endlich, liebe Damen und Herren, der Meister zu finden, der das Gastmahl mit Geschmack und Grazie, mit Berücksichtigung der Persönlichkeiten anordnet? Damen lieben ohne Zweifel leichte Speisen, süßen Wein; starke Trinker verlangen gewürzte Ragouts; Engländer große Fleischmassen und Port- oder Xereswein; Franzosen kleine Schüsseln, zahlreich und bunt, ein reiches Dessert. Wenn ich einen unerfahrenen deutschen Jüngling an solchem Diner Anteil nehmen lasse, so ist's nur zu seinem Verderben. Im Glauben, es sei unartig, eine Schüssel unberührt zu lassen, wird er bald unterliegen im Kampf gegen ein halb Dutzend Hors d'œuvre, vier Entremets, ebensoviel Patisserien, den Fischen und Braten, Früchten, Cremen und Kompotts, und schon sehr schwach sein bei den Marmeladen, Konfitüren, Gelees und Biskuits, wenn ihn sonst die Weinsorten, die sich zwischen den Speisen durchschlängelten, nicht schon unfähig zum Kampfe gemacht haben. Einfacher serviert der Russe. Schon bei der Suppe stehen Fruchtkörbe und Kompotts auf dem Tisch, um auch den Unwissenden an Aufhebung eines Platzes im Magen zu erinnern, während ein feuriger Likör herumgeht, um den Genuß zu reizen und zu stärken.
Bei einem diplomatischen Mahle sah ich die Tafel zweckmäßig in verschiedenen Gängen aufgetragen, und die Dienerschaft schnell abtreten; dann folgte ein behagliches Plaudern, bis ein Zeichen mit der Glocke vom Wirt gegeben wurde, worauf die Türen sich schnell öffneten, ein Teil der Diener ab- und ein anderer den neuen Gang auftrug, um uns wieder dieselbe ungestörte Freiheit zu lassen. –
Bei einem Damendiner sah ich auf gleich verständige Weise reich und bunt gefüllte Blumenvasen und Réchauds mit Silberglocken von zierlicher Arbeit und darunter leichte Frikassees und süße Mehlspeisen; ebenso ein bunt-französisches Dessert mit südlichen und allerlei ganz fremd aussehenden Früchten, Biskuitvasen und Fruchtkörben von Zephiretten und Grazien getragen. Am artigsten fand man einen Porzellanaufsatz mit einem goldenen Mât de cocagne in der Mitte, an dem reizende Liebesgötter emporkletterten, wahrscheinlich um die, wer weiß von welchem mutwilligen Gotte, so hoch gelegten Pfeile und Bogen zu gewinnen. Ein duftiges Gebräu von Champagner und Ananas ward nicht verschmäht; hellbunte Gläser flogen gleich sehnsüchtigen Schmetterlingen an die Rosenlippen.
Nicht minder wichtig ist das Alter, Stand, Geschlecht der besonders zu berücksichtigenden Gäste, denen sich die anderen anschließen, weil das Wichtige immer das Herrschende sein und bleiben wird. Einen neapolitanischen Minister, der dem russischen Gesandten Kaviar als etwas ganz Rares in den Hundstagen Neapels vorsetzte, würde ich absetzen, wenn ich der König unter jenem glücklichen Himmelsstriche wäre. Dem Abul-Hasseim-Khan ward während seiner Gesandtschaft in England eine Einladung von einem hochstehenden Beamten. Dieser hatte sich viel Mühe gegeben, Spargel zu verschaffen, denn da es in der Mitte des Winters war, glaubte er seinem Gast eine angenehme Überraschung bereitet zu haben. Aber der Khan fragte ihn mit mißvergnügter Stirn, ob er ihn für ein Pferd ansehe, daß er ihm Kraut zum Essen vorsetze.
In Italien heilt man den Husten mit Eisessen; in Kopenhagen würde man davon den Keuchhusten bekommen. In Andalusien wirkt die Nahrung des Lappländers, wenn nicht als Arznei, doch als Gift; dieselbe Gabe Opium, die den Pommer tötet, reizt den Türken zur Exaltation; der starke Likör, der den Russen tätig macht, ist dem Spanier tödlich; in der Berberei sollen sich J. A. Schmidt: »Materia medica«. die Vornehmen ihr Leben durch eine so starke Dosis Ambraduft verlängern, die ich meinem Körper nicht einmal, geschweige täglich zumuten möchte. Ebensowenig möchte ich das Fett genießen, und die Menge gepökelter, eingesalzener und ranziger Fische, die ein holländischer Matrose gemächlich überwindet. Im Feldzuge von 1813 habe ich von Kirgisen Pilze essen sehen, die wir als giftig erkannten, und Fordyce erzählt, daß er einen Schwarzen gekannt habe, der sich eine Suppe aus Klapperschlangen kochte. Der Kopf wurde immer mit seinem Gifte in den Topf getan.
Die Wahl der Gerichte also, die der Gänge, die Reihenfolge der Speisen und Getränke, kurz alle Anordnungen hängen von Umständen ab, und schon Pindea, ein altspanischer berühmter Exeget, behauptet, daß ein Fest nicht durch die Menge der Gerichte, sondern durch die Art, wie selbige genossen werden, seine Bedeutung erhält. Es ist nur dann erlaubt, die Wahl der Gerichte eines Gastmahls dem Koch zu überlassen, wenn dieser mehr Geschmack hat als der Herr, und auch dann kaum; der Koch kennt schwerlich die geladenen Gäste. Friedrich der Große ließ sich alle Morgen den Küchenzettel vorlegen und änderte ihn häufig.
Wenn ich acht, vierzehn Tage im voraus zu einem Mahle geladen bin, feierlich, schriftlich, von einem halb Unbekannten, wenn sich etwa um den ganzen Einladungsbrief eine zierliche Vignette schlängelt, mit in Kupfer gestochenen Delikatessen aller Weltteile, die mir zum Teil so unbekannt sind, daß ich sehnsuchtsvoll ihrer Bekanntschaft entgegensehe, so schließe ich logisch und artig auf meisterhafte Zu- und Vorbereitung aller Art. Ich setze nicht voraus: die Aufschrift sei größer als der Sack; im Gegenteil, mein Geist verliert sich in angenehme Schwärmereien. Endlich naht der ersehnte Festtag; nach einer tüchtigen, vorbereitenden Bewegung eile ich zur Tafel. Mit Zufriedenheit und Vertrauen schließe ich von den guten Gästen auf das Mahl. Gute Gäste, sage ich, d. i. solche, die wissend sind, auf daß nicht eine edle Suppe auf einen unedlen Boden fällt. So ist denn der entscheidende Augenblick gekommen; die Türen zum Salon sind – der Kampfplatz ist geöffnet. Die Prozession dahin ist mit Würde, mit Feierlichkeit zurückgelegt; man setzt sich, und indem ich mit Vorsicht den schweren silbernen Teller, der vor mir steht, verstohlen leise aufhebe, vorsichtig auf der Hand wiege, überschlage ich flüchtig, was zu erwarten ist, wenn alles mit ihm in reiner Harmonie steht. – – Jetzt träume ich anmutig, lieblich, kindlich, gemütlich. Mein Gaumen schwelgt unter Palmen; aus Rosengebüsch tönt der Nachtigallengesang, begleitet vom Murmeln der Quellen, anmutsvoll getragen auf leisen Flügeln der Westwinde, durchhauchend – – und auf einmal dampft eine – graue Erbsensuppe durch die Blüten! – – Nein; ich bin so duldsam gegen einen Verstoß wie gegen einen derben Fehler, aber nicht gegen grobe Verbrechen. Ein Scherz, gut! Eine Mystifikation in schicklichen Grenzen mag hingehen! Aber wenn der Wirt, der durch seine Einladung die feierliche Verpflichtung übernommen hat, solange ich unter seinem Dache bin, für mein Wohl zu sorgen, zu denken und zu dichten, mich an dem gelinden Feuer vierzehntägiger Erwartung zu einem Göttermahle vorbereitet, um mich wie einen Tantalus zu behandeln – so sei ferner kein Verkehr zwischen uns. Wenn irgendein stiller Menschenkenner mich bei einer solchen Gelegenheit jemals beobachtet hat, so kann ihm die wehmütige Umgestaltung meines Wesens nicht entgangen sein. Saß ich nicht froh da und heiter in begeisterter Erwartung? Zart ruhte das Plektron, ich meine den Löffel, in meiner Rechten. Er entfällt mir, ich bin das Bild der getäuschten Hoffnung, des verborgenen Schmerzes, der sprachlosen Resignation, ganz wie Niobe, der blühenden Kinder der Phantasie mit einem Male, und aller beraubt. Den Wirt wünsche ich aber auf die Gewürzinseln, wo das Piper, nigrum et album, wächst! Ich erwarte von dem Manne jetzt, gleich beim Dampfe der unglückseligen Erbsensuppe, die Bemerkung, die er an das erste herumgehende Glas Wein knüpft. Dieser koste so und so viel, und das habe er von da und dorther; das habe ihm sein Freund, der Fürst von so und so, geschickt. Kurz, der Mann wird es sich unmaßgeblich merken lassen, daß wir andern das nicht so gut haben können. Er wird das Betragen eines jener Menschen zeigen, die nicht durch Talent und Verdienst, sondern durch die bizarren Launen Fortunas, blind und ohne zu wissen warum, in den Reichtum hineingeraten sind –, etwa mit dem Verdienst des Kranichs, der auch nach Athen kommt und Memphis gesehen hat.
Einer derjenigen, die es am besten verstanden, gute Gäste um sich zu vereinen, war der Staatskanzler Fürst Hardenberg. Bei einem Diner fand ich da einmal die sonderbarste Gesellschaft, daß ich im Anfange aus solcher Mischung gar nicht klug werden konnte. Fast keiner der Gäste stand mit dem andern in einigem Verkehr, die meisten waren sich ganz fremd. Militärs, Zivilbeamte, Bankiers, Schriftsteller, Fremde, bunt durcheinander. Bei Tische fand sich dann sehr bald der Punkt gegenseitiger Verständigung; jedes Glied der Gesellschaft verstand mit raffiniertem Geiste zu genießen, es war das erfreulichste Mahl der Welt und ein wahrhaft klassisches. Nie werde ich die dem Kanzler so eigentümliche, fein vornehme, verbindliche Weise vergessen, mit welcher er unsere verständigsten Bemerkungen belebte und zu immer neuen ermunterte.
Dafür hat er es aber auch schon allein verdient, wie Moses zu sterben, mit einem Blick auf das gelobte Land. Ich wenigstens kenne keine reichere, belohnendere Aussicht, als die aus dem Fenster des Hotel de Londres in Genua, vor dem er dahin schied, und habe lange genug dieselben Zimmer bewohnt, um die vollendete Schönheit dieser Aussicht zu fühlen. Unter diesem Fenster liegt der Hafen; man übersieht mit einem einzigen Blicke die weit daliegende Flotte. Gegenüber leuchtet der Pharus weit hinaus ins offene Meer, und in stolzer Pracht prallen von seinem Fuße die schäumenden Fluten zurück. Zur rechten Hand bergen in mächtiger Ruhe die Alpenhäupter sich in den Wolken, während ihr Fuß vom Meere bespült wird. Zwischen Pinien, Zypressen und Lorbeeren steht des großen Doria Statue und blickt hinaus in das beherrschte Meer. Wie prächtig! Hier starb unser Kanzler, bis zum letzten Augenblicke sich gleich bleibend. Ein alter Hausbedienter, bei dem ich mich nach den kleinsten Nebenumständen erkundigte, konnte den Kanzler gar nicht genug preisen, nur bemerkte er, daß es doch schade sei, daß er auf dem Wiener Kongresse dem Staate keine besseren Grenzen verschafft habe, und das war des Lobes ewiger Refrain. Das Ris de veau, sagte er, was der Arzt Seiner Exzellenz für denselben bestellt hatte, steckte noch am Spieße, als er unerwartet starb. Er war, setzte er geschwätzig hinzu, ein prächtiger Herr, ein großer Minister, mais – pas de frontière!
An den Staatskanzler schließt sich der auch als Dichter bekannte General Steigentesch an. Einen dezidierteren Gourmand, ja Gastrosophen mag es nicht leicht irgendwo gegeben haben. Wenn er die ganze Woche ernst über ein Küchenprojekt meditiert hatte, und gegen seine Leute eine Art Haustyrann gewesen war, so konnte er sich wiederum stundenlang mit seinem Koch unterhalten. Mit salbungsvollem Ernste stellte er ihm ein andermal die Wichtigkeit seines Berufs vor; er setzte ihm auseinander, wie oft der gute Name, das Wohl und Wehe, das ganze Familienglück von dem Koch allein abhänge. Niemals sind lange Predigten mit mehr Eifer und innerer Überzeugung gehalten worden.
Der Luxus eines gut geordneten Diners, sagte er mir einmal, muß sich von der Suppe gradatim steigern, und erst beim Dessert darf er in der reichsten Fülle seines Glanzes sich offenbaren. Deshalb fängt es ganz einfach mit dem Tageslichte an und muß, als wolle man zuletzt nichts der Natur und alles der Kunst verdanken, bei buntfarbigem Kerzenschein enden, wo dann nur noch feine Liköre, kandierte Früchte, geistreiche Bonbons, schwere Weine, in englischem Kristall und auf französischem Vermeil, die Runde machen. Gute Diners enden so, wie schlechte beginnen, nämlich damit, daß man den Gästen warmes Wasser vorsetzt, nur mit dem Unterschiede, daß man von letzterem den Mundzwang, den Kinnbackenkrampf bekommt. Denn dieser ist, wie ich, der entschiedene Feind aller schlechten Mahlzeiten und entsteht gleichsam als Rache dieses beleidigten Organs nach anhaltend schlechten Nahrungsmitteln bei wenigem Getränk, und kann (nach Larrey, Napoleons Leibarzt) jeder neue Anfall der so entstandenen Krankheit nur durch höchst gewählte Kost vermieden werden.
Der Sinn für die höhere Kochkunst, fuhr der General in seiner ergötzlichen Predigt fort, bildet sich freilich erst im fortschreitenden Alter; der Gourmand ißt leider nur noch mit den Weisheitszähnen, und wenn er älter wird, ißt er vorzugsweise das am liebsten, was er nicht zu kauen braucht, weil er das eben wenig kann. Komisch und ergötzlich sah es aus, wenn während des Mahles eine Tirolerin im Eßsaale in einer kleinen kristallenen Maschine Butter machte, damit sich jeder Gast von der Frische der Butter augenscheinlich überzeugen könne. Ich verdarb es einst auf lange Zeit mit ihm, als ich, bei einem sogenannten diplomatischen Probediner, einige Tage vor dem wirklichen, eine Wachtel für eine Leipziger Lerche aß, ein kulinarisches Verbrechen, welches er mir verziehen, aber niemals vergessen hat. Fast ebenso empfindlich war er gegen den König von Dänemark, der die Artigkeit hatte, ihm nach Wien eine Probe des weltberühmten Likörs zu schicken, den Madame Fouls auf Martinique in unübertroffener Güte fabriziert. Der General fand, daß die Probe keine echte sei, und war undiplomatisch genug, das nach Kopenhagen zu schreiben. Vielleicht war die Folge davon, daß er nie dahin auf seinen Gesandtschaftsposten zurückkehrte. »Kinderchens!« rief der General einmal in Mitte eines heiteren Soupers, »heute wollen wir einmal morgen zu Bette gehen!«
Peter der Große machte bekanntlich einen Küchenjungen zum General, Minister und Fürsten. Ludwig XIV. wollte nicht nur einen ehemaligen Koch – Gourville – zum Minister erheben, sondern machte wirklich jemand dazu, von dem er weiter nichts gehört hatte, als daß er eine neue Sauce erfunden. Selbst der große Rothschild liebte seinen Koch, den noch größeren Carême. Es war aber auch ein wahrer Genuß, diesen Künstler Befehle zu einem Gastmahle erteilen, die verschiedenen Mischungen zu den seltensten Gerichten leiten zu sehen. Wenn er nach heiligen, der Muse einzig geweihten Stunden im Sofa saß und kochte, so schien es, als ob ein Orakel seine Stimme erschallen ließe; alles um ihn her verstummte.
»Jacques!« rief er begeistert. »Si votre canard est plumé, vidé et flambé, vous lui troussez les pattes en dedans de cuisses vous le donnez au garçon pour le brider avec de la ficelle et vous l'assujettissez avec l'aiguille à brider et de la ficelle, vous lui frottez l'estomac avec un jus de citron et vous mettez des bardes de lard dans votre casserolle, votre canard dessus; vous le couvrez de bardes, vous mettez au poêle pour le cuire.« Nach kleinem Bedenken fuhr er fort: »Une heure trente-cinq minutes avant de servir, vous le mettez au feu; faites-le mijoter jusqu'au moment de servir, vous l'égouttez, le débridez et le dressez ensuite sur le plat; vous mettrez plein trois cuillières à dégraisser d'espagnole travaillé, le jus d'une bigarade, avec un peu de son zeste; vous placerez cette sauce au feu: au premier bouillon vous la verserez sur votre canard.« Indem er diese Worte sprach, schrieb er mit goldener Schreibfeder in ein dickes Buch, in Maroquin gebunden, mit goldenem Schnitt, ein paar Worte, um zu bemerken: zwischen welchen Gerichten und wann die Ente aufgetragen werden solle zur gehörigen Notiz für den Haushofmeister, und schüttete zugleich mit der linken Hand Gewürze in eine Kasserolle, die der Gegenstand seiner ernsteren Betrachtungen war. So dreifach, wie Cäsar, beschäftigt, gab er, mit dem Kopf winkend, verschiedene Befehle, und um ihn standen einige Köche mit Tiegeln und Pfannen, damit er die sublimsten Mischungen selbst verrichte – mit den Kunstfingern. Was endlich Vatel, den großen, unsterblichen Vatel anbetrifft, diesen Cato von Utica der Küche und Köche, so ist sein tragisches Ende zu vortrefflich in den Briefen von Sévigné beschrieben, als daß ich mir getrauen könnte, ihm noch ein Denkmal im Tempel der Gastrosophie zu setzen.
Dr. Alibert sagt: Ein wahrer Koch muß die Kunst verstehen, Nahrungsmittel durch das Feuer zu modifizieren. Diese Kunst erfordert tiefe wissenschaftliche Studien; man muß lange Zeit über die Produkte der Erdkugel nachgedacht haben, um die Speisen mit Geschick anzurichten, sie wohlschmeckend zu machen und die besten Ingredienzien zweckmäßig verwenden zu können.
Auch sollen unsere Tafeln zugleich den schönsten Gärten in der Pracht des Anblicks nichts nachgeben. Jeder Tag, ja jeder Gang hat seine eigene Farbe. Zur maigrünen Suppe sind die Nebengerichte ganz anders als zum himmelblauen Hecht schattiert; und ich wollte keinem Koche raten, eine Sauce Couleur de procureur général zu einer grünen mit Silber inkrustierten Pastete zu geben, oder Mosaik auf dem Schinken aus anderen Farben zusammenzusetzen, als wovon die Frisur an Hammelkeule oder der Email anderer Krusten gemacht ist. Ich wollte keinem raten, im Frühlinge, wo die Natur und die Tafel mit Blumen besetzt sein muß, einfarbige oder wohl gar rote und gelbe Gallerte zu geben, und die Tafel mit modernen Dormans zu gruppieren, wenn der ganze Aufsatz à la Romaine ist. Der Kaiser, der sich durch die Erfindung der Farcen einen unsterblichen Namen gemacht, und zuerst Fische von Schweinefleisch und Schinken von Käse erfunden hat, würde gegen unsere heutigen Köche eine schlechte Figur machen und seine Tafel, worauf er oft zur Pracht alle Speisen in Petit-point oder künstlich gestickter Arbeit nachahmen ließ, gegen die unsrigen, wenn sie mit Gerichten von Porzellan oder Email besetzt sind, sehr verlieren. Unsere Köche sind in der Mythologie, Geschichte, Dichtkunst, Malerei, Heraldik, überhaupt in allen nur möglichen Wissenschaften weit erfahrener als mancher Professor, und es würde schade sein, wenn sie nicht eine Belagerung besser ausbacken könnten als der größte Feldherr. Aus diesen Gründen mochte wohl Ludwig XV. bei seinem berühmten Leibkoche Montier Von Montier ist es übrigens ganz bekannt, daß er zur Vervollkommnung seiner Kunst Medizin und Chemie studiert hatte. Unterricht in der Kochkunst nehmen. Dieser Fürst las alles, was über diese Materie geschrieben wurde. Er unterhielt sich eines Tages bei der Marquise Pompadour mit einem neu angenommenen Koche derselben, und fand sich sehr geschmeichelt, als ihn dieser für seinesgleichen hielt und ihn fragte, wieviel Gehalt er habe. Ganz besonders tat er sich darauf etwas zu gut, jedesmal auf einen Messerhieb ein Ei aufschlagen zu können. Seinen Lieblingen gab er zuweilen in Trianon ein kleines Mahl, von ihm selbst bereitet, wie der Herzog von Richelieu erzählt. – »Wie haben Sie«, frug er diesen Marschall, der siegreich von Majorca kam, »wie haben Sie die Feigen dort gefunden; man sagt, sie seien vorzüglich?« Richelieu klagt über die verbrannten Omelettes des Königs, die er natürlich vortrefflich finden mußte. Den Königen fehlt eine Haupteigenschaft guter Köche – Geduld.
Die Markgräfin von Bayreuth hält sich in ihren Memoiren darüber auf, daß ein Diplomat ihr eines Tages mit Hilfe von Kompaß, Zirkel und Papier ein Diner beschreibt, sie muß aber am Ende doch zugeben, daß sich derselbe einen brillanteren Ruf an seinem Hofe verschaffte durch die Art wie er Beefsteak à l'anglaise bereitete, als sich der geschickteste Minister jemals erwerben könnte. Sie setzt hinzu, daß sie hiernach begreife, wie es durchaus nötig sei, ein guter Koch zu sein, um ein großer Staatsmann zu werden.
Wenigstens sind, merkwürdig genug, die ersten und wichtigsten Hofchargen von Küche und Keller genommen. Der Ober-Hofküchenmeister ist eine bedeutende Exzellenz und der Erz-Mundschenk ein mächtiger König. So schätzten es sich der große Condé und der Herzog von Beaufort, die Helden der Fronde, zur besonderen Ehre, unter ähnlichen Titeln ihrem Könige bei Tische aufzuwarten, wie sie namentlich öfter bei den Lustpartien zu Fontainebleau taten. Ein gleichzeitiger Schriftsteller (Choisy, »Memoires«) bemerkt, daß sich Condé dabei ebenso groß als auf dem Felde seiner Siege zeigte.
Der bekannte Fürst Potemkin, der berühmte Prinz von Nassau und Branicki, Kron-Großfeldherr von Polen, bereiteten der Kaiserin Katharina und dem Kaiser Joseph auf ihrer Reise nach Cherson eigenhändig ein Mahl, welches so abscheulich war, wie man es bei so noblen Köchen irgend erwarten konnte.
Solange in Deutschland Leute von Verstand und Bildung, ja, solange es vornehme Herren unter ihrer Würde halten, sich um die Küche zu bekümmern, solange werden wir keine athenischen oder Pariser Diners haben. In Frankreich verschmähten die Höchststehenden es nicht, sich sehr genau um die Küche zu bekümmern: viele neue Gerichte sind aus der besten Gesellschaft hervorgegangen. Der große Colbert gab als Erfinder einer Suppe seinen Namen, der Marquis von Béchamel der Steinbuttsauce. Die Filets de volaille à la Bellevue sind erfunden von der Pompadour im Schloß Bellevue für die kleinen Soupers des Königs. Sie war die Tochter eines reichen Schlächters und die Frau eines reichen Finanziers. Sie erfand auch die Filets à la Pompadour. Der Marschall Prinz Soubise, ein schlechter General aber vortrefflicher Hofmann, erfand die Carbonnade à la Soubise, und sein Schwiegersohn, der Prinz Guémenée, besonders bekannt durch einen Bankrott von 28 Millionen Franken, erfand die Carré de veau à la Guémenée und mehrere Ragouts, die ihn nicht weniger als sein Bankrott unsterblich machten. Die Frau des Marschalls von Luxemburg, eine der gründlichsten weiblichen Gourmands am Hofe Ludwigs XV., erfand die Poulets à la Villeroi; sie war früher an den Herzog von Villeroi vermählt. – Das Pain à la Orleans ist eine Erfindung des Regenten und der Vol au vent à la Berry eine der Herzogin von Berry, seiner sehr geliebten Tochter. Der Vol au vent à la Nesle ist eine Erfindung des Marquis de Nesle, der die Pairie refüsierte, um der erste Marquis Frankreichs zu bleiben; die Poularde à la Montmorency vom vorletzten Herzog dieses Namens vor der Revolution. Die Filets de veau à la Montgolfier vom Luftschiffer, weil sie so aufgeblasen sind als ein Luftballon. Die petites bouches à la reine haben ihren Namen von der Maria Leszczynska, Gemahlin Ludwigs XV., die, als eine Fromme, der Gourmandise sehr ergeben war. Alle Entrées, die den Namen Bayonnaise führen, wie es auf vielen älteren französischen Speisekarten heißt (korrumpiert aus Mahonnaise), sind eine Erfindung des Marschalls Richelieu, nach dem Orte seiner berühmtesten Waffentat. Die Rebhühner à la Montglas erkennen für ihren Vater jemanden dieses Namens von der Magistratur in Montpellier, der durch seine gastronomischen Kenntnisse berühmt war. Die sehr schwierig zu bereitende Sauté de pigeons au sang sowie auch die Chaille à la Mirepoix sind von der Marschallin dieses Namens erfunden, Potage à la Xavier von Ludwig XVIII., und à la Condé auch von einem Prinzen aus königlich bourbonischem Geblüt; die Pain de chasse à la Poniatowski von diesem; die Baba, ein Kuchen, der in Polen sehr beliebt ist, vom König Stanislaus Leszczynski, der mit allem Praktischen der Küche ebenso bekannt war wie sein königlicher Schwiegersohn in Frankreich. Endlich sind die Ris de veau à la d'Artois eine Erfindung von König Karl X. In Wien habe ich Catalani-Pußerle und Paganini-Brot gegessen.

Von Cäsar rühmt es Plutarch ganz besonders, daß er ein Gastmahl so gut zu ordnen verstand als eine Schlacht. Hätte Napoleon das eine so gut verstanden als das andere, so würde er sich Freunde erworben haben und nicht auf Helena gestorben sein. Sind doch mächtige Reiche durch Gastmähler gestürzt worden! Als Cyrus sich gegen seinen Großvater Astyages auflehnen und den Unterschied seiner Regierung mit der seines Großvater anschaulich machen wollte, ließ er am ersten Tage die Perser arbeiten und bewirtete sie am zweiten aufs herrlichste, und alle fühlten den Unterschied und wollten alle Tage gut leben. So gewann er das Perserreich. Als Pausanias nach der Schlacht von Plataeae das Feldgerät des Mardonius erbeutete, ließ er durch die persischen Köche und Bäcker ein köstliches Mahl bereiten und die Obersten der Hellenen berufen. »Seht«, rief er aus, »die Torheit des Meders, der einen so herrlichen Tisch führt und zu uns kam, um unsern erbärmlichen zu nehmen!«, woraus doch wohl folgt, daß selbst die Spartaner, trotz ihrer abscheulichen Suppe, Sinn hatten für etwas Besseres.
Das größte Gastmahl aber, das je im Altertume gegeben wurde, ist, wenn ich nicht irre, das bei der Leichenfeier des Abner, bei welchem Feste nicht nur die Vornehmsten, sondern das ganze Volk eingeladen war, der Vornehmste, nämlich David, allein ausgenommen. Von dem prächtigsten Gastmahl aber erzählt Josephus. Der Sohn des Herodes gab bei seines Vaters Tode ein siebentägiges Leichenfest mit solcher Verschwendung, daß er dadurch vom reichsten Erben zum ärmsten Manne in Judäa ward. Auch der weise Salomon wird niemals müde, das Essen und Trinken, und zwar sehr gutes, zu loben. Nach ihm hat der Mensch nichts Besseres unter der Sonne zu tun, denn essen und trinken und fröhlich sein. Er sagt: »Iß dein Brot mit Freuden, trinke deinen Wein mit gutem Mute; von vieler Mühe und Arbeit bekommt man Schmerzen und Grämen und Leid; darum ist's besser, essen und trinken und guter Dinge sein.« »Wer hat«, ruft er aus, »fröhlicher gegessen und sich ergötzt, denn ich?«
Aber man mag viel oder wenig essen, man kann es der Welt damit niemals recht machen, wie schon Matthäus im 11. Kapitel bemerkt: »Johannes ist gekommen; er aß nicht und trank nicht; so sagten sie: Er hat den Teufel. Des Menschen Sohn ist gekommen, isset und trinket; so sagen sie: Siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Säufer.«
Die Alten hielten ihre größten Mahlzeiten daher gern bei Nacht, so konnte man wenigstens die Trunkenheit nicht sehen. Dies geht unter anderem hervor aus dem ersten Briefe an die Thessalonicher (5. Kap., 7. Vers). So ist auch die Stelle im Matthäus (22. Kap., 13. Vers) zu verstehen, da man sonst gar nicht begreift, wo die Finsternis auf einmal herkommt. Auch das berühmte Fest des Belsazar, von dem Daniel spricht, war ein Nachtfest. Aber die merkwürdigste Stelle über die rechte Zeit zum Essen ist Prediger Salomonis (10. Kap., 17. Vers): »Wohl dir, Land, des Fürsten zur rechten Zeit essen!« ruft Salomo aus.
Im vierzehnten Jahrhundert aß der König von Frankreich um acht Uhr des Morgens zu Mittag und ging abends zur selben Stunde mit den Hühnern zu Bette. Zur Zeit Philipps des Guten von Burgund hieß es:
Steh auf um fünf,
Iß zu Mittag um neun,
Geh' zu Bette um neun,
Und du wirst leben der Jahre neunundneunzig.
Unter Heinrich IV. und Ludwig XIV. ging man um elf zu Tische; unter Ludwig XV. um zwei Uhr, und dieser Gebrauch dauerte bis zur Revolution. Noch vor 50 Jahren aß der König von Spanien um zwölf Uhr zu Mittag; unter der Regierung Heinrichs VIII. frühstückten die Leute von gutem Ton in England um sieben Uhr und aßen um zehn Uhr des Morgens zu Mittag. Zur Zeit der Königin Elisabeth dinierte man um elf Uhr und soupierte zwischen fünf und sechs Uhr, eine Zeit, in der man sich heutzutage in England kaum zum Diner setzt. Jetzt ist die Zeit des Essens in England sehr verschieden. Ich erinnere mich, daß ein Bekannter von mir sich um halb neun Uhr zum Souper bei dem Kanzler Eldon zu Tische setzte, aber um dreiviertel zehn Uhr aufstand, um sich zu Georg IV. zum Diner zu begeben. In Paris wurde ich einmal auf einen Ball geladen. Auf der Einladungskarte stand gedruckt, daß man um drei Uhr (des Morgens) das Souper auftragen werde. Ich aber war zugleich für denselben Morgen zu einer Jagdpartie eingeladen, und das Frühstück für das Rendezvous, sechs Stunden von Paris, war um fünf Uhr.
In Frankreich ist sechs Uhr die Stunde des Diners. In Paris heißt aber um sechs Uhr meist sieben Uhr, und sechs Uhr präzis halb sieben Uhr. Gastrosophen, in Furcht, daß durch Warten gewisse Speisen (Braten, Mehlspeisen) verdorben werden, setzen auf das Einladungsbillett die Stunde des Diner und entweder: Un quart d'heure de grace pour les dames, oder l'heure militaire; im letzteren Falle wird mit dem Schlage der Uhr angerichtet. Ein Witzbold hat gesagt, daß die Franzosen, durch das ewige Hinausschieben der Stunde des Diners damit endigen würden, erst den folgenden Tag zu Mittag zu essen.
In England herrscht die schlechte Sitte, daß man in vielen Häusern erst eine Stunde nach der Stunde der Einladung erscheint, so daß man in steter Furcht ist, zu früh oder zu spät zu kommen. Lord Minto, englischer Gesandter in Berlin, wollte dies an der Tafel des sehr pünktlichen hochseligen Königs nachmachen, fand aber alle bei der Tafel. In Ostindien herrscht die sehr schöne Sitte, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang sich zum Mittagstisch einzufinden. In Deutschland aßen wir bekanntlich bis zur französischen Revolution fast durchaus um zwölf Uhr zu Mittag, bis wir durch eine spätere Stunde einen längeren Morgen gewannen. Jener Philosoph hatte ganz recht, der, als man ihn fragte, welches die beste Zeit zum Essen sei, zur Antwort gab: »Für Reiche, wenn sich der Hunger einstellt, und für Arme, wenn sie etwas zu essen haben.«
Man hat den Einfluß der Nahrungsmittel auf einzelne Individuen, wie auf ganze Völker, noch nicht hinlänglich untersucht, und doch ist derselbe, und zwar ganz augenscheinlich, von den größten Folgen auf den ganzen tierischen Organismus. Zwar behauptet Hasselquist: alle Speise, die den Körper nicht verändert, sei Nahrung; aber ich bin der Meinung, daß gerade Nahrung eins von den Dingen ist, die den Körper fortwährend verändern, und schon Favorinus in seinem Kommentar zum Aulus Gellius zeigt diesen Einfluß auf die bestimmteste Weise. Nach wiederholt angestellten Versuchen bekommen junge Ziegen, die von Schafen gesäugt werden, weiches und wolliges Haar, während auch umgekehrt Lämmer, von Ziegen genährt, struppige und harte Haare bekommen. Pflanzen ändern bekanntlich nicht nur die Farbe, sondern oft den Charakter nach dem verschiedenen Boden, der sie ernährt. Es erzählt Justinus von einem Spanier, der, weil er in seiner Jugend von einem Reh getränkt wurde, ein vorzüglicher Läufer ward. Aristoteles behauptet sich überzeugt zu haben, daß Schafe, die an Abhängen der Berge weiden, mehr schwarze als gefleckte Schafe erzeugen, je nachdem das herabfließende Wasser mehr oder minder mineralische Teile durch stärkere oder schwächere Regengüsse enthalte, und daß der Fluß Skamander seinen Namen daher habe, weil Schafe, die aus diesem Gewässer trinken, blond würden, was im Griechischen Skamandros oder Xanthos bedeute.
Ich weiß nicht, welcher Schriftsteller behauptet hat, daß sich ganze Völker wegen der Verschiedenheit der Saucen hassen. Als der Marquis Caraccioli, neapolitanischer Gesandter in England, gefragt wurde, wie es ihm in diesem Lande gefalle, antwortete er: »Wie soll es mir da gefallen, wo es hundert verschiedene Religionssekten und nur eine Sauce gibt?« Voltaire wirft es den Engländern vielfach vor, daß sie keine anderen Saucen kennen als die von zerlassener Butter. Gewiß ist doch wohl, daß Tiger-Kotelette einen anderen Humor geben werden als ausgekochtes Kalb- und Hammelfleisch. Dem breiten, stämmigen Engländer sieht man so gut seine großen saftigen Fleischmassen, als dem zarteren Franzosen die ätherischen Saucen, feinen Ragouts und kleineren Portionen an. Die Holländer würden weniger phlegmatisch sein, wenn sie nicht so viel eingesalzenes, gedörrtes und gepökeltes Fleisch, weniger Fett genössen, welches alles die Verdauung erschwert, also träge macht. Die Lebhaftigkeit des Spaniers erklärt sich zum Teil durch den vielen Gebrauch von Gewürzen und Zwiebeln. Es scheint, daß die alten Deutschen den Magen geradezu für die Integrität des ganzen Individuums ansahen, sie nannten ihre nächsten männlichen und weiblichen Erben Schwert- und Spillmagen; sie handelten Krieg und Frieden, ihre wichtigsten Angelegenheiten bei ihren Gastmählern ab; daher diese niemals nüchtern waren. Die neueren Diplomaten haben dies beibehalten; wie sie es mit dem letzterwähnten Punkte halten, mag der Himmel wissen. Soviel ist gewiß, daß bei ihnen Häuser und Küchen sinnverwandt sind; in einem guten Hause ist aber oft nichts gut als – die Küche.
In den frühesten Zeiten natürlicher und einfacher Anschauung aller Dinge der Außenwelt hat man den großen Einfluß der Nahrungsmittel auf Denk- und Empfindungsweise vielfach anerkannt. Es heißt (Hebräer, 5. Kap., 14. Vers): »Den Vollkommenen, die durch Gewohnheit geübte Sinne haben, gehört starke Speise.« In einer Prophezeiung über Jesus (Jesaias, 6. Kap., 15. Vers) heißt es: »Butter und Honig wird er essen, daß er wisse, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen.« Huarte stellt hierbei die Meinung auf, daß Christus, als Zeichen höchster Weisheit, wohl zuerst seine Weisheitszähne bekommen habe, und daß nach Galen ein Gemisch von Butter und Honig den Durchbruch der Weisheitszähne sehr erleichtere.
Von jedem Gericht ist eigentlich zu verlangen, daß es nahrhaft sei und leicht verdaulich, daß der Geschmack vollkommen sei. Die Schönheit muß dem Geschmacke gleichen, der Geruch endlich sei einladend. Oft muß man sich mit einigen dieser Eigenschaften begnügen. Ich muß bei dieser Gelegenheit vor allerlei unbedeutenden, unnützen, häßlichen Gerichten warnen. Obenan steht das Spanferkel, welches schon der allgemeine Grundsatz verwirft: daß kein Gericht einen Sinn geradezu beleidigen soll – ein Grundsatz, der nicht bloß auf die Tafel, sondern auf jeden veredelten Genuß anzuwenden ist. Den Gaumen zu kitzeln, während die Augen beleidigt werden, ist entschieden Barbarei. Was aber kann ein Auge mehr verletzen, als daß mitten unter den lachenden Tafelfreuden, die in bunter Mannigfaltigkeit den rohen Genuß verbergen, sich ein geschundenes Schwein darstellt, dessen leichenfarbige Haut an Embryonen in Spiritus erinnert. Friedrich der Große sagte (Ode an seinen Koch Noël) bei Gelegenheit dieses von ihm verachteten Gerichts, man soll die Leichname, die zur menschlichen Speise bestimmt sind, maskieren:
Un cuisinier qui brigue la louange,
Doit déguiser les cadavres qu'on mange.
Der wilde Schweinskopf ist wenigstens keiner Leiche ähnlich, er ist mit Blumen verziert, und die Zitrone im Rüssel gibt ihm ein humoristisches Ansehen; der Kalbskopf aber, mit seiner gelben Sauce, ist dem Greuel verwandter, und wird gewiß selten von Jungfrauen und Damen überhaupt genossen werden, weil diese immer Widerwillen gegen alles Rohe, Anstößige, die Sinne Verletzende haben. Deshalb ist mir die Gewohnheit mancher Gegenden, daß man die Enten peitscht, ehe man sie schlachtet, vielleicht nach ähnlichen Grundsätzen, nach welchen Ziegen vom Dache gestürzt werden, ordentlich lieb; denn dieses schändliche, unsaubere und dumme Vieh, dies geflügelte Schwein, verdient nichts Besseres.
Die Taube ist dagegen zwar ein liebenswürdiger Vogel, schön in der Luft, aber schlecht in der Schüssel. Nach der Meinung der Syrier brütete eine Taube im Euphrat das Ei aus, welches die Göttin der Liebe verschloß; daher dieser Vogel, der Liebling der Venus, den Syriern so heilig war, daß sie ihn (nach Sextus Empiricus) für unverletzlich erachteten. So viel ist gewiß, daß kein Gastrosoph ein Freund dieses Vogels ist, es müßte denn in Bouillon, in Suppen sein. Im südlichen Europa ist das Taubenfleisch saftiger und blander, so daß es in der französischen Küche schon geduldet wird, während es in Neapel und noch mehr in Lissabon mit Recht zu dem zartesten Geflügel gehört und den Fasanen an die Seite gesetzt wird. In Persien sind die Tauben, wie schon Tavernier in seinen berühmten Reisen bemerkt, äußerst schmackhaft und so groß wie Kapaunen.
Makkaroni sollte man nur in Neapel essen. Dort werden sie nicht mit der Gabel, sondern mit dem Löffel gegessen oder auch, selbst in bester Gesellschaft, mit den bloßen Fingern; selbst König Ferdinand I. hatte diese Gewohnheit. Das kleine, von Fremden selten besuchte Volkstheater San-Carlino in Neapel zeigt die rechte, echte und fast unbeschreibliche Art des Makkaroni-Essens. Die Hauptrolle aller Stücke ist der Macaroni (lustige Person, Hanswurst), der auch fast alle Abende vor dem Publikum seine Makkaroni verspeist. Man muß diese beliebte Person gesehen haben, wie sie dies Gericht mit zierlicher Fingerbewegung manipuliert! Wie Schneeflocken fällt es hinab; er spielt damit wie mit artigen Bändern, und es tut dem Zuschauer wie dem Schauspieler leid, wenn er damit zu Ende ist.
Ganz besonders warne ich vor allerlei Eingeweiden, namentlich Lebern, Gänselebern ausgenommen. Den Geruch verbrannter Leber flieht der Teufel, und schon der Erzengel Raphael läßt für die vom Teufel besessene zukünftige Frau des Tobias den Rat geben, daß er eine Leber braten möge, weil dieser Geruch so schändlich sei, daß ihn der Teufel selbst nicht ertragen könne (Tobias, 6. Kap., 20. Vers). Raphael glaubt, weil, wie es im Hiob heißt, es auf Erden keine Kraft gibt, die der Teufel fürchte, so müsse man mit diesem Geruch, der eine neu erzeugte Kraft sei, dem Teufel zu Leibe gehen können. Diejenigen Kirchenväter, welche solche Stellen, gewiß mit Unrecht, symbolisch zu nehmen pflegen, da doch ohne alle Symbolik solcher Geruch den Teufel wohl zu vertreiben geeignet ist, deuten die Leber als Organ des Gebets und meinen, wie der Herr Herz und Nieren prüfe, so seien überhaupt die Organe des Unterleibes die religiösen Organe und in diesen stehe die Leber dem Gebete vor. So Valesius im Buch De philosophia sacra, und Eugubinus De perenni philosophia, aus welchem Grunde auch der heilige Ambrosius im Morgensabbatgesang sagt:
Lumbos, jecurque morbidum
Adure igne congruo.
(Meine Nieren und meine Leber erglühen dir im feurigen Dank.) Soviel ist gewiß, daß leberkranke Menschen gern beten und Betschwestern gern leberkrank sind.
Der Einladung zu einem Dilettantenkonzert und einem Liebhabertheater muß man noch eine dritte und vierte Plage hinzurechnen, nämlich die zu einer freundschaftlichen Mittagssuppe und zu einem Familienmahle. Sogenannte Hausmannskost ist in der Regel ein plumpes, ungeschicktes Essen, ohne Geist und Verstand, ohne System und Ordnung, grob gehandhabt; man steht hungrig davon auf. Shakespeare (»Komödie der Irrungen«, 3. Akt, 3. Szene) läßt einen Bediensteten sagen:
Willkommen auf ein mäßig Mahl gibt frohe Feste;
worauf der Herr sehr verständig antwortet:
Ja, für 'nen filz'gen Wirt und für noch kärg're Gäste. –
Schon die Athener liebten so wenig wie die Franzosen Familienessen, wo, unter dem Vorwande ganz freundschaftlicher Behandlung, der Magen mißhandelt wird. Zwei Schriftsteller, zweitausend Jahre voneinander entfernt, drücken sich sehr verwandt darüber aus. Boissy in seinen »Dehors trompeurs« hat folgende Stelle:
Le Baron
Nous mangerons ensemble un poulet sans façon, Et je veux vous donner un dîner d'ami – –
De Forlis
Non. Je crains ces dîners-là, j'aime la bonne chère Va, traite-moi plutôt en personne étrangère.
Menander, den zuverlässig der Chevalier Boissy nicht gelesen hatte, sagte:
– – daß die Güte der Götter
Mich für immer von einem Familienmahle bewahre!
Trauriger Kreis, wo die Verwandten glänzen,
Wo der Magen leidet und ernst vereint
Kinder und Enkel, Kusins und Kusinen
Versammelt sind, als war' es zum Opfer;
Alle leiden gemeinsam am Fasten.
Der Wirt zuerst, mit dem Glas in der Hand
Erzählt längst vergang'ne, bekannte Geschichten,
Das Haus erzittert unter seiner gewaltigen Stimme.
Und seitwärts die Hausfrau, die biedre Matrone,
Mischt im Fistelgetön sich in das ernste Gespräch
Und unterbricht das ohnedies traurige Mahl.
Jedes Gericht erhält seine Beschreibung.
Ihr zur Seite Onkel, Tante und Großmutter;
Und bei jedem Gericht werden die Freuden
des Lebens strenge getadelt – – –
Ebenso verschrien wie die Familienmahle in Athen waren, so beliebt waren die sogenannten Picknicks. Will Aristoteles beweisen, was besser sei, ob der Staat von einem oder von einer ausgesuchten kleinen Zahl regiert werde, so beruft er sich auf solche Picknicks. Die besten Gastmähler, sagt er, sind die, bei denen jeder Gast ein Gericht mitbringt.
Die Pariser Köche geben alle Jahre unter sich ein solches Picknick; es hält aber sehr schwer, Zutritt zu bekommen, wenn man nicht Koch ist. Es soll das beste Diner der Welt sein, denn jeder Koch gibt das Gericht, welches er am besten zu bereiten versteht. Ich weiß es zwar nicht, ich setze aber gewiß mit Recht voraus, daß diese Gesellschaft verabredet, welche Schüssel jeder Koch bereiten soll, seinen bekannten Fähigkeiten und Kräften angemessen. Denn wenn es nur auf Willkür ankäme, auf Überraschungen hinausliefe, so möchte es eher zu einer Fresserei als zu einem wohlgeordneten Mahle werden. Dieses muß einen leitenden Gedanken haben, einem bestimmten System angehören, welches über dem Bedürfnis der Sättigung steht, wie die Form der Poesie über dem in Prosa ausgesprochenen Inhalte.
Den Ärzten gehört die Polizei bei Tische; dem geistreichsten Weltmanne die Leitung des Gesprächs. Daß weder das eine noch das andere Sache der Gelehrten sei, beweist Luther in seinen gar zu derben Tischreden. Ein berühmter Jesuit, der Pater Franziskus Mendoza, behandelt die Frage, ob die Alten bei Tische mehr gesprochen als geschwiegen haben (in seinem Veridario, 44. Problem) und schließt sehr auf das Schweigen, weil bei dem Essen nichts so gefährlich sei als Streit, im Schweigen sich aber der Zwist löste. Eine Bemerkung, die Streitlust verrät; denn Sprechen ist nicht Streiten. Auch irrt der gute Pater sehr. Aus tausend Stellen alter Schriftsteller läßt sich mit aller Bestimmtheit nachweisen, daß die Alten bei Tische gern, gut und viel sprachen.
Ein heiteres Gespräch fördert die Verdauung. Cicero sagt (in der letzten Rede gegen den Verres) von einem Gastmahle bei demselben. Es war ein Gastmahl, nicht getrübt von dem schweigenden Ernste der Prätoren und Imperatoren, noch von der scheinbaren Klugheit, in welche sich Magistratspersonen bei Gastmählern gern hüllen möchten, sondern es herrschte dabei ein reger Lärm, lautes Rufen, lebendige Handbewegung, ja nicht selten das Anlegen der Hände ans Schlachtschwert, so daß öfter ein milder, harmonischer Schlachtlärm zu hören war, und der fröhliche Lärm verhallte, so recht die Mitte haltend zwischen Schlacht- und Liebesgesängen.
Ich finde das gar gut, aber freilich nur bei einem Gastmahle für Männer. Selbst Alcibiades scheint nur solche gewünscht zu haben, er sagt: Mit meinem Lehrer lieb' ich zu frühstücken; mit Staatsmännern spreche ich am liebsten beim Mittagstisch, und meine Abendmahlzeit kann mich nur mit Frauen ergötzen.
Ganz artig sagt ein lateinisches Sprichwort: Im Forum rede, bei Tisch schwatze. Ich verkenne den Alkibiades ganz, wenn er nur Staatsmänner, also einen gewissen Ernst bei Tische verlangt, der ihm sonst bei ernsterer Gelegenheit fern war, und der auch in allem Ernste dabei nicht nötig ist. Die Grazie kennt keinen Ernst oder, um mich richtiger auszudrücken, sie macht kein ernstes Gesicht, selbst nicht zu schwerer Arbeit; denn sie ist Grazie dadurch, daß auch Schweres ihr leicht wird. Bei den Diners und Soupers Ludwigs XIV. stand (Tribouillet, Etat de la France, Tome IV.) ein Gardeoffizier hinter dem Stuhle des Königs, der niemandem erlaubte, mit dem Könige von Staats- und anderen ernsten Angelegenheiten zu sprechen.
Steigentesch pflegte zu sagen: »Kommen Sie nur nicht hungrig zu Tische, wenn Sie geistreich vor dem Dessert sein wollen; mit ihm entwickeln Sie erst den geistigen Luxus; da öffnen Sie die sprudelnden Quellen Ihrer bis dahin ruhenden Geister. Reden Sie bis dahin nichts Rechtes und um Himmelswillen weder Tiefes noch Gelehrtes; vergessen Sie nicht, wozu Sie da sind – zum verständigen Essen und Trinken.« Bis dahin war er selbst matt, es blieb zweifelhaft, ob man es mit einem bedeutenden Menschen zu tun hatte oder nicht. Aber mit dem Dessert deboutonnierte er sich wie der witzsprudelnde Champagner, wie ein Feuerwerk mit Raketen.
Ich verlange die Gespräche bei Tische ebenso leicht und abwechselnd als die Speisen: jene sollen ebensowenig den Kopf wie diese den Magen drücken; die beste Probe für beide ist, wenn Kopf und Magen sich darnach leicht fühlen. Man vergesse nie, daß man nicht plaudert, wenn man streitet. Ein angenehmes Kosen mit Schüsseln und Gästen ist an rechter Stelle, und wenn es jemals erlaubt ist zu sprechen, ohne sich um die Antwort zu bekümmern, so ist's hier. Wenn zuletzt die Unterhaltung einem tüchtigen Tutti am Schluß eines geräuschvollen Konzerts gleicht, dann ist sie vollkommen.
Bei einem solchen Diner haben wir mit Lust geübt und gelernt: heiter zu genießen; so wandeln wir weiter, von Diner zu Diner zur Küchen- und Kochvollkommenheit!
