
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

So frißt's Würmlein frisch Keimleinblatt,
Das Würmlein macht das Lerchlein satt,
Und weil ich auch bin zu essen hier,
Mir das Lerchlein zu Gemüte führ'.
Goethe
Der Magen ist das digestierende und zum Teil assimilierende Organ, von dem aus bloß für die Fleischmasse des Inhabers gesorgt wird. Aber wer nennt mir Taten und Untaten aller derjenigen im blätterreichen Buche der Weltgeschichte, die ihr historisches Dasein den Anregungen des Magens durch dessen gesamte Skala vom leisen Knurren bis zum lauten Schreien verdanken? Ja, wie manche Weltgeschichte sogar verdankt ihre voluminöse Kompilation einem hungrigen Magen. So auch sendet die Brust, das Gebläse, welches dem Körper den sehr nötigen Sauer- und den weniger nötigen Stick- und Kohlenstoff zu- und abführt, nach innen zu nichts als tierische Wärme, aber nach außen den lebendigen Hauch, den sehnsuchtsvollen Seufzer und das schaffende Wort, knüpft Menschen an Menschen und ordnet die Welt ihnen unter. Selbst das Auge, das den kleinen Menschen mit unermeßlichen Sonnensystemen in Verbindung setzt, es hat auch innere Funktionen für die Selbständigkeit und kann als Lichtlunge betrachtet werden. Die gesichtslosen Organismen – die Pflanzen – brauchen Licht als unerläßlich zum Leben, und wen rührt das tote Leben der dem Licht entzogenen Gefangenen nicht? Auf solchem Wege lernen wir die Absonderungen in unserem Munde als eine solche Zweideutigkeit kennen, die allerdings im Magen zur Bereitung des Chymus und Chylus und aller jener lateinischen und griechischen Flüssigkeiten beiträgt, wodurch selbst der Lehr- zum Zehrstande sich erniedrigt. Aber im Munde hat sie einen andern Zweck, dort ist sie das Smegma zur Erhaltung der Volubilität und Beweglichkeit unserer Sprachwerkzeuge, damit wir den Faden unseres Gesprächs rund und ununterbrochen leicht fortspinnen.
Nach dieser Abschweifung, obgleich es, wenn ich in dieser Schreibart fortfahren wollte, ebensowenig Abwege wie in einem Labyrinthe gibt, wende ich mich zum Hauptgegenstande dieses Werkes – zum Magen. Allerdings verlangt die Natur auch für ihn nur das Notwendige, die Vernunft aber fordert das Nützliche, die Eigenliebe das Angenehme und die Leidenschaft das Überflüssige. Ein Freund von mir, der viele hatte – viele Leidenschaften nämlich –, pflegte, wenn er ihnen die Zügel schießen ließ, zu seiner Entschuldigung zu sagen: Götter haben Leidenschaften!
Helvetius behauptete, der Mensch sei vorzugsweise ein fleischfressendes Tier; Rousseau sieht im Gegenteil die sich von Fleisch nährenden Menschen als entartet an. Gassendi verfaßte ein Werk, worin er zu beweisen suchte, daß wir nur zu vegetabilischer Nahrung bestimmt sind und Fleischessen ein gefährlicher Mißbrauch sei. Er lebte auch nach den Grundsätzen der Hindu, aber – er war immer kränklich. Ich behaupte aber, der Mensch sei Omnivore; denn er zieht seine Nahrung ebensogut aus dem Tier-, Pflanzen- als auch aus dem Mineralreich, und diese glückliche Eigenschaft ändert sich nur teilweise nach Klima und Sitte. Daß der Mensch zu den Omnivoren gehört, dafür spricht also die Erfahrung, ebenso aber auch die vergleichende Anatomie. So sind z.B. die Zähne ein Gemisch von Zähnen der pflanzen- und fleischfressenden Tiere; der Dick- und Blinddarm ist nicht so lang und weit als der der Pflanzenfresser, und nicht so kurz und eng als der der Fleischfresser, sondern zeigt eine mittlere Länge und Weite. Gall will auch in der Bildung des Gehirns und Schädels einen Beweis dafür gefunden haben, daß der Mensch zu den Allesessern gehört. Er behauptet nämlich, daß, wenn man durch den äußeren Gehörgang eines horizontal gestellten Schädels eine perpendikulare Linie gegen den Scheitel des Kopfes hinzieht, bei den Fleischfressern das meiste Gehirn hinter der Linie, bei den Pflanzenfressern hingegen vor derselben sich befindet; bei dem Menschen aber werde das Mittel gehalten – bei dem befinde sich ebensoviel nach vorn als nach hinten.
Rousseau, der deshalb den Menschen zum Pflanzenfresser macht, weil er der Regel nach, wie andere pflanzenfressende Säugetiere, nur ein Junges zur Welt bringt und nur mit zwei Brüsten versehen sei, vergißt etwas: dieser Vergleich paßt nur auf die größeren pflanzenfressenden Säugetiere, z.B. Pferde und Rindvieh, keineswegs aber auf die kleineren, z.B. Hasen, Kaninchen usw.
Die wichtigste Handlung des Lebens ist die Wahl der Lebensmittel, denn diese übt nicht nur deren Einfluß auf die physische Organisation, sie ändert auch den Charakter. Alle Welt weiß, daß diejenigen Völker, deren Hauptnahrung Fleisch ist, mehr Kraft, Mut und Tätigkeit haben als diejenigen, die bloß oder doch größtenteils von Vegetabilien leben. Der Bau unserer Verdauungswerkzeuge ist auch weder mit denen der fleisch-, noch mit denen der grasfressenden Tiere übereinstimmend; er besitzt deren gemeinschaftliche Eigenschaften und berechtigt uns zum Genuß der Nahrungsmittel aus allen Reichen der Natur. Wie aber namentlich das Verhältnis unserer animalischen Nahrungsmittel zu den Vegetabilien sein müsse, hat die Natur in den Verhältnissen der Schneide- zu den Eckzähnen in sehr bestimmten Zahlen, zehn zu zwölf, ausgesprochen.
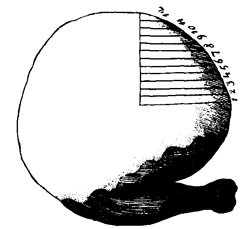
Der Mensch ißt im gesunden Zustand in jedem Monat mehr als er schwer ist, und wird durch Speise, Trank und Luft nach früheren, sehr gewichtigen Theorien, als nach Sanctorius in elf Jahren, nach Bernouilli in drei Jahren, nach Reil in einem Jahre ein anderer Mensch. Jean Paul hat in der »Unsichtbaren Loge« diese Ansichten zusammengestellt und gibt für die Erneuerung sieben Jahre an. Spätere Schriftsteller haben fünf und drei Jahre angenommen.
Eine Diät aus lauter Pflanzenspeisen erzeugt Blässe und Schwäche in allen Verrichtungen des Körpers, die mit einer zweideutigen Gesundheit gepaart ist. Lauter Fleischspeisen geben der arteriellen Blutbildung, dem Muskelsystem und dem Willensvermögen ein einseitiges Übergewicht und begründen dadurch eine Anlage zu entzündlichen und fieberhaften Krankheiten. Sie entwickeln im Blut einen Zündstoff zur Fäulnis. Bei der Speise aus beiden Naturreichen wird wechselseitig das Entstehen einer Schärfe vermieden, welche sich zum Nachteil des Körpers und der Seele aus einer Klasse von Nahrungsmitteln erzeugen muß. Das Fleisch dämpft die Säure und Schwäche der Vegetabilien, und die natürliche Säure der Gewächse und Früchte verhindert die Erzeugung eines faulenden Saftes im Blute, der von lauter Fleisch entstehen würde. Bei den Pflanzen ist ihr Schleim, beim Fleisch der Gallert der Stoff, der uns nährt. Die Nahrungsmittel aus dem Tierreiche, durch die Einwirkung tierischer Organe subtilisiert, sind durchgearbeiteter als die Pflanzen, unserer Natur verwandter und lassen sich daher leichter in unsere Substanz verwandeln, sie nähren stärker und werden leichter verdaut. Fleisch erhöht unsere körperlichen und Seelenkräfte, gibt mehr Mut, macht das Blut hitziger, das Gemüt zorniger und den Geist wilder. Kühnheit und Grausamkeit ist der Charakter der fleischfressenden Tiere, Sanftmut derjenigen, die von Pflanzen leben. Eine fade, nahrungslose vegetabilische Kost ist daher vollblütigen, fetten und saftreichen Personen gesünder als viele Fleischspeisen, die mit ihren Säften die Gefahren ihrer Konstitution vermehren.
Die Menge der genossenen Speisen muß nicht bloß mit den Bedürfnissen und den Verdauungskräften, sondern auch mit der Menge der Getränke, die wir zu uns nehmen, in richtigem Verhältnisse stehen, wenn sie nicht schädlich werden soll. Doch gibt es eine Fügsamkeit der menschlichen Verdauungskraft, die freilich auch wieder ihre Grenzen hat. Derselbe Stoff, dieselbe Menge kann nach Umständen zuträglich und schädlich sein. Die japanischen Ärzte kümmern sich – nach Golowins »Begebenheiten in japanischer Gefangenschaft« – wenig um die Diät ihrer Kranken. Je mehr diese essen, desto höher steigt, nach ihrer Meinung, die Hoffnung der Genesung. Die Bestimmung der richtigen Menge ist nur relativ, nicht absolut. Leicht verdaulich ist im allgemeinen eine Speise, welche ohne großen Kraftaufwand der Verdauungswerkzeuge in tierischen Stoff umgewandelt werden kann, wobei es nicht in Betracht kommt, ob sie nach geschehener Assimilation viel oder wenig nährt. Die leichte Verähnlichung äußerer Substanzen durch die organischen Kräfte hängt aber teils von ihrer größeren oder geringeren Ähnlichkeit (Homogenität) mit dem zu nährenden Organismus, teils von ihrer Auflöslichkeit in den Verdauungssäften ab, denn alle Verdauung beginnt mit Auflösung.
Eine zu schwer verdauliche Nahrung belästigt den Magen, erschöpft die Verdauungskräfte, wird entweder nur unvollkommen assimiliert oder zersetzt sich, wenn sie durch die letzteren gar keine Veränderung erleidet.
Zu leicht assimilable Speisen erzeugen leicht Schwäche der Verdauungswerkzeuge durch Verwöhnung, weil sie ihre Kräfte zu wenig in Anspruch nehmen, und überfüllen den Körper mit einer zu großen Menge wenig beharrlicher, ebenso schnell sich wieder zersetzender als verähnlichter Stoffe, die alle Stufen der organischen Metamorphose zu schnell durchlaufen, woraus Schwäche der festen Teile und überhaupt eine zu geringe Selbständigkeit und Reaktionskraft des organischen Körpers entsteht. Solchen, die an eine derbe Kost gewöhnt waren, werden sie doppelt schädlich. Erwachsenen und an eine reizende Nahrung gewöhnten, in einem kälteren Klima sich aufhaltenden Personen werden fade Speisen nachteilig.
Die schädlichen Folgen einer zu reizenden und vielleicht überdies noch zu kräftigen Nahrung, welche bei einer gesunden Verdauung um so schneller eintreten, bestehen in einer zu hohen Steigerung des ganzen Lebensprozesses, insbesondere der Assimilationswerkzeuge, welche leicht in Überreizung übergehen kann.
Eine gewisse Mannigfaltigkeit muß die Nahrung der Menschen und Tiere besitzen, wenn sie zweckmäßig sein soll. Die Speisen können ebensogut durch zu große Einfachheit als durch eine zu mannigfaltige Zusammensetzung Schaden bringen.
Die Einförmigkeit der Nahrung, das sich vorzugsweise und ausdauernde Halten an eine gewisse Abteilung, einen beschränkten Kreis der Nahrungsmittel, hat einen mächtig nachteiligen Einfluß auf die Gesundheit durch die einseitige Richtung gewisser Lebensäußerungen.
Die nahrhaftesten Speisen sind die viel Eiweißstoff, Faserstoff, Käsestoff, Gallerte, Osmazom enthaltenden animalischen Nahrungsmittel, wie Eier, Fleisch, Milch, Blut, Käse. Die Nahrhaftigkeit der übrigens weniger nahrhaften Pflanzenspeisen richtet sich vorzüglich nach der Menge der in ihnen vorhandenen stickstoffigen Verbindungen. Verdaulichkeit und Nahrhaftigkeit bedingen sich nicht. Käse, Pflanzenkleber, Brot und Baumrinde, isländisches Moos usw. enthalten dem Organismus verwandte Bestandteile, sind aber doch schwer zu verdauen.
Magere, große Menschen bedürfen mehr Nahrung als fette und kleine, und cholerische und phlegmatische mehr als sanguinische und melancholische. Ferner erzeugt das Polarklima eine ohne Nachteil für die Gesundheit zu befriedigende Gefräßigkeit, während umgekehrt das Bedürfnis reichlicher Nahrung nach dem Äquator hin immer mehr abnimmt. Die Bewohner der Tropengegenden zeichnen sich durch die größte Mäßigkeit aus. Norweger, Schweden, Russen, Polen verzehren täglich eine größere Menge von Speisen als Deutsche, Briten und Franzosen. Aber Spanier, Portugiesen und Italiener sind wieder mäßiger als diese. Das frugalste Leben führen Ägypter, Araber, Perser, Inder, Malaien usw.
In den gemäßigten Gegenden verlangen Winter und Frühling eine größere Menge von Speisen als Sommer und Herbst. Zur Mittagszeit kann ungestraft eine größere Menge von Speisen verzehrt werden als des Morgens und Abends. Eine trockene, reine, sauerstoffartige und kalte Luft befähigt vorzugsweise zu einer reichlichen Aufnahme von Speisen.
Eine zu große Menge von Nahrungsmitteln wirkt immer schädlich. Es lassen sich jedoch drei Grade der Überfüllung unterscheiden. Im ersten Fall übersteigt das in zu reichlicher Menge Genossene niemals die Verdauungskräfte – die Natur gewöhnt sich an einiges Übermaß. Sind aber die Verdauungskräfte der Menge der genossenen Nahrungsmittel gar nicht gewachsen, so leiden die Verdauungsorgane, und wird endlich drittens alles Maß überschritten, so entstehen die schlimmsten Folgen, die traurigsten Zufälle, ernsthafte Krankheiten, ja der Tod.
Lord Byron lebte zu Zeiten sehr mäßig. Tagelang nahm er nur täglich zwei kleine Schiffszwiebacke zu sich, und oft nur einen mit einer Tasse Tee, die er gewöhnlich nachmittags um ein Uhr trank. Er versicherte, daß diese Diät ihn leicht und lebhaft mache, und daß ihn diese Selbstüberwindung auch zu der in anderen Dingen geführt habe. Er behauptete, die starken Esser wären leidenschaftlich und dumm. Er aß lange Zeit nur Pflanzenstoffe und äußerte gegen jemand: Fürchten Sie nicht, einen Mord zu begehen, wenn Sie Beefsteaks essen? Er pflegte zu sagen: Man gebe mir eine Sonne, so brennend, und Sorbets so kalt als immer möglich, und mein Paradies ist so leicht zu erbauen wie das der Perser. Dies Wort bezieht sich auf eine Stelle in seinem »Don Juan«, wo es heißt: Der Himmel der Perser ist leicht gebaut, er besteht aus schwarzen Augen und einem Limonadenstrom.
Leicht verdaulich ist endlich dasjenige, bei dem die nährende Materie sich leichter auflösen, ausscheiden und von ihrem fremdartigen Gehalte trennen läßt; schwer verdaulich, wenn sie den erdigen, faserigen und fremdartigen Teilen fest anklebt. Ganz saftig nennt man dasjenige, was einen milden Nahrungssaft hat, roh saftig solche Nahrungsmittel, die zugleich zähe, saure, unserm Wesen fremde Materien mit ins Blut führen. Die Nahrungsmittel müssen also, ehe sie unseren Verlust ersetzen können, ihre erste Gestalt ablegen und durch die Einwirkung unserer Organe durch die Verdauung in unsere eigene Substanz verwandelt werden.
Ist das Geheimnis der Wiederverjüngung irgendwo zu finden, so muß man es in der Küche suchen: daher die Wichtigkeit eines ausgezeichneten Kochs. In der englischen Marine werden die unbrauchbarsten und liederlichsten Matrosen zum Küchendienst verwendet. Die Folgen davon lassen sich denken. In den Küchen der Walachei dienen Zigeuner als Küchenjungen, die später zu Köchen avancieren: dies ist der Hauptgrund der Unreinlichkeit der dortigen Küchen.
Endlich ist auch ein großer Unterschied zwischen einem Koch und einem Bratenkünstler. Ein bekannter französischer Ausspruch sagt: On devient cuisinier, on naît rôtisseur. Ein geschickter Bratenkünstler ist sehr selten; deshalb hat man auch in London zu gewissen Dingen – doch nicht zum Anrichten oder auch nur zum Ausputzen und Verzieren – nur Köchinnen, z.B. beim Braten. Sie ordnen nichts an; aber mit gewissenhafter Pünktlichkeit drehen sie unter gewissen Wärmegraden so und so oft den Spieß, nach Größe und Beschaffenheit des Bratens. Man hat jetzt in Frankreich Bratenwender mit einem Uhrwerk, nicht eben etwa die alten Turmuhren unserer Vorfahren, sondern wie eine kleine Stutzuhr, mit einer blechernen halben Trommel, welche man vor jeden Kamin, ja jeden Ofen aufstellen und den vorzüglichsten Braten selbst machen kann – jeder nämlich, der eine Idee davon hat, was ein guter Braten ist. Mit einer solchen Maschine, die für 25 Franken zu haben ist, kann jeder Mensch einen Braten à point machen – die höchste Leistung dieser Aufgabe. Ich habe eine solche Maschine gesehen, wobei kleine Eimer, nicht viel größer als Fingerhüte, innerhalb der Trommel in Ketten hängend, die Sauce aus dem Grunde der Trommel durch das Uhrwerk fortwährend über den Braten gossen.
Jedes Ding will seine Zeit haben. Moses kam nicht in das Gelobte Land, weil er den Felsen schlug; er hätte bloß zu ihm sagen dürfen, er möge Wasser geben. Moses beweist auch an einem anderen Orte, daß der Hunger wie der Durst zornig, ungeduldig macht; denn er zerschlug die Gesetztafel beim Anblicke des Goldenen Kalbes; er hatte freilich auf Sinai lange gefastet und da begreift sich sein Zorn beim Anblick eines Kalbes – von Gold.
Gesetzte Männer mögen nicht gern auf die Suppe warten, und warten darauf selten ohne Zorn. Ein Koch darf hitzig sein: Feuer ist sein Element. Wie ein Soldat den Feind mit dem Degen vertreibt, so darf er mit dem Spieß in der Hand die Topfriecher aus der Küche verjagen. Pünktlichkeit ist eine Haupttugend eines Kochs: eine versäumte Viertelstunde kann jedes Gericht verderben. Jay, einer der berühmtesten Schüler des berühmten Carême, schlug eine Zulage von 1000 Franken und im Falle der Invalidität die Beibehaltung seines vollen Gehalts dem Marquis Wellesley aus, weil Mylord das Diner meist eine Stunde später verzehrte als angerichtet wurde.
Nach Beaumont (in J. Müllers »Handbuch der Physiologie«), der Gelegenheit hatte, einen Menschen mit einer zwei Zoll langen Wunde im Magen genau zu beobachten, dauerte der Verdauungsprozeß von Kaldaunen und Schweinefüßen bei mäßiger Arbeit immer eine Stunde; von Fischen und Wildbret 1 Stunde 35 Minuten; von Brot, Milch und von getrocknetem und gekochtem Stockfisch 2 Stunden; von wilden Gänsen und jungem Schweinefleisch 2½ Stunden; von rohen Austern 2 Stunden; geröstetem Rindfleisch 3½ Stunden, gekochtem 4 Stunden, gebratenem 3 Stunden, eingesalzenem 5½ Stunden; eingesalzenem Schweinefleisch 5 bis 6 Stunden, gebratenem 3 Stunden 15 Minuten; Hammel, geröstet, 3½ Stunden, gebraten 4½ Stunden; weichen Eiern 4½ Stunden, harten 5 Stunden; gebratenem Kalbfleisch 4 Stunden; Butterbrot mit Kaffee 4 Stunden 15 Minuten; trockenem Brot 3 Stunden 45 Minuten.
Fleisch, das mit Butter gebraten ist, befördert leicht die Fäulnis. Vorzüglich bringt das Schweinefleisch Fäulnis in die Säfte, weil die Säfte des Schweines oft verdorben sind, weil überhaupt das Schwein unter allen Tieren den Geschwüren der Lunge, den Hautkrankheiten und der Fäulnis am meisten unterworfen ist: daher man auch in den Zeiten der Pest da, wo Ordnung ist, insgemein das Schwein tötet.
Der Wahrheit gemäß muß ich aber doch bemerken, daß Schinken, und vorzugsweise der rohe, selbst zur Zeit der Pest das Gesündeste ist, was man essen kann; auch ist nicht zu fettes Schweinefleisch anerkannt leicht verdaulich, freilich weder ungesundes noch die Schwarten. Noch mehr werden unsere Säfte durch die so beliebten Vögel, die meistenteils nur von Insekten leben, zur Fäulung geneigt; auch die milderen Rebhühner haben diese Eigenschaft.
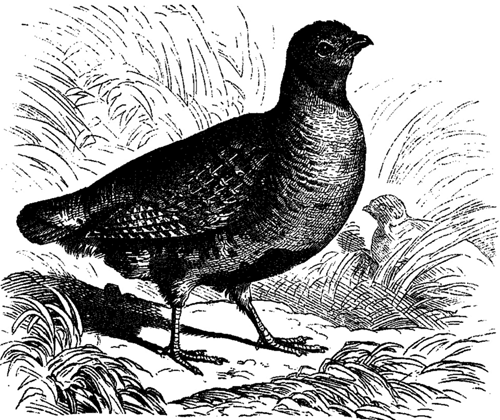
Rebhuhn
Das Fleisch von weißem Geflügel und das nur freilich nicht zu junge Kalbfleisch scheint am leichtesten zu verdauen. Unreifes Fleisch (la viande non faite) ist immer ungesund und schwer verdaulich: das junge faserige Hühnchen schwerer als der gemästete Kapaun. Das Verdauliche liegt in dem Wohlgenährten, Gesunden, Kraftvollen; dann ist die Muskelfaser mürbe. Das Fleisch von jungen, aber völlig ausgewachsenen Tieren ist unendlich leichter als alles Fleisch von alten. Das von schwarzem Geflügel, Rindfleisch, Wildbret verdaut sich mit vieler Mühe, und fettes Fleisch immer unendlich schwerer als mageres.
Unter allem Fleisch, sagt Zimmermann in dem Buche »Von der Erfahrung«, dünkt mich das gemeine, kraftlose Rindfleisch für einen schwachen Magen das unverdaulichste, nicht, weil es im Magen fault, sondern weil es gleichsam zentnerschwer auf ihn drückt. Aber dennoch ist ein gut gemästeter Ochse nahrhafter und wohlschmeckender und für die meisten, besonders gesunden Menschen verdaulicher als alles andere Fleisch, natürlich von keinem alten, abgearbeiteten; und wenn Zimmermann vom gemeinen, kraftlosen Rindfleisch spricht, so meint er damit zweifelsohne das ausgekochte, zur Fleischbrühe, zur Bouillon schon in Anspruch genommene, an dem oft nur noch die Muskelfaser übrig ist, und von dem das Krausesche, im Hôtel de Brandebourg in Berlin, zu Anfang dieses Jahrhunderts ein wahres Modell gab, das alle andern Wirtshäuser von Norddeutschland – ich nehme Hamburg ehrenvoll aus – nachzuahmen sich bestrebten. Er kann damit nicht ein gedämpftes Rindbruststück oder ein gebratenes Rindsfilet gemeint haben, was, so allgemein hingestellt, angenommen werden könnte. Im allgemeinen kann man sagen, daß alle Speisen, welche leicht in Fäulnis übergehen, leicht verdaulich sind; aber wohl zu merken, leichte Verdaulichkeit ist kein Kriterium der Gesundheit, und beide Momente wollen streng geschieden sein.
Man will die Gallerte, die aus dem Kalbe häufiger als die aus dem Rindfleische, aus dem Schafe weniger als aus dem Kalbfleische gezogen werden, allen Menschen aufdringen, die einen schwachen Magen haben und einen besonders ausgemergelten. Hütet euch (sagt Boerhave), daß ihr Kraftbrühe oder Gallerte schwachen Mägen anvertraut; denn sie werden nur durch große Kräfte verdaut und verwandeln sich in einen wahren Leim, wo diese Kräfte nicht vorhanden sind. Es ist ein pöbelhafter Irrtum, daß man glaubt, sie seien um so stärkender, als sie unvermengt sind, da doch gewiß ist, daß sie, mit zehnfachem Wasser geläutert, einem schwachen Magen um so viel zuträglicher sind. Man hat den Versuch gemacht, einen Hund bloß mit der allerkräftigsten Bouillon zu ernähren; er konnte aber nicht lange am Leben erhalten werden. Ein anderer bekam nichts als dünne Bouillon, und kam mit dem Leben davon.
Alle Tiere stehen dem Menschen nach an Stärke des Magens; nur sehr wenige nehmen, nach Verhältnis ihrer Größe, gleichviel Nahrung zu sich; keines in so mannigfaltiger Mischung als der Mensch. Der größte Esser unter allen ist der Europäer. Das Tier nährt sich gewöhnlich von wenigen einfachen Nahrungsmitteln; der Mensch, wenn ihn Not treibt, genießt Würmer, Insekten, ja sogar Ton und Erde. Auch ohne Not essen die Geophagen am Orinoko und in anderen Gegenden Ton (nach Humboldt): es scheint ein klimatisch begründetes Naturbedürfnis jener auf der untersten Stufe der Zivilisation befindlichen Menschen zu sein, dem sie durch kein anderes Hilfsmittel ihrer Kultur begegnen können. Selbst an Gifte kann sich der menschliche Magen gewöhnen, z.B. an Opium. Byron, ein englischer Admiral, litt in seiner Jugend Schiffbruch und ward an die Küste des Feuerlandes verschlagen. Er schätzte sich sehr glücklich, ein Stück verfaulte Seehundshaut zu finden, von welcher er drei Tage lang lebte.
Man hat einzelne Beispiele von Menschen, deren Magen zur Sättigung eine unglaubliche Menge Nahrungsmittel, mitunter ganz ungewöhnliche, sonst gar nicht eßbare Dinge nötig hatte. Milo von Kroton, der berühmte Wettkämpfer, trug einen ganzen Ochsen und verzehrte ihn darauf. Herodor von Megara verlangte zu einer Mahlzeit 20 Pfund Fleisch, ebensoviel Brot und einen halben Anker Wein. Die Flötenspielerin Aglais hingegen ließ sich an 12 Pfund Fleisch, ebensoviel Brot und 16 Quart Wein genügen. Claudius Albinus konnte auf einmal 500 Feigen, 100 Pfirsiche, 10 Melonen und 20 Pfund Weintrauben und 100 Schnepfen verzehren. Der Kaiser Maximin konnte in einem Tage einen Eimer Wein trinken und 40 Pfund Fleisch essen; aber er konnte auch einen schwer beladenen Wagen fortziehen, einem Pferde mit einem Faustschlage das Bein brechen, Steine mit den Fingern zerreiben und nicht sehr starke Bäume mit den Wurzeln ausreißen.
Solche Erzählungen aus dem Altertume könnten verdächtig erscheinen, lieferten nicht die neuesten Zeiten ähnliche Beispiele. Im Jahre 1765 fand sich unter der sächsischen Leibgarde ein Mann, der auf einmal 20 Pfund Rindfleisch und ein halbes gebratenes Kalb verzehrte. Im Jahre 1771 starb zu Ilefeld der Passauer Vielfraß Joseph Kolniker. Schon in seinem dritten Jahre fraß er vor Hunger Steine. Mutter und Großmutter waren Steinfresserinnen gewesen. Er konnte nicht anders satt werden, als wenn er Steine unter sein Essen mischte. Länger als 1 ½ Stunden hielt keine Mahlzeit vor. Einst verzehrte er in Braunschweig auf dem Schlosse in sechs Stunden 25 Pfund gebratenes Ochsenfleisch und trank 20 Quart Wein dazu. Ein andermal aß er zwei Kälber in fünf Stunden. Auch nahm er Metalle, Filz und andere Dinge zu sich. Von seinen zwei Kindern brauchte ein fünf Monate alter Knabe täglich zwei Quart Suppe, und eine Tochter, die in der neunten Woche starb, täglich ein Quart Milch. In seiner Jugend war er Soldat, bei Einquartierungen ward er für acht Mann gerechnet. Kolniker verdankte die Erhaltung seines Lebens seinem Steinfressen. Er bekam in einem Treffen einen Schuß in den Unterleib; die Kugel prallte an den Steinen in seinem Magen ab, und er kam mit einer leichten Hautwunde davon. Der Galeerensklave Bazile war ein ähnlicher Fresser. Kurz vor seinem Tode sagte er: ich habe tausend Teufel im Leib, die mir alle diese Schmerzen bringen. Es fanden sich nach seinem Tode darin: Faßreifen, 13 Stück Eichenholz, hölzerne und zinnerne Löffel, zinnerne Schnallen, ein Pfeifenkopf, ein Klappmesser, Fensterglas, Leder, eine blecherne Röhre usw. Aber der Gärtner Kahle, der 1754 in Wittenberg starb, übertraf sie alle. Er fraß acht Schock Pflaumen nebst den Kernen, oder einen Scheffel Kirschen nebst den Kernen. Reichten die gewöhnlichen Speisen nicht zu, so fraß er die irdenen Schüsseln und Teller mit. Sein Gebiß war so stark, daß sein Einbiß in Steinen so sichtbar war, als habe er in Obst gebissen. Wenn er eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein zu sich nahm, so zermalmte er Tasse und Glas so schnell, mit so lautem Getöse wie die hungrigste Dogge einen Knochen. Lieblingsspeisen waren ihm lebendige Eulen, Mäuse, Ratten, Heuschrecken und Raupen. Ein Spanferkel mit Haaren und Borsten galt ihm als ein Morgenbrot. Mittags darauf hungerte er wieder dermaßen, daß er einen Hammel mit Wolle und Knochen zu sich nahm. Einmal raste seine Eßlust so, daß er ein bleiernes Schreibzeug nebst der Tinte, dem Streusande, dem Federmesser und den Federn verschlang. Diesen Umstand hat ein Zeuge vor Gericht eidlich versichert. Armut bewog ihn oft, das Ungewöhnlichste zur Schau zu verschlucken. Daher machte er sich einst in einem Wirtshause, in Gegenwart vieler Menschen, darüber her, einen ganzen Dudelsack zu fressen. Bei alledem ward er 79 Jahre alt. Sein Leichnam ward auf landesherrlichen Befehl geöffnet; man konnte aber den Grund seiner Gefräßigkeit nicht entdecken. Der Marschall Villars hatte einen Schweizer, der ein ungeheurer Fresser war. Er fragte ihn, wieviel Rindsrücken er auf ein Niedersitzen essen könne. Wenig war die Antwort: vier bis fünf. – Und Keulen? – Sieben bis acht. – Und Hühner? – Zwanzig. – Tauben? – Vierzig, vielleicht fünfzig, nachdem es kommt. – Aber Lerchen? – Ach, Monseigneur, was diese Tierchen anlangt, die kann ich unaufhörlich essen.

Von der Gattung des Tieres, seinem Alter, Geschlecht, seiner Lebensart, von dem Orte, wo es lebt, hängt der Unterschied der verschiedenen Nahrungsmittel ab, die es uns geben kann. Tiere, die jung, von Natur feucht und schleimig sind, werden im Alter trocken, hart und grobfaserig: sie werden also in ihrer Kindheit am besten sein. Doch ist natürlich das zu unreife Fleisch, wie gesagt, keine zuträgliche Speise. Frauen, Kinder, schwächliche, an wenig körperliche Tätigkeit gewöhnte Menschen werden von jungem Fleisch genährt. Der arbeitende Mann muß ein Tier von reiferem Alter haben. Eine ausgekalbte Kuh, die Mutter von Enkeln und Urenkeln, und ein alter, abgetriebener Zugochse haben trockenes, saft- und kraftloses Fleisch. Durch die Mästung wird ihr zähes Fleisch mit Talg überzogen. Jenes ist gar nicht, dieses sehr schwer zu verdauen.
Auch das Geschlecht hat Einfluß auf Nahrhaftigkeit und Verdaulichkeit. Das Fleisch von weiblichen Tieren ist fader und weniger nahrhaft als das von männlichen; bei solchen aber, wo eine starke Entwicklung der Fleischfaser stattfindet, wie z.B. bei den Vögeln, ist es dem des männlichen Geschlechts vorzuziehen. Überhaupt sind weibliche Tiere schwächer, zarter; ihr Fleisch hat mehrere, aber gröbere und weniger subtilisierte Gallerte; männliche Tiere sind dagegen trocken und derber, und die Nahrung in ihnen ist durch die kräftige Einwirkung stärkender Organe mehr verdünnt. Das Fleisch der zahmen Tiere ist feuchter, grobsaftiger als das Fleisch derjenigen, welche frei in Feld und Wald ihrer Nahrung nachgehen. Die Glieder, die das Tier am meisten übt, sind fleischiger und stärker und werden früher hart und trocken. Auch ist das Fleisch der wilden Tiere reicher an Cruor und Osmazom, daher reizender, schmackhafter, nahrhafter, überhaupt vollkommener und daher auch gesünder als das der gezähmten, in Ställen eingeschlossenen, indem solche Einschränkungen einen unnatürlichen, schwächlichen, kränkelnden Zustand veranlassen. Noch mehr ist dies bei den gemästeten Tieren der Fall, deren Fleisch wegen unvollkommener Ausbildung des Faserstoffes weniger nahrhaft und reizend ist, und durch das viele Fett sowie durch andere, durch die Mästung entwickelte Stoffe selbst schädlich werden kann.
Diejenigen Vögel, die viel zu Fuß gehen, haben stärkere Schenkel; die mehr fliegen, fleischigere Flügel und hervorstehende Brustmuskeln. Bei jungen Tieren sind daher diese Teile die besten, weil das Nutriment am stärksten in ihnen durchgearbeitet ist; bei alten und harten die schlechtesten, weil sie durch die Tätigkeit hart, unverdaulich geworden sind. Am Kalb ist die Keule das Beste, an Truthühnern, Hirschen und Zugochsen das Schlechteste. Die Tiere, die auf hohen, trockenen Wiesen weiden, sind gesünder als die an Flüssen, Morästen, am Schlamm.
Fleischfressende Tiere, die vom Raube leben, Leichen verzehren, haben übelriechendes Blut, sind zur Fäulnis geneigt. Tiere, die Fleisch fressen, haben ein lehmiges, rohsaftiges Fleisch, ranziges Fett. Die grasfressenden, von Kräutern, Wurzeln, Körnern lebenden Tiere sind milde, süß von Geschmack, unserer Natur freundlicher, weniger fäulend.
Selbst bei ein und derselben Gattung variiert das Fleisch nach der verschiedenen Nahrung der Tiere. Das Fett der Schweine, die mit Kartoffeln, Bucheckern oder den Trebern des Branntweins gemästet sind, ist wässeriger als das der mit Korn und Eicheln gefütterten. Die Bayonner Schinken haben ihren hohen und wohlverdienten Ruf nur daher, weil die Schweine dortiger Gegend mit zahmen Kastanien gemästet werden. Im Herbst bekommen die Krammetsvögel von den Ebereschen ihren delikaten Geschmack. Doch sind Tiere, die giftige Sachen fressen, darum nicht ungesund, wie z. B. die Krammetsvögel, die gern die Blätter des Bilsenkrauts, die Lerche, die den Schierling frißt; nur muß man sich hüten, Magen und Gedärme zu essen. Das Fleisch der Säugetiere ist, im ganzen genommen, zwar schwer verdaulich, aber kräftig nährend, wenn es der Magen bezwungen hat. Das Fleisch der Vögel ist leichter verdaulich und trockener, wird aber geschwinder verzehrt.
Fische sind unserer Natur nach mehr fremd, weniger nahrhaft, und die fetten, oder in sumpfigen, stehenden Gewässern lebenden, z. B. Aal und Karpfen, sind zugleich schwer verdaulich. Überhaupt sind die Fische nicht so nachhaltig nahrhaft als das Fleisch der Säugetiere, obwohl der Thun dem Kalbfleisch nichts nachgibt. Sie haben aber wegen des großen Phosphorgehalts ihres Fleisches eine ganz bekannte schätzenswerte Eigenschaft. Der übermäßige Genuß geräucherter und gesalzener Fische ist nachteiliger als der des auf gleiche Weise behandelten Säugetierfleisches. Es verursacht Skorbut und gefährliche Fieber. Die vom Genuß gesalzener und getrockneter Fische entstehenden Krankheiten finden sich häufig bei den Norwegern, Isländern, Kamtschadalen, bei den Bewohnern der Orkaden und Faröer usw.
Das giftige Prinzip im verdorbenen Pökelfleisch soll nichts anderes als Blausäure sein. Schon beim Einpökeln fängt das Fleisch an zu gären, ehe das Salz und die Abhaltung der äußeren Luft ihre volle Wirkung tun, und das Osmazom sowie die Gallerte werden durch ersteres ausgezogen; daher ist solches Fleisch schwer verdaulich und weniger nahrhaft. Die zu große Menge des Salzes, die beim Genusse desselben mit in den Körper kommt, reizt nicht bloß die Schleimhaut zu sehr und das Lymphdrüsensystem und bewirkt einen katarrhalischen Zustand derselben, sondern auch andere Organe, z. B. die des Auges. Durch das Räuchern vertrocknet und verhärtet der Eiweiß- und Faserstoff der Muskelfaser und wird schwerer verdaulich. Zugleich übt die im Rauch enthaltene brenzliche Holzsäure einen nachteiligen Einfluß auf die Verdauung. Dies gilt vorzugsweise, wenn das geräucherte Rindfleisch wie der Schweineschinken wieder gekocht wird, und dies nicht in einer Umhüllung von Brot, anderem Fleisch oder einer verkitteten Kasserolle geschieht, um den Nahrungsstoff möglichst darin zu erhalten. Geräuchertes Hamburger Rindfleisch ist durchaus nicht schwer verdaulich, weshalb es auch mit Recht selbst kalt und des Abends genossen werden darf. Aber freilich, wenn es langsam am Feuer der Verdammten ausgelaugt ist, dann gehören Wolfszähne und Straußenmägen zu seiner Verarbeitung.
Von manchen periodischen Lebenszuständen und äußeren Zeitverhältnissen hängt auch die Genießbarkeit der Tiere ab. Zur Zeit der Brütung und Säugung, die das Tier auf Kosten seiner eigenen Selbsterhaltung ausübt, ist es auch für fremde Ernährung untauglich.
Je größer das Tier, ein desto kräftigeres, aber zugleich schwerer verdauliches Nutriment gibt es. Hellfarbige Tiere sind zarter, feuchter, phlegmatischer; dunkelfarbige trockener, reizbarer, grobfaseriger. Ein heller Ochse ist einem dunkelbraunen vorzuziehen; ein schwarzes Huhn aber einem weißen, weil dieses schon von Natur weich und feucht, jenes härter und faseriger vom Fleisch ist. Frisch geschlachtetes Fleisch muß erst die tierische Wärme und den rauchenden Dampf verlieren, und darf nicht, bevor es hinreichend mortifiziert ist, mit den letzten Zuckungen der sterbenden Reizbarkeit, so daß es noch im Kessel hüpft, an das Feuer gesetzt werden. Nach dem tiefsinnigen Sprichwort: Frische Fische, gute Fische – machen diese um so mehr eine Ausnahme, als sie kein warmes Blut haben.
Doch ist das frische Fleisch im ganzen gesünder als altes, in Salzlake versteinertes, in Rauch zur Mumie gedörrtes Fleisch. Man ißt das Fleisch in Wasser, in Suppen, im Gemüse gekocht, gedämpft, gebraten.
Altes, dürres, mageres kocht man, wobei wohl zu merken ist, daß bei dem starken langen Kochen alle nahrhaften, saftigen und gallertartigen Teile in die Suppe übergehen, weil dadurch dem Fleische die nahrhaften Teile entzogen werden, namentlich das Osmazom; zugleich gerinnt das Eiweiß zu stark, die Fasern verschrumpfen. Das so ausgekochte Fleisch wird ein nahrungsloser Leichnam, saft- und kraftlos, und der nächste Verwandte des Mastrichter Sohlenleders. Eine gute gesunde Suppe muß aber keineswegs fett, sondern gallertartig sein. Eine Rindfleischsuppe, worauf ein Zoll hoch Fett schwimmt, fordert einen Straußenmagen und eine Galle, die ätzender ist als Feuer. Gallertartige Fleischsuppen enthalten die wesentliche Nahrung des Fleisches, wickeln ein, versüßen das Blut, sind leicht verdaulich, nähren stark und sind gesund. Sie sind gesund für Schwache, Entkräftete, Genesende und für Personen, die schlechte Verdauung, Mangel an Blut und gesunden Säften haben. Dem Gesunden dienen sie zur täglichen Nahrung, nur sparsam genossen; sie machen ihn sonst leicht fett und vollblütig, gehen ihm ins Blut über. Der Magen erschlafft leicht durch untätige Muße, wie von vielem warmen Wasser. Darum bekommen einige Magendrücken, wenn sie viel Suppe essen.
Das junge, saftige Fleisch, vorzüglich von feuchten Tieren, muß man braten; die eindringende Wärme löst die inneren Säfte in Dünste auf, erweicht die in den heißen Dämpfen schwimmenden Fasern, sprengt die Zellen, lockert die Gallerte darin auf und treibt die überflüssigen Feuchtigkeiten daraus hervor. Das Fleisch von jungen Tieren hat zuviel Gallerte und gelatinöses Fett, weniger Eiweiß- und Faserstoff; das von alten ist dagegen zu faserstoffartig, zu stark oxydiert, zu fest, hat einen Teil seiner nahrhaften Stoffe wieder eingebüßt. Fleisch, das an offenem Feuer und nicht stärker gebraten ist, als daß, wenn man hineinsticht, die Jus herausläuft, ist am nahrhaftesten und dem Geschmack am angenehmsten.

Hase
Das zu lange Braten raubt dem Fleische nicht in dem Maße seine Gallerte, wie das zu lange Kochen, jedoch säuert es das Fett desselben. Gebratenes Fleisch ist reizender und bei torpiden Verdauungskräften leichter verdaulich als gekochtes. Ist aber durch das Braten das Fett zu sehr gesäuert und ranzig geworden, so erregt es leicht Säure in den ersten Wegen und ist bei vorhandener Polycholie nachteilig. Auch wird die zu sehr zusammengedorrte Fleischfaser schwer verdaulich.
Bleibt wegen zu geringen Bratens und Kochens das Fleisch noch zu roh, so behält es zwar mehr Nahrhaftigkeit, wird aber auch schwerer verdaulich. Die Gallerten entwickeln sich nicht genug, der Cruor wird nicht hinlänglich zerstört und der Faserstoff nicht genug erweicht.
Das Muskelfleisch ist von allen tierischen Teilen, mit Ausnahme der Eier, am nahrhaftesten und am leichtesten zu verdauen. Das Gehirn, die Leber, die Thymusdrüse und die Nieren enthalten viel Eiweiß und sind daher sehr nahrhaft, die Leber jedoch wegen ihres Fettgehaltes, die Nieren wegen ihrer derben Textur und ammoniakalischen Beschaffenheit, die Lunge wegen ihrer faserknorpligen Teile schwer zu verdauen. Das Gekröse ist leicht assimilierbar, nur zuweilen durch sein Fett den Magen beschwerend. Die Zunge hat ein zartes Muskelfleisch, und das Triebrad des Lebens, das Herz, das vom ersten Beginn des Lebens bis zu seinem Ende sich bewegen muß, ist am härtesten, grob von Fasern, schwer zu verdauen. Das Herz ist nur bei jungen, schleimigen und weichen Tieren gut, die Zunge hingegen, die vorzüglich an der Wurzel ein lockeres, schwammiges und leicht verdauliches Fleisch hat, von Rindern, Hammeln, Schweinen und andern hartfleischigen Tieren eine gute und nahrhafte Speise. Das Blut ist reizend, aber sehr nahrhaft; gekocht gerinnt sein Eiweißstoff. Daher die aus ihm, aus der Leber, aus dem Hirn bereiteten Würste zu den sehr schwer verdaulichen Speisen gehören. Es schadet auch durch das beigemischte Fett, dessen nachteilige Wirkung unbezweifelt ist.
Je süßer und blander alle fleischige Substanz ist, desto frischer das Öl darin; je härter sie ist, desto mehr Arbeit macht sie dem Magen. Das Mark der Knochen, die süßen und weichen Fette der Tiere sind am schönsten für Verdauung und Nahrung.
Der Gebrauch des Fleisches ist unter den nördlichen Nationen gewöhnlicher als im Süden. Die Bewohner von Japan essen kein Fleisch von vierfüßigen Tieren, sondern nur die Wasservögel, sie genießen auch keine Milch, aber sie essen den ganzen Walfisch und sogar seine Gedärme; auch der Fische schonen sie nicht. Die gemäßigten Zonen sind der Küche klassischer Boden: die Verschiedenheit aller Produkte gibt ihm ihre unendlichen Quellen.
Neben den Fleischspeisen wies uns die Natur das Pflanzenreich zu unserer Nahrung an, um dem faulenden Stoff im Blute, der alkalischen Beschaffenheit unserer Säfte, die zuletzt durch den häufigen Fleischgenuß entsteht, durch die fäulnisdämpfende Kraft der Vegetabilien das Gleichgewicht zu halten. Bei ausbrechenden hitzigen Krankheiten ekelt uns am ersten vor Fleischspeisen, und wir brennen nach Vegetabilien, um an ihren kühlenden Säuren unseren inneren Brand zu löschen. Im schwülen Sommer ist eine hitzige Fleischdiät nicht so gesund als vegetabilische Speisen, und eben um diese Zeit gab uns die Vorsehung die Menge Pflanzen und den Überfluß an kühlenden und säuerlichen Früchten. So speisen in den heißen Erdstrichen die Menschen vorzüglich Pflanzen, um den fauligen Charakter ihrer Säfte zu dämpfen, den die Hitze ihres Klimas darin erzeugt.
Personen, die ein cholerisches Temperament, eine wilde, zornige Gemütsart, heftige Leidenschaften, alkalische Schärfe der Säfte, einen Hang zu hitzigen Fiebern haben, ist das Fleisch nicht dienlich. Sie befinden sich besser bei vegetabilischer Kost, und können ihre körperlichen Fehler durch eine säuerliche, aus Obst und Pflanzen bestehende Diät verbessern. Das nährende Wesen ist den Pflanzen sparsamer zugeteilt, deshalb nähren sie weniger dauerhaft als das Fleisch. Darum haben die grasfressenden Tiere die ungeheuren Mägen und bedürfen einer großen Menge Nahrungsmittel, um den zum Ersatz nötigen Milchsaft auszuziehen.
Bei einer bloß vegetabilischen Diät bekommt die Muskelfaser nie gehörige Stärke und Reizbarkeit, und die Gefäße nie soviel rotes, öliges Blut, das ein Eigentum starker Naturen ist. Das Blut wird wässeriger, faserstoffärmer, venöser, gibt dem Nervenleben, vorzüglich dem Gangliensystem ein abnormes Übergewicht und dadurch Veranlassung zu Nervenkrankheiten. Viele Pflanzenspeisen verursachen Säure, Sodbrennen und Koliken; einige durch ihre viele Luft, die sie enthalten; andere machen leicht Kruditäten, besonders die Samen der Gräser, wenn sie ungegoren genossen werden.
Die Nahrhaftigkeit der Pflanzenspeisen richtet sich vorzüglich nach der Quantität der in ihnen freilich nur spärlich vorhandenen stickstoffigen Verbindungen. Daher vorzüglich Pilze, das Mehl der Getreidearten, die trockenen Hülsenfrüchte, die Mandeln und Nüsse die nahrhaftesten vegetabilischen Speisen sind. Dann folgen die an Satzmehl und Zucker reichen Wurzeln. Am wenigsten nähren Obstarten und junge Gemüse; ihr Verdienst besteht in Erfrischung und Abkühlung des Blutes. Durch Hunger entkräftete Menschen erholen sich bei animalischer Kost schneller, und Hunger stellt sich nach vegetabilischer Kost wieder früher ein.
Alle Substanzen, deren Bestandteile mechanisch sehr fest zusammenhängen, sehr dicht, zähe sind, wie z. B. trockenes, geräuchertes Fleisch, Haut, Sehnen, Knorpel, Knochen, ungegorene Mehlspeise, sind schwer verdaulich. Desgleichen solche Dinge, deren chemische Bestandteile so fest aneinandergebunden sind, daß sie nicht leicht aus dieser Verbindung getrennt werden, und also eine andere, vom Leben geforderte Mischung annehmen können, wie z. B. alle schweren, zersetzbaren, eine stark ausgesprochene chemische Polarität besitzenden Stoffe, als Fett, Säuren, Kalien usw.
Da die Pflanzenstoffe auf einer niedrigeren Organisationsstufe stehen als die animalischen Substanzen, wenig Stickstoff enthalten, der Faserstoff ihnen durchaus fehlt, so sind sie schwerer assimilabel und weniger nahrhaft. Wegen ihrer mehr gesäuerten Beschaffenheit führen sie dem Organismus verhältnismäßig auch weniger Brennstoff zu als die animalischen Speisen; daher tritt der durch Pflanzenkost genährte Körper auch in einen weniger lebhaften Gegensatz mit der Atmosphäre. Die Respiration und alle davon abhängenden Prozesse, als die arterielle Blutbildung, die Muskelbewegung, die sensoriellen Verrichtungen gehen weniger lebhaft vonstatten: das gesamte tierische Leben wird in seiner Ausbildung zurückgehalten. Dagegen begründet die Pflanzennahrung die Venosität, die Wasser- und Schleimbildung. Der größte Teil der Vegetabilien neigt sich zur Gärung und bildet dadurch bei schwachen Verdauungsorganen die Grundlage zu fehlerhafter Assimilation.
Sogar die Tageszeiten und nicht bloß Klima und Jahreszeit verändern die Beschaffenheit der Pflanzen. Das Bryophyllum calycinum hat des Morgens einen sauren Geschmack, des Mittags keinen, abends einen bitteren. Keimende, welke, mit Schimmel bedeckte Kartoffeln, im Frühjahr genossen, brachten große Beängstigung, Zittern der Glieder hervor. Auch erfrorene Kartoffeln sind schädlich; ebenso faulende Früchte, schimmelndes Brot.
Nicht bloß unter den satzmehlhaltigen Wurzelknollen, sondern unter allen dem Gewächsreich angehörenden Nahrungsstoffen nehmen die Kartoffeln durch ihre allgemeine Benutzung den ersten Platz ein. Sie sind wegen ihres großen Gehalts an Stärke sehr nahrhaft und wegen ihres Zuckergehalts leicht verdaulich. Freilich nicht in Butter geröstet oder vielmehr geschmort und zehnmal wieder aufgewärmt, wie sie fast in allen und jeden Wirtshäusern gegeben werden. Die giftige Eigenschaft der Schalen und des davon abgebrühten Wassers verrät ihre Abkunft und Verwandtschaft mit der Familie der Tollkräuter. Die krautartigen Gemüse, die große Menge der Kohlarten, Spinat, sind wenig nahrhaft, obgleich sie Eiweiß und Schleim, jedoch sehr viel Wasser enthalten; sie wirken durch ihre Säuren und Salze kühlend und eröffnend; in schwachen Verdauungswerkzeugen erregen sie durch die ihnen reichlich beiwohnende Pflanzenfaser und durch ihre Neigung zur Gärung Magendrücken und Koliken. Die jungen Sprossen von Spargeln und Hopfen sind wenig nahrhaft.
Die mehligen Samen der Zerealien: Weizen, Spelt, Roggen, Gerste, Hafer, Reis usw. liefern den Hauptnahrungsstoff des Menschen seit den ältesten Zeiten – das Mehl. Seine vorzüglichsten Bestandteile sind Kleber, Stärkemehl, Schleimzucker, Pflanzenschleim und Salze, vorzüglich phosphorsaure Kalkerde. Die Hülsenfrüchte sind stickstoffreicher als das Mehl der Getreidearten durch das Legumin, und enthalten außerdem auch viel Stärkemehl, vorzüglich die Erbsen und Bohnen; Gummi – Erbsen und Linsen; Schleimzucker – Erbsen und Bohnen; Pflanzengallerte – Erbsen: also viel nahrhafte Stoffe, besonders die Erbsen. Die spezifische Wirkung der Zwiebeln auf das Nervensystem ist wahrscheinlich ihrem Phosphorgehalt und dem flüchtigen Ammonium zuzuschreiben, das sie besitzen.
Der Wassergehalt der Gemüse ist sehr bedeutend. Er beträgt beim Kohl 90 %.
Die Nahrung, welche die Pflanze gibt, ist auch verschieden, sowohl nach ihren verschiedenen Teilen: Wurzeln, Blättern, Samen, Früchten, und nach ihrem Alter, als auch, wie gesagt, nach dem Klima und der Jahreszeit, worin sie ihr volles Wachstum erlangt hat. Viel Kleber enthaltende Gerichte sind dem Winter, kühlende, wenig nahrhafte Speisen dem Sommer angemessen; das Fleisch zu dieser Zeit aber ist ungesund und daher auch widerlich. Den beiden Übergangszeiten, Frühjahr und Herbst, entspricht eine gemischte Nahrung, jedoch so, daß im Frühjahr die Fleischnahrung vor der vegetabilischen, im Herbst umgekehrt, vorwalten muß.
Die Witterung bleibt natürlich auch nicht ohne Einfluß auf diese Bestimmungen. In einem kühlen Sommer und in einem kalten, feuchten Herbst ist der Genuß des Obstes schädlich und erzeugt Ruhr, gastrische Fieber, sowie in einem warmen, sommerähnlichen der Genuß harter Fleischspeisen ebenfalls seiner leicht schädlich werdenden Wirkung halber zu beschränken ist. Die Pflanzen feuchter und kalter Gegenden sind wässerig und weniger nährend. In warmen Klimaten sind sie süßer und gewürzhafter und enthalten mehr und verdichteteren Nahrungsschleim.
In ihrer frühesten Jugend ist die Pflanze ein fades Gemisch aus Wasser und Erde; bei zunehmendem Wachstum treten salzige Teile in diese Verbindung und geben der Frucht den herben, streng-sauren Geschmack, den wir vor ihrer Reife an ihnen wahrnehmen. Gegen das Ende der Zeitigung kommt noch der letzte Bestandteil eines vollkommenen Schleimes, das brennbare und ölige Wesen, hinzu, welches das Hervorstechende dämpft, die Gleichheit der Teile erzeugt und der Frucht ihre Farbe, ihren eigentümlichen gewürzhaften Geruch und den süßen Geschmack gibt. Die Wurzel der Pflanze enthält, im ganzen genommen, viel Erde und gibt eine grobe Nahrung. Die Blätter und Stiele werden nur in ihrer frühen Jugend genossen und sind im Alter faserig, unverdaulich und nahrungslos. Die Blüten dienen zur Befruchtung, zur Arznei und zum Vergnügen, selten zur Speise. Der Same ist gleichsam der letzte Teil der Pflanzen, der aus den Säften entspringt, welche die Pflanze in ihrem vollkommensten Zustande hervorbringt. Er ist ein Nahrungsmittel, das viele nährende Substanzen in einem engen Räume einschließt.
Auch die Pflanzen haben ihre Krankheiten: Wasser-, Dürr- und Bleichsuchten, Verhärtung, Krebsschäden und Geschwülste und werden von Blattläusen, wie das Tier vom Ungeziefer, geplagt. Um diese Zeit sind sie zu unserer Nahrung untauglich, teils weil sie verfault, nahrungslos, von Insekten verunreinigt und zerfressen sind, teils weil die Ursache ihrer Krankheit, als giftige Honig- und Mehltaue, die Gesundheit des Menschen verletzen. Dergleichen Geschwülste findet man vorzüglich in nassen Jahren am Roggen, unter dem Namen von Mutterkorn. Es verursacht, wenn es scharf von Geruch und Geschmack ist und in beträchtlicher Menge unter dem Korn verbacken wird, bei Leuten, die viel Brot essen, allerlei giftige Wirkungen, Magenweh und Koliken.
Einige Pflanzen sind aber auch von Natur scharf und ungesund und führen ein Gift bei sich. Einige sind in gemäßigten Klimaten eßbar, in wärmeren scharf und giftig. Wie viele Beispiele von den fürchterlichsten Wirkungen hat man vom Wasserschierling, Bilsenkraut, der Tollkirsche, den Beeren des Eibenbaumes usw., wenn sie aus Unwissenheit oder Unvorsichtigkeit, mit eßbaren Wurzeln und Früchten verwechselt, genossen wurden! Diese Verwechslung ist bei den giftigen und eßbaren Gattungen der Pilze noch leichter, weil ihre Unterscheidungszeichen versteckt sind, und einige Gattungen auf dem einen Boden eßbar, auf dem andern aber giftig sind.
Die Früchte der Ceres und Pomona bieten unserem Magen keine hinreichende Substanz und würden unserem Blute keine hinreichende Kraft geben, und die Fische der Ichthyophagen würden unseren Organen zu wenig Materielles liefern; das Fleisch endlich, die fetten Speisen der Nordländer, würden unser Blut zu sehr erhitzen. Zu unserem Wohlsein gehört daher – wie es die Natur will –, daß wir von vielem genießen, aber mit Mäßigkeit; nördliche Völker mehr Fleisch, südliche mehr Vegetabilien. Der Bauer von Nordfrankreich begnügt sich nicht mit dem, womit der Südfrankreichs zufrieden ist, und der Raum von zweihundert Stunden mehrt und mindert den Bedarf bedeutend.
Nirgends wird vielleicht besser gegessen und getrunken als in Bordeaux; das Land, der Strom und das Meer bieten alles in Mannigfaltigkeit und Überfluß dar, was bei uns als höchste Seltenheit gilt. Austern sind der Beginn der Mahlzeit; sie werden vor der Suppe gereicht und sind mit Kleie gemästet. Die roten Rebhühner und Ortolane sind einzig, wie die Trüffeln, und die Pasteten von Nerac, und welches Obst, welche Südfrüchte! Tausendfache Arten von frischen Seefischen und Weine der ersten Art an der Quelle. Vielleicht kann England mit einigen Produkten wetteifern, überwiegen in manchen Fleischarten; nur nicht mit Geflügel. Auch in Holland fand ich gleich die Waterzoodjes bliksems lekker (sehr delikat); aber freilich, die Schoone pijpen (die Tonpfeifen) nebst den geliebten Vlammetjes zum Anzünden sind nicht jedermanns Sache; nicht einmal der Quispeldoorjes zu gedenken. Man mag mich excuseren, wenn ich mich sanft drücke, weil ich kein Freund von Tabaksrauch und Langeweile bin. Lieber ginge ich zu den gebackenen Hendeln, Lungenstrudeln, steierischen Kapaunerln, Donaukarpfen, Lungenbrateln und Milchstrudeln und würde kugelrund.

In Wien soll man an manchen Tafeln Einschnitte in die Tische machen, damit der Bauch der Wohlbeleibten Platz habe. Ein Fiaker fragte einmal einen solchen: »Ihr Gnaden, soll'n wir das auf einmal aufladen?« Vom ersten König von Württemberg, der bekanntlich sehr stark war, sagte Napoleon, die Natur habe an ihm zeigen wollen, wie weit sich die menschliche Haut ausdehnen lasse.
Für das russische Nationalessen, den Schtschi (Suppe mit saurem Kohl); den Kuliebiaka (Kuchen aus Grütze mit Reis) danke ich; weit mehr noch für die Hunde der Südseeinsulaner, für Katzen, die in Tonkin zu den Delikatessen gehören, wie für die Katzen, die in dem ganzen marokkanischen Gebiete besonders deshalb Lieblingsspeise der Frauen sind, um nach dem orientalischen Geschmack hübsch fett zu werden. Die Jakuten speisen sogar Mäuse und Ratten. Heuschrecken aber sind seit den urältesten Zeiten eine Lieblingsspeise der Morgenländer. Die Hindu trinken geschmolzene Butter, wie wir hitzige spanische Weine. In einigen Gegenden von Afrika werden Schlangen und Raupen gegessen. Die Otowaken essen Tonerde; die Neukaledonier zerriebenen Speckstein; die Javaner Ton; die Neger an der Mündung des Senegal eine Erdart, die sie unter den Reis mischen; die Tungusen andere Erdarten; die Bewohner der Antillischen Inseln, namentlich auf Martinique und Guadeloupe eine Erde, Caouac genannt; die indianischen Weiber am Magdalenenflusse essen den frischen Ton, aus welchem sie Töpfe verfertigen, und die Türkinnen und Griechinnen Siegelerde als Näscherei. Selbst in Deutschland wurde während einer Hungersnot das Bergmehl zu Brot verbacken, und die Steinbrecher am Kyffhäuser essen noch die Bergbutter. Die Suppen der nordamerikanischen Wilden bestehen aus Bärenfett. Spinnen gelten bei vielen Nationen für eine Leckerei. Die Bewohner von Neuseeland verzehren Seife als eine der größten Delikatessen, die frommen Anhänger des Dalai-Lama dessen Exkremente, und wir – Schnepfendreck. Die scheußlichste Fresserei ist die Menschenfresserei. Wo sie zu Hause – »hört alles auf«; keine Autorität wird geschont, man wird gefressen mitsamt dem Schwarzen Adlerorden in Brillanten. Für Liebhaber bemerke ich, daß die weißen Menschen schmackhafter sind als die schwarzen; die Frauen besser als die Männer; Engländer besser als Franzosen.
Es gab aber auch Menschen, die in der Enthaltsamkeit von allen Speisen nichts Übernatürliches finden wollten; sie behaupteten, daß ein starker Körperbau und eine stufenweise Abgewöhnung dazu gehöre. Simon Stylites fastete vierzig Tage, um Christus nachzuahmen. Unsere erst Sorge, sagt der heilige Gregor von Nyssa in seinen Episteln, soll gegen die Sinnlichkeit des Essens gerichtet sein, gegen diese Urverderbnis des menschlichen Geschlechts, die Mutter der Laster. Der wütendste aller Schmerzen ist aber der Hunger.
Als die Luft der Erde reiner war und die Menschen weder durch Leidenschaften noch durch Weichlichkeit und Geistesanstrengungen geschwächt wurden, wurden sie viel älter. Fromme und kein Fleisch essende Inder sollen noch im Mittelalter zwei- bis dreihundert Jahre alt geworden sein, und Buffon hält es für möglich, das menschliche Leben auf 900 bis 1000 Jahre zu bringen. Die Tiere leben achtmal länger als sie wachsen; darnach müßte der Mensch gewöhnlich 200 Jahre alt werden.
Die Spartaner haben ihren Kindern so wenig zu essen gegeben, damit ihr Körper groß und stark werde. Philopömen zwang sie, diese Art, ihre Kinder zu ernähren, aufzugeben, weil er wohl wußte, daß sie sonst neben einem starken Körper auch eine große Seele und ein erhabenes Herz behalten würden.
Die Frage: wie viel soll man essen? verdient nur eine Antwort: so viel, bis man gesättigt ist. Die Natur ladet uns auf der einen Seite durch die angenehmen Empfindungen beim Genuß der Speisen zu unserer Selbsterhaltung ein und warnt auf der anderen Seite vor der Versäumnis dieser Pflicht durch die unangenehme Empfindung des Hungers. Die Triebe der Natur, Hunger und Durst, sollen uns an unsere Erhaltung erinnern. Mangel an Appetit ist eine Warnung, daß wir nicht essen sollen, weil der Magen nicht verdauen kann. Unverdaute Speisen nähren nie und erzeugen in unseren Säften einen fehlerhaften Stoff, der uns zu allerlei Krankheiten empfänglich macht. Wir müssen nach Tische keine Neigung zum Schlaf fühlen, wenn wir ihn nicht gewohnt sind, kein Schlucken, keine Mattigkeit, einen gesunden und ruhigen Nachtschlaf haben. Wer sich nach diesen Regeln sättigt, hat nicht nötig, sich ängstlich, wie Cornaro, seine Speisen mit der Waage zuzumessen.
Maß und Beschaffenheit der Nahrungsmittel müssen unserer Natur, und ihr Widerstand unseren Kräften angemessen sein. Jede einzelne Person muß sich selbst, nach dem Vermögen ihres Magens, ihrem Alter, ihrer Lebensart, Konstitution, nach Klima und Jahreszeit ihre Diät bestimmen. Hunger, Bewegung und Verdauungsvermögen gehen gleichen Schritt. Bei Wachstum und körperlicher Arbeit ist unser Appetit stärker als bei dem Müßiggang und im Alter. Im Winter dient uns mehr und härtere Kost, im Sommer weniger und leichtere Speisen, die durch ihre Säure das Blut auswaschen.
In Ansehung der Qualität der Speisen können wir auf doppelte Art die Grenzen überschreiten – zu wenig oder zu viel essen. Die Mittelstraße zwischen beiden Feldern ist Mäßigkeit – die erste Quelle, woraus Leben und Gesundheit fließt, die den Gesunden erhält, den Kranken gesund und den Schwachen alt werden läßt. Von zu wenigem Essen entstehen Schwachheit und Schärfe der Säfte. Die Muskelfaser verliert ihre Spannung, die Verdauungswerkzeuge ihre Stärke, weil sie nicht in Tätigkeit erhalten werden. Die kleinen Gefäße fallen zusammen und verwachsen aus Blutmangel und Armut an Säften. Das Blut bekommt eine faulende Schärfe, an der alle Säfte teilnehmen.
Häufiger ist der entgegengesetzte Fehler – mehr zu essen, als unsere Natur bedarf. Bei den tausend sinnreichen Erfindungen, unserem Gaumen zu schmeicheln, ist nichts gewöhnlicher als dieser Fehler. Wir würden um die Hälfte weniger Krankheiten haben, wenn man die von der Summe abzöge, die von Unmäßigkeit abstammen. Es soll jeder den andern Tag fasten, der den vorigen bei fröhlichem Mahle zuviel des Guten getan hat. Vorzüglich sollten fette, vollblütige und korpulente Müßiggänger, die eine verdächtige Gesundheit haben, dann und wann fasten, in den Zwischenzeiten nahrungslose Speisen essen, viel arbeiten und wenig schlafen. Der erste Fehler einer beständigen Überladung ist, daß man gefräßig wird. Kampf macht stark. Der Magen wird an die überspannte Ausdehnung gewöhnt, und die Bewegung der Säfte geht mehr, als sie sollte, dahin. Ist der Magen dabei stark und vermögend, den Überfluß der Nahrungsmittel zu bezwingen, so bekommen solche Personen zuviel Milchsaft, zuviel Blut, zuviel Fett. Sie schweben in stündlicher Todesgefahr und sind, wenn sie krank werden, schwer zu retten. Ist der Magen schwach, so entstehen nach der Überladung Schwere, Drücken und Aufschwellen desselben, Schlucken, Übelkeiten, Röte des Gesichts, Unfähigkeit zur Arbeit und Neigung zum Schlafe. Die scharfen Reste machen in den Gedärmen Kollern und Bauchgrimmen. Nach einigen Stunden, wenn der rohe und unbezwungene Milchsaft zum Blute kommt, entstehen durch den Widerstand, den er in seinen Gefäßen findet, Frösteln, Hitze, Durst, Drücken auf der Brust und ein unruhiger Schlaf. Personen, die einen schlechten Magen haben, müssen sich fleißige Bewegung machen. Leibesübung ist eine der reellsten Quellen guter Verdauung. Besonders dienen jenen mäßige, stufenweise vermehrte Bewegungen nach dem Schlaf und auch Spaziergänge am Morgen, welche die rohen Materien des Bluts austreiben, die während des Schlafs bearbeitet und gekocht sind.
Bei einer schnellen und starken Überfüllung wird der Magen über Vermögen ausgedehnt und gleichsam lahm; er verliert Bewegung und Tätigkeit, und die Speisen bleiben unverrückbar an ihrem Orte stecken. Die Luft, die aus den faulenden Speisen hervorbricht, schwellt den Magen noch mehr auf, drückt alle benachbarten Gefäße und Kanäle der Galle, der Gekrösdrüse und die niedersteigende Aorta zusammen, und kann Blutspucken, Schlag und Entzündung des Magens erzeugen. Sie ist desto gefährlicher, wenn die Speisen schwer verdaulich, halb gar und flatulent (Graupen- und Hülsenfrüchte) sind, nicht gehörig gekaut werden, und die Überfüllung schnell und ohne Appetit geschehen ist. Man hat viele Beispiele, daß, bei unsinnigen Wetten, sich Leute an Kuchen, Brezeln und Hülsenfrüchten auf der Stelle tot gefressen haben oder bald nachher gestorben sind.
Wer gut verdauen will, muß vor allem andern langsam essen und gut kauen. Gut gekaut ist halb verdaut. Ein französischer Dichter sagt:
Jouissez lentement, et que rien ne vous presse;
Gardez qu'en votre bouche un morceau trop hâté
Ne soit en chemin par un autre heurté.
Nicht umsonst hat die Natur den Kinnladen so starke Muskeln gegeben, die eine Kraft von mehr als tausend Pfund überwiegen. Unter einem langsamen Kauen preßt sich der Speichel desto häufiger aus, mischt sich inniger mit den Speisen, und die Verdauungssäfte wirken desto besser, je feiner sie durch die mechanische Zermalmung unter den Zähnen zerrieben sind. Geschäfts- und Staatsmänner essen gewöhnlich sehr schnell; Kinder, Frauenzimmer, Gelehrte, genesende und sitzende Personen, alle, die an einem schwachen Magen leiden, sollten hierin der arbeitenden Volksklasse, dem Landmann und Taglöhner, nachahmen, die gut kauen, langsam einpacken und wie die Strauße verdauen.
Noch schädlicher ist es, die Getränke, Suppen und andere Speisen zu heiß zu genießen. Zu heißes Essen schwächt und erschlafft die Muskeltätigkeit des Speisekanals, verändert seine Sekretion. Die Hitze macht Wallungen des Bluts und treibt die Säfte nach außen, die während der Verdauung nach innen gehen sollten. Der Schlund kann gleich darauf gefährliche Entzündungen und der verbrühte Magen krampfhafte Zufälle bekommen.
Besonders leiden die Zähne und verderben davon, die bald glühend sind und unmittelbar darauf an der kalten Luft schnell abgekühlt werden. Der schnelle Wechsel von kalten und heißen Speisen ist schädlich: die Natur liebt keine Extreme.
Man hat die Empfindungen des Hungers auf eine lächerliche Weise dem Reiben der Magenwände aneinander zugeschrieben; so auch der großen Schärfe des Magensaftes, welcher die Häute des Magens auffräße. Wäre eine dieser Ursachen vorhanden, so müßte Entzündung erfolgen, wenn der Hunger einige Zeit gedauert hätte. Von Entzündung aber ist bei dem Hunger keine Spur. Kälte, nicht Hitze, ist die Begleitung derselben, und dies beweist, daß er, wie der Durst, der Untätigkeit derjenigen Membranen, in welchen er seinen Sitz hat, zugeschrieben werden muß.
Zur Erhaltung der Gesundheit ist es notwendig, daß ein dem Verbrauche der organischen Substanz angemessener Ersatz durch die Aufnahme frischer Nahrungsstoffe und durch ihre Umwandlung in Blut geleistet werde. Hunger und Durst fordern zu dem Genuß der erforderlichen Speisen und Getränke auf; das Genossene aber wird durch die auflösende Kraft des Magensaftes in den sogenannten Speisebrei verwandelt und dieser im Darmkanale durch die beigemischte Galle und pankreatische Flüssigkeit dergestalt zersetzt, daß der aus ihm abgeschiedene Milchsaft, Chylus, alle nahrhaften der Mischung des Körpers assimilierbaren Bestandteile enthält. Eigentümliche, im Darmkanal zahlreich verbreitete Saugadern nehmen den Chylus in sich auf und leiten ihn in einen durch ihre Vereinigung gebildeten Kanal, welcher ihn in das Blut der zum Herzen zurückführenden Adern ergießt. Auf diesem Wege erfährt der Chylus eine Reihe von chemischen Veränderungen, durch welche er dem Blute immer ähnlicher wird, und seine völlige Umwandlung in dasselbe erfolgt in den Lungen, in welchen er, mit dem Blute vermischt, der rechten Herzkammer zugebracht wird.
Wenn es gewiß ist, daß von unmäßiger Lebensweise sich bei vielen Menschen das Podagra ausbildet, so fehlt es andernteils auch nicht an Beispielen, daß Männer von der mäßigsten Lebensweise von diesem Übel heimgesucht werden. So wissen wir, daß Papst Gregor der Heilige, trotzdem daß er sein ganzes Leben sehr mäßig gewesen, keinen Tag vom Podagra frei blieb, wie auch der Kardinal Colonna, der berühmte Freund Petrarcas, dessen fast spartanische Lebensweise zu seiner Zeit allgemein bekannt war.
Man hat sogar im Gegenteil beobachtet, daß das gelegentliche Überschreiten des Maßes der zu nehmenden Lebensmittel nichts schadet, da dem Menschen bei Benutzung seiner Kräfte ein weiter Spielraum gelassen ist, so daß er nur im großen und ganzen sein Leben nach den Forderungen der Natur einzurichten braucht und nur nicht immer ihre Ordnung durchkreuzen darf. Aber auch ein mäßiges Fasten, welches der spät genossenen Hauptmahlzeit während mehrerer Stunden vorhergeht, schadet nicht nur nichts, sondern befördert ungemein die Spannung der geistigen Kräfte und schwächt keineswegs, wie so oft behauptet ist, die Verdauung. Ja, man kann diese wichtige Funktion so ganz in seine Gewalt bekommen, daß man während ganzer Tage fasten darf, ohne sich zu schaden, wenn man nur später das Versäumte nachholt. Bei den Gesunden und Erwachsenen wird überhaupt die Menge der zu genießenden Speisen durch die Summe und die Art ihrer Tätigkeit bestimmt.
Obgleich man die einfachsten Bestandteile der tierischen und vegetabilischen Speisen als solche nicht genießt, sie auch zur Ernährung für sich allein nicht hinreichen, so dienen sie doch, wenn sie den vorwaltenden Bestandteil gewisser Nahrungsmittel bilden, zur Bestimmung ihrer Hauptwirkung oder bringen doch selbst, in kleineren Quantitäten ihnen beigemischt, für die Beurteilung ihres schädlichen Einflusses wichtige Nebenwirkungen auf einzelne Organe hervor. Es ist daher hoch notwendig, sie – in etwas wenigstens – kennen zu lernen.
Im allgemeinen sind die stickstofffreien Substanzen schwerer zu assimilieren und weniger nahrhaft als die azotischen.
Die lebendige Aktion der Elemente in den Nahrungsflüssigkeiten verursacht eine immerwährende Verbindung und Trennung, Bildung und Umbildung, so daß im Chemismus organischer Körper eine ewige Veränderung waltet. So sehen wir den Milchsaft in dem tierischen Körper oxydiert und desoxydiert werden, und ein Ähnliches findet mit den kohlensauren stickstoffhaltigen Nahrungsflüssigkeiten der Pflanzen statt, wobei durch das Vorwalten des Sauerstoffs die Umwandlung flüssiger Substanzen in festere bedingt wird. So entsteht aus Schleim Gummi und aus Öl Harz. Der sorgfältigste chemische Experimentator vermag nicht den fliehenden Geist zu halten, der im Leben den Organismus und die Stoffe durchdrang. Er entflieht der Prüfung, und sogleich gehen Umwandlungen vor sich, die nur den organischen Stoffen außerhalb der belebten Organe eigen sind. Hierdurch entsteht ein chemischer Prozeß, welcher mit Entwicklung der Kohlensäure anhebt, und, bei den Pflanzen, mit vorwaltender Essigsäure endet; diesen Vorgang nennt man die Gärung. Doch nicht alle Vegetabilien bilden dieses Phänomen, bei einigen Pilzen und anderen pflanzlichen Säften, welche sich schon mehr den animalischen Stoffen nähern, sowie überhaupt in animalischen Körpern entwickelt sich dann vorzugsweise Wasser- und Stickstoff, welche Entbindung Fäulnis genannt wird.
Die nächsten Bestandteile oder Grundelemente der pflanzlichen Organismen sind Karbon, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff, welche auf mannigfache Weise vereint sind und daher eigene (stöchiometrische) Verbindungen bilden. So entsteht z. B. aus der Zusammensetzung des Karbons mit dem Sauerstoff die Kohlensäure: Karbon mit Sauer- und Wasserstoff gibt die Essigsäure und die Funginsäure.
Die einfachsten Bestandteile der vegetabilischen und tierischen Speisen sind vorzugsweise:
Der Schleim (Mucus). Im frischen Zustande ist er halb flüssig, zähe, in Fäden ziehbar; getrocknet wird er durchscheinend und spröde. Er ist eine organische Verbindung des Gummi mit vielem Wasser, enthält etwas Stickstoff, welcher jedoch im Pflanzenkleber und Eiweiß viel häufiger ist. Er ist nicht leicht assimilierbar, stumpft die Empfänglichkeit ab, ruft auch die tierische Schleimbildung hervor und gibt zur Säuerung Gelegenheit.
Stärke (Satzmehl, Amidon). Ist geschmack- und geruchlos, unlöslich im kalten Wasser, löslich im heißen. Findet sich bereits in der Form kleiner Körnchen in den Höhlungen des Zellgewebes der Samen und anderer Teile der vollkommenen Pflanzen. Nicht aber in den stärkehaltigen Flechten, z. B. dem isländischen Moos, wo die ganze Masse reichlich (44 %) davon durchsetzt ist. Die Stärke steht zwischen dem verhärteten Schleim und dem Milchzucker und besitzt große Nahrhaftigkeit, besonders in Verbindung mit Eiweiß. Sie wird in mehlhaltigen Samen- und Knollenwurzeln angetroffen, bildet einen unserer hauptsächlichsten Nahrungsstoffe und wird durch chemische Prozesse und anhaltendes Kochen in Traubenzucker umgewandelt. So werden geistige Getränke erzeugt, deshalb die ausgedehnte Wichtigkeit dieses Stoffes.
Gummi ist nahrhafter wie der Schleim, jedoch schwerer auflöslich, daher auch noch schwerer zu verdauen. Es ist ein sehr verbreiteter Pflanzenbestandteil, der sich in allen Pflanzenteilen findet.
Schleimzucker ist sehr nährend, begünstigt aber noch mehr die Säure im Magen. Die Wurzeln einiger Doldengewächse sind reich daran, z. B. die gelben Rüben (Möhren) und die Pastinakwurzeln.
Pflanzenkleber, der Stärke nahe verwandt, ist noch nahrhafter, ja unter allen vegetabilischen Substanzen die nahrhafteste, aber sehr schwer assimilierbar, zumal das Gliadin oder der Kleber der Hülsenfrüchte. Beide werden durch eine zuckerartige Gärung und einen geringen Grad von Säuerung verdaulich. Durch seinen bedeutenden Stickstoffgehalt ist er geeignet, die Blut- und Muskelbildung zu begünstigen.
Pflanzengallert, pektische Säure, ist gerbstoffartig, sehr nahrhaft, entwickelt bei der Verdauung viel Kohlen- und Essigsäure und schadet, in zu großer Menge genossen, durch die säuerlichen Salze und kalkhaltigen Verbindungen.
Die vegetabilische Faser oder das Xylin macht die Grundlage aller festen Pflanzenteile aus, daher sie sich nach den verschiedenen Pflanzenfamilien gar sehr ändert. Sie hat ein faseriges Gehänge und ist geruch- und geschmacklos; schwer verdaulich, schon durch den festen, mechanischen Zusammenhang ihrer Teile, ist auch sehr wenig nahrhaft.
Das Fungin oder das Phytokoll. Eine weiße oder gelblich-weiße, faserige, spröde Masse, die im feuchten Zustande weich, elastisch, von fadem Geschmack ist. Sie ist unauflöslich im Wasser und wegen ihres Stickstoffgehalts und ihrer Ähnlichkeit mit dem tierischen Faserstoff schwer verdaulich, aber doch sehr nahrhaft; wegen ihrer öfteren Verbindung mit scharfen, narkotischen Stoffen und durch Blausäureentwicklung gefährlich. Das Fungin findet sich in Schwämmen und Pilzen als der fleischige Teil derselben; wenn man diese auspreßt, so bleibt das Fungin zurück.
Der Gerbestoff ist in allen Pflanzenteilen, welche einen sehr zusammenziehenden Geschmack haben, vorhanden, z. B. in den Weintraubenbirnen. Er ist schwer anzueignen, begünstigt die Blutbildung und hat adstringierende Wirkung. Wird in Wasser sehr leicht aufgelöst.
Die Alkaloiden, die sich in vielen vegetabilischen Nahrungsmitteln vorfinden, wirken auf verschiedene Abteilungen des Nervensystems, dessen Tätigkeit sie entweder steigern oder herabstimmen. Dadurch können sie eine schädliche, selbst giftige Wirkung erhalten.
Die fetten Öle sind zwar sehr nahrhaft, aber äußerst schwer verdaulich, besonders wenn sie rein, nicht mit Schleim und Eiweißstoff verbunden sind. Sie werden leicht im Magen gesäuert und in einen ranzigen Zustand versetzt, wodurch sie Sodbrennen, Magenkrämpfe verursachen. Werden sie assimiliert, so begünstigen sie Gallenabsonderung, die Pigment- und Fettbildung, beschränken dagegen die Erzeugung des roten Bluts und der Muskelfaser, stimmen die Rezeptivität der Nerven herab und schwächen die Kontraktilität der irritablen Organe.
Die ätherischen Öle erregen das Gefäßsystem und mittelbar auch das Nervensystem, besonders in den Verdauungswerkzeugen. Sie veranlassen Kongestionen und Entzündungen. In ihnen findet sich zum Teil gar kein Oxygen. So enthält das Terpentinöl nur 12% Wasserstoff in Verbindung mit 87 % Kohlenstoff. Das scharfstoffige Pflanzenprinzip hat schon mehr eine arzneiliche Wirkung auf die Schleimhäute und das Lymphsystem. Doch kann es einigermaßen die Verdauung unterstützen. Kommt es in Verbindung mit dem narkotischen Prinzip, so wirkt es zugleich deprimierend auf das Nervensystem und nicht selten giftig erregend.
Die Harze, je nachdem sie mit Gummi oder Scharfstoff verbunden sind, haben stets eine mehr oder weniger medikamentöse Wirkung.
Der tierische Schleim erzeugt wie der vegetabilische in den Verdauungswegen leicht gastrisch-nervöse Krankheiten. Er bekleidet die Wände aller inneren Höhlungen und Kanäle des menschlichen und tierischen Körpers, welche zur Aufnahme flüssiger Stoffe bestimmt sind.
Der Eiweißstoff ist in flüssigem Zustande leichter zu verdauen als in geronnenem, und der hauptsächlichste nahrhafte Bestandteil aller animalischen Speisen. Im Übermaß begünstigt er zu sehr die Blutbildung. Der flüssige Eiweißstoff ist farblos, ohne Geruch und Geschmack, er gerinnt bei 60° Réaumur; ist er aber mit dem zwanzigsten Gewicht Wasser gemischt, so gerinnt er in der Siedehitze nicht. In mehrfacher Hinsicht ist ihm der vegetabilische Eiweißstoff (Albumin) ähnlich, welches sich sowohl in der Bildungsmasse der Pflanzenwelt, als auch in flüssiger Form in mehreren Pflanzensäften findet. Es ist eines der wichtigsten Bestandteile des Pflanzenkörpers, in kaltem Wasser unauflöslich, wird aber durch das Kochen in eine opalartige Masse verwandelt. In seinem mit Wasser organisch verbundenen Zustande ist es eine dicke, zähe und geschmacklose Flüssigkeit, welche durch Säuren, Weingeist, Gerbestoff und einige Metallsalze niedergeschlagen wird.
Der Faserstoff (Fibrin) ist gleichfalls sehr nahrhaft, aber schwer zu verdauen. Lange gekocht nimmt dieser Stoff die Eigenschaft des Käse an. In größerer Menge genossen und verdaut, begünstigt er die Bildung des roten Bluts und des Muskelsystems, die Entstehung entzündlicher und fieberhafter Krankheiten. Er ist dem Eiweißstoff sehr nahe verwandt.
Der Käsestoff (Galaktin) ist dem Fibrin verwandt, nur noch schwerer assimilierbar, wegen des ihm oft beigemischten Fettes in fauler Gärung scharfe Stoffe entwickelnd, und besonders Ammonium, dann stark reizend und wegen großer Differenz schädlich. Diese sehr nahrhafte Materie befindet sich in der Milch der Säugetiere und ist überhaupt nur in Tierkörpern zu Hause. Vertrocknet wandelt er sich in eine hornartige Substanz und ist dann fast ganz unverdaulich.
Die tierischen Fette und Öle haben eine ähnliche Wirkung wie die Pflanzenöle; nur daß sie, als tierische Erzeugnisse, dem Organismus näher stehen und deshalb leichter zu assimilieren sind. Die ätherischen Öle (Pflanzenäther) werden in allen duftenden Pflanzenteilen getroffen. Sie sind bei mittlerer Temperatur flüssig, bei höherer gasartig. In dieser Form sind sie sehr entzündlich und werden vom Alkohol aufgelöst, vom Wasser aber entweder gar nicht oder nur in geringer Menge. Sauerstoffgas, Chlorin- und Salpetersäure verdicken alle ätherischen Öle und machen sie, was wohl zu merken ist, geruchlos.
Das Osmazom (Fleischextrakt) ist eine leicht verdauliche nährende Substanz, schmeckt scharf und riecht gewürzhaft, löst sich leicht im Wasser auf; nur wenn die saure Gärung anfängt, wird es schädlich. Das Osmazom ist nahe verwandt mit dem Faserstoffe. Es findet sich immer nur im Fleische der reifen Säugetiere. Es kommt in großer Menge namentlich im Muskelfleisch vor.
Dies sind die Materialien, aus denen die verdauende Kraft dem Menschenleibe seine verlorenen Teile wieder ersetzt. Die chemische Zergliederung derselben zeigt uns freilich nur, daß es immer dieselben Elemente sind, mit denen eine unsichtbare und unwägbare Lebenskraft ihr Spiel treibt. Je nachdem diese Materialien in mehr oder minder reichlicher Menge in den Tieren und Pflanzen enthalten sind, desto geeigneter werden diese zum Genuß sein, wenn nicht etwa ein der Verdauung minder nachgiebiger Stoff jene nahrhaften Teile so umhüllt und festgebunden hält, daß sie hierdurch ganz unwirksam und fruchtlos für den sie aufnehmenden Magen werden.
Der Geschmack ist schon nach Aristoteles eine Art des Tastsinnes – das Schmeckbare ist ein Tastsinn; aber freilich ist diese Theorie eine Folge der Kindheitsstufe, auf welcher zu seiner Zeit die Physiologie überhaupt noch stand. Ein heutiger Philosoph würde sich anders ausdrücken und ungefähr sagen, daß alle Sinnenwahrnehmung durch das allgemeine Nervengefühl vermittelt werde. Daß die tastende Zunge mehrere Sinne vereinigt, ist daher gewiß, weil sie zugleich die tastbaren Dinge und den Geschmack empfindet.
Unser Geschmack ist schärfer als der Geruch, weil jener eine Art des Tastens ist, und der Mensch diesen Sinn als den stärksten besitzt. In den anderen Sinnen wird der Mensch von vielen Tieren übertroffen; den Tastsinn anlangend, unterscheidet er um vieles besser als alle Tiere, ein Beweis, daß gerade hierin ein besonderer Vorzug beruht, daß die von hartem Fleisch unfähig im Geiste sind, die von weichem aber Fähige. Helvetius sagt: Hätte die Natur anstatt der biegsamen Hand und Finger unsere Arme in Hufe geendigt, wir würden noch in den Wäldern umherirren gleich flüchtigen Herden. In dem weichen, biegsamen Rüssel des Elefanten, der fingerartig endet, ist seine Weisheit begründet.
Zwei Menschen kannte ich, die beide ein schreckliches Ende fanden (denn der eine ward lebendig zerrissen und der andere starb des Hungertodes), in denen sich die wilde und milde, die tierische und höhere Bestimmung, besonders in ihren materiellen Genüssen, bis an die Grenzen der Möglichkeit erstreckte.
Der eine war der Rittmeister K–r. Diesen Mann sah ich in Breslau in einem Weinhause unter anderm einmal acht Pfund rohes Rindfleisch essen, wozu er zwei Flaschen Rum austrank, und zum Dessert das Glas auffraß, aus dem er getrunken hatte. Ob er nachher noch mehr zu sich nahm, weiß ich nicht; denn nachdem sein Glas daran gekommen war, schlich ich sanft von dannen; da ich mager, also leicht zu verdauen bin, so fürchtete ich, am Ende selbst von diesem Zyklopen verschlungen zu werden. Übrigens sah das rohe Fleischessen ganz appetitlich aus. Er schnitt das Fleisch klein, schabte es, zog die Sehnen heraus und hackte es auf einem Hackbrett sehr fein mit Zwiebeln, Schalotten und Sardellen; dann goß er Essig, Öl und Senf dazu und pfefferte das Ganze stark. Das Glas biß er ein und kaute es zu Pulver, ohne sich den Mund im geringsten zu verletzen. So verzehrte er es ganz und ließ nichts zurück als die Mitte des gar zu dicken Bodens. Dieser Mann ging im Jahre 1831 in russische Dienste, machte den Feldzug gegen die insurgierten Polen mit, wurde von diesen gefangen und vom wütenden Pöbel in Warschau bei lebendigem Leibe in Stücke gerissen.
Das Gegenbild von ihm war ein sehr lieber Freund von mir, der sich als älterer Mann meiner Unerfahrenheit annahm. Dieser, mein sehr geistreicher Freund, ward mein Vorbild in vielen, nur zu vielen Dingen. Ich mußte ihm unter anderem oft bei Jagor in Berlin (wo ich als junger Gardeoffizier in Garnison stand) Gesellschaft leisten. Ich mußte mir, so wollte er es, die Gerichte aus einer Eßkarte aussuchen, von der ich das Wenigste kannte, und bei meinem jugendlich munteren und gesunden Appetite griff ich immer zu derber Kost, zu Rotkohl mit Hasen, Vol au vent, Backobst mit Klößen und Speck usw. Es dauerte lange, bis ich eine Art von gelinden Verzückungen im Gesichte meines Freundes bemerkte. Er war ein Feinschmecker mit einer ganz übertriebenen Theorie. Man müsse, behauptete er, immer Hunger haben – der gebe blühende Gedanken; vor allen Dingen nie schwere Speisen essen und überhaupt wenig Kompaktes. Wenn er kalten Hasenbraten aß, und er aß nur kalten, so zog er den Speck mit den niedlichsten Fingern auf die reizendste Weise aus dem Braten. Speck, behauptete er, habe wie Oerindur eine zwiefache Natur, man müsse ihn lieben und hassen:
» – – erklärt mir Oerindur
Diesen Zwiespalt der Natur.«
Dies vermochte ich natürlich nicht, ich hatte von alledem keine Ahnung. Nun erklärte er mir die Natur des Specks, dessen flüchtiges Öl vortrefflich, dessen im Braten zurückgebliebenes ganz unverdaulich sei. Er behauptete, der Sinn des Essens könne durch allzu große Nachgiebigkeit in der Menge, welche ihm zur Sättigung gereicht, leicht krankhaft werden. Derjenige, der sich angewöhnt, durch Massen seinen Magen auszudehnen, empfinde Mangel, wenn der Magen nicht vollgestopft und vollgepfropft sei, wie das jenem Fresser erging, der behauptete, eine Gans sei ein ekliger und dummer Vogel, denn eine sei zu wenig und zwei zuviel. Diesen Mangel an Ausdehnung nennen solche Fresser Hunger; aber diese Empfindung ist von ganz anderer Art.
Ich habe, so fuhr mein Freund fort, von jemandem gehört, der um einer Wette willen einmal eine große Menge Speisen zu sich genommen hatte und versicherte, seit dieser Zeit sich niemals wieder vollkommen gesättigt zu haben, und sich daher genötigt sah, um dem Heißhunger nur einigermaßen zu genügen, noch einmal soviel zu jeder Mahlzeit zu nehmen als früher.
Mein Freund genoß sehr starke Bouillon, Suppen von zerstoßenen Mandeln mit Eiern, Kalbsfüße zu Brühen gekocht, scharfe Ragouts. Selbst von Geflügel und Lammkoteletten saugte er nur den Saft aus. Kapaunen ließ er im Burgunder ersticken; auch wußte er, wie oft jedes Geflügel, bei so- und soviel Grad Feuerhitze am Spieß gedreht werden müsse. Alles Gespickte: Filets, Wild, Hecht, verlangte er so zugerichtet, daß man den unverdaulichen Speck, indem man mit dem Messer zart darauf drückt, leicht herausziehen könne, weil sonst dergleichen Speisen nur kalt zu genießen seien; er hatte dazu eine eigene Spicknadel erfunden. Das Süße, behauptete er, ernähre, das Fette erweiche, das Salzige reize, aber erhitze. Wer an Säure des Magens leide, müsse bittere Pflanzen genießen, weil sie den Appetit reizen, vermehren und die Stelle der Galle ersetzen. Saure Pflanzen aber lindern Hitze und Durst.
Ein Glas Likör, aber auch nur eines, behauptete er, gebe Lebhaftigkeit, wie alles, was sich leicht verdaut. Aber Pflanzen geben keine Kraft, sie füllen, aber schwächen, machen träge; animalischer Saft reize die Nerven, gebe Munterkeit. Blumenkohl war ihm schon dem Namen nach verhaßt: er habe bloß den Namen von Blumen, sonst nichts, sogar sein Geruch sei widerlich. Salatessen nannte er Grasfresserei, und diese sei rein tierisch.
Als großer Freund vom Kaffee hatte er eine spezielle Malice gegen Zichorien, die ich ihm, als Surrogat für den Kaffee, allerdings nicht verargen kann. Über diese Materie war er ganz unerschöpflich. Wenn Kaffee, sagte er, mit Zichorien nicht Nachteile für die Gesundheit hätte, die man sogar dem wahren Kaffee anrechnet, so hat die Zichorie doch keinen einzigen Vorzug der Kaffeebohne. Man darf, behauptete er, über Zichorienfabriken nicht nachdenken, sonst könnte man zum Mordbrenner werden. Sein Kaffee war so stark, daß das ganze Haus davon den Geruch annahm. Ich besuchte ihn einmal, als er, ich weiß nicht welches Experiment gemacht hatte, wozu er mehrere Tropfen Olei Cinnamomi eingenommen, nach denen er tagelang nach Zimt roch.
Er hatte eine ganze Farbentheorie für den Magen. Rot sei sauer, wie denn auch die sauern Äpfel gemeiniglich rot seien – alle feuerroten Blätter wiesen auf Pflanzensäure; gelb sei bitter – Rhabarber, Gentiana, Centaurea; die grüne Farbe deute auf Roheit, daher alle jungen Früchte roh seien, solange sie grün sind; sobald sie die grüne Farbe ablegten, hätten die eßbaren einen besseren Geschmack, und daß die blasse Farbe Abgeschmacktheit verrate, das beweise die in allen Formen abgeschmackte Zichorie.
Bei allen Wasserpflanzen müsse man auf der Hut sein; diese aber, auf trockenem Boden kultiviert, verlören einen großen Teil ihrer Schärfe. Der Sellerie der Italiener ist, wenn er in Sümpfen wächst, scharf, ekelhaft, giftig. Durch Kultur auf trockenem Erdreich wird er süß und genießbar. Die kaustische Radix Callae wird eßbar, sobald sie in Mehl gerieben und gekocht wird; so wird fortwährend die Wirksamkeit gestört, wenn Geschmack und Geruch aufgehoben wird. Die in den Apotheken aufbewahrten Pflanzen verlieren mit der Zeit Geschmack und Geruch, daher sie von den Ärzten bei der jährlichen Visitation verworfen werden. Pflanzen und Früchte, die im Schatten wachsen, werden wässerig und geschmacklos – Folia Cichorei! Kaffee davon erzeugt Ohrenbrausen, fortgesetzter Gebrauch Taubheit – und somit ritt er wieder auf seinem Steckenpferde.
Ziegen, sagte er, die sich von Wermut nähren, geben bittere Milch. Schafe, die Wermut fressen, haben ein angenehm bitteres Fleisch. Pflanzen, deren überwiegende Bestandteile in einer Säure bestehen, sind kühlend. Pflanzen, die mit Wasser angezogen einen Bitterstoff geben, wirken erregend; enthalten sie Gerbstoff, so erhitzen sie. Pflanzen, welche in der Gattung zusammentreffen, treffen auch in der Wirksamkeit zusammen; die in der natürlichen Ordnung beieinander sind, treten sich auch in der Wirksamkeit näher.
Er erfand eine eigene, hell aussehende Sauce; sie war aber ein höllisches Feuer. Das Aufsuchen von allerlei Beziehungen wurde immer feiner. Erst lächelte ihn eine Frucht an, dann wollte er sich in ihr getäuscht, sich durch sie vergiftet haben. Seine Studien der Pflanzen in bezug auf den Boden, auf dem sie wurzelten, und der Qualitäten in bezug auf den Geschmackssinn wurden immer gründlicher. Pflanzen auf trockenem Boden sind schmackhafter als die auf feuchtem, und die wässerigen oft korrosiv. Die trefflichsten aromatischen Pflanzen: Cinnamomum, Rosmarinus, Salvia, Thymus, Lavendola, Melissa – wachsen sie nicht auf trockenem Boden? Er stellte reiche Versuche mit Pflanzen in dem trockenen Lande an, welches er bewohnte.
Wissen Sie, rief er mir nach einer langen Vorlesung bei Jagor zu, wer der erste Gourmand und Feinschmecker Berlins ist? Mein Nachbar zur Linken. Mein Nachbar zur Linken, wiederholte er mir, ohne mit Kopf und Hand wohin zu deuten, denn es saß da keine Menschenseele, so daß ich nicht wußte, wen er meinte, bis er mit der Hand auf das freundliche, neben ihm stehende Pinscherhündchen von Jagor deutete. Ich reichte also diesem seinen Schützling einen delikaten Knochen. Dieser aber knurrte mich an, warf mir einen Blick zu, wie der Bramin dem Paria, kniff den Schwanz ein und zog sich zurück. Einen größeren Triumph seiner Theorien hatte mein Freund noch nicht erlebt; er war darob überglücklich, um so mehr, da der Hund jedesmal bei meinem Freunde Posto faßte und selbst mit Fußtritten nicht zu vertreiben war. Gegen mich hatte er dagegen eine ganz entschiedene Abneigung, und mein Freund bewies mir mit Gründen, wie recht der Hund, welch feine Geruchsnerven er habe, was für ein ausgezeichneter Gourmand er sei.
Indes litt mein Freund fortwährend an Unverdaulichkeit wie an Schlaflosigkeit. Diese letztere nahm so überhand wie seine künstlichen Mittel dagegen. Er stellte stark riechende narkotische Dinge in seine Schlafstube; ich mußte zuletzt viele Nächte bei ihm bleiben, ihm die Zeit mit Schachspielen zu verkürzen. Zuweilen bekam er des Morgens um 2 oder 3 Uhr Appetit. Dann ließ er ein Geflügel an den Spieß stecken. Auch dadurch schwächte er den Magen. Denn Personen von schwachen Magen müssen ihre Mahlzeit zu gewissen, ein- für allemal festgesetzten Stunden nehmen, weil dann nicht bloß der Reiz der genossenen Nahrung, sondern auch die periodische Gewohnheit zur Verdauung hilft. Er genoß immer weniger, konnte fast gar nichts mehr verdauen und starb im eigentlichsten Sinne des Wortes am Hungertode. Bei seiner Öffnung fanden sich die Eingeweide aus Mangel aller bewegenden und belebenden Kraft vollkommen zusammengeschrumpft, hart, fast versteinert, und in der Mitte war ein dünner Kanal, kaum hinlänglich, Flüssigkeiten durchzulassen.
Ich, der ich alle seine Grundsätze angenommen, alles nachgemacht hatte, aber noch jung war, hatte mir auch schon mit dem Eingekochten, den Sülzen, Pürees und Ragouts den Magen gründlich verdorben und nichts erlangt als einen gewissen Grad von Achtung von seiten des verdammten Pinscherhundes. Ich schlug aber diese Achtung in die Schanze, fing wieder an, Sauer-, Blumen- und Rotkohl zu genießen und beobachtete vor allen Dingen Montaignes goldene Regel, mindestens einmal im Monat dem Magen vollauf zu tun zu geben und ihn in der Arbeit zu stärken!
Nicht so leicht wurde es mir, so manchen andern seiner Fehler wiederum abzulegen; die von ihm erhaltenen Eindrücke waren lebhaft und bleibend zugleich. Die Eindrücke, die ein wahrhaft liebenswürdiger Mensch auf die leicht empfängliche Jugend macht, sind oft allmächtig, und in diesem meinem Freunde lag überdies ein Zauber, der auf mich eine unwiderstehliche Gewalt ausübte.