
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wer glaubt doch die Alfanzerei,
Daß Bratenessen Sünde sei,
Und wider des Allmächt'gen Zorn
Ein Hering ward zum Gnadenborn.
Schaut er, in Majestät gehüllt,
Auf das, was uns den Magen füllt?
Swift
Es ist nützlich, sagt Voltaire, daß es im Jahre eine Zeit gibt, in der weniger Ochsen, Kälber, Lämmer, Schöpse und Geflügel aller Art geschlachtet werden als gewöhnlich. Man hat im März, wenn die Fastenzeit beginnt, weder junge Hühner noch Tauben. Die Polizei hat sehr weise befohlen, daß das Fleisch zu dieser Zeit etwas teurer in Paris sein soll und daß die Vorteile den Hospitälern anheimfallen. Es ist ein fast unmerklicher Tribut, welchen der Reichtum der Armut zahlen muß; denn die Reichen haben nicht die Kraft wie die Armen, das ganze Jahr hindurch zu fasten.
Es gibt wenig Landleute, die einmal im Monat Fleisch essen können; könnten sie es aber täglich, so würde das fruchtbarste Land nicht soviel produzieren. Zwanzig Millionen Pfund Fleisch täglich würden jährlich 7300 Millionen Pfund ausmachen. Das Fazit ist erschrecklich. Die kleine Anzahl der Reichen, der Finanziers, der Prälaten, der großen Herren und vornehmen Damen, welche geruhen, Fastenspeisen auftragen zu lassen, fasten bei Lachs, Hummern, Steinbutten und Stören.
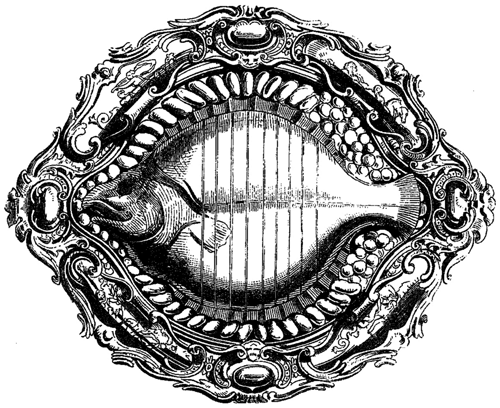
Ein berühmter Finanzier hatte Kuriere, welche ihm täglich für hundert Taler alle möglichen Arten von Seefischen nach Paris brachten. Diese Ausgabe nährte die Kuriere, die Postmeister, welche die Pferde lieferten, die Fischer, Schiffer, Schiffbauer, Fischnetzfabrikanten usw. sowie die Gewürzhändler, bei denen man alle die ausgezeichneten Spezereien entnahm, welche den Fischen einen feineren Geschmack als dem Fleisch geben. Lukullus selbst hätte nicht wollüstiger fasten können. Dabei ist noch zu bemerken, daß alle Seefische dem Staate bei ihrer Ankunft in Paris eine bedeutende Steuer entrichten. Die Sekretäre der Reichen, ihre Kammerdiener, Bedienten, das Hofgefolge usw. essen die Überbleibsel des Krösus und fasten ebenso köstlich wie er selbst. – Bei den Armen ist es nicht so. Sie begehen nicht bloß an dem Benagen der zähen Hammelkeule eine Sünde, sondern sie suchen auch oft vergebens dies elende Nahrungsmittel. Sie haben nur ihr Roggenbrot, den Käse, den sie von ihren Kühen, Ziegen und Schafen gewonnen haben, und einige Eier von ihren Hühnern. Was bleibt ihnen nun noch zur Nahrung. Nichts! Sie willigen ein zu fasten, aber nicht zu sterben; es ist durchaus notwendig, daß sie ihr Leben fristen, sei es auch nur, um den Acker der höheren Stände zu bebauen. So frage man denn, ob es nicht einzig und allein der polizeilichen Obrigkeit zukomme, über die Gesundheit der Menschen zu wachen und ihnen die Erlaubnis zu geben, von dem Käse zu essen, den ihre Hände geknetet, und von den Eiern, die ihre Hühner gelegt haben. Die alleinseligmachende Kirche ordnet wohl die Fasten an, aber sie kann, als geistige Macht, nur dem Herzen gebieten und nur geistige Strafen auferlegen. Sie kann nicht, wie in alten Zeiten, einen armen Mann, der nur ranzigen Speck zur Nahrung hat und diesen Speck auf trockenem Brote verzehrt, zum Scheiterhaufen verdammen. Die Polizei muß von dem größeren oder kleineren Vorrate der Lebensmittel unterrichtet sein; aber die Geistlichkeit sollte höheren Beschäftigungen nachgehen.
Weshalb fastete Christus vierzig Tage in der Wüste, wohin ihn der Teufel geführt hatte? Der heilige Matthias bemerkt, daß er nach diesem Fasten Hunger gehabt habe. Demnach scheint er in der Fastenzeit keinen Hunger gehabt zu haben. Der heilige Johann von Matha verschmähte schon als saugendes Kind an den Fasttagen die Brust, und der heilige Aldobrand machte an einem Fasttage ein gebratenes Rebhuhn wieder lebendig (Acta Sanct. vom 9. April 830). – Der Papst Zacharias antwortete dem Bonifazius, Missionär der Deutschen: »Du fragst mich, wie es mit dem Speck zu halten sei? Die Väter haben deshalb nichts vorgeschrieben. Meine Meinung indessen ist, daß man ihn nicht anders als am Feuer gekocht oder geräuchert essen müsse. Aber wenn man ihn roh essen will, so tut man wohl, damit bis nach Ostern zu warten.«
Überstrenge Muselmänner sollen sich sogar auch daraus ein Gewissen machen, in den Fasten den Geruch der Blumen einzuziehen, gleichsam als sei diese Erquickung ein feines Nahrungsmittel. Daher heißt es in Rückerts »Makamen des Hariri«: »So daß ich mit trockenem Munde – die Gebetspflichten jeder Tagesstunde – selbst den Duft der Salben mir hielt vom Haupte, daß er mir nicht den Stand der Nüchternheit raubte.« – Auf einem Kongreß aller Völker zur gemeinsamen Annahme der besten Religion neigte man sich schon zum Mohammedanismus; aber ein Samojede protestierte dagegen, weil im Koran vorgeschrieben wird, unter anderem auch ein Fasten von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang zu halten. »Das hält«, sagte der Samojede, »kein Mensch von meiner Nation aus, denn bei uns geht die Sonne manchmal nur alle sechs Monate auf.«
Madame Campan erzählt in ihren »Memoiren«, daß die Prinzessin Viktoria von Frankreich nicht unempfindlich gegen die gute Küche, aber sehr skrupulös im Fasten war. »Ich sah sie«, erzählt dieselbe, »eines Tages sehr beunruhigt über die Zweifel, ob ein gewisser Wasservogel, den man ihr während der Fastenzeit vorgesetzt hatte, auch in der Tat Fastenspeise sei. Sie zog darüber einen Bischof zu Rate, der sich an ihrer Tafel fand. Der Prälat nahm sogleich einen ernsten Ton an, um sich als Richter in letzter Instanz zu bekunden. Er antwortete der Prinzessin, daß es entschieden sei, daß man bei dergleichen Zweifeln den möglichst warm aufgetragenen Gegenstand auf einen recht kalten Teller legen und mit einer Gabel durchstechen müsse. Wenn die herausgeflossene Jus in einer Viertelstunde gerinne, so sei der Gegenstand keine Fastenspeise und daher verboten; bleibe das Fett aber flüssig, so könne man davon ohne Gefahr am Fasttage genießen. Der Versuch wurde gemacht und das Tier zur Freude der Fürstin als unschuldig befunden. Die Fastenspeisen inkommodierten diese Fürstin sehr, deshalb erwartete sie mit großer Ungeduld den ersten Schlag der Mitternachtsstunde vom Freitag zum Sonnabend, um ihrem Verlangen nach gewichtiger Speise sofort zu genügen.
Der Frühling, d. i. die Fastenzeit, ist die traurigste Zeit für die Küche; mit Ungeduld werden die ersten Gemüse erwartet. Bis dahin glänzen die Entremets auf Kosten des Solideren. Da werden fast überall die Soufflés gegessen, überall, aber fast nirgends gut, denn sie verlieren ihre Physiognomie, d. h. ihr Verdienst, wenn sie auch nur eine Minute auf den Tisch gesetzt werden; sie müssen unmittelbar aus der Küche, ja, vom Herde kommend, gegessen werden.
Beignets müssen, wie alle Frituren, croquant sein, weshalb sie erst im letzten Moment an das Feuer gesetzt werden dürfen. In Italien werden sie mit Öl und ganz vortrefflich bereitet.
Wer das köstliche, süße, frische Öl in Italien nicht genossen hat, kann sich von der Güte aller damit zubereiteten Speisen, von ihrem Wohlgeschmack keinen Begriff machen, und man mag sagen, was man will, unsere nordische Butter ist gegen Luccheser Öl doch nur eine Schmiere, ein bei uns leider unentbehrliches Surrogat. Wenn Reil unter allen Fetten und Ölen der Butter den Vorzug gibt, so muß ich ihm, den ich so sehr verehre und so vielfach zu Rate gezogen habe, auf das allerentschiedenste widersprechen. Gewiß kannte er nur alle die schlechten Ölsorten, die bei uns für gute italienische und Provencer Öle verkauft werden, und außer der Qualität auch noch ihr oft hohes Alter gegen sich haben. Öl ist freilich nur frisch, aber so frisch wie es gepreßt ist, vortrefflich; das kann jeder erfahren, der einmal aus der Ölstampfe frisches, eben geschlagenes Leinöl auf Brot gekostet hat. Nun kann aber auf der ganzen Erde nur ein kleiner Teil Menschen frisches Olivenöl essen, der bei weitem größte Teil muß sich mit verschicktem, oft sehr altem, d. h. sehr schlechtem Öle begnügen. Aber zwischen frischem Öle und noch so frischer Butter schwankt der Gastrosoph gewiß keinen Augenblick.
Der Wert und die Güte der Olive ist an sich so verschieden wie das Öl derselben. In der Provence gibt es davon zwei Hauptsorten. Die sehr großen Olivenbäume, Saurins genannt, und jene, die so klein bleiben, daß man ihre Früchte ohne Leiter mit der Hand abnehmen kann – sie heißen Salonings –, sie geben das beste Öl. Die erste Art findet man im Var-Departement, in Nizza und in Genua. Diese Art hat sechs Varietäten, die sich durch Blätter und Früchte sehr bestimmt unterscheiden, und wovon jede ihre Vorzüge hat. Es eignet sich z. B. die Art, welche man im Provenzalischen Puncia nennt, ganz besonders zum Einsalzen. Die sogenannte wilde gibt das wenigste, aber allerfeinste Öl. Die Art, die in Grasse Cacone genannt wird, aber mehr unter dem Namen Nostral bekannt ist, ist die gemeinste. Jeder Kanton in der Provenze und in Languedoc gibt aber derselben Olivenart andere Namen, so daß man sich schwer zurecht findet. Die letztgenannte Art ist die zahlreichste, weil sie das gemeinste Öl gibt, nicht aber das beste. Es ist mit der Olive wie mit dem Wein, Äpfeln und sehr vielen Früchten. Die Varietät, welche viel trägt, ist von der Mehrzahl der Anbauer die gesuchteste, aber sie trägt nicht die besten Früchte. Die Olive gedeiht auf jeder Bodenart, nur nicht im Morast; aber das beste Öl geben Bäume auf trockenem, leichtem Boden.
Im allgemeinen gibt die Erde, welche guten Wein gibt, auch gutes Öl. Dem Ölbaum muß alles trockene Holz genommen werden, sonst trägt er nur halb so viel. Deshalb sieht ein Olivengebüsch auch immer so schön aus, trotz des dunklen Grüns seiner Blätter, fast wie das der Weidenblätter, und nimmt sich in der Nähe des Meeres, zwischen anderen Bäumen, besonders neben Wiesen, gar freundlich aus. Sollen die Olivenbäume viel tragen, so müssen sie gut gedüngt sein; aber das Öl von solchen Bäumen wird nicht besonders. Im Monat April blühen die Oliven in der Provence, in Nizza vierzehn Tage früher. Wenn Insekten den Bäumen sehr zur Last fallen, so wird das Öl schlecht und hält sich nicht lange. In einigen Gegenden der Provence läßt man die Oliven gären, bevor man sie in die Mühle schickt. Wenn die Mühlsteine und die Gefäße nicht sehr rein sind, wenn die Lese nicht auf das properste gemacht wird, so bekommt das Öl einen schlechten Geschmack. Reinlichkeit ist aber in Südfrankreich und Italien eine sehr große Seltenheit. Darum ist auch gutes Öl, besonders in Italien, selbst in Lucca, etwas sehr Seltenes. Das schlechteste Öl, das sogenannte Höllenöl, welches aus dem Mark der Olive gepreßt wird, benutzt man zum Brennen, es wirft ein helles Licht und verzehrt sich fast ganz. Die Olivenkerne werden zum Kaminfeuer genutzt; sie geben ein mildes, blaues, gleichmäßig brennendes Feuer, eine anhaltend glimmende Glut.
Gastrosophen lieben das Öl von Aix in der Provence; es ist sehr selten, aber vortrefflich, bewahrt den leicht bitteren Geschmack und ist grünlich, weshalb die Fälscher unreife, grüne Oliven nehmen, um es nachzuahmen; ein solches Öl hält sich nicht lange. Auch hat man das Olivenöl schon mit Blei vermischt gefunden, was von der Gewohnheit kommt, es in Bleigefäßen aufzubewahren, damit es nicht ranzig werden soll. Häufiger erhält man Olivenöl mit Mohnöl gemischt. Eine andere, ganz schlechte Sorte, die gewöhnlich auch als Salatöl verkauft wird, bereiten die Ölfabrikanten dadurch, daß sie die ausgepreßten Ölkuchen mit heißem Wasser auskochen und die Flüssigkeit abschäumen. Nicht nur zur Verfälschung des Olivenöls wird, im Vorbeigehen gesagt, das Mohnöl gebraucht, man mischt es auch unter Mandel-, Hasel- und Walnußöl. Aus Schwaben und dem Elsaß gehen jährlich viele tausend Pfund Mohnöl nach Triest, die von da unter veredelter Gestalt wieder zurückkommen.
Die Olivenfelder würden den reichsten Ertrag geben, wenn nicht zuweilen ein einziger Nachtfrost das reichste Feld auf zwanzig Jahre verdürbe. Die Natur gibt die Lehre, daß ein kleiner, sicherer Gewinn dem sehr großen, aber unsicheren vorzuziehen sei. Ein Sprichwort sagt: Wer nichts besitzt als Olivenwälder, ist immer arm. Man rechnet ein gutes Jahr um das andere, und das andere Jahr gibt nur den fünften oder achten Teil des Gewinstes eines guten Jahres. Deshalb wechseln die Ölpreise so ungeheuer, und man sieht ebenso häufig sehr reiche als ruinierte Ölhändler. Der Olivenbaum verträgt fünf bis sechs Grad Kälte, aber die Äste sind sehr zart; ein Regen, ein kalter Wind (nicht zu vergessen, in der Provence weht der fürchterliche Mistral) verzehrt oft eine ganze Ernte. Der Olivenbaum ist nicht gemacht für den Schnee, er zerbricht oft unter seiner Last, und man hat alles für die Ernte zu fürchten, wenn nicht Wind dem Schnee bald folgt, um den Baum von einem Kleide zu befreien, das seinem immerwährenden Grün so lästig ist. Die Bäume haben das mit den Tieren gemein, daß die an ein mildes Klima gewöhnten gegen den Frost sehr empfindlich sind. Die Bäume, welche die Mittagssonne genießen, gehen leichter zugrunde als die, welche dem Nordostwinde ausgesetzt sind, denn diese haben eine härtere Rinde. Wir Nordländer brauchen uns wenigstens darüber, daß wir keinen Wein und kein Öl haben, nicht zu beklagen, denn sicher geben Wiesen und Getreidefelder einen größeren und gesicherteren Wohlstand.