
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
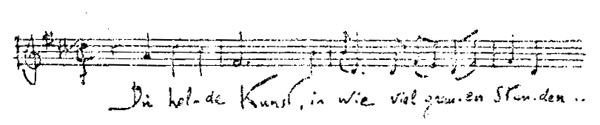
Das Leben vergeht. Körper und Seele fließen dahin gleich einem Strome. Die Jahre graben sich in das Holz des alternden Baumes. Die ganze Welt der Formen verbraucht und erneuert sich wieder. Du allein vergehst nicht, unsterbliche Musik. Du bist das Meer der Herzenstiefen. Du bist die innerste Seele. In deinen klaren Augen spiegelt sich das düstere Gesicht des Lebens nicht. Fern von dir, gleich dem schwärmenden Gewölk, flieht der Zug der heißen, der kalten, der fiebernden Tage dahin, die die Sorge jagt, und die ohne Dauer sind. Du allein vergehst nicht. Du stehst außerhalb der Welt. Du bist eine Welt für dich. Du hast deine Sonne, deine Gesetze, Flut und Ebbe. In dir ist der Frieden der Sterne, die durch das Feld der nächtlichen Räume ihre Lichtfurchen ziehen, – silberne Pflugscharen, die die sichere Hand des unsichtbaren Hirten führt.
Musik, du milde, wie wohl tut dein Mondlicht den Augen, die vom scharfen Glanz der Sonne hier unten müde wurden! Die Seele, die das Leben kennt, wendet sich ab von der allgemeinen Tränke, in der die Menschen, wenn sie trinken wollen, den Schlamm mit den Füßen aufrühren; sie eilt an deinen Busen und saugt an deinen Brüsten den frischen Quell des Traumes. Musik, jungfräuliche Mutter, die alle Leidenschaften in ihrem unberührten Leibe trägt, die Gutes und Böses im See ihrer Augen birgt, in dem binsenfarbenen, dem blaßgrünen Wasser, das von den Gletschern kommt! Du stehst über dem Bösen, du stehst über dem Guten; wer sich zu dir flüchtet, lebt außerhalb der Jahrhunderte; die Zahl seiner Tage wird sein wie ein einziger Tag; und der Tod, der alles zernagt, verliert seine Macht über ihn.
Musik, die du meine schlaftrunkene Seele wiegst, Musik, die mich von neuem fest, ruhig und froh gemacht hat, – meine Liebe und mein Leben, – ich küsse deinen reinen Mund, ich berge mein Gesicht in deinen goldenen Haaren, ich bette meine brennenden Lider in deine weichen Hände. Wir schweigen, unsere Augen sind geschlossen, und doch sehe ich das unauslöschliche Licht deiner Augen, und doch trinke ich das Lächeln deines stummen Mundes; und an deinem Herzen geborgen lausche ich dem Schlage ewigen Lebens.
Christof zählt nicht mehr die fliehenden Jahre. Tropfen für Tropfen verrinnt Leben, aber seines ist anderswo. Es hat keine Geschichte mehr. Seine Geschichte ist das Werk, das er schafft. Der unaufhörlich quellende Sang der Musik erfüllt seine Seele und macht sie für das Getöse der Außenwelt unempfindlich.
Christof hat gesiegt. Sein Name hat sich durchgesetzt. Das Alter kommt. Seine Haare sind weiß geworden. Das kümmert ihn nicht; sein Herz bleibt immer jung; es hat nichts von seiner Kraft und seinem Glauben eingebüßt. Er hat die Ruhe wiedergefunden, aber es ist nicht mehr dieselbe, die er hatte, bevor er durch den feurigen Busch schritt. In ihm zittert die Erregung über den Gewittersturm und über den Blick in den Abgrund nach, den das aufgepeitschte Meer vor ihm aufgetan hat. Er weiß, daß niemand sich rühmen darf, Herr seiner selbst zu sein, es sei denn, Gott, der die Kämpfe lenkt, läßt es zu. Zwei Seelen leben in seiner Brust. Die eine ist ein von Winden und Wolken gepeitschtes Hochland. Die andere, die jene beherrscht, ist ein Schneegipfel, der im Lichte badet. Verweilen kann man dort nicht; doch wenn man von den Tiefennebeln erstarrt ist, kennt man den Weg, der zur Sonne führt. In seiner Nebelseele ist Christof nicht allein, er fühlt, die unsichtbare Freundin ist ihm nahe, – die starke Heilige Cäcilia, die mit großen, ruhevollen Augen den himmlischen Chören lauscht; und wie den Apostel Paulus – auf Raffaels Gemälde – der, auf sein Schwert gestützt, sinnend schweigt, erregt ihn nichts mehr; er denkt nicht an den Kampf, er träumt und spinnt seinen Traum.
In dieser Periode seines Lebens schrieb er vor allem Kompositionen für Klavier und Kammermusik. Darin hat man mehr Freiheit, etwas zu wagen. Es gibt weniger Zwischenstufen zwischen dem Gedanken und seiner Verwirklichung: denn der Gedanke hat nicht Zeit gehabt, sich unterwegs abzuschwächen. Frescobaldi, Couperin, Schubert und Chopin sind durch die Kühnheit ihres Ausdrucks und Stils den Revolutionären des Orchesters um fünfzig Jahre voraus gewesen. Aus dem tönenden Teig, den die kräftigen Hände Christofs kneteten, wurden bisher unbekannte harmonische Gebilde, schwindelerregende Akkordfolgen, die von den entlegensten Tonverbindungen herrührten, für die unser heutiges Empfindungsvermögen noch empfänglich ist; sie wirkten auf den Geist wie ein heiliger Zauber. – Aber das Publikum braucht Zeit, um sich an die Eroberungen zu gewöhnen, die ein großer Künstler vom Tauchen auf den Meeresgrund mitbringt. Sehr wenige folgten Christof in der Kühnheit seiner letzten Kompositionen; sein Ruhm galt ganz und gar seinen ersten Werken. Das Gefühl der Verständnislosigkeit gegenüber dem Erfolg, das noch peinlicher ist als das gegenüber dem Mißerfolg, weil es unheilbar erscheint, hatte bei Christof seit dem Tode seines einzigen Freundes die etwas krankhafte Neigung, sich von der Welt zurückzuziehen, noch vertieft.
Inzwischen hatten sich ihm die Tore Deutschlands wieder geöffnet. In Frankreich war sein tragisches Abenteuer in Vergessenheit geraten. Er konnte nach seinem Belieben gehen, wohin er wollte. Aber er fürchtete die Erinnerungen, die ihn in Paris erwarteten. Und obgleich er für einige Monate nach Deutschland zurückgekehrt war, obgleich er von Zeit zu Zeit dort hinging, um seine Werke zu dirigieren, hatte er sich dort nicht niedergelassen. Allzu vieles verletzte ihn. Dinge, die nicht nur Deutschland eigentümlich waren; er fand sie auch anderwärts. Aber man steht seinem Land anspruchsvoller gegenüber als einem anderen und leidet tiefer unter seinen Schwächen. Im übrigen trug Deutschland in der Tat die schwerste Sündenlast Europas. Wenn man den Sieg errungen hat, ist man dafür verantwortlich; man ist der Schuldner der Besiegten geworden. Man übernimmt stillschweigend die Verpflichtung, ihnen vorauszuschreiten, ihnen den Weg zu weisen. Der siegreiche Ludwig XIV. brachte Europa den Glanz der französischen Vernunft. Welches Licht hat das Deutschland von Sedan der Welt gebracht? Das Blitzen der Bajonette? Eine Gedankenwelt ohne Schwung, Tatkraft ohne Großherzigkeit, einen brutalen Wirklichkeitssinn, der nicht einmal die Entschuldigung hat, der des gesunden Menschen zu sein; Gewalt, mit Gier nach Vorteilen vereint: Mars als Geschäftsreisender. Vierzig Jahre lang hatte sich Europa furchterfüllt durch die Nacht geschleppt. Die Sonne war unter dem Helm des Siegers verborgen! Wenn Besiegte, die zu schwach waren, um den Helm vom Licht wegzuheben, nur ein mit etwas Verachtung gemischtes Mitleid verdienten, welches Gefühl müßte dann der Mann mit dem Helm erwecken?
Seit kurzem kündigte sich ein neuer Tag an. Durch die Spalten drang etwas Licht. Um als einer der ersten die Sonne aufgehen zu sehen, war Christof aus dem Bereich des Helmes geflohen; er kehrte gern in das Land zurück, in dem er einst gezwungenermaßen Gast gewesen war: nach der Schweiz. Wie soviele Geister der damaligen Zeit, in denen die Freiheit gärte, die im engen Kreis der feindlichen Nationen nach Luft rangen, suchte er einen Erdenwinkel, in dem man über Europa stand und atmen konnte. Einst, zu Goethes Zeit, war das Rom der freien Päpste die Insel gewesen, auf der sich die Gedanken jeder Rasse niederließen, wie die Vögel im Unterschlupf vor dem Gewitter. Welche Zuflucht wäre es heute? Die Insel ist vom Meere bedeckt. Rom ist nicht mehr. Die Vögel sind von den sieben Hügeln geflohen. – Die Alpen bleiben ihnen. Dort, inmitten des gierigen Europas, hält sich (für wie lange noch?) das Eiland der vierundzwanzig Kantone. Allerdings strahlt es nicht den Zauberschein der ewigen Stadt aus. Die Geschichte hat dort der Luft, die man atmet, nicht den Duft der Götter und der Helden gegeben; aber aus der nackten Erde steigt eine machtvolle Musik; die Linien der Berge laufen in heldenhaften Rhythmen; und mehr als anderwärts fühlt man hier die Berührung mit den elementaren Mächten. Christof suchte bei ihnen kein romantisches Vergnügen; ein Feld, ein paar Bäume, eine Quelle, der weite Himmel hätten ihm zum Leben genügt. Das ruhige Antlitz seiner Heimaterde stand ihm innerlich näher als die gigantische Alpenwelt. Aber er konnte nicht vergessen, daß er hier seine Kraft wiedergewonnen hatte; hier war ihm Gott im feurigen Busch erschienen; niemals kehrte er dahin zurück, ohne daß ein Schauer von Dankbarkeit und Glauben ihn durchrann. Er war nicht der Einzige. Wieviele Lebenskämpfer, die das Leben zermürbt hatte, fanden auf diesem Boden die notwendige Kraft wieder, um den Kampf von neuem aufzunehmen und noch einmal an ihn zu glauben!
Während er in diesem Lande lebte, hatte er es kennen gelernt. Die meisten Durchreisenden sahen an ihm nur die Auswüchse: den Aussatz der Hotels, der die schönsten Züge dieser kraftvollen Erde entstellt, die Fremdenstädte, das heißt die ungeheuren Kaufhäuser, in denen das satte Volk der ganzen Welt seine Gesundheit kauft, seine Table d'hôte-Mahlzeiten, diese in den Raubtierkäfig geworfenen Fleischmassen, seine Kasinokonzerte, deren Lärm sich mit dem Lärm der Spieltische mengt, die gemeinen italienischen Hanswürste, bei deren widerwärtigem Gebrüll reiche, gelangweilte Dummköpfe vor Vergnügen außer sich geraten, all den Unsinn aus den Ladenfenstern: Holzbären, Häuschen, alberne Nippes, die sich abwechselungsarm immer wiederholen, die Skandalbroschüren, den ehrbaren Buchladen – den ganzen sittlichen Tiefstand jener Orte, in die sich jedes Jahr Millionen von Müßiggängern stürzen, unfähig, Zerstreuungen zu finden, die höher ständen als die des Pöbels, und die doch nicht einmal so lebendig sind.
Nichts kennen sie vom Leben des Volkes, bei dem sie zu Gast sind. Sie ahnen nichts von den Schätzen sittlicher Kraft und bürgerlicher Freiheit, die sich seit Jahrhunderten in ihm aufgespeichert haben, nichts von den Kohlen aus der Feuersbrunst eines Calvin und Zwingli, die noch unter der Asche glühen, nichts von dem kraftvollen demokratischen Geiste, den die napoleonische Republik niemals anerkennen wird, von der Schlichtheit der Einrichtungen, der Größe sozialer Werke, nichts von dem Beispiel, das diese Vereinigten Staaten der drei Hauptrassen des Okzidents, das dieses Miniaturbild des zukünftigen Europas, der Welt geben. Noch weniger ahnen sie etwas von der Daphne, die sich unter dieser harten Rinde birgt, von den blitzgrellen und ungebändigten Träumen eines Böcklin, dem rauhen Heldentum eines Hodler, den heiter-ernsten Gesichten und dem derben Freimut eines Gottfried Keller, oder von der lebendigen Überlieferung der großen Volksfeste, dem Frühlingssafte, der den Wald schwellt, nichts von dieser ganzen, noch jungen Kunst, die bald herbe schmeckt wie kernige Früchte wilder Birnbäume, bald fade und zuckrig wie schwarzblaue Heidelbeeren, die aber wenigstens nach Erde duftet; nichts ahnen sie von dem Schaffen der Autodidakten, die eine uralte Kultur doch nicht von ihrem Volke trennt; denn sie lesen mit ihm in demselben Buche des Lebens.
Christof empfand Zuneigung zu diesen Menschen, die weniger scheinen als sein wollen, und die unter dem neuen Lack eines übermodernen Industriegeistes manche der erfrischendsten Züge des alten, bäuerlichen und bürgerlichen Europas bewahren. Er hatte unter ihnen zwei oder drei gute Freunde gewonnen, die feierlich, ernsthaft und treu, einsam und verschlossen in der Sehnsucht nach der Vergangenheit lebten; sie schauten dem langsamen Verschwinden der alten Schweiz in einer Art von religiösem Fatalismus, mit calvinistischem Pessimismus zu: große, aber verdüsterte Seelen. Christof sah sie selten. Seine alten Wunden waren scheinbar vernarbt; aber sie waren zu tief gewesen, um ganz zu heilen. Er hatte Furcht, wieder mit den Menschen anzuknüpfen. Er hatte Furcht, sich wieder an die Kette von Sehnsucht und Schmerzen zu legen. Gerade darum fühlte er sich wohl in einem Lande, in dem er leicht abseits, als Fremder unter der fremden Menge, leben konnte. Im übrigen hielt er sich selten lange am selben Orte auf; er wechselte häufig die Raststätte: ein alter Wandervogel, der Weite brauchte, und dessen Reich die Luft ist ... »Mein Reich ist in der Luft ...«
Ein Sommerabend.
Er wanderte im Gebirge umher, oberhalb eines Dorfes. Er trug den Hut in der Hand und schritt auf einem in Windungen aufsteigenden Weg. Auf einem Paß machte der Weg zwischen zwei Abhängen eine doppelte Wendung; Haselnußsträucher und Tannen faßten ihn ein. Er glich einer kleinen, abgeschlossenen Welt. An der oberen und unteren Biegung schien der Weg, durch die Leere abgeschnitten, zu enden. Über ihm blaue Fernen, leuchtende Luft. Der Abendfrieden sank allmählich nieder gleich einem Wasserrinnsal, das unterm Moose tropft.
Sie tauchten beide gleichzeitig auf, jeder an einer der sich gegenüber liegenden Wegbiegungen. Sie war in Schwarz gekleidet und hob sich von der Klarheit des Himmels ab; hinter ihr spielten zwei Kinder zwischen sechs und acht Jahren, ein kleiner Junge und ein Mädelchen und pflückten Blumen. Einige Schritte voneinander entfernt erkannten sie sich. Ihre Augen verrieten ihre Ergriffenheit; aber kein lautes Wort fiel, nur eine unmerkliche Gebärde. Er war sehr verwirrt, ihre Lippen zitterten ein wenig. Sie standen still. Beinahe flüsternd klang es: »Grazia!«
»Sie hier!«
Sie gaben sich die Hand und blieben wortlos stehen. Grazia machte zuerst Anstalten, das Schweigen zu brechen. Sie sagte, wo sie wohnte, sie fragte, wo er wäre. Mechanische Fragen und Antworten, die sie kaum hörten, die sie erst später verstanden, als sie sich getrennt hatten; sie waren einer in des anderen Anblick vertieft. Die Kinder waren herangekommen. Sie stellte sie ihm vor. Er empfand eine feindselige Stimmung gegen sie; er sah sie gütelos an und sagte nichts. Er war von ihr erfüllt und einzig damit beschäftigt, ihr schönes, ein wenig leidendes und gealtertes Gesicht zu studieren. Sie wurde unter seinen Augen befangen. Sie sagte:
»Wollen Sie heute abend zu mir kommen?«
Sie nannte den Namen des Hotels.
Er fragte, wo ihr Mann sei. Sie wies auf ihre Trauerkleider. Er war zu bewegt, um die Unterhaltung fortzusetzen. Linkisch verließ er sie. Nachdem er aber zwei Schritte gemacht hatte, wandte er sich den Kindern wieder zu, die Erdbeeren pflückten, umarmte sie mit Heftigkeit, küßte sie und lief davon.
Abends kam er in das Hotel. Sie saß unter der Glasveranda. Sie setzten sich abseits. Wenig Menschen; zwei oder drei alte Leute. Christof wurde durch ihre Gegenwart innerlich gereizt. Grazia betrachtete ihn. Er betrachtete Grazia, indes er ganz leise immer wieder ihren Namen sagte.
»Ich habe mich sehr verändert, nicht wahr?« fragte sie.
Sein Herz war von Erregung geschwellt.
»Sie haben gelitten,« sagte er.
»Sie auch,« meinte sie voller Mitleid, und schaute sein von Leid und Leidenschaften verwüstetes Gesicht an.
Sie fanden keine Worte mehr.
»Ich bitte Sie,« sagte er nach einem Augenblick, »gehen wir wo anders hin. Können wir uns nicht an einem Ort sprechen, an dem wir allein sind?«
»Nein, mein Freund, bleiben wir. Bleiben wir hier; wir sitzen gut; wer gibt auf uns acht?«
»Ich kann nicht frei sprechen.«
»Es ist besser so.«
Er begriff nicht, warum. Später, als er die Unterhaltung in seiner Erinnerung noch einmal durchlebte, dachte er, sie habe kein Vertrauen zu ihm gehabt. Aber sie hatte nur eine instinktive Furcht vor bewegten Auftritten; ohne es sich klar zu machen, suchte sie einen Schutzwall gegen die Überraschungen ihrer Herzen; ja, sie liebte sogar bei dieser Vertrautheit in einem Hotelsalon den Zwang, der ihre geheime Befangenheit schamvoll verbarg.
Halblaut, von häufigem Schweigen unterbrochen, erzählten sie sich in großen Linien ihr Leben. Graf Berény war einige Monate zuvor in einem Duell getötet worden; und Christof hörte heraus, daß sie mit ihm nicht sehr glücklich gewesen war. Sie hatte auch ein Kind, ihr Erstgeborenes, verloren. Sie vermied jede Klage. Sie lenkte selbst die Unterhaltung ab, um Christof zu befragen, und bewies während der Erzählung seiner Schicksale ein herzliches Mitgefühl.
Die Glocken läuteten. Es war Sonntagabend. Das Leben setzte aus.
Sie bat ihn, am übernächsten Tage wiederzukommen. Er war betrübt, daß sie so wenig Eile zeigte, ihn wiederzusehen. In seinem Herzen mischten sich Glück und Leid.
Am nächsten Tage schrieb sie unter einem Vorwande, er möge kommen. Dieses alltägliche Wort versetzte ihn in Entzücken. Sie empfing ihn diesmal in ihrem Privatsalon. Sie war mit ihren beiden Kindern zusammen. Er betrachtete sie beide noch mit einiger Unruhe und sehr viel Zärtlichkeit. Er fand, daß die Kleine, die Ältere, der Mutter gliche; er fragte nicht, wem der Knabe ähnlich sähe. Sie plauderten von dem Lande, vom Wetter, von den Büchern, die auf dem Tische aufgeschlagen lagen, – ihre Augen hielten eine andre Zwiesprache. Er hoffte, daß es ihm gelingen werde, noch vertrauter mit ihr zu reden. Aber eine Hotelbekannte kam herein. Er sah die liebenswürdige Höflichkeit, mit der Grazia diese Fremde empfing; sie schien keinerlei Unterschied zwischen ihren beiden Besuchern zu machen. Das betrübte ihn, aber er war ihr deswegen nicht böse. Sie schlug einen gemeinsamen Spaziergang vor; er sagte zu. Obgleich die andere hübsch und nett war, langweilte ihn ihre Begleitung doch; der Tag war ihm verdorben.
Er sah Grazia erst zwei Tage später wieder. Während jener beiden Tage lebte er nur für die Stunden, die er mit ihr verbringen sollte. – Auch diesmal gelang es ihm nicht besser, mit ihr zu reden. So gütig sie auch zu ihm war, sie ging doch nicht aus ihrer Zurückhaltung heraus. Christof trug dazu noch unbewußt durch ein paar Ausbrüche germanischen Gefühlsüberschwanges bei, die ihr peinlich waren und gegen die sie sich instinktiv auflehnte.
Er schrieb ihr einen Brief, der sie rührte. Er sagte, daß das Leben so kurz sei und ihrer beider Leben schon so vorgeschritten; vielleicht hätten sie nur wenig Zeit, einander zu sehen: es wäre schmerzlich und fast sündhaft, wenn sie die Gelegenheit nicht wahrnähmen, um frei miteinander zu reden.
Sie antwortete mit ein paar herzlichen Zeilen. Sie entschuldigte sich, daß sie, ohne es zu wollen, seit das Leben sie verwundet habe, ein gewisses Mißtrauen bewahre; sie könne die Gewöhnung an Zurückhaltung nicht abstreifen; jede Äußerung eines zu lebhaften Empfindens, selbst wenn es aufrichtig sei, beunruhige, ja, erschrecke sie. Aber sie fühle den Wert der wiedergefundenen Freundschaft. Und sie sei darüber ebenso glücklich wie er. Sie bat ihn, am Abend zum Essen zu kommen.
Sein Herz strömte über von Dankbarkeit. Er lag in seinem Hotelzimmer auf dem Bett, den Kopf in die Kissen vergraben, und schluchzte. Es war die Erlösung aus zehn Jahren der Einsamkeit; denn seit Oliviers Tode war er einsam geblieben. Dieser Brief brachte ihm die Auferstehungsbotschaft für sein nach Zärtlichkeit hungerndes Herz. Zärtlichkeit! ... Er hatte es wohl oder übel lernen müssen, sie zu entbehren! Heute fühlte er, wie sehr sie ihm gefehlt hatte, fühlte, was alles er an Liebe in sich angesammelt trug ...
Wonnevoller und heiliger Abend, den sie miteinander verbrachten ... Er konnte zu ihr nur von gleichgültigen Dingen reden, trotz ihrer Absicht, einander nichts zu verbergen. Wieviel Wohltuendes aber sprach er am Klavier aus, zu dem sie ihn mit einem Blick einlud, damit er zu ihr rede! Sie wurde von der Demut dieses Mannesherzens betroffen, das sie als hochfahrend und leidenschaftlich gekannt hatte. Als er fortging, sagte der schweigende Druck ihrer Hände, daß sie einander wiedergefunden hatten, daß sie sich nicht mehr verlieren würden. – Es war windstill und regnete. Sein Herz sang.
Sie konnte nur noch einige Tage an dem Ort bleiben und verschob ihre Abreise nicht um eine Stunde; er wagte nicht, sie darum zu bitten oder sich darüber zu beklagen. Am letzten Tage gingen sie allein mit den Kindern spazieren; während eines Augenblickes war er so von Liebe und Glück erfüllt, daß er es ihr sagen wollte. Aber mit einer sehr sanften Gebärde hielt sie ihn lächelnd zurück:
»Christof! ich fühle alles, was Sie sagen können.«
Sie setzten sich an der Wegbiegung nieder, an der sie sich getroffen hatten. Sie betrachtete, immer lächelnd, das Tal zu ihren Füßen; aber es war nicht das Tal, das sie schaute. Er betrachtete das liebliche Antlitz, auf dem Qualen ihren Stempel zurückgelassen hatten. In dem dichten schwarzen Haar zeigten sich überall weiße Fäden. Er fühlte sich von mitleidsvoller und leidenschaftlicher Anbetung für diesen Leib, der geduldet hatte, erfüllt, der von seelischen Leiden durchtränkt war. Die Seele schien überall aus diesen Brandmalen der Zeit hervor. – Und er bat sie mit leise zitternder Stimme, wie um eine kostbare Gunst, um eines ihrer weißen Haare.
Sie reiste ab. Er konnte nicht begreifen, warum sie es nicht so eingerichtet hatte, daß er sie begleiten durfte. Er zweifelte nicht an ihrer Freundschaft; aber ihre Zurückhaltung brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Er vermochte nicht zwei Tage länger an dem Ort zu bleiben; er reiste in einer anderen Richtung fort. Er versuchte, seinen Geist durch Reisen und Arbeiten abzulenken. Er schrieb an Grazia. Sie antwortete ihm zwei oder drei Wochen später mit kurzen Briefen, aus denen eine ruhige Freundschaft ohne Ungeduld, ohne Unruhe sprach. Er litt darunter und liebte die Briefe doch. Er erkannte sich nicht das Recht zu, ihr einen Vorwurf zu machen; ihrer beider Zuneigung war zu neu, zu kürzlich erneuert! Er zitterte davor, sie zu verlieren. Und doch atmete jeder Brief, der von ihr kam, eine so ruhige Herzlichkeit, daß sie ihn hätte mit völliger Sicherheit erfüllen müssen. Aber sie war so verschieden von ihm! ... Sie hatten verabredet, sich gegen Ende des Herbstes in Rom zu treffen. Ohne die Vorstellung, sie wiederzusehen, hätte diese Reise für Christof wenig Reiz gehabt. Seine lange Einsamkeit hatte ihn sehr seßhaft gemacht; alle unnützen Ortsveränderungen, in denen sich der fieberhafte Müßiggang der modernen Menschheit gefällt, behagten ihm nicht mehr. Er fürchtete einen Wechsel der Gewohnheiten, der für die regelmäßige geistige Arbeit gefährlich ist. Überdies zog ihn Italien nicht an. Er kannte von ihm nichts als die niederträchtige Musik der Veristen und die Tenor-Arien, zu denen die Erde Virgils regelmäßig immer wieder reisende Literaten begeistert. Er empfand für Italien die mißtrauische Feindseligkeit eines Künstlers des Vortrabs, der nur allzu oft den Namen Rom von den schlimmsten Kämpen der akademischen Routine hatte anrufen hören. Schließlich kam noch der alte Gärungsstoff instinktiver Abneigung dazu, den alle Nordländer gegen die Südländer im Herzen tragen, oder zum mindesten gegen den sagenhaften Typus oratorischer Großsprecherei, den der Südländer für den Nordländer darstellt. Wenn er nur daran dachte, machte Christof schon ein verächtliches Gesicht ... Nein, er hatte keinerlei Lust, mit dem Volk ohne Musik näher bekannt zu werden – (denn was gilt schließlich das Mandolinengekratze und das hochtrabende Melodramengebrüll in der Musik des heutigen Europas?) – Aber trotzdem gehörte Grazia diesem Volke an. Wohin und welche Wege wäre Christof nicht gegangen, um sie wiederzufinden? Er würde eben solange die Augen zudrücken, bis er mit ihr vereint war.
Er war ja gewöhnt, die Augen zuzudrücken. Seit vielen Jahren waren diese Laden vor seinem Innenleben niedergelassen! In diesem Spätherbst war es nötiger als je. Drei Wochen hintereinander hatte es ohne Aufhören geregnet. Seitdem lastete eine graue Haube undurchdringlicher Wolken über den Tälern der Schweiz, die in der Nässe schauderten. Man konnte sich kaum mehr erinnern, wie wohl die Sonne tat. Um ihre gesammelte Kraft in sich selbst wiederzufinden, mußte man zunächst vollständig Nacht machen und unter den geschlossenen Lidern in die Tiefe des Bergwerkes, in die unterirdischen Schächte des Traumes, hinabsteigen. Dort schlief in der Kohle die Sonne verstorbener Tage. Aber wenn man sein Leben lang so gebückt beim Ausgraben verbracht hatte, kam man ausgedörrt, mit steifem Rückgrat, steifen Knien und verkrümmten Gliedern halb versteint wieder empor und hatte den trüben Blick und die Augen eines Nachtvogels. Christof hatte manches Mal unter schwerer Mühe im Bergwerk das Feuer gewonnen und emporgetragen, das halberstarrte Herzen wieder erwärmt. Aber die Träume des Nordens riechen nach Ofenhitze und Stubenluft. Lebt man in ihnen, so ahnt man das nicht; man liebt die drückende Wärme, man liebt das Halbdunkel und die seelischen Träume im dumpfen Kopf. Man liebt, was man hat. Man muß wohl oder übel damit zufrieden sein! ...
Als Christof, in einem Winkel des Wagenabteils hindämmernd, aus dem Alpentor herauskam und den unbefleckten Himmel und das durchsichtige Licht, das über die Bergabhänge rann, schaute, meinte er zu träumen. Hinter der Mauer hatte er eben einen fahlen Himmel, einen Dämmertag verlassen. Der Wechsel war so plötzlich, daß er zuerst mehr Überraschung als Freude empfand. Er brauchte einige Zeit, bevor seine betäubte Seele allmählich wieder zu sich kam, bevor die Rinde, die ihn umschloß, schmolz und das Herz sich aus dem Dunkel der Vergangenheit freimachte. Aber je weiter der Tag vorschritt, um so weicher umfingen ihn die Arme des Lichts. Die Erinnerung an alles Gewesene verlöschte, gierig sog er die Wollust des Schauens in sich ein.
Ihr Ebenen Mailands! Du Auge des Tages, das sich in den bläulichen Kanälen spiegelt, deren Adernetz die flaumigen Reisfelder durchfurcht! Herbstbäume mit den mageren und geschmeidigen Körpern voller Büschel roter Federchen gleiten in scharfer Zeichnung vorüber. Berge von Vinci, schneeige Alpen im sanften Glanz, deren bewegte Linie den Horizont einfaßt, von Rot, Orange, Grüngold und blassem Himmelblau befranzt! Der Abend sinkt über den Apennin. Schlängelnd geht es längs der kleinen, steilen Berge in Serpentinen abwärts, deren Rhythmus sich wiederholt und ineinanderflicht gleich einer Farandole. – Und ist man unten am Fuß, trifft einen plötzlich wie ein Kuß der Atem des Meeres und der Duft der Orangenbäume. Das Meer, das lateinische Meer mit seinem opalenen Lichte, in dem Schwärme kleiner Barken mit gefalteten Flügeln schlafend schweben ...
Der Zug hielt am Meeresufer in einem Fischerdorf. Man erklärte den Reisenden, daß infolge der großen Regengüsse in einem Tunnel auf der Strecke von Genua nach Pisa ein Einsturz stattgefunden habe. Alle Züge hätten mehrere Stunden Verspätung. Christof, der ein durchgehendes Billet nach Rom genommen hatte, war über dieses Mißgeschick entzückt, das bei seinen Gefährten empörten Widerspruch hervorrief. Er sprang auf den Bahnsteig und benutzte den Aufenthalt, um ans Meer zu gehen, dessen Anblick ihn lockte. Es lockte ihn so sehr, daß er sich, als nach ein oder zwei Stunden der Pfiff des abgehenden Zuges ertönte, in einer Barke befand und ihm beim Vorbeifahren »Gute Reise«! zurief. Er ließ sich in der leuchtenden Nacht auf dem leuchtenden Meere wiegen, an der duftenden Küste entlang, deren Vorgebirge von niedrigen Zypressen umrandet waren. Im Dorf fand er ein Unterkommen und lebte dort fünf Tage lang in einer beständigen Freude. Er glich einem Menschen, der eine lange Fastenzeit durchgemacht hat und nun gierig ißt. Mit all seinen ausgehungerten Sinnen genoß er das herrliche Licht ... Licht, du Blut der Welt, das gleich einem Strome des Lebens durch den Weltenraum fließt, das sich durch unsere Augen, unsere Lippen, unsere Nüstern, durch alle Poren unserer Haut bis ins Innerste unseres Körpers ergießt, Licht, das zum Leben notwendiger ist als Brot, – wer dich, von den Schleiern des Nordens entkleidet, sieht, rein, glühend und nackt, fragt sich, wie er jemals ohne dich hat leben können, und fühlt, daß er dich nie mehr wird entbehren können ... Fünf Tage lang war Christof in einen wahren Sonnenrausch getaucht, fünf Tage lang vergaß er – zum ersten Male – daß er Musiker war. Die Musik seines Lebens hatte sich in Licht verwandelt. Licht, Meer und Erde; strahlende Symphonie, die das Orchester der Sonne spielt. Und mit welcher angeborenen Kunst weiß Italien dieses Orchester zu verwenden! Die anderen Völker malen nach der Natur. Italien arbeitet mit ihr; es malt mit der Sonne. Musik der Farben. Alles ist Musik, alles singt. Eine einfache Mauer am Wege, rot, mit Gold durchwebt; darüber zwei Zypressen mit ihren krausen Büscheln; rings umher der Himmel in verzehrendem Blau. Eine weiße, steile, enge Marmortreppe, die zwischen rosigen Mauern zu einer blauen Kirchenfassade aufsteigt. Irgend eines jener vielfarbigen, aprikosenroten, zitronengelben, bräunlichen Häuser, die zwischen den Oliven leuchten, macht den Eindruck einer wundervollen, reifen Frucht im Laube. Italien ist ein sinnlicher Genuß; die Augen genießen die Farben wie der Gaumen und die Zunge eine saftige, duftende Frucht. Christof stürzte sich auf dieses neue Mahl mit gieriger und kindlicher Lust; er hielt sich schadlos für das Asketentum der grauen Visionen, zu denen er bis dahin verdammt gewesen war. Seine überströmende Natur, die das Schicksal zurückgedrängt hatte, wurde sich plötzlich der Genußmöglichkeiten bewußt, von denen sie bisher keinen Gebrauch gemacht hatte; sie bemächtigte sich der Beute, die sich ihr bot; Düfte, Farben, Musik der Stimmen, der Glocken, des Meeres, Liebkosungen der Luft, laue Bäder des Lichtes, in denen sich die gealterte und müde Seele löst ... Christof dachte an nichts. Er schwamm in vollständiger Glückseligkeit. Er unterbrach sie nur, um seine Umgebung an seiner Freude teilnehmen zu lassen: seinen Ruderer, einen alten Fischer mit lebhaften, von Falten umgebenen Augen, der eine rote venetianische Senatorenmütze trug, – dessen einzigen Genossen, einen Mailänder, der beim Makkaroni-Essen seine grausamen Othelloaugen, die schwarz von wütendem Haß schienen, rollte, und dabei – ein apathischer, verschlafener Mensch war; – den Gasthauskellner, der beim Tragen eines Tabletts den Hals reckte und Arme und Körper verrenkte, als wäre er ein Berninischer Engel; – den kleinen St. Johannes, der mit koketten Seitenblicken am Wege bettelte und den Vorübergehenden eine Orange am grünen Zweig anbot. Er rief die Wagenkutscher an, die, mit nach rückwärts gelegtem Kopf sich in ihre Wagen geflegelt hatten, ihre tausend und einen Gassenhauer in näselnden, trägen und schreienden Tönen sangen, und dabei ganz nach Belieben aussetzten. Er überraschte sich dabei, daß er » Cavalleria rusticana« trällerte. Das Ziel seiner Reise war vollständig vergessen. Vergessen auch seine Eile, ans Ziel zu kommen, um Grazia wiederzufinden ...
Bis zu dem Tage, an dem das geliebte Bild wieder in ihm erwachte. Vielleicht durch einen Blick, dem er auf dem Wege begegnete, vielleicht durch einen ernsten, singenden Tonfall, der es heraufbeschwor? Er war sich dessen nicht bewußt. Aber die Stunde kam, in der aus allem, was ihn umgab, aus der olivenbedeckten Hügelkette und den hohen blanken Kämmen des Apennin, den der dichte Schatten und die brennende Sonne konturieren, aus den blüten- und fruchtschweren Orangegehölzen und dem tiefen Atemzuge des Meeres nur noch die lächelnde Gestalt der Freundin strahlte. Aus den unzähligen Augen der Luft schauten ihre Augen ihn an. Sie erblühte aus dieser geliebten Erde wie eine Rose aus dem Strauch.
Da kam er wieder zu sich. Er nahm den Zug nach Rom, ohne irgendwo anzuhalten. Keine von den italienischen Erinnerungen, den Kunststätten der Vergangenheit, interessierte ihn. Von Rom sah er nichts, wollte er nichts sehen. Und was er im Vorbeigehen zuerst bemerkte, die neuen stillosen Stadtviertel, die vierschrötigen Gebäude, flößten ihm nicht den Wunsch ein, es näher kennen zu lernen.
Sobald er angekommen war, suchte er Grazia auf. Sie fragte ihn:
»Auf welchem Wege sind Sie gekommen? Haben Sie sich in Mailand oder Florenz aufgehalten?«
»Nein,« sagte er, »wozu?«
Sie lachte.
»Schöne Antwort! Und was halten Sie von Rom?«
»Garnichts,« sagte er, »ich habe noch nichts gesehen.«
»Nein, wirklich?«
»Nichts, nicht ein Denkmal. Ich bin aus dem Hotel geradewegs zu Ihnen gekommen.«
»Man braucht nur zehn Schritte zu machen, um Rom zu sehen ... Schauen Sie da drüben die Mauer ... Man braucht nur ihre Beleuchtung zu sehen.«
»Ich sehe nur Sie,« sagte er.
»Sie sind ein Barbar, Sie sehen nur Ihre Gedankenwelt. Und wann sind Sie aus der Schweiz abgereist?«
»Vor acht Tagen.«
»Was haben Sie denn seither gemacht?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe zufällig in einem Orte nahe am Meere Halt gemacht. Ich habe kaum auf den Namen geachtet. Acht Tage lang habe ich geschlafen. Mit offenen Augen geschlafen. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, was ich geträumt habe. Ich glaube, ich habe von Ihnen geträumt. Ich weiß nur, daß das sehr schön war. Aber das Schönste ist, daß ich alles vergessen habe ...«
»Danke,« sagte sie.
(Er hörte es nicht.)
»… Alles,« fuhr er fort, »alles, was dort war, alles, was vorher war. Ich bin wie ein neuer Mensch, der das Leben beginnt.« »Wahrhaftig,« sagte sie, und sah ihn mit ihren lachenden Augen an, »Sie sind seit unserer letzten Begegnung verändert.«
Er sah sie auch an und fand sie ebenfalls anders, als die, an die er gedacht hatte. Sie war wohl während der zwei Monate nicht anders geworden. Aber er sah sie mit neuen Augen. Dort in der Schweiz hatte sich das Bild der alten Tage, der leichte Schatten der jungen Grazia, zwischen seinen Blick und die jetzige Freundin geschoben. Jetzt waren unter der italienischen Sonne die nordischen Träume geschmolzen. Er sah die wirkliche Seele und den wirklichen Körper der Geliebten so, wie sie war, in der Klarheit des Tages. Wie fern war sie der wilden Gemse, die man in Paris gefangen hielt, wie fern der jungen Frau mit dem Lächeln des Heiligen Johannes, die er eines Abends, kurz nach ihrer Heirat, wiedergefunden hatte, um sie alsbald wieder zu verlieren! Aus der kleinen umbrischen Madonna war eine schöne Römerin erblüht:
» Color verus, corpus solidum et succi plenum.«
Ihre Formen hatten eine harmonische Fülle gewonnen; ihr Körper war wie in eine stolze Mattigkeit gebadet. Der Geist der Ruhe umgab sie. Ihre größte Lust war durchsonnte Stille, tatenloses Sinnen, der wollüstige Genuß eines friedvollen Dahinlebens, das die Seelen nordischer Länder niemals ganz kennen lernen werden. Was sie vor allem aus ihrer Vergangenheit bewahrt hatte, war ihre große Güte, die alle ihre Empfindungen durchtränkte. Aber in ihrem leuchtenden Lächeln las man noch etwas anderes Neues: eine wehmütige Nachsicht, etwas Müdigkeit, sehr viel Seelenverständnis, ein wenig Ironie und ruhigen gesunden Menschenverstand. Das Alter hatte sie mit einer Kälte umhüllt, die sie gegen die Illusionen des Herzens schützte; sie gab sich selten rückhaltslos hin; und bei aller Herzlichkeit verwahrte sich ihr hellsichtiges Lächeln gegen die Ausbrüche von Leidenschaft, die Christof nur mit Mühe zurückdrängen konnte. Dabei hatte sie je nach den Tagen auch einmal schwache Augenblicke, Augenblicke, in denen sie sich gehen ließ; sie war kokett, spottete selbst darüber, bekämpfte es aber durchaus nicht. Keinerlei Auflehnung war in ihr, weder gegen die Dinge noch gegen sich selbst: der leise Fatalismus einer vollkommen guten und etwas müden Natur.
Sie sah viele Menschen bei sich, ohne – wenigstens dem Anschein nach – sehr wählerisch zu sein; da aber ihr vertrauter Verkehr meistens denselben Kreisen angehörte, dieselbe Luft atmete, durch dieselben Gewohnheiten gemodelt war, so war diese Gesellschaft von einer ziemlich gleichartigen Harmonie getragen, die sehr verschieden von der war, die Christof in Deutschland und Frankreich vernommen hatte. Die Meisten waren aus alten italienischen Geschlechtern, die sich hier und da durch Heiraten mit Ausländern aufgefrischt hatten; es herrschte unter ihnen ein oberflächliches Weltbürgertum, in dem sich die vier Hauptsprachen und das geistige Gepäck der vier großen Nationen des Okzidents leicht vermischten. Jedes Volk fügte seine persönliche Note hinzu; die Juden ihre Rastlosigkeit und die Angelsachsen ihr Phlegma; aber das alles verschmolz sogleich in dem italienischen Tiegel. Wenn räuberische Schloßherren jahrhundertelang in ein Geschlecht ihr hochmütiges und gieriges Raubvogelprofil eingegraben haben, kann das Metall sich wohl ändern, die Prägung bleibt dieselbe. Manche dieser Gestalten, die am echtesten italienisch wirkten, mit Luinischem Lächeln, genußsüchtigem und ruhigem Tizianschem Blick, Blumen der Adria oder der lombardischen Ebenen, waren aus nordischem Reis erwachsen, das man in den alten lateinischen Boden verpflanzt hatte. Welche Farben man auch immer auf Roms Palette mischen mag, der Ton, der entsteht, ist immer römisch.
Ohne seinen Eindruck zergliedern zu können, bewunderte Christof den Duft jahrhundertealter Kultur und alter Zivilisation, den diese Seelen ausströmten, obgleich sie oft unbedeutend und zuweilen sogar weniger als mittelmäßig waren. Aber es ging ein unmerklicher Duft von ihnen aus, ein Duft, der in einem Nichts bestand, in einer höflichen Anmut, einer Zartheit des Wesens, mit der man herzlich zu sein verstand, obgleich man seinen leisen Spott und seine Stellung wahrte, in einer vornehmen Feinheit im Blick, im Lächeln, in einem frischen und sorglosen, skeptischen, vielseitigen und ungezwungenen Verstand. Nichts Steifes und Schroffes. Keinerlei Bücherweisheit. Man brauchte nicht zu fürchten, hier einen der Psychologen der Pariser Salons zu treffen, der hinter seinen Augengläsern auf der Lauer liegt, oder das Feldwebeltum eines deutschen Doktors. Es waren ganz einfach Menschen, sehr menschliche Menschen, wie es schon die Freunde des Terenz und des Scipio Ämilianus gewesen waren ...
Homo sum ...
Eine schöne Außenseite. Das Leben war mehr Schein als Wirklichkeit und verbarg die unheilbare Leichtfertigkeit, die der guten Gesellschaft aller Länder gemeinsam ist ... Was dieser hier den Rassencharakter verlieh, war ihre Lässigkeit. Die französische Leichtlebigkeit ist von einem nervösen Fieber begleitet, einer beständigen Regsamkeit des Gehirns, selbst wenn es leer läuft. Das italienische Gehirn versteht, sich auszuruhen. Es versteht es nur allzu gut. Es ist ihm wonnevoll, im warmen Schatten zu schlummern, auf den lauen Kissen eines weichlichen Epikuräertums und einer sehr geschmeidigen, ziemlich wißbegierigen, ironischen Intelligenz, der im Grunde alles außerordentlich gleichgültig ist.
Allen diesen Menschen fehlten ausgesprochene Ansichten. Sie trieben Politik und Kunst mit dem gleichen Dilettantismus. Man sah unter ihnen entzückende Wesen, jene italienischen Patriziergestalten mit feinen Zügen, klugen und sanften Augen und ruhigem Benehmen, die mit auserlesenem Geschmack und warmem Herzen die Natur liebten, die alten Maler, Blumen, Frauen, Bücher, gute Küche, das Vaterland, die Musik ... Sie liebten alles. Sie hatten für nichts eine Vorliebe. Man hatte oft das Empfinden, daß sie garnichts liebten. Doch nahm die Liebe einen großen Raum in ihrem Leben ein; doch unter der Bedingung, daß sie sie nicht störte. Sie war lässig und träge wie sie selbst; sogar in der Leidenschaft hatte sie leicht einen familienhaften Charakter. Der wohlgebildete und harmonische Verstand dieser Menschen paßte sich jeder Trägheit an, in der die gegensätzlichsten Gedanken sich, ohne einander zu stoßen, trafen und sich ruhig, lächelnd, stumpf und ungefährlich gemacht, miteinander vereinen ließen. Sie hatten Angst vor ausgeprägten Überzeugungen und starker Parteinahme; bei halben Entschlüssen und halben Gedanken fühlten sie sich wohl. Sie waren konservativ-liberalen Geistes. Sie brauchten die Atmosphäre einer halbhohen Politik und Kunst, in der man wie in manchen Luftkurorten nicht Gefahr läuft, den Atem zu verlieren und Herzklopfen zu bekommen. Sie erkannten sich selbst in der trägen Dramenkunst eines Goldoni oder in dem gleichmäßigen und zerstreuten Licht eines Manzoni wieder. Ihre liebenswürdige Unbekümmertheit wurde davon nicht berührt. Sie hätten nicht, wie ihre großen Vorfahren, gesagt: » Primum vivere ...«, sondern eher: » Dapprima, quieto vivere.«
Ruhiges Leben. Das war der heimliche Wunsch, der Wille aller, selbst der Kraftvollsten unter ihnen, derer, die das politische Leben lenkten. Irgend ein kleiner Machiavell, der sich selbst und andere mit eben so kaltem Herzen wie kaltem Kopf beherrschte, dessen hellsichtige und blasierte Intelligenz es verstand und wagte, sich aller Mittel zu bedienen, um sein Ziel zu erreichen, der bereit war, seine sämtlichen Freundschaften seinem Ehrgeiz zu opfern, war fähig, seinen Ehrgeiz einer einzigen Sache zu opfern: seinem quieto vivere. Sie bedurften langer Perioden des Nichtstuns. Wenn sie die hinter sich hatten, waren sie frisch und rüstig, wie nach einem guten Schlaf. Diese ernsten Männer, diese ruhevollen Madonnen wurden plötzlich von dem Heißhunger gepackt, zu reden, lustig zu sein, gesellig zu leben, mußten sich in leichten, flinken Gebärden und Worten verausgaben, in paradoxen Einfällen, in drolligem Humor: sie spielten eine » opera buffa.« In dieser italienischen Bildergalerie fand man selten die Spur des Gedankens, den metallischen Glanz der Augensterne, die von beständiger geistiger Arbeit zermürbten Gesichter, wie man sie im Norden sieht. Zwar fehlte es, hier wie überall, nicht an Seelen, die sich zergrübelten, die ihre Kümmernisse, ihre Sorgen unter Gleichmut verbargen und sich genußsüchtig in Betäubung hüllten. Ganz zu schweigen von denen, die an plötzlichen Anfällen sonderbarer, verwirrender Laune litten – den Anzeichen eines Mangels an Gleichgewicht, das sehr alten Rassen eigentümlich ist, die den Erdspalten gleichen, die in der römischen Campagna klaffen.
In dem lässigen Rätsel dieser Seelen, in diesen ruhevollen und spöttischen Augen, in denen eine verborgene Tragik schlummerte, lag viel Reiz. Christof aber war nicht in der Stimmung, ihn zu erkennen. Er war wütend, daß Grazia von geistreichen und leeren Gesellschaftsmenschen umgeben war. Er war ihnen und ihr deswegen böse. Er schmollte mit ihr ebenso, wie er mit Rom schmollte. Er besuchte sie seltener, er schwor sich, wieder abzureisen.
Er reiste nicht ab. Unbewußt begann bereits die Anziehungskraft dieser italienischen Welt, die ihn aufreizte, auf ihn zu wirken.
Vorläufig sonderte er sich ab. Er schlenderte in Rom und in der Umgebung umher. Das römische Licht, die hängenden Gärten, die Campagna, die gleich einer goldenen Schärpe das übersonnte Meer umgürtet, offenbarten ihm nach und nach das Geheimnis der zauberischen Erde. Er hatte sich geschworen, nicht einen Schritt zu tun, um die toten Denkmale anzusehen, die er zu verachten vorgab; er sagte brummend, er warte darauf, daß sie zu ihm kämen. Sie kamen; er begegnete ihnen, wenn er aufs Geratewohl auf dem welligen Boden der ewigen Stadt spazieren ging. Ohne, daß er es suchte, sah er bei untergehender Sonne das rote Forum und die halb zusammengestürzten Bogen des Palatin, in deren Tiefe sich der dunkle Azur höhlte wie ein Abgrund blauen Lichts. Er irrte in der unendlichen Campagna umher, an dem rötlichen Tiber entlang, der fett von Schlamm ist, als wäre er wandernde Erde – er wanderte längs der zerfallenen Aquädukte, dieser gigantischen Wirbelknochen vorsintflutlicher Ungeheuer. Dichte Massen schwarzer Wolken wälzten sich am blauen Himmel. Bauern zu Pferde trieben mit dünnen Stangen Herden großer perlgrauer Ochsen mit langen Hörnern durch die Einöde; und auf der antiken Heerstraße, die sich gerade, staubig und kahl hinzieht, zogen bocksfüßige Hirten, die Schenkel mit haarigen Fellen bedeckt, mit Zügen kleiner Esel und Eselfüllen schweigend dahin. Am fernen Horizonte entfaltete die Sabinerkette in olympischen Linien ihre Hügel; und am anderen Rande der Himmelskuppel standen die alten Stadtmauern, die Fassade von San Giovanni, über der tanzende Statuen ihre schwarzen Silhouetten vom Himmel abhoben ... Stille ... Glühende Sonne ... über die Ebene streicht der Wind ... Auf einer Statue ohne Kopf, deren Arme von den Fluten des Grases ganz umsponnen waren, saß eine Eidechse, deren Herz friedlich schlug, und sog regungslos das Licht in sich ein. Christof, dem der Kopf von der Sonne (und manchmal auch vom Castelliwein) summte, saß lächelnd auf der schwarzen Erde, neben dem zerbrochenen Marmor, war ganz in Vergessenheit eingelullt und gebadet und trank die ruhige und leidenschaftliche Kraft Roms. So saß er bis zur sinkenden Nacht. – Dann wurde sein Herz von einer plötzlichen Angst umschnürt, er floh die düstere Einsamkeit, in der das ernste Licht unterging ... O Erde, glühende Erde, leidenschaftliche und stumme Erde! Unter deinem fiebererfüllten Frieden höre ich noch den Trompetenklang der Legionen. Wieviel tobendes Leben rollt in deiner Brust! Wieviel Sehnsucht nach Erwachen!
Christof fand Seelen, in denen die Brände jahrhundertealten Feuers glühten. Unter dem Staube der Toten hatte es sich bewahrt. Man hätte meinen sollen, daß dieses Feuer mit Mazzinis Augen erloschen wäre. Es lebte wieder auf. Es war das alte Feuer. Doch nur wenige wollten es sehen. Es störte die Ruhe der Schlafenden. Es verbreitete ein helles und hartes Licht. Die, die es trugen, – junge Männer (der Älteste war noch nicht fünfunddreißig Jahre alt), eine Auslese, die aus allen Himmelsrichtungen zusammengekommen war – waren freie Intellektuelle, die untereinander an Temperament, Erziehung, Ansichten und Glauben sehr verschieden waren, aber sich in demselben Kultus für diese Flammen neuen Lebens einten. Parteivorschriften und Gedankensysteme galten für sie nicht; die Hauptsache war: »kühn zu denken,« freimütig und tapfer im Geist und in der Tat zu sein. Sie rüttelten unsanft ihr schlafendes Geschlecht. Nach der politischen Auferstehung Italiens, das auf den Ruf der Helden vom Tode aufgewacht war, nach seiner erst kürzlich erfolgten ökonomischen Auferstehung wollten sie den Geist Italiens dem Grabe entreißen. Sie litten unter der trägen und ängstlichen Teilnahmslosigkeit, der geistigen Feigheit, der Wortberauschtheit der Ausersehenen wie unter einer Beleidigung. Ihre Stimmen dröhnten in dem Nebel der Rhetorik und der sittlichen Knechtschaft, der seit Jahrhunderten auf der Seele ihres Vaterlandes lastete. Sie bliesen mit ihrem rücksichtslosen Wirklichkeitssinn und ihrem unbestechlichen Freimut hinein. Ein klarer Verstand, dem ein energisches Handeln folgt, bedeutete ihnen alles. Waren sie auch fähig, wenn nötig, die Lieblingsvorstellungen ihrer persönlichen Überzeugung der notwendigen Zucht zu opfern, die das politische Leben dem Einzelnen aufzwingt, so gehörten ihr heiligster Altar und ihre reinsten Gluten doch der Wahrheit. Sie liebten sie mit stürmischem und frommem Herzen. Als sie von ihren Widersachern verleumdet, bedroht, beleidigt wurden, antwortete einer der Führer dieser jungen Männer mit ruhiger Größe:
»Achtet die Wahrheit. Ich spreche zu euch offenen Herzens und frei von jedem Groll. Ich vergesse, was ihr mir Böses getan habt, und was ich euch vielleicht Böses getan haben mag. Seid wahr. Wo keine religiöse, unbeugsame und strenge Achtung vor der Wahrheit herrscht, gibt es keine sittliche Höhe, keinen Opfermut, keinen Edelsinn. Übt euch in dieser schweren Pflicht. Das Unwahre zieht den nieder, der damit arbeitet, bevor es den besiegt, gegen den man es braucht. Was nützt euch der schnelle Erfolg, den ihr damit erzielt? Die Wurzeln eures Wesens werden über dem von der Lüge zerfressenen Boden im Leeren hängen. Ich rede nicht mehr als Widersacher zu euch. Wir stehen über unseren gegenseitigen Meinungsverschiedenheiten, selbst wenn ihr eure Leidenschaft prahlend mit dem Namen Vaterland benennt. Es gibt etwas Größeres als das Vaterland: das ist das menschliche Gewissen. Es gibt Gesetze, die ihr nicht vergewaltigen dürft, ohne schlechte Italiener zu werden. Ihr habt nur einen Menschen vor euch, der die Wahrheit sucht. Ihr müßt seinen Ruf vernehmen. Ihr habt nur einen Menschen vor euch, der brennend wünscht, euch groß und rein zu sehen und mit euch zusammen zu arbeiten. Denn, ob ihr wollt oder nicht, wir arbeiten gemeinsam mit allen denen auf der Welt, die in Wahrheit arbeiten. Was wir hervorbringen werden (und was wir nicht voraussehen können), wird unseren gemeinsamen Stempel tragen, wenn unser Tun wahrhaftig gewesen war. Das Beste des Menschen liegt in seiner wundervollen Fähigkeit, die Wahrheit zu suchen, sie zu erkennen, sie zu lieben und sich ihr zu opfern. – Wahrheit, die du alle, die dich in sich tragen, mit dem Zauberhauch deiner machtvollen Gesundheit erfüllst! ...«
Das erste Mal, als Christof diese Worte vernahm, schienen sie ihm wie das Echo seiner eigenen Stimme; und er fühlte, wie sehr diese Menschen seine Brüder waren. Durch die Zufälligkeiten des Völkerkampfes und irgend welcher Anschauungen konnten sie eines Tages aneinander geraten: aber ob als Freunde oder Feinde, sie gehörten zur selben Familie der Menschheit und würden ihr immer zugehören. Sie wußten es wie er. Sie wußten es vor ihm. Sie kannten ihn, bevor er sie kannte. Denn sie waren schon Oliviers Freunde gewesen. Christof entdeckte, daß die Werke seines Freundes, (ein paar Versbücher und einige kritische Essays), die in Paris nur von einem kleinen Kreise gelesen wurden, von diesen Italienern übersetzt und ihnen ebenso vertraut waren wie ihm selbst.
Später sollte er die unüberwindlichen Unterschiede entdecken, die jene Seelen von der Oliviers trennten. In ihrer Art, andere zu beurteilen, blieben sie völlig Italiener, die, in die Gedankenwelt ihrer Rasse verwurzelt, unfähig jeden Strebens waren, aus sich herauszugehen. Im Grunde suchten sie aufrichtig in fremden Werken nur, was ihr völkischer Instinkt darin suchen wollte; oft entnahmen sie ihnen nur, was sie selbst unbewußt hineingelegt hatten. Als mittelmäßige Kritiker und jämmerliche Psychologen waren sie ausschließlich von sich selbst und ihren Leidenschaften erfüllt, selbst wenn sie noch so sehr von der Wahrheit eingenommen waren. Der italienische Idealismus kann sich nicht selbst vergessen; an den unpersönlichen Träumen des Nordens nimmt er keinen Anteil; er bezieht alles auf sich, auf seine Wünsche, auf seinen Rassenstolz, den er verklärt. Bewußt oder unbewußt arbeitet er beständig für die terza Roma. Man muß allerdings gestehen, daß er sich jahrhundertelang nicht allzu große Mühe gegeben hat, sie zu verwirklichen. Diese schönen Italiener, die eigentlich wie geschaffen zum energischen Handeln sind, betätigen sich nur, wenn die Leidenschaft sie treibt, und werden schnell des Handelns müde; aber wenn die Leidenschaft aufbraust, hebt sie sie höher empor als alle anderen Völker; das hat ihr Risorgimento bewiesen. Einer jener großen Stürme begann gerade jetzt über die italienische Jugend aller Parteien dahinzufahren: über Nationalisten, Sozialisten, Neu-Katholiken, freie Idealisten, alles eingefleischte Italiener, alle von der Hoffnung und dem Willen beseelt, Bürger des kaiserlichen Roms, der Königin der Welt, zu sein.
Zuerst sah Christof nur ihre großherzige Inbrunst und die gemeinsamen Abneigungen, die sie und ihn verbanden. Sie mußten sich notwendigerweise mit ihm in der Verachtung der gesellschaftlichen Kreise treffen, denen Christof grollte, weil Grazia sie bevorzugte. Sie haßten mehr noch als er den Geist der Vorsicht, die Teilnahmslosigkeit, die Kompromisse und Mätzchen, alle nur halb ausgesprochenen Dinge, das marklose Denken, das spitzfindige Hin- und Herpendeln zwischen allen Möglichkeiten, ohne sich für irgend eine zu entscheiden, die schönen Phrasen, das süße Wesen. Als bewußte Autodidakten, die aus allem möglichen zusammengesetzt waren und weder die Mittel noch die Muße gehabt hatten, sich den letzten Schliff zu geben, übertrieben sie gern ihre angeborene Derbheit und ihren etwas herben, ungehobelten Contadini-Ton. Sie wollten, daß man sie höre. Sie wollten, daß man sie bekämpfe. Alles wollten sie lieber als Gleichgültigkeit. Sie wären, wenn sie damit die Kräfte ihrer Rasse hätten erwecken können, freudig die ersten Opfer solcher neuen Energien geworden.
Zunächst aber waren sie nicht beliebt und bemühten sich auch nicht darum. Christof fand wenig Anklang, als er zu Grazia von seinen neuen Freunden sprechen wollte. Sie mißfielen ihrer nach Maß und Frieden strebenden Natur. Man mußte ihr wohl recht geben, daß die Art, mit der diese Leute die beste Sache verteidigten, oft die Lust erweckte, sich als ihr Feind zu erklären. Sie waren ironisch und herausfordernd; die Schärfe ihrer Kritik grenzte oft an Beleidigung, selbst Leuten gegenüber, die sie nicht verletzen wollten. Sie waren zu selbstsicher und zu schnell bei der Hand zu verallgemeinern, etwas mit Heftigkeit zu behaupten. Da sie zur Betätigung in der Öffentlichkeit gelangten, bevor sie sich zur Reife entwickelt hatten, fällten sie ein Vorurteil nach dem anderen. Sie gaben sich in leidenschaftlicher Aufrichtigkeit vollständig aus, ohne irgend etwas zurückzuhalten, und wurden durch ihre übertriebene Geistesarbeit, durch ihre frühzeitige und erzwungene Betriebsamkeit verbraucht. Es ist jungen Gedanken, die kaum der Hülle entschlüpft sind, nicht gesund, wenn sie sich der vollen Sonne aussetzen. Die Seele verbrennt dabei. Alles Reifen braucht Zeit und Ruhe. Zeit und Ruhe hatte ihnen gefehlt. Das ist das Unglück allzu vieler italienischer Talente. Hastiges und heftiges Handeln wirkt wie Alkohol. Der Geist, der davon gekostet hat, entwöhnt sich nachher nur mit Mühe; sein normales Wachstum läuft Gefahr, dadurch für immer etwas Erzwungenes und Verfälschtes zu behalten.
Christof schätzte die herbe Frische dieses derben Freimutes im Gegensatz zu der Fadheit der Leute des goldenen Mittelwegs, der vie di mezzo, die eine ewige Angst davor haben, sich bloßzustellen und das geschickte Talent besitzen, weder nein noch ja zu sagen. Aber er fand bald heraus, daß auch diese letzteren mit ihrer ruhigen und höflichen Klugheit ihren Wert hatten. Der beständige Kampfzustand, in dem seine Freunde lebten, war ermüdend. Christof, der es für seine Pflicht hielt, zu Grazia zu gehen, um diese Menschen zu verteidigen, ging manchmal hin, um sie zu vergessen. Zweifellos ähnelten sie ihm. Sie ähnelten ihm nur allzu sehr. Sie waren heute, was er mit zwanzig Jahren gewesen war. Und der Strom des Lebens fließt nicht zurück. Im Grunde wußte Christof sehr wohl, daß er für seine Person diese Gewalttätigkeiten abgestreift hatte und daß er auf dem Wege zu dem Frieden war, dessen Geheimnis Grazias Augen zu bewahren schienen. Warum also lehnte er sich gegen sie auf? ... Ach! weil er in liebender Selbstsucht diesen Frieden als Einziger genießen wollte. Er mochte nicht leiden, daß Grazia, ohne zu rechnen, ihre Wohltaten an jeden ersten Besten verausgabte, daß sie an alle ihr reizendes Entgegenkommen verschwendete.
Sie las in seiner Seele, und mit ihrem liebenswürdigen Freimut sagte sie eines Tages zu ihm:
»Sie zürnen mir, weil ich bin, wie ich bin? Sie müssen mich nicht idealisieren, mein Freund. Ich bin eine Frau und bin nicht besser als eine andere. Ich suche die Gesellschaft nicht; aber ich gebe zu, daß sie mir angenehm ist, ebenso, wie es mir Vergnügen macht, manchmal in mittelmäßige Theaterstücke zu gehen, ein wenig oberflächliche Bücher zu lesen, die Sie verachten, bei denen ich mich aber ausruhe und zerstreue. Ich kann mir nichts versagen.«
»Wie können Sie diese albernen Menschen ertragen?«
»Das Leben hat mich gelehrt, nicht anspruchsvoll zu sein. Man muß nicht zuviel von ihm verlangen. Ich versichere Sie, es ist schon viel, wenn man mit braven, nicht bösen, einigermaßen gutherzigen Menschen zu tun hat ... (natürlich unter der Bedingung, daß man nichts von ihnen erwartet; ich weiß wohl, daß, wenn ich sie brauchte, ich nicht viel mehr finden würde ...) Immerhin hängen sie an mir; und wenn ich ein wenig aufrichtiger Zuneigung begegne, gehe ich über das übrige hinweg. Sie zürnen mir, nicht wahr? Verzeihen Sie mir, wenn ich unbedeutend bin. Ich weiß wenigstens zwischen dem Besseren und dem weniger Guten in mir zu unterscheiden. Und was Ihnen gehört, ist das Beste.«
»Ich möchte alles,« sagte er in schmollendem Ton. Doch fühlte er wohl, daß sie aufrichtig redete. Er war ihrer Zuneigung so sicher, daß er sie eines Tages, nachdem er wochenlang gezögert hatte, fragte:
»Würden Sie denn niemals ...?«
»Was denn?«
»Mir gehören.«
Er verbesserte sich:
»Ich meine, ... mir erlauben, daß ich Ihnen gehöre?«
Sie lächelte:
»Aber das tue ich ja, mein Freund.«
»Sie wissen ganz gut, was ich meine.«
Sie war ein wenig verwirrt; aber sie nahm seine Hände und schaute ihn offen an:
»Nein, lieber Freund,« sagte sie mit herzlicher Wärme.
Er konnte nicht sprechen. Sie sah, daß er traurig war.
»Seien Sie mir nicht böse, ich tue Ihnen weh. Ich wußte, daß Sie mir das sagen würden. Wir müssen ganz offen miteinander sprechen, wie gute Freunde.«
»Freunde,« sagte er traurig, »nicht mehr?«
»Undankbarer! Was wollen Sie noch mehr? Mich heiraten? ... Denken Sie noch an damals, als Sie nur Augen für meine schöne Kusine hatten? Damals war ich traurig, daß Sie nicht verstanden, was ich für Sie empfand. Unser ganzes Leben hätte anders sein können. Jetzt denke ich, daß es so besser ist ... es ist besser, daß wir unsere Freundschaft nicht dem gemeinsamen Leben ausgesetzt haben, dem Alltagsleben, in dem das Reinste schließlich herabgezogen wird ...«
»Sie sagen das, weil Sie mich weniger lieben.«
»O nein, ich liebe Sie immer noch ebenso.«
»Ach! es ist das erste Mal, daß Sie es mir sagen.«
»Es soll nichts mehr verborgen zwischen uns sein. Sehen Sie, ich halte nicht viel von der Ehe. Ich weiß wohl, das Beispiel meiner eigenen ist unzulänglich. Aber ich habe nachgedacht und mich umgeschaut. Glückliche Ehen sind selten. Die Ehe ist ein wenig widernatürlich. Man kann zweierlei Willen und zwei Wesen nicht zusammenketten, ohne eines zu verstümmeln, wenn nicht alle beide; und vielleicht erwachsen der Seele dadurch Leiden, die ihr nicht einmal besonders zuträglich sind.«
»Ach,« sagte er, »ich sehe im Gegenteil etwas Schönes in der Verbindung zweier opferbereiten Herzen, zweier in eins verschmolzenen Seelen.«
»Ihr Traum ist etwas Schönes. In Wirklichkeit würden Sie mehr als irgend jemand darunter leiden.«
»Wie, Sie glauben, daß ich niemals eine Frau haben könnte, eine Familie, Kinder? ... Sagen Sie das nicht! Ich würde sie so lieben! Sie glauben, dieses Glück sei für mich unerreichbar?«
»Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht ginge es mit einer guten Frau, die nicht sehr intelligent und nicht sehr schön wäre, die Ihnen ergeben wäre und Sie nicht verstehen würde.«
»Wie böse Sie sind! ... Aber es ist nicht recht, daß Sie sich lustig machen. Eine gute Frau ist etwas Gutes, selbst wenn sie nicht geistreich ist.«
»Ich bin davon überzeugt! Wollen Sie, daß ich Ihnen eine suche?«
»Seien Sie still, ich bitte Sie inständig. Sie tun mir weh. Wie können Sie nur so reden?«
»Was habe ich denn gesagt?«
»Sie lieben mich also gar nicht, nicht ein bißchen; denn Sie denken daran, mich mit einer anderen zu verheiraten.«
»Aber im Gegenteil, gerade weil ich Sie liebe, würde ich glücklich sein, wenn ich etwas tun könnte, um Sie glücklich zu machen.«
»Nun also, wenn das der Fall ist ...«
»Nein, nein, lassen Sie das. Ich sage Ihnen, es würde Ihr Unglück sein.«
»Sorgen Sie sich nicht um mich. Ich schwöre, ich würde glücklich sein; aber sagen Sie die Wahrheit: Sie meinen, daß Sie selber mit mir unglücklich sein würden?«
»O unglücklich? lieber Freund, nein. Ich schätze Sie zu hoch, und ich bewundere Sie zu sehr, um jemals mit Ihnen unglücklich zu werden ... Und dann will ich Ihnen etwas sagen: ich glaube, daß mich heute nichts mehr völlig unglücklich machen könnte. Ich habe zu viel gesehen, ich bin Philosophin geworden ... Aber, wenn ich offen reden soll, – (nicht wahr, da Sie mich darum bitten, werden Sie nicht böse sein?) – nun also, ich kenne meine Schwäche, ich wäre vielleicht dumm genug, nach ein paar Monaten nicht mehr ganz glücklich mit Ihnen zu sein: und das gerade will ich nicht, weil mich für Sie die heiligste Zuneigung erfüllt und ich nicht will, daß etwas in der Welt sie trübe.«
Traurig erwiderte er:
»Ja, so reden Sie, um mir die Pille zu versüßen. Ich gefalle Ihnen nicht. Irgend etwas in mir ist Ihnen widerwärtig.«
»Nicht doch, gewiß nicht. Machen Sie kein so klägliches Gesicht. Sie sind ein guter und lieber Mensch.«
»Dann begreife ich nicht. Warum sollten wir nicht zusammenpassen?«
»Weil wir zu verschieden sind, unsere Charaktere sind zu ausgeprägt, zu persönlich.«
»Gerade darum liebe ich Sie.«
»Ich Sie auch. Aber darum würden wir auch in Widerstreit geraten.«
»Aber nein.«
»O doch. Oder ich würde, da ich weiß, daß Sie bedeutender als ich sind, mir vorwerfen, Sie mit meiner kleinen Persönlichkeit zu hindern; und dann würde ich mich selbst aufgeben, ich würde schweigen und leiden.«
In Christofs Augen traten Tränen.
»O, das will ich nicht. Niemals! Lieber will ich unendlich unglücklich sein, ehe Sie durch meine Schuld für mich leiden ...«
»Beruhigen Sie sich, mein Freund ... Ich rede nur so. Ich bilde es mir vielleicht ein ... Aber vielleicht wäre ich garnicht gut genug, um mich für Sie aufzuopfern.«
»Um so besser!«
»Aber dann wären Sie mein Opfer, und dann wäre die Reihe an mir, mich zu quälen ... Sie sehen, es ist nach allen Seiten hin unlösbar. Bleiben wir, wie wir sind. Gibt es etwas Besseres als unsere Freundschaft?«
Er nickte den Kopf und lächelte ein wenig bitter.
»Ja, alles in allem heißt das eben, daß Sie mich im Grunde nicht lieb genug haben.«
Sie lächelte ebenfalls, freundlich, ein wenig melancholisch. Und seufzend sagte sie:
»Vielleicht haben Sie recht. Ich bin nicht mehr ganz jung, mein Freund. Ich bin müde. Das Leben verbraucht einen, wenn man nicht sehr stark ist, wie Sie ... O Sie! Wenn ich Sie manchmal anschaue, sehen Sie wie ein junger Bursche von achtzehn Jahren aus.«
»Ach Gott, mit diesem alten Kopf, diesen Runzeln, dieser welken Haut?«
»Ich weiß wohl, daß Sie ebensoviel wie ich gelitten haben. Vielleicht mehr. Ich sehe es. Aber Sie schauen mich manchmal mit den Augen eines Jünglings an; und ich fühle, wie eine Flut frischen Lebens aus Ihnen quillt. Ich dagegen bin erloschen. Ach! wenn ich an meine frühere Lebhaftigkeit denke! Wie heißt es doch?: »Das war eine schöne Zeit, da war ich recht unglücklich!« Heute habe ich nicht mehr die Kraft, unglücklich zu sein. Nur ein kleines Lebensbächlein ist in mir. Ich wäre nicht mehr kühn genug, um den Versuch einer Ehe zu wagen. Ach, früher, früher! ... Wenn jemand, den ich kenne, mir damals nur einen Wink gegeben hätte! ...«
»Nun und dann, dann? Reden Sie ...«
»Also, wenn ich früher ... O, mein Gott!«
»Was! Wenn Sie früher? Ich habe nichts gesagt.«
»Ich habe verstanden. Sie sind grausam.«
»Also gut, früher war ich eben toll.«
»Was Sie da sagen, ist noch schlimmer.«
»Armer Christof! Ich kann kein Wort mehr reden, ohne Ihnen weh zu tun. Ich werde also nichts mehr reden.«
»Doch, doch! Sagen Sie mir ... sagen Sie mir etwas.«
»Was denn?«
»Irgend etwas Gutes.«
Sie lachte.
»Lachen Sie nicht!«
»Und seien Sie nicht traurig.«
»Wie sollte ich es nicht sein?«
»Sie haben keinen Grund dazu. Ich versichere es Ihnen.«
»Weshalb?«
»Weil Sie eine Freundin haben, die Sie herzlich lieb hat.«
»Wirklich?«
»Wenn ich es Ihnen sage, glauben Sie es dann nicht?«
»Sagen Sie es noch einmal!«
»Werden Sie dann nicht mehr traurig sein? Werden Sie nicht unersättlich sein? Werden Sie sich mit unserer lieben Freundschaft begnügen?«
»Ich muß wohl.«
»Undankbarer, Undankbarer! Und Sie behaupten, Sie lieben mich? Ich glaube, im Grunde liebe ich Sie mehr, als Sie mich lieben.«
»Ach, wenn das der Fall wäre!«
Er sagte das mit einer Aufwallung so verliebter Selbstsucht, daß sie lachen mußte. Und auch er lachte und drang in sie:
»Sagen Sie mir's ...«
Einen Augenblick schwieg sie und schaute ihn an; dann neigte sie sich plötzlich zu Christof und küßte ihn. Es kam so unerwartet! Es traf sein Herz wie ein Schlag. Er wollte sie in seine Arme schließen. Doch schon hatte sie sich losgemacht. An der Türe des kleinen Salons schaute sie ihn an, legte einen Finger an die Lippen, machte: Scht! und verschwand.
Von nun an sprach er ihr nicht mehr von seiner Liebe und war ihr gegenüber weniger befangen. Dem Schwanken zwischen erzwungenem Schweigen und schlecht unterdrückter Leidenschaft folgte eine schlichte und beherrschte Vertraulichkeit. So wird Offenheit in der Freundschaft belohnt. Keine versteckten Andeutungen, keine Illusionen oder Befürchtungen mehr. Sie kannten jeder des anderen innerste Gedanken. Wenn Christof mit Grazia wieder in der Gesellschaft jener Gleichgültigen zusammentraf, die ihn ärgerten, und er wieder ungeduldig wurde, weil er seine Freundin mit ihnen über die Nichtigkeiten reden hörte, die in den Salons an der Tagesordnung sind, so schaute sie ihn an, wenn sie's merkte, und lächelte. Das war genug, er wußte, daß sie zusammengehörten; und es wurde wieder still in ihm.
Die Gegenwart des Geliebten nimmt der Fantasie ihren giftigen Stachel; das Fieber des Begehrens läßt nach; die Seele ist von dem keuschen Besitz der anwesenden Geliebten erfüllt. – Grazia strahlte überdies auf ihre ganze Umgebung den schweigenden Zauber ihrer harmonischen Natur aus. Jede, selbst ungewollte, Übertreibung einer Gebärde oder eines Tonfalles verletzte sie als etwas Unschlichtes, als etwas Unschönes. Dadurch wirke sie auch mit der Zeit auf Christof; nachdem er das Zaumzeug, das man seinem leidenschaftlichen Temperament angelegt, zerrissen hatte, gewann er nun eine Selbstbeherrschung und eine Kraft, die um so größer waren, als er sie nicht mehr in vergeblicher Leidenschaft vergeudete.
Ihre Seelen verschmolzen ineinander. Grazia erwachte durch die Berührung mit Christofs moralischer Kraft aus dem Halbschlaf, in dem sie sich der Wonne des Lebens lächelnd hingegeben hatte. Sie nahm an geistigen Dingen unmittelbarer und weniger tatenlos Anteil. Sie, die wenig las und die eher dazu neigte, dieselben alten Bücher mit trägem Behagen immer wieder durchzulesen, wurde von Neugierde für andere Gedanken erfaßt und empfand bald auch deren Anziehungskraft. Der Reichtum der modernen Gedankenwelt, den sie wohl kannte, in die sie sich aber allein nicht wagte, schüchterte sie noch mehr ein, seit sie einen Gefährten zum Führer hatte. Ohne daß sie es merkte und trotz ihrem Widerstreben ließ sie sich zum Verständnis des jungen Italiens erziehen, dessen bilderstürmerisches Feuer ihr solange mißfallen hatte.
Vor allem aber kam Christof die Wohltat dieser gegenseitigen geistigen Durchdringung zugute. Man hat oft beobachtet, daß in der Liebe der Schwächere von beiden mehr gibt; der andre liebt zwar nicht weniger; aber als der Stärkere muß er notwendigerweise mehr nehmen. So war Christof bereits durch Oliviers Geist bereichert worden. Aber seine neue übersinnliche Ehe war weit fruchtbarer; denn Grazia brachte ihm als Mitgift den seltenen Schatz, den Olivier niemals besessen hatte: die Freude. Die Freude der Seele und der Augen. Das Licht. Das Lächeln dieses lateinischen Himmels, das die Häßlichkeit der geringsten Dinge umspült, das die Steine der alten Mauern umblüht und selbst der Trauer sein ruhiges Leuchten mitteilt.
Sie hatte den erwachenden Frühling zum Bundesgenossen. Der Traum eines neuen Lebens lag in der lauen, verschlafenen Luft. Junges Grün vermählte sich den silbergrauen Oliven. Unter den düsterroten Bogen der zerfallenen Aquädukte blühten weiße Mandelbäume. In der wiedererwachten Campagna wogten die Fluten des Grases und die Flammen des sieghaften Mohnes, über den Rasen der Gärten rannen Bäche von lila Anemonen, lagen Teppiche von Veilchen gebreitet. Glyzinien kletterten zu den Pinienschirmen empor; und der Wind, der über die Stadt strich, trug den Duft der Rosen vom Palatin herbei.
Sie gingen zusammen spazieren. Wenn sie sich erst einmal aus ihrer orientalischen Benommenheit aufraffte, in der sie stundenlang dahindämmerte, wurde sie eine ganz andere. Sie wanderte gern. Groß, mit langen Beinen, mit kräftigem, biegsamem Oberkörper, war sie in der Silhouette ganz wie eine Diana des Primaticcio. – Am häufigsten besuchten sie eine jener Villen, die von der Sturmflut verschont geblieben waren, in die das herrliche Rom des Settecento unter den Wogen der piemontesischen Barbarei versunken ist. Besonders liebten sie die Villa Mattei, dieses Vorgebirge des alten Rom, an dessen Fuß die letzten Wellen der verödeten Campagna hinsterben. Sie folgten der Eichenallee, deren tiefe Wölbung die blaue Hügelkette umrahmt, die liebliche Albanerkette, die sanft anschwillt wie ein klopfendes Herz. Längs des Weges schauten aus dem Laube die Gräber römischer Ehegatten, mit schwermütigen Gesichtern und treu verschlungenen Händen. Sie setzten sich am Ende der Allee unter eine Rosenlaube, die sich an einen weißen Sarkophag anlehnte. Vor ihnen die Wildnis. Tiefer Frieden. Das Murmeln einer langsam tropfenden Quelle, die vor Sehnsucht zu sterben schien. Sie plauderten halblaut. Grazias Blick senkte sich voller Vertrauen in den des Freundes. Christof erzählte von seinem Leben, seinen Kämpfen, seinen vergangenen Schmerzen; sie hatten nichts Trauriges mehr. Neben ihr, unter ihrem Blick schien alles einfach, war alles, wie es sein mußte ... Auch sie erzählte. Er hörte kaum, was sie sagte, aber keiner ihrer Gedanken war für ihn verloren. Er vermählte sich mit ihrer Seele. Er sah mit ihren Augen, überall sah er ihre Augen, ihre ruhigen Augen, in denen ein inneres Feuer glühte; er sah sie in den schönen verstümmelten Gesichtern antiker Statuen und im Rätsel ihrer stummen Blicke. Er sah sie in Roms Himmel, der rings um die wolligen Zypressen und zwischen den gefingerten Blättern der schwarz glänzenden Steineichen lachte, die von Sonnenpfeilen durchschossen wurden.
Durch Grazias Augen drang ihm der Sinn für die lateinische Kunst ins Herz. Bis dahin hatte Christof den italienischen Werken gleichgültig gegenübergestanden. Der barbarische Träumer, der große Bär, der aus dem germanischen Walde gekommen war, hatte dem sinnlichen Reiz der schönen, wie mit einem Honigglanz vergoldeten Marmorwerke keinen Geschmack abgewinnen können. Den vatikanischen Antiken stand er einfach feindlich gegenüber. Er konnte diese dummen Köpfe, diese verweichlichten oder schwerfälligen Proportionen, dies nichtssagende und glatte Körperideal, alle diese Lustknaben und Gladiatoren nicht ausstehen. Kaum ein paar Portraitstatuen fanden Gnade vor seinen Augen; ihre Vorbilder hatten keinerlei Interesse für ihn. Für die blassen, grimassenschneidenden Florentiner, die krankhaften Madonnen, die präraffaelitischen Aphroditen, die blutarm, schwindsüchtig, affektiert und abgezehrt waren, fühlte er nicht viel mehr Zuneigung. Und die roten, schwitzenden Kraftprotzen und Athleten, die die Sixtinische Kapelle auf die Menschheit losgelassen hat, kamen ihm in ihrer tierischen Blödheit wie Kanonenfutter vor. Nur vor Michelangelo, vor seinem tragischen Leiden, seiner göttlichen Verachtung und dem Ernst seiner keuschen Leidenschaften empfand er eine stille Ehrfurcht. Mit reiner und barbarischer Liebe, wie die des Meisters gewesen war, liebte er die fromme Nacktheit dieser Jünglinge, seine rothaarigen und wilden Jungfrauen, die wie verfolgte Tiere aussahen, die schmerzvolle Aurora, die Madonna mit den wilden Augen, die das Kind in die Brust beißt, und die schöne Lea, die er zur Frau hätte haben mögen. Aber in der Seele des gequälten Helden fand er nur das verherrlichte Widerspiel seiner eigenen Seele wieder.
Grazia öffnete ihm die Pforten einer neuen Kunstwelt. Er lernte die überlegene Heiterkeit eines Raffael und eines Tizian kennen. Er sah den erhabenen Glanz des klassischen Genius, der wie ein Löwe über die Welt der eroberten und gemeisterten Formen herrscht. Er sah die zornsprühende Vision des großen Venetianers, die bis ins Herz trifft und deren Strahlen die unklaren Nebel zerteilt, in die sich das Leben hüllt, – er empfand die allmächtige Herrschaft dieser Lateiner, die nicht allein zu siegen verstehen, sondern sich selbst besiegen, die sich als Sieger die strengste Zucht auferlegen, und die es verstehen, auf dem Schlachtfelde unter der Siegesbeute sehr genau Auswahl zu treffen, wenn sie sie davontragen. – Die olympischen Bildnisse und die Stanzen Raffaels erfüllten Christofs Herz mit einer reicheren Musik als der Wagnerischen. Musik heiterer Linien, edler Bauwerke, harmonischer Gruppen! Musik, die aus der vollkommenen Schönheit des Ausdruckes, der Hände, der reizenden Füße, des Faltenwurfs und der Gebärden strahlt! Vergeistigung, Liebe, Quell der Liebe, der aus diesen Seelen, aus diesen Jünglingskörpern quillt. Kraft des Geistes und der Wollust. Jugendliche Zärtlichkeit, ironische Weisheit, starker und heißer Duft liebeatmender Körper; leuchtendes Lächeln, in dem die Schatten verschwinden, in dem die Leidenschaft entschlummert. Bebende Lebenskräfte, die sich wie die Rosse des Helios bäumen, aber von der ruhigen Hand des Lenkers gebändigt werden ... Und Christof fragte sich:
»Ist es denn unmöglich, die Kraft und den Frieden Roms zu vereinen, wie sie es getan haben? Heute streben die Besten immer nur nach dem einen von beiden auf Kosten des anderen. Die Italiener scheinen unter allen Völkern am meisten den Sinn für die Harmonie verloren zu haben, die Poussin, Lorrain und Goethe vernahmen. Muß noch einmal ein Fremder ihnen den Wert alles dessen offenbaren? ... Und wer wird unsere Musiker belehren? Die Musik hat ihren Raffael noch nicht gehabt. Mozart ist nur ein Kind, ein deutscher Kleinbürger, der fiebernde Hände und eine gefühlvolle Seele hat, der zuviel redet und zuviele Gesten macht, der da redet, weint und lacht um eines Nichts willen. Und weder Bach, der Gotiker, noch der Bonner Prometheus, der mit dem Geier kämpft, noch seine titanischen Nachfolger, die den Pelion auf den Ossa türmen und den Himmel mit Schmähungen überhäufen, haben jemals das Lächeln Gottes geschaut ...«
Seit er das gesehen hatte, schämte sich Christof seiner eigenen Musik; sein eitles Gehabe, seine übertriebenen Leidenschaften, seine schamlosen Klagen, kurz, diese ganze Zurschaustellung des eigenen Ich, dieser Mangel an Maß erschienen ihm jämmerlich und schmachvoll zugleich. Eine Herde ohne Hirt, ein Königreich ohne König. – Man muß König sein über die tobende Seele ... Während dieser Monate schien Christof die Musik vergessen zu haben. Er schrieb kaum und fühlte nicht das Bedürfnis danach. Sein von Rom befruchteter Geist ging trächtig. Er verbrachte seine Tage in einem Zustand von Traum und halber Trunkenheit. Die Natur befand sich gleich ihm im ersten Frühling, in dem sich die Mattigkeit des Erwachens mit einem wonnevollen Schwindel eint. Er und sie träumten umschlungen wie Liebende, die sich im Schlaf aneinander schmiegen. Das fiebernde Rätsel der Campagna schien ihm nicht mehr feindlich und beunruhigend; er hatte sich zum Herrn ihrer tragischen Schönheit gemacht: in seinen Armen hielt er die entschlummerte Demeter.
Im Laufe des April machte man ihm von Paris aus den Vorschlag, dort eine Reihe von Konzerten zu dirigieren. Ohne ihn weiter zu prüfen, lehnte er ihn ab; aber er hielt es für seine Pflicht, zunächst mit Grazia darüber zu sprechen. Es bereitete ihm eine innige Freude, sich mit ihr über sein Leben zu beraten; dabei gab er sich der Täuschung hin, daß sie es mit ihm teile. Sie bereitete ihm diesmal eine kleine Enttäuschung. Sie ließ sich die Angelegenheit sehr genau auseinandersetzen; dann riet sie ihm, anzunehmen. Er war darüber betrübt; er sah darin den Beweis ihrer Gleichgültigkeit.
Grazia gab ihren Rat vielleicht nicht ohne Bedauern. Weshalb aber fragte Christof sie dann? Je mehr er es ihr anheimstellte, für ihn zu entscheiden, um so mehr fühlte sie sich für die Handlungsweise ihres Freundes verantwortlich. Durch den Austausch, der zwischen ihren Gedanken bestand, hatte sie Christof etwas von seinem Willen geraubt. Er dagegen hatte ihr offenbart, wie notwendig und schön es sei, zu handeln. Zum mindesten hatte sie erkannt, daß es für ihren Freund eine Pflicht bedeute; und sie wollte nicht, daß er sie versäume. Sie kannte besser als er die einschläfernde Macht, die der Atem der italienischen Erde in sich birgt, und die wie das schleichende Gift des Scirocco in die Adern dringt und den Willen einlullt. Wie oft hatte sie seinen verderblichen Zauber empfunden, ohne die Kraft zu finden, ihm zu widerstehen! Ihr ganzer Kreis war mehr oder weniger von dieser seelischen Malaria ergriffen. Selbst die Stärksten waren ihr früher einmal zum Opfer gefallen; sie hatte die eherne Kraft der römischen Wölfin aufgezehrt. Rom atmet den Tod: es hat zuviele Gräber. Es ist gesünder, sich dort nur vorübergehend aufzuhalten, als dort zu leben. Nur allzu leicht verliert man dort die Fühlung mit der eigenen Zeit: darin liegt ein gefährlicher Reiz für noch junge Kräfte, die eine lange Laufbahn vor sich haben. Grazia machte sich klar, daß die Welt, die sie umgab, keine anregende Umgebung für einen Künstler sei. Und obgleich sie für Christof mehr Freundschaft empfand als für jeden anderen – (wagte sie, sich dies einzugestehen?) –, so war sie im Grunde doch nicht böse, wenn er fortging. Ach, er ermüdete sie mit allem, was sie an ihm liebte, mit seiner überquellenden Intelligenz, mit der Fülle seiner Lebenskraft, die, jahrelang angesammelt, nun überströmte: ihre Ruhe wurde dadurch gestört. Er fiel ihr vielleicht auch zur Last, weil sie stets die Bedrohung durch diese schöne und rührende, aber sie quälende Liebe empfand, vor der es immer auf der Hut zu sein galt; es war klüger, ihn fern zu halten. Sie hütete sich wohl, sich das selbst zuzugeben; sie glaubte nur, Christofs Vorteil im Auge zu haben.
An guten Gründen fehlte es ihr nicht. Im damaligen Italien konnte ein Musiker nur schwer leben. Die Luft war ihm knapp zugemessen. Das musikalische Leben war unterdrückt, entstellt. Der fabrikmäßige Theaterbetrieb überrußte und verräucherte den Boden, dessen musikalische Blüten einst ganz Europa mit ihrem Duft erfüllt hatten. Wer sich nicht in die Gefolgschaft der Schreier einreihen mochte, wer in die Fabrik nicht eintreten konnte oder wollte, war zur Verbannung verurteilt oder mußte ohne Luft und Licht leben. Das Talent war durchaus nicht versiegt, aber man ließ es nutzlos versiegen oder verlorengehen. Christof war so manchem jungen Musiker begegnet, bei dem die Seele der melodienreichen Meister jener Rasse und der Instinkt für Schönheit, der die meisterhafte und schlichte Kunst der Vergangenheit durchdrungen hatte, wieder auflebte. Wer aber kümmerte sich um sie? Sie gelangten weder zur Aufführung noch zur Herausgabe ihrer Werke. Für die reine Symphonie war keinerlei Verständnis vorhanden, nirgends hörte man auf eine Musik, die sich nicht herausputzte und überschminkte ... So sangen sie denn für sich selbst mit entmutigter Stimme, die schließlich ganz verhallte. Wozu? Schlafen ... – Christof hätte ihnen von Herzen gern geholfen. Doch hätte er es auch gekonnt, so hätte ihre mißtrauische Eitelkeit es doch nicht zugelassen. Was er auch tat, er war für sie ein Fremder; und für die Italiener der alten Geschlechter bleibt jeder Fremde trotz ihrem herzlichen Entgegenkommen im Grunde ein Barbar. Sie fanden, daß das Elend ihrer Kunst eine Angelegenheit sei, die sie unter sich abzumachen hätten. Waren sie Christof gegenüber auch mit Freundschaftsbezeigungen verschwenderisch, so nahmen sie ihn doch nicht in ihre Familie auf. – Was blieb ihm übrig? Er konnte doch nicht mit ihnen in Wettstreit treten und ihnen ihren kleinen Platz an der Sonne streitig machen, dessen sie nicht einmal sicher waren! ...
Aber das Genie kann die Nahrung nicht entbehren. Der Musiker bedarf der Musik – er muß Musik hören, muß selbst Musik machen. Eine zeitweilige Zurückgezogenheit hat wohl Wert für den Geist, der dadurch zur Sammlung gezwungen wird. Aber nur unter der Bedingung, daß er sich aus ihr wieder befreit. Einsamkeit ist vornehm, aber todbringend für den Künstler, der schließlich nicht mehr die Kraft findet, sich aus ihr herauszureißen. Man muß das Leben seiner Zeit, selbst wenn es lärmend und niedrig ist, mitmachen; unaufhörlich muß man geben und empfangen, geben und immer wieder geben und noch einmal empfangen. – Zu Christofs Zeit war Italien nicht mehr der große Kunstmarkt, der es einst gewesen war und der es vielleicht wieder werden wird. Die Jahrmärkte der Gedanken, auf denen die Seelen aller Nationen Austausch halten, liegen heute im Norden. Wer leben will, muß dort leben.
Wäre Christof sich selbst überlassen gewesen, hätte es ihm widerstanden, sich von neuem in das Gewühl zu stürzen. Grazia aber empfand Christofs Pflicht klarer als er selbst. Und sie verlangte mehr von ihm als er von sich selbst. Wohl weil sie ihn höher achtete, aber auch, weil es ihr bequemer war. Sie wies ihn auf die Tatkraft hin. Sie selbst bewahrte ihre Ruhe. – Er konnte ihr deswegen nicht zürnen. Sie glich Maria; sie hatte das bessere Teil erwählt. Jedem ist im Leben seine Rolle zugeteilt. Christofs Aufgabe bestand darin, sich zu betätigen. Ihr genügte es, zu sein. Er verlangte nichts weiter von ihr.
Nichts weiter, als daß sie ihn liebe, wenn möglich, etwas weniger in seinem und etwas mehr in ihrem Interesse. Denn er wußte ihr nicht besonderen Dank für die Selbstlosigkeit ihrer Freundschaft, die so weit ging, daß sie nur noch an den Vorteil des Freundes dachte, – der nichts Besseres wünschte, als nicht daran zu denken. Er reiste ab. Er entfernte sich von ihr. Doch er trennte sich nicht von ihr. Ein alter Minnesänger sagte: »Der Freund trennt sich von der Freundin nur, wenn seine Seele es will.«
Schweren Herzens kam er in Paris an. Es war das erste Mal seit Oliviers Tode, daß er dorthin zurückkehrte. Nie mehr hatte er diese Stadt wiedersehen wollen. Als er im Wagen saß, der ihn vom Bahnhof zum Hotel brachte, wagte er kaum, zum Schlag heraus zu sehen; er verbrachte die ersten Tage im Zimmer, ohne sich zum Ausgehen entschließen zu können. Er hatte Angst vor den Erinnerungen, die vor der Türe auf ihn lauerten. Aber warum hatte er eigentlich Angst? Machte er sich das klar? War es, und das schien ihm wahrscheinlich, die Angst, daß die Erinnerungen überall lebendig vor ihm auftauchen würden? Oder fürchtete er das viel Schmerzhaftere, sie tot wiederzufinden? ... Gegen diese neue Trauer wappneten sich in ihm halb unbewußt alle Listen des Instinkts. Aus diesem Grunde – (er ahnte das vielleicht selbst nicht) – hatte er sein Hotel in einem Stadtviertel gewählt, das von dem früher bewohnten weit entfernt lag. Und als er zum ersten Male durch die Straßen ging, als er in dem Konzertsaal seine Orchesterproben dirigieren mußte, als er wieder mit dem Pariser Leben in Berührung trat, schloß er eine zeitlang immer noch die Augen, wollte nicht sehen, was er sah, wollte hartnäckig nicht sehen, was er einst gesehen hatte. Er sagte sich schon immer im voraus:
»Ich kenne das, ich kenne das ...«
In der Kunst herrschte noch immer die gleiche unduldsame Anarchie wie in der Politik. Immer noch derselbe Jahrmarkt. Nur die Schauspieler hatten die Rollen gewechselt. Die Revolutionäre seiner Zeit waren Bürger geworden; die Übermenschen waren in Mode. Die Unabhängigen von einst versuchten die Unabhängigen von heute zu ersticken. Die vor zwanzig Jahren jung gewesen waren, zeigten sich jetzt rückständiger als die Alten, die sie einst bekämpft hatten; und ihre Kritiker verweigerten den Neuankömmlingen das Lebensrecht. Dem Anschein nach hatte sich nichts verändert.
Und doch war alles anders geworden ...
»Liebe Freundin, verzeihen Sie mir. Wie gütig sind Sie, mir wegen meines Stillschweigens nicht zu zürnen. Ihr Brief hat mir sehr wohlgetan. Ich habe ein paar Wochen in schrecklicher Verwirrung verbracht. Alles fehlte mir. Ich hatte Sie verloren. Und hier die furchtbare Leere an der Stelle derer, die ich verloren habe. Alle alten Freunde, von denen ich Ihnen gesprochen habe, verschwunden. Philomele – (Sie erinnern sich an die Stimme, die an jenem trüben und lieben Abend sang, an dem ich durch eine festliche Menge irrte und in einem Spiegel Ihre Augen wiedersah, die mich anschauten) – Philomele hat ihren vernünftigen Traum verwirklicht; sie hat eine kleine Erbschaft gemacht und ist nach der Normandie gezogen; dort hat sie einen Gutshof, den sie leitet. Herr Arnaud hat seinen Abschied genommen: er ist mit seiner Frau in die Provinz zurückgekehrt, in eine kleine Stadt in der Nähe von Angers. Von den Berühmtheiten meiner Zeit sind viele gestorben oder gestürzt worden; nur ein paar alte Komödianten, die vor zwanzig Jahren die jugendlichen Hauptrollen in Kunst und Politik spielten, spielen sie heute noch mit derselben falschen Grimasse. Außer diesen Masken kenne ich niemanden. Ich hatte den Eindruck, als grinsten sie über einem Grabe. Es war ein entsetzliches Gefühl. – Außerdem habe ich in der ersten Zeit nach meiner Ankunft körperlich unter der Häßlichkeit aller Dinge gelitten, besonders unter dem grauen Licht des Nordens, nachdem ich Ihre goldene Sonne gerade eben verlassen hatte; die aneinandergedrängten, bleigrauen Häuser, die gewöhnlichen Linien mancher Dome, mancher Denkmäler, die mich früher niemals befremdet hatten, verletzten mich sehr. Die sittliche Atmosphäre war mir nicht angenehmer.
Zwar kann ich mich über die Pariser nicht beklagen. Der Empfang, den sie mir bereiteten, gleicht wenig dem, den ich einst fand. Es scheint, ich bin während meiner Abwesenheit eine Art Berühmtheit geworden. Ich mache darüber zu Ihnen keine Worte: ich weiß, was sie wert ist, und bin gerührt über all die freundlichen Dinge, die diese Leute von mir sagen und über mich schreiben; und bin ihnen dankbar dafür. Aber wie soll ich mich erklären? Ich fühle mich denen, die mich einst bekämpften, näher als denen, die mich heute loben ... Die Schuld liegt an mir, ich weiß es. Schelten Sie mich nicht. Ich war einen Augenblick aus dem Gleichgewicht. Darauf mußte ich gefaßt sein. Jetzt ist das vorbei. Ich begreife. Ja, Sie hatten recht, mich unter Menschen zu schicken. Ich war im Begriff, in meiner Einsamkeit auf den Sand zu laufen. Es ist ungesund, den Zarathustra zu spielen. Der Strom des Lebens fließt dahin und von uns fort. Ein Augenblick kommt, wo man nur noch eine Wüste ist. Will man aber im Sande ein neues Fahrwasser bis zum Fluß graben, so braucht man dazu viele Tage anstrengender Arbeit bei brennender Sonne. – Sie ist getan. Mir ist nicht mehr schwindlig. Ich bin wieder drin im Strome. Ich schaue um mich und sehe.
Liebe Freundin, welch sonderbares Volk sind diese Franzosen! Vor zwanzig Jahren glaubte ich, es ginge mit ihnen zu Ende ... Sie fangen wieder von vorne an. Mein lieber Genosse Jeannin hatte es mir wohl vorausgesagt; aber ich hatte ihn im Verdacht, daß er sich etwas vortäusche. Wie hätte ich es damals glauben sollen! Frankreich war, wie sein Paris, voller Abbrüche, Schutt und Löcher. Ich sagte: ›Sie haben alles zerstört ... Was für eine Nagerrasse!‹ ... – Ein Geschlecht von Bibern. Gerade, wenn man meint, sie hätten sich über die Ruinen hergestürzt, gründen sie mit diesen selben Ruinen eine neue Stadt. Ich sehe heute nichts als Baugerüste, die sich auf allen Seiten erheben ...
›Wenn ein Ding geschehen,
Selbst die Narren es verstehen ...‹
Eigentlich ist es immer dieselbe französische Unordnung. Man muß daran gewöhnt sein, wenn man in der sich nach allen Seiten stoßenden Menge die Rotten der Arbeiter erkennen will, von denen jeder an seine Aufgabe geht. Sie wissen, es sind Leute, die nichts tun können, ohne von den Dächern zu schreien, was sie tun. Auch sind es Leute, die nichts fertig bringen können, ohne das zu verlästern, was die Nachbarn vollführen. Das kann wohl die sichersten Köpfe verwirren. Wenn man aber, wie ich, nahezu zehn Jahre bei ihnen gelebt hat, läßt man sich durch ihr Gelärme nicht mehr täuschen. Man merkt, daß das ihre Art ist, sich zur Arbeit anzufeuern. Gerade beim Reden handeln sie: und da auf jedem Bauplatz ein Haus errichtet wird, ist schließlich die ganze Stadt neu erbaut. Das Tollste ist, daß die Gesamtheit der Bauten nicht einmal unharmonisch wirkt. Wenn sie auch die gegensätzlichsten Ansichten vertreten, so sind sie doch alle von derselben Art. So bestehen unter ihrer Anarchie gemeinsame Instinkte, eine Rassenlogik, die sie anstelle von Zucht zusammenhält, und die am Ende wirksamer ist, als die Zucht eines preußischen Regiments.
Überall findet man dieselbe Schwungkraft, dasselbe Baufieber; in der Politik, wo Sozialisten und Nationalisten um die Wette daran arbeiten, das Räderwerk der gelockerten Macht straffer anzuziehen; in der Kunst, wo die einen ein altes aristokratisches Wohnhaus für die Bevorzugten herrichten wollen, die anderen eine weite Volkshalle, in der die Gesamtseele singt. Wiedererbauer der Vergangenheit, Erbauer der Zukunft! Was immer diese erfinderischen Tiere auch machen, sie bauen stets von neuem dieselben Zellen. Ihr Biber- oder Bieneninstinkt läßt sie durch alle Jahrhunderte hindurch dieselben Bewegungen vollführen, dieselben Formen wiederfinden. Die Revolutionärsten sind vielleicht unbewußt die, die sich an die ältesten Überlieferungen anschließen. Mir sind in den Syndikaten und unter den bedeutendsten jungen Schriftstellern mittelalterliche Seelen begegnet.
Jetzt, nachdem ich mich in ihre aufrührerische Art wieder eingelebt habe, sehe ich ihrer Arbeit mit Vergnügen zu. Offen gesagt, ich bin ein zu alter Bär, um mich jemals in einem ihrer Häuser wohlzufühlen; ich brauche freie Luft. Aber was für gute Arbeiter sind sie! Das ist ihre beste Eigenschaft. Sie bringt die Mittelmäßigsten und die Verderbtesten zu Ansehen. Und welcher Schönheitssinn bei ihren Künstlern! Ich empfand das früher weniger. Sie haben mich sehen gelehrt. Meine Augen sind unter Roms Licht geöffnet worden. Ihre Renaissancemenschen haben mich diese hier verstehen gelehrt. Eine Seite von Debussy, ein Torso von Rodin, ein Satz von Suarès stehen auf der gleichen Linie mit Ihren Cinquecentisten.
Mir gefällt hier nicht etwa alles. Ich habe meine alten Bekannten vom Jahrmarkt wiedergefunden, die mir schon einst soviel heiligen Zorn verursachten. Sie haben sich kaum verändert. Ich aber bin leider verändert. Ich wage nicht mehr, streng zu sein. Wenn mich die Lust ergreift, einen unter ihnen streng zu verurteilen, sage ich mir: du hast kein Recht dazu. Du hast Schlimmeres begangen als diese Menschen, Du, der sich für so stark hielt.
Ich habe auch schon gelernt, daß es nichts Zweckloses gibt und daß selbst die Häßlichsten ihre Rolle in dem Plan der Tragödie haben. Die schlimmsten Dilettanten, die stinkendsten Amoralisten haben ihre Aufgabe als Holzwürmer erfüllt; es galt, die wacklige Hütte zu zerstören, bevor man sie wieder aufbauen konnte. Die Juden sind ihrer heiligen Mission gefolgt, die darin besteht, zwischen den anderen Rassen das Fremdvolk zu bleiben, das Volk, das von einem zum anderen Ende der Welt das Netz menschlicher Gemeinschaft webt. Sie schlagen die verstandesmäßigen Schranken zwischen den Nationen nieder, um der göttlichen Vernunft freie Bahn zu schaffen. Die schlimmsten Fälscher, die spöttelnden Zerstörer, die die Glaubensüberzeugungen unserer Vergangenheit untergraben, die unsere geliebten Toten morden, arbeiten, ohne es zu wissen, an dem heiligen Werke, an dem neuen Leben. In derselben Art arbeitet das raubgierige Interesse weltbürgerlicher Bankiers – wenn auch mit unendlichen Zerstörungen – am künftigen Weltfrieden, ob sie ihn wollen oder nicht, und zwar wirken sie Seite an Seite mit den Revolutionären, die jene Kapitalisten unendlich viel sicherer als die albernen Pazifisten bekämpfen.
Sie sehen, ich altere. Ich beiße nicht mehr. Meine Zähne sind abgenutzt. Wenn ich ins Theater gehe, gehöre ich nicht mehr zu den kindlichen Zuschauern, die die Schauspieler beschimpfen und den Verräter beleidigen.
Stille Grazia, ich rede nur von mir; und doch denke ich nur an Sie. Wenn Sie wüßten, wieviel ich mit meinem Ich zu tun habe! Es lastet auf mir und saugt mich auf. Es ist wie eine Kugel, die mir Gott an den Hals gehängt hat. Wie gern hätte ich sie zu Ihren Füßen niedergelegt! Aber was hätten Sie damit anfangen sollen? Es ist ein trauriges Geschenk ... Ihre Füße sind dazu geschaffen, über sanfte Erde zu schreiten, über Sand, der unter den Schritten singt. Ich sehe sie, diese lieben Füße, wie sie lässig über die anemonenbedeckten Rasenflächen gehen ... (Sind Sie wieder einmal in die Villa Doria gegangen?) ... Nun sind Sie schon müde! Ich sehe Sie jetzt in ihrem Lieblingswinkel, hinten in Ihrem Wohnzimmer ausgestreckt liegen, auf den Ellbogen gestützt, und ein Buch haltend, das Sie nicht lesen. Sie hören mir liebevoll zu, ohne recht auf das achtzugeben, was ich sage: denn ich bin langweilig, und um Geduld zu bewahren, kehren Sie sich hin und wieder Ihren eigenen Gedanken zu; aber Sie sind höflich und passen auf, daß Sie mich nicht kränken; und wenn ein Wort Sie zufällig aus weiter Ferne zurückholt, nehmen Ihre Augen schnell wieder einen interessierten Ausdruck an. Und auch ich bin ebenso weit wie Sie von dem entfernt, was ich sage; auch ich höre kaum das Geräusch meiner Worte: und während ich ihrem Widerschein auf Ihrem schönen Gesicht folge, lausche ich in meinem Innern ganz anderen Worten, die ich Ihnen nicht sage. Diese, stille Grazia, vernehmen Sie im Gegensatz zu den anderen recht gut; aber Sie tun, als hörten Sie sie nicht.
Leben Sie wohl. Ich glaube, Sie werden mich bald wiedersehen. Ich will hier nicht verschmachten. Was soll ich hier noch tun, jetzt, da meine Konzerte gegeben sind? Ich küsse Ihre Kinder auf die lieben kleinen Wangen; sie sind ein Teil von Ihnen. Man muß sich eben bescheiden! ...
Christof«
Die »stille Grazia« antwortete:
»Lieber Freund, ich habe Ihren Brief in dem kleinen Wohnzimmerwinkel empfangen, an den Sie sich noch so gut erinnern; und ich habe ihn gelesen, so wie ich zu lesen pflege; ich ließ von Zeit zu Zeit Ihren Brief ruhen und ruhte selbst auch. Spotten Sie nicht, denn ich tat es nur, um ihn länger zu genießen. So haben wir einen ganzen Nachmittag miteinander verbracht. Die Kinder fragten mich, was ich immer läse. Ich sagte, daß es ein Brief von Ihnen sei. Aurora hat das Papier voller Mitleid betrachtet und meinte: ›Wie langweilig muß es sein, einen so langen Brief zu schreiben.‹ Ich versuchte, ihr klarzumachen, daß er kein Pensum sei, das ich Ihnen aufgegeben hätte, sondern eine Unterhaltung, die wir miteinander pflegten. Sie hörte ohne ein Wort zu sagen zu; dann rannte sie mit ihrem Bruder davon, um im Nebenzimmer zu spielen; und kurze Zeit danach, als Lionello einmal schrie, hörte ich Aurora sagen: ›Wir dürfen keinen Lärm machen; Mama unterhält sich mit Herrn Christof.‹
Was Sie mir da von den Franzosen sagen, interessiert mich, aber es überrascht mich nicht. Erinnern Sie sich, daß ich Ihnen oft vorgeworfen habe, ihnen gegenüber ungerecht zu sein? Man kann sie vielleicht nicht lieben. Aber welch intelligentes Volk! Es gibt unbedeutende Völker, die ihr gutes Herz oder ihre physische Kraft rettet. Die Franzosen rettet ihre Intelligenz. Sie entschuldigt alle ihre Schwächen. Sie verjüngt sie. Wenn man glaubt, sie wären gesunken, geschlagen, verdorben, finden sie eine neue Jugend in der beständig sprudelnden Quelle ihres Geistes.
Aber ich muß Sie schelten. Sie entschuldigen sich, daß Sie nur von sich selbst reden. Sie sind ein Ingannatore. Sie erzählen mir ja garnichts von sich. Nichts von dem, was Sie getan haben! Nichts von dem, was Sie gesehen haben! Meine Cousine Colette – (warum besuchen Sie sie nicht?) – soll mir doch über Ihre Konzerte Zeitungsausschnitte schicken, damit ich über Ihre Erfolge etwas erführe. Sie streifen das nur mit einem Wort. Ist Ihnen alles so gleichgültig? ... Das ist nicht wahr. Gestehen Sie, daß es Ihnen Freude macht ... Es muß Ihnen Freude machen, schon darum, weil es mir Freude macht. Ich mag an Ihnen keine enttäuschte Miene. Der Ton Ihres Briefes war schwermütig! Das soll nicht sein ... Es ist gut, daß Sie anderen gegenüber gerechter sind. Aber das ist kein Grund, sich selbst anzuklagen, wie Sie es tun, und zu sagen, daß Sie schlimmer sind als die Schlimmsten unter ihnen. Ein guter Christ würde sie loben. Ich sage Ihnen, daß es schlecht ist. Ich bin kein guter Christ. Ich bin eine gute Italienerin, die nicht mag, daß man sich mit der Vergangenheit quält. Die Gegenwart genügt vollständig. Ich weiß nicht alles genau, was Sie vielleicht früher getan haben. Sie deuteten es mir durch ein paar Worte an, und ich glaube, das Übrige erraten zu haben. Es war nicht sehr schön; aber Sie sind mir darum nicht weniger lieb. Armer Christof! Eine Frau in meinem Alter weiß, daß ein braver Mann oft recht schwach ist. Wenn man seine Schwäche nicht kennen würde, liebte man ihn nicht so sehr. Denken Sie nicht mehr an das, was Sie getan haben. Denken Sie an das, was Sie tun werden. Reue nützt garnichts. Reue heißt: rückwärts gehen. Aber im Guten wie im Bösen: man muß immer vorwärts. Sempre avanti, Savoia! ... Glauben Sie etwa, ich ließe Sie nach Rom zurückkommen? Sie haben hier nichts zu suchen. Bleiben Sie in Paris. Schaffen Sie, regen Sie sich, nehmen Sie teil am Kunstleben. Ich will nicht, daß Sie entsagen. Ich will, daß Sie Schönes schaffen, ich will, daß es Erfolg hat, ich will, daß Sie stark sind, damit Sie den neuen jungen Christofs helfen können, die die gleichen Kämpfe durchzumachen und die gleichen Prüfungen zu bestehen haben wie Sie. Suchen Sie sie auf, helfen Sie ihnen, seien Sie zu diesen Jüngeren besser, als die Älteren zu Ihnen waren. – Und schließlich will ich, daß Sie stark sind, damit ich weiß, daß Sie stark sind. Sie ahnen nicht, wieviel Kraft mir das selbst gibt. Ich gehe fast jeden Tag mit den Kleinen in die Villa Borghese. Vorgestern sind wir zum Ponte Molle gefahren und sind zu Fuß auf den Monte Mario gegangen. Sie verleumden meine armen Beine, sie sind bös auf Sie. »Wie kann dieser Herr behaupten, daß wir nach den zehn Schritten zur Villa Doria schon müde sind? Er kennt uns gar nicht. Wenn wir uns nicht gern anstrengen, kommt es daher, weil wir faul, nicht, weil wir unfähig sind.« Sie vergessen, mein Freund, daß ich eine kleine Bäuerin bin ...
Besuchen Sie meine Cousine Colette. Zürnen Sie ihr noch? Sie ist im Grunde eine gute Frau. Und Sie schwört nicht höher als bei Ihnen. Es scheint, die Pariserinnen sind närrisch mit Ihrer Musik. (Sie waren es vielleicht schon vorher.) Es liegt nur an meinem Berner Bären, ob er ein Pariser Löwe sein will. Haben Sie Briefe bekommen? Hat man Ihnen Liebeserklärungen gemacht? Sie erzählen mir von keiner Frau. Werden Sie sich verlieben? Erzählen Sie es mir. Ich bin nicht eifersüchtig.
Ihre Freundin G.«
»Meinen Sie etwa, daß ich Ihren letzten Satz zu schätzen weiß? Wollte Gott, spottlustige Grazia, daß Sie eifersüchtig wären! Aber rechnen Sie nicht auf mich, daß ich Sie's lehren werde. Ich bin auf die tollen Pariserinnen, wie Sie sie nennen, durchaus nicht versessen. Toll? Sie mögen es wohl sein. Das ist das Mindeste, was sie sind. Hoffen Sie nicht, daß sie mir den Kopf verdrehen. Es wäre vielleicht eher Aussicht dazu vorhanden, wenn sie sich meiner Musik gegenüber gleichgültiger zeigten. Aber es ist nur allzu wahr; sie lieben sie. Wie soll man dabei seine Illusionen bewahren? Wenn einem jemand sagt, daß er einen versteht, dann kann man sicher sein, daß er einen niemals verstehen wird ...
Nehmen Sie meine Späße nicht allzu ernst. Die Empfindungen, die ich für Sie hege, machen mich anderen Frauen gegenüber nicht ungerecht. Ich habe niemals aufrichtigere Sympathien für Sie gefühlt, als seitdem ich Sie nicht mehr mit verliebten Augen betrachte. Die große Anstrengung, die die Frauen seit dreißig Jahren machen, um sich aus der niederziehenden und ungesunden Halb-Knechtschaft loszumachen, in die unsere törichte Männerselbstsucht sie zu ihrem und unserem Unglück hineinzwang, scheint mir eine der größten Taten unserer Zeit zu sein. In einer Stadt wie dieser lernt man die neue Generation junger Mädchen bewundern, die trotz sovielen Hindernissen sich mit aufrichtigem Feuer an die Eroberung der Wissenschaft und der Diplome machen – dieser Wissenschaft und dieser Diplome, die sie, so denken sie, befreien, ihnen die Geheimnisse einer unbekannten Welt eröffnen, sie den Männern gleichstellen müssen ...
Sicherlich ist dieser Glaube trügerisch und ein wenig lächerlich. Doch der Fortschritt verwirklicht sich nie in der Art, wie man ihn erhofft; er verwirklicht sich darum nicht weniger, nur auf anderem Wege. Dieses Streben der Frauen wird nicht verloren sein. Es wird vollkommenere, menschlichere Frauen schaffen, wie sie in den großen Jahrhunderten waren. Sie werden den lebendigen Weltfragen nicht mehr teilnahmlos gegenüberstehen; das war schmachvoll und unnatürlich; denn es ist unerhört, daß eine Frau, sei sie in ihren häuslichen Obliegenheiten noch so sorgsam, sich der Pflichten in dem modernen Gemeinwesen ledig glaubt. Ihre Urahninnen aus der Zeit der Jeanne d'Arc und der Catharina Sforza dachten nicht so. Die Frau ist siech geworden. Wir haben ihr Luft und Sonne verweigert. Sie erobert sie mit Gewalt von uns zurück. Ach, die tapferen Kleinen! Natürlich werden viele von denen, die heute kämpfen, sterben, viele werden verderben. Es ist ein kritisches Zeitalter. Das Streben ist zu leidenschaftlich für die verweichlichten Kräfte. Wenn eine Pflanze lange ohne Wasser bleibt, kann sie durch den ersten Regen zerstört werden. Nun ja! Das ist das Lösegeld jedes Fortschrittes. Die Späteren werden aus solchen Leiden emporblühen. Die armen kleinen kriegerischen Jungfrauen von heute, von denen viele sich nicht verheiraten, werden fruchtbarer für die Zukunft sein als Generationen von Matronen, die vor ihnen Kinder zur Welt gebracht haben; denn aus ihnen, mit ihren Opfern erkauft, wird das weibliche Geschlecht eines neuen klassischen Zeitalters erstehen.
Im Salon Ihrer Cousine Colette hat man nicht gerade Aussicht, diese arbeitsamen Bienen anzutreffen. Was ist in Sie gefahren, daß Sie mich durchaus zu dieser Frau schicken wollen? Ich mußte Ihnen gehorchen; aber es ist nicht recht. Sie mißbrauchen Ihre Macht. Ich habe drei Einladungen abgesagt, zwei Briefe ohne Antwort gelassen. Sie hat mich bei einer meiner Orchesterproben überrumpelt – (man probte meine sechste Symphonie). – Während der Pause sah ich sie auf mich zukommen; sie trug die Nase hoch, schnupperte umher und rief: ›Das riecht nach Liebe! Ach, wie ich für diese Musik schwärme!‹
Äußerlich hat sie sich verändert. Nur ihre Katzenaugen mit den vorstehenden Augäpfeln und ihre eigensinnige, immer bewegliche Nase sind dieselben geblieben. Aber ihr Gesicht ist jetzt breiter, derber, blühender, kräftiger. Der Sport hat sie verwandelt. Sie hat sich ihm ganz ergeben. Ihr Mann ist, wie Sie wissen, einer der Oberbonzen im Automobil- und Aëroklub. Kein Flugereignis, kein Wettbewerb, weder zu Luft, zu Pferde, noch zu Wasser, von dem die Stevens-Delestrade nicht glauben, dabei sein zu müssen. Sie sind immer unterwegs. Man kann mit ihnen nichts mehr reden; sie sprechen von nichts anderem mehr als von Racing, Rowing, Rugby und Derby. Ein neues Geschlecht von Gesellschaftsmenschen! Die Zeit des Pelleas ist für die Frauen vorbei. Die Mode gehört nicht mehr den Seelen. Die jungen Mädchen prahlen mit ihrer rotgebrannten, in Freiluftmärschen und -spielen gebratenen Haut; sie sehen einen mit männlichen Augen an. Sie lachen ein etwas derbes Lachen. Ihr Ton ist brutaler und roher geworden. Ihre Cousine sagt seelenruhig manchmal Ungeheuerlichkeiten. Sie ist eine starke Esserin, sie, die früher so wenig aß. Sie klagt dabei weiter über ihren schlechten Magen, um im Klagen nicht aus der Übung zu kommen; aber sie läßt sich deswegen doch keinen guten Bissen entgehen. Sie liest nichts. Man liest in dieser Gesellschaft nicht mehr. Nur die Musik hat Gnade gefunden. Ihr ist die Verwilderung der Literatur sogar zugute gekommen. Wenn diese Leute hundsmüde sind, ist ihnen die Musik ein türkisches Bad, warmer Dampf, eine Massage, ein Nargileh. Man braucht dabei nicht zu denken. Sie ist ein Zwischending zwischen Sport und Liebe. Und sie ist auch ein Sport. Der beliebteste Sport unter den ästhetischen Vergnügungen aber ist heute der Tanz. Russische Tänze, griechische Tänze, schweizer Tänze, amerikanische Tänze – man tanzt in Paris alles ... die Symphonien von Beethoven, die Tragödien von Äschylus, das wohltemperierte Klavier, die Antiken des Vatikan, Orpheus, Tristan, die Passion und die Gymnastik. Diese Leute haben den Koller.
Das Sonderbare ist, wie Ihre Cousine das alles miteinander vereinigt: ihre Ästhetik, ihren Sport und ihren praktischen Geist (denn sie hat von ihrer Mutter den Geschäftssinn und den häuslichen Despotismus geerbt.) All dieses muß einen unglaublichen Mischmasch abgeben. Aber sie befindet sich dabei wohl; sie bewahrt bei ihren tollsten Launen einen klaren Kopf, ebenso wie sie bei ihren schwindelerregenden Automobilfahrten immer den sicheren Blick und die sichere Hand behält. Sie ist eine gebieterische Frau; mit klingendem Spiel macht sie sich alles untertan: ihren Mann, ihre Gäste, ihre Leute. Sie kümmert sich auch um Politik; sie ist für »Hochwürden«: ich halte sie nicht etwa für royalistisch; aber es ist ihr ein Vorwand, sich noch mehr zu schaffen zu machen. Und obgleich sie unfähig ist, zehn Seiten in einem Buche zu lesen, wählt sie für die Akademie mit. – Sie maßt sich an, mich unter ihren Schutz zu nehmen. Sie können sich denken, daß das nicht nach meinem Geschmack ist. Das Ärgerlichste ist, daß sie durch die bloße Tatsache meines Besuches bei ihr, den ich aus Gehorsam gegen Sie gemacht habe, jetzt von ihrer Macht über mich überzeugt ist ... Ich räche mich, indem ich ihr derbe Wahrheiten sage. Sie lacht nur darüber; sie ist um eine Antwort nie verlegen. ›Im Grunde ist sie eine gute Frau ...‹ Ja, vorausgesetzt, daß sie beschäftigt ist. Das weiß sie selbst: wenn diese Maschine nichts mehr zu zerreiben hätte, wäre sie zu allem, aber auch zu allem bereit, um ihr frisches Futter zuzuführen. – Ich war zweimal bei ihr. Jetzt gehe ich nicht mehr hin. Es ist genug, um Ihnen meine Unterwürfigkeit zu beweisen. Sie wollen doch nicht meinen Tod? Ich komme von ihr gebrochen, zerschlagen, gerädert zurück. Das letzte Mal, als ich sie sah, hatte ich in der folgenden Nacht einen schrecklichen Albdruck. Mir träumte, ich sei ihr Mann und wäre mein Leben lang an diesen lebenden Wirbelwind gefesselt ... Ein dummer Traum, der den wirklichen Ehemann nicht beunruhigen würde; denn von allen, die man in ihrem Hause trifft, kommt er vielleicht am wenigsten mit ihr zusammen; und wenn sie zusammen sind, reden sie von nichts als von Sport. Sie verstehen sich sehr gut.
Wie konnten diese Leute meiner Musik einen Erfolg bereiten? Ich versuche gar nicht erst, es zu begreifen. Ich nehme an, sie rüttelt sie in einer ganz neuen Art auf. Sie sind ihr dankbar dafür, daß sie sie mißhandelt. Sie lieben heute die Kunst, die einen Körper hat. Aber von der Seele, die in diesem Körper ist, ahnen sie nicht ein bißchen; sie fallen aus ihrer Vorliebe von heute in die Gleichgültigkeit von morgen, und aus der Gleichgültigkeit von morgen in die Verleumdung von übermorgen, ohne sie jemals gekannt zu haben. Das ist das Los aller Künstler. Ich gebe mich keiner Einbildung inbezug auf meinen Erfolg hin. Ich werde ihn nicht lange haben; und sie werden mich ihn obendrein noch teuer bezahlen lassen. – Unterdessen erlebe ich sonderbare Dinge. Der Begeistertste unter meinen Bewunderern (ich wette tausend gegen eins, daß Sie es nicht erraten) ... ist unser Freund Lévy-Coeur. Sie erinnern sich an diesen sauberen Herrn, mit dem ich früher ein lächerliches Duell hatte? Heute sagt er allen, die mich früher nicht verstanden, wie sie sich zu verhalten haben. Er macht es sogar sehr gut. Von allen, die über mich reden, ist er der Klügste. Urteilen Sie selbst, was die anderen taugen. Ich versichere Sie, man braucht darauf nicht stolz zu sein.
Ich habe dazu auch keine Lust. Ich fühle mich zu gedemütigt, wenn ich die Werke höre, um derentwillen man mich lobt. Ich erkenne mich in ihnen und gefalle mir nicht. Welch unbarmherziger Spiegel ist ein musikalisches Werk für den, der zu sehen versteht! Zum Glück sind sie blind und taub. Ich habe in meine Werke soviel von meinen Wirren und meinen Schwächen gelegt, daß es mir manchmal scheint, als beginge ich eine Missetat, indem ich diese Schwärme von Dämonen in die Welt loslasse. Ich gebe mich zufrieden, wenn ich die Ruhe des Publikums sehe: es trägt einen dreifachen Panzer; nichts dringt hindurch; sonst würde ich verdammt werden ... Sie werfen mir vor, ich sei zu strenge gegen mich. Sie tun es, weil Sie mich nicht kennen, wie ich mich kenne. Man sieht das, was wir sind. Man sieht nicht, was wir hätten sein können; und man ehrt uns um der Dinge willen, die viel weniger unser Verdienst sind als das der Ereignisse, die uns tragen, und der Kräfte, die uns lenken. Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Neulich abends ging ich in eines jener Kaffeehäuser, in denen man ziemlich gute Musik, wenn auch auf etwas eigenartige Weise macht: mit fünf oder sechs Instrumenten und einem Klavier spielt man alle Symphonien, Messen und Oratorien. Geradeso wie in Rom bei manchen Marmorhändlern die Mediceerkapelle als Kamingarnitur verkauft wird. Scheinbar ist das der Kunst dienlich. Damit sie unter den Menschen in Umlauf gesetzt werden kann, muß man wohl oder übel schlechtes Kleingeld daraus machen. Im übrigen betrügt man einen bei diesen Konzerten nicht mit der Rechnung. Die Programme sind reichlich, die Ausführenden gewissenhaft. Ich habe dort einen Cellisten getroffen, mit dem ich in Beziehungen getreten bin; seine Augen erinnerten mich in seltsamer Weise an die Augen meines Vaters. Er hat mir die Geschichte seines Lebens erzählt. Er ist der Enkel eines Bauern und der Sohn eines kleinen Magistratsbeamten, der in einer Stadt im Norden angestellt war. Man wollte aus ihm einen Herrn, einen Advokaten machen; man schickte ihn aufs Gymnasium der Nachbarstadt. Der kleine, kräftige, bäuerische Kerl, der für die fleißige Arbeit eines kleinen Notars schlecht geschaffen war, konnte nicht im Käfig bleiben; er sprang über die Mauer, irrte durch die Felder, lief den Mädchen nach und gab seine große Kraft in Keilereien aus; die übrige Zeit schlenderte er herum und träumte von Dingen, zu denen er doch niemals fähig gewesen wäre. Nur eines lockte ihn: die Musik. Gott weiß, wieso! Unter den Seinen war niemals ein Musiker gewesen, außer einem etwas verrückten Großonkel, einem dieser Provinzoriginale, deren oft bedeutende Intelligenz und Begabung sich in einer hochmütigen Zurückgezogenheit mit tollen Albernheiten verbraucht. Dieser hatte ein neues System der Notenschreibart erfunden – noch eins! –, das die Musik auf den Kopf stellen sollte! Er behauptete sogar, eine Art von Stenographie entdeckt zu haben, durch die man gleichzeitig die Worte, den Gesang und die Begleitung notieren könne; er war niemals so weit gekommen, sie selbst richtig nachlesen zu können. In der Familie machte man sich über den guten Alten lustig; aber deswegen war man doch stolz auf ihn. Man dachte: ›Er ist ein alter Narr. Wer weiß? Vielleicht ist er ein Genie ...‹ – Wahrscheinlich hatte sich der Hang zur Musik von ihm auf den Großneffen vererbt. Was für eine Musik konnte er wohl in seiner Vaterstadt hören? ... Aber schlechte Musik kann eine ebenso reine Liebe einflößen wie gute.
Das Unglück war, daß man sich in jenen Kreisen einer solchen Leidenschaft schämen zu müssen glaubte; und das Kind besaß nicht die gesunde Unvernunft des Großonkels. Es versteckte sich, um die Ausgeburten des alten Tollhäuslers zu lesen, die den Grund zu seiner verdrehten musikalischen Erziehung legten. Eitel und voll Furcht vor seinem Vater und der öffentlichen Meinung, wollte er nichts von seinem Ehrgeiz verraten, bevor er zu etwas gekommen war. Als guter Junge, der von der Familie erdrückt wurde, machte er es wie so viele französische Kleinbürger, die aus Schwäche oder Güte nicht wagen, dem Willen der Ihrigen Trotz zu bieten, die sich scheinbar unterwerfen und ihr ganzes wirkliches Leben in beständiger Heimlichkeit verbringen. Anstatt seiner Neigung zu folgen, mühte er sich ohne Liebe zu der Arbeit, die man ihm zugewiesen hatte, obwohl er ebenso unfähig war, darin etwas zu leisten, wie mit Glanz durchzufallen. So gut es eben ging, bestand er die notwendigen Prüfungen. Der Hauptvorteil, den er darin sah, war, dadurch der doppelten Oberaufsicht der Provinz und des Vaters zu entschlüpfen. Das Jus langweilte ihn zu Tode; er war entschlossen, diese Laufbahn nicht weiter zu verfolgen. Aber solange sein Vater lebte, wagte er nicht, seinen Willen zu äußern. Vielleicht war er nicht einmal böse, daß er noch warten mußte, bevor er sich zu entscheiden hatte. Er gehörte zu denen, die sich ihr ganzes Leben lang mit dem narren, was sie später machen werden oder machen könnten. Vorläufig tat er nichts. Aus dem Gleise geraten und berauscht von seinem neuen Leben in Paris, gab er sich mit der ganzen Wildheit eines jungen Bauern seinen beiden Leidenschaften hin: den Frauen und der Musik; die Konzerte stiegen ihm nicht weniger zu Kopf als das Vergnügen. Er verlor damit Jahre, ohne etwa die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Vervollständigung seiner musikalischen Bildung zu verwenden. Sein scheuer Stolz, sein schlechter eigenwilliger und argwöhnischer Charakter hinderten ihn, irgendwie Unterricht zu nehmen, irgend jemand um Rat zu fragen.
Als sein Vater starb, schickte er Themis und Justinian zum Teufel. Er begann zu komponieren, ohne daß er den Mut gehabt hatte, sich um die notwendige Technik zu bemühen. Eingewurzelte Gewöhnung an faules Herumlungern und der Hang zum Vergnügen hatten ihn zu jeder ernsten Anstrengung unfähig gemacht. Er empfand stark; aber sein Denken wie seine Formbildung entglitten ihm schnell; zu guter Letzt sprach er nichts als Banalitäten aus. Das Schlimmste war, daß in diesem mittelmäßigen Menschen wirklich etwas Großes steckte. Ich habe zwei seiner früheren Kompositionen gelesen. Hier und dort packende Gedanken, die im Entwurf stecken blieben und sogleich entstellt wurden. Raketenfeuer auf einem Torfmoor ... Und was für ein sonderbares Gehirn! Er hat mir die Sonaten von Beethoven erklären wollen. Er sieht darin kindliche und abgeschmackte Romane. Dabei welche Leidenschaft, welcher tiefe Ernst! Die Tränen treten ihm in die Augen, wenn er darüber spricht. Er ließe sich für das, was er liebt, töten. Er ist rührend und komisch. In dem Augenblick, in dem ich ihm ins Gesicht lachen wollte, hätte ich ihn umarmen mögen ... Eine angeborene Anständigkeit ist in ihm, eine kräftige Verachtung für das Heuchlertum der Pariser Klicken und für falschen Ruhm! – (kann er sich auch einer kindhaften, kleinbürgerlichen Bewunderung für Leute, die Erfolg haben, nicht erwehren) ... Er besaß eine kleine Erbschaft. In wenigen Monaten hatte er sie aufgezehrt; und bei völliger Mittellosigkeit hatte er, wie zahlreiche seinesgleichen, die sündhafte Anständigkeit gehabt, ein mittelloses Mädchen zu heiraten, das er verführt hatte. Sie hatte eine schöne Stimme und trieb Musik, ohne sie wahrhaft zu lieben. Es galt, von ihrer Stimme und der mittelmäßigen Fertigkeit, die er im Cellospiel erworben hatte, zu leben. Natürlich entdeckten sie bald ihre beiderseitige Unzulänglichkeit und wurden sich unerträglich. Eine Tochter wurde ihnen geboren. Der Vater übertrug auf das Kind die Kraft seiner Illusionen; er dachte, sie würde das werden, was er nicht hatte sein können. Das Mädchen ähnelte der Mutter: sie klimperte ohne einen Schatten von Talent unermüdlich auf dem Klavier herum. Sie vergötterte ihren Vater und war ihm zu Gefallen fleißig. Während mehrerer Jahre grasten sie die Hotels der Badeorte ab und heimsten dabei mehr Schimpf als Geld ein. Das kränkliche und überangestrengte Kind starb. Die verzweifelte Frau wurde jeden Tag mürrischer. Und so entstand ein bodenloses Elend, aus dem herauszukommen keine Hoffnung war, und das nur verschärft wurde durch das Gefühl, ein Ideal unerreichbar vor sich zu wissen ...
Als ich, liebe Freundin, diesen schiffbrüchigen armen Teufel sah, dessen Leben nichts als eine Kette von Verdruß gewesen ist, dachte ich: ›Da hast du, was du selbst hättest werden können. In unseren Kinderseelen waren gemeinsame Züge; und manche Abenteuer unseres Lebens ähnelten sich; ich habe sogar eine gewisse Verwandtschaft in unseren musikalischen Gedanken gefunden; aber seine sind unterwegs stecken geblieben. Woran hat es gelegen, daß ich nicht untergegangen bin wie er? Zweifellos an meinem Willen. Aber auch an den Zufälligkeiten des Lebens. Und wenn ich selbst nur meinen Willen nehme, danke ich den einzig und allein meinem Verdienst? Nicht vielmehr meiner Familie, meinen Freunden, Gott, der mir geholfen hat? ...‹
Solche Gedanken machen demütig. Dann fühlt man sich als Bruder aller derer, die die Kunst lieben und für sie leiden. Vom Niedrigsten zum Höchsten ist der Abstand nicht groß ...
Darüber habe ich bei dem, was Sie mir schrieben, nachgedacht. Sie haben recht: ein Künstler hat nicht die Berechtigung, sich abseits zu halten, solange er anderen zu Hilfe kommen kann. So bleibe ich denn; und ich werde mich zwingen, einige Monate im Jahre, sei es hier, sei es in Wien oder Berlin zu verbringen, obgleich ich mich nur mit Mühe an diese Städte wieder gewöhnen werde. Aber man muß nicht freiwillig abdanken. Gelingt es mir nicht, besonders viel nützen zu können, was ich gute Gründe habe zu fürchten, so wird mein Aufenthalt vielleicht mir selbst dienlich sein. Und ich werde mich mit dem Gedanken trösten, daß Sie es so gewollt haben. Und dann ... (ich will nicht lügen) ... fange ich auch an, daran Vergnügen zu finden. Leben Sie wohl, Sie Tyrannin. Sie triumphieren. Nun bin ich so weit, nicht nur zu tun, was Sie wollen, sondern es sogar gern zu tun.
Christof.«
So blieb er also, teils um ihr zu gefallen, teils aber auch, weil seine einmal erwachte künstlerische Neugierde an dem Schauspiel der sich erneuernden Kunst wieder Freude gewann. Alles, was er auch sah und tat, brachte er in Gedanken Grazia dar. Er schrieb es ihr. Er wußte wohl, daß er das Interesse, das sie daran nahm, sich nur einbildete; er hatte sie im Verdacht, ein wenig gleichgültig zu sein. Aber er war ihr dafür dankbar, daß sie es ihn nicht sehr merken ließ.
Sie antwortete ihm regelmäßig alle vierzehn Tage. So herzlich und maßvoll wie ihre Bewegungen waren ihre Briefe. Wenn sie ihm von ihrem Leben erzählte, trat sie nicht aus ihrer zarten und stolzen Zurückhaltung heraus. Sie wußte, mit welcher Heftigkeit ihre Worte in Christofs Herzen widerhallten. Sie wollte lieber kalt scheinen, als ihn zu einem Gefühlsüberschwang treiben, in dem sie ihm nicht folgen konnte. Aber sie war zu sehr Frau, um nicht das Geheimnis zu verstehen, die Liebe ihres Freundes immer wach zu halten und mit lieben Worten die innerste Enttäuschung gleich wieder zu heilen, die ihre gleichgültigen Worte verursacht hatten. Christof merkte diese Taktik bald; und mit der List der Liebe zwang er sich, seine Gefühlsausbrüche niederzuhalten und maßvollere Briefe zu schreiben, damit Grazias Antworten sich nicht soviel Zwang aufzuerlegen brauchten.
Je mehr er seinen Aufenthalt in Paris verlängerte, desto mehr nahm er an der neuen Betriebsamkeit teil, die den gigantischen Ameisenhaufen aufrührte. Er nahm um so mehr daran teil, je weniger Sympathie er bei den jungen Ameisen für sich selbst fand. Er hatte sich nicht geirrt: sein Erfolg war ein Pyrrhussieg. Nach einer Abwesenheit von zehn Jahren hatte seine Wiederkehr in der Pariser Gesellschaft Aufsehen erregt. Aber durch eine nicht seltene Laune des Schicksals wurde er diesmal von seinen alten Feinden, den Snobs, den Modemenschen, begönnert; die Künstler waren ihm heimlich feind oder mißtrauten ihm. Er imponierte ihnen durch seinen Namen, der schon der Vergangenheit angehörte, durch seine großen Werke, seine leidenschaftlich überzeugte Sprache und seine heftige Wahrheitsliebe. Aber war man auch gezwungen, mit ihm zu rechnen, erzwang er sich auch Bewunderung und Achtung, so verstand man ihn doch schlecht und liebte ihn nicht. Er stand außerhalb der Kunst seiner Zeit. Ein Ungeheuer, ein lebendiger Anachronismus. Er war es immer gewesen. Zehn Jahre der Einsamkeit hätten den Gegensatz noch verschärft. Während seines Fortseins war in Europa und vor allem in Paris, wie er wohl bemerkt hatte, etwas Neues entstanden. Eine neue Weltordnung war da. Eine Generation war herangewachsen, die mehr danach trachtete, zu handeln, als zu verstehen, die mehr nach Glück als nach Wahrheit hungerte. Sie wollte leben, wollte sich des Lebens bemächtigen, wäre es selbst um den Preis der Lüge. Lügen aus Stolz – aus Stolz aller Art: Rassenstolz, Kastenstolz, Stolz auf Religion, auf Kultur und Kunst – dieser Generation war jede Art Lüge willkommen, wenn sie nur einen Eisenpanzer, Schwert und Schild hergab, unter deren Schutz man dem Sieg entgegengehen konnte. So war es ihr auch unangenehm, die große leiderfüllte Stimme zu vernehmen, die sie an das Vorhandensein von Schmerz und Zweifel erinnerte. Die Stürme, die die Nacht, der man kaum entflohen war, gestört hatten, und die trotz allem Leid die Welt noch weiter bedrohten, wollte man vergessen. Es war unmöglich, sie nicht zu hören; man stand ihnen noch zu nahe. Daher wandten sich die jungen Leute voller Unwillen ab und schrien aus vollem Halse, um das, was sie vernahmen, zu übertönen. Aber jene Stimme war lauter. Und sie zürnten ihr darum. Christof dagegen stand ihnen freundschaftlich gegenüber. Er begrüßte den Aufstieg der Welt dem Glück entgegen. Was in diesem Drang freiwillig begrenzt war, störte ihn nicht. Wenn man geradewegs auf ein Ziel losgehen will, darf man nur geradeaus sehen. Er, der am Wendepunkt einer Welt stand, genoß es, hinter sich den tragischen Glanz der Nacht zu sehen und vor sich das Lächeln junger Hoffnung, die ungewisse Schönheit der frischen und fiebernden Morgenröte. Er befand sich im unbeweglichen Aufhängungspunkt des Pendels, während die Uhr wieder zu gehen anfing. Ohne ihrem Lauf zu folgen, vernahm er voller Freude den Rhythmus des Lebens. Er teilte die Hoffnungen derer, die seine früheren Ängste verleugneten. Was kommen sollte, würde kommen, wie er es geträumt hatte. In Nacht und Pein hatte zehn Jahre früher Olivier – der arme, kleine gallische Hahn – mit seinem feinen Sang den fernen Tag verkündet. Der Sänger war nicht mehr. Aber sein Sang verwirklichte sich. Im Garten Frankreichs erwachten die Vögel. Und Christof vernahm plötzlich über allen anderen Stimmen klarer, stärker und beglückter die Stimme des auferstandenen Olivier.
In der Auslage einer Buchhandlung las Christof zerstreut in einem Gedichtband. Der Name des Verfassers war ihm unbekannt. Gewisse Worte fielen ihm auf: sie hielten ihn gefesselt. Je länger er zwischen den unaufgeschnittenen Seiten las, um so mehr schien er darin eine Stimme wiederzuerkennen, Freundeszüge ... Da er sich über seine Gefühle nicht klar werden konnte und sich von dem Buch nicht zu trennen vermochte, kaufte er es. Zu Hause nahm er die Lektüre wieder auf. Und sogleich befiel ihn wieder ein quälender Gedanke. Der ungestüme Atem der Dichtung beschwor mit visionärer Deutlichkeit die ungeheueren und jahrhundertealten Seelen herauf – die gigantischen Bäume, deren Blätter und Früchte wir sind, – die Vaterlande. Die übermenschliche Gestalt der Mutter erstand aus diesen Seiten, sie, die vor uns war, die nach uns sein wird, sie, die da thront wie die byzantinischen Madonnen, erhaben gleich Bergen, zu deren Füßen die menschlichen Ameisen beten. Der Dichter feierte den homerischen Zweikampf jener großen Göttinnen, deren Lanzen seit Anbeginn aller Zeiten aufeinanderprallen: er feierte diese ewige Ilias, die neben der trojanischen das bedeutet, was die Alpenkette neben den kleinen griechischen Hügeln ist.
Ein solcher Heldensang auf Stolz und kriegerische Tat lag den Gedankengängen einer europäischen Seele wie der Christofs sehr fern. Und dennoch sah Christof wie in einer plötzlichen Erleuchtung einen Blick, ein Lächeln, die er kannte, und die er geliebt hatte – angesichts der französischen Seele, der anmutvollen Jungfrau, die die Ägis trägt, der Athene, deren blaue Augen im Dunkeln leuchten, der Arbeitsgöttin, der unvergleichlichen Künstlerin, der überlegenen Vernunft, deren blitzende Lanze die brüllenden Barbaren niederschlägt. Aber im Augenblick, wo er die Vision fassen wollte, zerfloß sie ihm. Und wie er ärgerlich über seine vergebliche Mühe sie noch zu haschen versuchte, las er plötzlich, als er eine Seite umwandte, eine Erzählung, die Olivier ihm wenige Tage vor seinem Tode vorgetragen hatte ...
Das gab ihm einen Stoß. Er lief zu dem Verleger und bat um die Adresse des Dichters. Man verweigerte sie ihm, wie das der Brauch ist. Er wurde wütend. Umsonst. Schließlich fiel ihm ein, daß er die Auskunft in einem Adreßbuch finden würde. Er fand sie wirklich und ging sogleich zu dem Verfasser. Stets noch, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war ihm das Warten schwer geworden.
Im Batignollesviertel war es; in einem obersten Stockwerk. Mehrere Türen gingen auf einen gemeinsamen Flur. Christof klopfte an die, die man ihm bezeichnet hatte. Die Nebentür öffnete sich. Eine unschöne, sehr dunkle junge Frau, mit in die Stirn gekämmten Haaren, unreiner Haut, zusammengeschrumpftem Gesicht und lebhaften Augen fragte, was er wolle. Sie sah mißtrauisch aus. Christof nannte den Grund seines Besuches und auf eine neue Frage hin seinen Namen. Sie trat aus ihrer Wohnung heraus und öffnete die Nachbartür mit einem Schlüssel, den sie bei sich trug. Aber sie ließ Christof nicht sogleich eintreten. Sie sagte, Christof möge im Flur warten, und ging allein hinein, während sie ihm die Türe vor der Nase zuschlug. Schließlich wurde Christof der Eintritt in die wohlbewahrte Behausung gewährt. Er durchschritt einen halbleeren Raum, der als Eßzimmer diente. Einige zerschlissene Möbel standen herum. Nahe bei dem vorhanglosen Fenster schrien ein Dutzend Vögel in einem großen Bauer. Im Nebenzimmer lag auf einem fadenscheinigen Divan ein Mann. Er stand auf, um Christof zu begrüßen. Dieses abgezehrte Gesicht, das von der Seele, den schönen samtenen Augen, in denen eine fiebernde Flamme glühte, durchleuchtet war, diese langen, geistvollen Hände, diesen mißgestalten Körper, diese scharfe, heisere Stimme ... Christof erkannte das alles sofort ... Emanuel! Der kleine verkrüppelte Arbeiter, der die unschuldige Ursache gewesen war ... Und Emanuel, der mit einem Ruck aufgestanden war, hatte Christof ebenfalls erkannt.
Sie blieben wortlos stehen. Beide sahen in diesem Augenblick Olivier ... Sie brachten es über sich, einander die Hand zu geben. Emanuel hatte eine abwehrende Bewegung gemacht. Nach zehn Jahren noch stieg ein uneingestandener Groll, die alte Eifersucht, die er gegen Christof empfunden hatte, aus dem dunklen Untergrund seines Bewußtseins empor. Mißtrauisch und feindselig blieb er stehen. – Doch als er die Erregung Christofs sah, als er von dessen Lippen den Namen las, an den sie beide dachten: »Olivier!« ... übermannte es ihn: er warf sich in die Arme, die sich ihm entgegenstreckten.
Emanuel fragte:
»Ich wußte, daß Sie in Paris seien. Aber wie konnten Sie mich finden!«
Christof sagte:
»Ich habe Ihr letztes Buch gelesen; aus ihm vernahm ich seine Stimme.«
»Nicht wahr,« meinte Emanuel, »Sie haben sie wiedererkannt! Alles, was ich jetzt bin, verdanke ich ihm.«
(Er vermied es, den Namen auszusprechen.)
Nach einem Augenblick führ er düster fort:
»Er liebte Sie mehr als mich.«
Christof lächelte:
»Wer recht liebt, kennt kein mehr oder weniger; er gibt allen, die er liebt, alles.«
Emanuel schaute Christof an; der tragische Ernst seiner eigensinnigen Augen wurde plötzlich von einer tiefen Milde durchleuchtet. Er nahm Christofs Hand und ließ ihn neben sich auf dem Divan Platz nehmen.
Sie erzählten sich von ihrem Leben. Vom vierzehnten bis zum fünfundzwanzigsten Jahre hatte Emanuel mancherlei Berufe gehabt: als Buchdrucker, Tapezierer, kleiner Hausierer, Buchhandlungsgehilfe, Kanzleischreiber, Sekretär eines Politikers, Journalist ... Überall hatte er Mittel und Wege gefunden, fieberhaft zu lernen; hie und da hatten ihn gute Menschen, die von der Energie des kleinen Mannes überrascht waren, unterstützt. Öfters noch fiel er Leuten in die Hände, die sein Elend und seine Gaben ausbeuteten; er bereicherte sich an den schlimmsten Erfahrungen, und es gelang ihm, ohne allzu große Bitterkeit daraus hervorzugehen; nur den Rest seiner kargen Gesundheit ließ er dabei zurück. Sein eigentümlicher Hang für alte Sprachen (der bei einer mit humanistischen Traditionen vollgesogenen Rasse seltener ist, als man annehmen sollte) hatte ihm die Teilnahme eines alten Priesters eingetragen, der sich mit dem Studium des Griechischen befaßte. Solche Studien, die er aus Zeitmangel nicht sehr weit treiben konnte, dienten ihm zur geistigen Zucht und zur Stilschulung. Dieser Mann, der aus der Hefe des Volkes stammte, der sich seine ganze Bildung, die ungeheure Lücken aufwies, wahllos selbst angeeignet, hatte im sprachlichen Ausdruck eine Fertigkeit und eine Beherrschung der Form erworben, die zehn Jahre Universitätserziehung der bürgerlichen Jugend nicht geben können. Er wies das Verdienst daran Olivier zu. Andere hatten indessen wirksamer mitgeholfen. Aber von Olivier stammte der Funke, der sich in der Nacht dieser Seele entzündet hatte, von ihm stammte das ewige Licht. Die anderen hatten nur Öl in die Lampe gegossen.
Er sagte:
»Ich habe ihn erst von dem Augenblick an begriffen, als er von dannen ging. Aber alles, was er zu mir gesprochen hat, war tief in mich eingedrungen. Sein Licht ist niemals in mir erloschen.«
Er sprach von seinem Lebenswerk, von der Aufgabe, die ihm, wie er behauptete, Olivier hinterlassen hatte, von dem Erwachen der französischen Kräfte, von dem Fackelschein eines heldenhaften Idealismus, dessen Verkünder Olivier war. Er wollte seine tönende Stimme werden, die über dem Kampf schwebt und den nahen Sieg kündet, er sang das Heldenlied seiner, zu neuem Leben erweckten, Rasse.
Seine Gedichte waren ganz die Frucht dieser seltsamen Rasse, die durch Jahrhunderte hindurch ihren alten keltischen Duft völlig bewahrt hat, obgleich sie einen wunderlichen Stolz darein setzt, ihr Denken mit dem schäbigen Plunder und den Gesetzen des römischen Eroberers zu behängen.
Ganz unverfälscht fand man in ihm jene gallische Kühnheit wieder, jenen Geist heldenhafter Gerechtigkeit und Ironie, das Gemisch von Großsprecherei und tollem Draufgängertum derer, die die römischen Senatoren am Barte zupften, den Tempel von Delphi ausplünderten und lachend ihre Wurfspieße gegen den Himmel schleuderten. Aber genau wie es seine perückentragenden Großväter getan hatten und wie es zweifellos seine Ur-Urneffen tun würden, hatte dieser kleine Pariser Flickschuster seine Leidenschaften in den Gestalten der vor zweitausend Jahren verstorbenen Helden und Götter Griechenlands verlebendigen müssen. Sonderbarer Instinkt dieses Volkes, der mit seinem Streben nach dem Unbedingten zusammenfällt: wenn es sein Denken auf den Spuren der Jahrhunderte ruhen läßt, ist es ihm, als präge es sein Denken den Jahrhunderten auf. Der Zwang dieser klassischen Form gab den Leidenschaften Emanuels nur einen um so gewaltigeren Schwung. Das ruhige Vertrauen Oliviers in das Schicksal Frankreichs hatte sich bei seinem kleinen Schützling in einen glühenden Glauben verwandelt, der tatensicher und des Sieges gewiß war. Er wollte den Sieg, er sah ihn, er rief ihn aus. Gerade durch diesen begeisterten Glauben und durch diesen Optimismus hatte er die Seele des französischen Publikums mitgerissen. Sein Buch hatte wie eine Schlacht gewirkt. Er hatte in die Zweifelsucht und Furcht eine Bresche geschlagen. Die ganze junge Generation hatte sich in seine Gefolgschaft gedrängt, neuen Schicksalen entgegen ...
Es kam Leben in ihn, wenn er redete; seine Augen glühten, sein bleiches Gesicht bedeckte sich mit rosa Flecken, und seine Stimme wurde kreischend. Christof fiel unwillkürlich der Gegensatz zwischen diesem verzehrenden Feuer und dem elenden Körper auf, der jenem als Scheiterhaufen diente. Er ließ die herzbewegende Ironie dieses Schicksals nur ahnen. Der Sänger der Tatkraft, der Dichter, der die Generation des kühnen Sports, der Tat, des Krieges feierte, konnte selbst kaum ohne Keuchen gehen, war nüchtern, hielt eine strenge Diät, trank Wasser, konnte nicht rauchen, lebte ohne Liebschaften, trug alle Leidenschaften in sich und war durch seine schwache Gesundheit zum Asketentum verdammt.
Christof beobachtete Emanuel und empfand ein Gemisch von Bewunderung und brüderlichem Mitgefühl für ihn. Er wollte davon nichts merken lassen; aber wahrscheinlich verrieten seine Augen etwas davon, oder der Stolz Emanuels, der an der Seite eine immer blutende Wunde trug, meinte in Christofs Augen Mitleid zu lesen, das ihm widerwärtiger als Haß war. Plötzlich sank sein Feuer in sich zusammen. Er hörte zu reden auf. Christof versuchte vergeblich, sein Vertrauen neu zu beleben. Seine Seele hatte sich wieder verschlossen. Christof sah, daß er ihn verletzt hatte.
Das feindliche Schweigen dauerte fort. Christof stand auf. Emanuel begleitete ihn stumm zur Türe. Sein Gang betonte noch seine Gebrechlichkeit; er wußte es; er setzte seinen Stolz darein, dagegen gleichgültig zu erscheinen; aber er meinte, daß Christof ihn beobachte, und sein Groll verschärfte sich deswegen.
In dem Augenblick, als er seinem Gaste kühl die Hand gab, um ihn zu verabschieden, klingelte eine elegante junge Dame an der Türe. Sie war von einem jungen Gecken begleitet, den Christof als jemanden wiedererkannte, den er bei den Theaterpremièren bemerkt hatte, wo er lachte, schwatzte, mit der Hand grüßte, den Damen die Hand küßte und von seinem Parkettplatz aus bis in die hintersten Winkel des Theaters Lächeln spendete; da er seinen Namen nicht kannte, nannte er ihn »den Gimpel«. – Der »Gimpel« und seine Begleiterin stürzten sich beim Anblick Emanuels mit schmeichlerischem und vertraulichem Überschwang auf den »teuren Meister«. Christof hörte im Fortgehen, wie Emanuel mit trockenem Ton antwortete, daß er nicht empfangen könne, da er beschäftigt sei. Er bewunderte die Fähigkeit dieses Menschen, unhöflich zu sein. Er kannte die Gründe nicht, warum er sich den reichen Snobs gegenüber, die ihn mit ihren zudringlichen Besuchen auszeichneten, so abweisend verhielt: sie waren mit schönen Phrasen und Lobhudeleien verschwenderisch; aber sie bemühten sich deswegen durchaus nicht, ihm sein Elend zu erleichtern, wie die berühmten Freunde César Francks, die nie versuchten, ihn von seinen Klavierstunden zu befreien, die er bis zum letzten Tage geben mußte, um leben zu können.
Christof kam mehrere Male zu Emanuel zurück. Es gelang ihm nicht mehr, die Vertraulichkeit des ersten Besuches wieder erstehen zu lassen. Emanuel zeigte keinerlei Vergnügen, wenn er ihn sah, und bewahrte mißtrauische Zurückhaltung. In manchen Augenblicken riß ihn das großherzige Mitteilungsbedürfnis seines Genius fort. Irgend ein Wort Christofs rührte ihn im Innersten auf; dann gab er sich einer Anwandlung von begeistertem Vertrauen hin, und sein Idealismus warf die glänzenden Lichter leuchtender Poesie in seine verborgene Seele. Plötzlich aber sank er in sich zusammen, zog sich in mürrisches Schweigen zurück, und Christof sah wieder den Feind vor sich.
Allzu vieles trennte sie. Ihr Altersunterschied war nicht das Geringste. Christof ging der vollen Bewußtheit und der Beherrschung seiner selbst entgegen. Emanuel war noch in der Entwicklung begriffen und verwirrter als Christof jemals gewesen war. Die Einzigartigkeit seiner Erscheinung lag in den widersprechenden Elementen, die in ihm miteinander stritten: ein starker Stoizismus, der eine von atavistischen Begierden zerfressene Natur zu beherrschen suchte – ihn, den Sohn einer Prostituierten und eines Alkoholikers –, eine rasende Phantasie, die sich unter der Kandare eines stahlharten Willens bäumte; eine ungeheure Selbstsucht, und eine grenzenlose Liebe zu anderen, (man wußte nicht, welche von beiden einmal siegen würde); ein heldenhafter Idealismus und eine krankhafte Gier nach Ruhm, die ihn anderen hervorragenden Geistern gegenüber unsicher machte. Wenn sich auch Oliviers Denken, seine Unabhängigkeit und Uneigennützigkeit in ihm wiederfanden, wenn Emanuel seinem Lehrer durch plebejische Lebenskraft überlegen war, die nicht den Ekel vor dem Handeln kennt, auch durch die dichterische Begabung und durch seine rauhe Schale, die ihn gegen alle Widrigkeiten schützte, so war er doch weit von der heiteren Milde entfernt, die Antoinettes Bruder besessen hatte; sein Charakter war eitel und unruhig, und die Verwirrungen anderer Wesen vermehrten nur seine eigenen.
Er lebte in einer stürmischen Verbindung mit der jungen Frau, die seine Nachbarin war: dieselbe, die Christof bei seinem ersten Besuch empfangen hatte. Sie liebte Emanuel und kümmerte sich eifersüchtig um ihn, besorgte ihm die Wirtschaft, schrieb seine Werke ins Reine oder ließ sie sich von ihm diktieren. Sie war nicht schön und trug die Bürde einer leidenschaftlichen Seele. Sie stammte aus dem Volke, war lange Zeit Arbeiterin in einer Pappfabrik, dann Postbeamtin gewesen, und hatte eine bedrängte Kindheit in den üblichen Verhältnissen einer armen Pariser Arbeiterfamilie verbracht; Seele und Körper werden hier zusammengepfercht, bei aufreibender Arbeit, beständiger Promiskuität, ohne Luft, ohne Stille, ohne Alleinsein mit sich selbst, unfähig, sich zu sammeln, unfähig, die heiligen Tiefen des Herzens zu verteidigen. Da sie stolzen Geistes war und von religiöser Glut für ein verworrenes Wahrheitsideal erfüllt, hatte sie sich die Augen damit verdorben, nachts, und oft ohne Licht bei Mondschein, » Les Misérables« von Hugo abzuschreiben. Sie war Emanuel begegnet zu einer Zeit, in der er unglücklicher als sie, krank und ohne jede Hilfe war, und sie hatte sich ihm vollständig gewidmet. Diese Liebe war die erste und einzige Leidenschaft ihres Lebens. So hängte sie sich denn mit der Zähigkeit einer Verdurstenden an ihn. Ihre Anhänglichkeit war für Emanuel entsetzlich drückend; denn er teilte sie weniger, als er sie ertrug. Er war von ihrer Hingebung gerührt; er wußte, daß sie die beste Freundin sei, das einzige Wesen, für das er alles bedeutete, und das nicht ohne ihn leben konnte. Aber gerade dieses Gefühl lastete auf ihm. Er brauchte Freiheit und Einsamkeit; diese Augen, die gierig um einen Blick bettelten, quälten ihn; er sprach hart mit ihr; er hatte manchmal Lust, zu sagen: »Mach, daß du fortkommst.« Er wurde durch ihre Häßlichkeit und ihr heftiges Wesen gereizt. So wenig er in die gute Gesellschaft hineingeschaut hatte und soviel Verachtung er auch für sie bezeigte, (denn er litt darunter, daß er dort noch häßlicher und lächerlicher aussah), so war er doch für Vornehmheit empfänglich, fühlte sich von Frauen angezogen, die für ihn (er zweifelte nicht daran) Empfindungen hegten wie er für seine Freundin. Er suchte, dieser eine Zuneigung zu zeigen, die er nicht empfand oder die doch zum mindesten von plötzlich und unwillkürlich aufschnellendem Haß verdunkelt wurde. Es gelang ihm nicht; er trug in seiner Brust ein großes, edles Herz, das sich danach sehnte, das Gute zu tun, und gleichzeitig einen Dämon von Leidenschaft, der fähig war, das Böse zu tun. Dieser innere Kampf und das Bewußtsein, daß er ihn nicht siegreich beenden könne, erfüllten ihn mit dumpfer Gereiztheit, deren Spitzen Christof zu fühlen bekam.
Emanuel konnte sich Christof gegenüber einer doppelten Abneigung nicht erwehren: der einen, die aus seiner alten Eifersucht stammte (denn der Trieb der Kinderleidenschaften bleibt bestehen, selbst wenn man seine Ursachen vergessen hat); der anderen, die aus seinem glühenden Nationalbewußtsein hervorging. Er sah in Frankreich alle Träume von der Gerechtigkeit, dem Mitleid und der Verbrüderung der Menschen verwirklicht, so wie sie die Besten der vorhergehenden Epoche aufgefaßt hatten. Er stellte Frankreich nicht dem übrigen Europa gegenüber wie eine Feindin, deren Glück auf den Ruinen der anderen Nationen erblüht; er stellte es an ihre Spitze als die angestammte Herrscherin, die zum Besten aller regiert – als das Schwert der Vollkommenheit, als die Führerin des Menschengeschlechts. Ehe er Frankreich hätte eine Ungerechtigkeit begehen sehen, hätte er es lieber vernichtet gewünscht. Aber er zweifelte nicht an ihm. Er war ausschließlich Franzose, der Kultur und dem Herzen nach, einzig von französischer Überlieferung genährt, deren tiefe Richtigkeit ihm sein Instinkt bestätigte. Er wollte aus reiner Aufrichtigkeit die fremdländische Gedankenwelt nicht kennen und empfand für sie eine Art verächtlicher Herablassung – Ärger jedoch, wenn der Fremde diese demütigende Lage nicht anerkannte.
Christof sah das alles auch. Aber er war kälter, und das Leben hatte ihn mehr gelehrt; so regte er sich darüber nicht auf. Wenn dieser Rassenstolz auch immer wieder verletzend war, so wurde Christof davon nicht betroffen; er hielt ihm die Vorurteile der Sohnesliebe zugute, und es kam ihm nicht in den Sinn, die Übertreibungen eines heiligen Gefühls zu verurteilen. Im übrigen gereicht es der Menschheit selbst nur zum Vorteil, wenn die Völker von eitel Glauben an ihre Mission erfüllt sind. Von allen Ursachen, die er hatte, sich Emanuel fern zu fühlen, war ihm eine einzige peinlich. Das war seine Stimme, die manchmal in überschrille Töne umschlug. Christofs Ohr litt grausam darunter. Er konnte sich nicht enthalten, Grimassen zu schneiden. Er tat alles, damit Emanuel sie nicht sähe. Er bemühte sich, die Musik und nicht das Instrument zu hören. Aus dem mißgestalteten Dichter strahlte eine unendlich heldenhafte Schönheit, wenn er von den geistigen Siegen sprach, die anderen Siegen vorausgehen, von der Eroberung der Luft, vom »fliegenden Gott«, der die Menge mit sich riß und sie gleich dem Stern von Bethlehem in seine Gefolgschaft bannte, so daß sie verzückt in unbekannte Fernen zog oder irgend einer nahen Vergeltung entgegen. Der Glanz dieser Gesichte von kraftvollen Taten hinderte Christof nicht, ihre Gefahr zu erkennen und vorauszusehen, wohin dieser Sturmschritt und die wachsende Tonstärke dieser neuen Marseillaise führte. Er dachte ein wenig ironisch (ohne Sehnsucht nach der Vergangenheit, noch in Furcht vor der Zukunft), daß dieser Sang Echos hervorrufen werde, die der Vorsänger nicht voraussah, und daß ein Tag kommen würde, an dem die Menschen nach der entschwundenen Zeit des Jahrmarktes zurückseufzen würden ... Wie frei war man damals! Das goldene Zeitalter der Freiheit. Niemals würde es wieder Ähnliches geben. Die Welt war auf dem Wege zu einem Zeitalter der Kraft, der Gesundheit, der männlichen Tat und vielleicht des Ruhmes, aber harter Herrschaft und straffer Ordnung. Unsere Wünsche werden es endlich herbeigerufen haben, das eherne Zeitalter, die klassische Zeit! Die großen klassischen Zeitalter, – das Ludwigs XlV. oder Napoleons – scheinen uns aus der Ferne wie die Gipfel der Menschheit. Und vielleicht verwirklicht in ihnen die Nation am siegreichsten ihr Staatsideal. Aber fragt einmal die Helden jener Zeit, was sie von ihr gedacht haben! Euer Nicolas Poussin ist fortgegangen, um in Rom zu leben und zu sterben. Er erstickte zu Hause. Euer Pascal, euer Racine haben der Welt Lebewohl gesagt. Und wieviel andere unter den Größten haben abseits gelebt, in Ungnade, unterdrückt! Selbst die Seele eines Molière barg viel Bitternis. Und was euren Napoleon betrifft, den ihr so sehr zurücksehnt, so scheinen eure Väter von ihrem Glück keine Ahnung gehabt zu haben; und der Herrscher selber hat sich nichts vorgetäuscht; er wußte, daß die Welt bei seinem Verschwinden aufatmen würde ... Welche Gedankenwüste rings um den Imperator! Die afrikanische Sonne über unendlichen Sandstrecken ...
Christof sprach nicht alles aus, was er bei sich erwog. Ein paar Andeutungen hatten genügt, um Emanuel in Wut zu bringen. Er hatte nicht wieder angefangen; aber wenn er seine Gedanken auch ganz für sich behielt, so wußte Emanuel doch, daß er sie dachte. Mehr noch. Er war sich dunkel bewußt, daß Christof weiterblickte als er und war deswegen nur noch mehr gereizt. Junge Leute verzeihen es den älteren nicht, wenn sie sie zu sehen zwingen, was sie in zwanzig Jahren sein werden.
Christof las in seinem Herzen und sagte sich:
»Er hat recht. Jeder hat seinen Glauben für sich. Man muß glauben, was man glaubt. Gott bewahre mich, daß ich sein Vertrauen in die Zukunft erschüttere.«
Aber seine bloße Gegenwart war schon ein Grund zur Beunruhigung. Wenn zwei Persönlichkeiten zusammen sind, so mögen sich beide noch so sehr bemühen, bescheiden zurückzutreten, eine von beiden wird immer die andere erdrücken. Und die andere ist gedemütigt und trägt ihr das nach. Emanuels Stolz litt unter Christofs Überlegenheit an Erfahrung und Charakter. Und vielleicht wehrte er sich gegen die Liebe, die er in sich für ihn wachsen fühlte ...
Er wurde immer scheuer. Er verschloß seine Tür. Er antwortete ihm nicht auf seine Briefe. – Christof mußte darauf verzichten, ihn zu sehen.
Es war in den ersten Tagen des Juli. Christof überschlug, was ihm diese wenigen Monate eingetragen hatten: viel neue Ideen, aber wenig Freunde. Glänzende und spottschlechte Freunde. Glänzende und spottschlechte Erfolge: es ist nicht erfreulich, sein Bild und das Bild seines Lebenswerkes bläßlich oder entstellt in unbedeutenden Gehirnen wiederzufinden. Und wo er gern verstanden sein wollte, fand er keine Sympathie; dort hatte man sein Entgegenkommen nicht gut aufgenommen; er kam mit diesen Menschen nicht zusammen, so sehr er auch wünschte, an ihren Hoffnungen teilzuhaben, ihr Verbündeter zu werden; es war, als wehre sich ihre empfindliche Eigenliebe gegen seine Freundschaft und fände mehr Befriedigung darin, ihn zum Feinde zu haben. Kurz, er hatte den Strom seiner Generation vorbeifließen lassen, ohne mit ihm zu gehen; und der Strom der folgenden Generation wollte von ihm nichts wissen. Er war einsam und wunderte sich nicht darüber; denn er war sein Leben lang daran gewöhnt gewesen. Aber er fand, daß er nach diesem neuen Versuch jetzt das Recht erworben hätte, in seine Schweizer Einsiedelei zurückzukehren und dort abzuwarten, daß sich ein Plan verwirkliche, der seit kurzem etwas mehr Gestalt in ihm annahm. Je älter er wurde, um so mehr quälte ihn der Wunsch, sich wieder in seinem Vaterlande festzusetzen. Er kannte dort niemanden mehr, er fand dort sicher noch weniger geistige Verwandtschaft als in dieser fremden Stadt. Aber es war nichtsdestoweniger das Vaterland: man verlangt von Blutsverwandten nicht, daß sie wie man selbst denken sollen; zwischen ihnen und uns bestehen tausend geheime Bande; die Sinne haben gelernt, im selben Buche des Himmels und der Erde zu lesen, das Herz spricht dieselbe Sprache.
Er erzählte Grazia fröhlich von seinen Enttäuschungen und teilte ihr seine Absicht mit, nach der Schweiz zurückzukehren; er bat sie scherzend um Erlaubnis, Paris zu verlassen, und setzte seine Abreise für die folgende Woche fest. Aber am Schlusse des Briefes sagte eine Nachschrift:
»Ich habe meine Absicht geändert. Meine Reise ist aufgeschoben.«
Christof hatte zu Grazia unbedingtes Vertrauen; er offenbarte ihr das Geheimnis seiner tiefsten Gedanken. Und doch gab es eine Kammer in seinem Herzen, zu der er den Schlüssel verbarg. Das waren die Erinnerungen, die nicht ihm allein gehörten, sondern denen, die er geliebt hatte. So schwieg er über das, was Olivier betraf. Seine Zurückhaltung war nicht beabsichtigt. Die Worte wollten ihm nicht über die Lippen, wenn er von Olivier zu Grazia sprechen wollte. Sie hatte ihn nicht gekannt.
An diesem Morgen nun, gerade als er an seine Freundin schrieb, klopfte es an seine Tür. Er ging öffnen, während er darüber fluchte, daß er gestört wurde. Ein junger Bursche zwischen vierzehn und fünfzehn Jahren fragte nach Herrn Krafft. Griesgrämig ließ ihn Christof eintreten. Er war blond, hatte blaue Augen, feine Züge, war nicht sehr groß, hatte eine schmale und aufrechte Gestalt. Wortlos und etwas eingeschüchtert stand er vor Christof. Sehr schnell aber raffte er sich zusammen und hob seine klaren Augen zu ihm empor, die Christof voller Neugierde betrachteten. Christof lächelte, als er das reizende Gesicht anschaute; und der junge Bursche lächelte auch.
»Nun,« meinte Christof, »was wollen Sie?«
»Ich bin gekommen,« sagte das Kind ...
(Es wurde von neuem verwirrt, errötete und schwieg.)
»Ich sehe wohl, daß Sie gekommen sind,« meinte Christof lachend. »Aber warum sind Sie gekommen? Schauen Sie mich an, haben Sie vielleicht Angst vor mir?«
Der junge Bursche fand sein Lächeln wieder, schüttelte den Kopf und sagte:
»Nein.«
»Bravo! Also sagen Sie mir zunächst einmal, wer Sie sind.«
»Ich bin,« sagte das Kind ...
Es stockte noch einmal. Seine Augen, die neugierig im Zimmer umherwanderten, hatten eben auf Christofs Kamin Oliviers Bild entdeckt. Christof folgte mechanisch der Richtung seines Blickes.
»Nun!« sagte er, »Mut!«
Das Kind sagte:
»Ich bin sein Sohn.«
Christof fuhr auf. Er sprang vom Stuhl empor, ergriff den jungen Menschen an beiden Armen und zog ihn an sich; er sank auf seinen Stuhl zurück und hielt den Knaben fest umklammert. Ihre Gesichter berührten sich fast; und er schaute ihn an, schaute ihn lange, lange an, und wiederholte in einem fort:
»Lieber Junge ... mein armer Junge ...«
Plötzlich nahm er seinen Kopf zwischen die Hände und küßte ihn auf die Stirn, die Augen, die Wangen, auf die Nase, auf die Haare. Der junge Bursche war erschreckt und von der Heftigkeit dieser Ausbrüche etwas unangenehm berührt und machte sich aus Christofs Armen los. Christof ließ ihn. Er barg sein Gesicht in den Händen, lehnte die Stirn gegen die Wand und blieb so einige Augenblicke stehen. Der Kleine hatte sich weiter in das Zimmer zurückgezogen. Christof hob den Kopf. Sein Gesicht hatte sich beruhigt. Er schaute das Kind mit zärtlichem Lächeln an:
»Ich habe dich erschreckt,« sagte er. »Verzeih'. Es kommt daher, siehst du, weil ich ihn so lieb gehabt habe.«
Der Kleine war noch immer scheu und schwieg.
»Wie ähnlich du ihm bist ...« sagte Christof. »Und doch hätte ich dich nicht erkannt. Was ist an dir nur anders?«
Er fragte:
»Wie heißt du?«
»Georg.«
»Ach richtig. Christof-Olivier-Georg. Ich erinnere mich. Und wie alt bist du?«
»Vierzehn Jahre.«
»Vierzehn Jahre? Solange ist es schon her? ... Mir ist, als wäre es gestern gewesen – oder in der Nacht aller Zeiten ... Wie ähnlich du ihm bist! Es sind dieselben Züge. Derselbe und doch ein anderer. Dieselbe Farbe der Augen und doch nicht dieselben Augen, dasselbe Lächeln, derselbe Mund, doch nicht derselbe Klang in der Stimme. Du bist stärker, du hältst dich aufrechter. Du hast ein volleres Gesicht, aber du errötest wie er. Komm, setz dich, wir wollen plaudern. Wer hat dich zu mir geschickt?«
»Niemand.«
»Du bist von selbst gekommen? Woher kennst du mich?«
»Man hat mir von Ihnen erzählt.«
»Wer?«
»Meine Mutter.«
»Ach!« meinte Christof. »Weiß sie, daß du zu mir gegangen bist?«
»Nein.«
Christof schwieg einen Augenblick; dann fragte er:
»Wo wohnt ihr?«
»Am Monceau-Park.«
»Bist du zu Fuß gekommen? Ja? Das ist ein weiter Weg; du wirst müde sein.«
»Ich bin niemals müde.«
»Das ist ja famos! Zeige mir deine Arme!«
Er befühlte sie.
»Du bist ein strammer kleiner Bengel ... Und wie bist du auf den Gedanken gekommen, mich zu besuchen?«
»Weil Papa Sie mehr als alles auf der Welt liebte.«
»Hat sie dir das gesagt?« (Er verbesserte sich.) »Hat deine Mutter dir das gesagt?«
»Ja.«
Christof lächelte nachdenklich. Er dachte:
»Sie auch! ... Wie sie ihn alle liebten! Warum haben sie es ihm denn nicht gezeigt? ...«
Er fuhr fort:
»Warum hast du so lange gewartet, bis du zu mir kamst?«
»Ich wollte schon früher kommen. Aber ich glaubte, Sie wollten nichts von mir wissen.«
»Ich!«
»Vor ein paar Wochen habe ich Sie in den Chevillard-Konzerten gesehen; ich saß mit meiner Mutter ein paar Plätze von Ihnen entfernt; ich grüßte Sie; Sie sahen mich böse an, runzelten die Brauen und erwiderten meinen Gruß nicht.«
»Ich hätte dich angesehen? ... Mein lieber Junge; das konntest du dir einbilden? Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe schlechte Augen, darum runzele ich die Brauen ... Hältst du wich also für böse?«
»Ich glaube, daß Sie es auch sein können, wenn Sie wollen.«
»Wirklich?« sagte Christof. »Wenn du aber glaubtest, daß ich nichts von dir wissen wolle, wie hast du es trotzdem gewagt herzukommen?«
»Aber ich wollte Sie doch kennen lernen.«
»Und wenn ich dich vor die Türe gesetzt hätte?«
»Ich hätte es mir nicht gefallen lassen.«
Das sagte er mit einer kindlichen Miene, die gleichzeitig bestimmt, verlegen und herausfordernd war.
Christof brach in Lachen aus und Georg ebenfalls.
»Du hättest wohl mich vor die Türe gesetzt? ... Höre einer das an! Was für ein Draufgänger! ... Nein, wirklich, du gleichst deinem Vater nicht.«
Das bewegliche Gesicht des jungen Burschen verdüsterte sich.
»Sie finden, daß ich ihm nicht gleiche? Aber sie sagten doch noch eben ...? So glauben Sie also, er hätte mich nicht lieb gehabt? So haben Sie mich also auch nicht lieb?«
»Was kann dir denn daran liegen, ob ich dich liebe?«
»Mir liegt sehr viel daran.«
»Warum?«
»Weil ich Sie liebe.«
In einer Minute zeigten seine Augen, sein Mund, alle seine Züge zehn verschiedene Ausdrücke, wie wenn an einem Apriltage der Schatten der Wolken unter dem Hauch der Frühlingswinde über die Felder läuft. Christof empfand eine wundersame Freude, wenn er ihn ansah, ihm zuhörte; ihm war, als wären alle vergangenen Sorgen von ihm weggespült. Seine trüben Erfahrungen, seine Schicksale, seine Leiden und die Oliviers, alles war ausgelöscht: er war wie neuerstanden in dem jungen Reis vom Leben Oliviers.
Sie plauderten. Georg hatte bis in die letzten Monate nichts von Christofs Musik gekannt; seit Christof in Paris war, versäumte er kein Konzert, in dem man seine Werke spielte. Er sprach davon mit lebhaftem Gesicht, mit glänzenden, lachenden Augen und war dabei doch dem Weinen nahe wie ein Verliebter. Er vertraute Christof an, daß er Musik über alles liebe und daß er sie auch studieren wolle. Aber Christof merkte nach wenigen Fragen, daß der Kleine keine Ahnung von ihren Grundzügen hatte. Er erkundigte sich nach seiner Schule. Der junge Jeannin besuchte das Gymnasium; er sagte fröhlich, er sei kein berühmter Schüler.
»Worin bist du am besten? In den humanistischen oder den exakten Fächern?«
»Es ist überall so ziemlich dasselbe.«
»Aber wieso denn? Wieso denn? Du wirst doch kein Faulpelz sein?«
Er lachte offen und sagte:
»Ich glaube doch.«
Dann fügte er vertrauensvoll hinzu:
»Ich weiß aber im Grunde ganz gut, daß ich keiner bin.«
Christof konnte sich nicht enthalten, zu lachen:
»Also, warum arbeitest du nicht? Interessiert dich nichts?«
»Im Gegenteil! Alles interessiert mich!«
»Nun also, was ist es dann?«
»Alles ist interessant. Man hat keine Zeit ...«
»Du hast keine Zeit? Was zum Teufel tust du denn?«
Georg machte eine unbestimmte Bewegung:
»Sehr viel. Ich treibe Musik, Sport, gehe in die Ausstellungen, ich lese ...«
»Du tätest besser, deine Schulbücher zu lesen.«
»In der Schule liest man niemals etwas Interessantes. Und dann reisen wir. Letzten Monat war ich in England, um das Match zwischen Oxford und Cambridge zu sehen.«
»Das muß dich in der Schule sehr vorwärts bringen!«
»Bah! Dabei lernt man mehr, als wenn man im Gymnasium hockt.«
»Und was sagt deine Mutter zu alledem?«
»Meine Mutter ist sehr vernünftig. Sie tut alles, was ich will.«
»Kleiner Strick! Du kannst von Glück sagen, daß du mich nicht zum Vater hast.«
»Sie könnten dann sicher nicht von Glück sagen!«
Es war unmöglich, seiner Schmeichelmiene zu widerstehen.
»Sag einmal, Weltreisender,« meinte Christof, »kennst du mein Vaterland?«
»Ja.«
»Ich bin sicher, du kannst kein Wort Deutsch.«
»Ich kann es im Gegenteil sehr gut.«
»Laß einmal hören.«
Sie fingen an, sich deutsch zu unterhalten. Der Kleine redete mit drolliger Sicherheit ein höchst fehlerhaftes Kauderwelsch; da er sehr intelligent und aufgeweckt war, erriet er mehr, als er verstand. Er riet oft verkehrt und lachte dann selbst zuerst über seine Schnitzer. Er erzählte voller Eifer von seinen Reisen und von Büchern, die er kannte. Er hatte viel, aber hastig und oberflächlich gelesen, wobei er halbe Seiten ausgelassen und dann das nicht Gelesene dazu erfunden hatte. Immer aber spornte ihn eine lebhafte und frische Neugierde an, die überall nach Anlaß zur Begeisterung fahndete. Er sprang von einem Gegenstand zum anderen und sein Gesicht belebte sich, wenn er von Schauspielen oder Werken sprach, die ihn gerührt hatten. Was er kannte, stand in keinerlei Beziehung zueinander. Man verstand nicht, weshalb er ein Buch zehnten Ranges gelesen hatte – und von den berühmten Werken nichts wußte.
»Alles das ist recht hübsch,« sagte Christof, »aber du wirst es zu nichts bringen, wenn du nicht arbeitest.«
»O, das brauche ich nicht, wir sind reich.«
»Teufel, nun wird es ernst. Du willst ein Mensch werden, der zu nichts taugt, der nichts tut?«
»Im Gegenteil, ich will alles tun, es ist zu dumm, wenn man sich sein ganzes Leben lang in einen Beruf einzwängt.«
»Das ist immer noch die einzige Art und Weise, die man gefunden hat, um etwas darin zu leisten.«
»Das sagt man so!«
»Was heißt das? ... »Man sagt so« ... Ich, mein Junge, sage das! Jetzt studiere ich seit vierzig Jahren meinen Beruf und ich fange gerade an, ihn zu verstehen.«
»Vierzig Jahre, um seinen Beruf zu erlernen! Und wann kann man ihn dann ausüben?«
Christof mußte lachen:
»Kleiner logischer Franzose!«
»Ich möchte Musiker sein,« sagte Georg.
»Schön. Es ist hohe Zeit, daß du anfängst. Soll ich es dir beibringen?«
»O, wie glücklich wäre ich!«
»Komme morgen, ich werde sehen, was du taugst. Wenn du nichts taugst, verbiete ich dir, jemals ein Klavier zu berühren. Wenn du begabt bist, werde ich versuchen, etwas aus dir zu machen ... Aber ich sage es dir schon jetzt: ich lasse dich arbeiten.«
»Ich werde arbeiten«, sagte Georges entzückt.
Sie verabredeten ein Wiedersehen für den nächsten Tag. Beim Hinausgehen erinnerte sich Georg, daß er am nächsten Tage andere Verabredungen habe und auch am übernächsten. Ja, vor Ende der Woche war er nicht frei. Man setzte Tag und Stunde fest.
Als aber Tag und Stunde gekommen waren, wartete Christof vergeblich. Er war enttäuscht. Er hatte sich kindlich darauf gefreut, Georg wiederzusehen. Dieser unerwartete Besuch hatte einen hellen Strahl in sein Leben getragen. Er war so glücklich und bewegt darüber gewesen, daß er die folgende Nacht nicht hatte schlafen können. Er dachte mit gerührter Dankbarkeit an den jungen Freund, der vom Freunde gesandt, ihn aufgesucht hatte; er lächelte in Gedanken dem reizenden Gesicht zu: sein natürliches Wesen, seine Anmut, sein schelmischer und harmloser Freimut entzückten ihn; er gab sich der stummen Berauschtheit, jenem Summen von Glück hin, das ihm Ohr und Herz in den ersten Tagen seiner Freundschaft mit Olivier erfüllt hatte. Ein ernstes, fast religiöses Gefühl kam dazu, das über die Lebenden fort das Lächeln des Verblichenen erblickte. Er wartete den folgenden Tag und den nächstfolgenden. Niemand kam. Kein Brief der Entschuldigung. Christof war betrübt und suchte selbst nach Gründen, um das Kind zu entschuldigen. Er wußte nicht, wohin er ihm schreiben sollte, er hatte seine Adresse nicht. Hätte er sie gekannt, so würde er nicht gewagt haben, zu schreiben. Ein altes Herz, das sich in ein junges Wesen verliebt, schämt sich, ihm zu zeigen, daß es seiner bedarf. Er weiß wohl, daß der, der jung ist, nicht dasselbe Bedürfnis empfindet: das Spiel ist zwischen ihnen nicht gleich; und man fürchtet nichts so sehr, als sich scheinbar dem aufzudrängen, der sich nicht um einen kümmert.
Das Schweigen dehnte sich aus. Obgleich Christof darunter litt, zwang er sich doch, keinen Schritt zu tun, um den Jeannins wieder zu begegnen. Jeden Tag aber wartete er auf den, der nicht kam. Er reiste nicht nach der Schweiz. Er blieb den ganzen Sommer in Paris. Er hielt sich selbst für verdreht; aber er hatte keine Lust mehr zum Reisen. Erst im September entschloß er sich, einige Tage in Fontainebleau zu verbringen.
Gegen Ende Oktober klopfte Georg Jeannin wieder an seine Türe. Er entschuldigte sich ruhig und ohne die geringste Verlegenheit wegen seines nicht gehaltenen Versprechens.
»Ich konnte nicht kommen,« sagte er; »und dann sind wir abgereist, wir waren in der Bretagne.«
»Du hättest mir schreiben können.«
»Ja, das wollte ich auch. Aber ich hatte niemals Zeit ... Und dann habe ich es vergessen,« sagte er lachend. »Ich vergaß – ich vergesse alles.«
»Seit wann bist du zurück?«
»Seit Anfang Oktober.«
»Und du hast drei Wochen gewartet, ehe du dich zum Herkommen entschlossen hast? Höre, sage mir offen: hält dich deine Mutter zurück? ... Mag sie nicht, daß du mich siehst?«
»Aber nein. Im Gegenteil. Sie hat mich heute ermahnt, herzugehen.«
»Wie das?«
»Das letztemal, als ich Sie vor den Ferien sah, habe ich ihr als ich heimkam, alles erzählt. Sie sagte: ich hätte recht getan; sie erkundigte sich nach Ihnen, sie stellte viele Fragen. Als wir vor drei Wochen aus der Bretagne zurückkehrten, da hat sie mich aufgefordert, wieder zu Ihnen zu gehen. Vor acht Tagen hat sie mich wieder daran erinnert. Und heute morgen, als sie erfuhr, daß ich noch nicht gegangen sei, wurde sie böse. Sie wollte, daß ich gleich nach dem Frühstück ginge.«
»Und du schämst dich nicht, mir das zu erzählen? Man muß dich also zwingen, zu mir zu kommen?«
»Nein, nein, glauben Sie das nicht. Oh, ich habe Sie erzürnt. Verzeihen Sie ... Wirklich, ich bin ganz benommen ... Schelten Sie mich, aber seien Sie mir nicht böse. Ich habe Sie so lieb. Wenn ich Sie nicht liebte, wäre ich nicht hergekommen. Man hat mich nicht gezwungen, überhaupt kann man mich zu nichts zwingen, was ich nicht tun will.«
»Schlingel!« sagte Christof, wider Willen lachend. »Und wie steht es mit deinen musikalischen Plänen?«
»O, ich denke noch immer daran.«
»Das bringt dich nicht viel vorwärts.«
»Ich will mich jetzt daran machen. In diesen letzten Monaten konnte ich nicht. Ich hatte so schrecklich viel zu tun! Aber jetzt werden Sie sehen, wie ich arbeite, wenn Sie noch etwas von mir wissen wollen.«
Er schaute ihn schmeichelnd an.
»Du bist ein Schelm,« sagte Christof.
»Sie nehmen mich nicht ernst?«
»Nein, weiß Gott nicht.«
»Das ist abscheulich! Niemand nimmt mich ernst. Ich bin ganz mutlos.«
»Ich werde dich ernst nehmen, wenn ich dich bei der Arbeit sehen werde.«
»Ich habe keine Zeit. Morgen.«
»Nein, morgen liegt zu fern. Ich kann es nicht aushalten, daß Sie mich einen ganzen Tag verachten.«
»Du langweilst mich.«
»Bitte, bitte!«
Christof hieß ihn, während er über seine Schwäche lächelte, sich ans Klavier setzen und redete mit ihm von Musik. Er stellte ihm Fragen; er ließ ihn kleine Harmonieaufgaben lösen. Georg wußte nicht viel; aber sein musikalischer Instinkt ergänzte seine große Unwissenheit; er fand die Akkorde, die Christof erwartete, ohne ihren Namen zu kennen; und selbst seine Irrtümer zeigten in ihrer Unbeholfenheit Geschmack an Neuem, Unvorhergesehenem und ein eigentümlich verfeinertes Gefühl. Er nahm Christofs Bemerkungen nicht ohne Erörterung an. Und die klugen Fragen, die er stellte, zeigten einen offenen Geist, der die Kunst nicht wie ein Gebetbuch annahm, das man mit den Lippen hersagt, sondern der es mit vollem Bewußtsein lesen wollte. – Sie unterhielten sich nicht nur über Musik. Anläßlich von Harmonien zog Georg Bilder heran, Landschaften, Seelen. Es war schwierig, ihn am Zügel zu halten; man mußte ihn beständig wieder auf die Mitte des Weges zurückbringen; und Christof hatte nicht immer das Herz dazu. Es machte ihm Spaß, dem fröhlichen Geschwätz dieses kleinen geist- und lebensprühenden Wesens zuzuhören. Welcher Unterschied gegen Oliviers Natur! ... Bei dem einen war das Leben ein innerer Strom, der schweigend dahinfloß; bei dem anderen war es ganz nach außen gerichtet: ein launischer Bach, der sich beim Spiel im Sonnenlicht verausgabte. Und doch – wie ihre Augen sich glichen, war auch hier dasselbe schöne und reine Wasser. Christof fand lächelnd bei Georg gewisse instinktive Abneigungen wieder, eine Vorliebe oder einen Widerwillen, den er gut kannte, und daneben jene kindliche Unbestechlichkeit, jene Großzügigkeit des Herzens, die sich dem, was es liebt, ganz hingibt ... Nur liebte Georg so vieles, daß er nicht die Muße fand, lange Zeit dasselbe zu lieben.
Er kam am nächsten und am folgenden Tage wieder. Eine schöne, jugendliche Leidenschaft für Christof hatte ihn erfaßt und er befleißigte sich voller Begeisterung seiner Stunden ... Dann sank die Begeisterung, die Besuche wurden spärlicher. Er kam seltener. Und schließlich kam er gar nicht mehr. Er verschwand wieder für Wochen.
Er war leichtlebig, vergeßlich, kindlich egoistisch und aufrichtig zärtlich; er hatte ein gutes Herz und eine helle Intelligenz, die er von einem Tag zum andern in Kleingeld verausgabte. Man verzieh ihm alles, weil man ihn gern sah. Er war glücklich ... Christof wollte ihn nicht verurteilen. Er klagte nicht. Er hatte an Jacqueline geschrieben und ihr dafür gedankt, daß sie ihm ihren Sohn geschickt habe. Jacqueline antwortete mit einem kurzen Brief voll zurückgedrängter Empfindung und gab dem Wunsch Ausdruck, Christof möge sich für Georg interessieren, ihn im Leben leiten. Sie deutete mit keinem Wort die Möglichkeit an, Christof zu begegnen. Aus Scham oder aus Stolz konnte sie sich nicht entschließen, ihn wiederzusehen. Und Christof hielt sich nicht für berechtigt, zu ihr zu gehen, ohne daß sie ihn einlud. – So blieben sie voneinander getrennt, sahen sich manchmal von fern in einem Konzert und wurden nur durch die seltenen Besuche des jungen Burschen verbunden.
Der Winter verging. Grazia schrieb nur noch selten. Sie bewahrte Christof ihre treue Freundschaft. Aber als echte Italienerin, die wenig gefühlvoll ist und in der Wirklichkeit wurzelt, hatte sie das Bedürfnis, die Menschen von Zeit zu Zeit zu sehen, nicht etwa, um sie nicht zu vergessen, sondern um wieder einmal mit ihnen reden zu können. Sie mußte, um das Gedächtnis ihres Herzens wachzuhalten, zuweilen das Gedächtnis ihrer Augen auffrischen. So wurden ihre Briefe denn kurz und fremd. Sie blieb Christofs sicher, wie Christof es ihrer war. Aber diese Sicherheit verbreitete mehr Licht als Wärme.
Christof litt nicht allzusehr unter diesen neuen Enttäuschungen. Seine musikalische Betätigung erfüllte ihn völlig. Wenn ein kraftvoller Künstler ein gewisses Alter erreicht hat, lebt er weit mehr in seiner Kunst als im Leben. Das Leben ist Traum geworden, die Kunst Wirklichkeit. Da er wieder Fühlung zu Paris gewonnen hatte, war seine Schöpferkraft neu erwacht. Es gibt in der Welt keinen stärkeren Ansporn als das Schauspiel dieser Stadt der Arbeit. Die Trägsten werden von ihrem Fieber angesteckt. Christof, der durch Jahre gesunder Einsamkeit ausgeruht war, trug eine ungeheure Summe zu verausgabender Kraft in sich. Durch neue Eroberungen bereichert, die der kühne Vorwärtsdrang des französischen Geistes beständig auf dem Gebiet der musikalischen Technik machte, ging Christof nun seinerseits auf Entdeckungen aus. Leidenschaftlicher und barbarischer ging er weiter als alle andern zusammen. Nichts aber in diesen neuen Kühnheiten war dem Zufall des Instinkts überlassen. Ein Bedürfnis nach Klarheit hatte sich Christofs bemächtigt. Sein ganzes Leben lang war sein Genius dem Rhythmus wechselnder Strömungen gefolgt; sein Gesetz war es, immer wieder sich von einem Pol zum entgegengesetzten zu schwingen und den ganzen Zwischenraum zu erschöpfen. Nachdem er sich in der vorhergehenden Periode leidenschaftlich den »Augen des Chaos, die durch den Schleier leuchten«, hingegeben hatte, so gierig, daß er beinahe den Schleier zerrissen hätte, um sie sehen zu können, suchte er jetzt, sich aus ihrem Banne zu reißen und über das Antlitz der Sphynx von neuem das Zaubernetz des bändigenden Geistes zu werfen. Roms kaiserlicher Atem war über ihn hingeweht. Gleich der damaligen Pariser Kunst, von der er ein wenig angesteckt wurde, strebte er nach Ordnung, aber nicht etwa wie jene müden Rückständler, die ihre letzten Kräfte dafür verbrauchen, ihren Schlaf zu verteidigen, nicht etwa nach polnischer Ordnung. O diese braven Leute, die aus Bedürfnis nach Ruhe auf Brahms zurückgreifen, – auf die Brahms aller Künste, auf die starken Thematiker, die abgeschmackten Neuklassiker! Ist es nicht, als wären sie aller Leidenschaft bar? Sofort seid ihr hundemüde, meine Freunde ... Nein, von eurer Ordnung spreche ich nicht. Die meine ist nicht vom selben Schlage. Es ist die Ordnung in der Harmonie der freien Leidenschaften und des Willens ... Christof war es darum zu tun, in seiner Kunst das richtige Gleichgewicht zwischen den Kräften des Lebens zu halten. Seine neuen Akkorde, seine musikalischen Dämonen, die er aus dem klingenden Abgrunde heraufbeschworen hatte, brauchte er, um klare Symphonien aufzubauen, weite durchsonnte Architekturen gleich den italienischen Kuppelbasiliken.
Diese Spiele und geistigen Kämpfe erfüllten ihn während des ganzen Winters. Und der Winter ging schnell vorüber, obgleich Christof manchmal abends, wenn er sein Tagewerk getan hatte und hinter sich blickend die Summe seiner Tage überschaute, nicht hätte sagen können, ob sie groß oder klein sei, und ob er noch jung wäre oder schon sehr alt.
Da durchdrang ein neuer Strahl menschlicher Sonne die Nebel des Traumes und führte noch einmal den Frühling mit sich. Christof empfing einen Brief von Grazia, der ihm sagte, sie käme mit ihren beiden Kindern nach Paris. Seit langem hegte sie diesen Plan. Ihre Cousine Colette hatte sie oft eingeladen. Die Furcht vor der Anstrengung, die es sie kostete, um mit ihren Gewohnheiten zu brechen, um sich aus ihrem lässigen Frieden und aus ihrem » home«, das sie liebte, heraus zu reißen, um wieder in den ihr bekannten Pariser Trubel zurückzukehren, hatte sie ihre Reise von Jahr zu Jahr aufschieben lassen. Eine gewisse Schwermut, die sie in diesem Frühling überfiel, vielleicht eine geheime Enttäuschung – (wieviel stumme Romane spielen sich in einem Frauenherzen ab, ohne daß die anderen etwas davon wissen, und oft ohne daß das Herz selber es sich eingesteht!) – kurz, irgend ein Gefühl flößte ihr den Wunsch ein, von Rom fortzugehen. Eine drohende Epidemie bot den Vorwand, die Abreise der Kinder zu beschleunigen. Wenige Tage nach ihrem Brief an Christof kam sie selbst.
Kaum erfuhr er, daß sie bei Colette eingetroffen war, so eilte er hin, um sie zu sehen. Er fand sie noch in sich versunken und weit fort. Das tat ihm weh, aber er zeigte es nicht. Er hatte seinen Egoismus jetzt so ziemlich aufgegeben, und das gab seinem Herzen einen klaren Blick. Er begriff, daß sie einen Kummer habe, den sie verbergen wollte; aber er unterließ es, nach seiner Ursache zu forschen. Er bemühte sich nur, sie zu zerstreuen, indem er ihr heiter von seinen Mißgeschicken erzählte, sie an seinen Arbeiten und Plänen teilnehmen ließ und sie mit seiner Liebe zart umgab. Sie fühlte sich ganz umhüllt von dieser großen Zärtlichkeit, die sich aufzudrängen fürchtete; sie fühlte, daß Christof ihr Leid ahne; und das rührte sie. Ihr ein wenig trauriges Herz ruhte sich im Herzen des Freundes aus, der ihr von anderm redete, als dem, was sie beide beschäftigte. Und nach und nach sah er, wie der schwermütige Schatten in den Augen seiner Freundin lichter wurde, wie ihr Blick näher, immer näher kam. So, daß er eines Tages, als er mit ihr sprach, sich plötzlich unterbrach und sie schweigend anschaute.
»Was haben Sie?« fragte sie ihn.
»Heute,« sagte er, »sind Sie ganz zurückgekehrt.«
Sie lächelte und erwiderte ganz leise:
»Ja.«
Es war nicht ganz leicht, ungestört zu plaudern. Sie waren selten allein. Colette beehrte sie mit ihrer Gegenwart mehr, als es ihnen lieb war. Trotz ihrer Grillen war sie eine ausgezeichnete Frau und Grazia und Christof aufrichtig zugetan; aber es kam ihr nicht in den Sinn, daß sie sie langweilen könnte. Ihre Augen, die alles sahen, hatten wohl zwischen Christof und Grazia den Flirt, wie sie es nannte, bemerkt. Der Flirt war ihr Element. Sie war davon begeistert; sie wünschte nichts Besseres, als ihn zu begünstigen. Aber das gerade verlangte man nicht; man wünschte, daß sie sich nicht im geringsten um das kümmere, was sie nichts anginge. Sobald sie erschien oder zu einem von beiden zarte (unzarte) Anspielungen auf ihre Freundschaft machte, setzten Christof und Grazia eine eisige Miene auf und sprachen von anderen Dingen. Colette suchte in ihrem Vorrat nach allen denkbaren Gründen dafür, außer nach dem einen, dem richtigen. Glücklicherweise für ihre Freunde konnte sie nicht still sitzen. Sie kam und ging, trat ins Zimmer, lief hinaus, überwachte alles im Hause und leitete zehn Angelegenheiten zugleich. In den Pausen zwischen ihrem Erscheinen blieben Christof und Grazia mit den Kindern allein und nahmen dann den Faden ihrer unschuldigen Unterhaltungen wieder auf. Sie redeten niemals über die Gefühle, die sie vereinten. Sie vertrauten sich ihre kleinen täglichen Abenteuer ohne Scheu an. Grazia erkundigte sich mit weiblicher Anteilnahme nach den häuslichen Angelegenheiten Christofs. Alles ging schief bei ihm: er hatte unaufhörlich Krach mit seinen Aufwartefrauen. Er wurde von denen, die ihn bedienten, beständig betrogen und bestohlen. Sie lachte herzlich und voll mütterlichen Mitgefühls über den Mangel an praktischem Sinn bei diesem großen Kinde. Eines Tages, als Colette sie gerade verließ, nachdem sie sie länger als gewöhnlich gequält hatte, seufzte Grazia: »Arme Colette! Ich habe sie so gern ... aber sie langweilt mich sehr!«
»Ich habe sie auch gern,« sagte Christof, »wenn Sie damit sagen wollen, daß sie uns langweilt.«
Grazia lachte:
»Hören Sie! würden Sie mir erlauben, – es ist hier wirklich keine Möglichkeit, friedlich zu plaudern –, würden Sie mir erlauben, einmal zu Ihnen zu kommen?«
Er fuhr zusammen.
»Zu mir, Sie würden zu mir kommen?«
»Das ist Ihnen hoffentlich nicht unangenehm?«
»Unangenehm? Ach mein Gott!«
»Nun also, paßt es Ihnen Dienstag?«
»Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeden Tag, den Sie bestimmen.«
»Also dann Dienstag um vier Uhr. Abgemacht?«
»Wie gut Sie sind, wie gut Sie sind.«
»Warten Sie, es geschieht unter einer Bedingung.«
»Bedingung? Wozu das? Alles, was Sie wollen. Sie wissen ja, ich tue alles, mit oder ohne Bedingung.«
»Mir ist es mit der Bedingung lieber.«
»Einverstanden.«
»Sie wissen nicht, was es ist.«
»Das ist mir gleich. Ich bin einverstanden. Mit allem, was Sie wollen.«
»Aber hören Sie doch erst, Tollkopf.«
»Sprechen Sie.«
»Ich will, daß Sie nichts – Sie hören! – nicht das geringste an Ihrer Wohnung ändern. Alles bleibt genau im selben Zustande.«
Christofs Gesicht wurde lang. Er war aus der Fassung gebracht:
»Ach, das gilt nicht.«
Sie lachte:
»Da sehen Sie, wie es kommt, wenn man sich zu schnell festlegt; aber Sie haben es versprochen.«
»Aber warum wollen Sie das? ...«
»Weil ich sehen will, wie Sie alle Tage hausen, wenn Sie mich nicht erwarten.«
»Aber Sie werden mir doch erlauben ...«
»Garnichts, ich erlaube nichts.«
»Wenigstens ...«
»Nein, nein, nein, nein. Ich will nichts hören, oder ich komme nicht, wenn Sie das vorziehen ...«
»Sie wissen sehr wohl, daß ich in alles willige, vorausgesetzt, daß Sie kommen.«
»Also einverstanden?«
»Ich habe Ihr Wort?«
»Ja, Tyrann.«
»Bin ich ein guter Tyrann?«
»Es gibt keine guten Tyrannen: Es gibt Tyrannen, die man liebt, und Tyrannen, die man haßt.«
»Und ich gehöre zu beiden, nicht wahr?«
»O nein, Sie gehören nur zu den ersteren.«
»Das ist recht kränkend.«
Am festgesetzten Tage kam sie. Christof hatte in seiner gewissenhaften Anständigkeit nicht gewagt, das kleinste Blatt Papier in seiner unordentlichen Wohnung beiseite zu räumen: er hätte sich dadurch entehrt geglaubt. Aber er litt Folterqualen. Er schämte sich über das, was seine Freundin denken würde. Angstvoll erwartete er sie. Sie war pünktlich, sie kam kaum vier oder fünf Minuten nach der festgesetzten Zeit. Sie stieg mit ihrem kleinen festen Schritt die Treppe hinauf und klingelte. Er stand hinter der Türe und öffnete. Sie war mit schlichter und lässiger Vornehmheit gekleidet. Er sah unter dem Schleier ihre ruhigen Augen. Sie sagten sich halblaut »Guten Tag« und gaben sich die Hand; sie war schweigsamer als gewöhnlich; er, linkisch und bewegt, schwieg ganz und gar, um seine Verwirrung nicht zu zeigen. Er ließ sie eintreten, ohne ihr den Satz zu sagen, den er sich vorgenommen hatte, um die Unordnung des Zimmers zu entschuldigen. Sie setzte sich auf den besten Stuhl und er sich daneben.
»Das ist mein Arbeitszimmer.«
Es war alles, was er ihr zu sagen wußte.
Schweigen. Sie schaute ohne Hast, mit gütevollem Lächeln um sich und war selbst ein wenig verwirrt, obgleich sie es nicht zugab. (Später erzählte sie ihm, daß sie als Kind daran gedacht hatte, ihn zu besuchen; aber im Augenblick, als sie ins Haus gehen wollte, hatte sie Angst gehabt.) Sie war von dem vereinsamten und trübseligen Aussehen der Wohnung betroffen: das enge, dunkle Vorzimmer, der völlige Mangel an Bequemlichkeit, die sichtbare Armut, das alles schnürte ihr das Herz zusammen. Sie war von zärtlichem Mitleid für ihren alten Freund erfüllt, dem soviel Arbeit und Mühe und eine gewisse Berühmtheit nicht aus der Bedrängnis materieller Sorgen hatten heraushelfen können. Und gleichzeitig machte ihr die völlige Gleichgültigkeit gegen Behaglichkeit Spaß, die die Nacktheit dieses Zimmers ohne Teppich, ohne Bild, ohne Kunstgegenstand, ohne einen Sessel, offenbarte; keine anderen Möbel als ein Tisch, drei harte Stühle und ein Klavier; und außer ein paar Büchern – Papier, überall Papier; auf dem Tisch, unter dem Tisch, auf dem Boden, auf dem Klavier, auf den Stühlen, – (sie lächelte, als sie sah, mit welcher Gewissenhaftigkeit er Wort gehalten hatte.)
Nach einigen Augenblicken fragte sie ihn:
»Hier also – (indem sie auf seinen Platz wies) hier arbeiten Sie?«
»Nein,« sagte er, »dort.«
Er zeigte den dunkelsten Winkel des Zimmers und einen niedrigen Stuhl, der mit der Lehne gegen das Licht stand. Sie ging hin und setzte sich anmutig, ohne ein Wort zu sagen, dort nieder. Sie schwiegen einige Minuten und wußten nicht, was sie reden sollten. Er stand auf und ging zum Klavier. Er spielte, er fantasierte eine halbe Stunde lang. Er fühlte sich von der Gegenwart seiner Freundin umhüllt, und ein unendliches Glück schwellte ihm das Herz. Mit geschlossenen Augen spielte er wundersame Dinge. Da begriff sie die Schönheit dieses Zimmers, das ganz von göttlichen Harmonien erfüllt war; sie lauschte, als schlüge sein liebendes und leidendes Herz in ihrer eigenen Brust.
Als die Harmonien schwiegen, blieb er noch einen Augenblick reglos vor dem Klavier sitzen. Dann wandte er sich um; denn er hörte die Atemzüge seiner weinenden Freundin. Sie kam auf ihn zu:
»Dank,« murmelte sie, indem sie seine Hand nahm. Ihr Mund zitterte ein wenig, sie schloß die Augen. Er tat dasselbe. Einige Sekunden blieben sie so Hand in Hand, und die Zeit stand still. Sie öffnete die Augen wieder; und um ihrer Verwirrung Herr zu werden, fragte sie:
»Kann ich jetzt die übrige Wohnung sehen?«
Er, ebenfalls glücklich, seiner Bewegung zu entkommen, öffnete die Tür zum Nebenzimmer; aber gleich darauf schämte er sich. Dort stand ein enges, hartes Eisenbett. Später, als er Grazia anvertraute, er habe niemals eine Geliebte bei sich empfangen, sagte sie spottlustig:
»Das kann ich mir wohl denken. Dazu hätte sie viel Mut haben müssen.«
»Warum?«
»Um in Ihrem Bett zu schlafen.«
Dort stand auch eine bäuerliche Kommode, an der Wand hing ein Gipsabguß von dem Kopf Beethovens, und neben dem Bett in ganz billigen Rahmen die Photographien von seiner Mutter und Olivier. Auf der Kommode stand eine andere Photographie: sie, Grazia, fünfzehnjährig. Er hatte sie in Rom in einem Album bei ihr gefunden und sie ihr gestohlen. Er gestand es ihr, indem er sie um Verzeihung bat. Sie betrachtete das Bild und sagte:
»Erkennen Sie mich darauf?«
»Ich erkenne Sie und ich erinnere mich.«
»Welche von beiden lieben Sie am meisten?«
»Sie sind immer die Gleiche. Ich liebe Sie immer gleich. Ich erkenne Sie überall. Selbst in Ihren Photographien als ganz kleines Kind. Sie ahnen nicht, wie es mich rührt, wenn ich in dieser Schmetterlingspuppe schon Ihre ganze Seele fühle. Nichts läßt mich besser erkennen, daß Sie ewig sind. Ich liebte Sie, noch ehe Sie geboren waren, und ich liebe Sie bis nach ...«
Er schwieg. In liebender Verwirrung blieb sie die Antwort schuldig. Als sie wieder im Arbeitszimmer war und er ihr vor dem Fenster den kleinen Baum, seinen Freund, gezeigt hatte, in dem die Spatzen schwatzten, sagte sie zu ihm:
»Wissen Sie, was wir jetzt tun? Wir werden Tee trinken. Ich habe Tee und Kuchen mitgebracht. Denn ich dachte mir schon, daß Sie nichts dergleichen da hätten. Und ich habe noch etwas anderes mitgebracht. Geben Sie mir Ihren Überzieher.«
»Meinen Überzieher?«
»Ja, ja, geben Sie nur.«
Sie nahm aus ihrem Täschchen Nadel und Faden.
»Wie, Sie wollten?«
»Da waren neulich zwei Knöpfe, deren Schicksal mich beunruhigte. Wie ist es heute damit?«
»Ach wirklich, ich habe noch nicht daran gedacht, sie anzunähen. Das ist so langweilig.«
»Armer Junge, geben Sie her.«
»Ich schäme mich.«
»Machen Sie den Tee zurecht.«
Er trug den Wasserkessel und den Spirituskocher ins Zimmer, um keinen Augenblick mit seiner Freundin zu verlieren. Sie schaute, während sie nähte, seinen Unbeholfenheiten lächelnd zu. Sie tranken den Tee aus schartigen Tassen, die sie, schonend gesagt, abscheulich fand und die er empört verteidigte, weil sie Erinnerungen aus seinem gemeinsamen Leben mit Olivier waren.
Im Augenblick, als sie fortging, fragte er sie:
»Sie sind mir nicht böse?«
»Weswegen denn?«
»Wegen der Unordnung, die hier herrscht?«
Sie lachte.
»Ich werde Ordnung machen.«
Als sie auf der Schwelle stand und gerade die Tür öffnen wollte, kniete er vor ihr nieder und küßte ihre Füße.
»Was tun Sie? Tollkopf, Sie lieber Tollkopf!« sagte sie. »Leben Sie wohl.«
Sie kamen überein, daß sie jede Woche am bestimmten Tage wiederkommen sollte. Sie hatte ihn versprechen lassen, daß er keine Tollheiten mehr begehen werde. Kein Niederknieen, kein Fußküssen mehr. Eine so süße Ruhe strahlte von ihr aus, daß Christof selbst an seinen heftigsten Tagen von ihr durchdrungen wurde. Und obgleich er, wenn er allein war, oft mit leidenschaftlichem Begehren an sie dachte, verkehrten sie doch, wenn sie zusammen waren, immer wie gute Kameraden. Niemals entfuhr ihm ein Wort, eine Gebärde, die seine Freundin beunruhigen konnte.
Zu Christofs Geburtstag zog sie ihre kleine Tochter so an, wie sie selbst gekleidet war, als sie sich einst das erste Mal begegnet waren, und sie ließ das Kind das Stück spielen, das Christof ihr einst eingeübt hatte.
Diese ganze Anmut, diese Zärtlichkeit, diese warme Freundschaft mischten sich in ihr mit entgegengesetzten Empfindungen. Sie war leichtlebig und liebte die Gesellschaft; sie fand Vergnügen daran, wenn ihr, selbst von Dummköpfen, der Hof gemacht wurde. Sie war ziemlich kokett, außer mit Christof, – sogar mit Christof. War er sehr zärtlich zu ihr, war sie gern kalt und zurückhaltend. War er kalt und zurückhaltend, wurde sie zärtlich und neckte ihn liebevoll. Sie war die anständigste Frau. Aber in der anständigsten und besten steckt in manchen Augenblicken die Dirne. Es lag ihr daran, mit der Welt gut zu stehen, sich den Sitten anzupassen. Sie war für Musik begabt und verstand Christofs Werke; aber sie interessierte sich nicht besonders dafür – (und er wußte das wohl). – Für eine echte Lateinerin hat die Kunst nur insofern Wert, als sie mit dem Leben zu tun hat, und das Leben, insofern es zur Liebe führt ... Der Liebe, die auf dem Grunde des wollüstig hindämmernden Körpers schlummert ... Was hat sie mit der tragischen Gedankenwelt, mit den qualvollen Symphonien, den geistigen Leidenschaften des Nordens zu schaffen? Sie braucht eine Musik, in der ihre verborgenen Wünsche aufblühen, eine Oper, die leidenschaftliches Leben ist, ohne die Mühe der Leidenschaft zu fordern, eine gefühlvolle, sinnliche und träge Kunst.
Sie war schwach und schwankend; sie konnte sich einem ernsten Studium nur mit Unterbrechungen hingeben. Sie mußte sich zerstreuen; selten tat sie am nächsten Tage, was sie sich am Abend vorher vorgenommen hatte. Wieviel Kindereien, wieviel verstimmende kleine Launen hatte sie! Wie verworren ist die Natur des Weibes, wie krankhaft und unvernünftig zu Zeiten ihr Charakter! Sie war sich dessen wohl bewußt und suchte sich dann abzuschließen. Sie kannte ihre Schwächen und warf sich vor, ihnen nicht besser zu widerstehen, da sie ihren Freund damit betrübte. Manchmal brachte sie ihm, ohne daß er es wußte, wahrhafte Opfer; aber schließlich war die Natur doch die stärkere. Im übrigen konnte Grazia nicht leiden, wenn es den Anschein hatte, als befehle ihr Christof; und ein oder zwei Mal geschah es, daß sie, um ihre Unabhängigkeit zu beweisen, das Gegenteil von dem tat, um das er sie bat. Später bedauerte sie es; nachts hatte sie Gewissensbisse, weil sie Christof nicht glücklicher machte; sie liebte ihn viel mehr, als sie es ihm zeigte; sie fühlte, daß diese Freundschaft das Beste ihres Lebens sei. Wie es gewöhnlich zwischen zwei sehr verschiedenen Wesen, die sich lieben, geht, waren sie am innigsten vereint, wenn sie nicht zusammen waren. Wenn ein Mißverständnis ihre Schicksale auseinandergeführt hatte, so lag die Schuld in Wahrheit nicht ganz und gar an Christof, wenn er es auch treuherzig glaubte. Hätte Grazia, selbst damals, als sie Christof am meisten liebte, ihn geheiratet? Sie hätte ihm vielleicht ihr Leben gegeben; aber wäre sie wohl bereit gewesen, ihr ganzes Leben mit ihm zu verbringen? Sie wußte (und hütete sich, es Christof zu gestehen), sie wußte, daß sie ihren Mann geliebt hatte, und daß noch heute, nach allem Bösen, das er ihr zugefügt hatte, sie ihn so liebte, wie sie Christof niemals geliebt hatte ... Geheimnisse des Herzens, Geheimnisse des Körpers, auf die man nicht sehr stolz ist, und die man denen, die einem teuer sind, verbirgt, sowohl aus Achtung vor ihnen wie aus einem nachsichtigen Mitleid mit sich selbst. Christof war zu sehr Mann, um das zu ahnen; aber blitzartig durchschaute er manchmal, wie wenig die, die er am meisten liebte, die, die er wirklich liebte, an ihm hing, – und daß man auf niemanden ganz und gar zählen darf, auf niemanden im Leben. Seine Liebe wurde davon nicht berührt. Er empfand darüber nicht einmal irgend welche Bitterkeit. Grazias Frieden ging auf ihn über. Er nahm ihn an. O Leben, warum sollte man dir vorwerfen, was du nicht geben kannst? Bist du nicht sehr schön und sehr heilig, so wie du bist? Man muß dein Lächeln lieben, Gioconda ...
Christof betrachtete lange das schöne Antlitz der Freundin. Er las darin vieles aus Vergangenheit und Zukunft. Während der langen Jahre, in denen er allein gelebt hatte, gereist war, wenig gesprochen aber viel gesehen hatte, hatte er fast unbewußt die Gabe erworbenen, in einem menschlichen Antlitz zu lesen, diese reiche und umfassende Sprache zu verstehen, die die Jahrhunderte geformt haben, und die tausendmal reicher und umfassender ist als die Sprache des Wortes. Die Rasse drückt sich in ihr aus ... Beständige Gegensätze sind zwischen den Linien eines Gesichtes und dem, was es redet. Da ist ein junges Frauenprofil mit klarer, ein wenig herber Zeichnung in der Art des Burne Jones, tragisch, als wäre es von einer geheimen Leidenschaft zernagt, einer Eifersucht, einem Shakespearischen Schmerz. Da redet es – und entpuppt sich als das einer Kleinbürgerin, die dumm wie Bohnenstroh ist und keine Ahnung hat von den gefährlichen Kräften, die in ihrem Fleisch wohnen. Und doch sind diese Leidenschaften, diese Heftigkeiten in ihm. In welcher Form werden sie eines Tages in die Erscheinung treten? Vielleicht als Gier nach Geld, als eheliche Eifersucht, als schöne Tatkraft, oder als krankhafte Bosheit? Man weiß es nicht. Es ist sogar möglich, daß sie das alles auf einen anderen ihres Blutes überträgt, bevor die Stunde des Ausbruches gekommen ist. Aber es ist ein Element, mit dem man rechnen muß, und das wie ein Schicksal über dem Geschlecht schwebt.
Auch Grazia trug die Last dieser dunklen Erbschaft, die von dem ganzen Erbgut alter Familien diejenige ist, die am wenigsten Gefahr läuft, mit der Zeit verschleudert zu werden. Sie wenigstens kannte sie. Es liegt schon eine große Kraft darin, seine Schwächen zu kennen und wenn auch nicht ihr Herr, so doch ein Pilot der Seele seiner eigenen Rasse zu sein, an die man gebunden ist, und die einen, gleich einem Schiff, davonträgt. Es liegt eine große Kraft darin, wenn man das Schicksal zu seinem Werkzeug macht und sich seiner gleich einem Segel bedient, das man, je nach dem Winde, anspannt oder einzieht. Wenn Grazia die Augen schloß, vernahm sie in sich mehr als eine beunruhigende Stimme, deren Klang ihr bekannt war. Aber in ihrer gesunden Seele verschmolzen schließlich selbst die Dissonanzen; sie bildeten unter der Hand ihres harmonischen Geistes eine tiefinnerliche und gedämpfte Musik.
Unglücklicherweise hängt es nicht von uns ab, ob wir auf die, die unseres Blutes sind, das Beste unseres Blutes übertragen. Von Grazias beiden Kindern ähnelte das eine, das kleine Mädchen Aurora, das elf Jahre alt war, der Mutter; es war weniger hübsch, von etwas bäuerlichem Schlage; und hinkte leicht; es war eine gute Kleine, anschmiegend und heiter, von ausgezeichneter Gesundheit, viel gutem Willen, wenig Begabung, außer der zum Müßiggang, dem Hang zum Nichtstun. Christof liebte sie unendlich. Er genoß, wenn er sie neben Grazia sah, den Reiz eines Doppelwesens, das man gleichzeitig in zwei Lebensaltern, in zwei Generationen, in sich aufnimmt ... Zwei Blüten, demselben Stiel entsprossen: eine heilige Familie von Lionardo, die Madonna und die heilige Anna, das gleiche, kaum verschiedene Lächeln. Man küßt mit einem Blick den vollen Blütenflor einer weiblichen Seele; und das ist gleichzeitig schön und wehmütig: denn man sieht, woher sie kommt und wohin sie geht. Nichts ist für ein leidenschaftliches Herz natürlicher, als mit glühender und keuscher Liebe die beiden Schwestern, oder Mutter und Tochter zu lieben. Christof hätte die Frau, die er liebte, in der ganzen Nachfolge ihres Geschlechtes lieben mögen, so wie er in ihr ihr ganzes dahingegangenes Geschlecht liebte. War nicht jedes Lächeln, jede Träne, jedes Fältchen ihres lieben Gesichtes ein Wesen, die Rückerinnerung eines Lebens, das schon war, bevor ihre Augen sich dem Licht geöffnet hatten, das später kommen sollte, wenn ihre schönen Augen sich geschlossen haben würden? Der kleine Junge, Lionello, war neun Jahre alt. Viel hübscher als seine Schwester und von feinerer, allzu feiner, blutloser und verbrauchter Rasse, ähnelte er dem Vater. Er war klug, reich an schlimmen Trieben, ein Schmeichler und Duckmäuser. Er hatte große blaue Augen, lange blonde Mädchenhaare, eine bleiche Haut, eine zarte Brust und eine krankhafte Nervosität, deren er sich als geborener Schauspieler bei Gelegenheit bediente; denn er verstand es in eigentümlicher Weise, die Schwächen der Leute herauszufinden. Grazia zog ihn vor, in der natürlichen Vorliebe der Mutter für ihr weniger gesundes Kind, – und auch unter dem Einfluß der Anziehungskraft, die auf gute und anständige Frauen von Söhnen ausgeübt wird, die weder das eine noch das andere sind; (denn in ihnen macht sich der Teil ihres Lebens frei, den sie zurückgedrängt haben.) – Dazu kommt noch die Erinnerung an den Mann, der ihnen Leid zugefügt hat, und den sie vielleicht verachtet, aber geliebt haben, kommt jene ganze seltsame Blütenpracht der Seele, die in dem düsteren und warmen Treibhaus des Unterbewußtseins sprießt.
Obgleich sich Grazia alle Mühe gab, zwischen ihren beiden Kindern ihre Zärtlichkeit gleichmäßig zu verteilen, fühlte Aurora den Unterschied und litt ein wenig darunter. Christof und sie verstanden sich; instinktiv näherten sie sich einander. Im Gegensatz dazu bestand zwischen Christof und Lionello eine Abneigung, die das Kind unter einem Überschwang von läppischer Zutunlichkeit verbarg, – die Christof aber wie ein schmachvolles Gefühl zurückwies. Er tat sich Gewalt an; er zwang sich dazu, dieses Kind eines anderen zu liebkosen, als wäre es das, welches von der Geliebten als Geschenk empfangen zu haben ihm unendlich wonnevoll gewesen wäre. Er wollte die schlechten Anlagen Lionellos nicht sehen, nichts, was ihn an den »anderen« erinnerte. Er mühte sich, in ihm nur Grazia zu finden. Grazia sah klarer und gab sich keinerlei Täuschungen über ihren Sohn hin; aber sie liebte ihn darum nur desto mehr. Da kam die Krankheit, die seit Jahren in dem Kind schlummerte, zum Ausbruch. Die Schwindsucht äußerte sich. Grazia faßte den Entschluß, sich mit Lionello in ein Alpensanatorium zurückzuziehen. Christof bat, sie begleiten zu dürfen. Aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung redete sie ihm das aus. Die übertriebene Bedeutung, die sie den gesellschaftlichen Formen beilegte, berührte ihn schmerzlich.
Sie reiste ab. Ihre Tochter hatte sie bei Colette gelassen. Sehr bald fühlte sie sich schrecklich einsam unter all den Kranken, die nur von ihren Leiden sprachen, in dieser mitleidslosen Natur, die mit unbeweglichem Gesicht dem menschlichen Jammer zusah. Um dem niederdrückenden Anblick jener Unglücklichen zu entfliehen, die, den Speibecher in der Hand, einander belauerten und bei einem jeden von ihnen die Fortschritte der tödlichen Krankheit verfolgten, hatte sie das Palast-Hospital verlassen und ein Schweizer Häuschen gemietet, in dem sie mit ihrem kleinen Kranken allein war. Die Höhe verschlimmerte den Zustand Lionellos, anstatt ihn zu bessern. Das Fieber wurde stärker. Grazia verbrachte angstvolle Nächte. Christof empfand das in der Ferne ahnungsvoll und schmerzlich mit, obgleich seine Freundin ihm nichts davon schrieb; denn sie versteifte sich in ihren Stolz; sie hätte am liebsten gesehen, daß Christof bei ihr gewesen wäre; aber sie hatte ihm verboten, ihr zu folgen – sie konnte sich jetzt nicht überwinden, ihm einzugestehen: »Ich bin zu schwach, ich brauche Sie ...«
Eines Abends, als sie zur Dämmerstunde, die für bedrängte Herzen so grausam ist, auf der Galerie des Schweizerhäuschens stand, sah sie ... glaubte sie auf dem Fußweg, der von der Drahtseilbahnstation emporstieg, jemanden zu sehen ... Ein Mann schritt mit raschem Schritt dahin; zögernd, den Rücken ein wenig gebeugt, hielt er inne. Einmal hob er den Kopf und sah nach dem Schweizerhäuschen. Sie trat rasch ins Innere, damit er sie nicht bemerke. Sie preßte die Hand aufs Herz und lachte vor Erregung. Obgleich sie wenig fromm war, warf sie sich auf die Knie und verbarg das Gesicht in den Armen: sie mußte irgend jemand danken. Doch er kam nicht. Sie ging zum Fenster zurück und schaute, hinter den Vorhängen verborgen, hinaus. Er war stehengeblieben und lehnte an dem Gatter eines Feldes nahe dem Eingang zum Schweizerhäuschen. Er wagte nicht, einzutreten. Und sie, verwirrter noch als er, lächelte und sagte leise vor sich hin:
»Komm ...«
Endlich kam er zum Entschluß und klingelte. Schon war sie an der Tür. Sie öffnete. Er hatte die Augen eines guten Hundes, der fürchtet, geschlagen zu werden. Er sagte:
»Ich bin gekommen ... Verzeihen Sie ...«
Sie sagte ihm:
»Dank.«
Dann gestand sie ihm, wie sehr sie ihn erwartet hatte. Christof half ihr den Kleinen, dessen Zustand sich verschlimmerte, zu pflegen. Er tat es mit aufrichtigem Herzen. Das Kind zeigte ihm eine gereizte Feindseligkeit; es gab sich keine Mühe mehr, sie zu verbergen; es suchte ihn mit boshaften Worten zu treffen. Christof schrieb alles dem Leiden zu. Er hatte eine Geduld, die bei ihm ungewöhnlich war. Sie verbrachten am Lager des Kindes eine Reihe peinvoller Tage, besonders eine kritische Nacht, nach der Lionello, der verloren schien, gerettet war. Und als sie beide Hand in Hand neben dem kleinen schlummernden Kranken wachten, empfanden sie beide ein so reines Glück, daß sie plötzlich aufstand, ihren Wettermantel nahm und Christof hinauszog auf den Weg in den Schnee, in die Stille der Nacht, unter die kalten Sterne. Sie lehnte auf seinem Arm, beide tranken berauscht den eisigen Frieden der Welt in sich ein; sie tauschten kaum ein paar Silben miteinander. Keinerlei Andeutung ihrer Liebe fiel. Nur als sie wieder heimkehrten, sagte sie auf der Türschwelle mit einem Blick, der vor Glück über das gerettete Kind strahlte:
»Mein lieber, lieber Freund! ...«
Das war alles. Aber sie fühlten, daß das Band zwischen ihnen heilig geworden war.
Als sie nach der langen Genesungszeit nach Paris zurückgekehrt war und sich in einem kleinen Hause, das sie in Passy gemietet hatte, niederließ, achtete sie nicht im geringsten mehr darauf, was »die Leute sagen würden«. Sie fühlte den Mut in sich, um ihres Freundes willen ihnen entgegenzutreten. Ihrer beider Leben war von nun an so innig verschmolzen, daß sie es feige fand, die Freundschaft, die sie vereinte, verborgen zu halten, selbst auf die unausbleibliche Gefahr hin, daß diese Freundschaft verleumdet würde. Sie empfing Christof zu jeder Tagesstunde. Sie zeigte sich mit ihm auf Spaziergängen und im Theater. Sie sprach vor Allen vertraulich mit ihm. Niemand zweifelte daran, daß sie ein Liebespaar wären. Selbst Colette fand, daß sie sich zu sehr bloßstellten. Grazia schnitt die Andeutungen mit einem Lächeln ab und ging ruhig zu anderem über.
Zwar hatte sie Christof kein neues Recht auf sich eingeräumt. Sie waren nur Freunde. Er redete immer mit der gleichen zarten Hochachtung zu ihr. Aber nichts blieb zwischen ihnen verborgen; sie besprachen alles miteinander, und unmerklich kam Christof dazu, im Hause eine Art Familienoberhaupt zu werden. Grazia hörte seine Ratschläge und folgte ihnen. Seit dem im Sanatorium verbrachten Winter war sie nicht mehr dieselbe; die Sorgen und Anstrengungen hatten ihre bis dahin kräftige Gesundheit stark erschüttert. Die Seele war davon in Mitleidenschaft gezogen worden. Trotz einiger Rückfälle in frühere Launen war doch ein gewisser Ernst und eine Sammlung über sie gekommen; der Wunsch, gut zu sein, sich zu bilden und nicht weh zu tun, war beständiger geworden. Sie war von Christofs Anhänglichkeit, von seiner Selbstlosigkeit und Herzensreinheit gerührt, sie dachte daran, ihm eines Tages das große Glück zu schenken, von dem er nicht mehr zu träumen wagte: seine Frau zu werden.
Niemals seit der Zurückweisung, die sie ihm hatte zuteil werden lassen, hatte er wieder davon zu ihr gesprochen. Er hielt sich nicht dazu berechtigt. Aber er trauerte der unerfüllten Hoffnung nach. So sehr er auch die Worte der Freundin hochschätzte, so hatte doch die enttäuschte Art, in der sie über die Ehe sprach, ihn nicht überzeugt; er glaubte noch immer, daß die Vereinigung zweier Wesen, die sich mit tiefer und frommer Liebe lieben, der Gipfel menschlichen Glückes sei. – Seine Sehnsucht wurde durch die Begegnung mit dem alten Ehepaar Arnaud neu belebt.
Frau Arnaud war über fünfzig Jahre alt. Ihr Mann fünf- oder sechsundsechzig. Beide sahen viel älter aus. Er war stärker geworden, sie ganz mager, ein wenig zusammengeschrumpft; sie war schon früher sehr zart gewesen; jetzt war sie nur noch ein Hauch. Nachdem Arnaud seinen Abschied genommen hatte, hatten sie sich in die Provinz zurückgezogen. Kein Band verknüpfte sie mehr mit dem Jahrhundert als die Zeitung, die in die Stumpfheit der Kleinstadt und ihres verdämmernden Lebens kam, um ihnen das späte Echo des Weltgeschehens zu bringen. Einmal hatten sie Christofs Namen gelesen. Frau Arnaud hatte ihm einige herzliche, etwas feierliche Zeilen geschrieben, um die Freude auszudrücken, die sie über seinen Ruhm empfanden. Daraufhin war er, ohne sich anzumelden, gleich zu ihnen gefahren.
Er fand sie an einem warmen Sommernachmittag in ihrem Garten unter dem runden Blätterdach einer Esche eingeschlummert. Sie glichen dem alten Ehepaar von Böcklin, das Hand in Hand eingeschlafen in der Laube sitzt. Die Sonne, der Schlaf, das Alter übermannen sie. Sie erliegen, sie sind schon fast ganz in den ewigen Traum versunken. Und als letzter Lebensschimmer bleibt bis zum Ende ihre Zärtlichkeit bestehen, die Berührung ihrer Hände, das Aneinander ihrer Körperwärme, die im Verlöschen ist ... Sie empfanden bei Christofs Besuch eine große Freude über alles, was er ihnen aus der Vergangenheit zurückrief. Sie plauderten von alten Zeiten, die ihnen von ferne in hellem Lichte erschienen. Arnaud hörte sich gerne reden, aber sein Namengedächtnis war schwach geworden. Frau Arnaud half ihm nach. Sie schwieg gern; sie hörte lieber zu, als daß sie sprach; aber die Bilder von einst waren in ihrem stillen Herzen frisch geblieben; manchmal kamen sie leuchtend zum Vorschein gleich glänzenden Kieseln in einem Bach. Einer war darunter, dessen Widerschein Christof wiederholt in ihren Augen sah, die ihn mit herzlichem Mitgefühl anschauten; aber Oliviers Name wurde nicht ausgesprochen. Der alte Arnaud erwies seiner Frau ungeschickte und rührende Aufmerksamkeiten; er sorgte sich, daß sie nicht friere, daß ihr nicht heiß werde; seine Augen hingen mit besorgter Liebe an diesem lieben, verwelkten Gesicht, dessen müdes Lächeln sich bemühte, ihn zu beruhigen. Christof beobachtete sie gerührt und mit ein wenig Neid ... Zusammen altern! In seiner Gefährtin alles lieben, bis die Jahre vergehen. Sich sagen: »Diese kleinen Fältchen neben den Augen, über der Nase kenne ich, ich habe gesehen, wie sie sich bildeten. Ich weiß, wann sie erschienen sind. Diese armen grauen Haare sind Tag für Tag an meiner Seite gebleicht, und ach! ein wenig durch mich. Dieses feine Gesicht ist aufgedunsen und rot geworden in der Schmiede der Mühen und Leiden, die uns verbrannt haben. Du, meine Seele, wieviel mehr liebe ich dich, weil du mit mir zusammen gelitten hast und gealtert bist! Jede deiner Runzeln ist mir Musik aus der Vergangenheit.« ... Liebe alte Leutchen, die nach langem Lebensabend Seite an Seite, im Frieden der Nacht Seite an Seite entschlafen! Ihr Anblick war für Christof wohltuend und schmerzvoll zugleich, wie schön mußte so das Leben, wie schön so der Tod sein! ...
Als er Grazia wiedersah, konnte er sich nicht enthalten, ihr seinen Besuch zu schildern. Er sagte ihr nicht die Gedanken, die dieser Besuch in ihm erweckt hatte. Aber sie las sie in ihm. Er war zerstreut, als er davon redete, er wandte die Augen ab, und in manchen Augenblicken schwieg er. Sie schaute ihn an, sie lächelte, und die Verwirrung Christofs übertrug sich auf sie.
Als sie an diesem Abend allein in ihrem Zimmer war, träumte sie vor sich hin. Sie wiederholte sich Christofs Erzählung; aber das Bild, das sie vor sich sah, war nicht das des unter dem Eschenbaum entschlummerten alten Ehepaares: es war der schüchterne und rührende Traum ihres alten Freundes. Und ihr Herz war von Liebe für ihn erfüllt. Als sie sich niedergelegt und das Licht verlöscht hatte, dachte sie:
»Ja, es ist widersinnig, widersinnig und verbrecherisch, ein solches Glück zu versäumen. Was ist mehr wert auf der Welt, als den glücklich zu machen, den man liebt? ... Wie, liebe ich ihn denn? ...«
Sie schwieg und vernahm voller Rührung, wie ihr Herz ihr antwortete:
»Ich liebe ihn.«
In diesem Augenblick hörte sie einen trockenen, rauhen, stoßweisen Husten aus dem Nebenzimmer, in dem die Kinder schliefen. Grazia horchte auf: seit der Krankheit des Kleinen war sie immer besorgt. Sie fragte, was ihm fehle. Er antwortete nicht und hustete weiter. Sie sprang aus dem Bett und kam zu ihm. Er war gereizt, greinte und sagte, es ginge ihm nicht gut, und er fing wieder zu husten an.
»Wo tut es dir weh?«
Er antwortete nicht. Er stöhnte, daß ihm schlecht sei.
»Mein Herzblatt, ich flehe dich an, sag mir, wo es dir weh tut.«
»Ich weiß nicht.«
»Tut es hier weh?«
»Ja. Nein, ich weiß nicht. Es tut überall weh.«
Darauf kam ein neuer, besonders heftiger Hustenanfall. Grazia war erschreckt. Sie hatte das Gefühl, daß er sich zum Husten zwänge; aber sie bereute es, als sie den Kleinen in Schweiß gebadet und nach Atem ringend sah. Sie küßte ihn, sie sagte ihm zärtliche Worte; er schien sich zu beruhigen; aber sobald sie ihn verlassen wollte, fing er wieder zu husten an. Sie mußte, vor Kälte zitternd, an seinem Lager bleiben, denn er erlaubte nicht einmal, daß sie fortging, um sich anzukleiden; er wollte, daß sie seine Hand hielte und er ließ sie nicht los, bis der Schlaf ihn übermannte. Da legte sie sich erstarrt, besorgt, erschöpft wieder hin. Und es war ihr unmöglich, ihre Träume wiederzufinden. Das Kind besaß eine sonderbare Gabe, in den Gedanken seiner Mutter zu lesen. Man findet diese instinktive Begabung bei Wesen gleichen Blutes ziemlich häufig – aber selten in diesem Maße. Solche Menschen brauchen sich kaum anzuschauen, um zu wissen, was der andere denkt; sie erraten es an tausend unmerklichen Anzeichen. Diese natürliche Anlage, die das gemeinsame Leben verstärkt, war bei Lionello durch eine stets auf der Lauer liegende Bösartigkeit verschärft. Er besaß den Scharfblick, den der Wunsch, Schaden zuzufügen, verleiht. Er haßte Christof. Warum? Warum hegt ein Kind eine Abneigung gegen jemand, der ihm nichts getan hat? Oft ist es Zufall. Es genügt, daß das Kind sich eines Tages eingeredet hat, daß es jemanden nicht leiden mag, um sich daran zu gewöhnen; und je mehr man ihm gut zuredet, um so eigensinniger bleibt es; nachdem es erst den Haß gespielt hat, haßt es schließlich wirklich. Aber oft sind auch tiefere Gründe vorhanden, die über das Fassungsvermögen des Kindes hinausgehen; es ahnt sie nicht ... Von dem ersten Tage an, da er Christof kennen lernte, hatte der Sohn des Grafen Berény eine Feindseligkeit gegen den empfunden, den seine Mutter geliebt hatte. Man hätte meinen können, er habe genau in dem Augenblick, in dem Grazia daran dachte, Christof zu heiraten, dies unmittelbar erkannt. Von dem Augenblick an hörte er nicht auf, sie zu überwachen. Immer stand er zwischen ihnen. Er weigerte sich, den Salon zu verlassen, wenn Christof kam; oder er richtete es so ein, daß er plötzlich in das Zimmer hereinstürmte, in dem sie sich zusammen befanden. Ja, mehr noch, wenn seine Mutter allein war und an Christof dachte, schien er es zu ahnen. Er setzte sich neben sie und belauerte sie. Dieser Blick peinigte sie, ließ sie beinahe erröten. Sie stand auf, um ihre Verwirrung zu verbergen. Er machte sich ein Vergnügen daraus, vor ihr verletzende Dinge von Christof zu sagen. Sie bat ihn, zu schweigen. Er blieb dabei. Und wenn sie ihn bestrafen wollte, drohte er, sich krank machen zu wollen. Das war ein Verfahren, das er von Kindheit an mit Erfolg anwandte. Als er noch ganz klein war und man ihn eines Tages schalt, war er auf den Gedanken gekommen, sich aus Rache auszuziehen und ganz nackt auf die Fliesen zu legen, um eine starke Erkältung zu bekommen. – Einmal, als Christof ein musikalisches Werk, das er zu Grazias Geburtstag komponiert hatte, mitbrachte, hatte sich der Kleine des Manuskriptes bemächtigt und es verschwinden lassen. Man fand die Fetzen davon in einer Holztruhe. Grazia verlor die Geduld; sie schalt das Kind heftig. Da weinte er, schrie, stampfte mit dem Fuß auf, wälzte sich auf der Erde herum und bekam einen Nervenanfall. Grazia erschrak, küßte ihn, beschwor ihn und versprach ihm alles, was er wollte.
Von diesem Tage an war er der Herr: denn er wußte, er war es; und unzählige Male nahm er seine Zuflucht zu der Waffe, die er mit Erfolg angewendet hatte. Man wußte niemals, inwieweit seine Anfälle natürlich und inwieweit sie gespielt waren. Er begnügte sich nicht mehr damit, sie, wenn man ihn ärgerte, aus Rache heraufzubeschwören, sondern aus reiner Bosheit, wenn seine Mutter und Christof vorhatten, den Abend zusammen zu verbringen. Er kam schließlich dahin, dies gefährliche Spiel aus Langerweile und Heuchelei zu spielen und um zu versuchen, wie weit seine Macht reichte. Er entwickelte eine außerordentliche Begabung, neue sonderbare Nervenanfälle zu erfinden. Einmal überfiel ihn während des Essens ein konvulsivisches Zittern, er warf sein Glas um und zerbrach den Teller; ein andermal, als er eine Treppe hinaufstieg, klammerte er seine Hand an das Geländer und seine Finger krampften sich zusammen; er behauptete, sie nicht mehr aufzubekommen. Oder er hatte wohl auch einen stechenden Schmerz in der Seite und wälzte sich schreiend am Boden; oder er war nahe am Ersticken. Natürlich bekam er dadurch schließlich eine wirkliche Nervenkrankheit. Aber er hatte sich nicht vergeblich angestrengt. Christof und Grazia trugen den Schaden davon. Der Friede ihrer Zusammenkünfte, jene ruhigen Plaudereien, das Vorlesen, die Musik, alles, woraus sie sich ein Fest bereitet hatten – ihr ganzes bescheidenes Glück war von nun an gestört.
Dann und wann gewährte ihnen der durchtriebene Schlingel aber doch etwas Ruhe, weil ihn entweder seine Rolle ermüdete, oder seine Kindernatur zum Durchbruch kam und er an anderes dachte. (Er war jetzt sicher, das Spiel gewonnen zu haben.) Dann nutzten sie das ganz, ganz schnell aus. Jede Stunde, die sie sich so eroberten, war ihnen um so kostbarer, als sie nicht sicher waren, ob sie sie zu Ende genießen konnten. Wie nahe fühlten sie sich einander! Warum konnten sie nicht immer so bleiben? ... Eines Tages bekannte Grazia selbst diesen Kummer.
»Ja, warum?« fragte er.
»Sie wissen es ja, lieber Freund,« sagte sie mit tieftraurigem Lächeln.
Christof wußte es. Er wußte, daß sie ihrer beiden Glück ihrem Sohn opferte: er wußte, daß sie sich von Lionellos Lügen nicht täuschen ließ und daß sie ihn dennoch über alles liebte; er kannte die blinde Selbstsucht dieser Familiengefühle, bei denen die Besten ihre ganze Hingebungskraft zu Gunsten schlechter oder minderwertiger Wesen ihres Blutes verausgaben, so daß ihnen nichts mehr bleibt, um sie denen zu geben, die ihrer am würdigsten wären, denen, die sie am meisten lieben, die aber nicht ihres Blutes sind. Und obgleich ihn das aufbrachte, obgleich er in manchen Augenblicken Lust verspürte, das kleine Ungeheuer zu töten, das ihrer beider Leben zerstörte, beugte er sich schweigend und begriff, daß Grazia nicht anders handeln konnte. So verzichteten sie denn beide ohne unnützes Gejammer. Aber konnte man ihnen auch das Glück stehlen, das ihnen beschieden war, so konnte doch nichts ihre Herzen daran hindern, sich zu vereinen. Gerade der Verzicht, das gemeinsame Opfer, knüpfte sie mit stärkeren Banden aneinander, als die des Körpers. Jeder vertraute seine Kümmernisse dem Freunde an, lud sie auf ihn ab und nahm zum Tausch das Leid des Freundes: so verwandelte sich selbst der Kummer in Freude. Christof nannte Grazia seinen »Beichtiger«. Er verbarg ihr nicht die Schwächen, an denen seine Eitelkeit litt; er machte sie sich mit übertriebener Zerknirschung zum Vorwurf. Und sie beruhigte lächelnd die Gewissensbisse ihres großen Kindes. Er ging so weit, ihr seine materielle Not zu gestehen. Immerhin tat er es erst, nachdem es zwischen ihnen ausgemacht war, daß sie ihm nichts anbot und er nichts von ihr annahm. Eine letzte Hochmutsschranke, die er aufrecht hielt, und die sie achtete. Da es ihr nicht erlaubt war, Behaglichkeit in das Leben ihres Freundes zu tragen, so wurde sie erfinderisch, das über sein Leben auszubreiten, was tausendmal mehr Wert für ihn hatte: Zärtlichkeit. Nun fühlte er diesen Hauch zu jeder Tageszeit um sich. Er öffnete morgens nicht die Augen, er schloß sie abends nicht, ohne ein stilles Gebet liebender Anbetung. Und wenn sie erwachte, oder, was sehr oft geschah, nachts stundenlang wach lag, dachte sie:
»Mein Freund denkt an mich.«
Und eine große Ruhe verbreitete sich um sie her.
Allmählich aber war Grazias Gesundheit erschüttert worden. Sie mußte beständig im Bette liegen, oder Tage lang auf einem Divan hingestreckt verbringen. Christof kam täglich, um mit ihr zu plaudern oder zu lesen und ihr seine neuen Kompositionen zu zeigen. Dann stand sie von ihrem Ruhebett auf und schleppte sich auf unsicheren Füßen zum Klavier. Sie spielte ihm vor, was er mitgebracht hatte. Das war die größte Freude, die sie ihm machen konnte. Von allen Schülerinnen, die er ausgebildet hatte, war sie neben Cécile die weitaus Begabteste. Aber wenn Cécile Musik instinktmäßig empfand, beinahe, ohne sie zu begreifen, so war sie für Grazia eine schöne harmonische Sprache, deren Sinn sie kannte. Das Dämonische in dem Leben und der Kunst entging ihr völlig; sie goß die Klarheit ihres klugen Herzens hinein. Diese Klarheit durchdrang Christofs Genius. Das Spiel seiner Freundin ließ ihn die dunklen Leidenschaften, die er ausgedrückt hatte, besser verstehen. Mit geschlossenen Augen lauschte er ihr, folgte ihr, ließ sich an ihrer Hand durch den Irrgarten seiner eigenen Gedankenwelt leiten. Indem er seine Musik durch Grazias Seele erlebte, vermählte er sich ihrer Seele und besaß sie. Aus dieser geheimnisvollen Paarung wurden musikalische Werte geboren, die gleichsam die Frucht ihrer verschmolzenen Naturen waren. Das sagte er ihr eines Tages, als er ihr eine Sammlung seiner Vertonungen schenkte, die aus seinem und seiner Freundin innerstem Wesen gewebt waren.
»Unsere Kinder.«
Gemeinschaft in allen Augenblicken, in denen sie zusammen und in denen sie getrennt waren; wonnesame Abende, die sie in der Zurückgezogenheit des alten Hauses verlebten, dessen Rahmen wie für Grazias Bild geschaffen schien, und in dem schweigende und vertraute Dienstboten, die ihr ergeben waren, auf Christof etwas von der respektvollen Anhänglichkeit übertrugen, die sie für ihre Herrin empfanden. O Freude, zu zweit den Sang der verstreichenden Stunden zu vernehmen, den Strom des dahinfließenden Lebens zu schauen ... Die schwankende Gesundheit Grazias warf einen Schatten von Unruhe auf dieses Glück. Aber trotz ihrer kleinen Gebrechlichkeiten blieb sie so heiter, daß ihre geheimen Leiden ihren Reiz nur noch erhöhten. Sie war »seine liebe, leidende, rührende Freundin mit dem leuchtenden Gesicht«. Und er schrieb ihr nach manchem Abend, wenn er gerade von ihr nach Hause kam und sein Herz von Liebe so geschwellt war, daß er nicht bis zum nächsten Morgen warten wollte, um es ihr zu sagen:
»Liebe, liebe, liebe, liebe, liebe Grazia ...«
Diese Ruhe dauerte mehrere Monate. Sie dachten, sie würde immer dauern. Das Kind schien sie vergessen zu haben; seine Aufmerksamkeit war abgelenkt. Aber nach dieser Pause kam es auf sie zurück und ließ sie nicht mehr los. Der teuflische Kleine hatte sich in den Kopf gesetzt, seine Mutter von Christof zu trennen. Er begann seine Schauspielereien von neuem. Er trieb sie nicht nach vorgefaßten Plänen. Er folgte von einem Tag zum anderen den Launen seiner Bosheit. Er ahnte nicht, was er Schlimmes anrichtete; er suchte sich zu zerstreuen, indem er andere ärgerte. Er hörte nicht auf, bis er bei Grazia durchsetzte, daß sie von Paris wegginge, daß sie weit fortreisten. Grazia hatte nicht die Kraft, zu widerstehen. Im übrigen rieten ihr die Ärzte zu einem Aufenthalt in Ägypten. Sie sollte einen weiteren Winter in dem nordischen Klima vermeiden. Allzu vieles hatte sie zermürbt; die seelischen Erschütterungen der letzten Jahre, die beständige Sorge, die ihr die Gesundheit ihres Sohnes verursachte, die lange Ungewißheit, der Kampf, der in ihr tobte, und von dem sie nichts zeigte, der Kummer über den Kummer, den sie ihrem Freund bereitete. Christof, der ihre Qualen ahnte und sie nicht noch vermehren wollte, verbarg die, die er empfand, als er den Tag der Trennung näher kommen sah; er tat nichts, um ihn hinauszuschieben; und sie täuschten alle beide eine Ruhe vor, die sie nicht hatten, die sie aber schließlich aufeinander übertrugen.
Der Tag kam. Ein Septembermorgen. Sie hatten gemeinsam Mitte Juli Paris verlassen und die letzten Wochen, die ihnen blieben, in der Schweiz, in einem Berghotel, verbracht, nahe bei dem Ort, in dem sie sich vor nun schon sechs Jahren wiedergefunden hatten.
Seit fünf Tagen konnten sie nicht ausgehen; der Regen strömte unaufhörlich; sie waren fast allein im Hotel zurückgeblieben; die Mehrzahl der Reisenden war geflohen. An diesem letzten Morgen hörte der Regen endlich auf; aber das Gebirge blieb umwölkt. Die Kinder fuhren mit den Dienstboten im ersten Wagen voraus. Dann fuhr auch sie ab. Er begleitete sie bis dorthin, wo der Weg in schnellen Windungen zur italienischen Ebene abfiel. Unter dem Wagenverdeck drang die Feuchtigkeit in sie ein. Sie saßen eng aneinandergepreßt und redeten nichts; sie sahen einander kaum an. Sonderbares Halblicht, Halbdunkel hüllte sie ein! ... Grazias Atem näßte ihren Schleier. Er drückte die kleine warme Hand im Lederhandschuh. Ihre Gesichter neigten sich zueinander. Durch den feuchten Schleier hindurch küßte er den lieben Mund.
Sie waren an die Wegbiegung gekommen. Er stieg aus. Der Wagen tauchte im Nebel unter – und verschwand. Er hörte noch weiter das Rollen der Räder und die Hufschläge des Pferdes. Weiße Nebeltücher wogten über die Felder. Durch das dichte Geäst tropften die erstarrten Bäume. Kein Hauch. Der Nebel erstickte das Leben. Christof stand aufschluchzend still ... Nichts mehr. Alles ist vorbei.
Tief atmete er den Nebel ein. Er ging seinen Weg weiter. Nichts ist vorbei für den, mit dem es selbst nicht vorbei ist.
Die Abwesenheit vergrößert noch die Macht dessen, den man liebt. Das Herz bewahrt in sich nur das, was ihm in anderen teuer war. Das Echo jedes Wortes, das über den Raum hin von dem fernen Freunde kommt, löst in der Stille feierliche Schwingungen aus.
Christofs und Grazias Briefwechsel hatte den ernsten und verhaltenen Ton eines Paares angenommen, das nicht mehr die gefahrvolle Prüfung der Liebe zu bestehen hat, das darüber hinausgekommen ist, sich seines Weges sicher fühlt und Hand in Hand mit dem Freunde wandert. Jeder von beiden war stark, wenn es galt, den anderen zu stützen und zu lenken, schwach, wenn er sich von dem anderen lenken und stützen ließ. Christof kehrte nach Paris zurück. Er hatte sich vorgenommen, nicht mehr dorthin zu gehen. Was aber bedeuten Vorsätze! Er wußte, daß er dort noch den Schatten Grazias finden werde. Und die Umstände, die sich mit seinem geheimen Wunsch gegen seinen Willen verbündeten, wiesen ihm in Paris eine neue, zu erfüllende Pflicht. Colette, die gut in der Gesellschaftschronik Bescheid wußte, hatte Christof mitgeteilt, daß sein junger Freund Jeannin im besten Zuge war, Dummheiten zu begehen. Jacqueline, die ihrem Sohn gegenüber stets sehr schwach gewesen war, versuchte nicht mehr, ihn zurückzuhalten. Sie selbst machte eine eigenartige Krisis durch; sie war zu sehr mit sich beschäftigt, um sich um ihn zu kümmern.
Seit dem traurigen Abenteuer, das ihre Ehe und Oliviers Leben zerstört hatte, führte Jacqueline ein sehr ehrsames und zurückgezogenes Leben. Sie hielt sich abseits von der Pariser Gesellschaft, die, nachdem sie ihr heuchlerisch eine Art von Verbannung auferlegt, ihr von neuem Entgegenkommen gezeigt hatte. Aber sie hatte es zurückgewiesen. Sie empfand diesen Leuten gegenüber wegen ihrer Handlungsweise keinerlei Scham; sie fand, daß sie ihnen keine Rechenschaft schulde; denn sie waren weniger wert als sie; was sie freimütig getan hatte, tat die Hälfte aller Frauen, die sie kannte, ohne Aufsehen zu erregen, unter dem schützenden Dach des Hauses. Sie litt nur unter dem Leid, das sie ihrem besten Freunde zugefügt hatte, dem einzigen, der sie geliebt hatte. Sie verzieh sich nicht, daß sie in dieser Welt, die so arm ist, ein Gefühl wie das seine, verloren hatte.
Diese Reue, dieser Kummer, milderte sich allmählich. Ein dumpfes Leid nur blieb bestehen, eine demütige Selbstverachtung und eine Verachtung der anderen. Und die Liebe zu ihrem Kinde. Dieses Gefühl, in das sie ihr ganzes Liebesbedürfnis ergoß, machte sie ihm gegenüber nachsichtig. Sie war unfähig, Georgs Launen zu widerstehen. Um ihre Schwäche zu entschuldigen, redete sie sich ein, daß sie so das Unrecht gegen Olivier wieder gutmache. Auf Zeiten übertriebener Zärtlichkeit folgten Zeiten matter Gleichgültigkeit; einmal ermüdete sie Georg mit ihrer anspruchsvollen und besorgten Liebe, ein anderes Mal schien sie seiner müde zu werden und ließ ihn alles tun. Sie machte sich klar, daß sie eine schlechte Erzieherin sei, und machte sich darüber Vorwürfe, aber sie änderte nichts. Wenn sie (selten genug) versucht hatte, ihre Erziehungsmaßregeln in Oliviers Sinn zu gestalten, war das Ergebnis jammervoll gewesen; dieser seelische Pessimismus paßte weder für sie noch für das Kind. Im Grunde wollte sie auf ihren Sohn keine andere Herrschaft als die ihres Gefühles ausüben. Und sie hatte nicht unrecht; denn zwischen diesen beiden Wesen bestanden, wenn sie auch noch so ähnlich waren, keine anderen Bande als die des Herzens. Georg Jeannin empfand den physischen Zauber seiner Mutter; er liebte ihre Stimme, ihre Gebärden, ihre Bewegungen, ihre Anmut, ihre Liebe. Aber geistig stand er ihr fremd gegenüber. Das merkte sie bei der ersten Regung seiner Jünglingsseele, als er von ihr ins Weite flog. Da wunderte sie sich, lehnte sich auf und schob diese Entfremdung anderen weiblichen Einflüssen zu; als sie sie aber ungeschickt bekämpfen wollte, entfremdete sie sich ihn nur noch mehr. In Wahrheit hatten sie stets neben einander hergelebt, waren jeder von verschiedenen Sorgen erfüllt gewesen und hatten sich über das hinweggetäuscht, was sie trennte; denn sie empfanden nur die Gemeinsamkeit ihrer ganz oberflächlichen Sympathien und Antipathien, von denen nichts mehr übrig blieb, als aus dem Kinde (diesem Zwitterwesen, das noch ganz vom Dufte der Frau durchtränkt ist) der Mann hervorging. Und Jacqueline sagte voll Bitterkeit zu ihrem Sohne:
»Ich weiß nicht, wem du nachgerätst! du ähnelst weder deinem Vater noch mir.«
So ließ sie ihn vollends das empfinden, was sie voneinander trennte; und er empfand darüber einen geheimen Stolz, in den sich ein unruhiges Fieber mischte.
Die Generationen, die einander folgen, empfinden immer lebhafter das, was sie trennt, als das, was sie eint; sie fühlen das Bedürfnis, die Wichtigkeit ihres Daseins zu betonen, sei es auch um den Preis einer Ungerechtigkeit oder einer Lüge gegen sich selbst. Aber dies Gefühl ist je nach der Zeit mehr oder weniger ausgeprägt. In den klassischen Epochen, in denen sich für kurze Zeit das Gleichgewicht der Kräfte einer Zivilisation verwirklicht – auf diesen von steilen Abhängen begrenzten Hochebenen – ist der Unterschied zwischen der einen Generation und der anderen weniger groß. Aber in den Epochen von Aufstieg oder Abstieg lassen die jungen Menschen, die emporklimmen oder den schwindelnden Abhang hinabstürzen, die, die vor ihnen kamen, weit hinter sich. – Georg stieg mit seinen Altersgenossen den Berg wieder empor.
Er war weder geistig noch dem Charakter nach etwas Hervorragendes: bei ziemlich gleichmäßig verteilten Anlagen überstieg keine die Höhe einer gefälligen Mittelmäßigkeit. Und dennoch stand er ohne Anstrengung schon am Anfang seines Weges ein paar Stufen höher als sein Vater, der in seinem allzu kurzen Leben eine unabwägbare Summe von Intelligenz und Kraft verschwendet hatte.
Kaum hatten sich die Augen seiner Vernunft dem Lichte geöffnet, so sah er rings um sich her Nebelballen, die von blendenden Lichtstrahlen durchdrungen waren, Anhäufungen von Kenntnissen und Unkenntnissen, von einander feindlichen Wahrheiten und sich widersprechenden Irrtümern, zwischen denen sein Vater fieberhaft hin- und hergeirrt war. Gleichzeitig aber wurde er sich einer Waffe bewußt, die in seinem Machtbereich lag, und die seine Vorgänger nicht gekannt hatten: seine Kraft ... Woher kam sie ihm? ... Geheimnisvolles Wiederaufleben eines Geschlechtes, das erschöpft entschlummert ist und überströmend gleich einem Gebirgsbach im Frühling neu erwacht! ... Was sollte er mit dieser Kraft machen? Sollte er sie für sich dazu verwenden, das unentwirrbare Dickicht der modernen Gedankenwelt zu durchforschen? Das zog ihn nicht an. Er fühlte die Drohung der dort lauernden Gefahren auf sich lasten. Sie hatten seinen Vater zu Boden geschmettert. Ehe er dasselbe durchmachte und in den tragischen Wald zurückkehrte, hätte er Feuer daran gelegt. Er hatte in die Bücher der Weisheit und des heiligen Wahnsinns, an denen sich Olivier berauscht hatte, nur gerade hineingeschaut: in das nihilistische Mitleid eines Tolstoi, den düsteren Zerstörungsstolz eines Ibsen, die Raserei Nietzsches, den heldenhaften und sinnlichen Pessimismus Wagners. Mit einem Gemisch von Zorn und Entsetzen hatte er sich davon abgewandt. Er haßte die Reihe realistischer Schriftsteller, die ein halbes Jahrhundert lang die Freude in der Kunst getötet hatten. Doch konnte er die Schatten des trüben Traumes nicht ganz und gar verjagen, mit dem seine Kindheit gewiegt worden war. Er wollte nicht hinter sich schauen; aber er wußte genau, daß hinter ihm der Schatten lag. Zu gesund, um eine Ablenkung von seiner Unruhe in der trägen Zweifelsucht der vorhergehenden Epoche zu suchen, verabscheute er den Dilettantismus eines Renan und Anatole France, diese Entartung freien Denkens, dieses Lachen ohne Heiterkeit, diese Ironie ohne Größe: ein schmachvolles Mittel und nur gut für Sklaven, die mit ihren Ketten spielen, weil sie unfähig sind, sie zu zerbrechen.
Zu kraftvoll, um sich mit dem Zweifel zu begnügen, zu schwach, um sich Gewißheit zu verschaffen, verlangte er doch nach ihr, verlangte sie mit aller Kraft. Er bat um sie, er erflehte, er forderte sie. Und die ewig alten Popularitätshascher, die unechten Schriftstellergrößen, die unechten, auf der Lauer liegenden Denker beuteten solchen wundervollen, heischenden und angstvollen Wunsch aus, indem sie die Trommel rührten und die Marktschreier für ihre Schundware machten. Von seiner Gauklerbühne herab schrie jeder dieser Quacksalber, daß sein Tränkchen das einzig gute wäre, und verleumdete dabei die anderen. Ihre Geheimnisse waren alle gleich viel wert. Keiner dieser Händler hatte sich die Mühe gegeben, neue Rezepte zu finden. Sie hatten aus ihren Schrankwinkeln verwitterte Flaschen herausgesucht. Das Universalmittel des einen war die katholische Kirche, das des anderen die angestammte Monarchie, das des dritten die klassische Überlieferung; Spaßvögel waren darunter, die als Heilmittel sämtlicher Leiden die Rückkehr zum Lateinischen anpriesen. Andere predigten mit ungeheurem Wortschwall, der Hohlköpfen imponierte, in allem Ernst die Vorherrschaft des Festland-Geistes (sie wären in einem anderen Augenblick ebenso gut für den Übersee-Geist eingetreten). Gegenüber den Barbaren des Nordens und Ostens setzten sie mit Pomp die Erben eines neuen römischen Kaiserreiches ein ...
Worte, Worte, nichts als übernommene Worte. Eine ganze Bücherei, die sie in den Wind verstreuten. – Wie alle seine Kameraden ging der junge Jeannin von einem zum anderen Verkäufer, hörte der Possenszene zu, ließ sich manchmal verleiten, in die Bude hineinzugehen, und kam enttäuscht und ein wenig beschämt wieder heraus, weil er sein Geld und seine Zeit dafür hergegeben hatte, alte Clowns in abgenutzten Trikots anzusehen. Und doch ist die Hoffnungskraft der Jugend so groß, so groß die Gewißheit, zur Gewißheit zu gelangen, daß er bei jedem neuen Versprechen eines neuen Hoffnungs-Verkäufers sich wieder von neuem einfangen ließ. Er war ein echter Franzose: er hatte einen tadelsüchtigen Geist und war von einer angeborenen Liebe zur Ordnung erfüllt. Er brauchte einen Führer und war doch unfähig, irgend einen zu ertragen. Seine unbarmherzige Ironie durchschaute sie alle.
Während er so auf jemand wartete, der ihm das Rätselwort verraten würde –, fand er zum Warten keine Zeit. Er war nicht der Mensch, der sich gleich seinem Vater damit zufrieden gab, sein ganzes Leben lang die Wahrheit zu suchen. Seine junge, ungeduldige Kraft wollte sich ausleben. Mit oder ohne Grund wollte er zum Entschluß kommen. Er wollte handeln, seine Tatkraft verwenden, sie verbrauchen. Reisen, Kunstgenüsse, vor allem Musik, mit der er sich überladen hatte, bedeuteten ihm zunächst eine zeitweilige und leidenschaftliche Zerstreuung. Als hübscher, frühreifer Junge, der den Versuchungen ausgesetzt war, entdeckte er zeitig die Welt der durch das Äußere bestrickenden Liebe und stürzte sich mit dem Ungestüm genießerischer und romantischer Freude hinein. Dann wurde der kleine, kindliche und in seiner Frechheit unersättliche Cherubin der Frauen überdrüssig. Er brauchte Betätigung. So gab er sich mit Leidenschaft dem Sport hin. Er versuchte jeden, übte einen jeden aus. Er wohnte regelmäßig den Fecht-Turnieren und Boxerkämpfen bei. Er wurde französischer Champion im Wettlauf und Höhensprung und Führer einer Fußballgruppe. Mit ein paar jungen Tollköpfen seines Schlages, reichen Waghälsen, wetteiferte er an Kühnheit, in sinnlosen und übertriebenen Autofahrten, wahren Todesfahrten. Schließlich ließ er alles für das neue Steckenpferd liegen. Er nahm an der Massenbegeisterung für die Flugzeuge teil. Bei den Flugfesten, die in Reims stattfanden, heulte und weinte er vor Freude gemeinsam mit dreimalhunderttausend Menschen; er fühlte sich eins mit diesem ganzen Volk in glaubensseligem Jubel; die menschlichen Vögel, die über sie hinflogen, rissen sie in ihrem Schwung mit empor; zum ersten Male seit der Morgenröte der großen Revolution hoben diese zusammengepferchten Massen die Augen gen Himmel und sahen ihn sich öffnen. – Zum Entsetzen seiner Mutter erklärte der junge Jeannin, daß er sich der großen Schar der Lufteroberer zugesellen wolle. Jacqueline beschwor ihn, auf diesen gefährlichen Ehrgeiz zu verzichten. Sie befahl es ihm. Er setzte seinen Kopf durch. Christof, in dem Jacqueline einen Verbündeten zu finden hoffte, begnügte sich damit, dem jungen Manne einige Vorsichtsmaßregeln zu geben, von denen er im übrigen überzeugt war, daß Georg sie nicht befolgen würde. (Denn er hätte sie an seiner Stelle auch nicht befolgt.) Er gestand sich nicht das Recht zu – selbst, wenn er es vermocht hätte – das gesunde und normale Spiel junger Kräfte zu unterbinden, die, zur Tatenlosigkeit gezwungen, sich sonst selbst zerstört hätten.
Jacqueline konnte sich nicht damit abfinden, daß ihr Sohn ihr entglitt. Vergeblich hatte sie geglaubt, aufrichtig auf die Liebe zu verzichten; sie konnte den Traum der Liebe nicht entbehren; alle ihre Zuneigungen, alle ihre Empfindungen waren davon durchtränkt. Wieviele Mütter übertragen auf ihren Sohn die geheime Glut, die sie in der Ehe und außerhalb der Ehe nicht ausgeben konnten. Und wenn sie dann sehen, mit welcher Leichtigkeit der Sohn sie entbehren kann, wenn sie plötzlich begreifen, daß sie ihm nicht notwendig sind, machen sie eine Krisis derselben Art durch wie die, in welche sie der Verrat des Geliebten, die Enttäuschung der Liebe gestürzt hat. – Für Jacqueline wurde das ein neuer Zusammenbruch. Georg merkte nichts davon. Junge Leute ahnen nichts von den Herzenstragödien, die sich rings um sie abspielen: sie haben nicht die Zeit, stille zu stehen, um auszuschauen. Und sie wollen nichts sehen: ein Instinkt der Selbstsucht rät ihnen, geradeaus zu gehen, ohne den Kopf zu wenden.
Jacqueline mußte diesen neuen Schmerz allein überwinden. Sie wurde damit erst fertig, als der Schmerz sich verbraucht hatte. Verbraucht mit ihrer Liebe. Sie liebte ihren Sohn immer noch, aber mit einem feinen, hellsichtigen Gefühl, das sich als nutzlos erkannte und sich von sich selbst und von ihm loslöste. So schleppte sie sich durch ein trübes und elendes Jahr, ohne daß er darauf achtete. Und dann sollte dieses unglückliche Herz, das ohne Liebe weder leben noch sterben konnte, dahin kommen, einen Gegenstand der Liebe zu erfinden. Sie fiel einer seltsamen Leidenschaft zum Opfer, die weibliche Seelen häufig heimsucht, und wie es heißt, vor allem die edelsten und unantastbarsten, wenn die Reife kommt, und die schöne Lebensfrucht nicht gepflückt worden ist. Sie machte die Bekanntschaft einer Frau, die sie von der ersten Begegnung an ihrer geheimnisvollen Anziehungskraft unterwarf.
Sie war eine Nonne, ungefähr ihres Alters. Sie übte wohltätige Werke. Eine große, starke, ein wenig korpulente Frau; braun, mit schönen, ausdrucksvollen Zügen, lebhaften Augen, einem breiten, feinen Mund, der immer lächelte, einem gebieterischen Kinn. Sie war von bemerkenswerter Klugheit, ohne jeden Gefühlsüberschwang: eine schlaue Bäuerin mit ausgeprägtem Geschäftssinn, der mit einer südländischen Fantasie zusammenging, die gern ins Große sah, aber gleichzeitig, wenn es nötig war, wohl verstand, den richtigen Maßstab anzulegen; ein kraftvolles Gemisch von erhabenem Mystizismus und alter Advokatenschlauheit. Sie war das Herrschen gewöhnt und übte es in natürlicher Weise aus. Jacqueline wurde sofort gefangen genommen. Sie begeisterte sich für das fromme Werk. Sie glaubte es wenigstens. Schwester Angela wußte, wem die Leidenschaft galt: sie war daran gewöhnt, ähnliche zu erwecken; ohne sie scheinbar zu bemerken, verstand sie kühl, sie in den Dienst des Werkes zu stellen und zu Gottes Ruhm auszunutzen. Jacqueline gab ihr Geld, ihren Willen, ihr Herz. Aus Liebe wurde sie mildtätig und glaubte.
Es dauerte nicht lange und man bemerkte den Bann, in dem sie lag. Sie war die Einzige, die sich nicht darüber Rechenschaft gab. Georgs Vormund wurde besorgt. Georg, der zu großzügig und zu unbesonnen war, um sich um Geldfragen zu kümmern, merkte selbst, wie man seine Mutter umgarnte; und das traf ihn hart. Er versuchte zu spät, die frühere Vertrautheit mit ihr wieder herzustellen. Er sah, daß sich ein Vorhang zwischen sie gebreitet hatte; er schob das dem geheimen Einfluß zu und empfand gegen die Intrigantin, wie er sie nannte, nicht weniger als gegen Jacqueline selbst eine Gereiztheit, die er nicht verbarg; er wehrte sich dagegen, daß eine Fremde ihm den Platz in einem Herzen geraubt hatte, den er als sein natürliches Recht empfand. Er sagte sich nicht, daß der Platz nur darum besetzt sei, weil er ihn aufgegeben hatte. Anstatt mit Geduld die Wiedereroberung zu versuchen, wurde er ungeschickt und verletzend. Zwischen Mutter und Sohn, die beide ungeduldig und leidenschaftlich waren, fand ein heftiger Wortwechsel statt; die Spaltung verschärfte sich. Schwester Angela befestigte ihren Einfluß auf Jacqueline vollends, und Georg, dem volle Freiheit gelassen war, ging immer mehr Seitenwege. Er stürzte sich in ein betriebsames Verschwenderleben. Er spielte, er verlor beträchtliche Summen. Er setzte einen gewissen Stolz in seine Überspanntheiten, einesteils weil es ihm Spaß machte und dann auch, um den Überspanntheiten seiner Mutter die Spitze zu bieten. – Er kannte die Stevens-Delestrade. Colette war der hübsche Bursche wohl aufgefallen, und sie versuchte ihre Reize, die noch immer wirksam waren, an ihm. Sie wußte über die Streiche Georgs Bescheid. Sie machten ihr Spaß. Aber der Untergrund von gesundem Menschenverstand und wirklicher Güte, die unter ihrer Leichtlebigkeit verborgen waren, zeigte ihr die Gefahr, in die der junge Tollkopf lief. Und da sie wußte, daß sie nicht fähig sein werde, ihn davor zu bewahren, verständigte sie Christof, der sogleich zurückkam.
Christof war der einzige, der einigen Einfluß auf den jungen Jeannin hatte, einen zwar begrenzten und oft unterbrochenen Einfluß, der aber um so bemerkenswerter war, als er sich schwer erklären ließ. Christof gehörte der verflossenen Generation an, gegen die Georg und seine Gefährten mit Heftigkeit ankämpften. Er war einer der hervorragendsten Vertreter jener zerquälten Epoche, deren Kunst und Gedankenwelt ihnen mißtrauische Feindseligkeit einflößte. Er blieb für die neuen Evangelien und für die Amulette der kleinen Propheten und der alten Medizinmänner unzugänglich, die den guten jungen Leuten das unfehlbare Rezept darboten, wie man die Welt, Rom und Frankreich zu erlösen vermöge. Er blieb einem freien Glauben treu, frei von allen Bekenntnissen, frei von allen Parteien, frei von allen Vaterländern. Einem Glauben, der nicht mehr in Mode war – oder es noch nicht wieder geworden war. Endlich: so wenig er sich auch um nationale Fragen kümmerte, er war in Paris doch ein Fremder zu einer Zeit, wo dem natürlichen Empfinden aller Länder alle Fremden als Barbaren galten. Und dieser kleine heitere, leichtlebige Jeannin, der instinktiv allem feind war, was ihn betrüben oder verwirren konnte, der vergnügungssüchtig und leidenschaftlich dem Spiel ergeben war, der sich von der Rhetorik seiner Zeit leicht betören ließ und vor Muskelkraft und geistiger Trägheit den brutalen Lehren der nationalistischen, royalistischen, imperialistischen » Action française« zuneigte – (er wußte selbst nicht welcher) – dieser kleine Jeannin achtete dennoch im Grunde nur einen einzigen Menschen: Christof. Seine frühreife Erfahrung und das außerordentlich feine Taktgefühl, das er von seiner Mutter hatte, ließen ihn (ohne daß er sich die gute Laune dadurch verderben ließ) erkennen, wie wenig die Welt, die er nicht entbehren konnte, wert sei und wie hoch Christof über ihr stand. Er berauschte sich vergeblich an Bewegung und Handlung: das väterliche Erbteil konnte er nicht verleugnen. Von Olivier hatte er eine unbestimmte Unruhe mitbekommen, die ihn in plötzlichen und kurzen Anfällen heimsuchte: das Bedürfnis, seinem Tun ein festes Ziel zu setzen. Und vielleicht hatte er auch von Olivier den geheimnisvollen Trieb geerbt, der ihn zu dem hinzog, den Olivier geliebt hatte.
Er besuchte Christof; mitteilsam und ein wenig geschwätzig wie er war, vertraute er sich gerne an. Er kümmerte sich nicht darum, ob Christof Zeit habe, ihm zuzuhören. Christof hörte trotzdem zu und äußerte keinerlei Zeichen von Ungeduld. Es kam nur vor, daß er zerstreut war, wenn der Besuch ihn mitten in einer Arbeit überraschte. Das war die Angelegenheit einiger Minuten, währenddem sein Geist abschweifte, um das innere Werk um einen Zug, eine Schattierung zu bereichern; dann kam er zu Georg zurück, der seine Abwesenheit nicht bemerkt hatte. Ein solcher Seitensprung machte ihm Spaß wie einem, der auf den Zehenspitzen hereinkommt, ohne daß man ihn hört. Ein oder zwei Mal aber merkte es Georg und sagte ganz empört: »Aber du hörst mir ja nicht zu.«
Dann schämte sich Christof; gefügig schickte er sich an, seinem ungeduldigen Erzähler zu folgen, und verdoppelte seine Aufmerksamkeit, um es wieder gutzumachen. Was Georg erzählte, war nicht ohne Komik, und Christof konnte sich beim Bericht über einige Streiche nicht enthalten zu lachen: denn Georg erzählte alles; er war von entwaffnender Offenheit.
Christof lachte nicht immer. Georgs Betragen war ihm oft peinlich. Christof war kein Heiliger; er schrieb sich nicht das Recht zu, irgend jemand Moral zu predigen. Die Liebesabenteuer Georgs, die empörende Verschleuderung seines Vermögens in Dummheiten waren nicht das, was ihn am meisten verletzte. Was er am schwersten verzieh, war Georgs geistiger Leichtsinn seinen Fehlern gegenüber: sie lasteten wirklich wenig auf ihm; er fand sie natürlich. Er hatte von Sittlichkeit einen anderen Begriff wie Christof. Er gehörte zu dem Schlage der jungen Leute, die in den Beziehungen zwischen den Geschlechtern gern nur ein freies Spiel sehen, das jedes sittlichen Charakters bar ist. Ein gewisser Freimut und sorglose Güte waren für einen anständigen Menschen eine genügende Ausrüstung. Er beschwerte sich nicht mit Skrupeln wie Christof. Dieser wurde ärgerlich. Wenn er sich auch noch so sehr abmühte, dem anderen seine Gefühlsart nicht aufzuzwingen, so war er doch nicht duldsam; seine einstige Heftigkeit war nur halb gebändigt. Manchmal brach sie wieder durch. Manche Abenteuer Georgs konnte er nur als Schmutzereien ansehen und sagte es ihm auf den Kopf zu. Georg war nicht geduldig. Es kam zu ziemlich heftigen Auftritten. Dann sahen sie sich wochenlang nicht mehr. Christof machte sich klar, daß diese Heftigkeit nicht dazu angetan war, Georgs Betragen zu ändern, und daß eine gewisse Ungerechtigkeit darin lag, die Sittlichkeit einer Generation mit dem Maßstabe der sittlichen Ideen einer anderen Generation zu messen. Aber es war stärker als er: bei der nächsten Gelegenheit machte er es wieder ebenso. Wie soll man an dem Glauben zweifeln, für den man gelebt hat? Ebenso gut könnte man auf das Leben verzichten. Wozu ist es gut, sich zu Gedanken zu zwingen, die man nicht denkt? Um dem Nachbar zu ähneln, oder um ihn zu schonen? Das hieße, sich selbst zerstören, ohne irgend jemand zu nützen. Die erste Pflicht ist, zu sein, was man ist, den Mut zu haben, zu sagen: »Das ist gut, das ist schlecht.« Man tut den Schwachen mehr Gutes, wenn man stark ist, als wenn man schwach wird wie sie. Seid meinetwegen nachsichtig gegenüber einmal begangenen Schwachheiten, aber findet euch niemals mit einer Schwachheit ab, die begangen werden soll. Aber Georg hütete sich wohl, Christof über das zu befragen, was er begehen wollte. (Wußte er es selbst?) Er redete nur dann über etwas mit ihm, wenn es getan war. – Und dann? ... Was blieb Christof dann übrig, als den Taugenichts mit stummem Vorwurf anzuschauen und lächelnd die Achseln zu zucken wie ein alter Onkel, der weiß, daß man nicht auf ihn hört? An einem solchen Tage entstand ein kurzes Schweigen zwischen ihnen. Georg betrachtete Christofs Augen, die aus weiter Ferne zu kommen schienen. Und er fühlte sich ihm gegenüber wie ein ganz kleiner Junge. Er sah sich so, wie er war, in dem Spiegel dieses durchdringenden Blickes, in dem ein Schimmer von Spott aufleuchtete, und er war darauf nicht sehr stolz. Christof nützte die Beichten, die Georg ihm gerade gemacht hatte, selten gegen ihn aus; man hätte meinen können, er habe sie nicht gehört. Nach der stummen Zwiesprache ihrer Augen schüttelte er spottlustig den Kopf; dann begann er eine Geschichte zu erzählen, die scheinbar in keinerlei Beziehung zu dem Vorhergehenden stand: eine Geschichte aus seinem Leben oder aus irgend einem anderen wirklichen oder erfundenen Leben; und Georg sah nach und nach in neuem Lichte, und durch eine ärgerliche und lächerliche Situation bloßgestellt, seinen Doppelgänger auftauchen (er erkannte ihn wohl), der ähnliche Irrwege wie er ging. Dann konnte er nicht anders, als über sich und die klägliche Figur, die er spielte, lachen. Christof fügte keine Erläuterung hinzu. Was noch mehr wirkte als die Geschichte, war die kraftvolle Gutmütigkeit des Erzählers. Er sprach von sich wie von anderen mit derselben Überlegenheit, mit derselben fröhlichen und heiteren Laune. Diese Ruhe imponierte Georg. Diese Ruhe war es, die er bei ihm suchte. Wenn er sich seiner wortreichen Beichte entledigt hatte, fühlte er sich wie einer, der sich im Schatten eines großen Baumes an einem Sommernachmittag hinstreckt und sich reckt. Die fiebererregende Blendung des glühenden Tages ließ nach. Er fühlte über sich den Frieden schützender Schwingen. – Neben diesem Manne, der mit Seelenruhe die Last eines schweren Lebens trug, war er vor seinen eigenen Erregungen sicher. Hörte er ihn reden, so genoß er der Rast. Auch er hörte nicht immer zu: er ließ seinen Geist umherschweifen; aber wohin er sich auch verirrte, das Lachen Christofs folgte ihm.
Indessen blieben ihm die Gedankengänge seines alten Freundes fremd. Er fragte sich, wie Christof diese seelische Einsamkeit ertragen, wie er sich jedes Anschlusses an eine künstlerische, politische oder religiöse Partei, an irgend eine menschliche Gruppe enthalten könne. Er fragte ihn, ob er niemals das Bedürfnis empfände, sich einer Partei anzuschließen.
»Sich einschließen!« meinte Christof lachend. »Geht es einem draußen nicht gut? Und du redest davon, dich einzusperren, du, der Freiluftmensch?«
»O, für den Körper und für die Seele gilt doch nicht dasselbe,« erwiderte Georg; »der Geist hat Sicherheit nötig. Er muß in Gemeinschaft mit anderen denken, sich an die von allen Menschen einer Zeit anerkannten Grundsätze halten. Ich beneide die Menschen von ehedem, der klassischen Zeitalter. Meine Freunde haben recht, die die schöne Ordnung der Vergangenheit wieder aufrichten wollen.«
»Du Hasenherz!« sagte Christof. »Sind wir schon so ängstlich geworden?«
»Ich bin kein Angsthase,« widersprach Georg. »Keiner von uns ist es.«
»Ihr müßt schon welche sein,« sagte Christof, »wenn ihr vor euch selbst Angst habt. Wie? Ihr braucht eine Ordnung und könnt sie euch nicht selbst schaffen? Ihr müßt euch an die Röcke eurer Urgroßmütter hängen? Guter Gott, geht doch allein!«
»Man muß sich verwurzeln,« sagte Georg voller Stolz, wenn er so eines der Schlagworte der Zeit wiederholte.
»Sag mal, haben die Bäume, wenn sie sich verwurzeln wollen, Kübel nötig? Die Erde ist für alle da. Senke deine Wurzeln hinein. Finde deine Gesetze. Such in dir.«
»Ich habe keine Zeit,« sagte Georg.
»Du hast Angst,« wiederholte Christof.
Georg widersprach heftig. Aber schließlich gab er doch zu, daß er keinerlei Lust habe, in die Tiefen seiner selbst zu schauen; er begriff nicht, daß einem das Vergnügen machen könne: wenn man sich über dieses schwarze Loch beugte, lief man Gefahr hineinzufallen.
»Gib mir die Hand,« sagte Christof. Es machte ihm Spaß, die Falltüre über seiner realistischen und tragischen Lebensanschauung zu öffnen. Georg zuckte zurück. Christof schloß lachend die Klappe.
»Wie können Sie so leben?« fragte Georg.
»Ich lebe und bin glücklich,« sagte Christof.
»Ich würde sterben, wenn man mich zwänge, das immer zu sehen.«
Christof klopfte ihm auf die Schulter:
»Da haben wir unsere großen Athleten! ... Nun, so schau doch nicht hin, wenn du dich nicht sicher genug fühlst. Nichts zwingt dich schließlich dazu. Geh vorwärts, mein Junge. Aber brauchst du dazu einen Herrn, der dich auf der Schulter abstempelt wie das Rindvieh? Auf welche Parole wartest du? Das Signal ist schon seit langem gegeben. Es hat zur Attacke geblasen. Die Kavallerie geht vor. Kümmere dich nur um dein Pferd. Galopp! Sammeln!«
»Aber wohin geht es?« fragte Georg.
»Wo deine Schwadron hingeht. An die Eroberung der Welt. Bemächtigt euch der Luft, unterwerft euch die Elemente, dringt in die letzten Schlupfwinkel der Natur. Überbrückt den Raum, schlagt den Tod in die Flucht ...
› Expertus vacuum Daedalus aera ...‹
Du alter Lateiner, sag, kennst du das? Bist du auch nur imstande, mir zu erklären, was das heißen soll?
› Perrupit Acheronta ...‹
… Das ist euer Los. Glückliche Conquistadores!«
Er bewies so klar die Pflicht heldenhaften Handelns, die der neuen Generation oblag, daß Georg erstaunt sagte:
»Aber wenn Sie das fühlen, warum kommen Sie nicht auf unsere Seite?«
»Weil ich eine andere Aufgabe habe. Geh, mein Junge, vollende dein Werk. Geh über mich hinaus, wenn du kannst. Ich bleibe hier und wache ... Hast du die Geschichte aus Tausend und eine Nacht gelesen, in der ein Dämon, so groß wie ein Berg, unter dem Siegel Salomonis in eine Flasche geschlossen ist? ... Der Dämon ist hier, im Grunde unserer Seele, der Seele, über die dich zu beugen du Furcht hast. Ich und meine Zeitgenossen, wir haben unser Leben damit zugebracht, mit dieser Seele zu kämpfen. Wir haben sie nicht besiegt, sie hat uns nicht besiegt. Jetzt schöpfen wir und sie Atem und schauen einander ohne Groll und ohne Furcht an, befriedigt von den Schlachten, die wir einander geliefert haben, voll Erwartung, daß der zugebilligte Waffenstillstand abläuft. Nützt auch ihr den Waffenstillstand aus, um eure Kräfte wieder hochzubringen und die Schönheit der Welt in euch aufzunehmen. Seid glücklich, genießt die Windstille. Aber denkt daran, daß eines Tages ihr, oder die, die eure Söhne sein werden, beim Wiederbeginn eurer Eroberungen auf den Punkt, auf dem ich stehe, zurückkommen müßt, und daß ihr mit neuen Kräften den Kampf wieder aufnehmen werdet gegen den, der da ist und in dessen Nähe ich wache. Und der Kampf wird, von Waffenstillständen unterbrochen, andauern, bis einer von beiden (und vielleicht alle beide) niedergeschmettert sind. An euch ist es, stärker und glücklicher zu sein als wir! ... – Unterdessen treibe Sport, wenn du willst; mach deine Muskeln und dein Herz kriegerisch; und sei nicht so toll, deine ungeduldige Kraft an Albernheiten zu verschleudern: du gehörst (sei ruhig!) einer Zeit an, die sie brauchen wird!«
Georg merkte sich nicht viel von dem, was Christof ihm sagte. Sein Geist war offen genug, um Christofs Gedanken aufnehmen zu können; aber sie gingen gleich wieder heraus. Er war noch nicht die Treppe hinunter, und schon hatte er alles vergessen. Zwar stand er noch unter dem Eindruck eines Wohlbehagens, das fortdauerte, auch nachdem die Erinnerung an seine Ursache längst erloschen war. Er hegte für Christof große Verehrung. Er glaubte an nichts, woran Christof glaubte. (Im Grunde lachte er über alles und glaubte an nichts.) Aber er würde dem den Schädel eingeschlagen haben, der sich erlaubt hätte, von seinem alten Freunde schlecht zu reden.
Zum Glück redete man ihm gegenüber nichts: sonst hätte er viel zu tun bekommen.
Christof hatte die nächste Drehung des Windes wohl vorausgesehen. Das neue Ideal der jungen französischen Musik war von dem seinen sehr verschieden; aber obgleich das ein Grund mehr für Christof war, Sympathie für die junge Generation zu empfinden, so hatte sie doch keine für ihn. Sein Beifall beim Publikum war nicht dazu angetan, ihn mit den ruhmgierigen jungen Leuten in gutes Einvernehmen zu setzen; sie hatten nicht viel vor, dafür waren ihre Hauer um so länger und bissiger. Christof regte sich über ihre Bosheit nicht auf.
»Wie sie sich aufregen!« sagte er. »Sie bekommen Zähne, die Kleinen ...«
Er zog sie beinahe den anderen jungen Hunden vor, die ihn umschmeichelten, weil er Erfolg hatte, – von denen d'Aubigné sagt, daß sie, »wenn ein Fleischerhund den Kopf in einen Buttertopf gesteckt hat, kommen und ihm als Gratulation die Barthaare ablecken.«
Ein Werk von ihm war von der großen Oper erworben worden. Es war kaum angenommen, als man auch schon mit den Proben dazu begann. Eines Tages erfuhr Christof durch Zeitungsangriffe, daß man das Stück eines jungen Komponisten, das aufgeführt werden sollte, zurückgestellt habe, um sein Werk herauszubringen. Der Journalist war empört über diesen Mißbrauch der Macht und schob die Verantwortung dafür Christof zu.
Christof sprach mit dem Direktor und sagte zu ihm:
»Das haben Sie mir nicht gesagt. Das geht nicht. Sie werden zuerst die Oper, die Sie vor der meinen angenommen haben, aufführen.«
Der Direktor ereiferte sich, lachte, widersprach, sprach von Christof, seinem Charakter, seinen Werken und seinem Talent in den höchsten Schmeicheltönen, äußerte sich über das Werk des anderen mit tiefster Verachtung, versicherte, daß es nichts tauge und daß es nicht einen Sou einbringen werde.
»Warum haben Sie es dann angenommen?«
»Man kann nicht immer, wie man will. Man muß sich ab und zu den Anschein geben, als gehe man mit der öffentlichen Meinung. Früher konnten diese jungen Leute schreien; niemand hörte sie. Heute finden sie Mittel und Wege, eine nationalistische Presse gegen einen aufzuhetzen, die Verrat schreit und einen als schlechten Franzosen hinstellt, wenn man sich unglücklicherweise nicht für ihre junge Schule begeistert. Die junge Schule! Reden wir einmal offen! ... Wissen Sie was? Ich hab's satt bis an den Hals! Und das Publikum auch. Sie bringen uns um mit ihrem Oremus! ... Kein Blut in den Adern; kleine Sakristane, die die Messe singen; wenn sie Liebesduette machen, hält man es für De Profundis ... Wenn ich dumm genug wäre, alle Stücke aufzuführen, die man mich zwingt anzunehmen, würde ich mein Theater auf den Hund bringen. Ich nehme sie an: das ist aber auch alles, was man von mir verlangen kann. – Reden wir von ernsthaften Dingen. Sie, ja Sie machen volle Häuser ...«
Die Komplimente begannen von neuem.
Christof schnitt ihm das Wort ab und sagte voll Zorn:
»Ich falle auf nichts herein. Jetzt, da ich alt bin und ›durch‹, benutzen Sie mich, um die Jungen zu erdrücken. Als ich jung war, hätten Sie mich gleich ihnen erdrückt. Sie werden das Stück von diesem jungen Menschen spielen, oder ich ziehe das meine zurück.«
Der Direktor hob die Hände zum Himmel und sagte:
»Sehen Sie denn nicht, daß, wenn wir es so machen, wie Sie wollen, es so aussieht, als ließen wir uns von ihrer Pressehetze einschüchtern?«
»Was liegt mir daran?« meinte Christof.
»Wie Sie wollen! Sie werden als erster darunter zu leiden haben.«
Man setzte das Stück des jungen Komponisten zur Probe an, ohne die Proben zu Christofs Werk zu unterbrechen. Das seine war drei-, das andere zweiaktig; man kam überein, sie zusammen aufzuführen. Christof sah seinen Schützling; er hatte ihm als erster die Nachricht mitteilen wollen. Der andre zerfloß in Versicherungen ewigen Dankes.
Natürlich konnte Christof nicht verhindern, daß der Direktor seinem Stück alle Sorgfalt angedeihen ließ. Die Besetzung und Ausstattung des anderen wurden ein wenig zurückgesetzt. Christof wußte davon nichts. Er hatte darum gebeten, einigen Proben von dem Werke des jungen Mannes beiwohnen zu können. Er fand es recht mittelmäßig, so wie man es ihm gesagt hatte. Er hatte zwei oder drei Ratschläge zu machen gewagt: sie waren schlecht aufgenommen worden. Dann hatte er sich damit zufrieden gegeben und sich nicht mehr hineingemischt; andererseits hatte der Direktor dem Neuankömmling die Notwendigkeit einiger Striche beigebracht, wenn er wolle, daß sein Stück ohne Verzögerung herauskäme. Dieses Opfer, zu dem der Komponist zunächst leicht ja gesagt hatte, schien ihm bald recht schmerzlich.
Als der Abend der Aufführung kam, hatte das Stück des Anfängers keinerlei Erfolg, das Christofs aber erregte großes Aufsehen. Einige Zeitungen machten Christof herunter; sie sprachen von einem Trick, von einer Verschwörung, um einen jungen und großen französischen Künstler umzubringen; sie sagten, daß sein Werk verstümmelt worden wäre, dem deutschen Meister zu Gefallen, den sie als in niedriger Weise eifersüchtig auf alle aufstrebenden Berühmtheiten hinstellten. Christof zuckte die Achseln und dachte:
»Er wird darauf antworten.«
»Er« antwortete nicht. Christof schickte ihm einen der Auszüge mit folgenden Worten:
»Haben Sie das gelesen?«
Der andere schrieb:
»Wie bedauerlich ist das! Dieser Journalist war immer so taktvoll mir gegenüber! Ich bin wirklich ärgerlich. Das Beste ist, man achtet nicht darauf.«
Christof lachte und dachte:
»Er hat recht, der kleine Lump.«
Und er legte die Erinnerung daran weg, ins »Vergeßwinkelchen,« wie er in solchem Falle zu sagen pflegte.
Aber der Zufall wollte, daß Georg, der die Zeitungen, abgesehen vom Sportteil, nur selten und flüchtig las, diesmal auf die heftigsten Angriffe gegen Christof stieß. Er kannte den Journalisten. Er ging in das Café, in dem er ihn sicher treffen mußte, fand ihn dort in der Tat, ohrfeigte ihn, hatte ein Duell mit ihm und zerschürfte ihm kräftig mit seinem Degen die Schulter.
Am nächsten Tage erfuhr Christof beim Frühstück durch einen Freundesbrief die Geschichte. Er war außer sich darüber. Er ließ sein Frühstück stehen und lief zu Georg. Georg öffnete selbst. Christof fuhr wie ein Gewitter herein, packte ihn bei beiden Armen, schüttelte ihn voller Zorn und begann, ihn mit einem Schwall wütender Vorwürfe herunterzumachen.
»Kerl,« schrie er, »du hast dich für mich geschlagen! Wer hat dir die Erlaubnis dazu gegeben? Ein Lausbub, ein Naseweis, wer sich in meine Angelegenheiten mischt! Kann ich mich vielleicht nicht selbst darum kümmern? Heh? Da hast du ja etwas Schönes angerichtet. Du erweist diesem Lümmel noch die Ehre, dich mit ihm zu schlagen! Das wollte er ja nur. Du hast ihn zu einem Helden gemacht, Dummkopf! Und wenn der Zufall es gewollt hätte ... (Ich bin sicher, du hast dich kopflos, wie du immer bist, da hineingestürzt) ... wenn du verwundet worden wärest – vielleicht sogar getötet! ... Unglücklicher, ich hätte es dir dein Leben lang nicht verziehen! ...«
Georg, der wie toll lachte, bekam bei dieser letzten Drohung einen solchen Heiterkeitsanfall, daß ihm die Tränen kamen:
»Ach, alter Freund, du bist zu komisch! Ach, du bist unbezahlbar! Jetzt beschimpfst du mich, weil ich dich verteidigt habe. Das nächste Mal werde ich dich angreifen; vielleicht umarmst du mich dann.«
Christof hörte auf; er drückte Georg an sich, küßte ihn auf beide Wangen, dann noch einmal und sagte:
»Mein Junge! ... Verzeih. Ich bin ein altes Schaf! Aber diese Nachricht hat mich ganz aus dem Häuschen gebracht. Welche Idee, dich zu schlagen! Schlägt man sich mit dieser Art Leute? Du wirst mir sofort versprechen, daß du das niemals wieder tun wirst.«
»Ich verspreche gar nichts,« sagte Georg. »Ich tue, was mir paßt.«
»Ich verbiete es dir, verstehst du? Wenn du es wiedertust, will ich dich nicht mehr sehen. Ich erkläre öffentlich in den Zeitungen, daß ich nichts damit zu tun habe. Ich ...«
»Du enterbst mich, das versteht sich.«
»Aber höre doch, Georg, ich bitte dich ... Was hat das für einen Zweck?«
»Mein lieber Alter, du bist tausendmal mehr wert als ich, und du weißt unendlich viel mehr; aber dieses Gesindel kenne ich besser als du. Sei ruhig, es wird etwas nützen; sie werden es sich jetzt erst sieben mal überlegen, bevor sie dich mit ihrer vergifteten Zunge beschimpfen.«
»Gott, was geht mich dieses Gelichter an? Es ist mir ja ganz gleich, was sie sagen.«
»Aber mir ist es nicht gleich! Kümmere du dich nur um das, was dich angeht.«
Von nun an schwebte Christof in Todesangst, daß ein neuer Aufsatz Georgs Empfindlichkeit reizen könnte. Es hatte etwas Komisches, ihn an den folgenden Tagen zu sehen, wie er sich im Café festsetzte und die Zeitungen verschlang, er, der sie sonst nie las, und wie er auf dem Sprung war, im Falle er einen beleidigenden Aufsatz fände, wer weiß was zu begehen (eine Schlechtigkeit, wenn nötig), um zu verhindern, daß solche Zeilen Georg unter die Augen kämen. Nach einer Woche beruhigte er sich. Der Kleine hatte recht. Sein Verhalten hatte für den Augenblick den Kläffern zu denken gegeben. – Und während Christof noch über den jungen Tollkopf brummte, durch den er acht Tage Arbeit verloren hatte, sagte er sich, daß er schließlich kaum das Recht habe, ihm gute Lehren zu geben. Er dachte an einen gewissen Tag, der noch nicht allzu weit zurücklag, an dem er selbst sich um Oliviers willen geschlagen hatte. Und er glaubte, Olivier zu hören, wie er sagte:
»Laß gut sein, Christof, ich gebe dir zurück, was du mir geliehen hast.«
Wenn Christof die Angriffe gegen sich selbst leicht nahm, so war ein anderer sehr weit von dieser spöttischen Gleichgültigkeit entfernt. Das war Emanuel.
Die Entwickelung des europäischen Gedankens ging mit großen Schritten vorwärts. Man hätte meinen können, daß sie mit den technischen Erfindungen und neuen Motoren immer schneller werde. Der Vorrat an Vorurteilen und Hoffnungen, der einst genügt hatte, zwanzig Jahre die Menschheit zu nähren, war in fünf Jahren verbraucht. Die geistigen Generationen galoppierten eine hinter der anderen und oft übereinander fort: die Zeit blies zum Angriff. – Emanuel war überholt. Der Sänger der französischen Lebenskräfte hatte niemals den Idealismus seines Lehrers Olivier verleugnet. Wie leidenschaftlich auch sein Nationalgefühl war, er verschmolz es mit seiner Verehrung sittlicher Größe. Wenn er in seinen Versen mit schallender Stimme den Triumph Frankreichs verkündete, so tat er es, weil er in ihm in voller Glaubensüberzeugung die höchste Gedankenwelt des gegenwärtigen Europas anbetete, die Nike Athene, das siegreiche Recht, das sich von der Kraft Genugtuung verschafft. – Und siehe da, die Kraft hatte aus dem Herzen des Rechts neues Leben empfangen und kam in ihrer wilden Nacktheit zum Vorschein. Die neue, robuste und kriegerische Generation ersehnte den Kampf und befand sich schon vor dem Sieg in dem geistigen Zustand des Siegers. Sie war stolz auf ihre Muskeln, auf ihre breite Brust, auf ihre kräftigen und genußsüchtigen Sinne, auf ihre Raubvogelschwingen, die über den Ebenen schwebten; sie konnte es nicht erwarten, sich zu schlagen und ihre Klauen zu versuchen. Die Helden der Rasse, die tollen Flüge über Alpen und Meere, die heroischen Streifzüge durch die afrikanische Wüste, die neuen Kreuzzüge, die nicht viel weniger mystisch, nicht viel vorteilsüchtiger waren als die Philipp-Augusts und Villehardonins, verdrehten der Nation vollends den Kopf. Diesen Kindern, die den Krieg nirgends erlebt hatten als in Büchern, fiel es nicht schwer, ihm Schönheiten zu verleihen. Sie wurden angriffslustig. Des Friedens und der Gedanken müde, feierten sie den »Amboß der Schlachten,« auf dem die Tat mit bluttriefenden Fäusten eines Tages die französische Macht neu schmieden würde. Als Gegenstoß gegen den widerlichen Mißbrauch der Ideologien erhoben sie die Verachtung des Ideals zum Glaubensbekenntnis. Sie suchten etwas darin, den gesunden, beschränkten Menschenverstand zu feiern, den leidenschaftlichen Wirklichkeitssinn, die schamlose nationale Selbstsucht, die das Recht der anderen und andere Nationalitäten mit Füßen tritt, wenn es der Größe des Vaterlandes zuträglich ist. Sie waren Auslandsfeinde, Antidemokraten, und – selbst die Ungläubigsten – predigten die Rückkehr zum Katholizismus aus dem praktischen Bedürfnis heraus, »das Unbedingte zu kanalisieren«, das Unendliche unter die Schlüsselgewalt der Ordnung und Autorität zu bringen.
Sie begnügten sich nicht, zu verachten, sie stellten die sanften Schwätzer von gestern und die idealistischen Grübler, die Humanitätsverfechter, als gemeingefährlich hin. Emanuel war in den Augen dieser jungen Leute einer von denen. Er litt grausam darunter und lehnte sich dagegen auf.
Da er wußte, daß Christof gleich ihm – ja, mehr als er – ein Opfer dieser Ungerechtigkeit war, wurde er ihm sympathisch. Durch seine Unhöflichkeit hatte er Christof davon abgeschreckt, ihn zu besuchen. Er war zu stolz, um sich den Anschein zu geben, das zu bereuen und ihn seinerseits wieder aufzusuchen. Aber es gelang ihm, scheinbar zufällig, ihm zu begegnen, und er forderte ein gewisses Entgegenkommen heraus. Danach war seine mißtrauische Empfindlichkeit beruhigt, und er verbarg nicht das Vergnügen, das er an Christofs Besuchen fand. Von da an kamen sie oft zusammen, sei es bei dem einen, sei es bei dem anderen.
Emanuel vertraute Christof seinen Kummer an. Er war über gewisse Kritiken außer sich. Da er fand, daß Christof sich darüber nicht genug aufregte, ließ er ihn selbst lesen, wie man ihn in den Zeitungen abschätzte. Christof wurde dort beschuldigt, von der Grammatik seiner Kunst nichts zu verstehen, keine Ahnung von Harmonie zu haben, seine Kollegen zu bestehlen und die Musik zu entehren. Man nannte ihn: »den alten Rappelkopf« ..., man sagte:
»Wir haben genug von diesen Besessenen. Wir sind die Ordnung, die Vernunft, das klassische Gleichgewicht« ...
Christof machte das Spaß.
»Das ist Gesetz,« sagte er. »Die jungen Leute werfen die alten in die Grube ... Zu meiner Zeit wartete man allerdings, bis ein Mensch sechzig Jahre alt war, ehe man ihn als Greis behandelte. Heute ist man schneller fertig. Die drahtlose Telegraphie, die Aeroplane, ... eine Generation ermattet schneller ... Arme Teufel! ... Sie haben nicht viel Zeit! Sie sollen uns nur recht schnell verachten und sich in der Sonne brüsten!«
Emanuel aber besaß diese schöne Gesundheit nicht. Wenn er auch kühn im Denken war, so war er doch das Opfer seiner krankhaften Nerven; die glühende Seele in seinem rachitischen Körper brauchte den Kampf und war doch nicht für den Kampf geschaffen. Die Feindseligkeit mancher Urteile verwundete ihn tief.
»Ach,« sagte er, »wenn die Kritiker wüßten, was sie dem Künstler durch eines solcher aufs Geratewohl hingeworfenen ungerechten Worte antun, sie würden sich ihres Berufes schämen!«
»Aber sie wissen es, lieber Freund. Das ist ihr Lebenszweck. Jedermann muß schließlich leben.«
»Henkersknechte sind sie. Man ist vom Leben mit Blut überströmt, erschöpft von dem Kampf, den man mit der Kunst ausficht. Anstatt einem die Hand zu reichen und von seinen Schwächen voller Barmherzigkeit zu reden, einem brüderlich zu helfen sie zu beseitigen, stehen sie da, die Hände in den Taschen, sehen zu, wie man seine Last den Abhang hinaufschleppt, und sagen: »Kann nicht.« ... Und ist man auf dem Gipfel, sagen die einen: »Ja, aber so muß man nicht hinaufkommen,« während die anderen eigensinnig wiederholen: »Hat's nicht gekonnt.« ... Ein Glück, wenn sie einem nicht noch Steine zwischen die Beine werfen, damit man fällt!«
»Bah, es fehlt ebensowenig an braven Leuten unter ihnen; und wieviel Gutes können sie tun! Räudige Schafe gibt es überall; damit hat der Beruf nichts zu tun. Sag mir selbst, kennst du etwas Schlimmeres als einen eitlen, verbitterten Künstler ohne Güte, für den die Welt ein Fang ist, den er zu seiner größten Wut nicht hinunterschlucken kann? Man muß sich mit Geduld wappnen. Nichts Böses, das nicht auch zu etwas Gutem dienen könnte. Der schlimmste Kritiker nützt uns; er ist ein Trainer; er hindert uns, herumzuschlendern. Jedesmal, wenn wir uns am Ziel glauben, fällt uns die Meute von hinten an. Vorwärts! Weiter! Höher hinauf! Sie wird eher müde werden, mich zu verfolgen, als ich, vor ihr herzugehen. Wiederhole dir das arabische Wort: »Man quält die unfruchtbaren Bäume nicht. Nur die werden mit Steinen beworfen, deren Haupt mit goldenen Früchten gekrönt ist.« ... Beklagen wir die Künstler, die man schont. Sie bleiben auf halbem Wege faul sitzen. Wenn sie wieder aufstehen wollen, verweigern ihre steif gewordenen Beine den Dienst. Hoch meine Freunde, die Feinde! Sie haben mir in meinem Leben mehr Gutes getan als meine Feinde, die Freunde!«
Emanuel konnte sich nicht enthalten, zu lächeln. Dann sagte er:
»Findest du es nicht immerhin hart, wenn ein Veteran wie du von Gelbschnäbeln abgekanzelt wird, die in ihrer ersten Schlacht stehen?«
»Sie machen mir Spaß,« sagte Christof. »Dies anmaßende Wesen ist das Zeichen jungen, kochenden Blutes, das danach drängt, sich zu verspritzen. So war auch ich einst. Das sind Hagelschauer im März über der neuerwachenden Erde ... Mögen sie uns abkanzeln! Schließlich haben sie recht. Die Alten müssen bei den Jungen in die Lehre gehen. Sie haben von uns gelernt, sie sind undankbar: Das ist die Ordnung der Dinge! Aber durch unsere Anstrengungen bereichert, gehen sie weiter als wir. Sie verwirklichen, was wir versucht haben. Falls noch etwas von Jugend in uns steckt, so laßt uns nun unsererseits lernen und versuchen uns zu verjüngen. Wenn wir es nicht können, wenn wir zu alt sind, wollen wir uns an ihnen erfreuen. Wie schön ist es, das fortwährende Wiederaufblühen der menschlichen Seele, die erschöpft schien, zu sehen, den kraftvollen Optimismus dieser jungen Leute, ihre Freude an der abenteuerlichen Tat, diese Geschlechter, die wiederauferstehen, um die Welt zu erobern.«
»Was wären sie ohne uns? Diese Freude ist aus unseren Tränen geboren. Diese stolze Kraft ist die Blüte aus den Leiden einer ganzen Generation. Sic vos non vobis ...«
»Das alte Wort wird Lügen gestraft. Für uns haben wir gearbeitet, indem wir ein Menschengeschlecht schufen, das über uns hinausgeht. Wir haben ihre Ersparnisse gesammelt, wir haben sie in einer schlecht geschlossenen Baracke, durch die alle Winde pfiffen, verteidigt; wir mußten uns gegen die Türen stemmen, damit der Tod nicht hereinkomme. Unsere Arme haben den Siegesweg gebahnt, auf dem unsere Söhne schreiten werden. Unsere Schmerzen haben die Zukunft gerettet. Wir haben die Arche bis an die Schwelle des verheißenen Landes geführt. Mit ihnen und durch uns wird sie hineinkommen.«
»Werden sie jemals an die zurückdenken, die die Wüste durchwanderten, die das heilige Feuer trugen, die Götter unserer Rasse und sie selber, diese Kinder – die jetzt Männer sind? Unser Teil ist ein schweres Schicksal und Undankbarkeit gewesen.«
»Bedauerst du es?«
»Nein, es ist berauschend, die tragische Größe einer mächtigen Epoche wie der unseren zu sehen, die sich der aufopfert, die sie gebar. Die Menschen von heute wären nicht mehr fähig, die erhabene Freude des Verzichtens zu empfinden.«
»Wir waren die Glücklicheren. Wir haben den Berg Nebo erklommen, zu dessen Füßen sich die Lande dehnen, die wir nicht betreten werden. Aber wir erfreuen uns an ihnen mehr als die, die sie betreten werden. Wenn man in die Ebene hinabsteigt, verliert man die Unendlichkeit dieser Ebene und den fernen Horizont aus den Augen.«
Die Kraft zu dem beruhigenden Einfluß, den Christof auf Georg und Emanuel ausübte, schöpfte er aus der Liebe zu Grazia. Dieser Liebe dankte er, daß er sich allem, was jung war, verbunden fühlte und allen neuen Lebensformen eine niemals ermattende Anteilnahme entgegenbrachte. Welche Kräfte auch immer die Erde neu belebten, er ging mit ihnen, selbst wenn sie gegen ihn waren; er hatte keinerlei Furcht vor der künftigen Herrschaft der Demokratien, die dem Egoismus einer Handvoll Privilegierter Raubvogelschreie entlockten; er klammerte sich nicht verzweifelt an die Paternoster einer veralteten Kunst; er wartete voller Gewißheit, daß aus den ungeheuren Gesichten, aus den Träumen, die durch Wissenschaft und Tat verwirklicht wurden, eine mächtigere Kunst als die alte emporsprühen würde; er grüßte das neue Morgenrot der Welt, mußte auch die Schönheit der alten Welt mit ihm sterben.
Grazia wußte, wie sehr ihre Liebe Christof wohltat; das Bewußtsein ihrer Macht erhob sie über sich selbst. Durch ihre Briefe lenkte sie ihren Freund. Sie hatte nicht etwa die lächerliche Anmaßung, ihn in der Kunst zu leiten: sie besaß zu viel Takt und kannte ihre Grenzen. Aber ihre reine und klare Stimme war der Ton, auf den er seine Seele abstimmte. Es genügte, daß Christof im voraus diese Stimme seine Gedanken wiederholen zu hören glaubte, um nichts anderes zu denken, als was richtig, rein und würdig war, wiederholt zu werden. Der Klang eines schönen Instrumentes bedeutet für den Musiker dasselbe wie ein schöner Körper, in dem sich sein Traum sogleich verlebendigt. Geheimnisvolle Verschmelzung zweier Geister, die sich lieben: jeder raubt dem anderen sein Bestes; aber er tut es nur, um es ihm, durch seine Liebe bereichert, wiederzugeben. Grazia schreckte nicht davor zurück, Christof zu sagen, daß sie ihn liebe. Die Entfernung machte sie im Reden freier; und ebenso die Gewißheit, daß sie ihm niemals gehören würde. Diese Liebe, deren fromme Glut sich auf Christof übertragen hatte, wurde ihr zu einer Quelle von Kraft und Frieden.
Von dieser Kraft und diesem Frieden gab Grazia anderen weit mehr, als sie hatte. Ihre Gesundheit war gebrochen, ihr seelisches Gleichgewicht ernsthaft erschüttert. Der Zustand ihres Sohnes verbesserte sich nicht. Seit zwei Jahren lebte sie in beständiger Todesangst, die das mörderische Talent Lionellos, damit zu spielen, noch erhöhte. Er hatte in der Kunst, die Besorgnis derer, die ihn liebten, in Atem zu halten, eine wahre Virtuosität erworben. Um die Teilnahme wach zu erhalten und die Leute zu quälen, war sein unbeschäftigtes Gehirn an Erfindungen fruchtbar; das war bei ihm zur Manie geworden. Und das Tragische war, daß, während er ein Zerrbild der Krankheit zur Schau trug, diese wirklich fortschritt. Der Tod kam näher. Da geschah das, was vorauszusehen war: Grazia, die Jahre hindurch von ihrem Sohn mit einem vorgetäuschten Leiden gemartert worden war, glaubte es nicht mehr, als das Leiden wirklich da war. Das Herz hat seine Grenzen. Sie hatte ihre Mitleidskraft für Lügen verausgabt; sie behandelte Lionello als Komödianten in dem Augenblick, als er die Wahrheit sprach. Und nachdem sich die Wahrheit offenbart hatte, wurde der Rest ihres Lebens von Gewissensbissen vergiftet. Die Bosheit Lionellos hatte nicht die Waffen gestreckt. Ohne Liebe für irgend jemand, konnte er nicht ertragen, daß irgend einer von denen, die ihn umgaben, Liebe für irgend einen anderen fühlte als für ihn; Eifersucht war seine einzige Leidenschaft. Es genügte ihm nicht, seine Mutter von Christof entfernt zu haben; er wollte sie dazu zwingen, die Vertrautheit, die zwischen ihnen bestand, zu lösen. Schon hatte er seine gewohnte Waffe – die Krankheit – dazu benutzt, um Grazia schwören zu lassen, daß sie sich nicht wieder verheiraten werde. Er begnügte sich nicht mehr mit diesem Versprechen. Er beabsichtigte, bei seiner Mutter durchzusetzen, daß sie nicht mehr an Christof schriebe. Diesmal lehnte sie sich auf; und bei diesem Mißbrauch von Macht, der dazu beitrug, sie vollends von ihm frei zu machen, sagte sie ihm über seine Lügen Worte so grausamer Härte, daß sie sich sie später wie ein Verbrechen zum Vorwurf machte: denn sie versetzten Lionello in eine solche Wut, daß er wirklich krank wurde. Er wurde es um so mehr, als seine Mutter nicht daran glauben wollte. Da wünschte er in seiner Raserei, daß er sterben möge, um sich zu rächen. Er ahnte nicht, daß sein Wunsch erhört werden sollte.
Als der Arzt Grazia zu verstehen geben mußte, daß ihr Sohn verloren sei, war sie wie vom Blitz getroffen. Sie mußte indessen ihre Verzweiflung verbergen, um das Kind zu täuschen, das so oft sie getäuscht hatte. Er hatte den Verdacht, daß es diesmal ernst sei; aber er wollte es nicht glauben. Und seine Augen forschten in den Augen seiner Mutter nach dem Vorwurf der Lüge, der ihn in Wut gebracht hatte, als er wirklich log. Die Stunde kam, wo er nicht mehr zweifeln konnte. Da wurde es für ihn und die Seinen fürchterlich. Er wollte nicht sterben ...
Als Grazia ihn endlich entschlafen sah, fand sie keinen Schrei, sprach sie keine Klage aus; sie setzte die Ihren durch ihr Schweigen in Erstaunen; sie hatte nicht mehr Kraft genug, um zu leiden; sie hatte nur noch einen Wunsch: gleichfalls zu sterben.
Indessen ging sie mit derselben scheinbaren Ruhe all ihren täglichen Obliegenheiten weiter nach. Nach einigen Wochen erschien sogar auf ihrem noch schweigsamer gewordenen Munde das Lächeln wieder. Niemand ahnte ihre Verzweiflung, Christof weniger als jeder andere. Sie hatte sich damit begnügt, ihm die Nachricht mitzuteilen, ohne irgend etwas von sich selbst hinzuzufügen. Auf Christofs Briefe, die von besorgter Herzlichkeit überströmten, antwortete sie nicht. Er wollte kommen: sie bat ihn, es ja nicht zu tun. Nach zwei oder drei Monaten nahm sie ihm gegenüber den ernsten und milden Ton wieder auf, den sie vorher gehabt hatte. Sie hätte es verbrecherisch gefunden, wenn sie die Last ihrer Schwäche auf ihn abgeladen hätte. Sie wußte, wie sehr das Echo aller ihrer Empfindungen in ihm widerhallte, und wie nötig er es hatte, sich auf sie zu stützen. Sie legte sich keinen schmerzvollen Zwang auf. Eine innere Zucht rettete sie. In ihrem Lebensüberdruß erhielten sie zwei Dinge am Leben: Christofs Liebe und der Fatalismus, der in Leid und Freud den Untergrund ihrer italienischen Natur bildete. Dieser Fatalismus hatte nichts Intellektuelles: es war der natürliche Trieb, der das abgemattete Tier vorwärts hetzt, ohne daß es seine Müdigkeit fühlt, wobei es mit starren Augen traumbefangen dahingeht und die Steine des Weges und seinen Körper vergißt, bis es umsinkt. Dieser Fatalismus hielt ihren Körper aufrecht. Die Liebe hielt ihr Herz aufrecht. Jetzt, da ihr Leben verbraucht war, lebte sie in Christof. Trotzdem vermied sie sorgsamer als je, in ihren Briefen die Liebe zum Ausdruck zu bringen, die sie für ihn empfand, zweifellos weil ihre Liebe größer war. Dann aber auch, weil sie das Veto des kleinen Toten auf sich lasten fühlte, das aus ihrer Zuneigung ein Verbrechen machte. Also schwieg sie und zwang sich, einige Zeit lang nicht zu schreiben.
Christof begriff die Gründe dieses Stillschweigens nicht. Manchmal fielen ihm zwischen dem gleichmäßigen und ruhigen Klang eines Briefes unerwartete Töne auf, in denen eine leidenschaftliche Stimme zu beben schien. Er wurde davon aufgewühlt, aber er wagte nichts zu sagen. Kaum wagte er, sie zu bemerken; er war wie ein Mann, der den Atem anhält und fürchtet, Luft zu schöpfen, aus Angst, das Trugbild könne verfliegen. Er wußte, daß beinahe unausbleiblich solche Töne im folgenden Brief durch eine gewollte Kälte ausgeglichen würden ... Dann von neuem Ruhe, Meeresstille ...
Georg und Emanuel hatten sich bei Christof getroffen. Es war an einem Nachmittag. Beide waren von ihren persönlichen Sorgen erfüllt: Emanuel von einem literarischen Verdruß, Georg von einem Mißgeschick bei einem sportlichen Wettbewerb. Christof hörte ihnen gutmütig zu und verspottete sie freundschaftlich. Es klingelte. Georg ging öffnen. Ein Diener brachte einen Brief von Colette. Christof stellte sich ans Fenster und las. Die beiden Freunde hatten ihre Unterhaltung wieder aufgenommen. Sie sahen nicht auf Christof, der ihnen den Rücken drehte. Er ging aus dem Zimmer, ohne daß sie darauf achteten. Und als sie es merkten, waren sie nicht überrascht. Doch als seine Abwesenheit sich ausdehnte, klopfte Georg an die Tür des Nebenzimmers. Er bekam keine Antwort. Georg war nicht dringlich; denn er kannte das sonderbare Wesen seines alten Freundes. Einige Minuten später erschien Christof wieder. Seine Miene war sehr ruhig, sehr müde, sehr sanft. Er entschuldigte sich, daß er sie allein gelassen hatte, nahm die Unterhaltung da auf, wo er sie unterbrochen hatte, redete mit ihnen voller Güte von ihren Kümmernissen und sagte ihnen Dinge, die ihnen wohltaten. Der Ton seiner Stimme rührte sie, ohne daß sie wußten, warum.
Sie verließen ihn. Von ihm aus ging Georg zu Colette. Er fand sie in Tränen. Sobald sie ihn sah, stürzte sie auf ihn zu und fragte: »Und wie hat er den Schlag ertragen, der arme Freund? Es ist furchtbar!«
Georg begriff nicht; und er erfuhr von Colette, daß sie soeben Christof die Nachricht übersandt hatte, Grazia sei gestorben. Sie war davongegangen, ohne daß sie Zeit gefunden hätte, irgend jemand Lebewohl zu sagen. Seit einigen Monaten waren die Wurzeln ihres Lebens beinahe ausgerissen; ein Hauch hatte genügt, um sie zu Boden zu werfen. Am Abend vor dem Influenzarückfall, der sie dahinraffte, hatte sie einen guten Brief von Christof erhalten. Sie war darüber ganz gerührt gewesen. Sie hatte ihn zu sich rufen wollen; sie fühlte, daß alles übrige, alles, was sie trennte, falsch und sündhaft sei. Da sie sehr matt war, schob sie das Schreiben für den nächsten Tag auf. Am nächsten Tage mußte sie im Bett bleiben. Sie begann einen Brief, den sie nicht vollendete. Sie hatte Schwindel, alles drehte sich in ihrem Kopf, und überdies schwankte sie, ob sie von ihrer Krankheit reden sollte; denn sie fürchtete, Christof aufzuregen. Er war gerade mit den Proben zu einem symphonischen Chorwerk beschäftigt, das zu einer Dichtung Emanuels geschrieben war. Der Gegenstand hatte sie alle beide begeistert, denn er war ein wenig das Gleichnis ihres eigenen Schicksals: »Das verheißene Land.«
Christof hatte oft zu Grazia darüber gesprochen; die Erstaufführung sollte in der folgenden Woche stattfinden ... Er durfte nicht beunruhigt werden. Grazia deutete in ihrem Brief nur eine einfache Erkältung an. Dann fand sie, daß auch das zu viel sei. Sie zerriß den Brief und hatte nicht mehr die Kraft, einen neuen zu beginnen. Sie tröstete sich, daß sie am Abend schreiben würde. Am Abend war es zu spät. Zu spät, um ihn kommen zu lassen; zu spät sogar, um zu schreiben ... Wie schnell alles geht! Wenige Stunden genügen, um zu zerstören, was Jahrhunderte geformt haben ... Grazia hatte kaum Zeit, ihrer Tochter den Ring zu geben, den sie am Finger trug, und sie zu bitten, ihn ihrem Freunde zu überbringen. Sie war bis dahin mit Aurora nicht sehr vertraut gewesen. Jetzt, da sie schied, betrachtete sie inbrünstig das Gesicht der Zurückbleibenden; sie klammerte sich an die Hand, die ihren Druck weitergeben sollte, und sie dachte voller Freude:
»So gehe ich denn doch nicht völlig.«
»
Quid? hic, inquam, quis est
qui complet aures meas tantus
et tam dulcis sonus! ...«
(Scipios Traum)
Eine Aufwallung von Teilnahme führte Georg zu Christof zurück, nachdem er Colette verlassen hatte. Seit langem wußte er durch Colettes Vertrauensseligkeit, welchen Platz Grazia im Herzen seines alten Freundes einnahm. Und er hatte sich sogar manchmal – (die Jugend kennt durchaus keine Ehrerbietung) – darüber lustig gemacht. In diesem Augenblick aber empfand er mit großherziger Stärke den Schmerz, den ein solcher Verlust Christof bereiten mußte; und er fühlte das Bedürfnis, zu ihm zu laufen, ihn zu umarmen, ihn zu bemitleiden. Da er die Heftigkeit seiner Empfindungen kannte, beunruhigte ihn die Ruhe, die Christof soeben gezeigt hatte. Er schellte an der Tür. Nichts rührte sich. Er schellte noch einmal und klopfte in der zwischen ihm und Christof verabredeten Art. Er hörte einen Sessel rücken und einen langsamen, schweren Schritt, der näherkam. Christof öffnete. Sein Gesicht war so ruhig, daß Georg, der im Begriff war, sich in seine Arme zu werfen, an sich hielt; er wußte nicht mehr, was er sagen sollte. Christof fragte sanft:
»Du bist's, mein Junge; hast du etwas vergessen?«
Georg stotterte verwirrt:
»Ja.«
»Komm herein.«
Christof ließ sich wieder in den Stuhl nieder, in dem er vor Georgs Kommen gesessen hatte; beim Fenster, den Kopf auf die Stuhllehne gestützt, schaute er auf die gegenüberliegenden Dächer und den sich rötenden Abendhimmel. Er kümmerte sich nicht um Georg. Der junge Mann tat, als suche er etwas auf dem Tisch, während er verstohlen einen Blick auf Christof warf. Dessen Antlitz war regungslos; der Widerschein der untergehenden Sonne beleuchtete die Wangenknochen und einen Teil der Stirn. Georg ging mechanisch in das Nebenzimmer, das Schlafzimmer, als suche er dort weiter. Dort hatte sich Christof kurz vorher mit dem Brief eingeschlossen; der lag noch dort; auf dem Bett war keinerlei Unordnung, die den Eindruck eines Körpers gezeigt hätte. Ein Buch war auf den Teppich niedergeglitten. Es war durch eine zerknitterte Seite offen liegen geblieben. Georg hob es auf und las im Evangelium die Begegnung zwischen Magdalena und dem Gärtner. Er kehrte in das vordere Zimmer zurück, rückte einige Gegenstände nach rechts und nach links, um sich zu fassen, und schaute von neuem zu Christof hin, der sich nicht geregt hatte. Er hätte ihm so gerne gesagt, wie sehr er ihn bedauere. Aber Christof hatte etwas so Leuchtendes, daß Georg fühlte, jedes Wort wäre am unrechten Platz gewesen. Er selbst hätte viel eher des Trostes bedurft. Schüchtern sagte er:
»Ich gehe fort.«
Christof erwiderte, ohne den Kopf zu wenden:
»Auf Wiedersehen, mein Junge.«
Georg ging und schloß geräuschlos die Türe. Christof blieb lange Zeit so sitzen. Die Nacht kam. Er litt nicht, er dachte nicht nach, er sah kein deutliches Bild vor sich. Er glich einem müden Menschen, der eine große, undeutliche Musik vernimmt, ohne daß er versucht, sie zu verstehen. Als er wie zerschlagen aufstand, war die Nacht vorgeschritten. Er warf sich auf das Bett und schlief einen schweren Schlaf. Die Symphonie rauschte weiter ...
Und siehe, da sah er »sie«! Sie, die Vielgeliebte ... Sie streckte ihm lächelnd die Hände entgegen und sagte:
»Jetzt hast du den Feuerkreis überschritten.«
Da löste sich sein Herz. Ein unaussprechlicher Frieden erfüllte den bestirnten Raum, über den die Musik der Sphären ihre reglosen und dicken Tücher breitete.
Als er aufwachte (es war wieder Tag geworden) blieb das sonderbare Glück mit dem fernen Schimmer vernommener Worte bestehen. Er stand auf. Eine schweigende und heilige Begeisterung stimmte sein Herz höher.
… Or vedi, figlio,
tra Beatrice e te è questo muro ...
Zwischen Beatrice und ihm war die Mauer gefallen.
Seit langem schon lebte mehr als die Hälfte seiner Seele auf der anderen Seite. Je länger man lebt, je mehr man schafft, je mehr man liebt, und die, die man liebt, verliert, um so mehr entgleitet man dem Tode. Bei jedem neuen Schlage, der uns trifft, bei jedem neuen Werke, das man hämmert, löst man sich von sich selbst, flieht in das geschaffene Werk hinein, in die Seele, die man liebt und die uns verlassen hat. Zuletzt ist Rom nicht mehr in Rom; das Beste des eigenen Ichs ist außerhalb unsrer selbst. Als Einzige hatte nur Grazia noch ihn auf dieser Seite zurückgehalten. Und nun war die Reihe an sie gekommen ... Jetzt hatte sich die Pforte hinter der Welt der Schmerzen geschlossen. Er durchlebte eine Periode geheimen seelischen Entrücktseins. Er fühlte nicht mehr das Gewicht irgend einer Kette. Er erwartete nichts mehr von den Dingen der Welt. Er war von nichts mehr abhängig. Er war befreit. Der Kampf war beendet. Er war hinausgeschritten aus dem Kampfbereich und aus dem Kreise, in dem der Gott heldischer Schlachten, der Herr Zebaoth, herrscht. Er sah in der Nacht zu seinen Füßen die Fackel des brennenden Busches verlöschen; wie fern war sie schon! Als sie seinen Pfad erhellt hatte, hatte er sich fast auf dem Gipfel geglaubt. Und welchen Weg hatte er seitdem durchlaufen! Inzwischen schien der Gipfel nicht nähergerückt. Er würde ihn niemals erreichen – er sah es jetzt! – und sollte er auch in Ewigkeit wandern. Doch wenn man in den Kreis des Lichtes eingetreten ist und weiß, daß man die Geliebten nicht zurückläßt, so ist die Ewigkeit nicht zu lang, um den Weg an ihrer Seite zurückzulegen. Er verschloß seine Türe. Niemand klopfte mehr an. Georg hatte mit dem einen Mal sein ganzes Mitleid erschöpft. Nach Haus zurückgekehrt, war er beruhigt und dachte am nächsten Morgen nicht mehr daran. Colette war nach Rom abgereist. Emanuel wußte nichts. Und, empfindlich wie immer, hüllte er sich in gekränktes Schweigen, weil Christof seinen Besuch nicht erwidert hatte. Christof wurde tagelang nicht in der stummen Zwiesprache gestört, die er mit der hielt, die er jetzt in seiner Seele trug, wie eine schwangere Frau ihre teure Bürde trägt. Herzbewegende Zwiesprache, von der kein Wort übersetzbar ist. Kaum konnte die Musik sie ausdrücken. Wenn das Herz voll war, zum Überfließen voll, hörte Christof mit reglos geschlossenen Augen sie singen. Oder er saß stundenlang vor seinem Klavier und ließ seine Finger reden. Während dieser Zeit improvisierte er mehr als in seinem ganzen späteren Leben. Er schrieb seine Gedanken nicht nieder. Wozu?
Als er nach mehreren Wochen wieder ausging und andere Menschen traf, ahnte niemand von seinen Vertrauten, außer Georg, was vorgegangen war; der Genius der Improvisation aber harrte noch eine zeitlang bei ihm aus. Er kehrte bei Christof zu Stunden ein, in denen er ihn am wenigsten erwartete. Eines Abends bei Colette setzte sich Christof ans Klavier und spielte länger als eine Stunde, sprach sich rückhaltlos aus und vergaß, daß der Salon voll Gleichgültiger war. Es kam sie keine Lust an, zu lachen. Diese fürchterlichen Fantasien bezwangen und wühlten auf. Selbst die, die ihren Sinn nicht verstanden, fühlten ihr Herz beklommen; und Colette standen die Augen voll Tränen ... Als Christof zu Ende war, wandte er sich plötzlich um; er sah die Erregung der Leute, er zuckte die Achseln – und lachte.
Er war auf dem Punkte angelangt, auf dem auch der Schmerz eine Kraft wird – eine Kraft, die man beherrscht. Er gehörte nicht mehr dem Schmerz, der Schmerz gehörte ihm; er konnte aufgeregt an den Gitterstäben rütteln: Christof hielt ihn im Käfig gefangen.
Aus jener Epoche stammen seine ergreifendsten Werke und auch die glücklichsten: eine Stelle aus dem Evangelium, die Georg wiedererkannte:
»Mulier, quid ploras?« – »Quia tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum.«
Et cum haec dixisset, conversa est retrorsum, et vidit Jesum stantem: et non sciebat quia Jesus est.
– eine tragische Liederserie, zu Versen spanischer Cantares; unter anderem ein düsterer Liebes- und Grabgesang, der wie eine schwarze Flamme war:
Quisiera ser el sepulcro
Donde á ti te han de enterrar,
Para tenerte en mis brazos
Por toda la eternidad.
(Ich möchte die Grabstätte sein, in der man dich zur Ruhe bettet, um dich für alle Ewigkeit in meinen Armen zu halten.) Dann zwei Symphonien, »die Insel der Friedvollen« und »Scipios Traum« betitelt, in denen sich fester als in irgend einem anderen Werk von Johann Christof Krafft die schönsten musikalischen Kräfte seiner Zeit verschmelzen: die innige und weise Gedankenwelt Deutschlands mit ihren dämmerigen Tiefen, die leidenschaftliche Melodie Italiens und der lebensprühende Geist Frankreichs, der reich an feinen Rhythmen und wandlungsreichen Harmonien ist.
Diese »geistige Steigerung, die die Verzweiflung im Augenblick eines großen Verlustes hervorruft«, hielt ein oder zwei Monate lang an. Danach nahm Christof mit starkem Herzen und sicherem Schritt seinen Platz im Leben wieder ein. Der Wind des Todes hatte die letzten Nebel des Pessimismus, das Grau der Stoikerseele und die Fata morgana des mystischen Helldunkels fortgeblasen. Der Regenbogen leuchtete über den sich zerstreuenden Wolken. Reiner, wie in Tränen gebadet, lächelte das Auge des Himmels hindurch. Über den Bergen lag der Abend.
Die Feuersbrunst, die im Walde Europas glomm, begann aufzuflammen. Wenn man sie auch hier unterdrückte, etwas weiter fort entzündete sie sich wieder; mit Rauchwirbeln und Funkenregen sprang sie von einem Punkt zum anderen und brannte das dürre Buschwerk nieder. Im Orient fanden als Vorspiel zu dem großen Kriege der Nationen bereits Vorpostengefechte statt. Europa, das gestern noch zweiflerisch und apathisch wie ein toter Wald dalag, wurde eine Beute des Feuers. Die Sehnsucht nach Kampf brannte in allen Seelen. In jedem Augenblick konnte der Krieg ausbrechen. Man erstickte ihn. Er lebte wieder auf. Der geringste Vorwand bot ihm Nahrung. Die Welt fühlte sich von einem Zufall abhängig, der das Gemetzel entfesseln würde. Sie wartete. Auf den Friedliebendsten lastete das Gefühl der Notwendigkeit. Und die Ideologen, die sich hinter dem massigen Schatten Proudhons verschanzten, feierten im Kriege den höchsten Adelstitel des Menschen ...
Damit also mußte die körperliche und seelische Wiederauferstehung der Rassen des Okzidents enden! Zu solchen Schlächtereien rissen die Strömungen leidenschaftlichen Tatendranges und Glaubens sie hin! Nur ein napoleonisches Genie hätte diesem blinden Dahinrasen ein vorgefaßtes und erwähltes Ziel setzen können. Aber ein Genie der Tat gab es in Europa nirgends. Man hätte meinen können, die Welt habe unter den Unbedeutendsten die Auswahl getroffen, um sie zu regieren. Die Kraft des menschlichen Geistes lag anderwärts. – So blieb nichts übrig, als sich der abschüssigen Bahn zu überlassen, auf der man mitgerissen wurde. Das taten die Regierenden und die Regierten. Europa bot das Schauspiel einer ungeheueren Waffenmacht.
Christof erinnerte sich an eine gleiche Nachtwache, in der das angstvolle Antlitz Oliviers neben ihm war. Aber die Kriegsdrohungen waren in jener Zeit nur eine vorüberziehende Gewitterwolke gewesen. Jetzt bedeckten sie mit ihrem Schatten ganz Europa. Und auch Christofs Herz hatte sich verändert. Er konnte an dem Haß der Nationen nicht mehr teilnehmen. Er befand sich in dem Geisteszustand Goethes im Jahre 1813. Wie kann man ohne Haß kämpfen? Und wie ohne Jugend hassen? Die Zone des Hasses hatte er bereits hinter sich gelassen. Welches von den großen rivalisierenden Völkern war ihm das weniger teure? Er hatte ihrer aller Verdienste kennen gelernt und wußte, was die Welt ihnen schuldet. Wenn man eine gewisse seelische Reife erworben hat, »kennt man keine Nationen mehr, man fühlt Glück und Unglück der benachbarten Völker wie sein eigenes«. Die Gewitterwolken liegen unter einem. Rings umher ist nichts als Himmel – »der ganze Himmel, der dem Adler gehört.«
Indessen wurde Christof manchmal von der ihn umgebenden Feindseligkeit peinlich berührt. Man ließ ihn in Paris nur allzu sehr fühlen, daß er zur feindlichen Rasse gehöre; selbst sein lieber Georg konnte dem Vergnügen nicht widerstehen, vor ihm Gefühle inbezug auf Deutschland zum Ausdruck zu bringen, die ihn traurig machten. Also ging er fort; sein Wunsch, Grazias Tochter wiederzusehen, bot ihm einen Vorwand; er ging für einige Zeit nach Rom. Aber dort fand er eine Umgebung, die nicht heiterer war. Die große völkische Hochmutspest hatte sich auch dort verbreitet. Sie hatte den italienischen Charakter umgewandelt. Dieselben Leute, die Christof als gleichgültig und tatenunlustig gekannt hatte, träumten von nichts anderem als von militärischem Ruhm, von Kämpfen, von Eroberungen, von römischen Adlern, die über der lybischen Wüste kreisen sollten; sie glaubten sich in die Zeiten der Kaiser zurückversetzt. Das Wunderbare war, daß die Parteien der Opposition, Sozialisten und Klerikale ebenso wie die Monarchisten, aus heiliger Überzeugung diesen Rausch teilten, ohne im mindesten zu glauben, dadurch ihrer Sache untreu zu werden. Daran sieht man, wie wenig Politik und menschliche Vernunft gelten, wenn die großen epidemischen Leidenschaften über die Völker dahinbrausen. Diese geben sich nicht einmal die Mühe, die individuellen Leidenschaften zu unterdrücken. Sie nutzen sie aus: alles läuft doch demselben Ziele zu. In tatkräftigen Epochen war es immer so. Die Heere Heinrichs IV., die Ratgeber Ludwigs XIV., die die Größe Frankreichs schmiedeten, zählten unter sich ebenso viel Verstandes- und Glaubensmenschen wie Eitle, Interessenjäger und niedrige Genüßlinge. Jansenisten und Wüstlinge, Puritaner und Buschklepper dienten demselben Schicksal, indem sie ihren Instinkten folgten. In den künftigen Kriegen werden sicherlich Internationalisten und Pazifisten wie ihre Ahnen vom Konvent die Waffen brauchen und dabei überzeugt sein, es zum Besten der Völker und um des Friedens willen zu tun.
Christof schaute von der Terrasse des Janiculus, ein wenig ironisch lächelnd, auf die auffallend ungleichmäßige und zugleich harmonische Stadt nieder, auf dieses Sinnbild der Welt, das sie beherrschte: ausgeglühte Ruinen, »barocke« Fassaden, moderne Gebäude, von Rosen umrankte Zypressen – alle Jahrhunderte, alle Stile in einer starken und engverbundenen Einheit unter dem geistbeseelten Licht zusammengeschmolzen. So muß der Geist über das kämpfende Universum Ordnung und Licht ausstrahlen, die in ihm sind.
Christof blieb kurze Zeit in Rom. Der Eindruck, den diese Stadt auf ihn machte, war allzu stark: er fürchtete sich davor. Um jene Harmonie als wohltuend zu empfinden, mußte er sie aus der Entfernung hören; er fühlte, daß er beim Bleiben Gefahr liefe, von ihr aufgesogen zu werden wie so viele andere seines Volkes. – Von Zeit zu Zeit hielt er sich kurz in Deutschland auf. Aber schließlich zog ihn doch immer wieder, trotz dem nahe bevorstehenden französisch-deutschen Konflikt, Paris an. Allerdings war dort sein Georg, sein Adoptivsohn. Aber die Gefühlsgründe waren es nicht allein, die ihn in dieser Hinsicht bestimmten. Andere Gründe geistiger Art waren nicht weniger stark. Für einen an weites Geistesleben gewöhnten Künstler, der großzügig an allen Leidenschaften der großen Menschheitsfamilie teilnimmt, war es schwer, sich wieder an das Leben in Deutschland zu gewöhnen. An Künstlern fehlte es dort nicht, doch den Künstlern fehlte es an Luft. Sie waren von der übrigen Nation abgeschnitten; sie nahm an ihnen nicht teil. Andere soziale oder praktische Betätigungen nahmen den Geist der Allgemeinheit völlig in Anspruch. Die Dichter verschlossen sich mit gereizter Verachtung hinter ihrer verspotteten Kunst; sie setzten ihren Stolz darein, die letzten Bande, die sie an das Leben ihres Volkes knüpften, zu zerschneiden: sie schrieben nur noch für einige Wenige; eine kleine, talentvolle, überfeinerte, unfruchtbare Aristokratie, die selbst in sich bekämpfende Cliquen alberner Eingeweihter geteilt war. Sie erstickten in dem engen Raum, in dem sie zusammengepfercht waren: unfähig, ihn weiter auszudehnen, machten sie sich daran, ihn durchzuackern; sie warfen den Boden um, bis er nichts mehr hergab. Darauf versenkten sie sich in ihre umstürzlerischen Träume und kümmerten sich nicht einmal darum, diese zu vereinheitlichen. Jeder schlug sich im Nebel auf ein und demselben Platz herum; kein gemeinsames Licht. Jeder wollte das Licht nur von sich selbst erwarten. Im Gegensatz dazu wehten auf der anderen Seite des Rheins bei den westlichen Nachbarn von Zeit zu Zeit die großen Massenleidenschaften in allgemeinem Aufruhr über die Kunst hin. Und wie ihr Eiffelturm über Paris, so leuchtete, die Weite beherrschend, in der Ferne der niemals erloschene Leuchtturm einer klassischen Überlieferung, die, in Jahrhunderten der Arbeit und des Ruhmes erobert, von Hand zu Hand weitergegeben wurde. Sie wies dem Geist ohne ihn zu knechten oder einzuzwängen den Weg, den die Jahrhunderte beschritten hatten, und ließ ein ganzes Volk sich in ihrem Licht zusammenschließen. So mancher deutsche Geist kam, wie ein verirrter Vogel in der Nacht, raschen Fluges dem fernen Licht entgegen. Wer aber ahnt in Frankreich die Kraft der Sympathie, die so viele große Herzen des Nachbarvolkes nach Frankreich drängt? So viel treue Hände strecken sich aus, die für die Verbrechen der Politik nicht verantwortlich sind. Und auch ihr, deutsche Brüder, seht uns nicht, die wir euch sagen: »Hier unsere Hände! Trotz allen Lügen und allem Haß wird man uns nicht von einander trennen. Wir haben euch, ihr habt uns zur Größe unseres Geistes und unserer Rasse nötig. Wir sind die beiden Schwingen des Okzidents. Wenn die eine zerbricht, ist auch der Flug der anderen zerstört; möge der Krieg kommen! Er wird unsere verschlungenen Hände nicht lösen, wird den Aufschwung unserer Bruderseelen nicht hemmen.«
So dachte Christof. Er fühlte, wie sehr die beiden Völker sich gegenseitig ergänzten, und wie unvollkommen und schleppend ihr Geist, ihre Kunst, ihre Tatkraft sind, wenn man sie der gegenseitigen Unterstützung beraubt. Er persönlich, der aus jenen Rheinlanden stammte, in denen die beiden Zivilisationen in einen einzigen Strom verschmelzen, hatte von Kindheit an instinktmäßig die Notwendigkeit ihrer Einigung empfunden. Sein Leben war das unbewußte Streben seines Genius gewesen, das Gleichgewicht und die Sicherheit der beiden mächtigen Schwingen aufrecht zu erhalten. Je reicher er war an germanischen Träumen, um so mehr bedurfte er der lateinischen Geistesklarheit und -ordnung. Darum war ihm Frankreich so teuer. Er genoß dort die Wohltat, sich besser zu verstehen und sich zu meistern. Dort allein war er ganz und gar er selbst.
Aus den Elementen, die ihm zu schaden suchten, zog er Nutzen. Er verarbeitete die ihm fremden Energien mit den eigenen. Ein kraftvoller Geist nimmt, wenn er sich wohl fühlt, alle Kräfte, selbst die ihm feindlichen, in sich auf und macht sie zu seinem Fleisch und Blut. Es kommt sogar eine Zeit, in der man am meisten von dem angezogen wird, was einem am wenigsten gleicht; denn man findet dabei reichlichere Nahrung.
In der Tat hatte Christof mehr Freude an Werken mancher Künstler, die man ihm als Rivalen gegenüberstellte, als an denen seiner Nachahmer; denn er hatte Nachahmer, die sich zu seinem größten Ärger seine Schüler nannten. Es waren brave junge Leute, die voll Verehrung für ihn, arbeitsam, achtbar und von allen Tugenden gekrönt waren. Christof hätte viel darum gegeben, wenn er ihre Musik hätte lieben können; aber (zu seinem Glück!) war das ganz unmöglich: er fand sie durchaus nichtssagend. Er wurde tausendmal mehr von dem Talent der Musiker angezogen, die ihm persönlich unsympathisch waren und die ihm künstlerisch feindliche Bestrebungen verwirklichten ... Aber was kümmerte ihn das? Sie wenigstens waren lebendig. Leben ist an und für sich ein solcher Vorzug, daß, wer ihn nicht besitzt, möge er auch alle anderen guten Eigenschaften haben, niemals ein ganz tüchtiger Mensch sein wird, denn er ist kein ganzer Mensch. Christof sagte scherzend, er erkenne nur die als Schüler an, die ihn bekämpften. Und kam ein junger Künstler, um mit ihm von seiner musikalischen Begabung zu reden, und glaubte, Christofs Teilnahme zu wecken, indem er ihm schmeichelte, so fragte er ihn:
»Also meine Musik befriedigt Sie? Sie möchten Ihre Liebe oder Ihren Haß in dieser Art zum Ausdruck bringen?«
»Ja, Meister.«
»Nun, dann schweigen Sie. Dann haben Sie nichts zu sagen.«
Dieser Widerwillen gegen unterwürfige Seelen, die zum Gehorchen geboren sind, dieses Bedürfnis, nach anderen Gedanken als den eigenen zu trachten, ließ ihn besonders gern Kreise aufsuchen, deren Ideen den seinen diametral entgegenliefen. Er hatte Leute zu Freunden, für die seine Kunst, sein idealistischer Glaube, seine sittlichen Vorstellungen tote Buchstaben bedeuteten; sie sahen das Leben, die Liebe, die Ehe, die Familie, alle gesellschaftlichen Beziehungen auf andere Art an – im übrigen waren es brave Leute, die einer anderen Epoche der sittlichen Entwicklung anzugehören schienen. Die Ängste und Skrupel, die einen Teil von Christofs Leben aufgezehrt hatten, wären ihnen unbegreiflich erschienen. Zweifellos umso besser für sie! Christof wünschte nicht, sie ihnen begreiflich zu machen. Wenn er in seiner Art dachte, verlangte er doch nicht von anderen, daß sie seiner Gedankenwelt beistimmten. Er selbst war seiner Gedankenwelt sicher. Er verlangte, von ihnen andere Gedanken kennen, andere Seelen lieben zu lernen. Immer noch mehr lieben und kennen lernen! Sehen und sehen lernen. Er war dahin gekommen, nicht allein die geistigen Bestrebungen, die er früher bekämpft hatte, bei anderen anzuerkennen, sondern sich daran zu freuen; denn sie schienen ihm zur Fruchtbarkeit der Welt beizutragen. Er liebte Georg gerade deswegen, weil er das Leben nicht so tragisch auffaßte wie er. Die Menschheit würde zu arm, würde zu grau in grau erscheinen, wenn sie sich einförmig nur in den sittlichen Ernst kleiden, sich den heroischen Zwang auferlegen wollte, mit dem Christof gewappnet war. Die Menschheit hatte Freude nötig, Sorglosigkeit, unehrerbietige Kühnheit vor den Heiligtümern, vor allen Heiligtümern, selbst vor den erhabensten. »Hoch das gallische Salz, das die Erde würzt!« Zweifelsucht und Glauben sind nicht weniger notwendig. Die Zweifelsucht, die an dem Glauben von gestern nagt, schafft dem Glauben von morgen Raum ... Wie erhellt sich alles für den, der sich vom Leben wie von einem schönen Gemälde entfernt, und nun die verschiedenen Farben, die in der Nähe hart nebeneinander stehen, sich zu harmonischem Zauber verschmelzen sieht!
Christofs Augen hatten sich für die unendliche Verschiedenheit der sinnlichen wie der seelischen Welt geöffnet. Diese Erkenntnis war ihm hauptsächlich seit seiner ersten italienischen Reise geworden. In Paris hatte er sich vor allem an Maler und Bildhauer angeschlossen; er fand, daß in ihnen das Beste des französischen Genius lebte. Die siegreiche Kühnheit, mit der sie Bewegung und schwingende Farbe verfolgten und miteinander verschmolzen, mit der sie die Schleier herunterrissen, in die sich das Leben hüllt, ließen das Herz vor Jubel höher schlagen. Welch unerschöpflicher Reichtum liegt für den, der zu sehen versteht, in einem Tropfen Licht, in einer Sekunde Leben! Was gilt neben diesen höchsten geistigen Wonnen das eitle Gelärm von Streit und Krieg? ... Aber selbst diese Streitigkeiten und diese Kriege sind ein Teil des wundervollen Schauspiels. Es gilt, alles zu umfangen und tapfer und fröhlich in den Schmelzofen unseres Herzens ebenso die verneinenden wie die bejahenden Kräfte, die feindlichen wie die freundlichen hineinzuwerfen, kurz, das ganze Metall des Lebens. Das Ergebnis alles dessen ist die Statue, die sich in uns herausarbeitet, die göttliche Frucht des Geistes; und alles ist gut, was dazu beiträgt, sie schöner zu gestalten, sei es auch durch das Opfer unseres Selbst erkauft. Was gilt der Schaffende? Nur was man geschaffen hat, ist wirklich ... Ihr Feinde, die ihr uns zerstören wollt, reicht nicht an uns heran. Wir sind vor euren Schlägen gefeit ... Ihr greift in die leere Luft. Schon lange bin ich anderswo.
Sein musikalisches Schaffen nahm jetzt heiterere Formen an. Es waren nicht mehr die Frühlingsgewitter, die sich einst ansammelten, ausbrachen, und plötzlich wieder verschwanden. Es waren weiße Sommerwolken, wie Gebirge aus Schnee und Gold, wie große Vögel des Lichtes, die langsam dahinschweben und den Himmel erfüllen ... Schaffen! Ernten, die in ruhiger Augustsonne reifen.
Zuerst eine unbestimmte und mächtige Benommenheit, die dunkle Freude der vollen Traube, der geschwellten Ähre, der schwangeren Frau, die ihre reife Frucht trägt. Ein Orgelsummen: der singende Bienenschwarm im Innern des Korbes ... Aus dieser Musik, die dunkel und golden ist wie die Honigwabe im Herbst, löste sich nach und nach der führende Rhythmus; der Planetenkreis tritt deutlicher hervor; er beginnt zu schwingen ... Nun kommt der Wille. Er springt auf den Rücken des wiehernden Traumes, der vorbeirast, und preßt ihn zwischen die Knie. Der Geist erkennt die Gesetze des Rhythmus, der ihn mit sich reißt; er bändigt die ungeordneten Kräfte, er bestimmt ihren Weg und das Ziel, dem sie zustreben. Die Symphonie der Vernunft und des Instinktes formt sich. Das Dunkel hellt sich auf. Auf dem langen Straßenbande, das sich aufrollt, treten in Abständen leuchtende Punkte hervor, die in dem entstehenden Werke ihrerseits Kerne kleiner Planetenwelten bilden und mit dem Kreis ihres Sonnensystemes verbunden sind. Die großen Linien des Bildes sind von nun an festgelegt. Jetzt taucht sein Antlitz aus der ungewissen Morgendämmerung auf. Alles wird deutlicher: die Harmonie der Farben und die Züge der Gesichter. Um das Werk zu vollenden, werden alle Kräfte des Seins herangezogen. Das Räucherbecken des Gedächtnisses steht offen und strömt seine Düfte aus. Der Geist entfesselt die Sinne; er läßt sie schwärmen – und schweigt; aber zur Seite hingelagert, belauert er sie und wählt seine Beute ...
Alles ist bereit; die Rotte der Handlanger führt mit dem den Sinnen geraubten Material das Werk aus, das der Geist vorgezeichnet hat. Der große Architekt braucht gute Arbeiter, die ihr Handwerk verstehen und ihre Kräfte schonen. Die Kathedrale geht der Vollendung entgegen.
»Und Gott sieht sein Werk. Und er sieht, daß es noch nicht gut ist.«
Das Auge des Meisters umfaßt das Ganze seiner Schöpfung; und seine Hand vollendet die Harmonie ...
Der Traum ist erfüllt. Te deum ...
Die weißen Sommerwolken, große Vögel des Lichts, schweben langsam dahin; und der Himmel ist von ihren ausgespannten Schwingen verdeckt.
Und dennoch mußte Christofs Leben ganz und gar in seiner Kunst aufgehen. Ein Mann seines Schlages kann die Liebe nicht entbehren; nicht nur die ausgeglichene Liebe, die der Geist des Künstlers über alles Seiende breitet: nein, er muß auch wählen; er muß sich Geschöpfen seiner Wahl hingeben. Das sind die Wurzeln des Baumes. Dadurch erneuert sich sein ganzes Herzblut.
Christofs Blut war noch nicht am Versiegen. Eine Liebe umfloß ihn, die seine beste Freude war. Eine Doppelliebe für Grazias Tochter und Oliviers Sohn. In seinen Gedanken vereinte er sie. Er nahm sich vor, sie in Wirklichkeit zu vereinen.
Georg und Aurora hatten sich bei Christof kennen gelernt. Aurora wohnte im Hause ihrer Cousine. Sie lebte einen Teil des Jahres in Rom, die übrige Zeit in Paris. Sie war achtzehn Jahre alt, Georg fünf Jahre älter. Sie war groß, aufrecht, vornehm, blond, hatte einen kleinen Kopf, ein breites Gesicht, sonnengebräunte Haut, den Schatten eines kleinen Flaumes auf der Lippe, klare Augen, deren lachender Blick sich nicht durch Denken ermüdete, ein etwas fleischiges Kinn, braune Hände, schöne runde und kräftige Arme, eine wohlgeformte Büste und eine heitere, sinnliche und selbstbewußte Miene. Sie war keineswegs überbildet, sehr wenig empfindsam und hatte von der Mutter die lässige Trägheit geerbt. Sie schlief elf Stunden in einem Zuge wie ein Murmeltier. Die übrige Zeit schlenderte sie lachend und halb verschlafen umher. Christof nannte sie »Dornröschen«. Sie erinnerte ihn an seine kleine Sabine. Sie sang, wenn sie sich niederlegte, sie sang, wenn sie aufstand, sie lachte ohne Grund ihr natürliches Kinderlachen, das sie mit einem Glucksen verschluckte. Man wußte nicht, wie sie ihre Tage hinbrachte. Alle Anstrengungen Colettes, sie mit jenem unechten Glanz zu putzen, mit dem man so leicht den Geist junger Mädchen wie mit einem Firnis überzieht, waren vergeblich gewesen: der Firnis hielt nicht. Sie lernte nichts; sie brauchte Monate, um ein Buch zu lesen, das sie sehr schön fand, um acht Tage später den Titel und den Inhalt vollständig vergessen zu haben. Sie machte unbedenklich orthographische Fehler und beging, wenn sie von wissenschaftlichen Dingen redete, drollige Irrtümer. Sie wirkte erfrischend durch ihre Jugend, ihre Heiterkeit und ihren Mangel an Geistigkeit, ja selbst durch ihre Fehler, durch ihre Sorglosigkeit, die manchmal an Gleichgültigkeit grenzte, durch ihre urwüchsige Selbstsucht. Sie war stets ursprünglich. Dieses schlichte und träge Mädchen verstand, wenn es ihr paßte, sehr wohl, unschuldig zu kokettieren; dann spannte sie den jungen Bürschchen ihre Netze, malte in freier Natur, spielte Chopinsche Nocturnes, trug Gedichtbücher herum, in denen sie aber nicht las, führte ideale Unterhaltungen und trug nicht weniger ideale Hüte.
Christof beobachtete sie und lachte in sich hinein. Er empfand für Aurora eine väterliche, nachsichtige und spottlustige Zärtlichkeit. Und er barg auch ein geheimes Gefühl der Ehrfurcht für sie, das der galt, die er früher geliebt hatte und die in neuer Jugend wiedererschien, für eine andere Liebe als die seine geschaffen. Niemand kannte die Tiefe seines Gefühls. Die einzige, die sie ahnte, war Aurora. Seit ihrer Kindheit hatte sie fast immer Christof um sich gesehen; sie betrachtete ihn als zur Familie gehörig. In ihrem einstigen Leid, als sie nicht so wie ihr Bruder geliebt wurde, hatte sie sich instinktiv an Christof angeschlossen. Sie ahnte in ihm ein ähnliches Leid; er sah ihren Kummer; und ohne Herzensergießungen führten ihre Leiden sie zusammen. Später entdeckte sie das Gefühl, das ihre Mutter und Christof verband; es war ihr, als wäre sie eingeweiht, obgleich sie sie niemals zur Bundesgenossin gemacht hatten. Sie begriff den Sinn der Botschaft, mit der die sterbende Grazia sie betraut hatte, den Sinn des Ringes, der jetzt an Christofs Hand war. So bestanden zwischen ihm und ihr verborgene Bande, die sie nicht klar zu verstehen brauchte, um sie in ihrem ganzen Umfang zu empfinden. Sie hing aufrichtig an ihrem alten Freunde, wenn sie auch niemals die Anstrengung gemacht hatte, seine Werke zu spielen oder zu lesen. Obgleich sie ziemlich musikalisch war, besaß sie nicht einmal soviel Neugierde, um die Seiten einer Partitur, die ihr gewidmet war, aufzuschneiden. Sie kam gern, um vertraut mit ihm zu plaudern. – Öfter noch kam sie, wenn sie wußte, daß sie bei ihm Georg Jeannin treffen konnte.
Und Georg hatte seinerseits noch nie soviel Interesse an Christofs Gesellschaft bekundet.
Doch waren die beiden jungen Leute weit davon entfernt, ihre wahren Gefühle zu ahnen. Sie hatten sich zunächst mit spöttischem Blick betrachtet. Sie hatten nicht viel Ähnliches. Der eine war Quecksilber, die andere ein stilles Wasser. Aber es dauerte nicht lange und das Quecksilber bemühte sich, ruhiger zu scheinen, das stille Wasser wurde lebhaft. Georg bekrittelte Auroras Anzug, ihren italienischen Geschmack, – einen leichten Mangel an feinen Abstufungen, eine gewisse Vorliebe für lebhafte Farben. Aurora spottete gern und machte Georg die hastige und etwas anmaßende Redeweise nach. Und während sie sich so über einander lustig machten, fanden beide Vergnügen daran ... an dem Lustigmachen oder an der gegenseitigen Unterhaltung? Sie unterhielten sogar Christof damit, der weit davon entfernt, ihnen zu widersprechen, ihre kleinen Sticheleien schalkhaft von einem zum anderen weitergab. Sie taten, als läge ihnen gar nichts daran; aber sie machten die Entdeckung, daß ihnen im Gegenteil sehr viel daran lag. Und da sie, vor allem Georg, unfähig waren, ihren Ärger zu verbergen, kamen sie bei der ersten Begegnung in lebhaftes Geplänkel. Die Wunden waren leicht; sie fürchteten, einander wehzutun; und die Hand, die sie schlug, war ihnen so teuer, daß sie mehr Vergnügen an den Stichen hatten, die sie empfingen, als an denen, die sie austeilten. Sie beobachteten einander mit neugierigen Augen, die nach Fehlern im anderen suchten und Vorzüge in ihm entdeckten. Aber sie gaben das nicht zu. Jeder beteuerte, war er mit Christof allein, daß ihm der andere unausstehlich sei. Sie nahmen darum nicht weniger jede Gelegenheit wahr, die Christof ihnen bot, um einander zu treffen.
Eines Tages, als Aurora bei ihrem alten Freunde war und ihm ihren Besuch für den folgenden Sonntag vormittag ankündigte – stürmte Georg wie gewöhnlich wie ein Wirbelwind herein und sagte Christof, er werde Sonntag nachmittag kommen. Am Sonntagmorgen erwartete Christof Aurora vergeblich. Zu der von Georg angegebenen Stunde erschien sie und entschuldigte sich, daß sie nicht früher hätte kommen können; sie dichtete ein ganzes Geschichtchen um diese Ausrede herum. Christof, dem diese unschuldige Durchtriebenheit Spaß machte, sagte zu ihr:
»Das ist schade. Du hättest Georg getroffen; er war hier; wir haben zusammen gefrühstückt. Heute nachmittag kann er nicht kommen.«
Aurora war enttäuscht und hörte nicht auf das, was Christof sagte. Er redete gutgelaunt, sie antwortete zerstreut. Sie war ihm beinahe böse. Es klingelte. Es war Georg. Aurora fuhr zusammen. Christof sah sie lachend an. Sie begriff, daß er sie zum Besten gehalten hatte. Sie lachte und errötete. Er drohte ihr schelmisch mit dem Finger. Plötzlich lief sie auf ihn zu und küßte ihn voll Überschwang. Sie raunte ihm in die Ohren:
» Biricchina, ladroncella, furbetta ...«
Und sie legte ihm ihre Hand auf den Mund, damit er schwiege. Georg begriff nichts von diesem Gelächter und diesen Küssen. Seine erstaunte, ja ein wenig unwillige Miene erhöhte noch die Heiterkeit der beiden anderen.
So arbeitete Christof daran, die beiden Kinder einander näher zu bringen. Und als es ihm gelungen war, machte er es sich beinahe zum Vorwurf: er liebte sie beide gleich sehr; aber er beurteilte Georg strenger. Er kannte seine Schwächen, er idealisierte Aurora. Er fühlte sich für ihr Glück mehr verantwortlich als für das Georgs; denn es war ihm, als wäre Georg sein Sohn, ein Stück von ihm selbst. Und er fragte sich, ob es nicht strafbar sei, der unschuldigen Aurora einen Gefährten zu geben, der nicht mehr unschuldig war.
Aber eines Tages, als er bei einem Hagebuchengang vorüberkam, in dem die beiden jungen Leute saßen (es was kurze Zeit nach ihrer Verlobung), hörte er mit einem kleinen Schauder, wie Aurora Georg scherzend über eines seiner vergangenen Abenteuer befragte und Georg es ihr, ohne sich bitten zu lassen, erzählte. Andere Bruchstücke ihrer Unterhaltungen, aus denen sie durchaus kein Hehl machten, zeigten ihm, daß Aurora sich in Georgs sittlichen Ideen weit mehr zu Hause fühlte als er selbst. Obgleich sie einer in den anderen sehr verliebt waren, empfand man, daß sie sich durchaus nicht als für immer gebunden ansahen; sie betrachteten alles, was Liebe und Ehe anging, mit einem Freisinn, der wohl sein Schönes hatte, aber zu dem alten System gegenseitiger Hingabe – usque ad mortem – in eigentümlichem Gegensatz stand. Christof sah das alles mit ein wenig Wehmut ... Wie fern sie ihm schon waren! Wie schnell die Barke dahinschießt, die unsere Kinder fortträgt! ... Geduld! Der Tag wird kommen, an dem wir alle uns im Hafen wiederfinden werden.
Unterdessen sorgte sich die Barke wenig um den zu verfolgenden Weg; sie schwebte bei allen Winden des Tages dahin. – Man hätte meinen können, daß diese Freiheitlichkeit, die die früheren Sitten umzuwandeln strebte, auch auf andere Gebiete des Denkens und Handelns übergegriffen hätte. Aber das war nicht der Fall: die menschliche Natur kümmert sich nicht um Widersprüche. Zur selben Zeit, da die Sitten freier wurden, wurde der Verstand unfreier; er verlangte von der Religion, daß sie ihm wieder den Halfter anlege. Und diese Doppelbewegung in gegensätzlicher Richtung fand mit wundervoller Unlogik in denselben Seelen statt. Georg und Aurora hatten sich von der neuen katholischen Strömung gewinnen lassen, die im besten Zuge war, einen Teil der Gesellschaftsmenschen und der Intellektuellen zu erobern. Nichts war sonderbarer als die Art, wie Georg, der geborene Widerspruchsgeist, der ohne die geringsten Bedenken gottlos war, der sich nie um Gott noch um den Teufel gekümmert hatte, der als echter Vollblutgallier sich aus nichts etwas machte, plötzlich erklärt hatte, daß dort die Wahrheit sei. Er brauchte eine; und diese paßte zu seinem Betätigungsdrang, seinem französischen Bürgeratavismus und seinem Überdruß an der Freiheit. Das junge Füllen war genug herumgetollt; es kam ganz von selbst und ließ sich vor die Pflugschar der Rasse spannen. Das Beispiel einiger Freunde hatte genügt. Georg, der gegen den geringsten atmosphärischen Druck der ihn umgebenden Gedankenwelt überempfindlich war, ließ sich als einer der ersten einfangen. Und Aurora folgte ihm, wie sie ihm überall hin gefolgt wäre. Sofort wurden sie auch selbstsicher und verachteten alle, die nicht wie sie dachten.
O Ironie! Diese beiden leichtlebigen Kinder waren jetzt aufrichtig gläubig, die Seelenreinheit, der ernste, glühende Eifer Grazias und Oliviers hatte sie früher trotz heißem Bemühen nicht dahin zu bringen vermocht.
Christof beobachtete neugierig diese Entwicklung der Seelen. Er dachte nicht daran, sie zu bekämpfen, wie es Emanuel gerne getan hätte, dessen freier Idealismus sich durch die Rückkehr des alten Feindes gereizt fühlte. Man kämpft nicht gegen den vorüberstreichenden Wind. Man wartet, bis er vorüber ist. Die menschliche Vernunft war übermüdet. Sie hatte eine gigantische Anstrengung hinter sich. Sie mußte dem Schlaf weichen; und wie ein Kind, das von einem langen Tag ermattet ist, sagte sie vor dem Einschlafen ihr Gebet. Das Tor der Träume hatte sich wieder geöffnet: im Gefolge der Religion suchten theosophische, mystische, esoterische und okkultistische Strömungen das Gehirn des Okzidents heim. Selbst die Philosophie schwankte. Die Götter ihrer Gedankenwelt, Bergson, William James gerieten ins Wanken. Selbst in der Wissenschaft offenbarten sich Zeichen geistiger Ermüdung. Ein vorübergehender Augenblick. Laßt sie Luft schöpfen. Morgen wird der Geist frischer und freier wieder erwachen. Der Schlaf tut gut, wenn man angestrengt gearbeitet hat. Christof, der früher keine Zeit gefunden hatte, ihm nachzugeben, war glücklich, daß seine Kinder statt seiner ihn genießen konnten, daß sie die seelische Ruhe besaßen, die Sicherheit des Glaubens, das absolute, unerschütterliche Vertrauen in ihre Träume. Er hätte mit ihnen nicht tauschen wollen noch können. Aber er sagte sich, daß Grazias Schwermut und Oliviers Rastlosigkeit in ihren Kindern zum Frieden kommen würden, und daß es so gut sei.
»Alles, was wir gelitten haben, ich, meine Freunde, und so viele andere, die vor uns lebten, all das ist geschehen, damit diese beiden Kinder zur Freude gelangen ... Zu jener Freude, für die du, Antoinette, geschaffen warst, und die dir verwehrt wurde! ... Ach, könnten die Unglücklichen doch im voraus das Glück kosten, das eines Tages aus ihrem hingeopferten Leben erstehen soll!«
Warum hätte er ihnen dieses Glück streitig machen sollen? Man muß nicht wollen, daß andere auf unsere Art glücklich werden. Sie sollen auf ihre eigene Art glücklich werden. Höchstens bat er Georg und Aurora sanft, sie möchten die nicht allzu sehr verachten, die, gleich ihm, ihre Überzeugung nicht teilten.
Sie nahmen sich nicht einmal die Mühe, mit ihm zu streiten. Es sah so aus, als sagten sie:
»Er kann das nicht verstehen ...«
Er gehörte für sie der Vergangenheit an. Und, offen gesagt, sie legten der Vergangenheit keine besondere Bedeutung bei. Waren sie unter sich, so kam es vor, daß sie in aller Unschuld davon redeten, was sie später tun würden, wenn Christof »nicht mehr da wäre ...« – Dennoch liebten sie ihn herzlich. Diese furchtbaren Kinder, die rings um einen wie Schlinggewächse emporschießen! Diese Naturkraft, die dahinhastet, die einen verjagt ...
»– Geh fort! Geh fort! Hebe dich weg von da! Die Reihe ist an mir! ...«
Christof, der ihre stumme Sprache vernahm, hätte ihnen gern gesagt:
»Beeilt euch nicht so sehr! Es geht mir hier gut. Betrachtet mich noch als einen der Lebenden.«
Ihre harmlose Frechheit machte ihm Spaß.
»Sagt nur gleich,« meinte er eines Tages gutgelaunt, als sie ihn mit ihrer verachtungsvollen Miene niedergeschmettert hatten, »sagt mir nur gleich, daß ich ein altes Schaf bin.«
»Aber nein, lieber alter Freund,« meinte Aurora, aus vollem Herzen lachend, »Sie sind der beste Mensch; aber es gibt Dinge, die Sie nicht verstehen.«
»Und die du verstehst, kleines Mädchen? Sieh einer die Weisheit an!«
»Spotten Sie nicht. Ich weiß allerdings nicht viel; aber er, der Georg, er weiß etwas.«
Christof lächelte:
»Ja, du hast recht, Kleine; der, den man liebt, weiß immer alles.«
Was ihm weit schwerer zu ertragen war als ihre geistige Überlegenheit, war ihre Musik. Sie stellte seine Geduld auf eine harte Probe. Das Klavier hatte keine Ruhe, wenn sie bei ihm waren. Es war, als wecke die Liebe, wie bei den Vögeln, ihr Gezwitscher. Aber man konnte wohl sagen, sie waren zum Singen nicht ebenso geschickt. Aurora täuschte sich nicht über ihr Talent. Bei ihrem Verlobten war das anders: sie sah keinerlei Unterschied zwischen dem Spiel Georgs und dem Christofs. Vielleicht zog sie Georgs Art vor. Und dieser ließ sich trotz seinem ironischen Feinsinn beinahe von dem Glauben des verliebten Mädchens überzeugen. Christof widersprach nicht. Ironisch übertreibend stimmte er in den Sinn der Worte des jungen Mädchens ein (wenn, was immerhin manchmal geschah, es ihm nicht zuviel wurde und er den Platz räumte und im Fortgehen ein wenig heftig die Türen schlug). Er hörte mit freundlichem und mitleidigem Lächeln, wie Georg am Klavier den Tristan spielte. Der arme kleine Kerl gab diese gewaltigen Seiten mit fleißiger Gewissenhaftigkeit und der liebenswürdigen Anmut eines jungen Mädchens wieder, das von herzlichen Gefühlen erfüllt ist. Christof lachte vor sich hin. Er wollte dem jungen Burschen nicht sagen, weswegen er lache. Er küßte ihn. Er liebte ihn in solchen Augenblicken sehr ... er liebte ihn vielleicht darum noch mehr ... den armen Kleinen! ... O Eitelkeit der Kunst! ...
Er unterhielt sich oft mit Emanuel über »seine Kinder« – (so nannte er sie). Emanuel, der Georg sehr gern hatte, sagte scherzend zu Christof, er solle Georg ihm überlassen, er hätte doch schon Aurora, es wäre nicht gerecht, daß er alles mit Beschlag belege.
Ihre Freundschaft war in der Pariser Gesellschaft sozusagen legendenhaft geworden, obgleich sie ganz abseits lebten. Emanuel hatte eine Leidenschaft für Christof gefaßt; er wollte sie ihm aus Stolz nicht zeigen; er verbarg sie unter heftigem Wesen; er fuhr ihn manchmal an. Christof aber ließ sich nicht täuschen. Er wußte, wie sehr ihm dies Herz jetzt ergeben war, und kannte seinen Wert. Es verging keine Woche, ohne daß sie sich zwei oder dreimal sahen. Wenn ihre schlechte Gesundheit sie am Ausgehen hinderte, schrieben sie sich. Briefe, die aus fernen Regionen zu kommen schienen. Äußere Ereignisse interessierten sie weniger als gewisse geistige Strömungen in Wissenschaft und Kunst. Sie lebten in ihrer Gedankenwelt, tauschten ihre Ansichten über ihre Kunst aus oder hielten in dem Chaos der Tatsachen den kleinen unmerklichen Schimmer fest, der für die Geschichte des menschlichen Geistes bezeichnend ist.
Am häufigsten kam Christof zu Emanuel. Obgleich er seit einer kürzlich durchgemachten Krankheit sich nicht viel besser fühlte als sein Freund, hatten sie sich doch daran gewöhnt, es natürlich zu finden, daß Emanuels Gesundheit mehr Recht auf Schonung beanspruche. Christof stieg nicht mehr ohne Mühe die sechs Stockwerke zu Emanuels Wohnung hinauf; und wenn er oben war, brauchte er eine gute Zeit, bevor er wieder zu Atem kam. Sie verstanden beide gleich schlecht, sich zu pflegen. Trotz ihrer kranken Luftwege und ihrer Anfälle von Atemnot waren sie starke Raucher. Das war auch mit der Grund, weshalb Christof ihre Zusammenkünfte lieber bei Emanuel stattfinden ließ als bei sich. Denn Aurora zog gegen seinen Hang zum Rauchen zu Felde; und er verheimlichte es ihr. Es kam vor, daß die beiden Freunde mitten in ihrer Unterhaltung einen Hustenanfall bekamen; dann mußten sie innehalten und sahen sich lachend, wie zwei ertappte Schulbuben, an; und manchmal kanzelte einer von beiden den gerade Hustenden ab; der andere aber beteuerte, wenn er wieder zu Atem gekommen war, mit Nachdruck, daß das Rauchen gar nichts ausmache.
Auf Emanuels Tisch, auf einem freien Platz zwischen seinen Papieren, lag eine graue Katze, die die beiden Raucher ernsthaft und mit vorwurfsvoller Miene anschaute. Christof sagte, sie wäre ihr lebendiges Gewissen. Um es zu ersticken, stülpte er seinen Hut darüber. Es war eine kränkliche, ganz gewöhnliche Katze, die Emanuel halb totgeschlagen auf der Straße aufgelesen hatte. Sie hatte sich niemals ganz von den Roheiten erholt, aß wenig, spielte kaum und machte wenig Geräusch. Sie war sehr sanft, folgte ihrem Herrn mit klugen Augen, war unglücklich, wenn er nicht da war, zufrieden, wenn sie neben ihm auf dem Tisch liegen durfte, und ließ sich in ihren Betrachtungen nur stören, um stundenlang in Verzückung den Käfig anzustarren, in dem die unerreichbaren Vögel hin und herflogen; beim geringsten Zeichen von Aufmerksamkeit schnurrte sie höflich, gab sich den launischen Zärtlichkeiten Emanuels und den etwas heftigen Christofs geduldig hin und nahm sich stets in acht, weder zu kratzen noch zu beißen. Sie war kränklich; eines ihrer Augen triefte; sie hüstelte; hätte sie sprechen können, wäre sie sicher nicht so kühn gewesen wie die beiden Freunde, zu behaupten, »daß das Rauchen gar nichts ausmache«; aber von ihnen erduldete sie alles; sie sah aus, als dächte sie:
»Sie sind Menschen, sie wissen nicht, was sie tun.«
Emanuel hing an ihr, weil er zwischen dem Schicksal dieses leidenden Tieres und dem seinen eine Gleichartigkeit fand. Christof behauptete, daß diese Ähnlichkeit sich bis auf den Ausdruck im Blick erstrecke.
»Warum nicht?« fragte Emanuel.
Die Tiere spiegeln ihre Umgebung wieder. Ihre Physiognomie verfeinert sich je nach dem Herrn, den sie haben. Die Katze eines Dummkopfes hat nicht denselben Blick wie die Katze eines geistvollen Menschen. Ein Haustier kann gut oder böse, offen oder heimtückisch, geistvoll oder dumm werden, nicht nur infolge der Unterweisungen, die ihm sein Herr gibt, sondern auch je nach dem, wie sein Herr ist. Es bedarf nicht einmal des Einflusses der Menschen. Die Tiere passen sich ihrer Umgebung an. Eine geistbeseelte Landschaft erleuchtet auch die Augen der Tiere. Die graue Katze Emanuels stimmte zu der stickigen Mansarde und dem kränklichen Herrn, die beide vom Pariser Himmel ihr Licht empfingen.
Emanuel war menschlicher geworden. Er war nicht mehr derselbe wie in der ersten Zeit seiner Bekanntschaft mit Christof. Eine häusliche Tragödie hatte ihn tief erschüttert. Seine Gefährtin, die er in einer Stunde der Überreiztheit allzu deutlich hatte fühlen lassen, wie sehr er ihrer Anhänglichkeit überdrüssig sei, war plötzlich verschwunden. Er hatte sie, von Besorgnissen durchwühlt, eine ganze Nacht lang gesucht. Schließlich hatte er sie auf einem Polizeibüro gefunden, wo man sie aufgenommen hatte. Sie hatte sich in die Seine stürzen wollen; ein Vorübergehender hatte sie gerade in dem Augenblick an den Kleidern festgehalten, als sie über das Brückengeländer sprang; sie hatte sich geweigert, ihre Wohnung und ihren Namen anzugeben; sie wollte ihren Versuch wiederholen. Der Anblick dieses Schmerzes hatte Emanuel niedergeschmettert. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, daß er, nachdem er soviel durch andere gelitten hatte, nun seinerseits Leid zufügte. Er hatte die Verzweifelte zu sich zurückgeführt, er hatte sich bemüht, die Wunden, die er geschlagen hatte, zu heilen, indem er der anspruchsvollen Freundin das Vertrauen zu der Neigung wiedergab, das sie finden wollte. Er hatte seine innerliche Auflehnung zum Schweigen gebracht, hatte sich mit dieser anspruchsvollen Liebe abgefunden und brachte ihr dar, was ihm noch vom Leben blieb. Die ganze Kraft seines Genius war in sein Herz zurückgeströmt. Dieser Apostel der Tat war zu dem Glauben zurückgekommen daß nur eine Tat gut sei: nichts Böses zu tun. Seine Rolle war ausgespielt. Es war, als hätte die Kraft, die die großen menschlichen Flutwellen vorwärtstreibt, sich seiner nur als eines Instrumentes bedient, das die Tat entfesseln sollte. Nun das Gesetz erfüllt war, galt er nichts mehr: das Leben ging ohne ihn weiter. Er sah, wie es vorwärtsschritt, und fand sich so ziemlich mit den Ungerechtigkeiten, die ihn persönlich angingen, ab, wenn auch nicht ganz mit denen, die seine Überzeugung betrafen. Denn obgleich er als Freidenker behauptete, jede Religion hinter sich gelassen zu haben, und Christof scherzend als verkappten Klerikalen behandelte, besaß er wie jeder große Geist seinen Altar, auf dem die Träume, denen er sich weihte, als Götter thronten. Jetzt war der Altar verödet; und darunter litt Emanuel. Wie soll man ohne Schmerz mit ansehen, daß die heiligen Ideen, denen man mit soviel Mühe zum Siege verholfen hat, für die die Besten seit einem Jahrhundert soviele Qualen erlitten haben, von den Nachfolgenden mit Füßen getreten werden? Mit welcher blinden Brutalität werfen jene Leute das ganze Erbe des französischen Idealismus über den Haufen, – diesen Glauben an die Freiheit, der seine Heiligen, seine Märtyrer, seine Heroen besitzt, die Liebe zur Menschheit, das religiöse Streben nach Brüderlichkeit der Nationen und Rassen! Welcher Taumel hat sie ergriffen, daß sie die Ungeheuer, die wir besiegt haben, zurücksehnen, daß sie sich von neuem unter das Joch begeben, das wir zerbrochen haben, daß sie mit leidenschaftlichem Geschrei die Herrschaft der Gewalt zurückrufen und den Haß, den Wahnsinn des Krieges im Herzen meines Frankreichs neu entzünden?
»Das geschieht nicht nur in Frankreich, sondern in der ganzen Welt,« meinte Christof mit lachender Miene. »Von Spanien bis China braust derselbe Sturm. Kein Winkel mehr, in dem man sich vor dem Wind schützen könnte! Schau, es wird beinahe komisch: er weht sogar bis in meine Schweiz hinein; denn sie gebärdet sich nationalistisch!«
»Das findest du trostvoll?«
»Sicherlich. Man sieht daran, daß solche Strömungen nicht den lächerlichen Leidenschaften einiger wenigen Menschen zuzuschreiben sind, sondern einem verborgenen Gott, der das Universum lenkt. Und vor diesem Gott habe ich gelernt, mich zu beugen. Wenn ich ihn nicht begreife, ist das meine, nicht seine Schuld. Versuche, ihn zu begreifen. Wer aber von euch bemüht sich darum? Ihr lebt von einem Tag auf den anderen. Ihr seht nicht weiter als bis zum nächsten Meilenstein, und ihr bildet euch ein, daß er das Ende des Weges bezeichne; ihr seht die Welle, die euch emporträgt, und seht nicht das Meer! Die Welle von heute ist die Welle von gestern, ist die Flut unserer Seele, die ihr den Weg bereitet hat. Die Welle von heute höhlt das Bett für die Welle von morgen, die sie in Vergessenheit bringt, wie die unsere vergessen ist. Ich kann den Nationalismus der gegenwärtigen Stunde weder bewundern noch fürchten. Er wird mit der Stunde vergehen; er geht vorüber, er ist schon vorüber. Er ist eine Sprosse der Leiter: Steige zur Höhe! Er ist der Quartiermeister der kommenden Armee. Hörst du nicht schon ihr Pfeifen und Trommeln erschallen?«
(Christof trommelte auf den Tisch; die Katze wachte auf und fuhr in die Höhe.)
»… Jedes Volk fühlt heute das zwingende Bedürfnis, seine Kräfte zu sammeln und eine Abrechnung aufzustellen; denn seit einem Jahrhundert sind die Völker durch ihre gegenseitige Durchdringung und durch die ungeheure Überschwemmung mit allen Intelligenzen der Welt verwandelt worden und bauen nun die neue Sittlichkeit, die neue Wissenschaft und den neuen Glauben auf. Jedes Volk muß sein Gewissen prüfen und sich genau darüber Rechenschaft ablegen, was es ist und was ihm gehört, bevor es mit den anderen in das neue Jahrhundert eintritt. Ein neues Zeitalter beginnt. Die Menschheit wird einen neuen Vertrag mit dem Leben abschließen. Die Gesellschaft wird sich auf neuen Gesetzen wiederaufbauen. Morgen ist Sonntag. Jeder schließt seine Wochenrechnung ab. Jeder reinigt seine Wohnung und will, daß sein Haus sauber sei, bevor er mit den anderen vereint vor den gemeinsamen Gott tritt und mit ihm den neuen Bund schließt«.
Emanuel schaute Christof an, und seine Augen spiegelten die vorüberziehenden Gesichte wieder. Er schwieg noch einige Zeit, nachdem der andere geredet hatte; dann sagte er:
»Du bist glücklich, Christof! Du siehst nicht die Nacht.«
»Ich sehe die Nacht,« sagte Christof. »Ich habe lange genug darin gelebt. Ich bin eine alte Eule.«
Ungefähr zu dieser Zeit bemerkten seine Freunde eine Veränderung in seinem Wesen. Er war oft zerstreut, wie abwesend. Er hörte nicht recht zu, was man mit ihm sprach. Er zeigte eine in sich versunkene und lächelnde Miene. Wenn man ihn auf seine Zerstreutheit aufmerksam machte, entschuldigte er sich freundlich. Er redete von sich manchmal in der dritten Person:
»Krafft wird das schon machen ...«
oder ...
»Christof wird darüber wohl lachen ...«
Die ihn nicht kannten, sagten:
»Wie töricht eingenommen er von sich ist!« Gerade das Gegenteil war der Fall. Er stand sich selbst wie einem Fremden gegenüber. Für ihn war die Stunde gekommen, in der man den Kampf für das Schöne sein läßt, weil man, nachdem man seine Aufgabe erfüllt hat, zu dem Glauben neigt, daß die anderen die ihre auch erfüllen werden, und daß am Ende, wie Rodin sagt, »das Schöne immer wieder siegt.« Die Bosheit der Leute und die Ungerechtigkeiten brachten ihn nicht mehr auf. – Er sagte sich lachend, daß es nur natürlich sei, wenn das Leben sich von ihm zurückziehe.
Tatsächlich besaß er wirklich seine einstige Kraft nicht mehr. Die geringste körperliche Anstrengung, eine lange Wanderung, ein schneller Lauf ermüdeten ihn. Er war gleich außer Atem; das Herz tat ihm weh. Er dachte manchmal an seinen alten Freund Schulz. Er sprach nicht zu anderen über das, was er empfand. Wozu, nicht wahr? Man macht sie nur besorgt, und man nützt sich nicht. Im übrigen nahm er seine Beschwerden nicht ernst. Er fürchtete weit mehr als krank zu sein, daß man ihn zwingen könnte, sich zu pflegen.
Durch eine geheime Vorahnung wurde er von dem Wunsche beseelt, noch einmal das Vaterland wiederzusehen. Das war ein Plan, den er von Jahr zu Jahr hinausschob. Er sagte immer: nächstes Jahr ... Diesmal schob er es nicht hinaus.
Er reiste heimlich ab, ohne irgend jemand zu benachrichtigen. Die Reise war kurz. Christof fand nichts von dem wieder, was er suchte. Die Umwandlungen, die sich schon bei seinem letzten Aufenthalt gezeigt hatten, waren jetzt vollendet: aus der kleinen Stadt war eine große Industriestadt geworden. Die alten Häuser waren verschwunden. Verschwunden war auch der Friedhof. Anstelle von Sabinens Gutshof erhob eine Fabrik ihre hohen Schornsteine. Der Fluß hatte die Wiesen völlig fortgenagt, auf denen Christof als Kind gespielt hatte. Eine Straße (und was für eine Straße!) zwischen ungeheueren Gebäuden trug seinen Namen. Alles aus der Vergangenheit war tot, ja selbst der Tod. Sei es drum! Das Leben ging weiter. Vielleicht träumten, liebten und kämpften andere kleine Christofs hinter den Mauern dieser Straße, die mit seinem Namen geziert war. – Bei einem Konzert in der gigantischen Tonhalle hörte er eines seiner Werke in völligem Gegensatz zu seiner Auffassung wiedergeben, er erkannte es kaum ... Sei's drum! Falsch verstanden, würde es vielleicht doch neue Kräfte erwecken. Wir haben das Korn gesät. Tut damit, was ihr mögt; nährt euch von uns. – Christof wanderte bei sinkender Nacht durch die Felder rings um die Stadt, über der große Nebel webten, und dachte an die großen Nebel, die bald auch sein Leben umhüllen würden, dachte an die geliebten Wesen, die von der Erde entschwunden, in seinem Herzen geborgen waren, und die die sinkende Nacht gleich ihm bald wieder bedecken würde ... Sei es drum! Sei es drum! Ich fürchte dich nicht, o Nacht, du Brutstätte der Sonnen! Für einen verlöschenden Stern entzünden sich tausend andere. Wie ein kochender Milchkessel strömt der Abgrund des Raumes über von Licht. Du löschest mich nicht. Der Hauch des Todes wird mein Leben neu entfachen.
Bei der Rückfahrt aus Deutschland wollte Christof einen Abstecher in die Stadt machen, in der er Anna gekannt hatte. Seit er sie verlassen hatte, wußte er nichts mehr von ihr. Er hatte nicht gewagt, sich nach ihr zu erkundigen. Jahre hindurch ließ ihn der bloße Name erzittern ... – Jetzt war er ruhig, er fürchtete nichts mehr. Aber als am Abend in seinem Hotelzimmer, das auf den Rhein ging, der bekannte Glockensang das Fest des nächsten Tages einläutete, lebten die Bilder der Vergangenheit wieder auf. Aus dem Fluß stieg der Duft der fernen Gefahr zu ihm auf, die er kaum noch begriff. Er brachte die ganze Nacht damit zu, sie in sein Gedächtnis zurückzurufen. Er fühlte sich befreit von dem gefährlichen Meister. Das erfüllte ihn mit wehmütig-wonnevollem Gefühl. Er war noch nicht entschlossen, was er am nächsten Tage tun wollte. Einen Augenblick hatte er den Gedanken – (die Vergangenheit lag ja so weit zurück!) – bei den Brauns einen Besuch zu machen. Aber am nächsten Morgen fehlte ihm der Mut; er wagte nicht einmal, im Hotel zu fragen, ob der Doktor und seine Frau noch lebten. Er entschloß sich abzureisen.
Zur Stunde der Abfahrt trieb ihn eine unwiderstehliche Macht in die Kirche, in die Anna einst ging. Er stellte sich hinter einen Pfeiler, von wo aus er die Bank sehen konnte, auf der sie einst gekniet. Er wartete und war gewiß, daß, wenn sie lebte, sie noch immer dorthin komme.
Und wirklich kam eine Frau; und er erkannte sie nicht. Sie sah wie die anderen aus: beleibt, mit vollem Gesicht, starkem Kinn, gleichmütigem und hartem Ausdruck. In Schwarz. Sie ging an ihren Platz und saß dort unbeweglich. Sie schien weder zu beten noch zuzuhören. Sie sah vor sich hin. Nichts in dieser Frau erinnerte Christof an die, die er erwartete. Nur ein oder zweimal eine etwas steife Bewegung, als wollte sie die Falten ihres Kleides über den Knien glatt streichen. »Sie« hatte einst diese Bewegung ... Beim Fortgehen strich sie dicht an ihm vorbei, langsam, mit steifer Kopfhaltung, die Hände mit dem Gesangbuch über dem Leib gefaltet. Einen Augenblick traf das Licht dieser düsteren und müden Augen Christofs Augen. Sie schauten sich an. Und sie erkannten sich nicht. Gerade und steif ging sie vorüber, ohne den Kopf zu wenden. Erst einen Augenblick später erkannte er unter dem starren Lächeln, in einem plötzlichen Aufblitzen des Gedächtnisses, an einer gewissen Falte den Mund, den er einst geküßt hatte ... Der Atem versagte ihm, seine Knie schwankten.
Er dachte:
»Gott, ist das der Körper, in dem die, die ich liebte, wohnte? Wo ist sie? Wo ist sie? Und wo bin ich selbst? Wo ist der, der sie liebte? Was bleibt von uns übrig und von der grausamen Liebe, die uns verzehrt hat? – Die Asche. Wo ist das Feuer?«
Und sein Gott antwortete ihm:
»In mir.«
Da hob er die Augen und sah sie zum letzten Male, unter der Menge, wie sie durch das Portal in die Sonne hinausschritt.
Kurze Zeit nach seiner Rückkehr nach Paris schloß er Frieden mit seinem alten Feinde Lévy-Coeur. Dieser hatte ihn lange mit ebensoviel boshaftem Talent wie vorgespiegelter Überzeugung angegriffen. Dann, als er zu Erfolg gekommen, mit Ehren bedeckt, befriedigt und beruhigt war, hatte er soviel Geist besessen, Christofs Überlegenheit im stillen anzuerkennen; und er war ihm entgegengekommen. Christof hatte scheinbar weder Angriff noch Entgegenkommen bemerkt. Lévy-Coeur war der Versuche überdrüssig geworden. Sie wohnten in demselben Stadtteil und begegneten sich oft. Sie machten keine Miene, einander als Bekannte anzusehen. Christof ließ beim Vorübergehen seinen Blick über Lévy-Coeur hingleiten, als sähe er ihn nicht. Diese ruhige Art, ihn zu verleugnen, brachte Lévy-Coeur außer sich.
Er hatte eine achtzehnjährige, hübsche, feine, elegante Tochter, mit einem Hammelprofil, einem Glorienschein blonder, krauser Haare, sanften, koketten Augen und einem Luinischen Lächeln. Sie gingen zusammen spazieren; Christof begegnete ihnen auf den Wegen des Luxembourg; sie schienen sehr innig miteinander zu stehen; das junge Mädchen ging anmutig am Arm des Vaters. Christof, der bei aller Zerstreutheit doch hübsche Gesichter bemerkte, hatte für dieses eine Schwäche. Er dachte von Lévy-Coeur:
»Der Kerl hat Glück.«
Aber stolz fügte er hinzu:
»Auch ich habe eine Tochter.«
Und er verglich sie miteinander. Dieser Vergleich, bei dem seine Parteilichkeit Aurora jeden Vorzug gab, hatte schließlich in seinem Geist eine Art erträumter Freundschaft zwischen den beiden jungen Mädchen, die einander nicht kannten, geschaffen, und sogar, ohne daß er es merkte, ihm Lévy-Coeur näher gebracht.
Als er aus Deutschland zurückkam, erfuhr er, daß das »Schäfchen« gestorben war. Sein väterlicher Egoismus dachte sogleich:
»Wenn das meiner Tochter geschehen wäre!«
Und unendliches Mitleid mit Lévy-Coeur erfüllte ihn. Im ersten Augenblick wollte er ihm schreiben. Er begann zwei Briefe. Sie befriedigten ihn nicht. Er empfand eine falsche Scham; er sandte sie nicht ab. Aber einige Tage später, als er Lévy-Coeur wieder traf, dessen Gesicht verstört war, konnte er sich nicht bezwingen: er ging geradenwegs auf den Unglücklichen zu und streckte ihm die Hände entgegen. Lévy-Coeur ergriff sie, ebenfalls ohne zu überlegen. Christof sagte:
»Sie haben sie verloren.« ...
Sein bewegter Ton drang Lévy-Coeur ins Herz. Er empfand dabei eine unaussprechliche Dankbarkeit ... Sie tauschten schmerzerfüllte und verlegene Worte. Als sie darauf auseinandergingen, war nichts mehr von dem, was sie getrennt hatte, zurückgeblieben. Sie hatten einander bekämpft; das war zweifellos unvermeidlich gewesen; jeder muß dem Gesetz seiner Natur folgen! Wenn man aber das Ende der Tragikomödie kommen sieht, legt man die Leidenschaften, in die man vermummt war, ab und steht sich Auge in Auge gegenüber, – wie zwei Menschen, von denen der eine nicht viel besser ist als der andere, und die wohl berechtigt sind, nachdem sie ihre Rollen so gut sie konnten gespielt haben, einander die Hand zu reichen.
Die Heirat zwischen Georg und Aurora war für die ersten Frühlingstage festgesetzt worden. Mit Christofs Gesundheit ging es schnell bergab. Er hatte bemerkt, wie seine Kinder ihn mit besorgter Miene beobachteten. Einmal hörte er, wie sie halblaut miteinander redeten. Georg sagte:
»Wie schlecht er aussieht. Er ist imstande, jetzt noch krank zu werden.«
Und Aurora antwortete:
»Hoffentlich schiebt er unsere Hochzeit nicht hinaus.«
Er ließ es sich gesagt sein. Arme Kinder! Auf keinen Fall wollte er ihr Glück stören!
Aber am Vorabend der Hochzeit ging es ihm recht schlecht; (er hatte sich in den letzten Tagen lächerlich aufgeregt – man hätte meinen können, er sei es, der sich verheirate) – er war sehr ärgerlich, daß ihn sein altes Übel so überrumpelte, seine frühere Lungenentzündung, deren erster Anfall in die Zeit des Jahrmarktes zurückreichte. Er ärgerte sich über sich selbst. Er schalt sich einen Dummkopf. Er schwor, sich nicht unterkriegen zu lassen, bevor die Hochzeit stattgefunden habe. Er dachte an die sterbende Grazia, die ihn am Vorabend eines Konzertes nichts von ihrer Krankheit hatte wissen lassen; damit er von seiner Aufgabe und seinem Vergnügen nicht abgelenkt werde. Der Gedanke, jetzt für ihre Tochter – für sie – das zu tun, was sie für ihn einst tat, war ihm lieb. Er verbarg also seine Unpäßlichkeit; aber es wurde ihm schwer, bis zuletzt durchzuhalten. Immerhin machte ihn das Glück der beiden Kinder so froh, daß es ihm gelang, ohne Schwächeanwandlung die lange kirchliche Feier über sich ergehen zu lassen. Kaum war er zu Hause bei Colette, so verließen ihn die Kräfte. Er hatte gerade noch Zeit, sich in ein Zimmer zurückzuziehen; da wurde er ohnmächtig. Ein Dienstbote fand ihn so. Christof verbot, nachdem er zu sich gekommen war, den Jungvermählten, die am Abend abreisen sollten, etwas davon mitzuteilen. Sie waren allzu sehr mit sich beschäftigt, um irgend etwas anderes zu bemerken. Sie verließen ihn fröhlich und versprachen, morgen, übermorgen zu schreiben ...
Sobald sie abgereist waren, mußte sich Christof niederlegen. Das Fieber ergriff ihn und verließ ihn nicht mehr. Er war allein. Emanuel, der ebenfalls krank war, konnte nicht kommen. Christof nahm keinen Arzt. Er hielt seinen Zustand nicht für beunruhigend. Im übrigen hatte er keinen Dienstboten, um einen Arzt holen zu lassen. Die Aufwartefrau, die morgens zwei Stunden kam, nahm keinen Anteil an ihm; und er fand Mittel und Wege, sich ihrer Dienste zu entledigen. Er hatte sie schon zehnmal gebeten, beim Aufräumen nicht an seine Papiere zu rühren. Sie blieb hartnäckig; jetzt, da er an das Bett gefesselt war, hielt sie den Augenblick für gekommen, ihren Willen durchzusetzen. Er sah von seinem Lager aus im Schrankspiegel, wie sie im Nebenzimmer alles drunter und drüber warf. Er wurde so wütend – (nein, der alte Adam war sichtlich noch nicht in ihm gestorben) – daß er aus den Federn sprang, ihr ein Paket mit beschriebenen Papieren aus der Hand riß und sie vor die Türe setzte. Sein Zorn trug ihm einen schönen Fieberanfall ein und das Ausbleiben der beleidigten Dienstmagd, die nicht wiederkam und sich auch nicht die Mühe gab, es »diesem alten Narren«, wie sie ihn nannte, mitzuteilen. So blieb er denn trotz seiner Krankheit ohne jede Bedienung. Er stand morgens auf, um den Milchtopf, der vor seine Türe gesetzt wurde, zu holen und zu sehen, ob die Hausmeisterin nicht den versprochenen Brief des Liebespaares durch die Türritze gesteckt hatte. Der Brief kam nicht; sie vergaßen ihn in ihrem Glück. Er war ihnen darum nicht böse; er sagte sich, daß er es an ihrer Stelle ebenso gemacht hätte. Er dachte an ihre sorglose Freude, und daß er es gewesen war, der sie ihnen verschafft hatte. Es ging ihm ein wenig besser, und er stand schon wieder auf, als endlich der Brief Auroras ankam. Georg hatte sich damit begnügt, seine Unterschrift anzufügen. Aurora erkundigte sich kaum nach Christof und erzählte ihm wenig Neues. Dafür aber übertrug sie ihm eine Besorgung: sie bat ihn, ihr eine Halskrause nachzusenden, die sie bei Colette vergessen hatte. Obgleich das durchaus nicht wichtig war – (Aurora war erst im Augenblick, als sie an Christof schrieb, darauf gekommen, weil sie nach etwas suchte, was sie ihm wohl sagen könnte) – war Christof doch ganz froh, daß er zu irgend etwas gut sei, und ging aus, um das Ding zu holen. Es war Hagelwetter. Der Winter machte noch einen späten Angriff. Zerschmolzener Schnee, eisiger Wind. Nirgends ein Wagen. Christof mußte in einem Wartehaus stehen. Die Unhöflichkeit der Angestellten und ihre absichtliche Langsamkeit versetzten ihn in eine Aufregung, die seiner Gesundheit nicht förderlich war. Sein krankhafter Zustand war zum Teil die Ursache dieser Zornanfälle, die seiner geistigen Ruhe widersprachen; sie durchfuhren seinen Körper wie die letzten Schauer die Eiche, die unter der Axt fällt. Durchfroren kehrte er heim. Die Hausmeisterin übergab ihm, als er vorbeiging, einen Zeitschriftenausschnitt. Er warf einen Blick darauf. Es war ein bösartiger Artikel, ein Angriff gegen ihn. Sie kamen jetzt selten vor. Jemand anzugreifen, der es nicht merkt, macht kein Vergnügen. Die Wütendsten, wenn sie ihn auch nicht ausstehen konnten, wurden von einer Achtung für ihn bezwungen, die sie selbst ärgerte.
Bismarck sagte mit einem gewissen Bedauern, »nichts hänge so wenig vom Willen ab wie die Liebe; die Achtung tue es weit mehr ...«
Aber der Verfasser des Aufsatzes gehörte zu den starken Männern, die, besser als Bismarck gewappnet, von Anwandlungen der Achtung und Liebe unberührt bleiben. Er sprach von Christof in beleidigenden Ausdrücken und kündigte für die nächste, in vierzehn Tagen erscheinende Nummer eine Fortsetzung seiner Angriffe an. Christof mußte lachen und sagte, als er sich wieder hinlegte:
»Er wird schön hereinfallen; er wird mich nicht mehr zu Hause antreffen.«
Man wollte, daß er eine Wärterin zur Pflege nähme; er setzte sich eigensinnig zur Wehr. Er sagte, er habe lange genug allein gelebt, um zum mindesten die Wohltat seiner Einsamkeit in einem solchen Augenblick verlangen zu können.
Er langweilte sich nicht. In diesen letzten Jahren führte er dauernd Zwiesprache mit sich selbst: es war, als besäße er eine Doppelseele. Seit einigen Monaten aber war er innerlich noch mehr beschäftigt: nicht mehr zwei, sondern zehn Seelen wohnten in ihm. Sie unterhielten sich miteinander; häufiger noch sangen sie. Er nahm an der Unterhaltung teil oder schwieg, um zuzuhören. Er hatte stets auf seinem Bett oder auf seinem Tisch in greifbarer Nähe Notenpapier, auf das er ihre und seine Vorschläge niederschrieb, wobei er über die Entgegnungen lachte. Eine mechanische Angewohnheit; die beiden Handlungen, Denken und Schreiben, waren fast dasselbe geworden; Schreiben bedeutete für ihn, in voller Klarheit denken. Alles, was ihn von der Gesellschaft mit seiner Seele ablenkte, war ihm zuviel, ärgerte ihn. In gewissen Augenblicken sogar die Freunde, die er am meisten liebte. Er gab sich Mühe, es sie nicht zu sehr merken zu lassen. Aber dieser Zwang versetzte ihn in eine außerordentliche Ermattung. Er war ganz glücklich, wenn er sich dann wiederfand: denn er hatte sich verloren; es war unmöglich, die inneren Stimmen über dem menschlichen Geschwätz zu vernehmen. Göttliches Schweigen! ...
Er erlaubte nur der Hausmeistersfrau oder einem ihrer Kinder, daß sie zwei oder dreimal täglich kamen, um zu sehen, ob er etwas brauche. Er gab ihnen auch die Briefchen, die er bis zum letzten Tage beständig mit Emanuel wechselte. Die beiden Freunde waren einer fast ebenso krank wie der andere: sie täuschten sich darüber nicht. Auf verschiedenen Wegen waren der religiöse Genius Christofs und der freie, religionslose Genius Emanuels zur gleichen brüderlichen Milde gelangt. In ihrer zitternden Schrift, die sie mit mehr und mehr Mühe lasen, unterhielten sie sich, nicht von ihrer Krankheit, sondern von dem, was immer der Gegenstand ihrer Unterhaltungen gewesen war, von ihrer Kunst, von der Zukunft ihrer Ideen.
Bis zu dem Tage, an dem Christof mit versagender Hand das Wort des Schwedenkönigs, der in der Schlacht fiel, niederschrieb:
»Ich habe genug, Bruder, rette dich!«
Sein Blick umfing sein ganzes Leben wie eine Stufenleiter: die ungeheuerliche Anstrengung seiner Jugend, von sich selbst Besitz zu ergreifen, und die wütenden Kämpfe, den anderen sein bloßes Lebensrecht abzuzwingen, um der Dämonen seines Geschlechtes Herr zu werden. Selbst nach dem Siege der Zwang, rastlos über der Eroberung zu wachen, sie gegen den Sieg selber zu verteidigen. Die Wonnen und Prüfungen der Freundschaft, die das im Kampfe vereinsamte Herz der großen Menschheitsfamilie wieder zuführt. Das Vollgefühl der Kunst, der Mittag des Lebens. Stolz über den bezwungenen Geist herrschen. Sich Herr seines Schicksals glauben, um plötzlich bei der Wegbiegung auf die apokalyptischen Reiter zu stoßen, auf die Trauer, die Leidenschaft, die Schmach, den Vortrab des Herrn. Von Pferdehufen zu Boden gerissen, überritten, blutüberströmt sich bis zum Gipfel schleppen, auf dem aus Wolken empor das wilde, reinigende Feuer flammt. Gott Auge in Auge gegenüberstehen. Mit ihm kämpfen wie Jakob mit dem Engel. Gebrochen aus dem Kampf hervorgehen. Seine Niederlage lieben, seine Grenzen erkennen, sich zwingen, den Willen des Herrn auf dem Gebiet, das er uns gewiesen hat, zu erfüllen, um schließlich, wenn das Ackern, die Saat und die Ernte, wenn die harte, schöne Arbeit vollendet sein wird, das Recht erworben zu haben, sich am Fuß der besonnten Berge hinzustrecken und zu ihnen zu sprechen:
»Seid gesegnet! Ich werde euer Licht nicht genießen. Aber euer Schatten ist mir wonnevoll ...«
Dann war ihm die Geliebte erschienen; sie hatte ihn bei der Hand genommen; und der Tod hatte, indem er die Schranken seines Körpers niederbrach, die reine Seele der Freundin in die Seele des Freundes strömen lassen. Gemeinsam waren sie aus dem Dunkel der Tage hinausgeschritten und hatten die glückseligen Gipfel erreicht, auf denen, gleich den drei Grazien, in edlem Reigen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich bei der Hand hielten, wo das friedvolle Herz Leiden und Freuden zugleich entstehen, aufblühen und welken sieht, wo alles Harmonie ist ...
Er hatte es zu eilig. Er glaubte sich schon am Ziel. Doch der Schraubstock, der seine keuchende Brust zusammenpreßte, und das tobende Durcheinander von Bildern, die sich in seinem glühenden Kopf jagten, brachten ihm das Bewußtsein, daß noch die letzte Wegstrecke, die schwerste, zurückzulegen war ... Vorwärts! ... Er lag reglos an sein Bett gefesselt. Ein Stockwerk über ihm klimperte eine dumme kleine Frau stundenlang auf dem Klavier; sie konnte nur ein Stück; sie wiederholte unaufhörlich dieselben Sätze; es machte ihr soviel Vergnügen. Es bereitete ihr Freude und Erregung, die von mannigfachen Farben und Gestalten belebt wurden. Und Christof verstand ihr Glück; aber er wurde bis zu Tränen gepeinigt. Wenn sie wenigstens nicht so laut gepaukt hätte! Lärm war Christof so verhaßt wie die Sünde ... Schließlich ließ er es über sich ergehen. Es war so schwer, nicht hinzuhören. Doch es machte ihm weniger Mühe, als er gedacht hatte. Er löste sich von seinem Körper, diesem kranken, schwerfälligen Körper. Welche Schmach, daß man soviele Jahre in ihn eingeschlossen war! Er sah, wie er verfiel, und dachte: »Er macht es nicht mehr lange.«
Er fragte sich, um seinen menschlichen Egoismus zu prüfen:
»Was würdest du vorziehen? Daß die Erinnerung an Christof, an seine Person, an seinen Namen in Ewigkeit fortbestände und seine Werke verschwänden? Oder daß sein Werk dauere, und daß keinerlei Spur von seiner Person und seinem Namen übrig bliebe?«
Ohne zu zögern erwiderte er:
»Daß ich verschwände und mein Werk dauerte! Ich würde dabei doppelt gewinnen; denn es würde von mir nur das Wahrste, das einzig Wahre bleiben. Möge Christof untergehen ...«
Aber bald darauf fühlte er, wie er seinem Werke ebenso fremd wurde wie sich selbst. Welche kindliche Illusion, an die Ewigkeit seiner Kunst zu glauben! Er hatte das deutliche Bewußtsein, nicht allein des Wenigen, das er geschaffen hatte, sondern der Zerstörung, die die gesamte moderne Musik bedroht. Schneller als jede andere verzehrt sich die musikalische Sprache; nach ein oder zwei Jahrhunderten werden nur wenige Eingeweihte sie verstehen. Für wen bestehen noch Monteverdi und Lully? Schon überzieht Moos die Eichen des klassischen Waldes. Unsere Klanggebäude, in denen unsere Leidenschaften singen, werden zu leeren Tempeln werden, werden in Vergessenheit versinken ... Und Christof wunderte sich, daß er diese Ruinen ohne innere Unruhe betrachten konnte. –
»Liebe ich das Leben denn weniger?« fragte er sich erstaunt.
Aber er begriff alsbald, daß er es weit mehr liebte. Über den Trümmern der Kunst weinen? Das war der Mühe nicht wert. Die Kunst ist der Menschenschatten, der über die Natur gebreitet ist. Mögen sie beide, von der Sonne aufgetrunken, verschwinden. Sie hindern mich, die Sonne zu sehen ... Die unendlichen Schätze der Natur rinnen durch unsere Finger, der menschliche Verstand will fließendes Wasser in den Maschen eines Netzes fangen. Unsere Musik ist Täuschung. Unsere Tonleitern, unsere Klangfolgen sind Erfindung. Sie entsprechen keinem einzigen Ton der Wirklichkeit. Sie bedeuten gegenüber den wirklichen Tönen einen geistigen Kompromiß, die Anwendung eines metrischen Systems auf die ewige Bewegung. Der Geist bedurfte dieser Lüge, um das Unbegreifliche zu begreifen; und da er daran glauben wollte, glaubte er. Aber das alles ist nicht wahr. Es ist nicht lebendig. Und der Genuß, den der Geist von diesem durch ihn geschaffenen Gesetz empfängt, wird nur durch die Fälschung der unmittelbaren Ahnung alles dessen erzwungen, was ist. Von Zeit zu Zeit empfindet ein Genie in vorübergehender Berührung mit der Erde plötzlich den Sturzbach der Wirklichkeit, der die Rahmen der Kunst sprengen möchte. Für einen Augenblick krachen die Dämme. Die Natur strömt durch eine Spalte hinaus. Aber gleich darauf wird der Riß zugestopft. Das ist zum Schutz der menschlichen Vernunft nötig. Sie würde zugrunde gehen, wenn ihre Augen dem Auge Jehovahs begegnen würden. Also beginnt sie von neuem, ihre Zellen zu bauen, in die nichts von außen eindringt, was sie nicht verarbeitet hat; vielleicht ist das auch schön für die, die nicht sehen wollen ... Ich aber, ich will dein Antlitz sehen, Jehovah! Ich will den Donner deiner Stimme vernehmen, mag er mich auch vernichten. Der Lärm der Kunst stört mich. Es schweige der Geist. Ruhe für den Menschen! ...
Aber wenige Minuten nach diesen schönen Reden suchte er tastend eines der Papierblätter, die auf seiner Decke verstreut lagen, und versuchte wieder, ein paar Noten daraufzuschreiben. Als er den Widerspruch seiner Handlungsweise bemerkte, lächelte er und sagte:
»O du meine alte Gefährtin, meine Musik, du bist besser als ich. Ich bin ein Undankbarer, ich gebe dir den Laufpaß. Aber du, du verläßt mich nicht. Du läßt dich durch meine Launen nicht beirren. Verzeih; du weißt ja, das alles sind Grillen. Ich habe dich niemals verraten, du hast mich niemals verraten, wir sind einander sicher. Wir gehen gemeinsam davon, liebe Freundin. Bleibe bei mir bis zum Ende.
Bleib bei uns ...«

Er erwachte aus einer langen Betäubung, schwer von Fieber und Träumen, von seltsamen Träumen, die ihn noch ganz erfüllten. Und jetzt betrachtete er sich, betastete sich, suchte sich und konnte sich nicht mehr finden. Ihm war, als sei er »ein anderer«. Ein anderer, der ihm teuerer war als er selbst ... Wer nur? ... Ihm war, als hätte sich ein anderer im Traume in ihm verkörpert. Olivier? Grazia? ... Sein Herz, sein Kopf waren so schwach. Er konnte unter seinen Geliebten nicht mehr unterscheiden. Wozu auch unterscheiden? Er liebte sie alle gleich sehr. Er blieb gelähmt wie in einer erschlaffenden Glückseligkeit liegen. Er wollte sich nicht rühren. Er wußte, daß der Schmerz ihm aus dem Hinterhalt auflauerte, wie die Katze der Maus. Er spielte den Toten. Schon jetzt ... Niemand im Zimmer. Über seinem Haupte war das Klavier verstummt. Einsamkeit. Stille. Christof seufzte.
»Wie gut tut es, wenn man sich am Ende seines Lebens sagen kann, daß man niemals allein gewesen ist, selbst dann nicht, wenn man es am meisten war ... All ihr Seelen, denen ich auf meinen Wegen begegnet bin, Brüder, die ihr einen Augenblick lang mir die Hand gegeben habt, geheimnisvolle Geister, die meinem Denken entsprossen waren, Tote und Lebende, – nein, alles Lebende, – o, all das, was ich geliebt habe, all das, was ich geschaffen habe! Ihr umfangt mich mit eurer warmen Umarmung, ihr wacht bei mir, ich vernehme die Musik eurer Stimmen. Gesegnet sei das Schicksal, das mir euch geschenkt hat! Ich bin reich ... Mein Herz ist übervoll! ...«
Er sah zum Fenster ... Es war einer jener schönen sonnenlosen Tage, die, wie der alte Balzac sagt, einer schönen Blinden gleichen ... Christof vertiefte sich leidenschaftlich in den Anblick eines Zweiges, der sich vor den Scheiben neigte. Der Zweig schwoll an, und feuchte Knospen brachen auf, kleine weiße Blüten entfalteten sich; und in diesen Blüten, in diesen Blättern, in diesem sich erneuernden Wesen lebte eine solche verzückte Hingabe an die Auferstehungskraft, daß Christof seine Ermattung, seine Bedrücktheit, seinen elenden sterbenden Körper nicht mehr fühlte und in diesem Zweig wiederauflebte. Der sanfte Widerschein dieses Lebens hüllte ihn ein. Es war wie ein Kuß. Sein von Liebe übervolles Herz schenkte sich dem schönen Baum, der seinen letzten Augenblicken zulächelte. Er dachte daran, daß in dieser Minute Geschöpfe einander liebten, daß diese Stunde, die für ihn die Auflösung bedeutete, für andere eine Stunde des Rausches war, – daß es immer so sein wird, daß die mächtige Lebensfreude niemals versiegt. Und nach Atem ringend, mit einer Stimme, die seinem Denken nicht mehr gehorchte, – (vielleicht kam kein Ton aus seiner Kehle, aber er merkte es nicht) – begann er, einen Lobgesang auf das Leben anzustimmen.
Ein unsichtbares Orchester antwortete ihm. Christof sagte sich: »Wie stellen sie es nur an, um mitzukommen? Wir haben nicht geprobt, hoffentlich kommen sie ohne Fehler bis zum Schluß!« Er versuchte, sich in seinem Bette aufzurichten, damit man ihn vom ganzen Orchester aus gut sähe, und schlug mit seinen langen Armen den Takt. Aber das Orchester irrte sich nicht; es war seiner Sache sicher. Welch wundervolle Musik! Jetzt improvisierten sie Wiederholungen. Christof machte das Spaß:
»Halt, mein Junge, du wirst schon hereinfallen.« Und mit einem Taktzeichen lenkte er launisch die Barke nach rechts und links durch gefahrvolle Straßen.
»Wie wirst du dich hier herausfinden? ... Und da heraus? Los! ... und gar hier?«
Sie fanden sich immer zurecht ... Sie antworteten den Kühnheiten durch andere, noch gewagtere.
»Was werden sie nun noch erfinden? Verteufelte Schlauköpfe!« Christof schrie Bravo und lachte hell heraus.
»Verdammt, jetzt ist es schwer geworden, ihnen zu folgen! Werde ich mich schlagen lassen? ... Ihr wißt, das gilt nicht! Ich bin heute marode. Schadet nichts; es ist noch nicht gesagt, daß sie das letzte Wort haben werden!«
Aber das Orchester entfaltete eine Fantasie von so überströmender Fülle, von solcher Neuartigkeit, daß nichts weiter übrig blieb, als liegen zu bleiben und mit offenem Munde zuzuhören. Der Atem verging ihm ... Christof wurde von Mitleid mit sich selbst ergriffen:
»Schafskopf!« sagte er zu sich, »du bist ausgepumpt. Schweig doch. Das Instrument hat alles hergegeben, was es konnte. Genug von diesem Körper! Ich brauche einen anderen.«
Aber der Körper rächte sich. Heftige Hustenanfälle hinderten ihn am Zuhören.
»Wirst du wohl schweigen!«
Er faßte sich bei der Kehle, versetzte seiner Brust Faustschläge wie einem Feinde, den es zu besiegen gilt. Er sah sich mitten in einem Schlachtgetümmel. Die Menge heulte. Ein Mann umfaßte ihn mit den Armen. Sie stürzten zusammen hin. Der andere kniete auf ihm. Er erstickte ihn.
»Laß mich los, ich will hören! Ich will hören! Oder ich töte dich!« Er stieß ihn mit dem Kopf gegen die Wand. Der andere ließ nicht los.
»Aber wer ist das jetzt? Mit wem kämpfe ich so eng umschlungen? Wem gehört dieser Körper, den ich halte, der mich verbrennt? ...«
Kämpfe, von den Sinnen vorgetäuscht. Ein Chaos von Leidenschaften. Wut, Wollust, Mordlust, sinnliche Umarmungen, noch ein letztes Mal der ganze Schlamm aufgewühlt ...
»Ach, wird das nun nicht bald ein Ende haben? Werde ich euch nicht losreißen, Blutegel, die ihr an meinem Körper saugt? ... Wenn doch mein Fleisch mit ihnen abfiele!«
Von den Schultern, den Schenkeln, den Knien stieß Christof, sich aufstützend, den unsichtbaren Feind fort ... Er war frei! ... In weiter Ferne spielte noch immer die verhallende Musik. Christof streckte, von Schweiß überströmt, die Arme aus:
»Warte auf mich! Warte auf mich!«
Er lief, um sie einzuholen. Er taumelte. Er stieß alles um ... Er war so schnell gelaufen, daß er nicht mehr atmen konnte. Sein Herz schlug, das Blut sauste ihm in den Ohren: eine Eisenbahn, die durch einen Tunnel rollt.
»Mein Gott, ist das dumm! ...«
Er machte dem Orchester verzweifelte Zeichen, daß es nicht ohne ihn weiterspielen solle ... Endlich! Er war aus dem Tunnel heraus ... Es wurde wieder still. Er hörte wieder.
»Wie schön! Wie schön! Weiter. Mut, meine Jungens! ... Aber von wem kann das sein? ... Was sagt ihr? ... Ihr sagt, daß diese Musik von Johann Christof Krafft ist? Unsinn! Welche Torheit! Ich habe ihn doch gekannt! Niemals hätte er zehn solche Takte schreiben können ... Wer hustet da noch? Macht nicht soviel Lärm! Was ist das für ein Akkord? ... Und dieser da? ... Nicht so schnell! Wartet! ...«
Christof stieß unartikulierte Schreie aus; seine Hand machte auf der Decke, die er umkrampft hielt, die Bewegung des Schreibens; und sein erschöpftes Gehirn suchte mechanisch weiter, aus welchen Elementen diese Musik zusammengesetzt sei, und was sie bedeute: es gelang ihm nicht. Durch die Erregung entglitt ihm das Gefundene wieder. Er begann von neuem ... Ah! diesmal war es zuviel!
»Halt, halt, ich kann nicht mehr.«
Sein Wille ließ völlig nach. Christof schloß vor innerer Freudigkeit die Augen. Tränen des Glückes rannen unter seinen geschlossenen Lidern hervor. Das kleine Mädchen, das ihn, ohne daß er es merkte, betreute, trocknete sie fromm. Er fühlte nichts mehr von dem, was hier unten vorging. Das Orchester schwieg still und ließ ihn mit einer schwindelnden Harmonie allein, deren Rätsel ungelöst blieb. Das Gehirn wiederholte hartnäckig: »Aber welcher Akkord ist das? Wie kann man da herauskommen? Ich möchte doch gern die Lösung finden, bevor es zu Ende ist ...«
Stimmen erhoben sich jetzt. Eine leidenschaftliche Stimme. Die tragischen Augen Annas ... Aber im selben Augenblick war es nicht mehr Anna. Diese Augen voller Güte ...
»Grazia, bist du es? ... Wer von euch? Wer von euch? Ich sehe euch nicht mehr gut. Warum dauert es denn so lange, bis die Sonne kommt?«
Drei ruhige Glocken läuteten. Die Spatzen am Fenster piepsten, um ihn an die Stunde zu erinnern, in der er ihnen die Brocken vom Frühstück gab ... Christof sah im Traum sein kleines Kinderzimmer wieder ... Die Glocken – das ist die Morgendämmerung! Die schönen Klangwellen schweben durch die leichte Luft. Sie kommen von weit her, aus den Dörfern dort unten ... Das Murmeln des Flusses wächst hinter dem Hause an ... Christof sah sich wieder, wie er am Treppenfenster lehnte. Sein ganzes Leben floß vor seinen Augen dahin, gleich dem Rhein. Sein ganzes Leben, alle seine Leben, Luise, Gottfried, Olivier, Sabine ...
»Mutter, Geliebte, Freunde ... Wie nenne ich euch mit Namen? ... Liebe, wo bist du? Wo seid ihr, meine Seelen? Ich weiß, ihr seid hier, und ich kann euch nicht fassen.«
»Wir sind bei dir, Vielgeliebter.«
»Ich will euch nicht mehr verlieren. Ich habe euch so sehr gesucht.«
»Quäle dich nicht, wir werden dich nicht mehr verlassen.«
»Ach, die Welle trägt mich fort.«
»Der Strom, der dich fortträgt, trägt uns mit dir dahin.«
»Wo geht es hin?«
»Dorthin, wo wir vereint sein werden.«
»Wird es bald sein?«
»Schau hin.«
Und Christof, der eine übermenschliche Anstrengung machte, um den Kopf zu heben (Gott, wie schwer es war!), sah, wie der aus seinen Ufern tretende Strom die Felder bedeckte und sich erhaben, langsam, fast reglos dahinwälzte. Und gleich einem stählernen Schimmer schien vom Rande des Horizontes ein silberner Flutstreifen, zitternd in der Sonne, ihm entgegenzufließen. Das Rauschen des Ozeans ... Und sein brechendes Herz fragte: »Ist Er es?«
Die Stimmen aller seiner Geliebten antworteten ihm:
»Er ist es.«
Sein langsam versagendes Hirn dachte indessen:
»Die Pforte öffnet sich ... Da ist der Akkord, den ich suchte! ... Aber das ist doch nicht das Ende? Welche neuen, unendlichen Räume ... Morgen geht es weiter.«
O Freude, Freude, sich hinschwinden zu sehen in den erhabenen Frieden des Gottes, dem man zu dienen sein Leben lang sich bemüht hat! ...
»Herr, bist du nicht gar zu unzufrieden mit deinem Knecht? Ich tat so wenig. Ich vermochte nicht mehr ... Ich habe gekämpft, ich habe gelitten, ich irrte, ich schuf. Laß mich Atem schöpfen in deinen väterlichen Armen. Eines Tages werde ich zu neuen Kämpfen wieder auferstehen.«
Und das Rollen des Flusses und das rauschende Meer sangen mit ihm:
Du wirst auferstehen. Ruhe aus. Alles ist nur noch ein einziges Herz. Ein Lächeln von Tag und Nacht, die einander umschlingen. Harmonie, du erhabene Paarung von Liebe und Haß! Ich lobsinge dem Gott mit den beiden mächtigen Schwingen. Hosiannah dem Leben! Hosiannah dem Tode!
Christofori faciem die quacumque tueris,
Illa nempe die non morte mala morieris.
Sankt Christof hat den Fluß durchschritten. Die ganze Nacht hindurch ist er gegen den Strom gewandert. Gleich einem Felsen ragt sein Körper mit den kräftigen Gliedern aus den Wassern. Auf seiner linken Schulter trägt er die Last des zarten Kindes. Sankt Christof stützt sich auf eine entwurzelte Tanne, die sich biegt. Auch sein Rücken ist gebeugt. Die ihn davongehen sahen, sprachen: Er wird das Ziel nie erreichen! Und lange verfolgten sie ihn mit ihrem Spott und ihrem Gelächter. Dann kam die Nacht, und sie ermüdeten. Jetzt ist Christof zu weit, als daß ihn das Geschrei derer erreichen könnte, die am Ufer zurückgeblieben sind. Im Rauschen des reißenden Stromes vernimmt er nur die ruhige Stimme des Kindes, das eine krause Strähne auf dem Haupte des Riesen in seiner kleinen Faust hält, und das immer wieder sagt: »Vorwärts!« – Er geht mit gebeugtem Rücken, die Augen gerade vor sich hin auf das dunkle Ufer gerichtet, dessen Böschung sich zu erhellen beginnt.
Plötzlich erklingt das Angelus. Und die Schar der Glocken wacht jählings auf. Der neue Tag bricht an! Hinter der schwarzen, ragenden Klippe steigt der goldene Strahlenkranz der unsichtbaren Sonne empor. Christof ist dem Umsinken nahe. Endlich erreicht er das Ufer. Und er spricht zu dem Kinde:
»Nun sind wir am Ziel. Wie schwer du warst! Wer bist du denn, Kind?«
Und das Kind spricht:
»Ich bin der kommende Tag.«
Ende