
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Trotz dem Erfolge, der sich nun auch über Frankreichs Grenzen hinaus bemerkbar machte, verbesserte sich die Lebenslage Christofs und Oliviers nur langsam. Immer wieder gerieten sie in Schwierigkeiten und mußten sich den Gürtel enger schnallen. Hatte man Geld, so hielt man sich dann schadlos, indem man doppelte Portionen aß. Aber auf die Dauer wirkte diese Lebensweise doch entkräftend.
Augenblicklich war bei ihnen Schmalhans Küchenmeister. Christof hatte die halbe Nacht damit zugebracht, eine abgeschmackte Transkriptionsarbeit für Hecht fertigzustellen. Erst beim Morgengrauen hatte er sich niedergelegt und schlief nun wie ein Murmeltier, um das Versäumte nachzuholen. Olivier war ganz früh ausgegangen: er hatte eine Stunde am anderen Ende von Paris zu geben. Gegen acht Uhr klingelte der Hausmeister, der die Post heraufbrachte. Gewöhnlich hielt er sich nicht weiter auf, sondern schob die Briefe unter die Tür. Heute aber klopfte er zu wiederholten Malen. Verschlafen und knurrend ging Christof öffnen. Er hörte kaum zu, als ihm der Hausmeister weitschweifig etwas von einem Zeitungsartikel erzählte, nahm die Briefe, sah sie gar nicht an, schlug die Tür zu, ohne daß sie ins Schloß fiel, legte sich wieder hin und schlief nur um so besser weiter.
Nach einer Stunde fuhr er aufs neue in die Höhe; jetzt hatten ihn Schritte in seinem Zimmer aufgeweckt. Verblüfft sah er am Fußende seines Bettes eine fremde Gestalt, die ihn feierlich grüßte. Ein Journalist hatte die Tür offen gefunden und war ohne Umstände hereingekommen.
Christof sprang wütend aus dem Bett.
»Was haben Sie hier herumzuschnüffeln?« schrie er ihn an. Er hatte sein Kopfkissen gepackt, um es dem Eindringling an den Kopf zu werfen; der schickte sich sofort zum Rückzug an. Dann aber verständigten sie sich. Ein Berichterstatter der »Nation« wünschte Herrn Krafft über den Artikel, der im »Grand Journal« erschienen war, zu interviewen.
»Was für ein Artikel?«
Ob er ihn denn nicht gelesen habe? fragte der Berichterstatter und erbot sich, ihm davon Kenntnis zu geben.
Christof legte sich wieder zu Bett. Wenn er nicht so verschlafen gewesen wäre, hätte er den Mann vor die Türe gesetzt; aber es war ihm bequemer, ihn reden zu lassen. Er wühlte sich in die Kissen, schloß die Augen und tat, als ob er schliefe. Vielleicht hätte er seine Rolle auch gut zu Ende geführt; aber der andere ließ nicht locker und las mit lauter Stimme den Anfang des Aufsatzes. Nach den ersten Zeilen horchte Christof auf. Es wurde darin von Herrn Krafft als von dem größten musikalischen Genie der Zeit gesprochen. Da vergaß Christof seine Rolle, ein Ausruf des Erstaunens entfuhr ihm, er richtete sich auf dem Lager auf und rief:
»Sind die verrückt? Was fällt denen ein?«
Der Berichterstatter benutzte die Unterbrechung, um an Christof eine Reihe von Fragen zu richten, auf die dieser, ohne nachzudenken, antwortete. Christof hatte das Blatt genommen und betrachtete verblüfft sein Bild, das die ganze erste Seite füllte. Aber zum Lesen fand er keine Zeit; denn ein zweiter Journalist war inzwischen ins Zimmer getreten. Nun wurde Christof ernstlich böse. Er schrie die beiden an, sie sollten den Platz räumen; doch sie wollten noch schnell die Zimmereinrichtung, die Photographien an den Wänden und das Aussehen des Originals vermerken. Aber Christof, lachend und wütend zugleich, schob sie an den Schultern vor sich her, beförderte sie vor die Tür und riegelte hinter ihnen zu.
Aber die Vorsehung hatte beschlossen, daß er an diesem Tage nicht mehr zur Ruhe kommen sollte. Er war noch nicht mit dem Anziehen fertig, als es von neuem an der Tür pochte, diesmal in einer verabredeten Weise, die nur einige vertraute Freunde kannten. Christof öffnete und sah sich einem dritten Unbekannten gegenüber, den er kurzerhand hinauswerfen wollte. Der erhob jedoch dagegen Einspruch und stellte sich als Verfasser des Artikels vor. Wie soll man nun jemand hinauswerfen, der einen als Genie behandelt hat? Christof mußte widerwillig die Ergüsse seines Bewunderers über sich ergehen lassen. Er war höchst erstaunt über diese Berühmtheit, die so urplötzlich über ihn kam, und er fragte sich, ob er vielleicht, ohne es zu wissen, am Abend vorher ein Meisterwerk habe aufführen lassen. Aber er hatte keine Zeit, sich darüber klar zu werden; denn der Berichterstatter war gekommen, um ihn, so wie er ging und stand, gutwillig oder mit Gewalt, in die Zeitungsredaktion zu schleppen, wo ihn der Chefredakteur, der große Arsène Gamache, selber sehen wollte. Das Auto wartete unten. Christof versuchte, Widerstand zu leisten; aber in seiner Unerfahrenheit war er, trotz innerem Widerstreben, Freundschaftsbeteuerungen zuletzt doch zugänglich und ließ sich schließlich überreden. Zehn Minuten später stand er dem Gewaltigen, vor dem alles zitterte, gegenüber. Es war ein robuster, fideler Kerl von etwa 50 Jahren, klein und vierschrötig, mit dickem, rundem Kopf, dessen graues Haar bürstenartig geschoren war, mit einem roten Gesicht. Seine gebieterische Redeweise war bei sich überstürzender Zungenfertigkeit von schwerfälliger und getragener Betonung. Er hatte sich den Parisern durch sein ungeheures Selbstvertrauen aufzudrängen vermocht. Durch und durch Geschäftsmann, der die Menschen zu nehmen verstand, egoistisch, naiv und durchtrieben, temperamentvoll und von sich eingenommen, wußte er seine Interessen mit denen Frankreichs, sogar mit denen der ganzen Menschheit zu verschmelzen. Sein Vorteil erschien ihm gleichbedeutend und eng verbunden mit der Ertragsfähigkeit seiner Zeitung und der salus publica. Er war tief davon überzeugt, daß ein Vorwurf gegen ihn auch gegen Frankreich gerichtet sei. Mit leichtem Gewissen hätte er den Staat aus den Fugen gehoben, wenn es darauf angekommen wäre, einen persönlichen Gegner zu vernichten. Doch konnte er auch großzügig sein. Idealist, wie man es etwa nach einem guten Essen ist, machte es ihm Freude, wie Gottvater von Zeit zu Zeit irgend einen armen Teufel aus dem Staube zu heben, um damit die Größe seiner Macht zu beweisen, die aus nichts etwas schuf, die Minister machte, und die, wenn er es gewollt hätte, Könige auf den Thron erhoben oder gestürzt hätte. Er glaubte sich zu allem berufen. Er machte selbst Genies, wenn es ihm paßte.
An jenem Tage war er gerade dabei, Christof zu »machen«.
Olivier hatte ahnungslos das Rad ins Rollen gebracht. Er, der für sich selbst nicht einen Schritt unternahm, dem Reklame entsetzlich war und der die Journalisten wie die Pest floh, fühlte sich zu einem ganz anderen Verhalten verpflichtet, wenn es sich um einen Freund handelte. Darin glich er jenen verliebten Müttern, die, obgleich anständige kleine Bürgersfrauen und einwandfreie Gattinnen, sich selbst verkaufen, um irgend eine Vergünstigung für ihren Taugenichts von Sohn zu erlangen.
Da er für Zeitschriften schrieb und in beständiger Verbindung mit vielen Kritikern und Kunstfreunden war, ließ er keine Gelegenheit vorübergehen, von Christof zu sprechen; und seit einiger Zeit merkte er zu seinem Erstaunen, daß man ihm zuhörte. Es fiel ihm auf, daß er eine gewisse Neugierde erregte, daß durch die literarischen und gesellschaftlichen Kreise eine geheimnisvoll raunende Bewegung ging. Wo war ihr Ursprung zu suchen? Waren es etwa ein paar Zeitungsnotizen gewesen, die kürzlich nach einigen Aufführungen von Christofs Werken in England und Deutschland erschienen waren? Ein bestimmter Grund hierfür war nicht vorhanden. Es handelte sich um eine jener Erscheinungen, die den Spürnasen von Paris wohlbekannt war, die, besser als das Meteorologische Observatorium von St. Jacques, stets einen Tag vorher wissen, welcher Wind wehen und was er morgen mit sich führen wird. In dieser großen, nervösen Stadt, durch die elektrische Schauer laufen, eilen unsichtbare Wellenbewegungen eines Ruhmes, einer noch schlummernden Berühmtheit, dieser Berühmtheit selbst voraus; sie pflanzen sich durch das unbestimmte Gesumme der Salons fort und sind jenes nescio quid majus nascitur Iliade, das sich in einem bestimmten Augenblick in einem Reklameartikel Luft macht, in dem mächtigen Trompetenstoß, der auch den verhärtetsten Ohren den Namen des neuen Götzen einpaukt. Es kommt übrigens manchmal vor, daß diese Fanfare die ersten und besten Freunde des Mannes, den sie feiert, in die Flucht jagt. Und doch sind diese Freunde für sie verantwortlich.
So war auch Olivier an dem Aufsatz im »Grand Journal« beteiligt. Er hatte das Interesse, das sich für Christof bemerkbar machte, ausgenützt und sich bemüht, es durch geschickte Angaben warm zu erhalten. Indessen hatte er sich wohl gehütet, Christof in unmittelbare Beziehung zu den Journalisten zu bringen; er fürchtete irgend einen dummen Streich. Aber auf die Bitte des »Grand Journal« hin vermittelte er hinter seinem Rücken und ohne daß Christof etwas davon ahnte, eine Zusammenkunft zwischen ihm und einem Berichterstatter in einem Kaffeehaus. Alle diese Vorsichtsmaßregeln stachelten die Neugierde nur noch mehr auf und ließen Christof umso interessanter erscheinen.
Olivier hatte bis dahin noch nichts mit Reklame zu tun gehabt; er berechnete nicht, daß er eine gewaltige Maschine in Bewegung setzte, die, einmal losgelassen, nicht mehr zu lenken noch zurückzuhalten war.
Als er auf dem Wege zu seiner Stunde den Aufsatz im »Grand Journal« las, war er fassungslos. Diesen Keulenschlag hatte er nicht erwartet. Vor allem hatte er nicht geglaubt, daß er so schnell erfolgen würde. Er hatte damit gerechnet, daß die Zeitung erst alle Auskünfte einholen würde, bevor sie etwas schriebe, daß sie abwarten würde, bis sie mit dem Stoff etwas vertrauter wäre. So war es geradezu einfältig. Wenn eine Zeitung sich die Mühe nimmt, einen Stern zu entdecken, so tut sie das selbstverständlich nur zum eigenen Vorteil und weil sie der Konkurrenz die Ehre der Entdeckung nicht gönnt. Da heißt es denn, sich beeilen, selbst auf die Gefahr hin, daß man von den Werken, die man lobt, nichts versteht. Aber es kommt selten vor, daß sich der Autor darüber beschwert: wenn man ihn bewundert, fühlt er sich immer genugsam verstanden.
Das »Grand Journal« fing damit an, ungeheuerliche Geschichten von Christofs Elend zu erzählen; er wurde als ein Opfer der deutschen Gewaltherrschaft hingestellt, als ein Apostel der Freiheit, als einer, der gezwungenermaßen aus dem kaiserlichen Deutschland hatte fliehen müssen, um in Frankreich, der Heimstätte aller freien Seelen, seine Zuflucht zu finden – (ein schöner Vorwand für chauvinistische Phrasen!). – Darauf folgte eine geradezu betäubende Lobeshymne auf sein Talent, von dem man nichts kannte als einige nichtssagende Melodien, die aus der Zeit von Christofs ersten Anfängen in Deutschland stammten und die er selbst am liebsten vernichtet hätte, weil er sich ihrer schämte. Doch, wenn auch der Verfasser des Artikels von Christofs Werken keines kannte, so war er doch über seine Pläne um so besser unterrichtet, – wenigstens über die, die er ihm unterschob. Zwei oder drei Worte, die er von Christof oder Olivier aufgefangen hatte, oder nur von irgend einem Goujart, der sich für wohlunterrichtet ausgab, hatten ihm genügt, um von Johann Christof das Bild eines republikanischen Genies und großen Musikers der Demokratie zu entwerfen. Dies war zugleich ein Anlaß, um gegen die zeitgenössischen französischen Musiker zu Felde zu ziehen, vor allem gegen die eigenartigsten und freiesten, die sich um alles andere eher als um die Demokratie kümmerten. Nur ein oder zwei Komponisten ließ er als Ausnahme gelten, weil deren politische Überzeugungen ihm vortrefflich erschienen. Nur schade, daß ihre Musik weniger vortrefflich war; doch das war ja Nebensache, übrigens hatte solches Lob, und selbst das Christof gespendete, weniger Bedeutung als die Kritik der Andern. Wenn man in Paris einen Aufsatz liest, der von jemand etwas Günstiges sagt, fragt man sich am besten: »Von wem redet man Schlechtes?«
Olivier errötete vor Scham, je weiter er in der Zeitung las, und sagte sich: »Da habe ich ja etwas Schönes angerichtet.«
Es wurde ihm schwer, seine Stunde zu geben, und sobald er frei war, lief er nach Haus. Wie groß aber war seine Bestürzung, als er erfuhr, daß Christof bereits mit Journalisten ausgegangen sei! Er erwartete ihn zum Frühstück. Christof kam nicht zurück. Von Stunde zu Stunde wurde Olivier besorgter. Er dachte: »Was wird er alles für Dummheiten reden?« – Gegen drei Uhr endlich kam Christof ganz aufgekratzt heim. Er hatte mit Arsène Gamache gefrühstückt und war von dem Champagner, den er getrunken, ein wenig benebelt. Er begriff nicht, worüber sich Olivier, der ihn ängstlich fragte, was er gesagt und getan habe, Gedanken mache.
»Was ich getan habe? Ich habe famos gefrühstückt. Seit langem habe ich nicht so gut gegessen.«
Er fing an, ihm die Speisenfolge herzusagen:
»Und Wein ..., alle möglichen Sorten habe ich mir zu Gemüt geführt.«
Olivier wollte wissen, wer noch an dem Gelage teilgenommen hatte.
»Wer noch da war!? Ich weiß nicht. Gamache war da, ein famoser Kerl, echt wie Gold; Clodomir, der Verfasser des Aufsatzes, ein prächtiger Mensch; dann drei oder vier sehr lustige Journalisten, die ich nicht kenne, die aber alle riesig nett und liebenswürdig zu mir waren, eine wahre Auslese!«
Olivier machte kein sehr überzeugtes Gesicht.
Christof wunderte sich, wie wenig begeistert er war.
»Hast du den Artikel nicht gelesen?«
»Gewiß. Und du? Hast du ihn denn ordentlich gelesen?«
»Ja gewiß, das heißt – ich habe einen Blick hineingetan; viel Zeit hatte ich nicht dazu.«
»Nun, dann lies ihn noch einmal genauer.«
Christof las. Bei den ersten Zeilen lachte er laut auf.
»Nein, dieser Esel!« rief er.
Er bog sich vor Lachen.
»Ach,« fuhr er fort, »die Kritiker taugen alle nichts. Sie haben keine Ahnung.«
Als er aber weiter las, fing er an, sich zu ärgern. Das war wirklich zu dumm, das mußte ihn ja lächerlich machen! Einen »republikanischen Musiker« aus ihm machen zu wollen, war wirklich ganz sinnlos. Nun, schließlich mochte dieses Wortgedresche noch hingehen ... aber daß man seine »republikanische Kunst« der »Kirchenkunst« früherer Meister gegenüberstellte (grade seine Kunst, die sich von der Seele jener großen Männer nährte), – das war wirklich zu stark ...
»Verdammte Idioten! Sie werden mich noch ganz und gar zum Narren stempeln! ...«
Und wie kam man dazu, zu Gunsten seiner Person talentvolle französische Musiker herunterzureißen, die er mehr oder weniger schätzte (eher weniger als mehr), die aber etwas von ihrem Handwerk verstanden und diesem Ehre machten? Was jedoch das Schlimmste war, – man unterschob ihm mit ganz unglaublicher Unverfrorenheit eine abscheuliche Gesinnung gegenüber seinem Vaterlande! – Nein, das – das konnte man sich wirklich nicht gefallen lassen ...!
»Ich werde ihnen sofort schreiben,« sagte Christof.
Olivier wehrte ab:
»Nein,« sagte er, »nicht jetzt, du bist zu aufgeregt; morgen, wenn dein Kopf frei ist.«
Christof beharrte aber bei seinem Willen. Wenn er etwas zu sagen hatte, konnte er nicht bis zum nächsten Morgen warten. Er versprach nur Olivier, ihm den Brief zu zeigen. Das war auch sehr nötig. Nachdem der Brief gehörig verbessert worden war – er hatte sich darin hauptsächlich bemüht, die Ansichten, die man ihm über Deutschland zutraute, richtigzustellen –, lief Christof schleunigst hinunter, um ihn in den Kasten zu stecken. Als er wieder heraufkam, sagte er: »So ist die Sache wenigstens nur halb so schlimm, der Brief wird morgen erscheinen.«
Olivier schüttelte ein wenig zweifelnd den Kopf.
Dann fragte er, noch immer besorgt:
»Christof, hast du auch bei Tische nichts Unvorsichtiges gesagt?« Dabei sah er ihm prüfend in die Augen.
»Gott, nein,« meinte Christof lachend.
»Sicher nicht?«
»Nein, du Hasenfuß.«
Olivier war etwas beruhigt, Christof jedoch war es nun nicht mehr. Es fiel ihm ein, daß er alles Mögliche durcheinander geredet hatte. Er hatte sich gleich behaglich gefühlt. Nicht einen Augenblick war es ihm in den Sinn gekommen, den Leuten zu mißtrauen: sie schienen so herzlich, so wohlgesinnt! Und das waren sie ja auch. Man ist immer denen wohlgesinnt, denen man Gutes getan hat. Und Christof bezeigte eine so offene Freude, daß sie sich den anderen mitteilte. Seine gewinnende Zwanglosigkeit, seine gemütlichen Späße, seine ungeheure Eßlust und die Schnelligkeit, mit der die Getränke in seiner Kehle verschwanden, ohne ihn weiter zu erregen, waren ganz dazu angetan, Arsène Gamache zu gefallen; denn auch er war eß- und trinkfest, derb-bäuerisch und vollblütig, und voller Verachtung für alle kränklichen Menschen, die sich weder zu essen noch zu trinken getrauten, für jene magenschwachen Pariser. Er schloß sein Urteil über einen Menschen bei Tische ab. Christof schätzte er. Sofort schlug er ihm vor, seinen »Gargantua« in der Oper, ja, sogar in der »Großen Oper«, aufführen zu lassen. (»Fausts Verdammnis« oder auch die »Neun Symphonien« galten damals jenen französischen Spießbürgern als der Gipfel der Kunst!) – Christof, den die tolle Idee zu hellem Gelächter brachte, konnte ihn nur mit Mühe und Not davon abhalten, seine Befehle sogleich an die Direktion der Oper oder an das Ministerium der schönen Künste zu telephonieren. – (Wollte man Gamache glauben, so waren alle diese Leute zu jedem Dienst für ihn bereit.) – Und da ihm der Vorschlag die sonderbare Komödie ins Gedächtnis zurückrief, die man früher einmal mit seiner symphonischen Dichtung »David« gespielt hatte, ließ er sich hinreißen, die Geschichte jener Aufführung zu erzählen, die der Abgeordnete Roussin in die Hand genommen hatte, um seine Geliebte gut in die Öffentlichkeit einzuführen. Gamache, der Roussin nicht leiden konnte, war begeistert; und Christof, der durch den reichlichen Weingenuß und das Wohlwollen der Zuhörerschaft angeregt war, kam von einer Geschichte in die andere, die alle mehr oder weniger indiskret waren und von denen die Zuhörer sich nichts entgehen ließen. Nur Christof hatte sie schon wieder vergessen, als er vom Tisch aufstand, und erst jetzt, bei Oliviers Frage, kehrten sie ihm ins Gedächtnis zurück. Er fühlte, wie ihm ein kleiner Schauer das Rückgrat entlang lief. Denn er gab sich keinerlei Täuschung hin; er hatte genügend Erfahrungen gesammelt, um zu ahnen, was nun geschehen würde. Jetzt, nachdem seine Stimmung verflogen war, sah er es so klar vor sich, als wäre es schon geschehen: wie seine kleinen Schwätzereien entstellt und als üble Nachrede in Zeitungsnotizen veröffentlicht, seine Künstlereinfälle zu Kriegswaffen umgewandelt wurden. Was seinen Berichtigungsbrief anging, so wußte er so gut wie Olivier, wessen er sich zu gewärtigen hatte: Journalisten etwas erwidern, heißt unnütz Tinte verschwenden; ein Journalist hat immer das letzte Wort.
Alles geschah Wort für Wort, wie Christof es vorhergesehen hatte. Die Klatschereien erschienen, und der Berichtigungsbrief erschien nicht. Gamache begnügte sich damit, ihm sagen zu lassen, daß ihn seine edle Gesinnung und seine Bedenken ehrten; aber er bewahrte das Geheimnis dieser Bedenken eifersüchtig für sich. Die fälschlich Christof untergeschobenen Gesinnungen verbreiteten sich, riefen bissige Kritiken in Pariser Zeitungen hervor und wirkten dann ebenso in Deutschland, wo man empört darüber war, daß ein deutscher Künstler sich so wenig zurückhaltend über sein Vaterland äußere. – Christof glaubte, sehr klug zu handeln, als er gelegentlich bei dem Interview einer anderen Zeitung lebhaft seine Liebe für das Deutsche Reich beteuerte, in dem man, so sagte er, mindestens ebenso frei sei wie in der französischen Republik. – Er sprach dies dem Vertreter einer konservativen Zeitung gegenüber aus, der ihm sofort anti-republikanische Äußerungen unterschob.
»Es wird immer besser,« sagte Christof; »was hat meine Musik mit Politik zu tun?«
»Das ist bei uns so Sitte,« meinte Olivier; »sieh dir doch die Schlachten an, die man auf Beethovens Rücken ausficht. Die einen machen aus ihm einen Jakobiner, die anderen einen Pfaffen; diese einen Revolutionär, jene einen Fürstendiener.«
»Ach, und wie würde er ihnen allen einen Tritt in den Hintern versetzen!«
»Nun, dann mach' es doch ebenso!«
Dazu hatte Christof große Lust. Doch er stellte sich zu freundschaftlich mit denen, die ihm liebenswürdig entgegenkamen. Daher war Olivier immer voller Sorge, wenn er ihn allein ließ. Und Christof konnte noch so sehr versprechen, sich in acht zu nehmen, immer wieder war er zu mitteilsam und vertrauensselig. Er sagte alles, was ihm durch den Kopf ging. Da kamen Journalistinnen, die sich als seine Freundinnen ausgaben und ihn dazu brachten, von seinen Herzenserlebnissen zu erzählen. Andere bedienten sich seines Namens, um über den oder jenen Schlechtes zu reden. Wenn dann Olivier heimkehrte, fand er Christof ganz begossen vor.
»Wieder eine Dummheit?« fragte er.
»Es hört nicht auf!« sagte Christof niedergeschmettert.
»Man müßte mich hinter Schloß und Riegel setzen, aber diesmal wird es das letzte Mal sein, das schwöre ich dir.«
»Ja, ja, bis zum nächsten Mal!« ...
»Nein, mit diesem Male ist Schluß ...«
Am nächsten Morgen sagte Christof triumphierend zu Olivier: »Es ist noch einer gekommen, ich habe ihn vor die Türe gesetzt.«
»Man muß nicht übertreiben,« meinte Olivier, »nimm dich in acht; du weißt: »bissige Hunde!« Sie fallen dich an, wenn du dich verteidigst ... es ist ihnen so leicht, sich zu rächen, sie ziehen ihren Vorteil aus dem kleinsten Wort, das man sagt.«
Christof strich sich mit der Hand über die Stirn.
»Ach, guter Gott!«
»Was gibt es denn noch?«
»Mir fällt ein, daß ich ihm noch in der Türe gesagt habe ...«
»Was denn?«
»Das Wort des Kaisers.«
»Des Kaisers?«
»Ja, und wenn es nicht von ihm ist, ... so doch von einem aus seiner Umgebung.«
»Unglücklicher, du wirst es auf der ersten Seite der Zeitung zu lesen bekommen!«
Christof zitterte. Aber was er am nächsten Morgen fand, war eine Beschreibung seiner Wohnung, in der der Berichterstatter nicht gewesen war, und die Wiedergabe einer Unterhaltung, die nicht stattgefunden hatte. Je mehr Gerüchte sich über ihn verbreiteten, um so schlimmer wurden sie. In den ausländischen Zeitungen schmückte man sie mit immer größeren Widersinnigkeiten aus. Französische Zeitungen hatten z. B. ausgestreut, daß Christof in seinem Elend Musikstücke für Gitarre hatte bearbeiten müssen. Aus einer englischen Zeitung erfuhr er nun gar, daß er auf den Höfen Gitarre gespielt habe.
Er las also durchaus nicht nur Lobeserhebungen. Es genügte, daß er vom »Grand Journal« begünstigt wurde, damit die anderen Zeitungen über ihn herfielen; es war unter ihrer Würde zuzugeben, daß ein Kollege ein Genie entdeckt haben sollte, das sie übersehen hatten. Die einen machten sich darüber lustig, die anderen beklagten Christofs Schicksal. Goujart, der tief gekränkt war, daß man ihm einen solchen Bissen weggeschnappt hatte, schrieb einen Aufsatz, um, wie er sagte, die Dinge richtigzustellen. Er sprach sehr vertraut von seinem alten Freunde Christof, dessen erste Schritte in Paris er geleitet habe: ganz gewiß sei er ein talentierter Musiker, aber (er könne das ja gut sagen, da sie Freunde seien), sein Talent sei doch voller Lücken und ungenügend ausgebildet; es hieße, ihm den denkbar schlechtesten Dienst erweisen, wenn man seinem Hochmut in dieser lächerlichen Weise schmeicheln wolle, während er doch dringend eines umsichtigen Mentors bedürfe, der gebildet, urteilsfähig, wohlwollend und streng zugleich wäre. (Also ganz das Porträt von Goujart selbst.) Die Musiker mußten wider Willen lachen. Sie trugen eine bissige Verachtung für einen Künstler zur Schau, der den Beistand der Zeitungen genoß. Scheinbar flößte ihnen das vulgum pecus tiefen Ekel ein, und sie wiesen die Geschenke eines Artaxerxes zurück, die dieser ihnen nicht anbot. Die einen beschimpften Christof, die anderen erdrückten ihn förmlich durch die Wucht ihres Mitgefühls. Manche fielen über Olivier her, – (das waren seine Kollegen). – Es war ihnen sehr lieb, daß sie sich an seiner Unbestechlichkeit rächen konnten, und an der Art, mit der er sie unbeachtet ließ, was er – und das muß gesagt sein – mehr aus Einsamkeitsbedürfnis als aus Nichtachtung gegen irgend einen Menschen tat, wer immer es auch sein mochte. Aber was die Leute am wenigsten verzeihen, ist gerade, daß man ohne sie fertig wird. – Einige gingen beinahe soweit anzudeuten, daß er wohl ein sehr persönliches Interesse an den Aufsätzen im »Grand Journal« hätte. Andere hielten es für nötig, Christof gegen ihn in Schutz zu nehmen. Mit leidender Miene wiesen sie auf die Gewissenlosigkeit Oliviers hin, der einen zarten, träumerischen, dem Leben gegenüber ungenügend gewappneten Künstler – (und das war Christof!) – in das Getriebe des Jahrmarktes hinausstieß, in dem er notwendigerweise untergehen mußte. So machten sie aus Christof einen kleinen Jungen, der nicht vernünftig genug war, allein spazieren zu gehen. Man untergrübe, sagten sie, die Zukunft dieses Menschen, dessen guter Wille und angestrengt fleißiges Arbeiten bei allem Mangel an starker Begabung doch ein besseres Schicksal verdienten. Mit solch üblem Weihrauch aber beneble man ihn völlig. Es sei ein Jammer. Konnte man ihn denn nicht ganz unbeachtet noch jahrelang geduldig arbeiten lassen?
Olivier hätte ihnen zwar leicht antworten können:
»Wenn man arbeitet, muß man auch essen. Wer soll ihm denn Brot geben?«
Aber das hätte sie nicht weiter gestört. Sie hätten mit großartiger Überlegenheit geantwortet:
»Das macht nichts. Leiden muß sein. Was liegt schon daran?«
Natürlich konnten nur Gesellschaftsmenschen, die höchst behaglich lebten, solche stoischen Behauptungen ausstellen. So antwortete jener Millionär einem harmlosen Menschen, der ihn um Hilfe für einen im Elend lebenden Künstler anging:
»Aber, bester Herr, Mozart ist im Elend zugrunde gegangen!«
Man würde es sehr geschmacklos gefunden haben, wenn Olivier gesagt hätte, daß Mozart nichts sehnlicher gewünscht habe, als zu leben, und daß Christof dazu fest entschlossen sei.
Diese Klatschereien begannen Christof lästig zu werden. Er fragte sich, ob das immer so weitergehen würde. – Aber nach vierzehn Tagen hörte es auf. Die Zeitungen sprachen nicht mehr von ihm. Doch, nun war er auch bekannt. Wenn sein Name genannt wurde, sagte man nicht etwa:
»Das ist der Komponist des ›David‹ oder des ›Gargantua‹«, sondern:
»Ach ja, das ist der Mann, von dem das ›Grand Journal‹ ...«
Das war also die Berühmtheit!
Olivier merkte es an den vielen Briefen, die Christof empfing, und an denen, die indirekt auch an ihn selbst gelangten; da kamen Anerbieten von Librettoschreibern, Vorschläge von Konzertagenten, Zusicherungen ganz neuer Freunde, die oft noch vor kurzem Christofs Feinde gewesen waren, und Einladungen von Frauen. Auch für Zeitungsrundfragen wollte man seine Meinung über unendlich viele Dinge wissen; über die Entvölkerung Frankreichs, über die idealistische Kunst, über das Frauenkorsett, über Nacktdarstellungen auf der Bühne. Man fragte ihn, ob er nicht fände, daß Deutschland im Niedergang begriffen sei, daß es mit der musikalischen Kunst zu Ende ginge usw. usw. Die Freunde machten sich über all dies lustig. Aber trotzdem geschah es, daß Christof, dieser Wilde, die Diner-Einladungen doch schließlich annahm! Olivier traute seinen Augen nicht.
»Du?« sagte er.
»Ich, jawohl,« antwortete Christof spöttelnd.
»Du glaubtest wohl, daß nur du ausgehen könntest, um dir schöne Damen anzusehen? Da irrst du dich, mein Kleiner! Jetzt ist die Reihe an mir! Ich will auch meinen Spaß haben!«
»Deinen Spaß haben? Armer Junge!«
Tatsache war, daß Christof seit langer Zeit derartig abgeschlossen gelebt hatte, daß ihn jetzt ein leidenschaftliches Bedürfnis packte, etwas herauszukommen. Dann aber machte es ihm auch eine kindliche Freude, den neuen Ruhm zu kosten. Im übrigen langweilte er sich auf diesen Gesellschaften ungeheuer und fand die Leute idiotisch. Aber, wenn er heimgekehrt war, erzählte er Olivier in boshafter Weise das Gegenteil. Er nahm eine Einladung an, besuchte die Leute dann aber nie wieder und brauchte lächerlich durchsichtige Ausreden, um wiederholten Aufforderungen auszuweichen. Olivier schlug die Hände überm Kopf zusammen. Christof aber lachte nur über ihn. Er besuchte die Salons nicht, um seine Berühmtheit zu fördern, sondern um wieder mehr Fühlung mit dem Leben zu bekommen, um Blicke, Stimmen, Bewegungen in sich aufzunehmen, jenen ganzen Reichtum an Formen, Tönen und Farben, mit denen der Künstler notwendigerweise von Zeit zu Zeit seine Palette füllen muß. Ein Musiker nährt sich nicht nur von Musik. Die Betonung eines Wortes, der Rhythmus einer Geste, die Harmonie in einem Lächeln geben ihm mehr musikalische Anregungen als manche Symphonie eines Kollegen. Allerdings muß man sagen, daß in den Salons jene Musik der Gesichter und der Seelen ebenso eintönig und fade ist wie die Musik der Musiker. Jeder hat seine Pose und verharrt unentwegt in ihr. Das Lächeln einer hübschen Frau bleibt sich in seiner einstudierten Anmut ebenso ewig gleich wie eine Pariser Melodie. Die Männer sind noch nichtssagender als die Frauen. Unter dem entkräftenden Einfluß der Gesellschaft erschlaffen alle Energien, und die Eigenart der Charaktere verwischt sich erschreckend rasch. Christof war erstaunt, wie viele er unter den Künstlern traf, deren Künstlertum bereits erstorben war oder im Sterben lag. Da war z. B. ein junger Musiker voller Kraft und Talent, den der Erfolg derart entnervt und abgestumpft hatte, daß er nichts anderes mehr tat, als sich von dem Weihrauch, den man ihm streute, benebeln zu lassen, zu genießen und – zu schlafen. Was aus ihm nach zwanzig Jahren geworden sein würde, dafür sah man ein Beispiel am anderen Ende des Salons in der Gestalt jenes alten, pomadisierten, reichen, berühmten Meisters, Mitgliedes sämtlicher Akademien, der auf dem Gipfel seiner Laufbahn angekommen war, und der, wie man hätte meinen sollen, nichts mehr zu fürchten und auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen hatte, der aber vor allem und vor Allen auf dem Bauch lag, aus Angst vor der öffentlichen Meinung, vor einflußreichen Personen, vor der Presse, der nicht mehr zu sagen wagte, was er dachte – und übrigens auch gar nichts mehr dachte, der kein wirkliches Leben mehr führte: ein eitler Esel, behangen mit den Lappen seiner eigenen Größe. Man konnte sicher sein, daß hinter jedem dieser Künstler und Geisteshelden, die einmal groß gewesen waren oder es doch hätten sein können, eine Frau stand, die sie zugrunde richtete. Sie waren alle gefährlich, die dummen wie die klugen, die verliebten wie die selbstsüchtigen; die besten waren die schlimmsten: denn sie erstickten um so gewisser den Künstler unter dem Druck ihrer unvernünftigen Zärtlichkeit, taten in bester Absicht alles, das Talent einzuzwängen, es sich dienstbar zu machen, es zu verflachen und ganz und gar so umzugestalten, bis es in ihre Gefühlswelt paßte, in ihre kleine Welt der Eitelkeit und des Mittelmaßes.
Obgleich Christof diese Welt nur flüchtig streifte, sah er genug davon, um die Gefahr zu ahnen. Natürlich suchte mehr als eine Frau, ihn für ihren Salon und ihren Dienst zu kapern; und Christof war wohl auch manches Mal schon nahe daran, auf liebenswürdige Worte und ein verheißendes Lächeln hereinzufallen. Ohne seinen derben, gesunden Menschenverstand und das warnende Beispiel von allen jenen Verwandlungen, die diese modernen Circen in ihrer Umgebung schon zu Wege gebracht hatten, wäre er wohl nicht ungestraft entschlüpft. Aber es lag ihm nicht das mindeste daran, in eine der Herden dieser schönen Schweinehüterinnen eingereiht zu werden. Die Gefahr wäre für ihn größer geworden, wenn sie nicht alle hinter ihm her gewesen wären. Doch jetzt, da alle, Männer wie Frauen, ganz davon durchdrungen waren, daß sich ein Genie in ihrer Mitte befand, gaben sie sich in gewohnter Weise die größte Mühe, es zu ersticken. Diese Menschen haben immer nur den einen Gedanken, wenn sie eine Blume sehen, sie in einen Topf zu pflanzen, einen Vogel in den Käfig zu sperren, einen freien Mann zu einem Lakaien zu machen.
Christof hatte nur für kurze Zeit das Gleichgewicht verloren. Nun ergriff er die Zügel um so fester und schickte alle zum Teufel.
Das Schicksal ist voller Ironie. Die Unvorsichtigen läßt es durch seine Netzmaschen hindurchgleiten; aber die, die sich in acht nehmen, die Vorsichtigen, die Wachsamen, läßt es ganz sicher nicht entschlüpfen. So wurde denn auch Christof nicht in dem Netz der Stadt Paris gefangen, sondern Olivier.
Der Erfolg seines Freundes war ihm zugute gekommen. Christofs Ruhm hatte seine Strahlen auf ihn zurückgeworfen. Da zwei oder drei Zeitungen ihn als den Entdecker Christofs genannt hatten, kannte man ihn jetzt besser als durch alles, was er in den letzten zehn Jahren geschrieben. So hatte er teil an den Einladungen, die Christof zugingen, und er begleitete ihn in der Absicht, heimlich über ihm zu wachen. Wahrscheinlich nahm ihn diese Aufgabe so in Anspruch, daß er an sich selbst nicht denken konnte. Da ging die Liebe vorüber und nahm ihn gefangen.
Sie war ein reizendes blondes, mageres kleines Mädchen mit feinen lockigen Haaren, die ihr wie kleine Wellen um die schmale durchsichtige Stirn flossen. Sie hatte feine Brauen über den etwas schweren Lidern, Augen wie die Blüten des Immergrün, eine schmale Nase mit beweglichen Nüstern, leicht eingefallene Schläfen, ein eigensinniges Kinn, einen beweglichen, geistvollen, sinnlichen Mund, um dessen etwas hochgezogene Winkel das Lächeln eines kleinen unschuldigen Faunes spielte, wie es auf Bildern des Parmegiano zu finden ist. Sie hatte einen langen, schlanken Hals, eine hübsche Figur; ihr Körper war von eleganter Magerkeit. In ihrem jungen Gesicht war irgend ein halb glücklicher, halb schmerzlicher Zug, das beunruhigende und holde Rätsel vom »Frühlingserwachen«. Sie hieß Jacqueline Langeais, und war noch nicht zwanzig Jahre alt.
Jacqueline stammte aus einer katholischen, reichen, vornehmen und freigebigen Familie. Ihr Vater war ein intelligenter, erfinderischer und lebensgewandter Ingenieur, der allem Neuen zugänglich war und sein Vermögen der Arbeit, seinen politischen Beziehungen und seiner Heirat verdankte, einer Liebes- und Geldheirat (was für diese Art Leute erst die wahre Liebesheirat ist) mit einer sehr hübschen echten Pariserin aus der Finanzwelt. Das Geld war geblieben, die Liebe war verflogen. Immerhin waren noch ein paar Funken übrig: denn die Neigung war auf beiden Seiten sehr lebhaft gewesen. Sie legten keinen Wert auf übertriebene Treue; jedes von ihnen ging seiner Arbeit und seinem Vergnügen nach; so stand man kameradschaftlich und gut miteinander und lebte skrupellos aber besonnen den persönlichen Interessen. Ihr kleines Mädchen war der Gegenstand einer leisen Eifersucht und bildete so zugleich ein Band zwischen ihnen. Sie liebten es beide auf gleiche Weise. Jeder erkannte in dem Kind die eigenen Lieblingsfehler wieder, die aber durch die kindliche Anmut verklärt waren, und heimlich suchte jeder es dem anderen abspenstig zu machen. Die Kleine merkte das natürlich bald mit der ganzen harmlosen Durchtriebenheit jener kleinen Wesen, die nur allzugern glauben, die ganze Welt drehe sich bloß um sie, und wußte es sich zunutze zu machen. Sie brachte es zuwege, daß sich die Eltern für sie beständig in Zärtlichkeiten überboten. Sie war sicher, daß jede ihrer Launen von dem einen Teil unterstützt würde, wenn der andere ihr nicht nachgab; und der andere war so gekränkt, wenn er zurückgesetzt wurde, daß er gleich darauf noch mehr bot, als der erste gewährt hatte. Auf diese Weise war das Kind unglaublich verwöhnt worden; und es war sein Glück, daß in seiner Natur nichts Schlechtes lag, – außer Selbstsucht, die fast allen Kindern eigen ist, die jedoch bei allzu verhätschelten und allzu reichen Kindern aus völligem Mangel an Widerstand und Zielbewußtsein krankhafte Formen annimmt. Bei aller Anbetung für das Kind hätten sich Herr und Frau Langeais wohl gehütet, ihm irgend etwas von ihrer persönlichen Bequemlichkeit zu opfern. Sie ließen es fast während des ganzen Tages allein mit seinen tausend und ein Einfällen und Wünschen, die man ihm alle erfüllte. An Zeit zum Träumen fehlte es Jacqueline nicht. Und das war ihr auch am liebsten. Durch unvorsichtige Reden, die man in ihrer Gegenwart führte, frühreif und aufgeweckt geworden, – denn man tat sich keinerlei Zwang an, – erzählte sie schon mit sechs Jahren ihren Puppen kleine Liebesgeschichten, in denen der Mann, die Frau und der Liebhaber eine Rolle spielten. Selbstverständlich dachte sie sich nichts Böses dabei.
Von dem Tage an, als sich für sie hinter den Worten ein Schimmer von Gefühl offenbarte, bekamen die Puppen nichts mehr zu hören, und sie behielt ihre Geschichten für sich. Ein Unterton von unschuldiger Sinnlichkeit ging durch ihr Wesen, der gleich unsichtbaren Glocken aus weiter Ferne zu ihr herüberklang. Sie wußte selbst nicht, was es bedeutete. Manchmal trug es der Wind in Wellen zu ihr herüber, ohne daß sie wußte, woher sie kamen. Sie fühlte sich von ihnen umspielt und errötete, der Atem stockte ihr vor Angst und Lust. Das alles war ihr ganz unverständlich. Und ging auch wieder vorüber, wie es gekommen war. Nichts war mehr vernehmbar, nichts als ein leises Summen, ein unmerkbares Schwingen, das in der blauen Luft verschwamm. Nur eines war sicher, daß es von fern hinter den Bergen herkam, und daß man so schnell wie möglich dahin gelangen mußte: dort war das Glück. Ach, wenn man nur hinkäme!
Solange man noch nicht dort war, machte man sich die sonderbarsten Gedanken über das, was man finden würde; und es schien diesem kleinen Mädchen die schwerste Aufgabe, hinter dies Geheimnis zu kommen. Mit einer Altersgenossin, Simone Adam, unterhielt sie sich oft über diese ernsten Fragen. Eine half der anderen mit ihrer Wissenschaft und der ganzen Erfahrung ihrer zwölf Jahre mit aufgefangenen Unterhaltungen und heimlich Angelesenem. So mühten sich die beiden kleinen Mädchen, stellten sich gewissermaßen auf die Zehenspitzen und hielten sich an den Steinen fest, um über eine alte Mauer zu schauen, hinter der sich ihnen die Zukunft barg. Aber so sehr sie sich auch anstrengten und glauben mochten, etwas durch die Ritzen zu sehen: sie sahen garnichts. Es war ein sonderbares Gemisch in ihnen aus Reinheit, poetisch verklärter Freude an frivolen Dingen und Pariser Spottlust. Sie sprachen Ungeheuerlichkeiten aus, ohne es zu ahnen, und bauten sich aus den einfachsten Dingen ganze Welten auf. Jacqueline, die überall herumschnüffelte, ohne daß es ihr jemand verbot, steckte ihr Näschen in alle Bücher ihres Vaters. Glücklicherweise war sie vor schlimmen Erfahrungen durch ihre Unschuld und ihren sehr reinen Mädcheninstinkt geschützt: ein etwas roher Auftritt oder ein grobes Wort genügten, um sie abzuschrecken. Sofort ließ sie das Buch liegen und entschlüpfte der schlimmen Gesellschaft, gleich einer aufgeschreckten Katze, die geschickt über Pfützen hinwegsetzt, ohne sich zu beschmutzen.
Romane lockten sie im allgemeinen nicht: sie waren ihr zu deutlich und zu trocken. Doch etwas ließ ihr Herz in Mitgefühl und Hoffnung höher schlagen, weil sich ihr darin alle Rätsel enthüllten: Gedichte, natürlich nur solcher Poeten, die von Liebe sprachen. Diese waren der Empfindungsweise des kleinen Mädchens näher. Sie sahen die Dinge nicht so, wie sie waren, sie erträumten sie durch das Prisma von Wunsch und Sehnsucht. Fast schien es, als schauten sie gleich ihr durch die Fugen der alten Mauer. Aber sie wußten so viel mehr, sie wußten alles, worauf es ankam, und sie hüllten es in unendlich zarte und geheimnisvolle Worte, die man mit äußerster Vorsicht ergründen mußte, damit man fand ... fand ..., ach! Man fand garnichts, aber man war immer ganz nahe daran.
Die beiden Neugierigen ermüdeten daher niemals. Halblaut, mit einem leisen Schauer, sagten sie sich stets von neuem Alfred de Mussets oder Sully-Prudhommes Verse auf, in denen sie Abgründe von Verderbtheit vermuteten. Sie schrieben sie ab; sie befragten sich gegenseitig über den verborgenen Sinn von Stellen, die oft gar nichts verbargen. Unschuldig und keck, halb im Scherz, halb im Ernst, sprachen diese braven dreizehnjährigen kleinen Frauen, die nichts von Liebe wußten, über Liebe und Liebeslust; sie kritzelten in der Schulstunde, unter dem väterlichen Blick des Lehrers, – eines sehr sanften und höflichen alten Herrn –, auf ihr Löschblatt Verse, wie die folgenden, die er eines Tages entdeckte und über die er ganz entsetzt war:
Laissez, oh, laissez-moi vous tenir enlacées,
Boire dans vos baisers des amours insensées,
Goutte à goutte et longtemps! ...
Sie besuchten die Vorlesungen eines in den reichen Gesellschaftskreisen bevorzugten Institutes, dessen Lehrer Universitätsdozenten waren. Das war der rechte Boden für ihre sehnsüchtigen Gefühle. Fast alle jene kleinen Mädchen waren in ihre Lehrer verliebt, die nur jung und nicht allzu abstoßend zu sein brauchten, um in ihren Herzen Stürme zu entfesseln. Sie arbeiteten auf das allerbeste, um sich bei ihrem Sultan in ein gutes Licht zu setzen. Wenn ein Aufsatz von Ihm schlecht zensiert worden war, gab es Tränen, – bei einem anderen Lehrer machten sie sich natürlich garnichts daraus. Wenn Er lobte, errötete und erblaßte man, schmachtete man ihn dankbar an und war kokett. Wenn Er einen gar beiseite rief, um einen Rat zu erteilen oder ein freundliches Wort zu sagen, war man ganz und gar im Paradies. Man brauchte wirklich kein Genie zu sein, um ihnen zu gefallen. Als einmal in der Turnstunde der Lehrer Jacqueline an das Trapez hob, überfiel sie ein kleines Fieber. O, dieser leidenschaftliche Wetteifer, diese geheimen Regungen der Eifersucht! Mit wie demütigen und schmeichelnden Blicken suchte man den hohen Gebieter einer frechen Nebenbuhlerin abzujagen. Wenn er in der Stunde nur den Mund zum Reden aufmachte, so flogen die Federn und Bleistifte schon übers Papier, um ja mitzukommen. Auf das Verständnis kam es dabei nicht besonders an, die Hauptsache war, daß man keine Silbe verlor. Sie schrieben und schrieben, ohne daß ihr neugieriger Blick aufhörte, heimlich das Gesicht und die Bewegungen ihres Gottes bis ins kleinste zu studieren, und ganz leise fragten sie sich: »Glaubst du, daß ihm eine Kravatte mit blauen Punkten gut stehen würde?« – Ein andermal formten sie sich ihr Ideal aus bunten Bildern, aus überschwenglichen und banalen Gedichtbüchern, aus poetischen Modekupfern. Das war die Zeit der Schwärmereien für Schauspieler und Virtuosen, für lebende und tote Künstler wie Mounet-Sully, Samain, Debussy. – Man tauschte Blicke mit unbekannten jungen Leuten im Konzert, in einem Salon, auf der Straße; und in Gedanken entstanden daraus sofort kleine Leidenschaften; denn man hatte dauernd das Bedürfnis, sich für irgend etwas zu begeistern, immer von einer Liebe erfüllt zu sein, irgend einen Vorwand zum Lieben zu haben. Jacqueline und Simone vertrauten einander alles an: ein deutlicher Beweis dafür, daß sie nicht sehr tief empfanden; es war sogar das beste Mittel, um niemals ein tieferes Gefühl aufkommen zu lassen. Andererseits versetzten sie sich dadurch in eine Art von chronischem Krankheitszustand, den sie liebevoll pflegten, trotzdem sie selbst die ersten waren, die sich darüber lustig machten. Sie erhitzten sich gegenseitig. Simone, die romantischer und besonnener war, malte sich mehr die abenteuerlichen Dinge aus. Die wahrhaftigere und leidenschaftlichere Jacqueline hätte sie lieber in die Wirklichkeit umgesetzt.
Zwanzig Mal war sie nahe daran, die größten Dummheiten zu begehen. – Aber sie beging sie nicht, wie man es in diesem Alter fast niemals tut. Doch es gibt Stunden, in denen solch verliebte kleine Narren (wie wir alle es einmal waren) ganz nahe daran sind, entweder dem Selbstmord oder der Verführung des ersten Besten zu verfallen. Nur daß sie, Gott sei Dank, meistens nicht so weit kommen. Jacqueline entwarf zehn leidenschaftliche Briefe an Leute, die sie kaum kannte. Aber sie schickte keinen ab, außer einem einzigen begeisterten Schreiben, unter das sie nicht einmal ihren Namen setzte, an einen häßlichen, gewöhnlichen Kritiker. Sie hatte sich in ihn verliebt, weil sie in drei Zeilen von ihm einen Schatz von Empfindungen entdeckt zu haben glaubte. Auch für einen großen Schauspieler war sie entflammt. Er wohnte in ihrer Nähe; jedesmal, wenn sie bei der Haustüre vorbeikam, sagte sie bei sich:
»Wenn ich hineinginge!«
Und einmal war sie kühn genug, bis zu seiner Wohnung hinauf zu steigen. Aber dort ergriff sie die Flucht. Wovon hätte sie mit ihm reden sollen? Sie hatte ihm nichts, aber auch garnichts zu sagen. Sie liebte ihn nicht, und sie wußte das ganz gut. Zur Hälfte bestanden ihre Tollheiten in freiwilligem Selbstbetrug. Und zur anderen Hälfte aus dem ewig alten, wonnevollen und törichten Bedürfnis, zu lieben. Da Jacqueline von Haus aus sehr intelligent war, entging ihr davon nichts. Doch schützte sie das nicht vor Tollheiten. Ein Narr, der sich kennt, ist zwiefach ein Narr. Sie ging sehr viel in Gesellschaften. Sie war stets von jungen Leuten umgeben, die von ihrer Anmut gefesselt wurden, und mehr als einer liebte sie. Sie hingegen liebte keinen einzigen, aber flirtete mit allen. Was sie damit anrichten konnte, kümmerte sie wenig. Ein hübsches Mädchen macht aus der Liebe ein grausames Spiel. Es scheint ihm ganz natürlich, daß man es liebt, und es glaubt sich dem Liebenden gegenüber zu nichts verpflichtet. Daß einer sie lieben darf, das allein scheint ihr schon Glück genug für ihn zu sein. Als Entschuldigung sei gesagt, daß sie nicht ahnt, was Liebe ist, wenn sie auch den ganzen Tag an nichts anderes denkt. Man sollte meinen, daß ein junges Mädchen der Gesellschaft, das in der Treibhausluft der Großstadt aufgewachsen ist, frühreifer wäre als ein Kind vom Lande. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Durch Bücher und Gespräche ist sie mit der Liebe soweit vertraut geworden, daß diese sich in ihrem unausgefüllten Leben oft bis zur fixen Idee steigert; ja, es ist sogar zuweilen, als habe sie das Buch schon gelesen und wisse jedes Wort darin auswendig. Nur fühlt sie nichts dabei. Denn in der Liebe wie in der Kunst soll man nicht lesen, was andere sagen, sondern soll sagen, was man fühlt. Und wer voreilig etwas redet, ehe er wirklich etwas zu sagen hat, läuft Gefahr, niemals etwas Rechtes zu sagen.
So lebte Jacqueline, wie die meisten jungen Leute, in einem Wust fremder Empfindungen, die, wenn sie sie auch in einem Zustand beständigen Fiebers erhielten, in dem sie mit heißen Händen, trockener Kehle und brennenden Augen umherging, sie dennoch hinderten, die Dinge richtig zu sehen. Sie glaubte sie zu kennen. An gutem Willen fehlte es ihr nicht. Sie las oder hörte zu. Aus Unterhaltungen und Büchern hatte sie manche Brocken gelernt. Sie versuchte sogar, in sich selbst zu lesen. Sie war besser als ihre Umgebung; denn sie war aufrichtiger.
Nur eine Frau übte einen wohltuenden Einfluß auf sie aus. Leider nur zu kurze Zeit. Es war eine unverheiratete Schwester ihres Vaters, zwischen 40 und 50 Jahren. Martha Langeais war groß, hatte ein regelmäßiges, aber vergrämtes, unschönes Gesicht und ging immer schwarz gekleidet. In ihren Mienen und Bewegungen lag eine steife Vornehmheit. Sie sprach wenig und mit sehr tiefer Stimme. Man hätte sie übersehen können, wäre nicht der klare Blick ihrer klugen grauen Augen gewesen und das gütige Lächeln ihres etwas traurigen Mundes.
Man sah sie bei den Langeais nur an bestimmten Tagen, wenn sie allein waren. Langeais empfand für sie eine mit Langerweile gemischte Verehrung. Frau Langeais verhehlte ihrem Mann durchaus nicht, daß ihr diese Besuche wenig Freude machten. Trotzdem legte man sich aus konventioneller Pflicht den Zwang auf, sie regelmäßig einmal wöchentlich zu Tisch einzuladen. Und man ließ sie auch nicht allzu sehr fühlen, daß man damit nur eine Pflicht erfüllte. Langeais sprach von sich selbst, weil ihm das immer vom Herzen kam. Frau Langeais dachte an alle möglichen Dinge, während sie gewohnheitsmäßig lächelte und aufs Geratewohl antwortete. So ging alles gut und voller Höflichkeit vonstatten. Es kam sogar vor, daß man von Herzlichkeit überströmte, wenn die feinfühlige Tante früher fortging, als man erwartet hatte. Und an manchen Tagen, wenn Frau Langeais besonders liebe Erinnerungen durch den Kopf gingen, wurde ihr reizendes Lächeln geradezu strahlend. Tante Martha fühlte das alles; ihrem Blick entging nur wenig; und im Hause ihres Bruders sah sie vieles, was sie abstieß oder betrübte. Aber sie ließ sich nichts merken: was hätte es auch genützt? Sie liebte ihren Bruder, sie war stolz auf seine Klugheit und seine Erfolge, wie die übrige Familie, der kein Opfer zu schwer gewesen war, um damit den Erfolg des ältesten Sohnes zu erkaufen. Sie wenigstens hatte sich ihr Urteil nicht trüben lassen. Da sie ebenso klug wie er war, aber moralisch gefestigter, fast männlicher als er (wie überhaupt in Frankreich so viele Frauen den Männern überlegen sind), durchschaute sie ihn und sagte offen ihre Ansicht, wenn er sie danach fragte. Aber er hatte sie schon lange nicht mehr danach gefragt! Er fand es klüger, nichts zu wissen oder – (denn er wußte ebenso gut Bescheid wie sie) – nichts wissen zu wollen. Sie zog sich aus Stolz zurück. Niemand kümmerte sich um ihr Innenleben. Es war für die anderen auch bequemer, es nicht zu kennen. Sie lebte allein, ging wenig aus und hatte nur wenige, nicht sehr vertraute Freunde. Es wäre ihr leicht gefallen, die Beziehungen ihres Bruders und ihre eigenen Talente vorteilhaft auszunützen; sie tat es nicht. Sie hatte für eine der großen Pariser Zeitschriften zwei oder drei Aufsätze geschrieben, historische und literarische Portraits, deren nüchterner, guter, treffender Stil aufgefallen war. Dabei hatte sie es aber bewenden lassen. Sie hätte anregende Freundschaften mit manchen hervorragenden Männern und Frauen anknüpfen können, die Interesse für sie gezeigt hatten, und die sie selbst vielleicht gern kennen gelernt hätte. Sie hatte dieses Entgegenkommen nicht erwidert. Es kam vor, daß sie ein Billet zu einer Theatervorstellung hatte; man spielte irgend etwas Schönes, was sie liebte, und sie ging trotzdem nicht hin; oder sie hätte eine Reise machen können, die ihr sicher Freude gemacht hätte, und blieb zu Hause; ihre Natur war ein sonderbares Gemisch von Stoizismus und Neurasthenie. Diese konnte ihre gesunde Denkart nicht im entferntesten ankränkeln. Ihr Körper wurde zwar davon berührt, nicht aber ihr Geist. Ein altes Leiden, das nur sie allein kannte, hatte sie befallen. Und noch tiefer, unerkannter, ihr selbst unbekannt, waren die Spuren des Schicksals, das innere Weh, das bereits an ihr zu nagen begann. – Doch kannten die Langeais nichts von ihr als ihren klaren Blick, der ihnen manchmal peinlich war.
Jacqueline beachtete die Tante kaum, solange sie sorglos und glücklich dahinlebte, und das war zunächst ihr gewöhnlicher Zustand. Doch als sie in das Alter kam, in dem Körper und Seele beunruhigend durchwühlt werden, in dem das ganze Wesen allem Widerwillen, allen Ängsten, Schrecken und hoffnungsloser Traurigkeit ausgeliefert ist, in jener Zeit des sinnlosen und unerträglichen Taumels, der glücklicherweise nicht lange anhält, in der man sterben zu müssen meint, hatte das Kind, das sich dem Ertrinken nahe fühlte und doch nicht um Hilfe zu rufen wagte, einzig und allein die Tante Martha, die ihr die Hand bot. Ach, wie fern waren ihr die anderen! Wie fremd waren ihr Vater und Mutter! Ihre ganze zärtliche Selbstsucht erfüllte sie viel zu sehr, als daß sie sich mit den kleinen Kümmernissen ihrer vierzehnjährigen Puppe hätten befassen können! Die Tante aber ahnte und fühlte mit ihr. Sie sagte nichts. Sie lächelte nur still; über den Tisch hinüber tauschte sie einen gütevollen Blick mit Jacqueline. Jacqueline fühlte, daß die Tante sie verstand, und sie flüchtete sich zu ihr. Martha legte ihre Hand auf Jacquelines Kopf und streichelte sie, ohne zu reden.
Das junge Mädchen vertraute sich ihr an. Wenn ihr Herz übervoll war, besuchte sie ihre große Freundin; sie wußte, sie würde, wann immer sie käme, dieselben gütigen Augen finden, aus deren Ruhe ein wenig auf sie überströmte. Sie sprach mit der Tante fast nie von ihren eingebildeten kleinen Leidenschaften: sie hätte sich geschämt. Sie fühlte, daß sie nicht echt waren. Aber sie redete von ihren unbestimmten und tiefen Ängsten, die ehrlich waren, grundehrlich.
»Tante,« seufzte sie manchmal, »ich möchte so gerne glücklich sein.«
»Armes Kind«, sagte Martha lächelnd.
Jacqueline legte ihren Kopf an die Knie der Tante und küßte die Hände, die sie liebkosten:
»Werde ich glücklich sein? Tante, sag, werde ich glücklich sein?«
»Das weiß ich nicht, mein Liebling, das hängt ein wenig von dir ab ... man kann immer glücklich sein, wenn man will.«
Das glaubte Jacqueline nicht.
»Bist du denn glücklich?«
Martha lächelte wehmütig.
»Ja.«
»Nein wirklich, du bist glücklich?«
»Glaubst du's nicht?«
»Doch ... aber ...« Jacqueline stockte.
»Was denn?«
»Ja, ich möchte wohl glücklich werden, aber anders als du.«
»Armes Kleinchen! Das hoffe ich auch«, sagte Tante Martha.
»Nein,« fuhr Jacqueline fort, indem sie sehr bestimmt den Kopf schüttelte, »ich, siehst du, ich könnte es einfach so nicht ertragen.«
»Ich hätte auch nicht geglaubt, daß ich es könnte. Das Leben zwingt einen dazu, sehr vieles zu können.«
»Ach, aber ich will nicht dazu gezwungen werden,« wehrte Jacqueline ängstlich. »Ich will auf meine Art glücklich werden.«
»Du kämst sicher in Verlegenheit, wenn man dich fragen wollte, was für eine Art das ist.«
»Ich weiß sehr genau, was ich will!«
Sie wollte sehr vieles, doch wenn sie sagen sollte, was, fand sie nichts anderes als das eine, das immer wiederkehrte:
»Vor allem möchte ich, daß man mich liebt!«
Martha schwieg und nähte schweigend weiter. Nach einer kleinen Weile sagte sie:
»Und was hättest du davon, wenn du nicht liebtest?«
Jacqueline geriet in Verwirrung.
»Aber Tante,« rief sie, »natürlich spreche ich nur davon, daß ich liebe! Die übrigen zählen doch garnicht.«
»Und wenn du niemand liebtest?«
»Was für ein Gedanke! Man liebt doch immer, immer!«
Martha schüttelte mit zweifelnder Miene den Kopf.
»Man liebt nicht,« sagte sie, »man möchte nur lieben. Liebe ist das größte Gnadengeschenk Gottes. Bitte ihn, daß er es dir zuteil werden läßt.«
»Und wenn man mich nicht liebt?«
»Selbst, wenn man dich nicht liebt. Auch dann wirst du noch sehr glücklich sein.«
Jacqueline machte ein langes Gesicht und setzte eine Schmollmiene auf.
»Das mag ich nicht,« sagte sie, »das würde mir keinesfalls Vergnügen machen.«
Martha lachte liebevoll, schaute Jacqueline an, seufzte und nahm ihre Arbeit wieder auf.
»Armes Kind!« sagte sie noch einmal.
»Aber warum sagst du immer ›armes Kind‹?« fragte Jacqueline besorgt. »Ich will kein armes Kind sein, ich möchte so schrecklich, schrecklich gern glücklich sein!«
»Gerade deshalb sage ich ›armes Kind‹!«
Jacqueline schmollte noch, aber es dauerte nicht lange. Marthas gutes Lächeln entwaffnete sie. Während sie noch tat, als sei sie böse, umarmte sie sie. Im Grunde fühlt man sich in diesem Alter durch trübe Prophezeiungen für eine viel spätere Zeit schon im voraus heimlich geschmeichelt. In der Ferne erscheint einem das Unglück verklärt, und man fürchtet nichts so sehr wie die Mittelmäßigkeit des Lebens!
Jacqueline merkte nicht, daß das Gesicht der Tante fahler und fahler wurde. Wohl fiel ihr auf, daß Martha immer weniger ausging. Aber das schrieb sie ihrem Hang zur Abgeschlossenheit zu, über den sie sich oft lustig machte. Ein oder zwei Mal hatte sie bei ihrem Kommen den Arzt getroffen, der gerade fortging. Dann hatte sie die Tante gefragt:
»Bist du krank?«
Und Martha hatte geantwortet:
»Es hat nichts zu sagen.«
Aber nun stellte sie sogar ihre wöchentlichen Tischbesuche bei den Langeais ein. Tief gekränkt machte Jacqueline ihr bittere Vorwürfe.
»Mein Liebling,« sagte Martha sanft, »ich fühle mich ein wenig angegriffen.«
Doch davon wollte Jacqueline nichts wissen. Das alles seien bloß faule Ausreden.
»Das wäre auch schon eine Anstrengung, zwei Stunden in der Woche zu uns zu kommen! Du hast mich nicht lieb. Du liebst nur deine Kaminecke.«
Doch als sie zu Hause ganz stolz erzählte, sie habe Tante Martha Vorwürfe gemacht, verwies sie Langeais streng:
»Laß deine Tante in Frieden. Weißt du denn nicht, daß die arme Frau schwer krank ist?«
Jacqueline wurde kreidebleich; und mit zitternder Stimme fragte sie, was der Tante fehle. Man wollte es ihr nicht sagen. Schließlich bekam sie heraus, daß Martha an einem Darmkrebs zugrunde gehen müsse und daß sie nur noch wenige Monate zu leben habe.
Jacqueline verlebte qualvolle Tage. Sie beruhigte sich wieder ein wenig, wenn sie die Tante sah. Glücklicherweise litt Martha nicht allzu sehr. Sie bewahrte ihr ruhiges Lächeln, das in ihrem durchgeistigten Gesicht wie der Widerschein einer inneren Lampe leuchtete. Jacqueline sagte sich:
»Nein, es ist nicht möglich, sie irren sich. Sie wäre nicht so ruhig ...«
Sie nahm ihre kleinen Beichten wieder auf, für die Martha noch mehr Anteilnahme als früher zeigte. Nur manchmal, mitten in der Unterhaltung, verließ die Tante das Zimmer, ohne daß irgend etwas verriet, daß sie Schmerzen habe; und sie kam erst wieder zum Vorschein, wenn der Anfall vorüber war und ihre Züge sich wieder aufgeheitert hatten. Sie liebte es nicht, wenn man auf ihren Zustand anspielte, sie suchte ihn zu verbergen; vielleicht war es ihr selbst ein Bedürfnis, nicht allzu viel daran zu denken: die Krankheit, von der sie sich verzehrt fühlte, flößte ihr Entsetzen ein, sie wandte ihre Gedanken davon ab. Ihr ganzes Bestreben ging darauf hinaus, sich den Frieden der letzten Monate nicht zu zerstören.
Die Auflösung kam schneller, als man gedacht hatte. Bald empfing sie niemanden mehr außer Jacqueline; dann mußten auch Jacquelines Besuche abgekürzt werden. Schließlich kam der Tag der Trennung. Martha lag in ihrem Bett, das sie nun schon seit Wochen nicht mehr verlassen hatte; sie nahm mit ganz sanften und tröstenden Worten Abschied von ihrer kleinen Freundin. Und dann schloß sie sich ein, um zu sterben.
Jacqueline durchlebte Monate der Verzweiflung. Marthas Tod fiel in die schlimmsten Stunden jener seelischen Bedrängnis, in denen Martha als Einzige ihr beizustehen verstanden hätte. Sie war in einem Zustand unaussprechlicher Verlassenheit. Sie hätte, um einen Halt zu haben, eines starken Glaubens bedurft. Eigentlich hätte ihr dieser Halt nicht fehlen dürfen: man hatte sie stets angehalten, ihre religiösen Pflichten zu erfüllen, wie auch ihre Mutter es tat. Aber das war es gerade: ihre Mutter erfüllte die religiösen Pflichten, aber Tante Martha hatte es nicht getan. Wie hätte Jacqueline da nicht Vergleiche ziehen sollen! Kinderaugen entdecken sehr viele Lügen, die Erwachsene gar nicht mehr sehen wollen; sie merken sich auch sehr viele Schwächen und Widersprüche. Jacqueline beobachtete, daß ihre Mutter, und die, die sich für gläubig hielten, ebensoviel Angst vor dem Tode hatten wie die Ungläubigen. Nein, da war kein genügender Halt ... Und zu alledem kamen noch persönliche Erfahrungen, Auflehnung und Widerspruch, ein ungeschickter Beichtvater, der sie verletzt hatte ... So ging sie wohl weiter zur Kirche, aber ohne Glauben, so wie man Besuche macht, weil man wohlerzogen ist. Religion und Geselligkeit hatten ihr nichts mehr zu sagen. Ihre einzige Zuflucht war die Erinnerung an die Tote, in die sie sich ganz und gar versenkte. Sie machte sich viele Vorwürfe, daß sie die, die sie heute vergeblich zurückrief, in ihrer jugendlichen Selbstsucht früher oft vernachlässigt hatte. Das Bild der Toten verklärte sich ihr, und das edle Beispiel, das Martha ihr von einem verinnerlichten und zurückgezogenen Leben gegeben hatte, trug dazu bei, ihr gegen das Gesellschaftsleben ohne Ernst und Aufrichtigkeit Ekel einzuflößen. Sie sah darin nur noch Heuchelei, und all jene liebenswürdigen Zugeständnisse, die ihr zu anderer Zeit Spaß gemacht hätten, empörten sie. Sie lebte in einem Zustand seelischer Überreiztheit, in dem sie unter allem litt; ihre Seele war gleichsam bloßgelegt. Gewisse Dinge offenbarten sich ihr, die ihr bis dahin völlig entgangen waren. Etwas zum Beispiel verletzte sie im tiefsten Herzen.
Sie war eines Nachmittags im Salon ihrer Mutter. Frau Langeais hatte Besuch, – einen geckenhaften, anmaßenden Modemaler, der häufig ins Haus kam, aber nicht zum vertrauteren Kreise gehörte. Jacqueline glaubte zu fühlen, daß ihre Gegenwart den beiden unangenehm sei. Drum blieb sie erst recht. Frau Langeais, deren Kopf durch eine kleine Migräne benommen war oder durch eine jener Migränepillen, die die Damen von heute wie Bonbons schlucken und die ihr Hirnchen völlig erschöpfen, ließ sich beim Reden etwas gehen. Ganz unbewußt sagte sie im Laufe der Unterhaltung zu dem Besucher: »Mein Liebling«.
Sie merkte es sofort: er nahm ebenso wenig Anstoß daran wie sie, und sie führten die Unterhaltung ganz förmlich weiter. Jacqueline, die gerade den Tee reichte, ließ in ihrer Bestürzung beinahe eine Tasse fallen. Sie hatte die Empfindung, daß man hinter ihrem Rücken ein Lächeln des Einverständnisses tausche. Sie wandte sich schnell um und erhaschte schuldbewußte Blicke, die sich sofort verschleierten. – Ihre Entdeckung versetzte ihr einen furchtbaren Stoß. Dieses junge, frei erzogene Mädchen, das oft von derartigen Abenteuern hatte sprechen hören, das selbst davon lächelnd gesprochen hatte, empfand einen unerträglichen Schmerz, als sie merkte, daß ihre Mutter ... ihre Mutter, nein, das war nicht dasselbe! ... Mit gewohnter Übertreibung geriet sie aus einem Extrem ins andere. Bis jetzt hatte sie niemals Argwohn empfunden; nun beargwöhnte sie alles. Sie fing an, sich diese und jene Einzelheiten im früheren Verhalten ihrer Mutter zu deuten. Und Frau Langeais' Leichtsinn bot allerdings nur allzu viele Anhaltspunkte für solche Verdächtigungen. Doch Jacqueline bauschte sie auf. Sie hätte sich gerne ihrem Vater wieder mehr angeschlossen, der ihr immer nähergestanden hatte und dessen kluger Geist eine große Anziehungskraft auf sie ausübte. Sie hätte ihn jetzt doppelt liebhaben, ihn bedauern mögen. Doch Langeais schien ein Bedauern nicht im geringsten nötig zu haben; und der überreizte Sinn des jungen Mädchens wurde von dem Verdacht betroffen, der für sie noch schrecklicher als der erste war, daß ihr Vater durchaus unterrichtet sei, doch daß er es bequemer finde, nichts zu wissen, und daß ihm alles übrige gleichgültig sei, wenn er selbst nur nach seinem Geschmack leben könne. So war Jacqueline in trostloser Verzweiflung. Sie wagte nicht, ihre Eltern zu verachten. Sie liebte sie doch. Aber sie konnte nicht mehr mit ihnen zusammen leben. Auch ihre Freundschaft mit Simone Adam brachte ihr keinerlei Hilfe. Voller Strenge beurteilte sie die Schwächen ihrer älteren Schulkameradin. Auch sich selbst schonte sie nicht; sie litt unter allem, was sie in sich als häßlich und minderwertig erkannte. Verzweifelt rettete sie sich in die ungetrübte Erinnerung an Martha. Doch selbst diese Erinnerung verwischte sich. Sie fühlte, wie der Strom der Zeit sie immer mehr überflutete, um schließlich alle Eindrücke fortzuspülen. Dann würde alles zu Ende sein. Sie würde wie die anderen werden, würde im Sumpf ertrinken ... O, sie mußte um jeden Preis hinaus aus dieser Welt. Hilfe! Hilfe!
Gerade in diesen Tagen fiebernder Verlassenheit, leidenschaftlichen Weltschmerzes und geheimnisvoller Erwartungen, in denen sie die Hände einem unbekannten Retter entgegenstreckte, begegnete sie Olivier. Frau Langeais hatte nicht versäumt, Christof, der in diesem Winter Mode war, einzuladen. Christof war gekommen und hatte sich, wie gewöhnlich, nicht allzu sehr in Unkosten gestürzt. Nichtsdestoweniger fand ihn Frau Langeais bezaubernd: er konnte sich jetzt alles erlauben, man fand ihn immer reizend, aber auch das währte nur ein paar Monate. Jacqueline, die jetzt nicht so auf dem Laufenden war, zeigte sich weniger begeistert; die Tatsache allein, daß Christof von gewissen Leuten gelobt wurde, genügte, sie mißtrauisch zu machen. Im übrigen verletzte sie Christofs ungestümes Wesen, seine laute Sprechweise, seine Lustigkeit. In der Verfassung, in der sie sich befand, war ihr solche Lebensfreude zuwider; sie suchte nach einem wehmütigen Dämmerzustand der Seele und bildete sich ein, daß sie sich darin am wohlsten fühle. Christof war für sie wie zu grelles Tageslicht. Doch als sie sich mit ihm unterhielt, redete er ihr von Olivier: ihm war es Bedürfnis, seinen Freund mit allem, was ihn erfreute, in Beziehung zu bringen. Es wäre ihm selbstsüchtig erschienen, nicht einen Teil jeder neuen Zuneigung, die ihm galt, auf Olivier zu übertragen. Er sprach so gut von ihm, daß Jacqueline durch die Vorstellung, daß eine fremde Seele mit ihrem eigenen Denken so übereinstimme, heimlich ergriffen wurde und auch Olivier einladen ließ. Er sagte nicht sogleich zu; dadurch aber hatten Christof und Jacqueline die Möglichkeit, nach Gefallen ein erträumtes Idealbild von ihm zu entwerfen, dem er wohl oder übel gleichen mußte, als er sich endlich zum Kommen bequemte.
Er kam, sprach aber fast garnicht. Das brauchte er auch nicht. Seine klugen Augen, sein Lächeln, sein feines Wesen, die Ruhe, die ihn umgab und von ihm ausstrahlte, mußten Jacqueline bezwingen. Christof setzte durch den Gegensatz Olivier erst ins rechte Licht. Jacqueline ließ sich aus Furcht vor dem in ihr aufkeimenden Gefühl nichts merken, sie unterhielt sich weiter mit Christof über Olivier. Christof, der glücklich war, wenn er von seinem Freunde reden konnte, merkte nicht, welche Freude Jacqueline an diesem Unterhaltungsstoff fand. Er sprach auch von sich selbst, und sie hörte freundlich zu, obgleich sie das nicht im geringsten interessierte; ganz unbemerkt lenkte sie dann doch das Gespräch wieder auf kleine Ereignisse seines Lebens, bei denen Olivier eine Rolle spielte.
Das freundliche Entgegenkommen Jacquelines war für einen jungen Menschen wie Christof, der sich nicht im geringsten in acht nehmen konnte, gefährlich. Ohne daß er es ahnte, verliebte er sich in sie; es machte ihm Freude, immer wieder zu kommen; er kleidete sich sorgfältig; und ein ihm wohlbekanntes Gefühl mischte von neuem seine frohe, zarte Sehnsucht in all seine Gedanken.
Auch Olivier hatte sich in Jacqueline verliebt und zwar gleich in den ersten Tagen; er fühlte sich zurückgesetzt und litt schweigend darunter. Christof verschlimmerte das noch, indem er ihm, wenn er von Langeais nach Hause kam, freudig von seinen Unterhaltungen mit Jacqueline erzählte. Der Gedanke, daß er selbst Jacqueline gefallen könnte, kam Olivier gar nicht. Wenn er auch durch den Umgang mit Christof optimistischer geworden war, so mangelte ihm doch auch fernerhin das rechte Selbstvertrauen; er konnte sich nicht vorstellen, daß man ihn jemals lieben würde; er sah sich selbst mit zu kritischen Augen. Wer war überhaupt um seiner guten Eigenschaften willen wert, geliebt zu werden; dankte man es nicht immer nur der alles verzeihenden, zauberhaften Liebe?
Eines Abends, als er bei Langeais eingeladen war, fühlte er, daß es ihn zu unglücklich machen würde, sich immer wieder mit Jacquelines Gleichgültigkeit abfinden zu müssen. Er schützte deshalb Müdigkeit vor und bat Christof, allein hinzugehen. Christof schöpfte nicht den geringsten Verdacht und ging fröhlich vom Hause fort. In kindlichem Egoismus empfand er nur die Freude, Jacqueline für sich allein zu haben. Aber er sollte sich nicht lange freuen. Sobald Jacqueline hörte, daß Olivier nicht käme, fing sie an zu schmollen, war reizbar, gelangweilt und aus dem Gleichgewicht gebracht; sie gab sich nicht mehr die geringste Mühe, zu gefallen, hörte Christof nicht zu und gab zerstreute Antworten, und mit Beschämung sah Christof, wie sie verzweifelt ein Gähnen unterdrückte. Am liebsten hätte sie geweint. Plötzlich verschwand sie aus der Gesellschaft und kam nicht wieder.
Christof ging völlig niedergeschlagen heim. Auf dem ganzen Wege suchte er sich diesen plötzlichen Umschwung zu erklären, und ein Schimmer der Wahrheit begann langsam in ihm zu dämmern. Zu Hause fand er Olivier, der auf ihn wartete und ihn mit mühsam geheuchelter Gleichgültigkeit über den Abend befragte. Christof erzählte ihm von seinem Mißgeschick. Je länger er sprach, um so mehr erhellte sich Oliviers Gesicht.
»Und deine Müdigkeit?« fragte Christof; »warum hast du dich nicht schlafen gelegt?«
»O, es geht mir besser,« meinte Olivier. »Ich bin gar nicht mehr müde.«
»Ja, mir scheint auch, es war sehr gut für dich, daß du nicht hingegangen bist,« sagte Christof bedeutungsvoll.
Er sah ihn spöttisch und dabei zärtlich an, dann ging er in sein Zimmer; und als er allein war, begann er zu lachen, erst ganz leise, bis er schließlich so lachte, daß ihm die Tränen kamen.
»Das schlimme Mädchen!« dachte er, »sie hat ihr Spiel mit mir getrieben! Und auch er hat mich hinters Licht geführt. – Wie gut sie sich verstellt haben!«
Von nun an schlug er sich jeden persönlichen Gedanken in Bezug auf Jacqueline aus dem Kopf; und wie eine brave Henne eifersüchtig über ihre Eier wacht, so wachte er jetzt über den Roman der beiden Verliebten. Er ließ sich nicht merken, daß er ihr Geheimnis kannte, verriet sich gegen keinen von beiden und war ihnen behilflich, ohne daß sie es ahnten.
Er hielt es ernsthaft für seine Pflicht, Jacquelines Charakter zu ergründen, um zu sehen, ob Olivier mit ihr glücklich werden könne; und da er recht ungeschickt war, ärgerte er Jacqueline durch seine geschmacklosen Fragen nach ihren Liebhabereien, ihren sittlichen Anschauungen und anderem mehr.
»Ist das ein Tropf! Was fällt ihm ein?« dachte Jacqueline wütend, und sie antwortete ihm nicht und ließ ihn stehen.
Und Olivier strahlte vor Glück, weil er sah, daß Jacqueline sich nicht mehr um Christof kümmerte. Und Christof strahlte, weil er sah, daß Olivier glücklich war; er zeigte seine Freude sogar viel auffälliger als Olivier. Da er aber den Grund dazu nicht verriet, fand Jacqueline ihn unausstehlich; denn sie ahnte nicht, daß Christof in ihrer Liebe klarer sah als sie selbst. Sie konnte nicht begreifen, warum Olivier sich einen derartig gewöhnlichen und lästigen Freund zugelegt hatte. Der gute Christof durchschaute sie, und es war ihm ein boshaftes Vergnügen, sie in Wut zu bringen. Bald zog er sich ganz zurück, schützte Arbeit vor, sagte die Einladungen bei Langeais ab und überließ Jacqueline und Olivier sich selbst. Doch der Gedanke an die Zukunft machte ihn ein wenig besorgt. Für die Heirat, die sich da anbahnen wollte, schob er sich selbst eine große Verantwortung zu, die ihn sehr bedrückte; denn er beurteilte Jacqueline ziemlich richtig und fürchtete vielerlei: zunächst ihren Reichtum, ihre Umgebung und vor allem ihre Schwäche. Er mußte an seine alte Freundin Colette denken. Allerdings war er sich klar darüber, daß Jacqueline aufrichtiger, wahrhaftiger und leidenschaftlicher war; der brennende Wunsch nach einem tätigen Leben, ein beinahe heldisches Verlangen wohnte in diesem kleinen Geschöpf.
»Aber der Wunsch allein tut es nicht«, dachte Christof, und ein derbes Witzwort des alten Diderot kam ihm dabei in den Sinn; »man muß auch entsprechend gebaut sein.«
Er wollte Olivier vor der Gefahr warnen. Doch wenn er sah, wie Olivier mit freudetrunkenen Augen von Jacqueline zurückkehrte, brachte er's nicht übers Herz zu reden. Er dachte:
»Die armen Kinder sind glücklich. Ich will ihr Glück nicht stören.« Nach und nach ließ ihn seine Liebe zu Olivier auch wieder des Freundes Vertrauen zu Jacqueline teilen. Er wurde wieder sorgloser, und schließlich glaubte er, daß Jacqueline wirklich so wäre, wie Olivier sie sah, und wie sie selbst sich sehen wollte. Sie hatte solch guten Willen! Sie liebte Olivier um alles dessen willen, was ihn von ihr selbst und ihrer Welt unterschied: sie liebte ihn seiner Armut, seiner strengen sittlichen Grundsätze wegen und weil er sich in der Gesellschaft ungeschickt benahm. Sie liebte ihn so rein und ausschließlich, daß sie am liebsten arm wie er gewesen wäre; ja, in manchen Augenblicken hätte sie geradezu häßlich sein mögen, nur um ganz sicher zu sein, um ihrer selbst willen geliebt zu werden, um der Liebe willen, von der ihr Herz erfüllt war und nach der sie dürstete ...
Ach, an manchen Tagen, wenn er da war, fühlte sie, wie sie bleich wurde und wie ihre Hände zitterten. Sie gab sich Mühe, ihre Erregung zu verbergen, sie tat, als ob andere Dinge sie sehr beschäftigten, als ob sie Olivier kaum beachte, und führte spöttische Reden. Plötzlich aber unterbrach sie sich und stürzte auf ihr Zimmer; dort saß sie bei verschlossener Tür und heruntergelassenen Vorhängen, die Knie aneinander gedrückt, die Ellbogen an den Leib gepreßt und kreuzte die Arme über der Brust, um ihr Herzklopfen zu unterdrücken; so blieb sie zusammengekauert, regungslos, ohne einen Atemzug, und wagte nicht sich zu rühren, aus Furcht, daß bei der geringsten Bewegung ihr Glück entweichen könne. Sie wickelte sich ganz still in ihre Liebe ein.
Jetzt setzte sich Christof leidenschaftlich für Oliviers Erfolg ein. Wie eine Mutter war er um ihn besorgt, kümmerte sich um seine Kleidung, hielt es sogar für gut, ihm Ratschläge zu erteilen über die Art, sich anzuziehen, ja, er band ihm sogar die Krawatte (aber wie!). – Olivier ließ geduldig alles über sich ergehen, und auf der Treppe, wenn Christof nicht mehr dabei war, band er seine Krawatte neu. Er lächelte im stillen über ihn, war aber von seiner großen Fürsorglichkeit doch gerührt. Andererseits machte ihn die Liebe schüchtern und unsicher, und er holte sich daher auch wiederum gern bei Christof einen Rat und erzählte ihm ausführlich von seinen Besuchen. Christof bewegte das alles ebenso wie Olivier selbst, und manchmal lag er des Nachts Stunden lang wach, um auf Mittel zu sinnen, wie man der Liebe seines Freundes die Wege ebnen könne.
Draußen vor Paris in dem Park der Langeais'schen Villa, die in einer hübschen Gegend am Waldrand von l'Isle-Adam lag, fand zwischen Olivier und Jacqueline die Unterredung statt, die über ihr Leben entschied.
Christof hatte seinen Freund hinausbegleitet; aber da er in dem Hause ein Harmonium entdeckte, gab er sich ans Spielen und ließ die beiden Verliebten ruhig im Garten spazieren gehen. Eigentlich wünschten sie sich das gar nicht. Sie fürchteten sich eher vor dem Alleinsein. Jacqueline war schweigsam und ein wenig feindselig. Schon bei seinem letzten Besuch hatte Olivier eine Veränderung in ihrem Wesen bemerkt, eine plötzliche Kälte, eigentümliche Blicke, die hart, fast feindlich waren. Er fühlte, wie er unter diesen Blicken erstarrte. Er wagte nicht, sich mit ihr auszusprechen; denn er befürchtete viel zu sehr, von ihr, die er liebte, eine grausame Antwort zu empfangen. Es bangte ihm daher, als er Christof gehen sah. Es war ihm, als ob dessen Gegenwart allein ihn vor dem Schlage bewahren könne, der ihm drohte.
Jacqueline liebte Olivier um nichts weniger. Sie liebte ihn sogar weit mehr. Aber gerade das stimmte sie feindselig. Diese Liebe, mit der sie einstmals gespielt hatte, die sie so oft herbeigesehnt hatte, war nun wirklich und leibhaftig da. Gleich einem Abgrund öffnete es sich vor ihren Schritten und sie bäumte sich erschreckt zurück. Sie begriff nichts mehr; sie fragte sich:
»Warum? Warum nur? Was soll das bedeuten?«
Dann schaute sie Olivier an mit einem jener Blicke, die ihm wehtaten und dachte:
»Wer ist dieser Mann?«
Sie wußte es nicht, er war ihr ein Fremder.
»Warum liebe ich ihn?«
Sie wußte es nicht.
»Und liebe ich ihn wirklich?«
Sie wußte es nicht ... Sie wußte es nicht; doch sie wußte, daß sie in jedem Fall gefangen war. Die Liebe hielt sie fest; sie war im Begriff darin zu versinken, ganz und gar zu versinken, mit ihrem Willen, ihrer Freiheit, ihrer Selbstsucht, ihren Zukunftsträumen. Das alles sollte von diesem Moloch verschlungen werden? Und voller Zorn lehnte sie sich dagegen auf; für Augenblicke empfand sie gegen Olivier beinahe eine Art Haß.
Sie kamen bis zum äußersten Ende des Parkes in den Gemüsegarten, den dicht belaubte alte Bäume von den Rasenplätzen trennten. Mit kleinen Schritten gingen sie durch die Wege, die von früchtebehangenen roten und weißen Johannisbeersträuchern eingefaßt waren und von Erdbeerrabatten, deren Duft die Luft erfüllte. Es war Juni, aber Gewitter hatten etwas Kühlung gebracht. Der Himmel war grau, das Licht fast erloschen; niedrig hängende Wolkenballen trieben schwerfällig mit dem Wind. Aber von diesem starken Wind in der Ferne verspürte die Erde nichts. Kein Blatt rührte sich. Trotzdem war die Luft sehr frisch. Eine tiefe Wehmut umhüllte alles, umhüllte auch die Herzen, die von einem ernsten Glücksgefühl erfüllt waren. Und fern vom Garten her, aus den halb geöffneten Fenstern der unsichtbarem Villa, trugen die Töne des Harmoniums die Fuge in Es-moll von Johann Sebastian Bach zu ihnen herüber. Ganz bleich und ohne ein Wort zu reden, setzten sie sich auf den Rand eines steinernen Brunnens, und Olivier sah, wie über Jacquelines Wangen Tränen flossen. »Sie weinen?« murmelte er mit bebenden Lippen; und auch ihm kamen die Tränen. Er nahm ihre Hand. Sie neigte ihren blonden Kopf auf seine Schulter. Sie suchte nicht mehr zu kämpfen: sie war besiegt. O, wie das erleichterte! ... Sie weinten leise und lauschten der Musik. So saßen sie unter dem bewegten Baldachin der schweren Wolken, die in stillem Flug die Wipfel der Bäume zu streifen schienen. Sie dachten an alles, was sie gelitten hatten, und – wer weiß? – vielleicht auch an das, was sie später noch leiden sollten. Es gibt Minuten, in denen die Musik die ganze Schwermut an die Oberfläche treibt, die um das Schicksal eines Menschen gewoben ist ...
Nach einer kleinen Weile trocknete Jacqueline ihre Augen und schaute Olivier an. Und plötzlich umschlangen sie sich. O, unaussprechliches Glück! Heiliges Glück! So süß und tief, daß es fast schmerzlich ist!
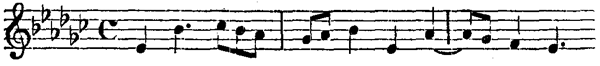
»Sah deine Schwester dir ähnlich?« fragte Jacqueline.
Olivier schreckte zusammen. Er sagte:
»Warum sprichst du von ihr? Hast du sie denn gekannt?«
Sie antwortete:
»Christof hat mir von ihr erzählt ... Du hast viel durchgemacht?«
Olivier nickte, er konnte vor Erregung nicht antworten.
»Ich habe auch viel durchgemacht,« sagte sie.
Sie sprach von der verstorbenen Freundin, der lieben Martha; sie erzählte beklommen, wie sie geweint, sich fast zu Tode geweint habe. »Du wirst mir helfen,« sagte sie mit flehender Stimme, »du wirst mir helfen, zu leben, gut zu sein, ihr ein wenig ähnlich zu werden. Wirst du die arme Martha auch ein bischen liebhaben, ja?«
»Wir werden sie alle beide lieben, wie diese beiden jetzt einander lieben.«
»Ich wünschte, sie wären dabei!«
»Sie sind ja dabei.«
Sie saßen dicht aneinander gepreßt; sie atmeten kaum und fühlten ihre Herzen schlagen. Ein kleiner, feiner Regen fiel allmählich nieder. Jacqueline erschauerte.
»Wir wollen hineingehen,« sagte sie.
Unter den Bäumen war es fast Nacht. Olivier küßte Jacquelines feuchtes Haar. Sie hob den Kopf zu ihm auf, und er fühlte auf seinen Lippen zum ersten Mal ihren liebenden Mund, ihre fiebernden, ein wenig aufgesprungenen kleinen Mädchenlippen. Sie waren nahe daran, die Besinnung zu verlieren.
Als sie dicht bei dem Hause waren, blieben sie noch einmal stehen:
»Wie allein wir früher waren!« sagte er. Er hatte Christof schon ganz vergessen.
Endlich erinnerten sie sich wieder an ihn. Die Musik hatte aufgehört. Sie gingen ins Haus. Auch Christof, die Arme auf das Harmonium und den Kopf in die Hände gestützt, sann träumerisch der Vergangenheit nach. Als er die Türe gehen hörte, erwachte er aus seiner Träumerei und zeigte ihnen sein liebevolles, von einem ernsten, zärtlichen Lächeln erhelltes Gesicht. Er las in ihren Augen, was sich zugetragen hatte, drückte beiden die Hand und sagte:
»Setzt euch dorthin, ich will euch etwas vorspielen.« Sie setzten sich, und er spielte auf dem Klavier alles, was sein Herz bewegte, all seine Liebe, die er für sie empfand. Als er geendet hatte, blieben alle drei schweigend sitzen. Dann stand Christof auf und schaute sie an. Er sah so gütig aus, und so viel älter und stärker als sie beide! Zum ersten Mal kam es Jacqueline zum Bewußtsein, wie er eigentlich war. Er nahm sie beide in den Arm und sagte zu Jacqueline:
»Sie werden ihn sehr lieb haben, nicht wahr? Ihr werdet Euch recht von Herzen lieben?«
Tiefe Dankbarkeit durchströmte sie. Gleich darauf aber brach er das Gespräch ab, lachte, trat ans Fenster und sprang in den Garten.
In den folgenden Tagen riet er Olivier, bei den Eltern um Jacquelines Hand anzuhalten. Aber Olivier wagte es nicht, aus Angst vor einer abschlägigen Antwort. Auch drängte ihn Christof, sich eine Stellung zu suchen; denn wenn Langeais ihre Einwilligung gäben, könnte er Jacquelines Vermögen doch nicht annehmen, wenn er nicht selbst in der Lage wäre, sein Brot zu verdienen. Olivier dachte darin ebenso, wenn er auch Christofs ungerechtes und ein wenig komisches Mißtrauen in Bezug auf Heiraten nicht teilte. In Christofs Kopf hatte sich nun einmal die Vorstellung festgesetzt, daß der Reichtum die Seele töte. Er hätte am liebsten das Scherzwort wiederholt, das ein witziger Habenichts einmal einer reichen Dame zurief, die sich über das Jenseits Gedanken machte:
»Wie, gnädige Frau, Sie besitzen Millionen und wollen auch noch eine unsterbliche Seele haben?«
»Nimm dich vor der Frau in acht«, hatte er oft halb scherzend, halb ernsthaft zu Olivier gesagt, »mißtraue einer Frau, aber zwanzig mal mehr noch einer reichen Frau. Die Frau liebt – unter Umständen – die Kunst, den Künstler aber erstickt sie. Die reiche Frau vergiftet beide. Reichtum ist eine Krankheit, die eine Frau noch schwerer übersteht als ein Mann. Jeder Reiche ist ein widernatürliches Geschöpf ... Du lachst, du machst dich über mich lustig? Wie, hat ein Reicher vielleicht eine Ahnung, was das Leben bedeutet? Bleibt er vielleicht in engem Zusammenhang mit der rauhen Wirklichkeit? Fühlt er etwa den kalten Hauch des Elends auf seinem Gesicht, atmet er den Geruch des Brotes, das er selbst verdienen, der Erde, die er selbst durchackern muß? Kann er Wesen und Dinge verstehen, sie überhaupt nur richtig sehen? ... Früher, als ich ein kleiner Junge war, ist es ein oder zwei Mal vorgekommen, daß ich zu einer Spazierfahrt im Wagen des Großherzogs mitgenommen wurde. Der Wagen fuhr mitten durch Wiesen, auf denen ich jeden Grashalm kannte, durch Wälder, die ich allein durchstreift hatte und die ich über alles liebte. Und, siehst du, ich sah von alledem nichts mehr. Die ganze vertraute Landschaft däuchte mir ebenso steif und unpersönlich wie jene Dummköpfe, die mich darin spazierenfuhren. Zwischen die Wiesen und mein Herz hatte sich nicht nur der Vorhang dieser versteiften Seelen geschoben; die vier Bretter unter meinen Füßen, dieses bewegliche Podium über der Erde, genügten schon allein. Soll ich fühlen, daß die Erde meine Mutter ist, so müssen meine Füße in ihrem Schoße wurzeln, wie bei dem Neugeborenen, der zum Lichte drängt. Reichtum zerschneidet das Band, das den Menschen mit der Erde eint und alle Erdenkinder miteinander verbindet. Und wie wolltest du da noch ein Künstler sein? Der Künstler ist die Stimme der Erde. Ein reicher Mann kann kein echter Künstler sein. Er müßte, um es dennoch zu sein, unter so ungünstigen Voraussetzungen tausend mal mehr Talent besitzen. Und selbst, wenn er es besäße, so wäre er doch immer nur eine Treibhauspflanze. Der große Goethe kann sich noch so sehr anstrengen, seine Seele hat verkümmerte Glieder; die notwendigsten Organe fehlen ihr: denn der Reichtum hat sie getötet. Du, der du nicht die Kraft eines Goethe in dir hast, würdest vom Reichtum aufgezehrt werden, vor allem von der reichen Frau, – die Goethe wenigstens vermieden hat. Allein kann der Mann noch gegen diese Geißel ankämpfen. Er birgt in sich soviel angeborene Roheit, einen solchen natürlichen Vorrat an wilden segensreichen Trieben, die ihn an die Erde fesseln, daß er, für sich allein, noch Möglichkeiten hat, mit heiler Haut davonzukommen. Die Frau aber ist widerstandslos gegen das Gift und überträgt es auf andere. Ihr ist wohl in der parfümierten Stickluft des Reichtums, die sie nicht mehr entbehren kann. Eine Frau, die im Reichtum ein gesundes Herz bewahrt, ist ein ebensolches Wunder wie ein Millionär, der ein Genie ist ... und außerdem mag ich keine Abnormitäten. Wer mehr hat, als er zum Leben braucht, ist anormal – ein menschlicher Krebsschaden, der an den anderen Menschen zehrt.«
Olivier lachte:
»Was soll ich tun?« sagte er, »ich kann doch meine Liebe zu Jacqueline nicht aufgeben, nur weil sie reich ist, und ebenso wenig kann ich sie zur Armut zwingen, weil sie mich liebt.«
»Na also, wenn du sie nicht retten kannst, so rette wenigstens dich selbst. Und damit wirst du auch ihr noch am ehesten helfen. Halte dich rein. Arbeite!«
Es war nicht einmal nötig, daß Christof seine Besorgnisse Olivier anvertraute. Dessen Seele war noch viel empfindsamer. Christofs Angriffe gegen das Geld nahm er zwar nicht allzu ernst: er war selbst reich gewesen; Reichtum war ihm durchaus nicht unangenehm, und er fand, daß er zu Jacquelines hübschem Gesicht gut paßte. Aber es war ihm unerträglich, daß man seiner Liebe den Verdacht des Eigennutzes unterschieben könnte. Er hegte den Wunsch, seine Universitätslaufbahn wieder aufzunehmen. Im Augenblick konnte er nichts weiter als eine mittelmäßige Stelle an einem Provinzgymnasium erhoffen. Das bedeutete ein trauriges Hochzeitsgeschenk für Jacqueline. Schüchtern redete er mit ihr davon. Jacqueline wurde es zunächst etwas schwer, seine Gründe gelten zu lassen; sie schrieb sie einem übertriebenen Stolz zu, den Christof ihm in den Kopf gesetzt hatte und den sie lächerlich fand. War es, wenn man liebte, nicht ganz natürlich, mit immer gleichbleibender Gesinnung Reichtum oder Armut von dem, den man liebte, entgegenzunehmen? Und war es nicht kleinlich, dem anderen eine Wohltat nicht schuldig bleiben zu wollen, die zu erweisen ihm soviel Freude machte? ... Nichtsdestoweniger erklärte Jacqueline sich mit Oliviers Plan einverstanden: gerade, weil etwas Asketisches und wenig Verlockendes darin lag, war es ihr recht. So bot sich ihr doch endlich die Gelegenheit, das Verlangen nach seelischer Größe zu stillen. In dem Zustand stolzer Auflehnung gegen ihre Umgebung, der durch ihre Trauer hervorgerufen und durch ihre Liebe noch gesteigert worden war, hatte sie schließlich alles in ihrer Natur unterdrückt, was im Widerspruch zu jener geheimnisvollen Glut stand. In voller Aufrichtigkeit stellte sie ihr ganzes Wesen, wie einen Bogen, auf ein unendlich reines, strenges und glückerfülltes Lebensziel ein ... Die Hindernisse, die Enge ihrer künftigen Lage, all das bedeutete für sie Freude. Wie gut und schön sollte alles werden! ...
Frau Langeais war allzu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich viel um das zu kümmern, was rings um sie her vorging. Seit einiger Zeit dachte sie nur noch an ihre Gesundheit; sie brachte ihre Tage damit hin, sich um eingebildete Krankheiten zu sorgen und einen Arzt nach dem anderen zu konsultieren. Jeder erschien ihr, wenn die Reihe an ihm war, als der Erretter; das dauerte vierzehn Tage. Dann kam die Reihe an einen anderen. Monatelang blieb sie vom Hause fern und hielt sich in höchst kostspieligen Sanatorien auf, wo sie in frommer Ergebenheit die lächerlichsten Vorschriften erfüllte. Tochter und Gatten hatte sie vergessen.
Herr Langeais, der weniger gleichgültig war, merkte allmählich, daß sich etwas anzuspinnen begann. Seine väterliche Eifersucht hieß ihn wachsam sein. Er empfand für Jacqueline jene beunruhigende und reine Zärtlichkeit, wie sie viele Väter für ihre Töchter haben, die sie sich aber nur selten eingestehen. Jenes undefinierbare Gefühl, jenes geheimnisvolle, lusterfüllte, gewissermaßen geheiligte Verlangen, in Geschöpfen des eigenen Blutes, die man wie das eigene Ich empfindet, und die doch Frauen sind, noch einmal zu leben. In diesen verborgenen Winkeln des Herzens gibt es viele Schatten und Lichter, über die man am besten mit gesundem Empfinden hinwegsieht. Bisher hatte es ihm Spaß gemacht zu sehen, wie seine Tochter die jungen Leutchen in sich verliebt machte; so gerade hatte er sie gern: kokett, romantisch, und doch lebensklug – (wie er selbst es war) –; doch als er sah, daß das Abenteuer ernsthafter zu werden drohte, wurde er besorgt. Er machte sich öfters in Gegenwart von Jacqueline über Olivier lustig und kritisierte ihn mit einer gewissen Schärfe. Jacqueline lachte zunächst darüber und sagte:
»Sprich nicht soviel Schlechtes von ihm, Papa; das würde Dir später peinlich sein, wenn ich ihn einmal heiraten wollte.«
Herr Langeais schrie Zeter und Mordio und nannte sie ganz und gar verrückt. Das war das beste Mittel, um sie wirklich verrücktzumachen. Er erklärte, sie würde Olivier niemals heiraten. Sie erklärte, sie werde ihn heiraten.
So kam es zur Klarheit zwischen ihnen. Er merkte, daß er für sie nichts mehr galt, und war empört darüber. Sein väterlicher Egoismus hatte das niemals vorausgeahnt. Er schwor, daß weder Olivier noch Christof jemals wieder einen Fuß in sein Haus setzen dürften. Jacqueline geriet außer sich; und eines schönen Morgens, als Olivier seine Türe aufmachte, kam das junge Mädchen wie ein Wirbelwind in sein Zimmer gestürzt, bleich und zu allem entschlossen, und rief:
»Entführe mich! Meine Eltern wollen nicht, aber ich will. Kompromittiere mich einfach!«
Olivier war bestürzt und dabei doch so gerührt, daß er nicht einmal eine ruhige Besprechung versuchte. Glücklicherweise war Christof anwesend, Er, der für gewöhnlich der Unbedachte war, brachte sie zur Vernunft. Er machte ihnen klar, wie sehr sie unter dem Skandal, den sie heraufbeschwören wollten, leiden würden.
Jacqueline biß sich in ihrem Zorn auf die Lippen und sagte: »Nun gut, dann nehmen wir uns nachher das Leben.«
Das erschreckte Olivier nicht im geringsten, sondern machte ihn eher entschlossen. Christof hatte nicht geringe Mühe, die beiden tollen Menschen etwas zur Geduld zu bringen. Sie sollten doch, meinte er, bevor sie zu so verzweifelten Mitteln griffen, erst einmal andere versuchen. Jacqueline sollte nach Hause zurückkehren. Er selbst würde Herrn Langeais aufsuchen und für ihre Sache eintreten.
Ein sonderbarer Anwalt! Bei den ersten Worten hätte ihn Herr Langeais beinahe vor die Türe gesetzt; dann aber fand er die Geschichte so lächerlich, daß sie ihn fast belustigte. Doch nach und nach machten der Ernst des Sprechers und sein anständiges überzeugendes Wesen Eindruck auf ihn, wenn er auch nicht nachgeben wollte und weiter die Pfeile seiner ironischen Rede gegen ihn schnellte. Christof tat, als höre er sie nicht; aber als ihn einige verletzendere Pfeile trafen, hielt er inne; alles in ihm lehnte sich auf. Dann ergriff er von neuem das Wort. Im gegebenen Moment ließ er die Faust auf die Tischplatte fallen und sagte:
»Sie können mir glauben, daß dieser Besuch mir nicht das geringste Vergnügen macht: ich muß mir Gewalt antun, gewisse Worte, die Sie gebraucht haben, nicht energisch zurückzuweisen; aber ich halte es für meine Pflicht, mit Ihnen zu reden, und so tue ich es. Schalten sie mich bitte aus, wie ich mich selbst ausschalte, und wägen Sie meine Worte!«
Herr Langeais horchte auf; als er von dem Selbstmordplan reden hörte, zuckte er die Achseln und bemühte sich zu lächeln; in Wirklichkeit aber war er bewegt. Er war viel zu gescheit, um solche Drohungen als Scherz aufzufassen; er wußte, daß man mit der Geistesverwirrung eines verliebten jungen Mädchens zu rechnen hatte. Eine seiner Geliebten, ein sonst immer heiteres und sanftes Mädchen, die er für unfähig gehalten hatte, mit ihren großen Worten Ernst zu machen, hatte sich vor seinen Augen eine Kugel in die Stirn gejagt. Sie war nicht sofort tot; er sah den Auftritt immer noch vor sich ... Nein, bei diesen Närrinnen war man vor nichts sicher. Das Herz krampfte sich ihm zusammen ...
»Sie will ihn durchaus? Nun, meinetwegen, um so schlimmer für das alberne Mädchen! ...«
Er hätte eher zu allem ja gesagt, als seine Tochter zum Äußersten zu treiben. Allerdings hätte er versuchen können, diplomatisch vorzugehen: scheinbar einzuwilligen, um Zeit zu gewinnen und so Jacqueline langsam von Olivier abzubringen. Dazu hätte er sich aber mehr Mühe geben müssen, als er konnte oder wollte. Und dann war er schwach; auch machte die Tatsache allein, daß er Jacqueline gegenüber energischest »Nein« gesagt hatte, ihn jetzt geneigt, »Ja« zu sagen. Was weiß man schließlich vom Leben? Vielleicht hatte die Kleine recht. Die Hauptsache war doch, daß man sich liebte. Herr Langeais wußte sehr gut, daß Olivier ein strebsamer junger Mensch war, der vielleicht sogar Talent hatte ... So gab er seine Einwilligung.
Am Vorabend der Hochzeit durchwachten die beiden Freunde einen Teil der Nacht miteinander. Sie wollten von diesen letzten Stunden einer ihnen teueren Vergangenheit nichts verlieren. Aber sie gehörten wirklich schon der Vergangenheit an. Es war wie in jenen trüben Abschiedsstunden auf einem Bahnsteig, wenn sich die Abfahrt des Zuges verzögert! Man zwingt sich zum Bleiben, zum Einander-Ansehen und Miteinander-Reden. Aber das Herz ist nicht mehr dabei; der Freund ist schon abgereist ... Christof versuchte zu plaudern. Mitten in einem Satz hielt er inne; denn er sah die zerstreuten Augen Oliviers und sagte lächelnd: »Wie weit du schon fort bist!«
Olivier entschuldigte sich verlegen. Es bedrückte ihn, daß er sich von diesen letzten vertrauten Augenblicken mit seinem Freunde ablenken ließ. Aber Christof drückte ihm die Hand und sagte:
»Laß nur, tu dir keinen Zwang an. Ich bin glücklich. Träume, mein Junge!«
So blieben sie, an das Fenster gelehnt, nebeneinander stehen und schauten in den nächtlichen Garten. Nach einer Weile sagte Christof zu Olivier:
»Du läufst mir davon? Du meinst, du kannst mir entfliehen? Du denkst an deine Jacqueline. Aber ich werde dich bald einholen, auch ich denke ja an sie.«
»Mein guter Junge,« sagte Olivier, »ich habe auch an dich gedacht und habe mir sogar ...«
Er brach ab.
Christof vollendete lächelnd den Satz:
»… sogar große Mühe damit gegeben!«
Christof hatte sich für das Fest sehr fein, fast elegant gemacht. Eine kirchliche Feier fand nicht statt. Beide hatten es nicht gewollt: Olivier aus Gleichgültigkeit, Jacqueline aus Widerspruchsgeist. Christof hatte für die Ziviltrauung eine symphonische Arbeit komponiert; aber noch im letzten Augenblick zog er sie zurück, nachdem er sich klar gemacht hatte, was eigentlich eine Ziviltrauung sei. Die Feierlichkeit kam ihm lächerlich vor. Um sie ernst zu nehmen, darf man weder gläubig noch frei sein. Wenn ein guter Katholik sich die Mühe macht, ein Freigeist zu werden, so tut er es wahrhaftig nicht, um einem Standesbeamten priesterliche Würden zuzugestehen. Zwischen Gott und dem freien Gewissen ist für eine Staatsreligion kein Platz. Der Staat nimmt zu Protokoll, er vereint nicht.
Oliviers und Jacquelines Trauung war nicht dazu angetan, um Christof seinen Entschluß bedauern zu lassen. Olivier hörte mit abgewandtem Blick und ein wenig ironischer Miene dem Standesbeamten zu, der das junge Paar, die reiche Familie und die ordengeschmückten Zeugen plump umschmeichelte. Jacqueline hörte überhaupt nicht zu; und einmal streckte sie heimlich der sie scharf beobachtenden Simone Adam die Zunge heraus; sie hatte mit dieser gewettet, daß »es ihr nicht das geringste bedeute, sich zu verheiraten«, und war im besten Zuge zu gewinnen; denn es kam ihr kaum zum Bewußtsein, daß sie selbst es war, die sich verheiratete. Dieser Gedanke machte ihr Spaß. Die anderen gaben sich Haltung für die Galerie. Und die Galerie prüfte genau. Herr Langeais spreizte sich wie ein Pfau; war auch die Liebe zu seiner Tochter noch so aufrichtig, die Hauptsache war ihm doch, sich die Anwesenden zu merken, und nachzuzählen, ob er auch bei den Einladungen niemand vergessen habe. Nur Christof war bewegt; er allein war Eltern, Brautpaar und Standesbeamter in einer Person; er wandte kein Auge von Olivier, der ihn garnicht beachtete.
Am Abend reiste das junge Paar nach Italien. Christof und Herr Langeais begleiteten sie zum Bahnhof. Sie waren offensichtlich glücklich, ohne jeden Abschiedsschmerz, und machten keinerlei Hehl aus ihrer Ungeduld, schnell fortzukommen. Olivier sah wie ein junges Bürschchen aus und Jacqueline wie ein Backfisch ... Welche schwermütige und sanfte Süße liegt über solcher Abreise! Der Vater ist ein wenig traurig, daß ein Fremder seine Kleine fortführt, wohin! ... In jedem Fall für immer weit fort von ihm. Die Jungen aber tragen nur das Gefühl einer berauschenden Befreiung in sich. Das Leben liegt schrankenlos vor ihnen; nichts hemmt sie mehr; es ist ihnen, als seien sie auf dem Gipfel angelangt: jetzt kann man sterben, man hat alles, man fürchtet nichts ... Bald merkt man, daß man nur eine kleine Rast gemacht hat. Der Weg geht weiter und führt um den Berg herum; und gar wenig Menschen gelangen bis zum zweiten Ruheplatz ...
Der Zug trug sie in die Nacht hinaus. Christof und Herr Langeais gingen zusammen zurück. Christof sagte mit naiver Schalkhaftigkeit:
»Nun wären wir also Witwer!«
Herr Langeais lachte. Er hatte Christof gern, nun da er ihn näher kennen gelernt hatte. Man sagte »auf Wiedersehen« und trennte sich. Es war ihnen traurig zumute. Aber eine Süßigkeit mischte sich in diese Trauer. Als Christof in seinem Zimmer allein war, dachte er:
»Mein besseres Ich ist glücklich.«
In Oliviers Zimmer war nichts verändert. Es war zwischen den Freunden ausgemacht worden, daß bis zu Oliviers Rückkehr und dem Einzug in die neue Wohnung seine Möbel und Andenken bei Christof bleiben sollten. Es war, als sei er noch anwesend. Christof betrachtete Antoinettes Bild, stellte es vor sich auf den Tisch und flüsterte ihm zu:
»Bist du zufrieden, Liebe?«
Er schrieb oft – ein wenig zu oft – an Olivier. Von ihm bekam er wenige, zerstreute Briefe, die nach und nach immer abwesender klangen, die ihn enttäuschten, aber nicht gar zu sehr verstimmten. Er sagte sich, daß es so sein müsse; und um die Zukunft ihrer Freundschaft sorgte er sich nicht.
Die Einsamkeit bedrückte ihn nicht. Im Gegenteil, er hätte, wenn es nach ihm gegangen wäre, noch mehr allein sein können. Die Rolle, die das »Grand Journal« als sein Beschützer spielte, begann ihm lästig zu werden. Arsène Gamache redete sich gern ein, er habe ein Eigentumsrecht auf die Berühmtheiten, die zu entdecken er sich die Mühe gemacht hatte: es schien ihm selbstverständlich, daß solche Berühmtheiten sich mit seiner eigenen zusammenschlössen, sowie einst Louis XIV. um seinen Thron Molière, Lebrun und Lulli versammelt hatte. Christof fand, daß der Komponist des »Sanges an Aegir« nicht majestätischer und der Kunst hinderlicher sei, als sein Schutzherr vom »Grand Journal«. Denn der Journalist, der von Kunst nicht mehr verstand als der Kaiser, hatte mindestens ebenso beschränkte Ansichten über Kunst wie dieser. Wenn er etwas nicht leiden mochte, so sprach er ihm die Daseinsberechtigung ab und erklärte das Werk im Interesse des öffentlichen Wohles für schlecht und schädlich. Es war wirklich eine sonderbare und gefährliche Sache um diese Sachwalter, die, selbst ungeschliffen und kulturlos, sich nicht nur die Herrschaft über Kultur anmaßten, sondern auch über den Geist – die ihm als Unterschlupf eine Hundehütte, Halsband und Futter boten, oder, wenn er das zurückwies, die tausend Idioten auf ihn hetzen konnten, die ihre gehorsame Meute bildeten! – Christof war nicht der Mann, sich schulmeistern zu lassen! Er fand es höchst albern, daß ein Esel ihm sagen wollte, was er in der Musik zu tun und zu lassen habe. Und er sprach sich darüber aus, daß man in der Musik etwas besser geschult sein müsse als in der Politik. Er lehnte auch ohne schönrednerische Floskeln das Anerbieten ab, ein ungeschicktes Textbuch in Musik zu setzen, das sein Verfasser, einer der besten Mitarbeiter der Zeitung, gern untergebracht hätte, und das der Chef empfohlen hatte. Diese Angelegenheit versetzte seinen Beziehungen zu Gamache den ersten Stoß. Christof war darüber nicht böse. Kaum war er aus dem Dunkel herausgetreten und schon sehnte er sich danach, wieder darin zu versinken. Er sah sich »jenem grellen Tageslicht ausgesetzt, in dem man sich unter den anderen verliert.« Allzu viele Leute kümmerten sich um ihn. Er mußte an Goethes Worte denken: »Wenn irgend ein guter Kopf die Aufmerksamkeit des Publikums durch ein verdienstliches Werk auf sich gezogen hat, so tut man das Möglichste, um zu verhindern, daß er jemals dergleichen wieder hervorbringt ... Man zerrt das konzentrierte Talent in die Zerstreuung, weil man denkt, man könne von seiner Persönlichkeit etwas abzupfen und sich zueignen.«
Er verschloß seine Tür vor der Außenwelt und kam in seinen eigenen vier Wänden wieder öfter mit ein paar alten Freunden zusammen. Er besuchte auch wieder die Arnauds, die er ein wenig vernachlässigt hatte. Frau Arnaud, die einen Teil des Tages für sich allein war, hatte Zeit, den Kümmernissen anderer nachzusinnen. Sie dachte an die Leere, die Oliviers Fortgang in Christof hervorgerufen haben mußte; und sie überwand die Schüchternheit und lud ihn zu Tisch ein. Wenn sie sich getraut hätte, würde sie sich sogar angeboten haben, von Zeit zu Zeit nach seinem Haushalt zu sehen; aber dazu fehlte ihr der Mut. Und sicher war es besser so: denn Christof liebte es ganz und gar nicht, wenn man sich um ihn kümmerte. Aber er nahm die Einladung zum Essen an und gewöhnte sich daran, abends regelmäßig bei den Arnauds vorzusprechen.
Er fand den kleinen Hausstand noch ebenso harmonisch und in dieselbe Atmosphäre einer etwas trüben, verschlafenen Zärtlichkeit gehüllt, die noch farbloser anmutete als früher. Arnaud machte eine Zeit seelischer Niedergeschlagenheit durch, die sein aufreibender Lehrberuf mit sich brachte; dieses ermüdende Arbeitsleben, das jeden Tag in derselben Weise abläuft, gleicht einem Rade, das, ohne jemals stille zu stehen, ohne jemals vorwärts zu gehen, sich um sich selber dreht. Trotz aller Geduld machte der gute Mann eine Zeit tiefster Entmutigung durch; allerhand Ungerechtigkeiten gingen ihm zu Herzen, er sah bei allem Pflichteifer keinen Erfolg. Frau Arnaud tröstete ihn mit guten Worten; sie schien noch immer so ausgeglichen wie einst, aber sie sah schlechter aus. Christof beglückwünschte Arnaud in ihrer Gegenwart, daß er eine so vernünftige Frau habe.
»Ja,« sagte Arnaud, »sie ist ein gutes Kind; sie läßt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Ein Glück für sie! Und auch für mich! Denn wenn auch sie unter diesem Leben gelitten hätte, wäre ich wohl zugrunde gegangen.«
Frau Arnaud errötete und schwieg. Dann sprach sie mit ihrer sanften Stimme von etwas anderem. Christofs Besuche wirkten wie immer wohltuend; sie verbreiteten Licht. Und auch ihm tat es wohl, die Güte dieser prächtigen Herzen zu fühlen.
Eine andere Freundin trat in sein Leben. Oder vielmehr, er zog sie heran: denn trotz ihrer Wünsche, ihn kennen zu lernen, hätte sie sich doch nicht überwunden, ihn aufzusuchen. Sie war ein junges Mädchen von etwas über fünfundzwanzig Jahren, eine Musikerin, die den ersten Preis für Klavierspiel am Konservatorium bekommen hatte. Sie hieß Cécile Fleury. Sie war ziemlich klein und untersetzt, hatte dichte Augenbrauen, schöne große Augen mit feuchtem Blick, eine kleine dicke, etwas gerötete Stumpfnase, dicke, gute und zärtliche Lippen, ein energisches, festes, volles Kinn, eine niedrige, aber breite Stirn. Die Haare waren im Nacken zu einem dicken Knoten gedreht. Sie hatte starke Arme und große Pianistenhände mit spannfähigem Daumen und breiten Fingerspitzen. Von ihrer ganzen Erscheinung ging der Eindruck etwas schwerfälliger Lebenskraft und derber Gesundheit aus. Sie lebte mit ihrer Mutter zusammen, die sie herzlich liebte, einer guten Frau, die sich nicht im mindesten für Musik interessierte, die aber, weil sie immerfort davon reden hörte, darüber mitsprach und alles wußte, was sich in Musikopolis begab. Cécile führte ein bescheidenes Leben, gab den ganzen Tag über Stunden und manchmal Konzerte, von denen aber niemand Notiz nahm. Sie kehrte dann zu Fuß oder mit dem Omnibus heim und war, wenn auch erschöpft, doch stets bei guter Laune; sie machte ebenso unentwegt ihre Fingerübungen wie ihre Hüte, plauderte viel, lachte gern und sang oft und ohne Grund.
Das Leben hatte sie nicht verwöhnt. Sie wußte ein wenig Bequemlichkeit, die man sich durch eigene Mühe erwirbt, zu schätzen; sie kannte den Wert der Freude an einer kleinen Abwechselung, an einer kleinen, unmerklichen Verbesserung in der Lebenslage oder in ihrem Talent. Ja, wenn sie in einem Monat nur fünf Franken mehr als im vorigen verdiente, oder wenn sie einen Lauf von Chopin endlich gut herausbrachte, an dem sie seit Wochen mühevoll geübt hatte, so war sie zufrieden. Ihre Arbeit, die sie nicht übertrieb, entsprach vollständig ihren Anlagen und verursachte ihr dasselbe Wohlbehagen wie eine vernunftgemäße körperliche Bewegung. Spielen, Singen, Unterrichten verschafften ihr das angenehme Gefühl vollbefriedigter, normaler und regelmäßiger Tätigkeit und zugleich die Mittel zu einem leidlich bequemen Leben und einem ruhigen Erfolg. Sie hatte einen guten Appetit, aß gut, schlief gut und war niemals krank. In ihrer geraden, vernünftigen, bescheidenen, vollkommen ausgeglichenen Sinnesart machte sie sich um nichts Sorge: denn sie lebte ganz in der Gegenwart, ohne sich um Vergangenes und Zukünftiges zu kümmern. Und da sie gesund war und ihr Leben sie verhältnismäßig vor Überraschungen des Schicksals bewahrte, so war sie fast immer zufrieden. Es machte ihr ebenso viel Freude, Klavier zu üben, wie ihre Wirtschaft zu besorgen oder von häuslichen Angelegenheiten zu reden oder gar nichts zu tun. Sie verstand zu leben, dabei nicht etwa in den Tag hinein (sie war sparsam und umsichtig), aber sie genoß von Minute zu Minute. Keinerlei Idealismus machte ihr zu schaffen; der einzige, den sie besaß, war, wenn man so sagen kann, bürgerlich und still über ihr ganzes Tagewerk, über alle ihre Lebensaugenblicke verteilt. Er bestand darin, das, was immer sie tat, gleich gern zu tun. Sonntags ging sie zur Kirche. Aber religiöse Gefühle nahmen fast keinerlei Platz in ihrem Leben ein. Sie bewunderte Feuerseelen wie Christof, die einen Glauben oder ein Genie besitzen; aber sie beneidete sie nicht: was hätte sie auch mit deren steter Unruhe und deren Genie anfangen sollen?
Wie kam es, daß es ihr dennoch möglich war, die Musik solcher Menschen nachzuempfinden? Sie hätte es selbst kaum erklären können. Aber sie wußte jedenfalls, daß sie nachempfand. Sie war den anderen Virtuosen durch ihr robustes körperliches und seelisches Gleichgewicht überlegen. Und gerade in dieser Lebensfülle ohne persönliche Leidenschaften fanden fremde Leidenschaften reichen Boden. Sie selbst wurde davon nicht beunruhigt. Die furchtbaren Leidenschaften, die den Künstler verzehrt hatten, brachte sie in ganzer Kraft zum Ausdruck, ohne von ihrem Gift angesteckt zu werden; sie empfand nur die Kraft und die gesunde, nachfolgende Ermattung. Wenn es vorbei war, saß sie erschöpft und in Schweiß gebadet, lächelte still vor sich hin und war zufrieden. Christof, der sie eines Abends hörte, wurde durch ihr Spiel mitgerissen. Er ging nach dem Konzert zu ihr und schüttelte ihr die Hand. Sie war ihm dankbar dafür: das Konzert war wenig besucht und sie war durch Schmeicheleien nicht verwöhnt. Sie war nicht schmiegsam genug, sich von einer musikalischen Clique anwerben zu lassen, und nicht gerissen genug, einen Troß Bewunderer hinter sich herzuziehen; sie trat nicht in einer besonderen Pose auf, versuchte aber auch nicht, durch irgend welche technischen Kunststücke oder ausgeklügelte Wiedergaben der anerkannten Werke aufzufallen. Sie maßte sich auch nicht das Monopol auf irgend einen großen Meister wie Johann Sebastian Bach oder Beethoven an, da sie deren Geist in keiner Weise theoretisch auslegte, sondern sich damit begnügte, schlecht und recht das zu spielen, was sie fühlte. So machte niemand Aufhebens von ihr, und die Kritiker kümmerten sich nicht um sie; denn niemand hatte ihnen gesagt, daß sie gut spielte; und von selbst merkten sie es nicht.
Christof kam oft mit Cécile zusammen. Dieses starke und ruhige Mädchen zog ihn wie ein Rätsel an. Sie war voller Kraft – und doch träge. Er war so empört, daß sie nicht bekannter war, daß er ihr vorgeschlagen hatte, seine Freunde vom »Grand Journal« zu veranlassen, über sie zu schreiben. Aber, obgleich es ihr recht war, wenn man sie lobte, hatte sie ihn doch gebeten, nichts zu diesem Zwecke zu unternehmen. Sie wollte nicht kämpfen, sich nicht große Mühe machen, keine Eifersüchteleien hervorrufen; sie wollte ihren Frieden haben. Man sprach nicht von ihr. Um so besser! Neid lag ihr fern und sie begeisterte sich als erste für die Technik anderer Virtuosen. Weder Ehrgeiz noch große Wünsche beherrschten sie. Dazu war sie viel zu trägen Sinnes. Wenn sie nicht mit einer bestimmten vor ihr liegenden Sache beschäftigt war, tat sie nichts, einfach nichts. Sie träumte nicht einmal; selbst nicht nachts in ihrem Bett. Sie schlief oder lag gedankenlos da. Sie war nicht in jener krankhaften Weise von dem Gedanken ans Heiraten besessen, die das Leben der Mädchen vergiftet, die vor dem Sitzenbleiben zittern. Wenn man sie fragte, ob sie nicht gerne einen guten Mann hätte, meinte sie:
»Auch noch! Warum nicht gleich fünfzigtausend Franken Zinsen! Man muß es nehmen, wie es kommt. Wenn es einem geboten wird, um so besser! Wenn nicht, geht es auch so. Wenn man keinen Kuchen hat, kann man gutes Brot darum doch gut finden, besonders dann, wenn man lange Zeit hartes gegessen hat.«
Und die Mutter fügte hinzu:
»Wie viele Leute haben selbst das nicht alle Tage.«
Cécile hatte ihre Gründe, den Männern nicht recht zu trauen. Ihr vor einigen Jahren verstorbener Vater war ein schwacher, fauler Mensch gewesen. Er hatte seiner Frau und den Seinen viel Leid zugefügt. Sie hatte auch einen Bruder, der auf Abwege geraten war; man wußte nicht genau, was er trieb: von Zeit zu Zeit tauchte er auf, um Geld zu verlangen. Man fürchtete ihn, schämte sich seiner, ängstigte sich vor dem, was man eines Tages über ihn hören könnte; und doch hatte man ihn lieb. Christof begegnete ihm einmal. Er war gerade bei Cécile; es schellte, die Mutter ging öffnen. Nebenan begann eine Unterhaltung, bei der laute Worte fielen. Cécile wurde dadurch sichtlich aufgeregt, ging ebenfalls hinaus und ließ Christof allein. Der Streit dauerte fort, und die fremde Stimme nahm einen drohenden Ton an; Christof glaubte sich verpflichtet, einzugreifen: er machte die Türe auf. Es blieb ihm kaum Zeit, eines jungen und etwas verwachsenen Menschen ansichtig zu werden, der ihm den Rücken drehte. Cécile lief Christof entgegen und beschwor ihn, sich wieder zu entfernen. Sie ging mit ihm hinaus. Schweigend setzten sie sich nieder. Im Nebenzimmer schrie der Besucher noch ein paar Minuten lang, dann ging er davon und schlug die Türen hinter sich zu. Cécile seufzte auf und sagte zu Christof:
Christof begriff.
»Ach,« sagte er, »ich verstehe, ich habe auch so einen!«
Cécile griff in herzlichem Mitleid nach seiner Hand.
»Sie auch?«
»Ja,« meinte er, »das sind so die Familienfreuden.«
Cécile lachte; und sie sprachen von anderen Dingen. Nein, die Familienfreuden hatten nichts Verlockendes für sie. Und der Gedanke an eine Heirat reizte sie nicht; die Männer taugten nicht viel. Sie wußte, daß ihr unabhängiges Leben sehr viel Gutes hatte: ihre Mutter hatte lange genug nach dieser Freiheit geseufzt. Sie selbst verspürte keine Lust, sie aufzugeben. Das einzige Luftschloß, das sie gern baute, war, eines Tages, später – Gott weiß wann! – keine Stunden mehr zu geben und auf dem Lande leben zu können. Aber sie gab sich nicht einmal Mühe, sich die Einzelheiten dieses Lebens auszumalen: sie fand es langweilig, über etwas so Unbestimmtes nachzudenken; da war Schlafen oder sein Tagewerk tun doch besser ... Solange sie das Luftschloß noch nicht hatte, mietete sie während des Sommers in einem Pariser Vorort ein Häuschen, das sie allein mit ihrer Mutter bewohnte. Man kam mit dem Zuge in zwanzig Minuten dorthin. Die Wohnung lag ziemlich weit ab vom Bahnhof einsam zwischen unbegrenzten Baugeländen, die man »Felder« nannte. Cécile kam oft spät in der Nacht nach Hause. Aber sie hatte keine Furcht. Sie glaubte an keine Gefahr; sie besaß wohl einen Revolver; aber sie vergaß ihn immer zu Haus. Überhaupt hätte sie kaum verstanden, ihn zu gebrauchen. Wenn Christof sie besuchte, veranlaßte er sie zum Spielen. Ihr tiefes Erfassen der Musikstücke machte ihm Freude, vor allem dann, wenn er ihr durch ein Wort den rechten Weg gezeigt hatte, wie dem Gefühl Ausdruck zu geben sei. Er hatte eine wundervolle Stimme in ihr entdeckt, von der sie keine Ahnung hatte. Er hielt sie dazu an, sie auszubilden; er ließ sie alte deutsche Lieder oder seine eigenen Kompositionen singen. Sie fand Gefallen daran und machte Fortschritte, die ihn ebenso sehr wie sie überraschten. Sie war erstaunlich begabt. Wie durch ein Wunder war der musikalische Funke in die Seele dieses Kindes einer Pariser Kleinbürgerfamilie gefallen, die jeder künstlerischen Empfindung bar gewesen war. Philomele (so nannte er sie) plauderte manchmal über musikalische Dinge mit Christof, aber immer praktisch, niemals gefühlsmäßig. Sie schien sich nur für Klavier- und Gesangstechnik zu interessieren. Wenn sie zusammen waren und keine Musik trieben, redeten sie meistens von den spießbürgerlichsten Dingen: vom Haushalt, von der Küche, vom täglichen Leben. Und Christof, der diese Unterhaltungen mit einer Hausfrau nicht eine Minute ausgehalten hätte, fand sie mit Philomele ganz natürlich.
So verbrachten sie ganze Abende allein miteinander und hatten sich in einer ruhigen, fast kühlen Zuneigung aufrichtig lieb. Eines Abends, als er zum Essen gekommen war und sich länger als gewöhnlich verplaudert hatte, brach ein heftiges Gewitter los. Als er gehen wollte, um den letzten Zug zu erreichen, tobten Regen und Wind; da sagte sie zu ihm:
»Aber Sie werden doch nicht fortgehen wollen! Sie fahren einfach morgen früh.«
Er richtete sich in dem kleinen Wohnzimmer auf einem schnell zurechtgemachten Lager ein. Eine dünne Tapetenwand trennte ihn von Céciles Schlafkammer. Die Türen schlossen nicht. Er hörte von seinem Bett aus das Bett im Nebenzimmer krachen und den ruhigen Atem des jungen Weibes. Nach fünf Minuten war sie eingeschlafen; und ihm ging es genau so, ohne daß der Schatten eines beunruhigenden Gedankens sie auch nur einen Augenblick gestreift hätte.
Um dieselbe Zeit fand er noch andere neue Freunde, die sich durch seine Werke allmählich zu ihm hingezogen fühlten. Die meisten lebten abgeschlossen fern von der Stadt und wären ihm sonst wohl nie begegnet. Ein, wenn auch nur äußerer, Erfolg hat immerhin sein Gutes: er führt dem Künstler Tausende braver Leute zu, die er ohne die dummen Zeitungsartikel niemals kennen gelernt hätte. Zu einigen von ihnen trat Christof in nähere Beziehung. Es waren einsam lebende junge Leute, die ein mühevolles Dasein führten, mit ihrem ganzen Wesen irgend ein unbestimmbares Ideal erstrebten und nun gierig die verwandte Seele Christofs in sich einsogen. Junge, unbedeutende Provinzler waren darunter, die ihm, nachdem sie seine Lieder gelesen, gleich dem alten Schulz schrieben, weil sie sich eines Sinnes mit ihm fühlten. Arme Künstler waren es, – unter anderen auch ein Komponist – die nichts erreicht hatten, die auch nichts erreichen konnten, weder einen Erfolg noch einen eigenen Ausdruck, und die glücklich waren, weil sie nun ihre Gedankenwelt durch Christof verwirklicht sahen. Und die liebsten von allen waren ihm vielleicht die, die ihm ohne Unterschrift schrieben, und dadurch unbefangener, in rührendem Vertrauen dem hilfreichen älteren Bruder kindlich ihr Herz ausschütteten. Der Gedanke tat ihm weh, daß er diese lieben Menschen, die er so gern in sein Herz geschlossen hätte, niemals kennen lernen würde. Und er küßte manchen dieser unbekannten Briefe, wie die, die sie geschrieben, seine Lieder geküßt hatten; jeder dachte für sich:
»Teure Blätter, wie wohl habt ihr mir getan!«
So schloß sich um Christof nach dem rhythmischen Gesetz des Weltalls ein Kreis verwandter Seelen, der sich um das Genie schart, sich von ihm nährt und es stärkt, der nach und nach anwächst und schließlich eine große Kollektivseele bildet, deren Feuerkern er ist, gleich einem Sternenkreis, einem seelischen Planeten, der im Weltenraum der Sonne zustrebt und seinen brüderlichen Chor der Harmonie der Sphären entgegenführt.
Je fester solche geheimnisvollen Bande zwischen Christof und seinen unsichtbaren Freunden wurden, um so mehr gestalteten sich seine künstlerischen Gedanken von Grund auf um, wurden umfassender, menschlicher. Er wollte nichts mehr wissen von einer Musik, die einem Selbstgespräch glich, einer Rede, die nur an und für sich etwas gilt, und noch weniger von einem gelehrten Gebilde, das einzig und allein für Fachleute bestimmt ist. Er wollte, daß sie eine Gemeinschaft bilde unter den Menschen. Nur eine lebensfähige Kunst teilt sich den anderen mit. Johann Sebastian Bach war in den schlimmsten Stunden seiner Vereinsamung mit den anderen Menschen durch seinen religiösen Glauben verbunden, den er in seiner Kunst zum Ausdruck brachte. Händel und Mozart schrieben gezwungenermaßen für ein Publikum, und nicht für sich allein. Selbst Beethoven mußte mit der Menge rechnen. Das ist heilsam. Es ist gut, wenn die Menschheit von Zeit zu Zeit dem Genie zuruft: »Was bringst du mir mit deiner Kunst? Wenn du nichts für mich hast, so geh!«
Bei solchem Zwang gewinnt vor allem das Genie. Allerdings gibt es auch große Musiker, die nur sich selbst ausdrücken. Aber die größten von allen sind die, deren Herz für alle schlägt. Wer den lebendigen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen will, soll ihn nicht am leeren Firmament seiner Gedankenwelt suchen, sondern in der Menschenliebe.
Die Künstler von heute waren weit entfernt von dieser Liebe. Sie schrieben nur für eine eitle, mehr oder weniger anarchistisch gesinnte Auslese, die keine Wurzeln mehr im sozialen Leben hatte und ihre Ehre darein setzte, die Vorurteile und Leidenschaften der übrigen Menschheit nicht mehr zu teilen oder ihr Spiel damit zu treiben. Ein schöner Ruhm, sich aller Lebenswerte zu berauben, nur um den anderen nicht ähnlich zu sein! Sie mögen sich begraben lassen! Wir anderen wollen uns den Lebenden zugesellen, wollen an der Erde Brüsten trinken, wollen teilhaben an allem Tiefsten und Heiligsten unserer stammverwandten Geschlechter, an ihrer Liebe zur Familie und zum Heimatboden. In den freiheitlichsten Jahrhunderten, in dem Volk, das den lebendigsten Schönheitskultus trieb, verherrlichte der junge Fürst der italienischen Renaissance, Raffael, die Mütterlichkeit in seinen römischen Madonnen. Wer bringt uns heute eine »Madonna della Sedia« in der Musik? Wer schafft uns eine Musik für alle Stunden unseres Lebens? In Frankreich gibt es nichts, nichts dergleichen. Wenn ihr eurem Volke Lieder geben wollt, seht ihr euch gezwungen, die Musik der alten deutschen Meister zu stehlen. Von A bis Z ist in eurer Kunst alles neu zu schaffen oder umzuschaffen.
Christof stand mit Olivier, der jetzt in einer Provinzstadt lebte, in Briefwechsel. Er suchte durch Briefe die Zusammenarbeit zwischen ihnen aufrecht zu erhalten, die während der Monate ihres gemeinsamen Lebens so fruchtbar gewesen war. Er hätte gerne von ihm schöne dichterische Texte gehabt, die sich dem Gedankenkreis und dem Tun des Alltags anpassen, gleich jenen, die den Stoff der alten deutschen Lieder vergangener Tage bilden. Er suchte nach kurzen Stücken aus der heiligen Schrift, aus den Dichtungen der Hindus, den alten griechischen Philosophen, nach kleinen religiösen oder lehrhaften Oden, kleinen Bildern aus der Natur, Regungen der Liebe oder des Familiengefühles, nach Morgen-, Abend- und Nachtgesängen für schlichte und gesunde Herzen. Vier oder sechs Zeilen für ein Lied, das genügt; die einfachsten Ausdrücke, ohne gelehrten Aufputz, und keine überfeinerten Harmonien. Was habe ich mit euern Ästhetenmätzchen zu schaffen? Liebt mein Leben, helft mir, es zu lieben und es zu leben. Gemeinsam wollen wir den klarsten Melodiensatz suchen. Fliehen wir wie die Pest die Künstlersprache einer Kaste, deren sich heute so viele Künstler und vor allem so viele französische Musiker bedienen. Es gilt, den Mut zu haben, als Menschen und nicht als »Künstler« zu reden. Aus den Tiefen, die allen gemeinsam sind, muß man schöpfen und ohne falsche Scham die herkömmlichen Formeln brauchen, denen die Jahrhunderte ihren Stempel aufgedrückt und die sie mit ihrer Seele erfüllt haben. Sieh an, was unsere Väter schufen. Aus der Rückkehr zur musikalischen Sprache Aller entstand die Kunst der deutschen Klassiker am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Die melodieerfüllten Tonsätze Glucks, der Schöpfer von Symphonien, der Liederkomponisten jener Zeit, sind manchmal gewöhnlich und spießbürgerlich im Vergleich zu den überfeinerten oder gelehrten Sachen Bachs oder Rameaus. Doch dieser Erdgeruch ist es gerade, der den großen Klassikern die Kraft und die ungeheuere Volkstümlichkeit gegeben hat. Sie sind von den einfachsten musikalischen Formen ausgegangen: vom Lied, vom Singspiel. Diese kleinen Blumen des Alltags haben die Kindheit eines Mozart oder eines Weber mit ihrem Duft erfüllt. – Macht es ebenso, schreibt Lieder für jedermann! Darauf könnt ihr dann Quartette und Symphonien aufbauen. Was nützt es, Zwischenstufen zu überspringen? Man beginnt den Bau einer Pyramide nicht mit der Spitze. Eure heutigen Symphonien sind Köpfe ohne Leib, Gedanken ohne Eingeweide! – O, ihr Schöngeister, werdet Fleisch! Uns tun Generationen duldsamer Musiker not, die sich fromm und fröhlich mit Ihrem Volk verbrüdern. In einem Tage wird die Kunst der Musik nicht geschaffen.
Es genügte Christof nicht, solche Prinzipien für die Musik aufzustellen; er regte Olivier an, sich an die Spitze einer ähnlichen Bewegung in der Literatur zu stellen. Die heutigen Schriftsteller, sagte er, bemühen sich, das menschlich Seltsame zu beschreiben, oder häufig vorkommende Fälle in anormalen Kreisen, die außerhalb der großen Gesellschaft tätiger und gesunder Menschen stehen. Da sie sich selbst vor die Türe des Lebens gestellt haben, laß sie und geh dorthin, wo Menschen sind. Dem Alltagsmenschen zeige das Alltagsleben: es ist tiefer und weiter als das Meer. Der Geringste unter uns trägt die Unendlichkeit in sich. Die Unendlichkeit lebt in jedem Menschen, der einfach genug ist, Mensch zu sein als Geliebter, als Freund, als Frau, die mit ihren Schmerzen die Strahlenglorie der Menschwerdung bezahlt, – sie lebt in allen, die sich in der Verborgenheit aufopfern und von denen nie jemand etwas wissen wird; das ist die Flut des Lebens, die von einem zum anderen, vom anderen zum einen strömt ... Schreibe das schlichte Leben eines jener schlichten Menschen, schreibe das ruhige Opus der Tage und der Nächte, die einander folgen, die als Söhne der selben Mutter einander gleichen und sich doch voneinander unterscheiden, wie es seit Anbeginn der Welt gewesen ist. Schreibe es einfach, so wie es sich abrollt. Mühe dich nicht um den Ausdruck, um gesuchte Feinheiten, in denen sich die Kraft der heutigen Künstler erschöpft. Du redest zu allen: so brauche auch die Sprache aller. Es gibt weder edle, noch gewöhnliche Worte. Es gibt weder einen geschliffenen, noch einen unreinen Stil; es gibt nur Menschen, die genau das sagen, was sie zu sagen haben, und solche, die es nicht tun. Sei mit deinem ganzen Wesen in allem, was du tust: denke was du denkst, und fühle was du fühlst. Der Rhythmus deines Herzens soll deine Schriften mitreißen! Der Stil ist die Seele!«
Olivier gab Christof recht; aber er antwortete mit einiger Ironie. »Solch ein Werk würde schön sein; aber es würde niemals bis zu denen gelangen, die es zu lesen verständen. Die Kritik würde es unterwegs ersticken.«
»Daran erkenne ich den französischen Kleinbürger!« antwortete Christof, »ihm ist es um das zu tun, was die Kritik von seinem Buch denken oder nicht denken könnte ... Die Kritiker, mein Lieber, sind nur dazu da, den Sieg oder die Niederlage zu buchen. Sei nur erst Sieger ... Ich bin recht gut ohne sie ausgekommen, lerne du es auch!«
Aber Olivier hatte noch ohne ganz andere Dinge auszukommen gelernt! Ohne die Kunst, ohne Christof und die ganze übrige Welt. Er dachte im Augenblick an nichts anderes mehr als an Jacqueline. Und Jacqueline dachte an nichts als an ihn.
Ihre selbstsüchtige Liebe hatte rings um sie eine Leere geschaffen. Ohne Vorbedacht verbrannte sie alle künftigen Hilfsmittel. O, Liebesrausch der ersten Wochen, wenn die miteinander verschmolzenen Wesen nichts anderes ersehnen, als einer im anderen aufzugehen. Alle Fibern ihrer Körper und ihrer Seelen berühren sich, genießen sich, suchen einander zu durchdringen. Sie sind in sich ein gesetzloses Universum, ein liebendes Chaos, in dem die umeinander kreisenden Kräfte noch nicht wissen, was sie voneinander scheidet, und sich gierig zu verzehren trachten. Alles entzückt sie im anderen: der andere ist man selbst. Was soll ihnen die Welt? Wie dem antiken Androgyn, den ein Traum reiner Wonne umfängt, sind ihre Augen für die Welt geschlossen. Die ganze Welt ist in ihnen.
O, Tage! o, Nächte! die ein einziges Traumgewebe bilden, Stunden, die dahinfließen gleich schönen weißen Wolken, die über den Himmel streichen und von denen nichts in das Bewußtsein emportaucht als im geblendeten Blick eine leuchtende Spur, ein sanfter Hauch, der mit Frühlingssehnen erfüllt, – o, strahlende Wärme der Körper, sonnige Liebeslaube – keusche Schamlosigkeit, Umarmungen, Tollheiten, Seufzer, glückliches Lachen, selige Träume, was bleibt von euch, ihr Staubkörner des Glückes? Kaum, daß das Herz sich eurer erinnern kann; denn als ihr waret, war die Zeit ausgeschaltet.
Ihr Tage, die ihr alle einander gleicht ... süßer Morgenbeginn ... Gleichzeitig tauchen aus dem Abgrund des Schlafes die beiden verschlungenen Körper empor; die lächelnden Häupter, deren Atem sich mischt, öffnen gemeinsam die Augen, schauen sich an und küssen sich ... Junge Frische der Morgenstunden, jungfräuliche Luft, in der sich das Fieber der glühenden Leiber kühlt ... wonnevolle Benommenheit der endlosen Tage, in denen die Wonne der Nächte summt ... Sommernachmittage, Träumereien in Feldern, auf samtenen Wiesen, unter dem Rascheln der hohen weißseidenen Pappeln ... Schöne Abende, wenn man verträumt, mit verschlungenen Armen, mit verschlungenen Händen unter dem leuchtenden Himmel heimkehrt zum Liebeslager. Die Zweige der Büsche schauern im Wind. Im lichten See des Himmels schwimmt gleich weißem Flaum der silberne Mond. Ein Stern fällt nieder und stirbt, – ein Schauer durchrinnt das Herz, – geräuschlos verlosch eine Welt. Ab und zu huschen, eilig und stumm, Schatten auf ihrem Wege vorüber. Die Glocken der Stadt läuten zum Fest des morgigen Tages. Sie bleiben ein Weilchen stehen, sie drängt sich an ihn, sie verharren ohne ein Wort ... Ach, bliebe doch das Leben so stehen reglos wie diese Sekunde! ... Sie seufzt, und sie sagt:
»Warum nur lieb ich dich so? ...«
Nach einigen Reisewochen in Italien hatten sie sich in einer Stadt im Osten Frankreichs niedergelassen, in der Olivier eine Anstellung als Oberlehrer gefunden hatte. Sie sahen fast niemanden. Sie nahmen an nichts teil. Als sie gezwungenermaßen einige Besuche machen mußten, trat ihre Gleichgültigkeit so unverhohlen zutage, daß sich die einen dadurch verletzt fühlten, die anderen darüber lächelten. Alle Worte glitten an ihnen ab, ohne bis zu ihnen zu dringen. Sie traten mit jener unverschämten Wichtigkeit jungverheirateter Leute auf, die immer zu sagen scheinen:
»Ihr anderen wißt überhaupt nichts.«
Auf Jacquelines hübschem, verträumtem, ein wenig schmollendem Gesichtchen, in Oliviers glücklichen, zerstreut dreinschauenden Augen konnte man es lesen:
»Wenn ihr wüßtet, wie ihr uns langweilt! Wann werden wir wieder allein sein?«
Selbst, wenn sie mitten unter anderen waren, taten sie so völlig zwanglos, als wären sie allein. Man fing ihre Blicke auf, die über die Unterhaltung fort zueinander sprachen. Sie brauchten sich nicht einmal anzuschauen, um sich zu sehen; und sie lächelten; denn sie wußten, daß sie zu gleicher Zeit an dasselbe dachten. Wenn sie dann, nach irgend einem gesellschaftlichen Zwang, wieder allein waren, stießen sie Rufe des Entzückens aus und vollführten tausend Kindertorheiten. Sie benahmen sich, als wären sie acht Jahre. Sie plauderten wie die Kinder. Sie gaben sich drollige Vornamen. Sie nannte ihn: Olive, Olivet, Olifant, Fanny, Mami, Mime, Minaud, Qinaud, Kaunitz, Cosimo, Koburg, Panot, Nacot, Ponette, Naquet und Canot.
Sie gebärdete sich wie ein kleines Mädchen. Und doch wollte sie alle Liebe in sich vereinigen, ihm alles zugleich sein: Mutter, Schwester, Frau, Liebende und Geliebte. Sie gab sich nicht damit zufrieden, teil zu haben an seiner Freude, sie hatte sich vorgenommen, auch teil zu haben an seiner Arbeit; aber auch das war ein Spiel. In der ersten Zeit setzte sie den freudigen Eifer einer Frau ein, für die Arbeit etwas Neues ist: es war, als machten ihr gerade die undankbarsten Aufgaben am meisten Spaß, z. B. Abschriften in Bibliotheken, Übersetzungen langweiliger Bücher: alles das gehörte zu ihrem Lebensplan, zu ihrem unendlich reinen und höchst ernsthaften Lebensplan, der ganz und gar nur hohen Gedanken und gemeinsamer Arbeit gewidmet sein sollte. Und das ging ausgezeichnet, solange die Liebe in ihnen leuchtete: denn sie dachte nur an ihn und nicht an das, was sie tat. Das Sonderbarste war, daß alles, was sie auf diese Art machte, gut war. Ihr Geist erging sich ohne jede Anstrengung in abstrakten Abhandlungen, denen sie zu einer anderen Zeit ihres Lebens nur mit Mühe hätte folgen können; ihr Wesen war durch die Liebe gleichsam über die Erde emporgehoben; sie merkte davon nichts: wie eine Schlafwandlerin, die über die Dächer geht, folgte sie ruhig, ohne etwas zu sehen, ihrem feierlichen und lächelnden Traumbild.
Dann sah sie plötzlich die Dächer; das erschreckte sie aber durchaus nicht; doch sie stellte sich die Frage, was sie denn da oben wolle, und sie kehrte heim ... Die Arbeit langweilte sie. Sie redete sich ein, daß ihre Liebe dadurch gestört werde. Sicher nur, weil ihre Liebe schon weniger stark war. Aber man merkte davon nichts. Sie konnten keinen Augenblick einander entbehren. Sie vermauerten sich vor der Welt, sie verrammelten ihre Türen, sie nahmen keinerlei Einladungen mehr an. Sie waren eifersüchtig auf die Zuneigung anderer Menschen, sogar auf ihre Beschäftigungen, kurz auf alles, was sie von ihrer Liebe ablenkte. Der Briefwechsel mit Christof wurde unregelmäßig. Jacqueline mochte ihn nicht leiden; er war für sie ein Nebenbuhler, er stellte einen ganzen Abschnitt in Oliviers Vergangenheit dar, woran sie keinen Anteil hatte. Und je mehr Raum er in Oliviers Leben eingenommen hatte, um so mehr suchte sie triebhaft, ihn ihm streitig zu machen. Ohne bestimmte Berechnung löste sie Olivier heimlich von seinem Freunde los; sie machte sich über Christofs Wesen, sein Gesicht, seine Schreibweise, seine Künstlerpläne lustig. Sie tat es ohne Bosheit, sogar ohne listige Absicht; die gute Natur besorgte das für sie. Olivier machten ihre Bemerkungen Spaß. Er fand nichts Schlimmes darin. Er glaubte, Christof noch immer wie früher zu lieben; aber er liebte nur noch seine Persönlichkeit: und das bedeutet in der Freundschaft nicht viel. Er merkte nicht, daß er allmählich aufhörte, ihn zu verstehen, daß er an seiner Gedankenwelt, an dem heldischen Idealismus, durch den sie sich verbunden gefühlt hatten, keinen Anteil mehr nahm ... Die Liebe besitzt für ein junges Herz eine allzu berauschende Süße. Welcher andere Glaube könnte neben ihr standhalten? In dem Körper der Geliebten, in ihrer Seele, die man, wie eine Blume, von dem geheiligten Leibe pflückt, liegen alle Wissenschaft und aller Glaube beschlossen. Mit welchem Mitleidslächeln betrachtet man das, was andere über alles lieben, was man selbst früher über alles liebte! Von dem mächtigen Leben und seiner herben Kraftentfaltung sieht man nichts mehr als die Blüte einer Stunde, die man unsterblich glaubt ... Olivier war von der Liebe ganz und gar besessen. Anfangs fand sein Glück noch die Kraft, sich in anmutigen Gedichten auszusprechen. Dann erschien ihm auch das müßig. Schade um die Zeit, die man dadurch der Liebe stahl! Und Jacqueline wetteiferte mit ihm darin, ihm jeden anderen Daseinsgrund zu zerstören, den Baum des Lebens abzutöten, ohne dessen Halt der Efeu der Liebe stirbt. So richteten sie sich beide im Glück zugrunde.
Ach, man gewöhnt sich so schnell an das Glück! Wenn selbstsüchtiges Glück der einzige Lebenszweck ist, wird das Leben schnell zwecklos. Es wird zur Gewohnheit, zu einem Gift, das man nicht mehr entbehren kann. Und wie nötig wäre es doch, daß man es entbehrte! ... Das Glück ist ein Augenblick im Weltenrhythmus. Einer der Pole, zwischen denen die Wage des Lebens hin- und herschwankt; wollte man die Wage anhalten, so müßte man sie zerbrechen.
Sie lernten ihn kennen: »jenen Überdruß am Wohlbefinden, der die Gefühlsfähigkeit überspannt.« Die holden Stunden schlichen langsamer dahin, wurden matt und welk, gleich Blumen ohne Wasser. Noch war der Himmel immer blau; aber die frische Morgenluft wehte nicht mehr. Alles war leblos; die Natur schwieg. Sie waren allein, wie sie sich's gewünscht hatten. Und ihr Herz wurde beklommen.
Ein undeutbares Gefühl von Leere, eine unbestimmte Langeweile, die nicht ohne Reiz war, bemächtigte sich ihrer. Sie konnten es sich nicht deuten; dunkel wurden sie davon beunruhigt. Sie waren krankhaft reizbar. Ihre Nerven, die nur gewöhnt waren, der Stille zu lauschen, schauerten wie Blätter beim geringsten unvorhergesehenen Hauch des Lebens. Jacqueline zerfloß in Tränen, ohne Grund zum Weinen zu haben; und wenn sie es auch gern geglaubt hätte: die Liebe war nicht mehr die einzige Ursache. Nachdem sie die sehnsuchtsvollen und durchquälten Jahre, die ihrer Heirat vorausgegangen waren, überwunden sah, wurde sie durch das plötzliche Aufhören ihrer Sehnsucht nach dem erreichten und auch schon überschrittenen Ziel, durch die plötzliche Nichtigkeit jeder neuen Anspannung – und vielleicht auch jeder vergangenen – in eine Verwirrung gestürzt, die sie sich nicht zu erklären vermochte und die sie entsetzte. Sie wollte sie sich nicht eingestehen; sie schrieb sie einer nervösen Abspannung zu, sie gab sich Mühe, darüber zu lachen; aber ihr Lachen war nicht weniger gereizt als ihre Tränen. Tapfer versuchte sie es von neuem mit der Arbeit. Aber schon bei dem ersten Versuch begriff sie nicht einmal mehr, wie sie fähig gewesen war, sich für derartig dumme Aufgaben zu erwärmen: widerwillig schob sie sie beiseite. Sie nahm einen Anlauf, um wieder gesellschaftliche Beziehungen anzuknüpfen: es gelang ihr ebensowenig. Unabänderlich stand fest, daß sie sich von den Leuten und von dem minderwertigen Gerede, zu dem das Leben verpflichtet, entwöhnt hatte: sie fand beides widersinnig. Und sie flüchtete in ihre gemeinsame Abgeschlossenheit zurück und suchte in diesen unglücklichen Versuchen den Beweis zu finden, daß es wirklich nichts Besseres als die Liebe gäbe. Und für einige Zeit schien sie wirklich liebeerfüllter zu sein als je. Aber es kam daher, weil sie es sein wollte.
Der weniger leidenschaftliche und an Zärtlichkeiten reichere Olivier war vor solchen Angstzuständen eher geschützt; nur ab und zu empfand er einen unbestimmten Schauer. Im übrigen wurde seine Liebe bis zu einem gewissen Grade durch den Zwang seiner täglichen Beschäftigung, durch seinen Beruf, den er nicht schätzte, bewahrt. Aber da er sehr feinfühlig war, und da alle Regungen des geliebten Herzens auch sein Herz erfüllten, übertrug sich Jacquelines geheime Unruhe auch auf ihn.
An einem schönen Nachmittag wanderten sie zusammen über Land. Sie hatten sich schon im voraus auf den Spaziergang gefreut. Alles rings um sie her atmete Fröhlichkeit. Aber gleich bei den ersten Schritten senkte sich ein Gefühl matter, dumpfer Schwermut auf sie nieder; sie fühlten sich erstarren, fanden keine Möglichkeit, miteinander zu reden. Trotzdem zwangen sie sich dazu; aber jedes Wort, das sie sagten, ließ nur die Leere widertönen, in der sie gingen. Automatisch machten sie ihren Spaziergang zu Ende, ohne irgend etwas zu sehen oder zu fühlen. Mit schwerem Herzen kehrten sie heim. Der Abend dämmerte; die Wohnung war leer, dunkel und kalt. Sie zündeten nicht sogleich Licht an, um sich selbst nicht zu sehen. Jacqueline ging in ihr Zimmer; anstatt Hut und Mantel abzunehmen, setzte sie sich stumm ans Fenster. Olivier setzte sich ins Nebenzimmer und stützte die Arme auf den Tisch. Die Türe zwischen den beiden Zimmern war offen; sie waren einander so nahe, daß sie ihren Atem hätten hören können. Und in dem stillen Halbdunkel weinten sie beide bitterlich. Sie preßten die Hand gegen den Mund, damit man nichts höre. Schließlich sagte Olivier beklommen:
»Jacqueline!«
Jacqueline schluckte die Tränen hinunter und sagte:
»Wie?«
»Kommst du?«
»Ich komme.«
Sie kleidete sich aus, sie kühlte sich die Augen. Er zündete die Lampe an. Nach einigen Minuten kam sie ins Zimmer. Sie sahen sich nicht an; sie wußten, daß sie geweint hatten. Und sie konnten sich nicht trösten; denn sie wußten, warum. Der Augenblick kam, wo sie ihren Kummer nicht mehr verbergen konnten. Und da sie sich die wahre Ursache nicht eingestehen wollten, suchten sie nach einer anderen, die zu finden ihnen nicht schwer fiel. Sie gaben der Langweile des Provinzlebens und der Umgebung, in der sie sich befanden, die Schuld. Das brachte ihnen Erleichterung. Herr Langeais, den seine Tochter verständigt hatte, war nicht allzu sehr überrascht, daß sie anfing, des Heldentums müde zu werden. Er machte sich seine guten politischen Beziehungen zu Nutze und erreichte die Berufung seines Schwiegersohnes nach Paris.
Als die gute Botschaft eintraf, hüpfte Jacqueline vor Freude und fand ihr ganzes früheres Glück wieder. Jetzt schien ihnen das öde Stückchen Erde, das sie verlassen sollten, wieder vertraut; sie hatten so unendlich viel Liebeserinnerungen darein gesät! Die letzten Tage brachten sie damit hin, den alten Spuren wieder zu folgen. Eine sanfte Wehmut umschwebte diesen Pilgergang. Diese stille Gegend hatte sie glücklich gesehen. Eine innere Stimme flüsterte ihnen zu:
»Du weißt, was du verläßt. Weißt du, was du finden wirst?«
Am Abend vor der Abreise weinte Jacqueline.
Olivier fragte sie, warum. Sie wollte nicht reden. Dann nahmen sie ein Stück Papier und schrieben, wie sie es gewöhnlich taten, wenn der Klang der Worte ihnen Furcht einflößte:
»Mein lieber kleiner Olivier!«
»Meine liebe kleine Jacqueline!«
»Es tut mir leid, zu gehen.«
»Von wo zu gehen?«
»Von da, wo wir uns geliebt haben.«
»Und wohin zu gehen?«
»Dahin, wo wir nicht mehr so jung sein werden.«
»Wo wir beisammen sein werden.«
»Aber nie wieder so in Liebe.«
»Immer mehr.«
»Wer weiß!«
»Ich weiß es!«
»Und ich will es.«
Dann machten sie zwei kleine Kreise unten auf das Papier, was einen Kuß bedeuten sollte. Und dann trocknete sie sich die Tränen ab, lachte und putzte ihn wie einen jener Günstlinge Heinrichs III. heraus: sie setzte ihm ihre Mütze auf und hüllte ihn in ihren weißen Umhang mit dem hochgeschlagenen Kragen, so daß er wie in einer Halskrause steckte.
In Paris fanden sie die Menschen wieder, die sie verlassen hatten, aber nicht so, wie sie sie verlassen hatten. Christof kam auf die Nachricht von Oliviers Ankunft freudestrahlend herbeigelaufen, Olivier empfand die gleiche Wiedersehensfreude wie er. Aber gleich bei den ersten Blicken empfanden sie eine unerwartete Verlegenheit. Beide versuchten, dagegen anzukämpfen. Vergeblich. Irgend etwas hatte sich in Olivier verändert. Und Christof fühlte es. Ein Freund, der sich verheiratet, kann tun, was er will: er ist doch nicht mehr der alte Freund. Der Seele des Mannes ist jetzt beständig die Seele der Frau zugesellt. Christof witterte sie überall in Olivier: in einem unmerklichen Schimmer seines Blickes, im leisesten Kräuseln seiner Lippen, das er bisher an ihm nicht gekannt hatte, in jeder neuen Biegung seiner Stimme und seines Gedankenganges. Olivier war sich dessen nicht bewußt; aber er wunderte sich, wie verschieden der jetzige Christof von dem früheren war. Er ging allerdings nicht so weit, zu glauben, Christof habe sich verändert; er gab wohl zu, daß in ihm selbst sich diese Umwandlung vollzogen habe; aber das schien ihm eine normale, seinem Alter entsprechende Entwickelung zu sein; und er war erstaunt, bei Christof nicht denselben Fortschritt zu finden. Er warf ihm vor, in den Gedanken erstarrt zu sein, die ihnen einst wohl teuer gewesen waren, die ihm aber heute kindisch und altmodisch erschienen. Das kam jedoch nur daher, weil diese Gedanken nicht dem Wesen jener fremden Seele entsprachen, die, ohne daß er es ahnte, sich in ihm eingenistet hatte. Dieses Gefühl verdeutlichte sich, wenn Jacqueline der Unterhaltung beiwohnte: dann senkte sich zwischen Oliviers und Christofs Augen ein Schleier von Ironie. Allerdings versuchten sie, sich ihre Empfindungen zu verbergen. Christof kam weiter ins Haus. Jacqueline versetzte ihm hin und wieder in ihrer Unschuld einige boshafte und widerhakige Nadelstiche. Er ließ es sich gefallen. Aber wenn er heimkehrte, war er niedergeschlagen.
Die ersten Monate in Paris wurden zu einer recht glücklichen Zeit für Jacqueline und deshalb auch für Olivier. Zunächst war sie mit ihrer Einrichtung beschäftigt. Sie hatten in einer alten Straße in Passy eine freundliche kleine Wohnung gefunden, die auf ein Viereck von Gärten ging. Die Auswahl der Möbel und Tapeten bot für ein paar Wochen eine hübsche Beschäftigung. Jacqueline verwandte darauf eine Unsumme von übertriebener, ja fast leidenschaftlicher Energie: es war, als hinge ihre ewige Seligkeit von der Farbenabstufung eines Vorhanges oder dem Profil irgend einer alten Truhe ab. Dann nahm sie den Verkehr mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Freundinnen wieder auf; da sie diese während ihres Liebesjahres vollständig vergessen hatte, wurde das eine wahre Neuentdeckung für sie; um so mehr, als ihre Seele, in dem Maße, wie sie sich mit der Oliviers verschmolzen, auch ein wenig von Olivier in sich aufgenommen hatte, und sie sah daher ihre alten Freunde mit ganz neuen Augen an. Sie schienen ihr sehr zum Vorteil verändert. Olivier verlor dabei zunächst nicht allzuviel. Sie dienten einander zur Folie. Die sittliche Sammlung, das poetische Helldunkel in ihrem Gefährten ließen Jacqueline mehr Vergnügen an diesen Weltmenschen finden, die nichts anderes wollten, als das Leben genießen, als glänzen und gefallen. Und die verführerischen, aber gefährlichen Fehler dieser Welt, die sie um so besser kannte, als sie ihr angehörte, machten ihr die Zuverlässigkeit ihres Freundes besonders wertvoll. Sie hatte viel Freude an diesen Vergleichen und übertrieb sie gerne, um sich damit die Richtigkeit ihrer Wahl zu beweisen. Sie übertrieb das so sehr, daß ihr in manchen Augenblicken nicht mehr recht klar war, warum sie gerade diese Wahl getroffen hatte. Glücklicherweise dauerten solche Überlegungen nicht lange, und da sie Gewissensbisse darüber empfand, war sie sogar niemals so zärtlich mit Olivier, wie gerade nach solchen Momenten. Aber gerade darum begann sie damit bald wieder von neuem. Durch die Gewohnheit hatte sie jedoch auch daran bald keine Freude mehr, und die Vergleiche forderten einander immer ernsthafter heraus: anstatt sich zu ergänzen, bekämpften sich die beiden gegensätzlichen Welten. Sie fragte sich, warum Olivier nicht die guten Eigenschaften oder, besser gesagt, etwas von den Fehlern besäße, die sie jetzt an ihren Pariser Freunden so angenehm empfand. Sie sagte ihm das nicht; aber Olivier fühlte den unnachsichtig beobachtenden Blick seiner Gefährtin; und er wurde davon beunruhigt und gequält. Zwar hatte er noch nicht die Macht über Jacqueline verloren, die ihm die Liebe gab; und die junge Ehe hätte noch ziemlich lange in ihrer zärtlichen und tätigen Gemeinsamkeit fortbestehen können, wenn nicht besondere Umstände die äußeren Lebensbedingungen verändert und dadurch ihr schwankendes, leicht zu störendes Gleichgewicht erschüttert hätten. » Quivi trovammo Pluto il gran nemico ...«
Eine Schwester von Frau Langeais starb. Sie war die Witwe eines reichen Industriellen und hatte keine Kinder. Ihr ganzes Hab und Gut ging an Langeais über. Jacquelines Vermögen wurde dadurch mehr als verdoppelt. Als die Erbschaft eintraf, mußte Olivier an Christofs Worte über das Geld denken, und er sagte:
»Wir lebten so gut ohne das; vielleicht bringt es uns nur Schaden.«
Jacqueline machte sich über ihn lustig:
»Du Schaf,« sagte sie, »als ob das jemals etwas schaden könnte! Übrigens werden wir nichts an unserem Leben ändern.«
Scheinbar blieb sich ihr Leben auch wirklich gleich. Es blieb sich sogar so sehr gleich, daß man nach einiger Zeit Jacqueline klagen hörte, sie sei nicht reich genug: ein deutlicher Beweis dafür, daß irgend etwas verändert war. Und obgleich sich ihre Einkünfte verdoppelt und verdreifacht hatten, wurde tatsächlich alles verausgabt, ohne daß sie wußten, wofür. Sie mußten sich fragen, wie sie nur vorher ausgekommen waren. Das Geld floß dahin, von tausend neuen Ausgaben aufgezehrt, die sofort gewohnt und unentbehrlich schienen. Jacqueline ließ bei den großen Schneidern arbeiten; die alte Hausschneiderin, die auf Tagesarbeit kam und die sie seit ihrer Kindheit kannte, hatte sie verabschiedet. Wo war die Zeit der spottbilligen kleinen Samthüte, die man mit einem Nichts aufputzte und die trotzdem niedlich waren, der Kleider, deren Eleganz zwar nicht einwandfrei war, jedoch ein Abglanz ihrer Anmut und ein Stück von ihr selbst gewesen waren? Der zarte persönliche Reiz, der von allem ausging, was sie umgab, verwischte sich immer mehr. Ihr anmutiges Wesen war verflogen. Sie wurde alltäglich.
Man hatte die Wohnung gewechselt. Die alte, die man mit so viel Mühe und Vergnügen eingerichtet hatte, erschien jetzt eng und häßlich. Statt der bescheidenen kleinen Zimmer, die den Stempel des Persönlichen trugen und vor deren Fenstern ein trauter Baum seine schlanke Silhouette wiegte, nahm man eine große, bequeme, gut eingeteilte Wohnung, aus der man sich nichts machte, die man nicht lieben konnte, in der man vor Langerweile starb. An Stelle der alten Familienstücke traten Möbel und Tapeten, die fremd anmuteten. Nirgends war mehr Platz für die Erinnerung. Die ersten Jahre des gemeinsamen Lebens wurden aus dem Gedächtnis gefegt ... Es ist ein großes Unglück, wenn zwei einander verbundene Menschen das Band zerschneiden, das sie an ihr vergangenes Liebesleben knüpft. Das Bild dieser Vergangenheit ist eine Schutzwehr gegen die Verzagtheiten und Feindseligkeiten, die unvermeidlich den ersten Zärtlichkeiten folgen. Dadurch, daß Jacqueline nicht mehr zu rechnen brauchte, war sie in Paris und auf Reisen (denn jetzt, da man reich war, reiste man oft) einer Klasse reicher und unnützer Leute näher getreten, die ihr durch ihren Umgang Verachtung für die übrigen Menschen einflößten, nämlich für die arbeitenden. Mit ihrer fabelhaften Anpassungsfähigkeit glich sie sich sofort diesen unfruchtbaren und stumpfen Seelen an. Keine Möglichkeit, dagegen anzukommen! Sofort wurde sie aufsässig und heftig und verwahrte sich, wie gegen »eine ganz gemeine Spießbürgerlichkeit«, gegen den Gedanken, daß man bei häuslichen Pflichten und in der aurea mediocritas glücklich sein könne – oder gar müsse. Die Stunden der Vergangenheit, da sie sich in Liebe großherzig verschenkt hatte, waren ihr bis zur Verständnislosigkeit verloren gegangen.
Olivier war nicht stark genug, um zu kämpfen. Auch er war verändert. Er hatte sein Lehramt niedergelegt und hatte keinerlei verbindliche Arbeit mehr. Er schriftstellerte nur, und davon wurde das Gleichgewicht seines Lebens bestimmt. Bisher hatte er darunter gelitten, nicht ganz der Kunst leben zu können. Jetzt, da er ganz der Kunst lebte, fühlte er sich im Unendlichen verloren. Die Kunst, die nicht als Gegengewicht einen Beruf hat, als Halt nicht ein starkes Tatenleben, die Kunst, die nicht den Stachel einer Alltagsarbeit in ihrem Fleisch fühlt, die Kunst, die nicht nötig hat, nach Brot zu gehen, büßt das Beste ihrer Kraft und ihrer Wahrhaftigkeit ein. Sie ist nur noch eine Luxusblume. Sie ist nicht mehr, was sie bei den größten Künstlern, den einzig großen, ist: die heilige Frucht des menschlichen Leidens. – Olivier überkam ein Gefühl träger Gleichgültigkeit, ein »Wozu?«. Nichts drängte ihn mehr. Er ließ seine Feder ruhen, er schlenderte umher, er konnte sich nicht mehr zurechtfinden. Er hatte die Fühlung mit seinen Berufsgenossen, die geduldig und mühevoll ihr Lebensfeld durchackerten, verloren. Er war in eine andere Welt geraten, in der er sich nicht wohlfühlte, die ihm aber dennoch nicht mißfiel.
Da er schwach, liebenswürdig und wißbegierig war, beobachtete er voller Wohlwollen jene Welt, der zwar nicht die Anmut, wohl aber die innere Festigkeit fehlte, und merkte nicht, wie diese Schwäche nach und nach auf ihn überging; seine Weltanschauung stand nicht mehr fest wie früher.
Zweifellos vollzog sich die Wandlung bei ihm weniger schnell als bei Jacqueline. Die Frau hat den zweifelhaften Vorzug, daß sie sich plötzlich von Grund auf verändern kann. Dieses Sterben und diese plötzliche Erneuerung ihres Wesens können die, die sie lieben, in Schrecken versetzen. Und doch ist es für ein lebensvolles Geschöpf, das vom Willen nicht gezügelt wird, etwas Natürliches, morgen das nicht mehr zu sein, was es heute war. Es ist wie ein fließendes Wasser. Wer es liebt, muß ihm folgen oder seinen Lauf mit Gewalt ablenken. In beiden Fällen heißt es wechseln. Aber es ist ein gefährliches Unterfangen; und man kennt die Liebe eigentlich erst, wenn man sie dieser Prüfung unterworfen hat. Der Zusammenklang der Seelen ist in den ersten Jahren eines gemeinsamen Lebens so zart, daß ihn die leiseste Schwingung in dem einen oder anderen der beiden Wesen völlig zerstören kann. Wieviel mehr noch ein plötzlicher Wechsel im Vermögen oder in der Umgebung! Man muß schon sehr stark – oder sehr stumpf sein, um da Widerstand zu leisten.
Jacqueline und Olivier waren weder stumpf noch stark. Sie sahen sich beide in einem anderen Licht; und das Antlitz des Freundes wurde ihnen fremd. In den Stunden, in denen sie diese traurige Entdeckung machten, verbargen sie sich aus Pietät für ihre Liebe voreinander: denn sie liebten sich noch immer. Olivier fand Zuflucht in seiner Arbeit, die ihm, wenn er auch nur wenig von ihr erfüllt war, durch ihre Regelmäßigkeit Ruhe verschaffte. Jacqueline hatte nichts, sie tat nichts. Sie blieb endlos lange im Bett, oder saß stundenlang bei ihrer Toilette, halb angezogen, reglos, in sich versunken. Und eine dumpfe Traurigkeit sammelte sich tropfenweise, gleich einem eisigen Nebel, in ihr an. Sie war unfähig, sich von der fixen Idee der Liebe freizumachen ... Liebe! Das Göttlichste, was der Mensch besitzt, wenn sie ihm Hingabe seines Selbst, ein rauscherfülltes Opfer bedeutet. Das Törichteste und Enttäuschendste, wenn sie nichts ist als die Jagd nach dem Glück ... Jacqueline war unfähig, sich einen anderen Lebenszweck zu denken. Manchmal hatte sie voll guten Willens versucht, sich für Andere zu erwärmen, an anderer Elend teilzunehmen. Es gelang ihr nicht. Die Leiden der anderen verursachten ihr einen unüberwindlichen Ekel. Ihre Nerven vertrugen sie nicht. Zwei oder drei mal hatte sie, um ihr Gewissen zu beruhigen, etwas getan, was einer Wohltat ähnlich sah; der Erfolg war recht mäßig gewesen.
»Siehst du,« sagte sie zu Christof, »wenn man Gutes tun will, richtet man Böses an, man soll es lieber lassen. Ich habe kein Talent dazu.«
Christof sah sie an, und er dachte an eine seiner flüchtigen Bekanntschaften, eine selbstsüchtige, sittenlose Grisette, die zu jeder wahren Zuneigung unfähig war, die aber, sobald sie jemanden leiden konnte, eine wahre Mutterliebe für den empfand, der ihr noch am Abend vorher gleichgültig und unbekannt gewesen war. Die widerwärtigsten Handreichungen stießen sie nicht ab: gerade die am meisten Überwindung kosteten, bereiteten ihr eine eigenartige Befriedigung. Sie gab sich darüber keinerlei Rechenschaft: es war, als ob darin die ganze Kraft einer dunklen, ererbten, ewig unausgesprochenen Sehnsucht zur Entfaltung käme; ihre sonst verkümmerte Seele lebte in solchen Augenblicken auf. Wenn sie ein Elend nur etwas lindern konnte, empfand sie Wohlbehagen und ein innerliches Glück; ihre Freude wirkte dann fast störend. – Die Güte dieser sonst selbstsüchtigen Frau und die Selbstsucht der eigentlich gütigen Jacqueline waren weder Laster noch Tugend, sondern für jede von ihnen nur notwendige Maßnahmen ihrer seelischen Gesundheit. Bloß fühlte sich die eine von ihnen wohler dabei.
Jacqueline wurde von der bloßen Vorstellung des Leidens zu Boden gedrückt. Sie hätte den Tod einem körperlichen Übel vorgezogen, wäre lieber gestorben, als den Verlust einer der Quellen ihrer Daseinsfreude, ihrer Schönheit oder ihrer Jugend, zu ertragen. Es wäre ihr wie die schrecklichste aller Ungerechtigkeiten erschienen, wenn ihr nicht das volle Glück zuteil geworden wäre, an das sie Anspruch zu haben glaubte, oder wenn sie andere glücklicher gesehen hätte als sich selbst; (denn sie glaubte an das Glück, in einer unanfechtbaren, sinnlosen, aber heiligen Überzeugung). Das Glück war für sie nicht nur Glaube, es war Tugend. Unglücklich zu sein, erschien ihr wie ein Gebrechen. Ihr ganzes Leben stellte sich nach und nach auf dieses Prinzip ein. Ihre wahre Natur hatte die idealistischen Schleier, mit denen sie sich als junges Mädchen in furchtsamer Schamhaftigkeit umhüllt hatte, zerrissen. In der Auflehnung gegen diesen überwundenen Idealismus betrachtete sie jetzt die Dinge klar und nüchtern. Sie hatten für sie nur insofern Wert, als sie mit der Meinung der Welt und einem bequemen Leben zusammenstimmten. Ihre seelische Verfassung glich jetzt der ihrer Mutter. Sie ging zur Kirche und erfüllte ihre religiösen Pflichten mit seelenloser Gewissenhaftigkeit. Sie quälte sich nicht mehr mit der Frage: ob hier im Grunde die Wahrheit sei, sie hatte greifbarere Sorgen und dachte mit ironischem Mitleid an die übersinnliche Auflehnung ihrer Kinderjahre.
Doch ihr heutiger Wirklichkeitssinn war nicht fester gegründet als ihr alter Idealismus. Sie tat sich Zwang an. Sie war weder Engel noch Teufel. Sie war eine arme Freu, die sich langweilte. Sie langweilte sich, Gott, und wie langweilte sie sich! Sie langweilte sich um so mehr, als sie zu ihrer Entschuldigung nicht sagen konnte, daß sie nicht geliebt werde, oder daß sie Olivier nicht leiden könne. Ihr Leben schien ihr wie verrammelt, vermauert, zukunftlos. Sie sehnte sich nach einem neuen, ewig sich erneuernden Glück; und das war geradezu kindisch, da es sich in keiner Weise durch ihr höchst mittelmäßiges Talent zum Glück rechtfertigte. Es ging ihr wie so vielen anderen Frauen, so vielen müßigen Ehepaaren, die alle Vorbedingungen zum Glück besitzen, und die nicht aufhören, sich zu quälen. Überall begegnet man solchen Menschen; sie sind reich, haben schöne Kinder, sind gesund, sind intelligent und für alles Schöne empfänglich, haben alle Möglichkeiten, sich zu betätigen und Gutes zu tun, ihr Leben und das anderer Menschen zu bereichern. Und doch bringen sie ihre Zeit mit Seufzen hin, weil sie sich nicht lieben, oder weil sie andere lieben, oder weil sie andere nicht lieben, und weil sie sich ewig nur mit sich selbst beschäftigen, mit ihren seelischen oder sexuellen Beziehungen, ihren vorgeblichen Rechten an Glück, ihren sich widersprechenden Selbstsüchteleien; sie erörtern, besprechen, bereden ewig dasselbe, spielen sich die Komödie der großen Liebe oder des tiefsten Unglücks vor und glauben schließlich selber daran – leiden auch wirklich ... Wenn ihnen nur einer sagen wollte:
»Ihr seid keineswegs interessant. Es ist schamlos, zu jammern, wenn man soviel Möglichkeiten hat, glücklich zu sein!«
Wenn ihnen nur einer ihr Geld, ihre Gesundheit, alle die wundervollen Gaben, deren sie nicht wert sind, entreißen wollte! Wenn nur einer diese zur Freiheit unfähigen Sklaven, die ihre Freiheit närrisch macht, wieder unter das harte Joch des Elends und der Mühe beugen wollte! Wenn sie ihr Brot nur verdienen müßten, würden sie es in Zufriedenheit essen. Und wenn sie in das furchtbare Antlitz menschlichen Leides sähen, würden sie nicht mehr wagen, eine empörende Komödie damit zu spielen.
Doch letzten Endes leiden sie wirklich. Sie sind Kranke. Wie sollte man sie nicht bedauern? – Die arme Jacqueline hatte keine Schuld, ebenso wenig Schuld, daß sie sich von Olivier loslöste, wie Olivier, daß er sie nicht zu halten vermochte. Sie war, wozu sie die Natur gemacht hatte. Sie wußte nicht, daß die Ehe eine Herausforderung an die Natur ist, und daß, wenn man ihr den Handschuh hingeworfen hat, man von ihr erwarten kann, daß sie ihn aufnimmt und man sich nun selbst anschicken muß, den einmal heraufbeschworenen Kampf tapfer weiterzuführen. Sie merkte, daß sie sich geirrt hatte. Sie war deswegen gegen sich selbst aufgebracht, und diese Enttäuschung verwandelte sich in Feindseligkeit gegen alles, was sie geliebt hatte, gegen den Glauben Oliviers, der auch der ihre gewesen war. Eine gescheite Frau hat – zuweilen mehr als ein Mann – das richtige Verständnis für Ewigkeitswerte; aber es fällt ihr schwerer, daran festzuhalten. Der Mann, der solche Gedanken begriffen hat, nährt sie mit seinem Leben. Die Frau hingegen nährt ihr Leben mit ihnen; sie nimmt sie in sich auf, aber sie schafft sie nicht neu. Ihrem Herzen und ihrem Geist muß man dauernd neue Nahrung zuführen: sie genügen sich nicht selbst. Und in Ermangelung von Glaube und Liebe muß sie zerstören – es sei denn, daß sie die höchste Tugend besitzt: die Ruhe des Gemüts.
Jacqueline hatte einst leidenschaftlich an eine auf gemeinsamem Glauben gegründete Ehe geglaubt, an das Glück, gemeinsam zu kämpfen und zu leiden, um ein Werk aufzubauen. Aber sie hatte auf dieses Werk, auf diesen Glauben nur so lange gebaut, als die Sonne der Liebe sie vergoldete; je mehr die Sonne sank, um so mehr waren sie ihr gleich kahlen, düsteren Bergen erschienen, die sich vom fernen Himmel abhoben; und sie fühlte nicht die Kraft in sich, den Weg fortzusetzen: wozu sollte es ihr nützen, den Gipfel zu erreichen? Was war auf der anderen Seite? Welch ungeheurer Betrug! ... Jacqueline konnte nicht begreifen, daß Olivier sich immer weiter von solchen Hirngespinsten, die das Leben aufzehren, täuschen lassen konnte; sie redete sich ein, daß er weder sehr intelligent, noch sehr lebenskräftig sei. Sie erstickte in seiner Atmosphäre, in der sie nicht atmen konnte; und ihr Selbsterhaltungstrieb drängte sie in einer Art Notwehr dazu, anzugreifen. Sie machte sich daran, die feindlichen Ansichten dessen, den sie noch immer liebte, gänzlich zu zerstören. Sie kämpfte zu diesem Zweck mit allen Waffen ihrer Ironie und Sinnlichkeit; sie umwand ihn mit den Schlingpflanzen ihrer Begierden und ihrer kleinlichen Nöte; sie wollte ihn mit aller Gewalt zu einem Spiegelbild ihrer selbst machen ... ihrer selbst, die nicht einmal wußte, was sie wollte, noch was sie war! Sie fühlte sich gedemütigt, weil Olivier keinen Erfolg hatte, und es machte ihr wenig aus, ob das gerechter- oder ungerechterweise so war: denn sie hatte sich zu der Überzeugung gebracht, daß es letzten Endes nur der Erfolg ist, der den Begabten vom Schiffbrüchigen unterscheidet. Olivier fühlte solche Zweifel auf sich lasten, und seine besten Kräfte gingen dabei verloren. Er kämpfte zwar, so gut er konnte, wie so viele andere vor ihm gekämpft haben und kämpfen werden; aber für die meisten wird dieser ungleiche Wettstreit vergeblich sein, weil in ihm die egoistischen Instinkte der Frau sich dem geistigen Egoismus des Mannes entgegenstellen, der Schwäche des Mannes, seinen Enttäuschungen und seinem gesunden Menschenverstand, hinter dem er seine verbrauchten Lebenskräfte und seine eigene Feigheit verbirgt. – Wohl waren Jacqueline und Olivier den meisten Kämpfern überlegen, denn er hätte niemals sein Ideal verraten, wie jene Tausende von Männern, die um ihrer Faulheit, Eitelkeit und Eigenliebe frönen zu können, sich so weit verlieren, ihre ewige Seele zu verleugnen. Und wäre es so weit mit ihm gekommen, so hätte ihn Jacqueline verachtet. Doch in ihrer Blindheit tat sie alles, um diese Kraft in Olivier, die doch ebenso sehr die ihre war, ihrer beider Schutzwehr, zu zerstören; und sie untergrub mit instinktiver Planmäßigkeit die freundschaftlichen Gefühle, auf die sich diese Kraft stützte.
Seit der Erbschaft hatte sich Christof in der Gesellschaft des jungen Ehepaares nicht mehr wohlgefühlt. Das snobistische Gehabe und die etwas banale Nüchternheit, die Jacqueline in ihrer Unterhaltung mit ihm böswillig übertrieb, war ihm schließlich zuviel geworden. Er begehrte manchmal auf und sprach harte Worte, die üble Aufnahme fanden. Das hätte zwar niemals zu einem Bruch zwischen den beiden Freunden geführt. Dazu standen sie sich zu nahe. Olivier hätte um nichts auf der Welt Christof verlieren mögen. Aber er konnte ihn Jacqueline nicht aufzwingen. Und schwach wie er in seiner Liebe zu ihr war, vermochte er nicht, ihr wehzutun. Christof sah, was in ihm vorging und wie er litt. Er machte ihm daher die Wahl leicht, indem er sich von selbst zurückzog. Er sah ein, daß er durch sein Bleiben Olivier keinen Dienst erwies; daß er ihm eher schadete. So kam er seinem Freund so weit entgegen, daß er ihm Grund gab, sich von ihm zurückzuziehen. Und Oliviers Schwäche machte davon Gebrauch, obwohl er Christofs Opfer ahnte und von Gewissensbissen gepeinigt wurde.
Christof zürnte ihm darob nicht. Er dachte, man habe so unrecht nicht, wenn man die Frau die Hälfte des Mannes nenne; denn ein verheirateter Mann ist nur ein halber Mann.
Er suchte, sein Leben ohne Olivier neu zu gestalten. Aber wenn er sich auch noch so sehr bemühte und sich einzureden suchte, daß die Trennung nur vorübergehend sei, so durchlebte er doch trotz seinem Optimismus trübe Stunden. Er war das Alleinsein nicht mehr gewöhnt. Allerdings war er während Oliviers Aufenthalt in der Provinz auch allein gewesen; aber damals konnte er sich noch Illusionen hingeben; er sagte sich, der Freund sei fern, aber er würde wiederkommen. Jetzt, da der Freund wieder da war, schien er ferner zu sein denn je. Die Freundschaft, die während mehrerer Jahre sein Leben ausgefüllt hatte, fehlte ihm nun auf einmal: ihm war, als habe er seinen besten Ansporn zur Betätigung verloren. Seitdem er Olivier liebte, war es ihm zur Gewohnheit geworden, mit ihm gemeinsam zu denken und ihn zu allem, was er tat, in Beziehung zu bringen. Die Arbeit als solche genügte nicht, um die Leere auszufüllen: denn Christof hatte sich daran gewöhnt, bei aller Arbeit immer das Bild des Freundes vor Augen zu haben. Jetzt, da der Freund keinen Anteil mehr an ihm nahm, war es ihm, als habe er das Gleichgewicht verloren: so suchte er, um es wieder herzustellen, nach einer anderen Zuneigung. Wohl besaß er die Freundschaft der Frau Arnaud und Philomeles. Aber diese stillen Freundinnen konnten ihm in dieser Zeit nicht genügen.
Die beiden Frauen schienen Christofs Kummer zu ahnen und fühlten im geheimen mit ihm. Christof war ganz überrascht, als er eines Abends Frau Arnaud bei sich eintreten sah. Bis dahin hatte sie niemals gewagt, ihn zu besuchen. Sie schien erregt. Christof achtete nicht darauf; er schob diese Stimmung auf ihre Schüchternheit. Sie setzte sich, sprach aber nicht. Christof suchte es ihr behaglich zu machen, indem er den Wirt spielte. Man sprach von Olivier, an den man überall im Zimmer erinnert wurde, Christof redete heiter und natürlich von ihm, ohne etwas von dem Vorgefallenen zu verraten. Doch Frau Arnaud, die es wußte, konnte nicht umhin ihn ein wenig mitleidig anzuschauen und zu sagen:
»Sie sehen sich wohl fast gar nicht mehr?«
Er dachte, daß sie gekommen sei, um ihn zu trösten; und das machte ihn ärgerlich; denn er mochte es durchaus nicht, daß sich jemand in seine Angelegenheiten mischte.
»So oft es uns gefällt!« antwortete er deshalb.
Sie errötete und sagte:
»O, ich wollte nicht indiskret sein!«
Er bedauerte seine Barschheit und griff nach ihrer Hand:
»Verzeihen Sie,« sagte er, »ich habe immer Angst, daß man ihn angreift. Der arme Kerl! Er leidet ja ebenso darunter wie ich; nein, wir sehen uns nicht mehr.«
»Und er schreibt Ihnen auch nicht?«
»Nein,« erwiderte Christof etwas beschämt.
»Wie traurig das Leben doch ist,« sagte Frau Arnaud nach einer kleinen Weile.
Christof hob den Kopf.
»Nein, das Leben ist nicht traurig,« meinte er, »es hat nur traurige Stunden.«
Frau Arnaud fuhr mit verhaltener Bitterkeit fort:
»Man hat sich geliebt, man liebt sich nicht mehr. Wozu dann das alles?«
Christof antwortete:
»Man hat sich geliebt.«
»Sie haben sich für ihn aufgeopfert,« fuhr sie fort, »wenn wenigstens das Opfer dem zugute käme, den man liebt! Aber er wird darum nicht glücklicher!«
»Ich habe mich nicht aufgeopfert,« sagte Christof voller Zorn. »Und wenn ich mich aufopfere, so tue ich es zu meinem Vergnügen. Darüber braucht man nicht viel Worte zu machen. Man tut, was man tun muß. Unterließe man es, so würde man sicher unglücklich! Es gibt nichts Dümmeres als dieses Gerede vom Opfer! Was für Pastorenseelen müssen das gewesen sein, die in ihrer Herzensarmut die Opferfreudigkeit mit der Vorstellung einer protestantischen, mürrischen und verstockten Trübseligkeit vermengt haben. Es ist gerade, als sei ein Opfer nur dann etwas wert, wenn es recht lästig ist ... Zum Teufel! Wenn euch ein Opfer Schmerz bereitet und keine Freude, so bringt es nicht; ihr seid dessen nicht würdig. Man tut es doch nicht umsonst, man tut es ja für sich selbst. Wenn ihr nicht das Glück empfindet, das darin liegt, sich hinzugeben, so schert euch zum Teufel! Ihr verdient nicht zu leben!«
Frau Arnaud hörte Christof zu und wagte nicht ihn anzusehen. Ganz unvermittelt stand sie auf und sagte:
»Leben Sie wohl.«
Da er meinte, daß sie gekommen sei, um ihm irgend etwas anzuvertrauen, sagte er:
»O, verzeihen Sie. Ich bin ein Egoist, ich spreche nur von mir. Bleiben Sie doch noch, ja ...?«
Doch sie sagte:
»Nein, ich kann nicht, danke.«
Und ging.
Es verstrich einige Zeit, ehe sie sich wiedersahen. Sie gab ihm keinerlei Lebenszeichen mehr; und er ging weder zu ihr noch zu Philomele. Er hatte sie beide herzlich gern; aber er fürchtete sich davor, mit ihnen von diesen Dingen zu reden, die ihn traurig stimmten. Dann aber behagte ihm auch im Augenblick nicht ihr stilles eingeengtes Dasein, ihre überdünne Atmosphäre. Er brauchte neue Gesichter, er mußte durch eine neue Spannung, durch eine neue Liebe wieder zu sich zurückfinden.
Um seinen Gedanken zu entfliehen, besuchte Christof jetzt häufiger das Theater, das er seit langem vernachlässigt hatte. Überdies schien es ihm eine anregende Schule für den Musiker zu sein, der den Ausdruck der Leidenschaften beobachten und festhalten will.
Die französischen Stücke fanden zwar auch jetzt nicht mehr Anklang bei ihm als zu Anfang seines Pariser Aufenthaltes. Ganz abgesehen von ihren ewig gleichen Themen, die sich nichtssagend und roh um die Psycho-Physiologie der Liebe drehten, und denen er wenig Geschmack abgewinnen konnte, fand er die Theatersprache der Franzosen, vor allem im Versdrama, grundfalsch. Weder ihre Prosa noch ihre Verse entsprachen der lebendigen Sprache und Eigenart des Volkes. Die Prosa war eine gekünstelte Sprache, im besten Fall die eines Salonerzählers, im schlimmsten die eines gewöhnlichen Feuilletonschreibers. Die Dramen in Versen gaben Goethes launischem Wort recht:
»Dichten ist gut für die, die nichts zu sagen haben.«
Es war eine weitschweifige und gewundene Prosa. Die Überfülle von Bildern, mit denen sie nach dem Muster der Lyrik anderer Völker ungeschickt vollgepfropft war, machte auf jeden einfach empfindenden Menschen einen verlogenen Eindruck. Christof fand, daß solche Dramen nicht höher standen als die italienischen Opern, mit ihrem süßlichen Ariengesäusel und ihren theatralischen Stimmübungen. Die Schauspieler interessierten ihn mehr als die Stücke. Auch die Dichter gaben sich Mühe, sich nach ihnen zu richten.
»Man konnte sich nicht einbilden, ein Stück mit irgendwelchem Erfolg aufgeführt zu sehen, falls man nicht vorsichtigerweise seine Charaktere nach den Lastern der Komödianten gestaltet hatte.«
Seit der Zeit, als Diderot diese Zeilen schrieb, hatte sich die Sachlage in nichts geändert. Die Mimen waren die Vorbilder für die Kunst geworden. Sobald einer zu Erfolg gekommen war, besaß er ein Theater, seine gefälligen Dichter-Schneider und seine nach Maß gearbeiteten Stücke.
Unter den großen Modellpuppen der literarischen Mode war eine, die Christofs Interesse wachrief: Françoise Oudon. Seit einem, höchstens zwei Jahren hatte sich Paris in sie vernarrt. Sie hatte natürlich auch ihr Theater und ihre Rollenlieferanten; aber sie spielte auch noch andere Stücke als nur die für sie zurechtgemachten; ihr ziemlich gemischter Spielplan reichte von Ibsen bis Sardou, von d'Annunzio bis zum jüngeren Dumas, von Bernard Shaw bis zu den jüngsten Pariser Theaterschreibern. Manchmal wagte sie sich sogar auf die Wege des klassischen Hexameters nach Versailler Mustern oder in den Strudel der leidenschaftlichen Bildersprache Shakespeares. Aber darin fühlte sie sich nicht so behaglich und ihr Publikum noch weniger. Was sie auch spielte, sie spielte sich selbst, einzig und allein nur sich. Hierin lag ihre Schwäche und ihre Stärke. Solange die öffentliche Aufmerksamkeit sich nicht mit ihrer Person beschäftigt hatte, war ihr Spiel ohne jeden Erfolg geblieben. Von dem Tage an, als man sich um sie persönlich kümmerte, galt alles, was sie spielte, als herrlich. Und wirklich, es lohnte der Mühe, da man bei ihrem Spiel die oft so kläglichen Werke übersah, die sie vergessen machte, indem sie sie durch ihr eigenes Leben verklärte. Das Rätsel dieses Frauenkörpers, dem eine unbekannte Seele Gestalt verlieh, war für Christof ergreifender als die Stücke, die sie spielte.
Sie hatte ein schönes und reines Profil, das fast tragisch wirken konnte. Nichts von den scharf betonten und schwerfälligen Linien des Gesichtes in römischem Stil war darin. Es hatte im Gegenteil zarte, pariserische Linien in der Art des Jean Goujon, – die ebenso gut einem jungen Burschen wie einer Frau gehören konnten: eine kurze, aber wohlgebildete Nase, einen schönen schmallippigen Mund mit einem etwas bitteren Zug, durchgeistigte Wangen von jugendlicher Magerkeit, auf denen etwas Rührendes, der Wiederschein eines inneren Leides lag, ein eigensinniges Kinn, einen blassen Teint. Es war eines jener Gesichter, die gewöhnt sind, sich zu beherrschen und die dennoch durchsichtig sind, in denen man die Seele wie bloßgelegt zittern fühlt, weil sie unter der Haut ganz von Seele durchbebt sind. Ihre Haare und Brauen waren sehr fein, ihre Augen schimmerten von grau zu bernsteingelb und konnten alle möglichen Farben zwischen grün und gold annehmen; wahre Katzenaugen. Ihr ganzes Wesen hatte überhaupt etwas von einer Katze durch eine scheinbare Benommenheit, eine Art Halbschlaf, in dem die Augen immer lauernd wie zur Verteidigung offen blieben, um plötzlich etwas Nervöses, ein wenig Grausames zu bekommen. Sie erschien größer, als sie eigentlich war, und wirkte mager, ohne es zu sein; sie hatte schöne Schultern, wohlgeformte Arme, lange, feine Hände. In ihrer Art, sich anzuziehen und das Haar zu tragen, bewies sie einen durchaus einwandfreien, schlichten Geschmack, ohne die geringste bohèmehafte Nachlässigkeit, ohne den übertriebenen Aufwand gewisser Künstlerinnen, – auch darin ganz Katze und ebenso wie diese mit aristokratischen Instinkten begabt, obgleich sie aus der Gosse stammte. Und hinter alledem schlummerte eine unbezähmbare Wildheit.
Sie mochte gegen dreißig Jahre alt sein. Christof hatte bei Gamache mit brutaler Bewunderung von ihr reden hören, als von einem sehr freien, gescheiten und kühnen Mädchen mit eiserner Energie und glühendem Ehrgeiz, die aber herb, eigensinnig, unstet und heftig sei. Man sagte, sie hätte viel durchgemacht, bevor sie zu der jetzigen Berühmtheit gelangt sei. Jetzt wolle sie sich schadlos halten.
Eines Tages, als Christof den Zug nach Meudon nahm, um zu Philomele zu fahren, saß die Schauspielerin in dem Abteil, in das er einstieg. Sie schien in erregtem, leidendem Zustand zu sein. Christofs Erscheinen war ihr unangenehm. Sie drehte ihm den Rücken zu und sah unentwegt durch das gegenüberliegende Fenster. Christof aber, der von der Veränderung in ihren Zügen betroffen war, wandte in einem kindlichen, aber belästigenden Mitleid kein Auge von ihr. Sie ärgerte sich darüber und warf ihm einen wütenden Blick zu, den er nicht verstand. Bei der nächsten Haltestelle stieg sie aus und setzte sich in einen anderen Wagen. Da erst merkte er – etwas spät – daß er sie vertrieben hatte; und er war ganz unglücklich darüber. Einige Tage darauf saß er an einer Haltestelle derselben Linie auf der einzigen Bank des Bahnsteiges, um den Zug nach Paris zu erwarten. Da erschien sie und setzte sich neben ihn. Er wollte aufstehen. Sie sagte jedoch:
»Bleiben Sie nur.«
Sie waren allein. Er entschuldigte sich, daß er sie neulich veranlaßt hätte, das Wagenabteil zu wechseln. Er sagte, wenn er geahnt hätte, daß er sie störe, wäre er ausgestiegen. Sie begnügte sich, ihm mit ironischem Lächeln zu antworten:
»Ja, Sie waren wirklich unausstehlich in Ihrem beharrlichen Anstarren.«
»Verzeihen Sie,« sagte er, »ich konnte nicht anders ... Sie sahen aus, als fühlten Sie sich nicht wohl.«
»Nun, und wenn schon?« sagte sie.
»Ich kann dagegen nicht an. Wenn Sie jemanden am Ertrinken sehen, werden Sie ihm doch auch die Hand reichen?«
»Ich? Gott bewahre,« sagte sie. »Ich werde ihm eher noch den Kopf unters Wasser drücken, damit es schneller vorbei ist.«
Sie sagte das mit einem Gemisch von Bitterkeit und Humor; und als er sie bestürzt anschaute, lachte sie. Der Zug lief ein. Alle Wagen, außer dem letzten, waren besetzt. Sie stieg ein. Der Schaffner drängte. Christof, dem nichts daran lag, den Auftritt von neulich noch einmal zu erleben, wollte ein anderes Abteil suchen. Doch sie sagte:
»Steigen Sie ein.«
Er tat es.
»Heute ist es mir gleich,« meinte sie.
Sie plauderten miteinander. Christof suchte ihr mit großem Ernst zu beweisen, daß man an den anderen nicht gleichgültig vorübergehen dürfe, und daß man sich gegenseitig unendlich viel Gutes tun könne, wenn man einander hülfe, einander tröste ...
»Trost,« sagte sie, »das zieht bei mir nicht.« ...
Und als Christof bei seiner Meinung beharrte, sagte sie mit ungezogenem Lächeln:
»O ja, die Rolle des Trösters ist für den, der sie spielt, sehr vorteilhaft.«
Es dauerte einen Augenblick, bevor er begriff, was sie meinte. Als er aber dann merkte, daß sie ihn im Verdacht hatte, seinen eigenen Vorteil zu suchen, während er doch nur an sie dachte, stand er empört auf, riß die Wagentür auf und wollte aussteigen, obgleich der Zug im Fahren war. Sie hielt ihn nur mit Mühe zurück. Wütend setzte er sich wieder hin und schloß die Wagentür, gerade in dem Augenblick, als der Zug durch einen Tunnel fuhr. »Sehen Sie«, meinte sie, »Sie hätten ums Leben kommen können.«
»Darauf pfeife ich!« sagte er.
Er wollte eigentlich nicht mehr mit ihr reden.
»Die Welt ist zu dumm,« sagte er. »Man tut einander weh, man leidet selbst; und wenn man jemandem helfen möchte, wird man noch verdächtigt. Das ist widerlich. Solche Art Leute sind gar keine Menschen.«
Sie suchte ihn lachend zu beruhigen; sie legte ihre behandschuhte Hand auf die seine; sie sprach ihm gut zu und nannte ihn bei seinem Namen.
»Wie, Sie kennen mich?« fragte er.
»Als ob in Paris sich nicht alle Welt kennte! Sie sind ja auch vom Bau. Es war unrecht von mir, Ihnen das zu sagen. Sie sind wirklich ein guter Junge, das sehe ich. Na, nun beruhigen Sie sich aber. Topp! schließen wir Frieden!«
Sie gaben sich die Hand und plauderten freundschaftlich mit einander. Sie sagte:
»Sehen Sie, es ist nicht meine Schuld. Ich habe so viele Erfahrungen mit den Leuten gemacht, daß ich mißtrauisch geworden bin.«
»Mich haben sie auch oft genug enttäuscht«, sagte Christof, »aber ich gebe ihnen doch immer wieder Kredit.«
»Ich merke schon, Sie können ein gut Teil hinunterschlucken.«
Er lachte:
»Ja, das habe ich in meinem Leben auch oft gemußt; aber es stört mich nicht. Ich habe einen guten Magen. Ich schlucke sogar harte Bissen, zum Beispiel das Elend, und wenn's nötig wird, auch die Elenden, die über mich herfallen. Dabei fühle ich mich außerordentlich wohl.«
»Sie sind gut dran,« sagte sie, »Sie sind eben ein Mann.«
»Und Sie sind eine Frau.«
»Das ist schon was Rechtes.«
»Das ist etwas sehr Schönes,« sagte er, »und es kann so gut sein!«
Sie lachte.
»Es kann!« sagte sie, »aber was fängt die Welt damit an?«
»Man muß sich zur Wehr setzen.«
»Dann ist es bald mit dem Gutsein vorbei.«
»Wenn man nicht viel davon zu vergeben hat – allerdings.«
»Das ist schon möglich. Man darf aber auch nicht allzuviel zu leiden haben. Es gibt ein Zuviel, das die Seele ausdörrt.«
Er wollte sie schon wieder bemitleiden. Aber noch rechtzeitig erinnerte er sich, wie sie das aufgenommen hatte ...
»Wollen Sie noch einmal von der vorteilhaften Rolle des Trösters reden?«
»Nein,« sagte sie, »ich werde es nicht mehr sagen. Ich fühle, Sie sind gut, Sie sind aufrichtig. Ich danke Ihnen. Nur sagen Sie mir nichts, Sie können nicht wissen ... Haben sie Dank.«
Sie kamen in Paris an. Sie trennten sich, ohne sich ihre Adresse zu geben, ohne sich zu einem Besuch aufzufordern.
Ein oder zwei Monate später kam sie ganz von selbst und klingelte an Christofs Türe.
»Ich komme zu Ihnen. Ich habe das Bedürfnis, ein wenig mit Ihnen zu plaudern. Ich habe seit unserer Begegnung manchmal an Sie gedacht.«
Sie setzte sich.
»Nur einen Augenblick, ich werde Sie nicht lange aufhalten.«
Er begann, mit ihr zu reden. Sie sagte:
»Warten Sie eine Minute, ja?«
Sie schwiegen. Dann sagte sie lächelnd:
»Ich konnte nicht mehr. Jetzt ist mir schon besser.«
Er wollte fragen.
»Nein,« sagte sie, »nicht so!«
Sie schaute sich im Zimmer um, sah sich verschiedene Dinge an und machte Bemerkungen darüber, gewahrte auch Luisens Photographie.
»Das ist wohl die Mutter?« fragte sie.
Sie nahm das Bild und betrachtete es mit Teilnahme.
»Die gute alte Frau,« sagte sie, »Sie haben's gut!«
»Ach, leider ist sie tot.«
»Das tut nichts, Sie haben sie doch wenigstens gehabt.«
»Nun, und Sie?«
Aber sie runzelte die Stirn und lenkte ab. Sie wollte nicht über ihre Angelegenheiten befragt werden.
»Nein, sprechen wir von Ihnen, erzählen Sie mir etwas, etwas aus Ihrem Leben!«
»Wie kann Sie das interessieren?«
»Los, erzählen Sie nur ...«
Er wollte nicht reden; aber er konnte nicht gut anders, als ihre Fragen zu beantworten, denn sie verstand es sehr gut, ihn auszufragen. Und so kam es, daß er gerade Dinge verriet, die ihm Kummer bereitet hatten: die Geschichte seiner Freundschaft mit Olivier, der sich von ihm getrennt hatte. Sie hörte ihm mit teilnehmendem, aber wie stets spöttischem Lächeln zu. Plötzlich fragte sie:
»Wieviel Uhr ist es? Ach, mein Gott! Seit zwei Stunden bin ich jetzt hier! ... Entschuldigen Sie! ... Ach, wie mich das aufgefrischt hat! ...«
»Ich möchte wohl wiederkommen dürfen ... nicht oft; ... nur manchmal ... Das würde mir gut tun! Aber ich möchte Sie nicht anöden und Ihnen die Zeit stehlen ... Nur dann und wann eine Minute!«
»Ich werde zu Ihnen kommen,« sagte Christof.
»Nein, nein, nicht zu mir. Ich komme zu Ihnen. Das ist mir lieber.«
Aber lange Zeit kam sie nicht wieder. Eines Abends erfuhr er durch Zufall, daß sie ernstlich krank sei und schon seit Wochen nicht spiele. Trotz dem Verbote ging er zu ihr. Niemand wurde vorgelassen; da er jedoch seinen Namen genannt hatte, rief man ihn von der Treppe zurück. Sie lag zu Bett, doch es ging ihr besser. Sie hatte eine Lungenentzündung gehabt und sah recht verändert aus. Aber sie hatte noch immer den spöttischen Ausdruck und den scharfen Blick, der sich nicht ergab. Immerhin zeigte sie eine wirkliche Freude über Christofs Besuch. Sie hieß ihn sich neben das Bett setzen. Sie sprach mit launiger Ungezwungenheit von sich selbst und erzählte, daß sie beinahe gestorben wäre. Er ließ sich Zeichen der Rührung merken. Da machte sie sich über ihn lustig. Er warf ihr vor, daß sie ihn nichts habe wissen lassen:
»Sie etwas wissen lassen? Damit Sie hergelaufen wären? Nicht um die Welt!«
»Ich wette, daß Sie nicht einmal an mich gedacht haben.«
»Und Sie haben gewonnen,« sagte sie mit ihrem spöttischen, ein wenig traurigen Lächeln. »Während ich krank war, habe ich nicht eine Minute an Sie gedacht. Nur ausgerechnet heute. Na, machen Sie sich nichts daraus. Wenn ich krank bin, denke ich an niemanden; ich will dann nichts weiter von den Leuten, als daß sie mich in Frieden lassen. Ich drehe meine Nase zur Wand und warte ab; ich will allein sein, will allein krepieren, wie eine Ratte.«
»Es ist aber doch hart, allein zu leiden.«
»Ich bin daran gewöhnt. Jahrelang war ich unglücklich. Kein Mensch ist mir jemals zu Hilfe gekommen. Jetzt bin ich daran gewöhnt ... Es ist auch besser so. Helfen kann einem ja doch niemand. Man macht nur Lärm im Zimmer, ist mit lästigen Betulichkeiten, mit geheucheltem Jammer um einen herum ... Nein, da sterbe ich schon lieber allein.«
»Sie sind recht resigniert.«
»Resigniert? Ich weiß nicht einmal, was das Wort bedeutet. Nein, ich beiße die Zähne zusammen, und ich hasse das Übel, das mir weh tut.«
Er fragte sie, ob man sie denn nicht besuche, ob sich niemand um sie kümmere. Sie erwiderte, daß ihre Kollegen vom Theater ganz nette Menschen seien, – zwar Schafsköpfe, aber dienstbeflissen und – in einer oberflächlichen Weise – auch teilnehmend.
»Aber ich sage Ihnen doch, daß ich selber sie nicht bei mir sehen will. Ich bin ein unverträglicher Mensch.«
»Nun, ich würde es mir schon gefallen lassen!« sagte er.
Sie sah ihn mitleidig an.
»Sie reden also auch wie die anderen!«
Er sagte:
»Verzeihen Sie, verzeihen Sie ... Du lieber Gott! So werde ich also auch zum Pariser! Ich schäme mich ... Ich schwöre Ihnen, ich habe mir nichts dabei gedacht, als ich das sagte ...«
Er vergrub sein Gesicht in die Bettdecke. Sie lachte ungezwungen und gab ihm einen Klaps auf den Kopf.
»Nun, diese Erklärung ist wenigstens nicht pariserisch! Es war noch gerade Zeit! Daran erkenne ich Sie wieder. Also kommen Sie mit Ihrem Gesicht wieder zum Vorschein. Weinen Sie mir meine Decke nicht naß.«
»Ist es also vergeben und vergessen?«
»Vergeben und vergessen, aber fangen Sie nicht wieder an.«
Sie plauderte noch ein wenig weiter mit ihm, fragte ihn nach seinem Tun, wurde dann aber müde und verstimmt und schickte ihn fort.
Sie hatten ausgemacht, daß er in der folgenden Woche wiederkommen sollte. Aber als er sich gerade auf den Weg machen wollte, bekam er ein Telegramm von ihr des Inhalts, er möge nicht kommen, sie habe einen ihrer schlechten Tage. – Am übernächsten Tag bat sie ihn, wieder zu kommen. Er kam. Ihre Genesung machte Fortschritte; sie lag halb ausgestreckt beim Fenster. Es war Vorfrühling, der Himmel übersonnt, die Bäume voll junger Knospen. Sie war zugänglicher und sanfter gegen ihn als je zuvor. Sie erklärte ihm, daß sie neulich niemanden hätte sehen können. Sie hätte ihn sonst wie die anderen Menschen verabscheut.
»Und heute?«
»Heute fühle ich mich ganz jung und ganz frisch, und ich bin allem gut, was ich rings um mich als jung und frisch empfinde – so wie Sie.«
»Dabei bin ich doch nicht mehr ganz jung und ganz frisch.«
»Sie werden es bis zu Ihrem Tode sein.«
Sie sprachen von dem, was er inzwischen gemacht hatte, dann vom Theater, an dem sie ihre Tätigkeit bald wieder beginnen wollte; bei dieser Gelegenheit sagte sie ihm, was sie vom Theater dachte: daß es ihr im Grunde zuwider sei, daß sie aber doch nicht davon loskommen könne.
Sie wollte nicht, daß er öfters käme; sie versprach, ihre Besuche bei ihm wieder aufzunehmen. Nur fürchtete sie, ihn zu stören. Er sagte ihr, welches die beste Zeit sei, ihn bei seiner Arbeit nicht zu stören. Sie verabredeten ein Erkennungszeichen. Sie sollte auf eine bestimmte Art an die Türe klopfen: dann würde er öffnen oder nicht, ganz so wie er Lust hätte ...
Zunächst nützte sie die Erlaubnis keineswegs aus. Einmal aber, als sie gerade auf dem Wege zu einer Abendgesellschaft war, wo sie vortragen sollte, hatte sie im letzten Augenblick keine Lust dazu. Sie telephonierte, daß sie nicht kommen könne, und fuhr zu Christof. Sie hatte nur die Absicht, ihm im Vorbeigehen »Guten Abend« zu sagen. Doch gerade an diesem Abend ergab es sich, daß sie ihm ihr Herz ausschüttete und ihm ihr Leben von Kindheit an erzählte.
Traurige Kindheit! Einen Zufallsvater, den sie nicht gekannt hatte. Eine Mutter, die in einer nordfranzösischen Stadt eine verrufene Herberge unterhielt; die Fuhrleute tranken dort ihren Schoppen, schliefen bei der Wirtin und mißhandelten sie. Einer von ihnen heiratete sie, weil sie ein paar Groschen hatte; er schlug sie und betrank sich. Françoise hatte eine ältere Schwester, die in der Herberge Magddienste verrichtete; sie rieb sich dabei auf. Der Wirt hatte sie unter den Augen der Mutter zu seiner Geliebten gemacht; sie wurde schwindsüchtig, sie starb. Françoise war unter Schlägereien und Gemeinheiten aufgewachsen. Sie war ein bleiches, verbittertes, verschlossenes Kind mit einer glühenden und wilden kleinen Seele. Sie sah ihre Mutter und ihre Schwester leiden, sich in ihr Schicksal ergeben, sich erniedrigen und sterben; sie war von dem verbissenen Willen besessen, sich nicht zu ergeben, aus dieser niederträchtigen Umgebung herauszukommen. Sie war von Natur ein aufrührerisches Geschöpf; bei gewissen Ungerechtigkeiten bekam sie Nervenanfälle; wenn man sie schlug, kratzte und biß sie. Einmal wollte sie sich erhängen; es gelang aber nicht; kaum hatte sie den Versuch gemacht, als sie schon nicht mehr wollte; sie hatte Angst, daß sie es nur zu gut fertig brächte; schon halb erstickt, löste sie schleunigst die Schnur mit ihren verkrampften und ungeschickten Fingern: ein rasender Wunsch, zu leben, bäumte sich in ihr auf. Und da sie durch den Tod doch nicht sich selbst entfliehen konnte, schwor sie sich, zu siegen, frei und reich zu werden und alle zu zertreten, die sie jetzt unterdrückten. (Christof lächelte traurig; denn er erinnerte sich an ähnliche Seelenzustände.) Das hatte sie sich eines Abends in ihrem Verschlag zugeschworen, während aus dem Zimmer nebenan die Flüche des Mannes, das Geschrei der Mutter, die er schlug, und das Weinen der Schwester zu ihr drangen. Wie elend war ihr zumute gewesen! Und doch hatte jener Schwur ihr gut getan. Sie hatte die Zähne zusammengebissen und gedacht:
»Ich werde euch alle zu Boden zwingen!«
In dieser düsteren Kindheit war ein einziger Lichtblick:
Eines Tages hatte einer der Bengel, mit denen sie sich in der Gosse herumtrieb, der Sohn des Hausmeisters vom Theater, obgleich es verboten war, sie zu einer Probe ins Theater mitgenommen. Sie schlüpften im Dunkeln ganz hinten in den Zuschauerraum. Das Mysterium der Bühne, die aus dem Dunkel erstrahlte, die großartigen und unverständlichen Dinge, die man sprach, die königliche Miene der Schauspielerin, die tatsächlich gerade eine Königin in einem romantischen Schauerdrama spielte: das alles machte auf sie den tiefsten Eindruck. Sie war starr vor Erregung; und dabei schlug ihr das Herz wie toll ... Das war es, das war es bestimmt, was sie eines Tages werden mußte! ... O, wenn sie so werden könnte! ...
Als die Probe vorbei war, wollte sie um jeden Preis die Abendvorstellung mit ansehen. Sie ließ ihren Spielgefährten vorausgehen und tat, als ob sie ihm folgte; dann machte sie kehrt und versteckte sich im Theater. Sie kauerte sich unter eine Bank, blieb so, ohne sich zu regen, drei Stunden lang und erstickte fast in dem Staub; als die Vorstellung beginnen sollte, das Publikum kam und sie aus ihrem Versteck herausmußte, wurde sie zu ihrem größten Schmerz erwischt, unter allgemeinem Hohngelächter schmählich an die Luft gesetzt und nach Hause gebracht, wo man sie noch gehörig züchtigte. In dieser Nacht wäre sie gestorben, wenn sie jetzt nicht gewußt hätte, was sie später tun wollte, um alle diese Leute zu beherrschen und sich an ihnen zu rächen.
Ihr Plan stand fest. Sie verdingte sich als Dienstmädchen im »Hotel und Café zum Theater«, wo die Schauspieler abstiegen. Sie konnte kaum lesen und schreiben, sie hatte nichts gelesen und besaß nichts, was sie hätte lesen können. Aber sie wollte lernen und machte sich mit verzweifeltem Eifer daran. Sie stibitzte Bücher aus dem Zimmer der Gäste und las sie nachts beim Mondenschein oder beim Morgengrauen, um die Kerze zu sparen. Bei der Unordnung der Schauspieler wurden ihre Diebstähle nicht bemerkt, oder die Besitzer begnügten sich damit, zu fluchen. Im übrigen brachte sie die Bücher zurück, wenn sie sie gelesen hatte – außer einem oder zweien, die sie zu tief bewegt hatten, als daß sie sich von ihnen hätte trennen können. Aber sie brachte sie nicht unbeschädigt zurück: Seiten, die ihr gefielen, riß sie heraus. Brachte sie dann die Bücher wieder, so schob sie sie sorgfältig unter das Bett oder unter ein Möbelstück, so daß man glauben sollte, sie wären nicht aus dem Zimmer gekommen. Sie horchte an den Türen, um die Schauspieler beim Rollenstudium zu belauschen. Und wenn sie allein im Flur beim Fegen war, ahmte sie halblaut ihren Tonfall nach und machte große Gebärden dazu. Als man sie einmal so überraschte, machte man sich lustig über sie und zankte sie aus. Voller Wut schwieg sie still. – Diese Art von Erziehung hätte noch lange dauern können, wenn sie einmal nicht die Unvorsichtigkeit begangen hätte, aus dem Zimmer eines Schauspielers eine Rolle zu stehlen. Der Schauspieler tobte. Niemand außer dem Dienstmädchen war im Zimmer gewesen; deshalb beschuldigte er sie. Sie leugnete frech; er drohte ihr, sie durchsuchen zu lassen; sie warf sich ihm zu Füßen, gestand ihm alles, auch die anderen Diebstähle und die herausgerissenen Blätter: das ganze Sündenregister. Er fluchte fürchterlich; aber er war nicht so schlimm, als er tat. Er fragte, warum sie das alles gemacht habe. Als sie sagte, daß sie Schauspielerin werden wolle, lachte er furchtbar. Er fragte sie näher aus; sie rezitierte ihm ganze Seiten, die sie auswendig gelernt hatte. Darüber war er verblüfft und sagte:
»Höre, willst du, daß ich dir Stunden gebe?«
Da war sie in allen Himmeln gewesen und hatte ihm die Hände geküßt.
»Ach,« sagte sie zu Christof, »wie unendlich hätte ich ihn geliebt!«
Aber er ergänzte seinen Vorschlag sofort:
»Du weißt natürlich, mein Kind, für nichts ist nichts ...«
Sie war noch unberührt. Allen Angriffen, mit denen man sie verfolgt hatte, war sie immer mit wilder Scheu ausgewichen. Von Kindheit an hatte sie sich aus Ekel vor den traurigen Auftritten, die sie zu Hause umgaben, die Keuschheit einer kleinen Wilden bewahrt, ein glühendes Bedürfnis nach Reinheit, einen Widerwillen vor schmutziger Berührung, vor niedriger Sinnlichkeit ohne Liebe: – Das alles hatte sie noch ... Die Unglückliche! ... Sie mußte bitter dafür büßen. Welch ein Hohn des Schicksals! ...
»Und Sie haben eingewilligt?« fragte Christof.
»Ach,« sagte sie, »ich hätte mich ins Feuer gestürzt, um einen Ausweg zu finden. Er drohte, mich als Diebin festnehmen zu lassen. Ich hatte keine Wahl. – Auf diese Weise bin ich denn in die Kunst eingeweiht worden ... und ins Leben ...«
»Der Elende!« murmelte Christof.
»Ja, ich habe ihn gehaßt. Aber seither habe ich soviel von dieser Sorte gesehen, daß er mir noch nicht als einer der schlimmsten erscheint. Der wenigstens hat Wort gehalten: er hat mich von seinem Schauspielerhandwerk gelehrt, was er wußte (nicht gerade viel). Er hat mich bei der Bühne untergebracht. Da war ich denn zunächst Mädchen für alles. Ich spielte die lumpigsten Rollen. Dann eines Abends, als die Soubrette plötzlich erkrankte, wagte man, mir ihre Rolle anzuvertrauen. Von da an spielte ich weiter. Man fand mich unmöglich, lächerlich, barock. Ich war damals häßlich. Das bin ich geblieben bis zu dem Tage, wo man mich plötzlich – wenn auch nicht gerade für »göttlich«, wie die Andere – so doch für das Weib im höchsten und idealsten Sinne, kurz für das Weib erklärte ... Die Schafsköpfe! – Was mein Spiel betraf, so fand man es fehlerhaft und übertrieben. Das Publikum mochte mich nicht. Die Kollegen machten sich über mich lustig. Man behielt mich nur, weil ich trotz allem zu gebrauchen und weil ich billig war. Ich kostete nicht nur wenig, sondern ich zahlte auch teures Lehrgeld. Ach, jeden Aufstieg habe ich Schritt für Schritt mit bittrem Leid, mit meinem Körper bezahlt. Die Kollegen, der Direktor, der Impresario, die Freunde des Impresario ...«
Sie schwieg, bleich, mit zusammengepreßten Lippen, mit starrem Blick, ohne zu weinen, aber man fühlte, daß ihre Seele blutige Tränen weinte. Wie unter einem Blitzstrahl lebte die ganze Schmach ihrer Vergangenheit wieder in ihr auf, aber auch der verzehrende Siegeswille, der ihr Halt gegeben hatte und der bei jeder neuen Erniedrigung, die sie erdulden mußte, nur immer leidenschaftlicher an ihr zehrte. Sie hätte sich am liebsten den Tod gewünscht, aber es wäre zu furchtbar gewesen, inmitten all dieser Demütigungen zugrunde zu gehen und nicht hindurchzukommen. Sich vorher das Leben nehmen, gut! Oder nach errungenem Sieg. Aber nicht, wenn man sich erniedrigt hat, ohne ans Ziel gelangt zu sein ...
Sie schwieg. Christof wanderte grimmig im Zimmer auf und ab. Er hätte jene Leute morden mögen, die dieser Frau Leid zugefügt, sie in den Schmutz gezogen hatten. Er sah sie mit tiefem Mitleid an; und wie er so vor ihr stand, nahm er ihren Kopf zwischen seine Hände, strich ihr liebevoll über Schläfen und Stirn und sagte:
»Armes, kleines Wesen!«
Sie machte eine Bewegung, ihn abzuwehren. Er sagte:
»Haben Sie keine Angst vor mir; ich habe Sie wirklich lieb.«
Da rannen Tränen über Françoises bleiche Wangen. Er kniete neben ihr nieder und küßte la lunga man d'ogni bellezza piena ..., die schönen, schmalen und feinen Hände, auf die zwei Tränen gefallen waren.
Dann setzte er sich wieder hin. Sie hatte die Fassung zurückgewonnen und nahm in Ruhe ihren Bericht wieder auf:
Ein Dichter hatte sie endlich zur Höhe geführt. Er hatte in diesem sonderbaren Geschöpf einen Dämon, ein Genie entdeckt, – ja, was ihm eigentlich noch mehr bedeutete, »einen Theater-Typus, ein neues Weib, die Repräsentantin einer ganzen Zeit«. Natürlich hatte er sie zu seiner Geliebten gemacht, wie so viele andere vor ihm. Und sie hatte sich ihm, wie so vielen anderen, hingegeben, ohne Liebe, ja sogar mit dem entgegengesetzten Empfinden. Aber er hatte ihren Ruhm begründet, und sie den seinen.
»Jetzt aber,« sagte Christof, »können die anderen Ihnen nichts mehr anhaben, und Sie machen mit ihnen, was Sie wollen.«
»Glauben Sie das wirklich?« fragte sie bitter.
Und sie erzählte ihm – was wiederum wie ein Hohn des Schicksals aussah – von einer Leidenschaft, die sie für einen elenden Wicht empfand, den sie im Grunde verachtete: einen Literaten, der sie ausgebeutet hatte, der ihr die schmerzlichsten Geheimnisse entlockt hatte, um sie literarisch zu verwerten, und der sie dann verließ.
»Ich verachte ihn wie den Kot an meinen Schuhen,« sagte sie, »und ich bebe vor Wut, wenn ich daran denke, daß ich ihn liebe, daß ein Wink von ihm genügen würde, damit ich zu ihm liefe und mich vor diesem Elenden demütigte. Aber was kann ich machen? Mein Herz liebt niemals, was mein Geist verlangt; und abwechselnd muß ich eins dem anderen opfern, eins vor dem anderen demütigen. Ich habe ein Herz. Ich habe einen Körper. Und beide schreien, sie schreien und wollen ihren Anteil am Glück. Und ich habe nicht die Kraft, sie zu zügeln, ich glaube an nichts, ich bin frei ... Frei? Sklave meines Herzens und meines Leibes bin ich, die oft, fast immer, mir entgegenarbeiten. Sie reißen mich fort, und ich schäme mich dessen. Aber, was kann ich machen?«
Sie schwieg einen Augenblick und stocherte mechanisch mit der Feuerzange in der Asche herum.
»Ich habe immer gelesen, daß Schauspieler nichts empfinden,« sagte sie. »Und die ich kenne, sind wirklich fast alle große Kinder, voller Selbstgefälligkeit, die sich höchstens um kleine Eitelkeitsfragen Sorgen machen. Ich weiß nicht: sind sie keine echten Schauspieler, oder bin ich es nicht? Ich glaube beinahe, ich bin es nicht. In jedem Fall muß ich für die anderen büßen.« Sie redete nicht weiter. Es war drei Uhr nachts. Sie wollte gehen. Christof schlug ihr vor, mit der Heimkehr bis zum Morgen zu warten und bot ihr an, sich auf seinem Bett auszustrecken. Sie zog es vor, im Lehnstuhl neben dem erloschenen Kamin sitzen zu bleiben, und plauderte ruhig weiter. Die Stille des Hauses umgab sie.
»Sie werden morgen müde sein?«
»Daran bin ich gewöhnt. Aber wie ist's mit Ihnen? Was haben Sie morgen vor?«
»Ich bin frei; nur eine Stunde gegen elf Uhr ... Und außerdem bin ich aus festem Holz.«
»Ein Grund mehr, um fest zu schlafen.«
»Ja, ich schlafe wie ein Sack, kein Kummer hält da stand. Manchmal bin ich wütend, daß ich so gut schlafe. Wieviele Stunden verliert man damit! ... Es freut mich kolossal, daß ich mich wenigstens einmal am Schlaf rächen und ihm eine Nacht stehlen kann.«
So plauderten sie weiter, halblaut, mit längeren Unterbrechungen. Und Christof schlummerte darüber ein. Françoise lächelte, sie schob ihm ein Kissen unter den Kopf, damit dieser nicht zur Seite fiele ... Sie setzte sich ans Fenster und schaute traumverloren in den dunklen Garten, in dem es bald zu tagen begann. Gegen sieben Uhr weckte sie Christof sanft auf und sagte ihm Lebewohl.
Im Laufe des Monats kam sie öfters zu Tageszeiten, wenn Christof gerade ausgegangen war. Sie fand die Türe verschlossen. Christof gab ihr daher einen Wohnungsschlüssel, damit sie, wann sie wolle, hineinkönne. Mehr als einmal kam sie auch wirklich, während Christof nicht da war. Dann hinterließ sie auf dem Tisch ein Veilchensträußchen oder ein paar Worte auf einem Zettel, irgend ein Gekritzel, eine kleine Zeichnung, eine Karikatur – als Zeichen, daß sie dagewesen war.
Und eines Abends kam sie nach der Theatervorstellung zu Christof, um wieder einmal freundschaftlich mit ihm zu plaudern. Sie fand ihn bei der Arbeit. Sie unterhielten sich.
Aber gleich bei den ersten Worten fühlten sie, daß sie beide nicht in derselben wohltuenden Verfassung waren wie das letzte Mal. Sie wollte gehen; aber es war zu spät. Christof legte ihr zwar nichts in den Weg. Es war ihr eigenster Wille, der es nicht mehr zuließ. So blieben sie denn zusammen, während sie fühlten, wie das Begehren langsam in ihnen wuchs. Und sie gaben sich einander hin.
Nach dieser Nacht verschwand sie für Wochen. Er aber, in dem diese Nacht die seit Monaten schlafende Sinnenglut von neuem entfacht hatte, konnte sie nicht entbehren. Sie hatte ihm verboten, sie zu besuchen. So ging er, sie im Theater zu sehen. Er saß verborgen auf einem der hintersten Plätze; und er wurde von Liebe und Erregung durchglüht. Er erschauerte bis ins Mark. Die tragische Glut, die sie in ihre Rollen goß, griff verzehrend auf ihn über. Schließlich schrieb er ihr:
»Liebste Freundin, zürnen Sie mir denn? Vergeben Sie mir, wenn ich Ihr Mißfallen erregt habe.«
Nach Empfang dieses demütigen Wortes kam sie zu ihm gelaufen und warf sich ihm in die Arme.
»Es wäre besser gewesen, wenn wir einfach gute Freunde geblieben wären. Aber es ging halt nicht; jetzt hat's keinen Sinn, gegen das Unabwendbare anzukämpfen; mag kommen, was will!«
Sie gehörten zueinander. Aber sie behielten beide ihre Wohnung und ihre Freiheit. Françoise hätte sich an ein regelmäßiges Zusammenwohnen mit Christof nicht gewöhnen können. Es hätte auch gar nicht zu ihrer ganzen Lebensweise gepaßt. Sie kam zu Christof, verbrachte einen Teil ihrer Tage und Nächte mit ihm; aber täglich kehrte sie nach Hause zurück und blieb auch oft über Nacht dort.
Während der Ferienmonate, in denen das Theater geschlossen war, mieteten sie sich zusammen eine Wohnung in der Umgegend von Paris, in der Nähe von Gif. Dort verlebten sie glückliche Tage, trotz einiger getrübter Stunden, Tage voll Vertrautheit und Arbeit. Sie hatten ein schönes, hochgelegenes, helles Zimmer mit weitem, freiem Ausblick über die Felder. Nachts sahen sie von ihrem Bett aus durch die Scheiben sonderbare dunkle Wolken über den matterleuchteten Himmel ziehen. Einer in des anderen Arm hörten sie halb im Schlaf die freudentrunkenen Grillen zirpen, die Gewitterregen niederrauschen. Der Atem der sommerlichen Erde – Geißblatt, Clematis, Glyzinien, frisch gemachtes Heu – durchduftete das Haus und ihre Körper. Schweigen der Nacht. Schlaf zu zweien. Stille. Weit in der Ferne Hundegebell. Hahnenschrei. Der Morgen graut. Ein feines Frühgeläut klingt vom fernen Kirchturm in die graue, kalte Morgendämmerung; die Körper schauern in ihrem lauen Nest zusammen und drängen sich liebevoll aneinander. Vogelstimmen erwachen in dem Weinspalier der Hauswand. Christof öffnet die Augen, hält den Atem an und betrachtet gerührt neben sich das vertraute, müde, liebesblasse Gesicht der schlafenden Freundin.
Ihre Liebe war keine selbstsüchtige Leidenschaft. Sie war eine tiefe Freundschaft, in der die Körper auch ihr Teil begehrten. Sie fielen sich nicht zur Last. Jeder arbeitete für sich. Françoise liebte an Christof das Talent, seine Güte, die Reinheit seines Charakters. In manchen Dingen fühlte sie sich älter als er und hatte eine mütterliche Freude daran. Daß sie nichts von dem, was er spielte, verstand, tat ihr leid: ihr war die Musik verschlossen, außer in seltenen Augenblicken, in denen eine wilde Erregung sie ergriff, die ihren Grund weniger in der Musik als in ihr selbst hatte, und in der Leidenschaftlichkeit, die dann nicht nur sie, sondern alles, was sie umgab, durchdrang: Landschaft, Menschen, Farben und Töne. Doch auch durch diese geheimnisvolle Sprache hindurch, die sie nicht verstand, fühlte sie Christofs Genie. Es war, als sähe sie einen großen Schauspieler in einer ihr fremden Sprache spielen. Ihr eigenes Talent wurde davon neu belebt. Und Christof verdankte es der Liebe, daß er neue Gedanken formen, seine leidenschaftlichen Empfindungen gestalten konnte in dem Gedanken an diese Frau und unter dem Eindruck ihrer geliebten Gestalt. So sah er alles schöner, als es in ihm selber lebte, sah es in einer antiken und gleichsam ewigen Schönheit. Unerschöpflicher Reichtum strömte ihm zu aus der Vertrautheit mit einer solchen Seele, die weiblich schwach und gut und grausam und von genialen Gedanken durchzuckt war. Sie gab ihm über das Leben und die Menschen viele Aufschlüsse, auch über die Frauen, die er noch recht schlecht kannte, und die sie mit Scharfblick beurteilte. Vor allem lernte er durch sie das Theater besser verstehen; durch sie drang er in den Geist dieser wundervollen, vollkommensten Kunst ein, dieser kargsten und reichsten aller Künste. Sie offenbarte ihm die Schönheit dieses Zauberinstrumentes menschlicher Träume – und überzeugte ihn, daß er für dieses Instrument und nicht nur für sich allein schreiben müsse, wie es seine Neigung war – (die Neigung nur allzu vieler Künstler, die nach Beethovens Beispiel sich weigern, »an ihre elende Geige zu denken, wenn der Geist zu ihnen spricht«). Ein großer Dramatiker schämt sich nicht, für eine bestimmte Bühne zu schreiben und seine Ideen den Schauspielern anzupassen, die er zur Verfügung hat; er weiß, daß er sich damit nichts vergibt und daß ein großer Theaterraum andere Ausdrucksmittel verlangt als ein kleiner, daß man für eine Flöte keine Trompetenstöße setzen darf. Wie das Fresko erschöpft das Theater die Kunst am reinsten. Deshalb ist es die menschliche Kunst im höchsten Sinne: die lebendige Kunst.
Die Gedanken, die Françoise in dieser Weise zum Ausdruck brachte, stimmten gut mit denen Christofs überein, der in diesem Augenblick seiner Laufbahn eine Gesamtkunst erstrebte, die ihn mit den anderen Menschen verbände. Françoises Erfahrung offenbarte ihm den geheimnisvollen Zusammenklang zwischen Publikum und Schauspielern. Wenn auch Françoise durchaus realistisch war und sich nur wenigen Illusionen hingab, so war sie doch von der gegenseitigen Suggestivkraft überzeugt, von den Wellen einer Sympathie, die den Schauspieler mit der Menge verbinden, und von der hohen Weihe in Tausenden von Seelen, aus der die Stimme des einen Mittlers sich erhebt. Natürlich empfand sie das nur ab und zu wie ein höchst seltenes Aufleuchten, das sich fast niemals bei demselben Stück und in derselben Umgebung wiederholte. Während der übrigen Zeit handelte es sich um das seelenlose Handwerk, den ausgeklügelten und kalten Mechanismus. Aber das Interessante ist die Ausnahme – der Blitzstrahl, bei dessen Schein man in den Abgrund schaut, in die Gesamtseele von Millionen Wesen, deren Kraft eine Ewigkeitssekunde lang in uns selbst lebendig wird.
Diese Gesamtseele soll der große Künstler zum Ausdruck bringen. Sein Ideal soll ein lebendiges Sich-Objektivieren sein, in dem der Sänger mit denen eins wird, für die er singt, und sich von seinem Selbst befreit, um den allmenschlichen Leidenschaften, die gleich einem Sturm durch die Welt brausen, Gestalt zu verleihen. Françoise empfand um so mehr das Bedürfnis nach einer solchen Kunst, als sie selber solcher Selbstverleugnung nicht fähig war und immer nur sich selber spielte. – Die wuchernde Blüte des individuellen Lyrismus hat seit anderthalb Jahrhunderten etwas Krankhaftes. Die seelische Größe besteht darin, viel zu fühlen und viel zu beherrschen, zurückhaltend in Worten und keusch in Gedanken zu sein, seine innere Welt nicht zur Schau zu stellen, sondern durch einen Blick zu sprechen, durch ein tiefes Wort, ohne kindische Übertreibungen, ohne weibischen Gefühlsüberschwang, für die zu sprechen, die Andeutungen verstehen, für die Menschen. Die moderne Musik, die so unendlich viel von sich selbst redet und jede Gelegenheit zu ihren schwatzhaften Vertraulichkeiten ergreift, beweist Mangel an Schamgefühl und Geschmack. Sie gleicht gewissen Kranken, die nur an ihre Krankheiten denken und nicht müde werden, zu anderen in widerlichen und lächerlichen Einzelheiten darüber zu sprechen. Solche künstlerischen Albernheiten greifen seit einem Jahrhundert immer mehr um sich. Françoise, die nicht musikalisch war, neigte dazu, ein Zeichen des Niederganges der Musik schon darin zu sehen, daß sie sich gleich einem fressenden Polypen auf Kosten der Dichtkunst entwickelte. Christof widersprach; aber nach reiflicher Überlegung fragte er sich, ob nicht doch etwas Wahres daran sei. Die ersten Melodien, die man zu Goethes Gedichten schrieb, waren zurückhaltend und dem Texte kongenial; bald aber verschmilzt Schubert seinen romantischen Gefühlsüberschwang mit ihnen und entstellt sie dadurch; und Schumann erfüllt sie mit der Liebessehnsucht kleiner Mädchen; bis zu Hugo Wolf artete die Bewegung immer mehr zu einer unterstrichenen Deklamation aus, einem schamlosen Zergliedern, einem Bestreben, auch nicht den kleinsten Winkel der Seele mehr unbeleuchtet zu lassen. Jeder Schleier wird von den Geheimnissen des Herzens gerissen. Was einst zurückhaltend von einem Mann gesagt wurde, heulen heute unzüchtige Weiber, die sich nackt zur Schau stellen.
Christof schämte sich ein wenig dieser Kunst, von der auch er sich angesteckt fühlte; und wenn er auch nicht auf Vergangenes zurückgreifen wollte (was stets ein widersinniges und unnatürliches Begehren ist), so tauchte er doch immer wieder in die Seele jener Meister der Vergangenheit unter, die ihre Gedanken mit vornehmer Zurückhaltung zum Ausdruck gebracht und Sinn für eine große Gesamtkunst besessen hatten; wie Händel, der, den tränenreichen Pietismus seiner Zeit und seiner Rasse verachtend, die gewaltigen » anthems« und seine Oratorien schrieb: Heldengesänge, Gesänge der Völker für die Völker. Das Schwierige war nur, Anregungen zu finden, die, wie die Bibel zur Zeit Händels, in den heutigen Völkern Europas ein gemeinsames Empfinden auslösen konnten. Das Europa von heute hatte kein gemeinsames Buch mehr: nicht ein Gedicht, nicht ein Gebet, nicht eine Glaubenstat, die Allgemeingut wäre. Eine Schmach, die alle Schriftsteller, alle Künstler, alle Denker der Jetztzeit niederschmettern müßte! Nicht einer, der für alle geschrieben oder gedacht hat. Beethoven allein hat ein paar Seiten eines neuen trostreichen und brüderlichen Evangeliums hinterlassen; aber nur Musiker können es lesen, und die Mehrzahl der Menschen wird es niemals vernehmen. Wohl hat Wagner versucht, auf dem Hügel von Bayreuth eine neue, religiöse Kunst erstehen zu lassen, die alle Menschen eint. Aber seine große Seele war nicht schlicht genug und allzu sehr von den Mängeln der im Niedergang begriffenen Musik und Denkart seiner Zeit gezeichnet: so haben sich auf dem heiligen Berg nicht die galiläischen Fischer, sondern die Pharisäer eingefunden.
Christof fühlte wohl, was es zu tun galt, aber es fehlte ihm ein Dichter. Er mußte an sich selbst Genüge finden, sich auf die Musik allein beschränken. Und die Musik ist, was immer man dagegen sagen mag, keine Sprache für die Allgemeinheit: Der Bogen der Worte ist nötig, will man den Pfeil der Töne in aller Herzen dringen lassen.
Christof plante eine Symphonienfolge, die aus dem täglichen Leben ihre Anregung schöpfen sollte. Unter anderem faßte er den Gedanken zu einer Symphonia domestica, in seinem Stil, der einigermaßen von dem Richard Strauß' abwich. Ihm war es nicht darum zu tun, in einem kinematographischen Bild das Familienleben zu veranschaulichen und dabei ausgetretene Wege zu wandeln; er wollte in seine musikalischen Themen nicht verschiedene Personen hineinzwängen, die man dann sich entwickeln sah, falls man willige Ohren und Augen hatte. Dergleichen erschien ihm wie das gelehrte und kindische Spiel eines großen Kontrapunktisten. Er suchte weder Personen noch Taten zu beschreiben, sondern Empfindungen zum Ausdruck zu bringen, die jedem bekannt wären und in denen jeder ein Echo seiner eigenen Seele, vielleicht einen Zuspruch finden könnte. Der erste Teil brachte das ernste und kindhafte Glück eines jungen Liebespaares zum Ausdruck, ihre zarte Sinnlichkeit, ihr Vertrauen in die Zukunft, ihre Freude und ihre Hoffnungen. Der zweite Teil war eine Elegie auf den Tod eines Kindes. Christof hatte dabei das Ausmalen des Todes, jeden Versuch eines wirklichkeitsgetreuen Schmerzausdruckes voller Abscheu gemieden; bestimmte Einzelgestalten verschwanden; da war nur ein großes Leid – das deine, das meine, das jedes Menschen, wenn er einem Unglück gegenübersteht, das das Los aller ist oder sein kann. Die durch solche Trauer zu Boden gedrückte Seele, die Christof mit Vermeidung der gewöhnlichen Effekte eines tränenreichen Melodramas zum Ausdruck zu bringen suchte, erhob sich nach und nach in schmerzvollem Aufschwung, um ihr Leid Gott als Opfer darzubringen. Tapfer nahm sie ihren Weg wieder auf, in dem Teil, der sich an den zweiten anschloß, einer eigenwilligen Fuge, deren kühner Wurf, deren beharrlicher Rhythmus sich schließlich des ganzen Wesens bemächtigte und aus Kämpfen und Tränen zu einem machtvollen Marsch überleitete, der erfüllt war von unbesiegbarem Glauben. Das letzte Stück schilderte den Lebensabend. Die Anfangsthemen tauchten darin wieder auf mit ihrem rührenden Vertrauen und ihrer vom Alter unberührten Zartheit, nur gereifter, leiderfahrener; sie tauchten, von Licht gekrönt, aus dem Schatten des Schmerzes empor und trieben in reicher Blütenpracht zum Himmel auf, ein Hymnus heiliger Liebe zum Leben und zu Gott.
Christof suchte auch in den Büchern der Vergangenheit schlichte und menschlich große Gegenstände, die dadurch, daß sie das Wertvollste, was es auf Erden gibt, berühren, zu Herzen sprechen konnten. So wählte er zwei: Josef und Niobe. Dabei aber wurde Christof nicht nur der Mangel eines Dichters fühlbar, sondern die seit Jahrhunderten umstrittene und niemals entschiedene Frage nach der Verbindung zwischen Dichtung und Musik wurde für ihn brennend. Seine Unterhaltungen mit Françoise führten ihn wieder zu den früher einmal mit Corinna flüchtig durchgesprochenen Plänen einer Form des Musikdramas, die sich zwischen rezitativer Oper und gesprochenem Drama bewegt – einer Kunst des freien Wortes, das sich mit der freien Musik eint, – einer Kunst, die kaum ein Künstler der Jetztzeit in Erwägung zieht und die die eingearbeitete, von Wagnerischen Überlieferungen umnebelte Kritik verleugnet, wie sie jedes wirklich neue Werk verleugnet; denn es handelt sich dabei ja nicht darum, in Beethovens, Webers, Schumanns, Bizets Fußtapfen zu treten, obgleich diese das Melodrama in genialer Weise gemeistert haben. Es handelt sich nicht darum, irgend eine Sprechstimme mit irgend einer Musik zusammenzuleimen, und mit Tremolos um jeden Preis plumpe Effekte auf ein plumpes Publikum auszuüben; es handelt sich darum, eine neue Kunstart zu schaffen, in der die Gesangsstimmen sich stimmverwandten Instrumenten vermählen und in ihren harmonischen Versen das Echo von Träumereien und Klagen der Musik in zarter Weise verschmelzen. Selbstverständlich würde eine solche Kunstform sich nur für gewisse Dinge eignen, nur den poetischen Duft gewisser intimer und straffer Seelenzustände wiedergeben können. Nur eine im höchsten Sinne zurückhaltende und aristokratische Kunst könnte das fertigbringen. Natürlich ist also wenig Aussicht vorhanden, daß sie sich in einer Zeit entfalten wird, die, den Ansprüchen ihrer Künstler zum Trotz, durch und durch von Parvenu-Gewöhnlichkeit erfüllt ist.
Vielleicht war Christof ebenso wenig wie die anderen für eine solche Kunst geschaffen. Gerade seine besten Gaben, seine plebejische Kraft, bedeuteten hier ein Hindernis. Er konnte sich diese Kunst nur vorstellen und mit Françoises Hilfe einige flüchtige Entwürfe zustande bringen.
So übertrug er fast wörtlich in die Musik einige Seiten aus der Bibel; den unsterblichen Auftritt, in dem sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gibt, bei dem er nach allen Prüfungen nicht mehr Herr seiner Bewegung und Zärtlichkeit werden kann und ganz leise jene Worte murmelt, die dem alten Tolstoi und manchem anderen Tränen entlockt haben: »Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Tretet doch her zu mir, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr in Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht, und denket nicht, daß ich euch darum zürne, daß ihr mich hierher verkauft habt; denn um eueres Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt.«
Diese schöne und freie Verbindung konnte nicht immer bestehen bleiben. Sie durchlebten zusammen Augenblicke größter Lebensfülle; aber sie waren allzu verschieden. Und da einer wie der andere gleich heftig war, kam es oft zu Reibereien zwischen beiden. Solche Reibereien nahmen niemals einen gewöhnlichen Charakter an; denn Christof schätzte Françoise zu hoch, und Françoise, die manchmal so rücksichtslos sein konnte, war gütig zu denen, die gut zu ihr waren; ihnen hätte sie um nichts in der Welt wehtun mögen. Beide hatten zudem einen guten Vorrat an heiterem Humor. Sie machte sich als erste über sich selbst lustig. Andererseits quälte sie sich darum nicht weniger; denn die alte Leidenschaft hielt sie noch immer im Bann; sie hörte nicht auf, an den Lumpen zu denken, den sie liebte; und dieser erniedrigende Zustand war ihr unerträglich; zumal da Christof ihn ahnte.
Christof sah, wie sie ganze Tage lang schweigsam und zusammengekrampft in ihre Schwermut versunken dasaß, und er wunderte sich, daß sie nicht glücklich war.
Sie war ans Ziel gelangt; sie war eine große Künstlerin, war bewundert, verwöhnt ...
»Ja,« sagte sie dann, »wäre ich eine jener sauberen Komödiantinnen mit der Krämerseele, die in Theater machen, als machten sie Geschäfte! Die sind zufrieden, wenn sie es zu etwas »gebracht haben«, eine reiche, anständige Heirat gemacht und als ein non plus ultra die Ehrenlegion ergattert haben. Ich aber wollte mehr. Erscheint einem der Erfolg nicht noch leerer als der Mißerfolg, wenn man kein Idiot ist? Du solltest doch auch etwas davon wissen!«
»Ich weiß es wohl!« sagte Christof, »du lieber Gott! Als ich noch ein Kind war, habe ich mir den Ruhm auch etwas anders vorgestellt. Mit welcher Glut sehnte ich ihn herbei, und wie strahlend erschien er mir! Etwas Heiliges war er für mich! ... Nun, wenn auch! Im Erfolg liegt doch etwas Göttliches: das Gute, das man dadurch tun kann.«
»Welches Gute? Man hat gesiegt. Aber was nützt das? Nichts ändert sich dadurch. Theater, Konzerte, alles bleibt immer beim alten. Es folgt nur eine neue Mode der anderen. Sie verstehen einen doch nicht oder höchstens oberflächlich; und schon denken sie an etwas anderes ... Verstehst denn du etwa die anderen Künstler? In jedem Falle wirst du von ihnen nicht verstanden. Wie fern stehen dir selbst die, die du am meisten liebst! Denke an deinen Tolstoi!«
Christof hatte ihm geschrieben; er war von ihm begeistert, er weinte, wenn er seine Bücher las. Er wollte eine seiner Erzählungen für die Muschiks vertonen und hatte ihn um die Erlaubnis gebeten und ihm seine Lieder geschickt. Tolstoi hatte darauf nicht geantwortet; ebenso wenig wie Goethe Schubert und Berlioz geantwortet hatte, als sie ihm ihre Meisterwerke schickten. Er hatte sich Christofs Musik vorspielen lassen, und sie hatte ihn geärgert. Er hatte nicht das geringste Verständnis für sie. Er hielt Beethoven für dekadent und Shakespeare für einen Gaukler. Dafür ließ er sich von geschniegelten Musikerchen einnehmen, von Spinettmelodien, die einen zopfigen Serenissimus entzückt hätten; und er fand, daß die »Bekenntnisse einer Kammerjungfer« ein christliches Buch seien ...
»Die Großen brauchen uns nicht,« sagte Christof, »an die anderen muß man denken.«
»An wen? an das Bürgerpack, an diese Schemen, die dir das Leben versperren? Für diese Leute soll man spielen, schreiben? Für sie sein Leben hingeben? Wie bitter ist das!«
»Bah,« sagte Christof, »ich sehe sie wie du. Und doch bekümmert mich das nicht. Sie sind nicht so schlimm, wie du sagst.«
»Du guter deutscher Optimist!«
»Es sind Menschen wie ich, warum sollten sie mich nicht verstehen? ... Und falls sie mich nicht verstehen, sollte ich deswegen verzweifeln? Unter den Tausenden werden sich immer ein oder zwei finden, die auf meiner Seite sind: das ist mir genug, es genügt eine Dachluke, um die frische Luft von draußen einzuatmen ... Denke doch an die kindhaft gläubigen Zuschauer, an die jungen, heranwachsenden Menschen, an die alten treuherzigen Seelen, die deine Erscheinung, deine Stimme, die Offenbarung tragischer Schönheit, die sie durch dich finden, über ihren jämmerlichen Alltag emportragen. Denke an die Zeit, als du selbst ein Kind warst! Ist es nicht schön, auch nur einen einzigen glücklich zu machen, nur einem so wohlzutun, wie irgend ein anderer einst dir tat?«
»Glaubst du wirklich, daß es auch nur einen solchen gibt? Mir ist selbst das zweifelhaft geworden ... Und dann, wie lieben uns denn selbst die besten? Wie sehen sie uns? Sie sehen so schlecht! Sie demütigen einen mit ihrer Bewunderung; es macht ihnen genau so viel Spaß, die erste beste Schmierenkomödiantin spielen zu sehen, sie stellen einen auf dieselbe Stufe mit den Idioten, die man verachtet. Alles, was Erfolg hat, gilt für sie gleich.«
»Und doch zwingen sich schließlich nur die wahrhaft Großen der Nachwelt als die Größten auf.«
»Das ist Fernwirkung. Die Berge wachsen, je weiter man von ihnen zurücktritt. Man kann dann besser ihre Höhe ermessen; aber man ist ihnen auch ferner ... Und wer sagt uns übrigens, daß sie die Größten sind? Kennst du die anderen, die den Blicken entschwunden sind?«
»Zum Teufel,« sagte Christof, »und wenn selbst niemand empfände, was ich fühle und was ich bin, ich fühle es und ich bin es. Ich habe meine Musik, ich liebe sie, ich glaube an sie; sie ist wahrhaftiger als alles.«
»Du bist wenigstens noch frei in deiner Kunst, du kannst machen, was du willst. Was aber kann ich machen? Ich muß spielen, was man mir aufzwingt, und es bis zur Übelkeit wiederkäuen. Wir sind ja in Frankreich noch nicht ganz und gar solche Lasttiere wie die amerikanischen Schauspieler, die zehntausend mal » Rip« oder » Robert Macaire« spielen, die während fünfundzwanzig Jahren ihres Lebens den Mühlstein um eine alberne Rolle drehen. Aber wir sind auf dem besten Wege dazu. Unsere Theater sind so armselig! Das Publikum verträgt das Genie nur in winzig kleinen Dosen, umkleidet mit Manierismus und modischer Literatur ... Ein »Genie, das Mode ist!« Ist das nicht zum Lachen? Welche Kraftverschwendung! Denke bloß daran, was sie aus einem Mounet gemacht haben! Was hat man ihm in seinem Leben zu spielen gegeben? Zwei oder drei Rollen, um die es die Mühe lohnt zu leben: den Ödipus, den Polyeukt. Alles andere sind Nichtigkeiten! Ist das nicht ekelhaft? Und dabei zu denken, wieviel Schönes und Großes er hätte leisten können! ... Außerhalb Frankreichs ist es nicht besser. Was haben sie aus einer Duse gemacht? Womit hat sie ihr Leben hingebracht? Mit welchen überflüssigen Rollen!«
»Eure wahre Rolle besteht darin, der Welt die starken Kunstwerke aufzuzwingen,« sagte Christof.
»Man reibt sich umsonst auf, und es lohnt nicht der Mühe. Sobald eines jener starken Werke mit der Bühne in Berührung kommt, verliert es seine große Dichtkraft, wird verlogen. Der Atem des Publikums macht es welk. Dieses Publikum in der stickigen Atmosphäre der Städte weiß nichts mehr von der freien Luft, von der Natur, von gesunder Dichtung: es braucht eine mit Flitter überladene, geschminkte Theaterdichtung, die obendrein noch übel duftet. – Ach, und dann ... dann ... Wenn man nun sogar zum Ziel käme ... Das füllt noch kein Leben aus, nein, mein Leben füllt das nicht aus ...«
»Du denkst immer noch an ihn?«
»An wen?«
»Du weißt ganz gut – an jenen Mann.«
»Ja!«
»Selbst wenn du jenen Mann besäßest und er dich liebte, so würdest du doch nicht glücklich sein, gestehe dir das doch ein, du würdest immer noch Mittel und Wege finden, dich zu quälen.«
»Das ist wahr! Ach, woran liegt das nur? ... Siehst du, ich habe zuviel kämpfen müssen, ich habe mich zu sehr aufgerieben, ich kann keine Ruhe mehr finden. Es ist eine Unrast in mir, ein Fieber ...«
»Das muß aber in dir gewesen sein, selbst vor all dem, was du durchgemacht hast.«
»Wohl möglich. Ja, als ich noch ein kleines Mädchen war, soweit ich zurückdenken kann ... hat das schon an mir gezehrt.«
»Was möchtest du denn?«
»Weiß ich es? Mehr als ich haben kann.«
»Ich kenne das,« sagte Christof, »ich war als junger Bursche ebenso.«
»Ja, aber du bist ein Mann geworden. Ich werde ewig in den Entwickelungsjahren stecken bleiben; ich bin ein unvollkommenes Geschöpf.«
»Niemand ist vollkommen. Glück heißt: seine Grenzen kennen und sie lieben.«
»Das kann ich nicht mehr. Ich habe sie schon überschritten. Das Leben hat mich vergewaltigt, verbraucht, verstümmelt. Und doch ist es mir, als hätte ich trotzdem eine normale Frau werden können, gesund und schön, ohne dabei der großen Herde zu gleichen.«
»Das kannst du noch werden. Ich sehe dich so gut vor mir.«
»Sag mir, wie du mich siehst.«
Er schilderte sie unter Verhältnissen, in denen sie sich natürlich und harmonisch entwickelt hätte, in denen sie, liebend und geliebt, glücklich gewesen wäre. Und das zu hören, tat ihr wohl. Dann aber sagte sie:
»Nein, jetzt ist das unmöglich.«
»Nun,« meinte er, »dann muß man sich eben sagen, wie der gute alte Händel, als er blind wurde«:

Und er sang es ihr am Klavier vor; sie küßte ihn, ihren lieben, närrischen Optimisten. Er tat ihr wohl. Sie aber schadete ihm, so fürchtete sie wenigstens. Sie hatte Anfälle von Verzweiflung, die sie ihm nicht verbergen konnte. Die Liebe machte sie schwach. Nachts, wenn sie Seite an Seite im Bett lagen, und sie ihre Ängste schweigend hinunterwürgte, ahnte er es und beschwor die Freundin, die so nah und doch so fern war, die Last, die sie bedrückte, doch mittragen zu dürfen; dann konnte sie nicht widerstehen, sie weinte in seinen Armen und schüttete ihm ihr ganzes Herz aus; er brachte Stunden damit zu, sie gütig zu trösten, ohne je ärgerlich zu werden. Aber mit der Zeit begannen diese dauernden Angstzustände doch, ihn niederzudrücken. Françoise zitterte davor, daß ihr Fieber ihn schließlich anstecken könnte; sie liebte ihn zu sehr, um den Gedanken ertragen zu können, daß er ihretwegen litte. Man bot ihr einen Vertrag nach Amerika. Sie nahm ihn an, um sich zum Fortgehen zu zwingen. Sie verließ ihn, ein wenig beschämt. Und auch er war es. Warum konnte man einander nicht glücklich machen?
»Mein armer Junge,« sagte sie zärtlich mit traurigem Lächeln, »sind wir nicht schrecklich ungeschickt? Wir werden niemals wieder so schöne Glücksmöglichkeiten finden, niemals eine ähnliche Freundschaft. Aber es hilft nichts, es hilft alles nichts. Wir sind zu dumm!«
Sie schauten einander mit Armesündermienen bekümmert an. Sie lachten, um nicht zu weinen, küßten sich und gingen mit Tränen in den Augen auseinander. Niemals hatten sie sich so geliebt, wie jetzt, da sie sich verließen. Und als sie fort war, kehrte er zur Kunst, seiner alten Gefährtin, zurück ... O, Frieden des Sternenfirmamentes!
Kurze Zeit darauf bekam Christof einen Brief von Jacqueline; es war erst das dritte Mal, daß sie ihm schrieb. Und der Ton war von ihrem sonstigen sehr verschieden. Sie sprach ihm ihr Bedauern aus, ihn so lange nicht gesehen zu haben, und lud ihn liebenswürdig ein, doch einmal wiederzukommen, wenn er nicht zwei Freunde, die ihn herzlich liebten, betrüben wolle. Christof war sehr erfreut, wunderte sich aber nicht allzu sehr. Er hatte immer gedacht, daß Jacquelines ungerechte Stellungnahme ihm gegenüber nicht ewig dauern könne. Er wiederholte sich gern ein Scherzwort des alten Großvaters:
»Früher oder später kommt den Frauen die Erleuchtung; man muß nur die Geduld haben, darauf zu warten.«
So kehrte er denn wieder bei Olivier ein und wurde freudig empfangen. Jacqueline zeigte sich voller Zuvorkommenheit; sie vermied ihren ironischen Ton, nahm sich in acht, um nichts zu sagen, was Christof verletzen konnte, zeigte Anteilnahme an seinem Tun und redete in kluger Weise von ernsten Dingen. Sie erschien Christof ganz verändert. Doch sie war es nur, um ihm zu gefallen. Jacqueline hatte von Christofs Beziehungen zu der gerade berühmten Schauspielerin reden hören, denn das hatte Stoff für den Pariser Klatsch abgegeben; und Christof war ihr in einem ganz neuen Licht erschienen. Er reizte ihre Neugierde. Als sie ihn wiedersah, fand sie ihn bedeutend netter. Sogar seine Fehler erschienen ihr nicht ohne Reiz. Sie entdeckte, daß Christof genial sei, und daß es der Mühe wert wäre, sich von ihm lieben zu lassen.
Das Verhältnis in der jungen Ehe hatte sich nicht gebessert; es war sogar schlechter geworden. Jacqueline langweilte sich immer mehr; sie starb fast vor Langerweile! ... Wie einsam ist die Frau! Nur das Kind erfüllt sie ganz; und das genügt nicht, sie auf die Dauer zu fesseln: denn wenn sie wahrhaft Frau ist und nicht nur Weibchen, wenn ihre Seele reich ist und sie vom Leben etwas verlangt, ist sie für unendlich viele Dinge geschaffen, die sie nicht allein vollbringen kann; man muß ihr zu Hilfe kommen! Der Mann ist weit weniger einsam, auch wenn er noch so sehr allein ist: das Selbstgespräch genügt ihm, um seine Einsamkeit zu beleben; und ist er einsam zu zweit, so kommt er auch darüber besser hinweg; denn er merkt es weniger. Er führt immer Selbstgespräche. Er ahnt nicht, daß der Ton solcher Stimme, die unermüdlich weiter in der Einsamkeit zu sich selbst redet, die Stille fürchterlicher und die Leere entsetzlicher macht für das Wesen neben ihm, dem jedes Wort tot ist, das nicht durch die Liebe belebt wird. Er merkt es nicht; er hat auch nicht gleich der Frau sein ganzes Leben als Einsatz auf die Liebe gestellt: sein Leben ist anderwärts verankert ... Was aber soll das Leben der Frau und ihre unendliche Sehnsucht erfüllen, diese zahllosen glühenden und verschwenderischen Kräfte, die seit den vierzig Jahrhunderten der Menschheitsdauer nutzlos als Sühnopfer vor den beiden einzigen Götzen verbrennen: der vergänglichen Liebe und der Mutterschaft, diesem erhabenen Blendwerk, das Tausenden von Frauen vorenthalten bleibt und das Leben der übrigen niemals länger als ein paar Jahre ausfüllt!
Jacqueline verlor jeden Halt. Sie durchlebte Augenblicke eines Entsetzens, das sie wie Schwertspitzen durchdrang. Sie dachte: »Wozu lebe ich, wozu bin ich geboren?«
Und ihr Herz krampfte sich in Angst zusammen.
»Mein Gott, ich werde sterben, mein Gott, ich werde sterben!«
Dieser Gedanke plagte sie, er verfolgte sie des Nachts. Sie träumte, daß sie sage:
»Wir zählen jetzt 1889.«
»Nein,« antwortete man ihr, »1909.«
Dann war sie unglücklich, daß sie zwanzig Jahre älter sei, als sie geglaubt hatte.
»Alles wird vorübergehen und ich habe nicht gelebt! Was habe ich mit diesen zwanzig Jahren angefangen? Was habe ich aus meinem Leben gemacht?«
Sie träumte, sie sei vier kleine Mädchen zugleich. Alle vier lagen im selben Zimmer in getrennten Betten. Alle vier hatten die gleiche Gestalt und das gleiche Gesicht. Aber die eine war acht Jahre, die andere fünfzehn, die dritte zwanzig und die letzte dreißig Jahre alt. Es herrschte eine Epidemie. Drei waren schon gestorben. Die vierte sah sich im Spiegel und wurde von Entsetzen ergriffen: sie sah sich mit spitzer Nase, verzerrten Zügen ... Auch sie würde sterben, – und dann würde alles zu Ende sein.
»Was habe ich aus meinem Leben gemacht?«
In Tränen gebadet erwachte sie. Und der Albdruck wich nicht mit dem anbrechenden Tage. Der Albdruck war Wirklichkeit. Was hatte sie aus ihrem Leben gemacht? Wer hatte es ihr geraubt? ... Sie begann, Olivier als unfreiwilligen Mitschuldigen zu hassen. (Unfreiwillig! Was ändert das, wenn das Leid dasselbe bleibt.) – So war er eben mitschuldig an der blinden Gewalt, die sie zermalmte. Gleich darauf hatte sie Gewissensbisse; denn sie war gut; aber sie litt zu sehr. Und sie konnte nicht verhindern, daß sie diesem Menschen, der an sie gefesselt war, der ihr Leben erstickte – mochte er auch selbst unglücklich sein –, noch mehr Leid zufügte. Dann war sie noch niedergedrückter und verabscheute sich selbst; und doch fühlte sie, wenn sie nicht einen Ausweg fand, würde sie noch mehr Unheil anrichten. Tastend suchte sie ringsumher nach einem solchen Ausweg. Wie ein Ertrinkender klammerte sie sich an alles. Sie suchte sich für irgend etwas, irgend ein Werk, irgend ein Wesen einzusetzen, das ihr eigen, ihr Werk, ihr Wesen sei. Sie wollte wieder irgend eine geistige Arbeit aufnehmen. Sie lernte fremde Sprachen, begann einen Aufsatz, eine Novelle, fing an, zu malen, zu komponieren ... Vergeblich. Gleich der erste Versuch entmutigte sie. Alles war zu schwer. Und dann: was sollten ihr Bücher, Kunstwerke! »Ich weiß nicht, ob ich sie mag, ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt ...«
An manchen Tagen plauderte sie voller Lebhaftigkeit, lachte mit Olivier, schien sich für das zu erwärmen, was sie miteinander redeten und was er tat, und suchte sich so zu betäuben ...
Vergeblich! Plötzlich fiel die Erregung von ihr, ihr Herz erstarrte, tränenlos, nach Luft ringend, entsetzt, flüchtete sie fort. – Bei Olivier hatte sie teilweise Glück gehabt. Er wurde skeptisch, Gesellschaftsmensch. Sie wußte ihm dafür durchaus nicht Dank. Sie fand, daß er ebenso schwach sei wie sie. Fast jeden Abend gingen sie aus, durch die Pariser Salons schleppte sie ihre quälende Langeweile, die niemand hinter ihrem stereotypen Lächeln vermutet hätte. Sie suchte einen Menschen, der sie liebte und sie vom Abgrund zurückrisse ... Umsonst, umsonst, umsonst. – Auf ihren Verzweiflungsschrei antwortete nur die Stille.
Sie mochte Christof durchaus nicht; sie konnte seine derbe Art, seine verletzende Offenheit und vor allem seinen Gleichmut nicht ausstehen. Sie mochte ihn nicht; aber sie hatte das Empfinden, daß er wenigstens stark sei, – ein Felsen, der dem Tode Trotz bot. Und sie wollte sich an diesen Felsen klammern, an diesen Schwimmer, der die Wellen meisterte, oder – ihn mit sich in die Tiefe ziehen ...
Dann war es auch noch nicht genug, ihren Mann von seinen Freunden getrennt zu haben; sie mußte sie ihm rauben. Die anständigsten Frauen sind manchmal von einem Trieb besessen, zu versuchen, wie weit ihre Macht reicht, und noch darüber hinaus zu gehen. In solchem Mißbrauch ihrer Macht will ihre Schwäche sich die Kraft beweisen. Und wenn die Frau selbstsüchtig und eitel ist, macht es ihr eine boshafte Freude, ihrem Mann die Freundschaft seiner Freunde zu stehlen. Die Aufgabe ist leicht genug: ein paar kokette Blicke genügen. Es gibt kaum einen Mann, ob anständig oder nicht, der nicht schwach genug wäre, auf den Köder anzubeißen. Und so redlich er als Freund auch sein mag, er wird in Gedanken fast immer den Freund betrügen, mag er auch die Tat meiden. Wenn das der andere Mann merkt, ist es mit der Freundschaft aus: sie sehen sich nicht mehr mit denselben Augen. Die Frau, die das gefährliche Spiel treibt, läßt es meistens dabei bewenden und verlangt nicht mehr: sie hält sie nur beide, getrennt, in ihrer Hand.
Christof merkte Jacquelines freundliches Wesen, und er wunderte sich nicht darüber. Wenn er für jemand eine Zuneigung empfand, so neigte er in aller Harmlosigkeit dazu, es ganz natürlich zu finden, daß man auch ihn ohne jeden Hintergedanken gern habe. Er ging fröhlich auf das Entgegenkommen der jungen Frau ein; er fand sie reizend; er war von Herzen vergnügt mit ihr; und sie machte einen so guten Eindruck auf ihn, daß er beinahe glaubte, Olivier sei doch recht ungeschickt, wenn es ihm nicht gelänge, glücklich zu sein und sie glücklich zu machen.
Er begleitete die beiden für einige Tage auf einer Automobilfahrt. Und er war ihr Gast in einem Landhaus, das Langeais in der Bourgogne besaßen, einem alten Familienbesitz, den man um seiner Erinnerungen willen behielt, wohin man aber nur selten kam. Einsam lag es zwischen Weinbergen und Wäldern, außen und innen vernachlässigt. Die Fenster schlossen schlecht; ein Schimmelgeruch umwehte einen, der Duft von reifen Früchten, kühlen Schatten und dem sonnendurchglühten Harz der Bäume. Als Christof so eine Reihe von Tagen in Jacquelines nächster Nähe verbrachte, ergriff ihn nach und nach ein süßes, ein schmeichelndes Gefühl, das ihn aber nicht weiter beunruhigte; er empfand eine unschuldige, wenn auch durchaus nicht rein seelische Freude, sie zu sehen, sie zu hören, diesen anmutigen Körper zu streifen und den Hauch ihres Mundes einzuatmen. Olivier wurde ein wenig besorgt, schwieg jedoch. Er hegte keinerlei Verdacht; aber eine unbestimmte Unruhe bemächtigte sich seiner, die sich einzugestehen er sich geschämt hätte; sich zur Strafe ließ er die beiden oft allein. Jacqueline verstand ihn und war gerührt; sie hatte Lust, ihm zu sagen:
»Schau, sei nicht traurig, du Guter. Ich habe dich doch immer noch am liebsten.«
Aber sie sagte es nicht; und sie ließen sich alle drei auf gut Glück treiben: Christof war ahnungslos; Jacqueline wußte nicht recht, was sie wollte; sie überließ es dem Zufall, ob er es ihr offenbaren werde; nur Olivier allein ahnte und fühlte voraus; aber aus Scham, Stolz und Liebe wollte er nicht darüber nachdenken. Wenn der Wille schweigt, spricht der Instinkt; wenn die Seele den Körper nicht erfüllt, geht er seine eigenen Wege.
Eines Abends nach dem Essen, die Nacht erschien ihnen besonders schön – eine mondlose, sternhelle Nacht, – wollten sie noch einen Gang durch den Garten machen. Olivier und Christof gingen einstweilen hinaus; Jacqueline war in ihr Zimmer hinaufgegangen, um sich einen Schal zu holen. Als sie nicht wiederkam, schimpfte Christof über die ewige Langsamkeit der Frauen und ging wieder hinein, um Jacqueline zu holen. – (Seit einiger Zeit spielte er, ohne es selbst zu merken, den Ehemann.) – Er hörte sie kommen. In dem Zimmer, in dem er sich befand, waren die Fensterladen geschlossen, und man sah nichts.
»Nur zu! Kommen Sie doch endlich, Frau Niemalsfertig!« rief Christof fröhlich. »Die Spiegel werden noch ganz abgenutzt, wenn Sie immerfort hineinschauen.«
Sie antwortete nicht. Sie war stehen geblieben, Christof hatte den Eindruck, daß sie im Zimmer sei, aber sie rührte sich nicht.
»Wo sind Sie?« fragte er.
Sie antwortete nicht. Auch Christof schwieg. Er tastete sich im Finstern vorwärts. Und eine Unruhe ergriff ihn. Mit klopfendem Herzen blieb er stehen. Ganz nahe vernahm er den leichten Atem Jacquelines. Er machte noch einen Schritt und blieb wieder stehen. Sie stand dicht vor ihm; er wußte es; aber er vermochte nicht mehr weiter zu gehen. Ein paar Augenblicke der Stille. Plötzlich griffen zwei Hände nach den seinen und zogen ihn an sich. Ein Mund lag auf seinem Mund. Er umschlang sie. Sie sprachen nichts, sie regten sich nicht. Ihre Lippen trennten sich, rissen sich voneinander los. Jacqueline lief aus dem Zimmer. Christof folgte ihr bebend. Die Knie zitterten ihm. Er blieb einen Augenblick an die Wand gelehnt stehen und wartete, daß das Klopfen seines Blutes sich beruhigte. Schließlich kam er ihnen nach. Jacqueline plauderte ruhig mit Olivier. Sie gingen ein paar Schritte vor ihm her. Er folgte ihnen, ganz niedergeschmettert. Olivier blieb stehen und wartete auf ihn. Nun blieb auch Christof stehen. Olivier rief ihm freundschaftlich zu. Christof antwortete nicht. Olivier, der an die Grillen seines Freundes gewöhnt war und wußte, daß er sich manchmal hinter launenhaftem Schweigen dreifach verriegelte, drängte nicht weiter und setzte seinen Weg mit Jacqueline fort. Und Christof folgte ihnen mechanisch in einer Entfernung von zehn Schritt, wie ein Hund. Wenn sie stillstanden, stand auch er still; wenn sie weitergingen, ging er auch weiter. So gingen sie um den Garten herum und kehrten ins Haus zurück. Christof ging in sein Zimmer hinauf und schloß sich ein. Er zündete kein Licht an. Er legte sich nicht nieder. Er dachte nicht. Im Laufe der Nacht übermannte ihn der Schlaf, während er noch dasaß und Kopf und Arme auf den Tisch gestützt hatte. Nach einer Stunde wachte er auf. Er zündete eine Kerze an, raffte fiebernd seine Papiere und seine paar Sachen zusammen und packte seinen Handkoffer. Danach warf er sich aufs Bett und schlief bis zum Morgengrauen. Dann ging er mit seinem Gepäck hinunter und reiste ab. Man wartete den ganzen Morgen auf ihn. Man suchte ihn den ganzen Tag. Jacqueline, die unter scheinbarem Gleichmut einen bebenden Zorn verbarg, meinte mit beleidigendem Spott, daß sie wohl ihr Silber nachzählen müsse. Erst am folgenden Abend bekam Olivier einen Brief von Christof:
»Mein lieber Junge! Sei mir nicht böse, daß ich wie ein Verrückter abgereist bin. Ich bin nun einmal verrückt, das weißt Du ja. Was ist dabei zu machen? Ich bin, wie ich bin. Hab Dank für Deine herzliche Gastfreundschaft. Das hat wohlgetan. Aber weißt Du, ich bin nun mal nicht für ein Leben mit anderen geschaffen. Ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt für das Leben geschaffen bin. Ich sollte besser in meinem Winkel bleiben, und die Leute – von ferne – liebhaben; das ist klüger. Wenn ich sie aus allzu großer Nähe sehe, werde ich ein Menschenfeind. Und das will ich nicht sein. Ich will die Menschen lieben. Ich will Euch lieben. O, wie gerne möchte ich Euch allen Gutes erweisen! Wenn ich doch etwas dazu tun könnte, daß Ihr, daß Du glücklich wärst. Mit welcher Freude würde ich dafür alles Glück, das für mich bestimmt wäre, hingeben! ... Aber es ist mir versagt. Man kann anderen nur den Weg weisen. Man kann nicht an ihrer Stelle diesen Weg gehen. Jeder muß sich selbst befreien. Mach Dich frei! Macht Euch frei!
Von Herzen
Dein Christof.
Meine Empfehlung an Frau Jeannin.«
»Frau Jeannin« las den Brief mit aufeinandergepreßten Lippen und einem Lächeln der Verachtung; sie sagte trocken:
»Nun, so folge doch seinem Rat. Mach dich frei.«
Aber als Olivier die Hand ausstreckte, um den Brief wieder an sich zu nehmen, zerknüllte Jacqueline das Papier und warf es zu Boden. Zwei große Tränen fielen aus ihren Augen nieder. Olivier ergriff ihre Hand:
»Was hast du?« fragte er bewegt.
»Laß mich!« schrie sie voll Zorn.
Sie ging hinaus. Auf der Türschwelle rief sie:
»Ihr Egoisten!«
Christof hatte es schließlich dahin gebracht, sich seine Gönner vom »Grand Journal« zu Feinden zu machen. Das war leicht vorauszusehen. Der Himmel hatte Christof die durch Goethe gefeierte Tugend mitgegeben: die Undankbarkeit.
»Widerwille gegen das Danken«, schrieb Goethe ironisch, »ist sehr selten und kommt nur bei vorzüglichen Menschen vor: solchen, die, mit großen Anlagen und dem Vorgefühl derselben in einem niederen Stande oder in einer hülflosen Lage geboren, sich von Jugend auf Schritt vor Schritt durchdrängen und von allen Orten her Hülfe und Beistand annehmen müssen, die ihnen dann manchmal durch Plumpheit der Wohltäter vergällt und widerwärtig werden ...«
Christof kam es nicht in den Sinn, daß er wegen eines ihm erwiesenen Dienstes sich erniedrigen oder etwa –, was für ihn dasselbe bedeutete –, seiner Freiheit entsagen müsse. Er selbst verlieh seine Wohltaten nicht zu so und soviel Prozent, er verschenkte sie. Seine Wohltäter dachten etwas anders darüber. Sie waren in ihren sehr ausgeprägten Moralbegriffen, die sie von den Pflichten ihrer Schuldner hatten, dadurch verletzt, daß Christof sich weigerte, die Musik zu einem albernen Hymnus für ein von der Zeitung veranstaltetes Reklamefest zu schreiben. Sie gaben ihm das Unpassende seines Betragens zu verstehen. Christof schickte sie zum Teufel. Er brachte sie vollends zur Entrüstung, als er kurz darauf in einer rückhaltlosen öffentlichen Erklärung gegen Behauptungen auftrat, die ihm die Zeitung untergeschoben hatte.
Darauf begann ein richtiger Feldzug gegen ihn. Man scheute vor keiner Waffe zurück. Man zog wieder einmal aus dem Arsenal von Niederträchtigkeiten die alte Kriegsmaschine, die von jeher allen Ohnmächtigen gegen alle Neuschöpfer gedient hat: sie hat zwar noch niemanden vernichtet, aber ihren Eindruck auf die Dummen niemals verfehlt: man beschuldigte ihn des Plagiats. Man griff aus seinem Werk und aus den Arbeiten obskurer Kollegen Stellen heraus, die höchst geschickt ausgewählt und zurechtgemacht waren, und man wies nach, daß er seine Eingebungen von andern gestohlen habe. Man beschuldigte ihn der Absicht, er habe junge Künstler am Emporkommen hindern wollen. Hätte er es wenigstens nur mit jenen berufsmäßigen Kläffern zu tun gehabt, mit jenen Knirpsen von Kritikern, die auf die Schultern eines großen Mannes klettern und dann schreien: »Ich bin größer als du!«
Aber keineswegs: selbst die Begabten fallen sich gegenseitig an, jeder tut was er kann, um sich bei seinem Kollegen unausstehlich zu machen; und doch ist, wie jemand richtig sagte, die Welt so groß, daß jeder in Frieden arbeiten könnte; und jeder hat schon in seinem eigenen Talent einen Feind, der ihm genug zu schaffen macht.
Es fanden sich in Deutschland Künstler, die aus Eifersucht seinen Feinden Waffen gegen ihn lieferten, sie im Notfalle sogar erst besonders schmiedeten.
Auch in Frankreich befanden sich solche. Die Nationalisten der musikalischen Presse, – unter denen mehrere Ausländer waren, – warfen ihm seine Abstammung wie eine Beleidigung an den Kopf. Christofs Ruhm war sehr gewachsen; und da noch hinzukam, daß er in Mode war, begriff man, daß er durch seine Übertreibungen selbst Leute ohne Voreingenommenheit reizte – wieviel mehr also noch die anderen. Christof hatte jetzt in dem Konzertpublikum, unter den Gesellschaftsmenschen, Literaten, und Mitarbeitern der jüngsten Zeitschriften begeisterte Anhänger, die über alles, was er tat, außer sich gerieten, und nur zu gern erklärten, daß es vor ihm keine Musik gegeben habe. Einige deuteten seine Werke aus und fanden darin philosophische Absichten, worüber er höchst erstaunt war. Andere sahen in ihnen eine musikalische Revolution, einen Sturmlauf gegen alle Überlieferungen, die Christof doch mehr als jeder andere achtete. Ein Widerspruch von ihm wäre zwecklos gewesen. Man hätte ihm bewiesen, daß er selbst nicht wüßte, was er geschrieben habe. Indem sie ihn bewunderten, bewunderten sie sich selbst. So fand denn der Feldzug gegen Christof auch unter denen seiner Berufsgenossen lebhafte Zustimmung, die sich über das Getue ärgerten, an dem er selbst völlig unschuldig war. Sie bedurften keinerlei Gründe, um seine Musik abzulehnen. Die meisten empfanden ihm gegenüber die natürliche Gereiztheit derer, die keine Ideen haben und sie ohne viel Mühe nach erlernten Formeln ausdrücken, gegen den, der voller Ideen steckt, sich ihrer aber mit einigem Ungeschick bedient in scheinbarem Durcheinander seiner schöpferischen Phantasie. Wie oft wurde ihm der Vorwurf gemacht, er verstände sein Handwerk nicht, und zwar von elenden Musikschriftstellern, für die »Stil« nichts anderes bedeutete als ein Zusammenstellen bewährter Schulrezepte, nach denen man den Gedanken nur in hausbackene Formen zu gießen brauchte. Christofs beste Freunde waren die, die sich gar keine Mühe gaben, ihn zu verstehen, und die allein ihn verstanden, denn sie liebten ihn ganz einfach, weil er ihnen wohltat. Aber das waren arme Schlucker, die keine Stimme im Rat hatten. Der Einzige, der kraftvoll in Christophs Namen hätte antworten können, – Olivier, stand ihm damals fern und schien ihn vergessen zu haben. So war Christof seinen Widersachern und Anbetern ausgeliefert, die untereinander wetteiferten, wie sie ihm am meisten schaden könnten. Angeekelt ließ er alles über sich ergehen. Wenn er die Urteile las, die irgend einer jener anmaßenden, die Kunst beherrschenden Kritiker von der Höhe einer großen Zeitung herab mit der ganzen Unverschämtheit von sich gab, die Unwissenheit und eine gesicherte Stellung verleihen, so zuckte er die Achseln und sagte: »Denk du das Deine über mich; ich denke das Meine über dich. In hundert Jahren sprechen wir uns wieder.« Inzwischen aber nahmen die Verleumdungen ihren Lauf. Und das Publikum nahm mit aufgesperrtem Schnabel die albernsten und schmählichsten Beschimpfungen entgegen. Ausgerechnet diesen Augenblick suchte sich Christof aus, als sei seine Lage noch nicht schwierig genug, um sich mit seinem Verleger zu überwerfen. Er hatte sich eigentlich über Hecht nicht zu beklagen; dieser brachte seine neuen Werke pünktlich heraus und war in Geschäften anständig. Allerdings hinderte ihn seine Anständigkeit nicht, mit Christof Verträge abzuschließen, die für diesen ungünstig waren. Aber diese Verträge hielt er wenigstens inne. Er hielt sie nur sogar allzu genau inne. Eines Tages sah Christof zu seiner Überraschung, daß ein Septett von ihm als Quartett zurechtgemacht war und eine Reihe von zweihändigen Klavierstücken ungeschickt in vierhändige übertragen waren, ohne daß man ihn darum gefragt hätte. Er lief zu Hecht, hielt ihm das corpus delicti unter die Nase und fragte:
»Kennen Sie das?«
»Allerdings,« sagte Hecht.
»Und Sie haben es gewagt ... Sie haben gewagt, ohne meine Erlaubnis an meinen Werken herumzupfuschen?«
»Was für eine Erlaubnis?« fragte Hecht in aller Ruhe. »Ihre Werke gehören doch mir!«
»Mir aber auch, sollte ich meinen.«
»Nein,« entgegnete Hecht unentwegt.
Christof fuhr auf:
»Meine Werke gehören mir nicht?«
»Sie gehören Ihnen nicht mehr, Sie haben sie mir verkauft.«
»Sie machen sich über mich lustig. Ich habe Ihnen das Papier verkauft. Machen Sie es zu Geld, wenn Sie Lust haben. Aber was darauf geschrieben steht, das ist mein Blut, das gehört mir.«
»Sie haben mir alles verkauft. Für das Werk hier habe ich Ihnen als äußersten Betrag die Summe von dreihundert Franken bewilligt, auf der Basis eines Anteils von dreißig Centimes an jedem Exemplar der Erstausgabe. Dafür haben Sie mir ohne irgend welche Einschränkungen alle Rechte an Ihrem Werk übertragen.«
»Auch das Recht, es zu verunstalten?«
Hecht zuckte die Achseln, klingelte und sagte zu einem Angestellten:
»Bringen Sie mir die Akten von Herrn Krafft.«
Dann las er Christof bedächtig den Wortlaut des Vertrages vor, den Christof ungelesen unterschrieben hatte, und aus dem hervorging, wie es gewöhnlich in jenen Verträgen der Fall war, die in damaligen Zeiten die Musikverleger abzuschließen pflegten, »daß Herr Hecht in alle Rechte und Befugnisse des Komponisten eingesetzt wurde und das ausschließliche Recht hatte, genanntes Werk herauszugeben, zu veröffentlichen, zu stechen, zu drucken, zu übertragen, es zu verleihen oder mit Gewinn zu verkaufen, es in jeder ihm passend erscheinenden Form in Konzerten, Varietés, Tanzgesellschaften, Theatern usw. aufführen zu lassen, es für jedes beliebige Instrument, sogar mit Text versehen, einzurichten, sowie auch seinen Titel zu verändern usw. usw.«
»Sie sehen,« sagte er, »ich bin noch sehr maßvoll.«
»Augenscheinlich habe ich Ihnen noch zu danken,« sagte Christof, »Sie hätten aus meinem Septett ja schließlich auch einen Varietéschlager machen können.«
Fassungslos schwieg er und barg den Kopf in den Händen. »Ich habe meine Seele verkauft,« sagte er immer wieder.
»Seien Sie versichert,« meinte Hecht ironisch, »daß ich keinen schlechten Gebrauch davon machen werde.«
»Und zu denken,« rief Christof, »daß Ihre Republik solchen Schacher gut heißt! Ihr behauptet, der Mensch ist frei, und Ihr versteigert seine Gedanken.«
»Sie haben Ihr Geld bekommen,« sagte Hecht.
»Ja, dreißig Silberlinge,« schrie Christof; »nehmen Sie sie wieder!«
Er kramte in seinen Taschen, um Hecht die dreihundert Franken zurückzugeben; aber er hatte sie nicht. Hecht lächelte leise, ein wenig verächtlich. Dieses Lächeln brachte Christof in Wut. »Ich will meine Werke wieder haben,« rief er, »ich kaufe sie zurück!«
»Dazu haben Sie kein Recht,« sagte Hecht; »aber da mir nicht das geringste daran liegt, jemanden mit Gewalt zurückzuhalten, so willige ich ein, sie Ihnen wiederzugeben, – wenn Sie imstande sind, mir die bisher aufgelaufenen Unkosten zu ersetzen.«
»Das werde ich,« meinte Christof, »und sollte ich mich selbst verkaufen müssen.«
Er ging dann ohne weitere Erörterung auf die Bedingungen ein, die Hecht ihm vierzehn Tage später unterbreitete. In seiner unglaublichen Torheit kaufte er die Auflagen seiner Werke zu einem fünffach höheren Preis zurück, als der war, den sie ihm eingetragen hatten; und das war an sich auch durchaus nicht zuviel; denn sie waren aufs genaueste nach dem wirklichen Verdienst berechnet, den sie Hecht eintrugen. Christof war außerstande zu bezahlen; und damit hatte Hecht gerechnet. Es war ihm nicht darum zu tun, Christof in die Enge zu treiben; denn er achtete ihn als Künstler und Menschen mehr als irgend einen anderen der jungen Musiker. Aber er wollte ihm eine Lektion erteilen. Es paßte ihm nicht, daß sich jemand gegen sein gutes Recht auflehnte. Er hatte jene Bedingungen nicht geschaffen; sie waren die zu jener Zeit üblichen, und deshalb fand er sie gerecht. Im übrigen war er aufrichtig überzeugt, daß sie ebenso zum besten des Komponisten wie des Verlegers gemacht waren, der besser als der Autor die Mittel kennt, ein Werk zu verbreiten, und der sich nicht wie dieser mit gefühlsmäßigen Skrupeln aufhält, die – so ehrenwert sie sein mögen – seinem wahren Vorteil entgegen sind. Er war gewillt, Christof zum Erfolge zu führen; aber auf seine Art und Weise und unter der Bedingung, daß Christof ihm mit Haut und Haaren ausgeliefert sei. Er wollte ihn fühlen lassen, daß man sich nicht so leicht seiner Dienste entledigen könne. So schlossen sie denn einen bedingten Handel ab: wenn es Christof binnen einer Frist von sechs Monaten nicht gelingen würde, die Schuld abzutragen, so sollten die Werke volles Eigentum von Hecht bleiben. Es war leicht vorauszusehen, daß Christof nicht ein Viertel der verlangten Summe zusammenbringen konnte.
Doch Christof hatte es sich nun einmal in den Kopf gesetzt; er gab seine Wohnung auf, obgleich sie voller Erinnerungen für ihn war, um eine billigere zu nehmen; er verkaufte verschiedene Gegenstände, von denen zu seiner Überraschung keiner einen besonderen Wert hatte, stürzte sich in Schulden, indem er wieder zu Moochs Gefälligkeit seine Zuflucht nahm, der unglücklicherweise selber sehr in der Klemme, krank und durch Rheumatismus ans Haus gebannt war, suchte sich einen anderen Verleger und stieß überall auf dieselben Bedingungen wie bei Hecht, wonach dem Verlag der Löwenanteil zufiel, oder gar auf eine Ablehnung.
Das geschah zu einer Zeit, in der die Angriffe der musikalischen Presse gegen ihn am heftigsten waren. Eines der ersten Pariser Blätter war ganz besonders erbost auf ihn; irgend einer der Redakteure, der nicht einmal mit seinem Namen zeichnete, hatte ihn zur Zielscheibe genommen: es verging keine Woche, in der nicht unter den kleinen Nachrichten irgend eine niederträchtige Bemerkung stand, die ihn lächerlich machen sollte. Der Musikkritiker ergänzte die Arbeit seines maskierten Kollegen: der geringste Vorwand war ihm gut genug, um so nebenbei seiner Gehässigkeit die Zügel schießen zu lassen. Das waren aber nur die ersten Vorpostengefechte: er versprach, daß er bei Gelegenheit darauf zurückkomme und dann eine Aburteilung nach allen Regeln der Kunst vornehmen würde. Sie beeilten sich indessen nicht damit; denn sie wußten nur zu wohl, daß keine ausgesprochene Anschuldigung dem Publikum so nachdrücklichen Eindruck macht, wie eine Folge von hartnäckig wiederholten Einflüsterungen. Sie spielten mit Christof wie die Katze mit der Maus. Christof, dem man die Artikel zuschickte, hatte nur Verachtung dafür; aber er litt dennoch darunter. Er schwieg indessen; und anstatt zu antworten, – (was er übrigens, selbst wenn er es gewollt, kaum gekonnt hätte) – verbohrte er sich eigensinnig in den nutzlosen und ungleichen Kampf gegen seinen Verleger. Er verlor dabei Zeit, Kraft und Geld und seine einzigen Waffen, indem er mutwillig die Reklame los zu werden strebte, die Hecht für seine Musik machte.
Plötzlich wurde alles anders. Der in der Zeitung vorangekündigte Artikel erschien nicht. Die Einflüsterungen hörten auf; der Feldzug brach kurzerhand ab. Ja, es kam noch besser: zwei oder drei Wochen später veröffentlichte der Kritiker der Zeitung ein paar leicht hingeworfene lobende Zeilen, die anscheinend bezeugen sollten, daß der Friede geschlossen sei. Ein großer Leipziger Musik-Verleger schrieb an Christof und bot ihm die Veröffentlichung seiner Werke an; und der Vertrag wurde unter vorteilhaften Bedingungen abgeschlossen. In einem schmeichelhaften Brief, der das Siegel der Österreichischen Botschaft trug, sprach man Christof den Wunsch aus, gewisse Werke von ihm auf dem Programm der großen Empfangsabende der Botschaft zu sehen. Christofs Schützling, Philomele, wurde gebeten, sich an einem jener Abende hören zu lassen; und daraufhin forderte man sie sogleich in allen aristokratischen Salons der deutschen und italienischen Kolonie von Paris auf. Christof selbst, der nicht umhin konnte, bei einem jener Konzerte zu erscheinen, wurde von dem Botschafter aufs liebenswürdigste empfangen. Ein paar Worte der Unterhaltung zeigten ihm indessen, daß sein Gastgeber, der wenig genug von Musik verstand, nichts von seinen Werken kannte. Woher kam also dieses plötzliche Interesse? Eine unsichtbare Hand schien über ihm zu schweben, die Hindernisse hinwegzuschieben, ihm den Weg zu ebnen. Christof erkundigte sich. Der Botschafter machte eine Andeutung, daß zwei hohe Gönner, der Graf und die Gräfin Berény, ihm sehr zugetan seien. Christof kannte sie nicht einmal dem Namen nach. Und auf dem Abendempfang der Botschaft fand er keine Gelegenheit, ihnen vorgestellt zu werden. Er drängte sich auch gar nicht danach, sie kennen zu lernen. Er durchlebte gerade eine Zeit des Widerwillens gegen Menschen, in der er ebenso wenig auf Freunde wie auf Feinde zählte: Freunde und Feinde waren gleichermaßen unbeständig; ein Hauch konnte sie umwandeln; man mußte sie entbehren lernen und sich wie jener alte Mann aus dem siebzehnten Jahrhundert sagen:
»Gott hat mir Freunde gegeben, er hat sie mir genommen. Sie haben mich verlassen. Ich lasse sie, und mache mir nichts daraus.«
Seitdem er Oliviers Haus den Rücken gekehrt, hatte ihm dieser kein Lebenszeichen mehr gegeben. Alles schien aus zu sein zwischen ihnen. Christof legte keinen Wert darauf, neue Freundschaften zu schließen. Er dachte sich den Grafen und die Gräfin Berény in der Art so vieler Snobs, die sich seine Freunde nannten; und er tat nichts dazu, um ihnen zu begegnen. Er hätte sie eher geflohen.
Am liebsten hätte er ganz Paris geflohen. Er hatte das Bedürfnis, sich für ein paar Wochen in eine trauliche Einsamkeit zu flüchten. Hätte er doch einen Tag, nur einen einzigen Tag, in seiner Heimat neue Kraft schöpfen können! Nach und nach wurde dieser Gedanke zu einem krankhaften Wunsch. Er wollte seinen Fluß wiedersehen, seinen Himmel, die Erde seiner Toten. Er mußte sie wiedersehen. Doch, er konnte es nicht, ohne seine Freiheit in Gefahr zu bringen: er stand immer noch unter dem Haftbefehl, der seit seiner Flucht aus Deutschland gegen ihn erlassen worden war. Aber er fühlte sich zu allen Tollheiten bereit, wenn er dafür heimkehren konnte, und wäre es auch nur auf einen einzigen Tag.
Zum Glück sprach er mit einem seiner neuen Gönner davon. Als ein junger Attaché der deutschen Botschaft, den er an jenem Abend, als man seine Werke aufführte, kennen gelernt hatte, ihm sagte, daß sein Land auf einen Musiker wie ihn stolz sein könne, antwortete Christof bitter:
»Es ist so stolz auf mich, daß es mich vor seiner Tür sterben lassen wird, ohne mir zu öffnen.«
Der junge Diplomat ließ sich die Sachlage erklären; einige Tage später suchte er Christof auf und sagte:
»Man nimmt an hoher Stelle Interesse an Ihnen. Eine erlauchte Persönlichkeit, die allein die Macht besitzt, den über Sie verhängten Urteilsspruch aufzuheben, ist von Ihrer Lage unterrichtet worden und hat geruht, Teilnahme dafür zu zeigen. Ich begreife nicht recht, wie Ihre Musik ihm gefallen konnte; denn (unter uns gesagt) er hat keinen besonders guten Geschmack; aber er ist klug und großherzig. Wenn es auch nicht möglich ist, sofort den Haftbefehl gegen Sie aufzuheben, so will man doch ein Auge zudrücken, wenn Sie achtundvierzig Stunden in Ihrer Vaterstadt zubringen wollen, um die Ihren wiederzusehen. Hier ist ein Paß. Sie müssen ihn bei der Ankunft und bei der Abfahrt beglaubigen lassen. Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht unnütz die Aufmerksamkeit auf sich lenken.«
Christof sah die Heimaterde noch einmal wieder. Er verbrachte die beiden Tage, die ihm gewährt waren, um nur mit ihr und denen, die darin gebettet lagen, Zwiesprache zu halten. Er sah das Grab seiner Mutter. Das Unkraut wucherte darauf; aber es waren vor kurzem Blumen hingelegt worden. Seite an Seite ruhten Vater und Großvater. Er setzte sich zu ihren Füßen nieder. Das Grab war an die Friedhofsmauer angelehnt. Ein Kastanienbaum, der auf der anderen Seite im Hohlweg wuchs, beschattete es. Über die niedere Mauer hinweg sah man die goldene Saat, die der laue Wind in sanften Wellen bestrich. Die Sonne thronte über der schlummernden Erde. Man vernahm den Ruf der Wachteln in den Feldern und über den Gräbern das sanfte Rauschen der Zypressen. Christof war allein und träumte. Sein Herz war ruhevoll. Er saß, die Hände ums Knie geschlungen, den Rücken an die Mauer gelehnt, und schaute in den Himmel. Seine Augen schlossen sich für eine Sekunde. Wie einfach doch alles war! Er fühlte sich zuhause, unter den Seinen. Es war, als säße er Hand in Hand mit ihnen. Die Stunden verstrichen. Gegen Abend knirschten Schritte im Sand der Alleen. Der Friedhofswächter ging vorüber und sah Christof sitzen. Christof fragte ihn, wer die Blumen gebracht hätte. Der Mann antwortete, die Pächterin von Buir käme ein oder zweimal im Jahre vorüber.
»Lorchen?« fragte Christof.
Sie plauderten miteinander.
»Sie sind wohl der Sohn?« fragte der Mann.
»Sie hatte drei,« antwortete Christof.
»Ich meine den Hamburger; die andern sind auf Abwege geraten.«
Christof saß reglos, den Kopf ein wenig zurückgelehnt, und schwieg. Die Sonne ging unter.
»Ich schließe jetzt,« sagte der Wächter.
Christof stand auf und machte langsam mit ihm die Runde auf dem Kirchhof. Der Wächter spielte den Führer. Christof blieb stehen, um die Inschriften zu lesen. Wie viele seiner Bekannten fand er da vereint! – Der alte Euler, – sein Schwiegersohn, – dort weiter Kindheitsgefährten, kleine Mädchen, mit denen er gespielt hatte, – und dort ein Name, der ihm das Herz bewegte: Ada ...
Friede ihnen allen!
Die Flammen der untergehenden Sonne röteten den stillen Horizont. Christof schritt hinaus. Er wanderte noch lange auf den Feldern umher. Die Sterne leuchteten auf ...
Am nächsten Tag kam er wieder und verbrachte den Nachmittag am selben Platze. Aber die schöne schweigsame Ruhe von gestern hatte sich belebt. Sein Herz sang einen unbekümmerten, glücklichen Hymnus. Er saß auf der Grabeinfriedigung und schrieb auf seinen Knien mit Bleistift in ein Notizheft den Sang, den er vernahm.
So verging der Tag. Ihm war, als arbeite er in seinem einstigen Zimmerchen und die Mutter säße da, hinter der dünnen Wand. Als er fertig war und fort mußte, – er war schon einige Schritte vom Grabe entfernt, – besann er sich anders, kam zurück und vergrub das Heft im Grase unter dem Efeu. Ein paar Regentropfen begannen zu fallen. Christof dachte: »Es wird schnell verwischt sein. Nun, um so besser ...! Für dich allein, für niemand anders.«
Er sah auch den Fluß wieder, die vertrauten Straßen, in denen so vieles verändert war. Vor den Toren der Stadt, auf den alten Festungswällen, verdrängte jetzt ein kleines Akaziengehölz, das er einst hatte pflanzen sehen, die alten Bäume. Als er bei der Gartenmauer der von Kerich vorüberkam, erkannte er den Eckpfeiler, auf den er als kleiner Knirps geklettert war, um in den Park zu sehen. Und er wunderte sich, wie klein die Straße, die Mauer, der Garten geworden waren. Vor dem Gittertor am Eingang blieb er einen Augenblick stehen. Als er seinen Weg wieder aufgenommen hatte, fuhr ein Wagen vorüber. Mechanisch blickte er auf; und seine Augen begegneten denen einer frischen, üppigen, fröhlich dreinschauenden jungen Dame, die ihn neugierig musterte. Ein Ausruf des Erstaunens entfuhr ihr. Auf einen Wink von ihr hielt der Wagen. »Herr Krafft!« rief sie.
Christof blieb stehen.
Lachend sagte sie:
»Minna ...«
Da eilte er auf sie zu, war aber fast ebenso befangen wie am Tage ihrer ersten Begegnung. Sie war in Gesellschaft eines großen, dicken, kahlköpfigen Herrn mit sieghaft hochgekämmtem Schnurrbart, den sie als ihren Gatten, Herrn Reichsgerichtsrat von Brombach, vorstellte. Sie wollte, daß Christof mit ihnen ins Haus käme. Er suchte, sich zu entschuldigen. Aber Minna ereiferte sich:
Nein nein, er müsse kommen, er müsse mit ihnen essen. Sie sprach sehr laut und sehr schnell; ohne gefragt zu sein, erzählte sie gleich von ihrem Leben. Christof war durch ihren Wortschwall und ihr lautes Wesen wie betäubt; er hörte nur die Hälfte und betrachtete sie dabei. Das war also seine kleine Minna! Sie war blühend, robust, überall gut ausgepolstert, hatte eine hübsche Haut und rosige Farben, aber verschwommene Züge und eine kräftige, etwas breite Nase. Ihre Bewegungen, ihr Wesen, ihre Liebenswürdigkeit waren sich gleich geblieben; nur die Maße hatten sich verändert.
Unterdessen hörte sie nicht auf zu reden: sie erzählte Christof Geschichten aus ihrem vergangenen Leben, intime Geschichten, zum Beispiel, wie sie sich in ihren Mann verliebt habe und ihr Mann sich in sie. Christof fühlte sich peinlich berührt. Sie besaß einen kritiklosen Optimismus, der sie, wenigstens andern gegenüber –, alles, was sie betraf, vollkommen und allen andern überlegen finden ließ: ihre Vaterstadt, ihr Haus, ihre Familie, ihren Mann, ihre Küche, ihre vier Kinder und sich selbst. Sie sagte von ihrem Mann und noch dazu vor ihm, daß er der großartigste Mensch sei, den sie jemals gesehen hätte, ein wahrer »Übermensch«. Der »Übermensch« tätschelte lachend Minnas Wangen und versicherte Christof, daß sie »eine höchst bedeutende Frau« sei. Der Herr Reichsgerichtsrat schien über Christofs Lage unterrichtet zu sein; und da er nicht recht wußte, ob er ihn höflich oder unhöflich behandeln sollte, – einerseits wegen seiner Verurteilung und anderseits wegen der hohen Gönnerschaft, die ihn schützte, – so entschloß er sich, abwechselnd höflich und unhöflich zu sein. Minna aber redete unaufhörlich. Als sie Christof genügend von sich erzählt hatte, begann sie von ihm zu sprechen: Sie marterte ihn mit ebenso intimen Fragen, wie es die Antworten auf angenommene Fragen gewesen waren, die er gar nicht an sie gestellt hatte. Sie war entzückt, Christof wiederzusehen: von seiner Musik kannte sie nichts; aber sie wußte, daß er bekannt war, und es schmeichelte ihrer Eitelkeit, daß er sie einmal geliebt hatte (und daß sie ihn abgewiesen hatte). Sie erinnerte ihn scherzend, ohne viel Zartgefühl, daran. Dann bat sie ihn um ein Autogramm für ihr Album. Sie fragte ihn ausführlich über Paris aus. Für diese Stadt bezeigte sie ebenso viel Neugier wie Verachtung. Sie behauptete, sie gut zu kennen, da sie ja die Folies-Bergère, die Oper, Montmartre und Saint-Cloud gesehen hatte. Nach ihrer Meinung waren die Pariserinnen alle Kokotten, schlechte Mütter, die möglichst wenig Kinder hatten, sich nicht um sie kümmerten und sie zu Hause ließen, während sie ins Theater oder in Vergnügungslokale gingen. Widerspruch duldete sie nicht. Im Verlauf des Abends wollte sie, daß Christof etwas auf dem Klaviere vorspiele. Sie fand es entzückend. Aber im Grunde bewunderte sie ebenso sehr das Spiel ihres Mannes, den sie in allem für überlegen hielt, wie auch sich selbst.
Christof hatte die Freude, in diesem Hause Minnas Mutter, Frau von Kerich, wiederzusehen. Er hatte sich eine stille Zärtlichkeit für sie bewahrt, weil sie gütig zu ihm gewesen war. Von ihrer Güte hatte sie nichts verloren. Und sie war natürlicher als Minna. Aber sie behandelte Christof immer noch bei aller Herzlichkeit mit jener kleinen Ironie, die ihn früher geärgert hatte. Sie war auf demselben Punkte stehen geblieben, auf dem er sie verlassen hatte. Sie liebte noch dieselben Dinge, und es schien ihr nicht zulässig, daß man etwas besser oder anders machen könne; sie stellte in Gedanken den Johann Christof von einst dem heutigen gegenüber. Und sie gab dem früheren den Vorzug.
In ihrer Umgebung hatte sich niemand geistig verändert außer Christof. Die Reglosigkeit der kleinen Stadt, ihr enger Horizont, waren ihm peinlich. Seine Gastgeber verbrachten einen Teil des Abends damit, ihn mit Klatschereien über Leute zu unterhalten, die er nicht kannte. Sie erspähten begierig alle Lächerlichkeiten ihrer Nachbarn und erklärten alles, was sich von ihnen und ihrer eigenen Lebensart unterschied, für lächerlich. Diese boshafte Neugier, die sich beständig an Nichtigkeiten hielt, verursachte Christof schließlich ein unerträgliches Mißbehagen. Er machte den Versuch, von seinem Leben im Ausland zu erzählen; aber er merkte sofort die Unmöglichkeit, sie irgend etwas von jener französischen Kultur empfinden zu lassen, unter der er gelitten hatte und die ihm in diesem Augenblick teuer wurde, wo er sie in seinem eigenen Lande als den freien lateinischen Geist empfand, dessen oberstes Gesetz die Klugheitsregel ist: soviel wie möglich vom Leben und von den geistigen Strömungen zu verstehen, selbst auf die Gefahr hin, es mit den Sittengesetzen leicht zu nehmen. Bei seinen Gastgebern, und vor allem bei Minna, fand er nur jenen Geist des Hochmuts wieder, an dem er sich früher gestoßen, den er aber vergessen hatte, – eines Hochmuts, der sowohl der Schwäche wie der Tugend entstammt –, jener mitleidlosen Ehrbarkeit, die auf ihre Tugendhaftigkeit stolz ist, und die ihr unbekannte Anfechtungen verachtet, einen Kultus mit der Wohlanständigkeit treibt und nur eine empörte Geringschätzung für überlegene Menschen hat, die vom Herdenweg abweichen. Minna glaubte mit ruhiger, überzeugter Sicherheit in allem und jedem recht zu haben. In ihrer Art, über andere zu urteilen, wußte sie nicht ab- und zuzugeben. Übrigens bemühte sie sich nicht im geringsten, andere zu verstehen; denn sie war nur mit sich selbst beschäftigt. Sie suchte ihrem Egoismus einen unbestimmten Anstrich von Metaphysischem zu geben. Es war stets von ihrem »Ich« die Rede, von der Entwicklung ihres »Ich«. Vielleicht war sie eine brave, zur Liebe fähige Frau, aber sie liebte sich selbst gar zu sehr. Vor allem nahm sie sich zu ernst. Sie schien förmlich ihr eignes »Ich« anzubeten. Man hatte das Gefühl, daß sie den Mann, den sie am meisten liebte, ganz und für immer zu lieben aufhören würde, – falls er es einen einzigen Augenblick an der schuldigen Achtung vor ihrem »Ich« fehlen ließe (auch wenn er es nachher tausendmal bedauert hätte) ... Zum Teufel mit dem »Ich«! Denk doch ein wenig an das »Du«!
Aber Christof beurteilte sie nicht so streng. Er, der für gewöhnlich so reizbar war, hörte ihr mit mehr als engelhafter Geduld zu. Er wehrte sich dagegen, sie abzuurteilen. Wie mit einem Glorienschein umgab er sie mit dem frommen Andenken seiner Kinderliebe. Eigensinnig suchte er in ihr das Bild der kleinen Minna. Und es war nicht ganz unmöglich, es in manchen ihrer Bewegungen wiederzufinden; im Klang ihrer Stimme war eine gewisse Färbung, die süße Erinnerungen weckte. Er versenkte sich ganz darein, schwieg, hörte gar nicht auf die Worte, die sie sprach, wenn er auch zuzuhören schien, und unterließ es nicht, ihr eine rührende Verehrung zu zeigen. Aber es wurde ihm schwer, seine Gedanken zu sammeln: sie machte zu viel Lärm und hinderte ihn dadurch, seine Minna zu vernehmen. Schließlich erhob er sich, ein wenig müde geworden. Arme kleine Minna! Man möchte mir weis machen, daß du das bist, diese hübsche rundliche Person, die so laut schreit und mich langweilt. Aber ich weiß es besser. Komm, Minna. Was haben wir mit diesen Leuten zu schaffen?
Er ging und ließ sie in dem Glauben, daß er am nächsten Tage wiederkommen würde. Hätte er gesagt, daß er noch am selben Abend abreise, so hätten sie ihn sicher bis zum Abgang seines Zuges nicht mehr losgelassen. Bei den ersten Schritten, die er in die Nacht hinaus tat, war ihm wieder so wohl, wie vor seiner Begegnung mit dem Wagen. Der ganze lästige Abend war wie mit einem Schwammstrich aus seinem Gedächtnis ausgelöscht: nichts blieb davon zurück. Die Stimme des Rheines übertönte alles. Er ging zum Ufer, wo das Haus stand, in dem er geboren war. Er erkannte es unschwer wieder. Die Laden waren geschlossen, alles schlief. Christof stand mitten auf dem Wege still. Ihm war, als brauchte er nur an die Türe zu klopfen, und bekannte Schemen würden ihm öffnen. Er ging über die Wiesen, die rings das Haus umgaben, in der Richtung zum Fluß hinab, wo er einstmals abends mit Gottfried zu plaudern pflegte. Er setzte sich nieder, und die vergangenen Tage lebten wieder auf. Da war auch das liebe kleine Mädchen wieder auferstanden, das mit ihm den Traum der ersten Liebe geträumt hatte. Sie durchlebten noch einmal zusammen ihre junge Zärtlichkeit, die süßen Tränen und die unendlichen Hoffnungen. Und er gestand sich mit treuherzigem Lächeln:
Das Leben hat mich nichts gelehrt. Ich mag noch so viele Erfahrungen machen ... ich behalte doch immer dieselben Illusionen.
Wie gut ist es zu lieben und unerschütterlich zu glauben! Alles, was mit Liebe in Berührung kommt, ist vor dem Tode gefeit. Du, Minna, die du bei mir bist, – bei mir, nicht bei dem Anderen, du, Minna, die niemals altern wird! ...
Der Mond kam verschleiert aus Wolken hervor und ließ auf dem Wellenkamm des Flusses silberne Schuppen aufleuchten. Christof hatte den Eindruck, als wäre der Fluß einst nicht so nahe dem Hügel vorübergeflossen, auf dem er saß. Er ging näher heran. Ja, damals war hinter jenem Birnbaum eine Landzunge gewesen, ein kleiner Rasenabhang, auf dem er so manchesmal gespielt hatte. Der Fluß hatte ihn weggespült; immer näher kam er und leckte schon nach den Wurzeln des Birnbaumes. Christof fühlte sich beklommen. Er ging zum Bahnhof zurück. In dieser Richtung begann ein neues Stadtviertel heranzuwachsen: armselige Häuser, Bauplätze, große Fabrikschornsteine. Christof erinnerte sich an das Akaziengehölz, das er am Nachmittag gesehen hatte, und dachte: Auch dort nagt der Fluß ...
Die alte Stadt, die im Dunkeln schlief, wurde ihm mit allem, was sie umschloß, dem Lebendigen und Toten, noch teurer; denn er fühlte sie bedroht ... Hostis habet muros ...
Schnell, retten wir die Unsern! Der Tod umlauert alles, was wir lieben. Beeilen wir uns, das Antlitz, das vorübergleitet, in unvergängliche Bronze zu graben. Entreißen wir den Flammen den Schatz des Vaterlandes, bevor das Feuer den Palast des Priamus zerstört ...
Christof stieg in den Zug, der davoneilte, wie einer, der vor der Überschwemmung flieht. Aber gleich jenen Männern, die aus den Trümmern ihrer Stadt die Götterbilder retteten, so trug Christof den Lebensfunken, der aus seiner Heimaterde entsprüht war, und die geheiligte Seele der Vergangenheit mit sich fort.
Jacqueline und Olivier waren sich für einige Zeit wieder näher gekommen. Jacqueline hatte ihren Vater verloren. Dieser Tod hatte sie tief bewegt. Dem wahren Unglück gegenüber hatte sie die elende Nichtigkeit anderer Schmerzen empfunden, und die Herzlichkeit, die ihr Olivier entgegenbrachte, hatte ihre Zuneigung für ihn neu belebt. Sie fühlte sich einige Jahre zurückversetzt, in die Trauertage nach Tante Marthes Tode, denen die Tage folgten, die der Liebe geweiht waren. Sie sagte, daß sie undankbar gegen das Leben gewesen sei, und daß man ihm Dank dafür wissen müsse, daß es das Wenige, das es gegeben habe, nicht wieder zurücknähme. Dieses Wenige, dessen Wert ihr von neuem zum Bewußtsein gekommen war, hielt sie jetzt eifersüchtig fest. Eine vorübergehende Abwesenheit von Paris, die der Arzt ihr verschrieben hatte, um sie von ihrer Trauer abzulenken, eine Reise, die sie mit Olivier zusammen gemacht hatte, und die zu einer Pilgerfahrt wurde nach den Orten, wo sie sich in dem ersten Jahr ihrer Ehe geliebt hatten, stimmte sie vollends weich. Voll Wehmut fanden sie hinter einer Wegbiegung die teure Gestalt der Liebe wieder, die sie verloren geglaubt hatten; sie sahen sie vorüberschreiten und wußten, daß sie von neuem entschwinden würde, – auf wie lange? Für immer vielleicht? – und sie hielten sie mit verzweifelter Leidenschaft ...
Bleibe, o bleibe bei uns!
Aber sie wußten wohl, daß sie sie nicht halten konnten ... Als Jacqueline nach Paris zurückkehrte, fühlte sie in sich ein neues kleines Leben sich regen, wie ein Flämmchen, das die Liebe entfacht hatte. Die Liebe aber war schon vorüber. Die Last, die sie beschwerte, band sie nicht enger an Olivier: sie empfand nicht die Freude, die ihrer wartete. Unruhig forschte sie in ihrem Herzen. Wenn sie sich früher gequält hatte, hatte sie oft gedacht daß die Ankunft eines Kindchens ihr Rettung bringen würde. Nun kam das Kindchen, aber die Rettung blieb aus. Voller Angst fühlte sie diese Menschenpflanze, die ihre Wurzeln in ihr Fleisch senkte, wachsen, ihr Blut und ihr Leben trinken. Tage verbrachte sie, in sich versunken, mit verlorenem Blick lauschend, und fühlte ihr ganzes Sein von dem unbekannten Wesen aufgesogen, das Besitz von ihr ergriffen hatte. Es war wie ein unbestimmtes, sanftes Summen in ihr, einschläfernd und beängstigend. Plötzlich schreckte sie aus dieser Benommenheit auf, – erwachte in Schweiß gebadet, fröstelnd, wie von einem Blitz trotziger Auflehnung getroffen. Sie sträubte sich gegen das Netz, in dem die Natur sie gefangen hatte. Sie wollte leben, wollte frei sein; ihr war, als habe die Natur sie überlistet. Dann schämte sie sich solcher Gedanken, fand sie widernatürlich und fragte sich, ob sie denn schlechter oder anders geartet sei als andere Frauen. Doch allmählich war sie wieder ruhiger und gefestigter geworden gleich einem Baume, der im Safte steht; so träumte sie der lebendigen Frucht entgegen, die in ihrem Schoße reifte. Was würde wohl daraus werden? ... Als sie seinen ersten Schrei dem Lichte zu vernahm, als sie den jämmerlichen erbarmungswürdigen, rührenden kleinen Körper sah, schmolz ihr ganzes Herz in Liebe. In einem Augenblick der Erleuchtung wurde ihr die stolze Freude der Mutterschaft zuteil, die höchste, die es auf Erden gibt: aus Leiden ein Geschöpf des eigenen Blutes geschaffen zu haben, einen Menschen. Und die große Liebeswoge, die das Weltall bewegt, erfaßte sie ganz und gar, riß sie mit sich, überströmte sie, hob sie zu allen Himmeln empor. O Gott, das Weib, das da gebärend schafft, ist Deinesgleichen; und du kennst nicht den Jubel, der dem ihren gleicht: denn du hast nicht gelitten ...
Dann sank die Woge wieder zurück, und die Seele stieß von neuem auf Sand.
Olivier neigte sich, vor Erregung bebend, über das Kind; und indem er Jacqueline zulächelte, suchte er zu verstehen, welches Band geheimnisvollen Lebens sich zwischen ihnen beiden und jenem elenden, noch kaum menschlichen Geschöpfchen schlang. Voll Zärtlichkeit, doch nicht ganz ohne Widerwillen berührten seine Lippen den gelben, runzligen, kleinen Kopf. Jacqueline sah ihn an: eifersüchtig drängte sie ihn fort. Sie umfaßte das Kind, drückte es an ihre Brust und bedeckte es mit Küssen. Das Kind schrie; sie gab es zurück; und das Gesicht zur Wand gedreht, weinte sie. Olivier trat zu ihr, küßte sie, trank ihre Tränen. Auch sie küßte ihn und zwang sich zu einem Lächeln. Dann bat sie, man möchte sie ruhen lassen, das Kind neben sich ... Ach! was soll man tun, wenn die Liebe erstorben ist? Dem Mann, der mehr als die Hälfte seines Selbst dem geistigen Leben schenkt, geht ein starkes Empfinden niemals spurlos verloren; er bewahrt stets in seinem Sinn die Spur, den Gedanken daran. Kann er nicht mehr lieben, so kann er doch nicht vergessen, daß er geliebt hat. Was aber fängt die Frau an, die ohne Bedenken, mit ihrem ganzen Sein, geliebt hat, und die ohne Bedenken vollständig zu lieben aufhört? Lieben wollen? Sich Täuschungen hingeben? Wenn sie nun zum Wollen zu schwach, zum Selbstbetrug zu aufrichtig ist? ...
Jacqueline betrachtete, in ihre Kissen gestützt, das Kind mit zärtlichem Mitleid. Was war dies Kind? Was es auch immer war: es war nicht ganz und gar sie selbst, es war auch ein Teil des »andern«. Und den »andern« liebte sie nicht mehr. Armes Kleines! Liebes Kleines! Sie zürnte diesem Geschöpf, das sie an eine tote Vergangenheit binden wollte. Und über es geneigt, küßte sie es wieder und wieder ...
Das große Unglück der Frauen von heute ist, daß sie zu frei sind und doch nicht frei genug. Wären sie noch freier, würden sie nach Banden suchen, würden Reiz und Sicherheit darin finden. Wären sie weniger frei, würden sie sich mit den Banden abfinden, die sie doch nicht zerreißen können; so würden sie weniger leiden. Das Schlimmste aber ist, Bande zu spüren, die nicht binden, und Pflichten, denen man sich entziehen kann. Hätte Jacqueline geglaubt, daß sie Zeit ihres Lebens auf ihr kleines Haus angewiesen sein würde, wäre es ihr weniger unbequem und eng erschienen, sie hätte sich dann bemüht, es behaglich zu gestalten; und schließlich wäre sie mit ihren Gefühlen dahin gekommen, von wo sie ausgegangen war: sie hätte es geliebt. Aber sie wußte, daß sie heraus konnte, und so meinte sie, darin ersticken zu müssen. Sie konnte sich empören, und so glaubte sie schließlich, sie müsse es tun.
Die Moralisten von heute sind sonderbare Heilige. Ihr ganzes Wesen ist verkümmert auf Kosten ihrer Beobachtungsgabe. Sie wollen das Leben nur noch betrachten; kaum suchen sie es mehr zu verstehen, nicht im geringsten ihm zu gebieten, es zu leben, es zu beherrschen. Wenn sie das in der menschlichen Natur Vorhandene erkannt und gebucht haben, scheint ihnen ihre Aufgabe erfüllt. Sie sagen: »So ist es!«
Sie versuchen nicht, etwas daran zu ändern. Es scheint, als wäre in ihren Augen schon die bloße Tatsache des Daseins ein sittliches Verdienst. Alle Schwächen bestehen durch eine Art göttlichen Urteilsspruchs zu Recht. Die Welt demokratisiert sich. Einst war nur der König unverantwortlich. Heute sind es alle Menschen und vor allem das Gesindel. Welche prächtigen Berater! Mit unendlicher Mühe und peinlicher Gewissenhaftigkeit befleißigen sie sich, den Schwachen zu zeigen, wie schwach sie sind, und daß es von der Natur von aller Ewigkeit her so beschlossen war. Was bleibt den Schwachen übrig, als die Hände in den Schoß zu legen? Es ist noch ein Glück, wenn sie sich deswegen nicht bewundern. Die Frau hört so lange, daß sie ein krankes Kind ist, bis sie ihren Stolz darein setzt, eins zu sein. Man pflegt und hätschelt ihre Niederträchtigkeiten, man tut alles, damit sie wachsen und gedeihen. Würde sich jemand das Vergnügen machen, den Kindern freundlich zu erzählen, daß die Entwicklungsjahre ein Alter sind, in dem die Seele noch nicht ihr Gleichgewicht gefunden hat, und daher des Verbrechens, des Selbstmordes, ja der schlimmsten körperlichen und seelischen Laster fähig ist, und würde er dergleichen auch noch entschuldigen, so schössen die Verbrechen sofort wie Pilze aus dem Boden. Selbst einem erwachsenen Mann braucht man nur immer wieder zu sagen, daß er nicht frei sei, damit er es nicht mehr ist und sich seinen tierischen Instinkten überläßt. Sagt der Frau, daß sie verantwortlich, daß sie Herrin ihres Leibes und ihres Willens ist, – und sie wird es sein. Aber feige, wie ihr seid, hütet ihr euch wohl, das auszusprechen; denn es liegt in eurem Interesse, daß sie es nicht weiß! ... Die trübselige Umgebung, in der Jacqueline lebte, führte sie vollends auf Abwege. Seitdem sie sich innerlich von Olivier losgelöst hatte, war sie wieder in jene Welt zurückgekehrt, die sie als junges Mädchen so verachtet hatte. Sie und ihre verheirateten Freundinnen hatten einen kleinen Kreis von jungen Leuten und jungen reichen Frauen um sich geschart, die alle elegant, müßiggängerisch, geistig beweglich und verweichlicht waren. Vollkommene Freiheit des Denkens und Redens, die nur durch Geist etwas gemildert und gleichzeitig gewürzt wurde, herrschte in diesem Kreise. Am liebsten hätten sie den Wahlspruch der Rabelaisschen Abtei gewählt:
» Fais ce que vouldras« (Tue was du willst).
Aber sie prahlten ein wenig; denn sie wollten nicht viel; es waren die Schwächlinge von Thélème. Selbstgefällig predigten sie die Freiheit der Instinkte; aber ihre eigenen Instinkte waren recht zahm und ihre Ausschweifungen rein geistiger Art. Für sie war es ein wollüstiger Genuß, in dem großen abgestandenen Teich der Zivilisation unterzutauchen, in diesem lauen Schmutzbade, in dem die menschlichen Energien, die derben Lebenskräfte, die ganze schlichte Urkraft mit ihrer überströmenden Fülle an Glauben, Willen, Pflichten und Leidenschaften sich auflösen. In dieser klebrigen Gedankenwelt badete sich Jacquelines anmutiger Körper. Olivier vermochte nicht, sie daran zu hindern. Übrigens war auch er von der Zeitkrankheit angesteckt: er schrieb sich nicht das Recht zu, die Freiheit eines anderen zu beschränken; von der, die er liebte, wollte er nichts erzwingen, was er mit Liebe nicht erreichen konnte. Und Jacqueline dankte es ihm in keiner Weise; denn sie sah in ihrer Freiheit nur ihr gutes Recht.
Das Schlimmste war, daß sie in diese Welt der Amphibien ein ganzes Herz mitbrachte, dem alles Zweideutige zuwider war. Wenn sie von etwas überzeugt war, so gab sie sich ihm hin. Noch in ihrer Selbstsucht brach ihre glühende und großherzige kleine Seele alle Brücken hinter sich ab; aus ihrem Leben in Oliviers Gemeinschaft hatte sie sich eine sittliche Unbeugsamkeit bewahrt, die sie noch in der Unsittlichkeit zu behaupten bereit war.
Ihre neuen Freunde waren viel zu vorsichtig, um sich vor anderen so zu zeigen, wie sie waren. Wenn sie theoretisch die vollkommenste Freiheit in bezug auf sittliche und gesellschaftliche Vorurteile zur Schau trugen, wußten sie es in der Praxis doch so einzurichten, daß sie mit niemandem, der ihnen vorteilhaft schien, zu brechen brauchten; sie benutzten die Sittlichkeit und die Gesellschaft und verrieten sie heimlich, wie schlechte Dienstboten, die ihre Herrschaft bestehlen. Sie bestahlen sich sogar untereinander, aus Gewohnheit sowohl wie aus Langerweile. Mehr als einer dieser Ehemänner wußte, daß seine Frau Liebhaber hatte. Den Frauen war es nicht unbekannt, daß sich ihre Männer Geliebte hielten. Sie fanden sich damit ab. Zum Skandal kommt es erst, wenn man Lärm schlägt. Diese guten Ehen beruhten auf einem stillschweigenden Übereinkommen zwischen Verbündeten, – zwischen Mitschuldigen. Die freimütigere Jacqueline aber spielte mit offenen Karten. Vor allem aufrichtig sein. Und nochmals und immer wieder aufrichtig sein. Die Aufrichtigkeit gehörte ebenfalls zu den Tugenden, die der Zeitgeschmack übermäßig rühmte. Hierbei aber zeigte es sich, daß für den Gesunden alles heilsam ist, dem verderbten Herzen aber alles zum Schaden gereicht. Wie häßlich ist manchmal Offenheit! Mittelmäßige Menschen begehen eine Sünde, wenn sie in ihrem Inneren lesen wollen. Sie lesen dort nur ihre eigene Mittelmäßigkeit; und die Eitelkeit kommt dabei noch auf ihre Rechnung. Jacqueline verbrachte ihre Zeit damit, sich im Spiegel zu studieren; und sie sah darin Dinge, die sie besser niemals gesehen hätte; denn nachdem sie sie gesehen hatte, fand sie nicht mehr die Kraft, die Augen davon abzuwenden. Und anstatt sie zu bekämpfen, sah sie zu, wie sie wuchsen: sie wuchsen ins Riesenhafte und nahmen schließlich ihre Augen und ihre Gedanken ganz und gar in Anspruch.
Das Kind gab ihrem Leben keinen genügenden Inhalt. Sie hatte es nicht nähren können. Der Kleine nahm ab und sie selbst auch. Man mußte eine Amme nehmen. Zuerst war das ein großer Jammer, – bald aber eine Erleichterung. Der Kleine gedieh jetzt prächtig. Er entwickelte sich kräftig als ein braver kleiner Kerl, machte keinerlei Umstände, verbrachte seine Zeit mit Schlafen und schrie kaum des Nachts. Die Amme, eine derbe Niverneserin, die nicht zum ersten Male nährte und jedes Mal für ihren Säugling von tierhaft eifersüchtiger, alles fortdrängender Liebe besessen war, schien die eigentliche Mutter zu sein. Wenn Jacqueline eine Ansicht aussprach, machte es die andere erst recht nach ihrem Kopf. Und wenn Jacqueline sich in Erörterungen darüber einzulassen versuchte, merkte sie schließlich selbst, daß sie nichts davon verstand. Sie hatte sich seit der Geburt des Kindes noch nicht ganz erholt. Eine beginnende Venenentzündung hatte ihre Nerven heruntergebracht. Wochenlang zur Reglosigkeit verdammt, zergrübelte sie sich; fieberhaft kreisten ihre Gedanken immer wieder um dieselbe eintönige Klage: »Sie hatte nicht gelebt, sie hatte nicht gelebt; und jetzt war ihr Leben zu Ende ...« Denn ihre Fantasie war wie vergiftet: sie glaubte sich für immer siech; und ein dumpfer, bitterer, uneingestandener Groll stieg in ihr auf gegen die unschuldige Ursache ihres Leidens, gegen das Kind. Solches Empfinden ist weniger selten, als man meint. Aber man verhüllt es mit einem Schleier, und die es fühlen, schämen sich meistens, es, selbst im geheimsten Herzen, sich einzugestehen. Auch Jacqueline verurteilte sich; Selbstsucht und Mutterliebe kämpften in ihr. Wenn sie das Kind sah, wie es selig schlief, war sie gerührt; gleich darauf aber dachte sie voller Bitterkeit: »Es hat mich getötet.«
Und sie konnte eine gereizte Auflehnung in sich nicht unterdrücken gegen den gleichmäßigen Schlaf dieses Geschöpfes, dessen Glück sie mit ihrem Leiden erkauft hatte. Selbst nach ihrer Heilung und als das Kind größer wurde, blieb dieses Gefühl der Feindseligkeit dunkel bestehen. Da sie sich dessen schämte, übertrug sie es auf Olivier. Sie hielt sich weiter für krank; und die beständige Pflege ihrer Gesundheit, ihre Besorgnisse, die die Ärzte noch dadurch unterstützten, daß sie ihrem Nichtstun Vorschub leisteten, führten vollends alle ihre Gedanken immer wieder auf sich selbst zurück; und doch war dieses Nichtstun: die Trennung von ihrem Kinde, die erzwungene Untätigkeit, die vollständige Abgeschlossenheit, – Wochen der Leere, in denen sie im Bett ausgestreckt liegen und sich wie eine Gans stopfen lassen mußte, die eigentliche Ursache ihrer Krankheit. Sonderbare Heilmethoden, die man heutzutage für die Neurasthenie findet, indem man eine Krankheit des Ich durch eine andere vertreiben will, nämlich durch die krankhafte Überschätzung des Ich. Warum zapft ihr nicht der Selbstsucht ein wenig Blut ab oder leitet durch ein wirksames seelisches Mittel das Blut, falls nicht zuviel vorhanden ist, aus dem Kopf in das Herz!
Jacqueline ging körperlich gestärkt aus ihrer Krankheit hervor, war voller und verjüngt, – aber seelisch kränker als zuvor. Die Monate lange Abgeschlossenheit hatte die letzten Bande, die sie in Gedanken noch an Olivier knüpften, zerrissen. Solange sie mit ihm zusammen war, stand sie noch unter dem Einfluß seiner idealistischen Natur, die trotz ihrer Schwächen ihrer Überzeugung treu blieb. Sie hatte sich vergeblich gegen die Sklaverei gewehrt, in der sie durch einen stärkeren Geist als den ihren gehalten wurde, gegen den Blick, der sie durchdrang und sie zwang, manchmal, trotz allen Widerstrebens, sich selbst schuldig zu sprechen. Sobald aber der Zufall sie von diesem Manne getrennt hatte, – sobald sie seine alles durchschauende Liebe nicht mehr auf sich lasten fühlte, – sobald sie frei war, – wandelte sich auch das freundschaftliche Verehren, das zwischen ihnen bestand, in einen Groll darüber, daß sie sich so verschwendet hatte, in eine Art von Haß, daß sie so lange das Joch einer Zuneigung getragen hatte, die sie nicht mehr empfand. – Wer ahnt all den unbewußten, unversöhnlichen Groll, der vielleicht im Herzen eines Wesens schlummert, das man liebt und von dem man sich geliebt glaubt? Von einem Tag zum andern ist alles verwandelt. Am Abend noch liebte sie, schien zu lieben, glaubte es selbst. Nun liebt sie nicht mehr. Der, den sie geliebt hat, ist aus ihren Gedanken gestrichen. Er merkt plötzlich, daß er ihr nichts mehr bedeutet; und er begreift es nicht. Er hat nichts von der langen Arbeit gesehen, die sich in ihr vorbereitete. Er ahnte nichts von der geheimnisvollen Feindseligkeit, die sich gegen ihn ansammelte; er will die Gründe solcher Rache- und Haßgefühle nicht einsehen! Vielfältiger und dunkler Groll, der oft weit zurückliegt, – mancher unter den Schleiern des Alkovens begraben, – anderer aus verletztem Stolz geboren, Geheimnisse eines Herzens, das sich durchschaut und verurteilt sieht, – noch andere ... von denen sie am Ende selbst nichts weiß. So ist es vielleicht mit einer verborgenen Beleidigung, die man ihr unbewußt zugefügt und die sie niemals verzeihen wird. – Niemals wird es gelingen, etwas davon zu erfahren, und sie selbst ist sich ihrer nicht mehr klar bewußt; aber die Beleidigung ist ihr in das Fleisch eingebrannt: ihr Fleisch wird sie niemals vergessen.
Um gegen diese furchtbare Strömung zurückebbender Liebe anzukämpfen, hätte Olivier ein anderer Mann sein müssen, naturnäher, schlichter und zugleich geschmeidiger, einer, der sich nicht mit gefühlvollen Skrupeln herumschlug; der instinktiver und im Augenblick zu Taten fähiger war, die seine Vernunft vielleicht mißbilligt hätte. Er war im voraus besiegt, entmutigt: er war zu hellsichtig, um nicht seit langem in Jacqueline eine erbliche Belastung erkannt zu haben, die stärker war als ihr Wille, die Seele der Mutter, die zum Vorschein kam; er sah sie, gleich einem Stein, auf den Boden ihrer Rasse sinken; und da er schwach und ungeschickt war, beschleunigten alle Versuche, die er machte, nur den Fall. Er zwang sich zur Ruhe. Sie dagegen versuchte in unbewußter Berechnung, ihn daraus aufzustören, ihn dazu zu bringen, heftige, brutale, grobe Worte zu gebrauchen, um einen Grund zur Verachtung gegen ihn zu haben. Ließ er seinem Zorn die Zügel schießen, so verachtete sie ihn. Schämte er sich später deswegen und trat ihr demütig gegenüber, so verachtete sie ihn noch mehr. Und gab er dem Zorn nicht Raum, wollte er ihm nicht Raum geben, dann haßte sie ihn. Das Schlimmste aber war das Schweigen, hinter das sie sich tagelang, einer in des anderen Gegenwart, vermauerten; dieses vergiftende, erdrückende, aufpeitschende Schweigen, durch das die sanftesten Wesen schließlich zur Wut gebracht werden, in der sie vorübergehend den Wunsch empfinden, Böses zu tun, zu schreien und den anderen zum Schreien zu bringen. Schweigen, finsteres Schweigen, in dem sich die Liebe vollends zersetzt, in dem die Wesen gleich den Weltkörpern ihrem Kreislauf folgen und in der Nacht versinken ... Sie waren schließlich dahin gekommen, daß alles, was sie taten, selbst das, was sie taten, um sich einander zu nähern, sie noch weiter voneinander trieb. Ihr Leben war unerträglich geworden. Ein Zufall beschleunigte dann die Ereignisse.
Seit einem Jahre kam Cécile Fleury öfters zu Jeannins. Olivier hatte sie bei Christof kennen gelernt. Dann hatte Jacqueline sie eingeladen, und Cécile besuchte sie weiter, selbst nachdem Christof sich ihnen entfremdet hatte. Jacqueline war sehr freundlich zu ihr gewesen: obgleich sie wenig musikalisch war und Cécile etwas gewöhnlich fand, empfand sie doch, wie reizvoll ihr Gesang war und wie wohltuend ihr Einfluß. Olivier musizierte gern mit ihr. Nach und nach war sie eine Freundin des Hauses geworden. Sie flößte Vertrauen ein: wenn sie mit ihren ehrlichen Augen, ihrem gesunden, fröhlichen Aussehen, ihrem warmen, ein wenig breiten Lachen, dessen Klang wohltat, in das Wohnzimmer der Jeannins trat, war es, als ob ein Sonnenstrahl den Nebel durchbräche. Olivier und Jacqueline empfanden dann eine unaussprechliche Erleichterung. Und wenn sie fortging, hätten sie ihr am liebsten zugerufen: »Nein, bleibe, bleibe, mir ist so kalt.«
Während Jacquelines Abgeschlossenheit hatte Olivier Cécile öfters gesehen; und er hatte ihr seinen Kummer nicht ganz verbergen können. Er tat es in dem unüberlegten Sichgehenlassen einer schwachen, zarten Seele, die am Ersticken ist, die der Aussprache bedarf und die sich anvertraut. Cécile war gerührt; sie schenkte ihm den Balsam ihrer mütterlichen Trostworte; alle beide taten ihr leid; sie redete Olivier zu, sich nicht völlig zu Boden drücken zu lassen. Aber ob ihr nun diese Beichten peinlicher als ihm waren, ob sie einen anderen Grund hatte, sie fand Vorwände, um weniger häufig zu kommen. Wahrscheinlich meinte sie, daß sie Jacqueline gegenüber nicht anständig handele, da sie kein Recht habe, ihre Geheimnisse zu kennen. Wenigstens deutete sich Olivier ihr Fernbleiben so, und er billigte es; denn er machte sich Vorwürfe darüber, daß er geredet hatte. Aber die Trennung ließ ihn fühlen, was Cécile ihm geworden war. Er hatte sich daran gewöhnt, seine Gedanken mit ihr zu teilen; sie allein befreite ihn von seinem drückenden Leid. Er verstand zu gut, in seinen Empfindungen zu lesen, um im Zweifel darüber zu sein, mit welchem Namen er solche Regungen zu nennen habe. Er hätte mit Cécile nicht darüber gesprochen. Aber er widerstand nicht dem Bedürfnis, für sich selbst niederzuschreiben, was er fühlte. Seit kurzem hatte er die gefährliche Angewohnheit wieder aufgenommen, sich auf dem Papier mit seinen eigenen Gedanken zu unterhalten. In den Jahren seiner Liebe hatte er sich davon befreit; jetzt aber, da er wieder allein stand, hatte ihn der ererbte Hang von neuem gepackt: seinem Kummer war das eine Erleichterung, und für ihn als Künstler eine Notwendigkeit, weil er sich dadurch analysierte. So schrieb er über sich, schrieb von seinen Kümmernissen, als spräche er sie Cécile gegenüber aus, – nur freier, da sie sie ja niemals lesen sollte.
Der Zufall aber wollte, daß diese Blätter Jacqueline zu Gesicht kamen. Es geschah an einem Tage, an dem sie sich Olivier wieder näher fühlte als seit Jahren. Beim Aufräumen ihres Schrankes hatte sie die alten Liebesbriefe von ihm wieder durchgelesen, und sie war davon bis zu Tränen gerührt worden. Sie saß vor dem Schrank und brachte es nicht fertig, weiter aufzuräumen; sie hatte ihre ganze Vergangenheit noch einmal durchlebt; die schlimmsten Gewissensbisse überkamen sie, daß sie sie zerstört hatte. Sie dachte an Oliviers Kummer. Niemals hatte sie den Gedanken daran kaltblütig ins Auge fassen können. Sie konnte ihn wohl vergessen, aber die Vorstellung, daß er durch ihre Schuld litt, mochte sie nicht ertragen. Das zerriß ihr das Herz. Am liebsten hätte sie sich ihm in die Arme geworfen und ihm gesagt:
»Ach, Olivier, Olivier, was haben wir getan? Wir sind wahnsinnig, wir sind wahnsinnig! Wir wollen doch einander nicht mehr weh tun!«
Wäre er doch in diesem Augenblick nach Hause gekommen!
Und gerade in diesem Augenblick fand sie jene Briefblätter! Da war alles zu Ende. – Meinte sie, daß Olivier sie in Wahrheit betrogen habe? Vielleicht. Was aber bedeutete das? Für sie lag der Betrug nicht in der Tat, sondern im Willen dazu. Sie hätte dem, den sie liebte, eher eine Geliebte verziehen, als daß er heimlich einer anderen sein Herz geschenkt. Und darin hatte sie recht.
»Was hat er denn Schlimmes getan!« werden manche sagen ... (Die Armseligen, die unter dem Verrat einer Liebe nur leiden, wenn er sich in die Tat umsetzt! ... Bleibt das Herz treu, so haben die Sünden des Leibes wenig zu bedeuten. Hat aber das Herz Verrat geübt, ist alles übrige nichts mehr wert.) ... Jacqueline kam es nicht eine Minute in den Sinn, Olivier wieder zurückzuerobern. Zu spät! Sie liebte ihn nicht mehr genug. Oder vielleicht liebte sie ihn allzusehr. Nein, Eifersucht empfand sie nicht. Ihr ganzes Vertrauen brach zusammen, alles, was heimlich in ihr an Glaube und Hoffnung, die auf ihm ruhten, lebendig geblieben war; sie gestand sich nicht ein, daß sie selbst es dazu hatte kommen lassen, daß sie ihn zurückgestoßen, ihn in diese Liebe hineingedrängt hatte, daß im übrigen diese Liebe unschuldig war, und daß man schließlich nicht Herr über Lieben und Nichtlieben ist. Es kam ihr nicht in den Sinn, dieses rein gefühlsmäßige Hingezogensein ihrem Flirt mit Christof zu vergleichen: sie liebte Christof nicht, also zählte er nicht! In leidenschaftlicher Übertreibung meinte sie, Olivier belöge sie und sie bedeute ihm nichts mehr. Der letzte Halt entglitt ihr in dem Augenblick, wo sie die Hand danach ausstreckte ... Alles war zu Ende.
Olivier erfuhr niemals, was sie an jenem Tage durchgemacht hatte. Doch als er sie wiedersah, hatte auch er den Eindruck, daß alles zu Ende sei.
Von diesem Augenblick an redeten sie nur noch miteinander, wenn sie mit anderen zusammen waren. Sie belauerten sich gegenseitig wie zwei verfolgte, umstellte Tiere, die auf ihrer Hut sind und die sich ängstigen. Jeremias Gotthelf beschreibt einmal mit grausamem Humor das bedrückende Verhältnis zwischen einem Mann und einer Frau, die sich nicht mehr lieben: wie sie sich gegenseitig beobachten, indem sie dem Gesundheitszustand des anderen nachspüren, jeden Schein einer Krankheit belauern und, wenn auch nicht gerade darauf sinnen, den Tod des anderen zu beschleunigen oder gar herbeizuwünschen, sich doch der Hoffnung auf einen unvorhergesehenen Zufall hingeben; jeder für sich aber hegt den Gedanken, der Widerstandsfähigere von beiden zu sein. In manchen Augenblicken redeten sich Jacqueline und Olivier beinahe ein, der andere hege solche Gedanken. Und doch waren beide völlig frei davon; aber es war schon schlimm genug, solche Gedanken dem anderen unterzuschieben, wie Jacqueline es tat, wenn sie sich des Nachts, in Augenblicken fieberhaften Wachseins einredete, der Andre sei der Stärkere, er verbrauche sie nach und nach und würde bald den Sieg über sie davontragen ... Ungeheuerliches Wahnbild einer irregeleiteten Fantasie, eines betörten Herzens! – Und bei alledem liebten sie sich schließlich noch immer im tiefsten Grunde und mit dem besten Teil ihres Wesens! ...
Olivier erlag unter der Last; er versuchte nicht mehr zu kämpfen; und da er sich abseits hielt, verlor er das Steuer von Jacquelines Seele aus den Händen. Sie aber, die sich selbst überlassen und führerlos war, wurde vom Freiheitstaumel erfaßt; sie brauchte einen Herrn, gegen den sie sich auflehnen konnte; wenn sie keinen hatte, mußte sie sich einen schaffen. So wurde sie die Beute einer Wahnvorstellung. Trotz allem, was sie innerlich durchlebte, war sie bisher nie auf den Gedanken gekommen, Olivier zu verlassen. Von jetzt an glaubte sie sich jeder Fessel ledig. Sie wollte lieben, bevor es zu spät sei; – (denn so jung sie noch war, hielt sie sich schon für alt.) – Sie liebte, und sie kannte jene eingeredeten und verzehrenden Leidenschaften, die sich an den ersten Besten, der einem begegnet, heften, an eine vorüberstreifende, nur flüchtig gesehene Gestalt, an den Ruf, der einem vorausgeht, ja manchmal sogar nur an einen Namen, und die, was sie einmal erfaßt haben, nicht mehr loslassen wollen und dem Herzen einreden, daß es den Gegenstand seiner Liebe nicht mehr entbehren könne. Sie kannte diese Leidenschaften, die das Herz vollständig verheeren und alles, was es früher erfüllte, daraus verbannen: einstige Zuneigungen, sittliche Grundsätze, Erinnerungen, die Achtung vor sich selbst und die Achtung vor andern. Wenn aber dann diese Wahnvorstellungen an der Reihe sind, aus Mangel an Zufuhr hinzusterben, nachdem sie alles zerstört haben, dann kommt es wohl vor, daß aus den Trümmern ein Wesen oft ohne Güte, ohne Mitleid, ohne Jugend, ohne Illusionen emporsteigt, nur noch darauf bedacht, das Leben zu untergraben, gleich wie das Unkraut alte Denkmäler untergräbt.
Wie gewöhnlich klammerte sich auch diesmal die fixe Idee an ein Wesen, das ganz dazu geschaffen war, das Herz zu enttäuschen. Die arme Jacqueline verliebte sich in einen Weiberhelden, einen Pariser Schriftsteller, der weder hübsch noch jung war, rotbackig, verlebt, mit schlechten Zähnen, dessen Herzensarmut erschreckend war und dessen Hauptverdienst darin bestand, in Mode zu sein und zahllose Frauen unglücklich gemacht zu haben. Jacqueline konnte sich nicht einmal damit entschuldigen, daß ihr sein Egoismus unbekannt sei; denn er prahlte damit in seiner Kunst. Er wußte sehr genau, was er tat: Egoismus, der unter dem Deckmantel der Kunst verfochten wird, ist wie der Spiegel des Vogelstellers, das Licht, das die Schwachen in die Flamme zieht. Aus Jacquelines Kreisen war mehr als eine ins Netz gegangen: erst ganz kürzlich hatte er eine ihr befreundete jungverheiratete Frau ohne große Mühe verführt und dann verlassen. Sie starben nicht daran, wenn sie auch ihre Enttäuschung zum Vergnügen der andern nur ungeschickt verbargen. Selbst die am grausamsten Getroffene behielt ihren Vorteil und ihre gesellschaftlichen Pflichten viel zu sehr im Auge, als daß sie ihre Verwirrungen nicht in den Grenzen des gesunden Menschenverstandes gehalten hätte. Alle diese Frauen erregten kein öffentliches Ärgernis. Mochten sie nun ihren Mann oder ihre Freundinnen betrügen, mochten sie betrogen werden und darunter leiden, – es geschah in der Stille. Sie waren Märtyrerinnen der gesellschaftlichen Meinung.
Jacqueline war ein Tollkopf: sie war nicht nur fähig, zu tun, was sie sagte, sondern auch zu sagen, was sie tat. Ihre Streiche waren ohne jede Berechnung und gänzlich uneigennützig. Sie hatte die gute, aber gefährliche Eigenschaft, sich selbst gegenüber ganz offen zu sein und vor den Folgen ihrer Handlungen nicht zurückzuschrecken. Sie war mehr wert, als die anderen ihres Gesellschaftskreises; darum trieb sie es schlimmer. Als sie liebte, als sie den Entschluß zum Ehebruch gefaßt hatte, stürzte sie sich mit verzweifeltem Freimut Hals über Kopf in das Abenteuer.
Frau Arnaud war allein zu Hause und strickte mit der fieberhaften Gleichmäßigkeit, die Penelope auf ihre berühmte Arbeit verwandt haben mochte. Gleich Penelope wartete sie auf ihren Mann. Herr Arnaud verbrachte den ganzen Tag außer dem Hause. Vor- und nachmittags hatte er Schule. Meistens kam er zum Frühstück heim, obwohl er hinkte und das Gymnasium am anderen Ende von Paris lag. Er zwang sich zu diesem langen Weg weniger aus Sehnsucht oder Sparsamkeit als aus Gewohnheit. An manchen Tagen aber hatte er Nachhilfestunden zu geben, oder arbeitete, da er nun schon einmal in dem Stadtviertel war, in einer nahe gelegenen Bibliothek. Lucile Arnaud blieb allein in der öden Wohnung. Außer der Aufwartefrau, die von acht bis zehn Uhr für die grobe Arbeit kam, und den Lieferanten, die morgens Bestellungen entgegennahmen und ausführten, läutete niemand an der Türe. Im Hause kannte sie niemanden mehr. Christof war ausgezogen, und neue Mieter hatten sich in dem Fliedergarten eingenistet. Céline Chabran hatte Augustin Elsberger geheiratet. Elie Elsberger war mit seiner Familie nach Spanien gezogen, wo er mit der Ausbeutung einer Mine beauftragt worden war. Der alte Weil hatte seine Frau verloren und bewohnte seine Pariser Wohnung fast nie mehr. Nur Christof und seine Freundin Cécile hatten ihre Beziehungen zu Lucile Arnaud aufrecht erhalten, aber sie wohnten weit entfernt, und da sie den ganzen Tag über angestrengt arbeiteten, blieben sie oft wochenlang fern. So war sie ganz auf sich angewiesen.
Sie langweilte sich jedoch durchaus nicht. Die geringsten täglichen Pflichten genügten ihr, um sie innerlich zu beschäftigen: die Pflege einer winzigen Pflanze, deren zartes Blattwerk sie jeden Morgen mit mütterlicher Sorgfalt reinigte; ihre stille graue Katze, die mit der Zeit ein wenig von ihrem eignen Wesen angenommen hatte, wie dies bei Haustieren vorkommt, die man wirklich gern hat; sie verbrachte den Tag bei ihr am Kamin oder auf dem Tisch neben der Lampe und betrachtete ihre emsigen Finger oder schlug auch manchmal ihre seltsamen Augen zu ihr auf, um sie einen Moment lang zu beobachten und dann wieder in Gleichgültigkeit zu erlöschen. Selbst die Möbel leisteten Lucile Gesellschaft. Jedes Stück hatte für sie ein vertrautes Antlitz. Sie fand ein kindliches Vergnügen daran, sie zu putzen, den Staub sorgsam von allen Seiten zu wischen und sie mit unendlicher Rücksicht auf ihren gewohnten Platz zurückzustellen. Sie unterhielt sich leise mit ihnen. Dem einzigen, schönen alten Stück, das sie besaß, einem feinen Cylinderschreibtisch im Louis XVI.-Stil, lächelte sie vertraulich zu, und täglich betrachtete sie ihn mit gleicher Freude. Nicht minder beschäftigt war sie, wenn sie ihre Wäsche durchsah: dann stand sie stundenlang auf einem Stuhl, Kopf und Arme in dem großen Bauernschrank vergraben, untersuchte und ordnete, während die Katze sie erstaunt und beunruhigt stundenlang mit den Blicken verfolgte. –
Ganz glücklich aber war sie, wenn alle Arbeit getan war, wenn sie – Gott weiß wie! – gefrühstückt (sie hatte niemals großen Hunger) und die notwendigsten Gänge besorgt hatte, und nun nach vollendetem Tagewerk gegen vier Uhr heimkehrte und sich mit ihrer Arbeit und ihrem Kätzchen ans Fenster oder ans Feuer setzen konnte. Manchmal fand sie einen Vorwand, um garnicht ausgehen zu brauchen; sie war am glücklichsten, wenn sie sich zu Haus einschließen konnte, vor allem im Winter, wenn es schneite. Kälte, Wind, Schmutz und Regen waren ihr entsetzlich, denn auch sie war ein sehr sauberes, zartes und verwöhntes Kätzchen. Lieber aß sie gar nichts, als auszugehen, um ihr Frühstück zu besorgen, wenn die Lieferanten sie einmal zufällig vergessen hatten. In solchem Falle knabberte sie ein Stückchen Schokolade oder etwas Obst vom Speiseschrank. Sie hütete sich allerdings, es Arnaud zu erzählen. Das waren ihre »Seitensprünge«.
So saß sie an manchen dämmerigen und manchmal auch an schönen, sonnigen Tagen, wenn draußen der blaue Himmel leuchtete und der Straßenlärm summte, in ihrer stillen, schattigen Wohnung. Dann war es, als würde ihre Seele von einem Zauberspiegel aufgesogen; sie saß an ihrem Lieblingsplatz, den Schemel unter den Füßen, das Strickzeug in den Händen, reglos, in sich versunken, während ihre Finger eilig hin- und hergingen. Neben ihr lag eines ihrer Lieblingsbücher, gewöhnlich einer jener bescheidenen Bände in rotem Umschlag, die Übersetzung irgend eines englischen Romans. Sie las sehr wenig, kaum ein Kapitel täglich; und das Buch auf ihren Knieen blieb dann lange Zeit auf derselben Seite geöffnet liegen oder wurde überhaupt nicht aufgemacht: sie kannte es schon; sie träumte daraus. So zogen sich die langen Romane von Dickens oder Thackeray durch Wochen hin, und ihre Träume machten Jahre daraus. Sie umhüllten sie mit ihrer Zärtlichkeit. Die Leute von heute, die schnell und schlecht lesen, kennen nicht mehr die wunderbare Kraft, die aus schönen Büchern quillt, wenn man sie langsam schlürft. Für Frau Arnaud stand es außer Frage, daß das Leben dieser Romangeschöpfe ebenso wirklich sei wie das ihre; es waren Wesen darunter, für die sie sich hätte aufopfern mögen: die sanftmütige, eifersüchtige Lady Castlewood, diese schweigende Liebende mit dem mütterlichen und dabei jungfräulichen Herzen war ihr wie eine Schwester; der kleine Dombey war ihr süßes kleines Kind; sie war Dora, die kindhafte Frau, die sterben muß; sie streckte ihre Arme allen diesen Kinderseelen entgegen, die mit mutigen und reinen Augen durch die Welt gehen; und um sie her bewegte sich ein Zug liebenswürdiger armer Schlucker und harmloser Originale, die ihren lächerlichen und rührenden Hirngespinsten nachjagten, – allen voran der liebevolle Genius des guten Dickens, der zu seinen Träumen in einem Atemzug lachte und weinte. Wenn sie in solchen Augenblicken aus dem Fenster schaute, erkannte sie unter den Vorübergehenden diese oder jene geliebte oder gefürchtete Gestalt aus dieser erträumten Welt wieder. Hinter den Mauern der Häuser ahnte sie ähnliche oder die gleichen Schicksale. Wenn sie nicht ausgehen mochte, so war der Grund dafür ihre Furcht vor dieser Welt voll beunruhigender Geheimnisse. Sie witterte rings um sich her verborgene Dramen oder sah Komödien sich abspielen. Und nicht immer war es Einbildung. In ihrer Einsamkeit hatte sie sich jenes geheimnisvolle Ahnungsvermögen angeeignet, das aus vorüberstreifenden Blicken so manches Geheimnis aus dem vergangenen oder zukünftigen Leben der Menschen abliest, von denen diese oft selbst nichts wissen. Diese tatsächlichen Gesichte verschmolz sie mit romantischen Erinnerungen und formte sie um. In diesem unendlichen Universum fühlte sie sich dem Ertrinken nahe. Sie mußte zu sich selbst zurückfinden, um wieder festen Boden zu fassen.
Aber hatte sie nötig, in anderen zu lesen oder auch nur nach ihnen zu schauen? Sie brauchte nur in sich selbst hineinzublicken. Wie war dieses äußerlich so blasse, verlöschte Dasein innerlich so hell! Welch überströmend reiches Leben! Wieviel Erinnerungen, wieviel Schätze ruhten da, von deren Existenz niemand etwas ahnte! Hatten sie jemals in Wirklichkeit bestanden? – Zweifellos waren sie Wirklichkeit; denn sie bestanden für sie ... O, arme Leben, die des Traumes Zauberstab verklärt!
Frau Arnaud ließ die Jahre, bis in ihre früheste Kindheit zurück, an ihrem Geiste vorüberziehen; jedes der zarten Blümchen ihrer zerstörten Hoffnungen blühte in der Stille wieder auf ... Die erste Kinderliebe zu einem jungen Mädchen, dessen Anmut sie vom ersten Augenblick an gefangen genommen hatte; sie liebte es, wie man nur aus Liebe fühlen kann, wenn man unendlich rein ist; sie verging vor Erregung, wenn sie sich von ihr berührt fühlte; sie hätte ihr die Füße küssen mögen, ihre Geliebte sein, sie heiraten mögen; die Freundin hatte sich verheiratet, war nicht glücklich geworden, hatte ein Kind gehabt, das starb, war dann selbst gestorben ... Eine andere Liebe hegte sie, als sie ungefähr zwölf Jahre alt war, für ein Mädelchen ihres Alters, das sie tyrannisierte, ein lachlustiges, herrschsüchtiges blondes Teufelchen, dem es Spaß machte, sie zum Weinen zu bringen und sie hinterher mit Küssen zu überschütten; sie schmiedeten tausend romantische Zukunftspläne miteinander; diese Freundin war dann plötzlich Karmeliterin geworden, ohne daß man wußte, warum; es hieß, sie sei glücklich ... Dann packte sie eine große Leidenschaft für einen viel älteren Mann. Von jener Leidenschaft hatte niemand etwas gewußt, nicht einmal der, dem sie galt. Sie hatte glühende Hingebung, Schätze von Zärtlichkeit dabei verschwendet ... Dann kam eine andere Leidenschaft: diesmal liebte man sie. Aber aus eigentümlicher Schüchternheit, aus Mangel an Selbstvertrauen hatte sie nicht zu glauben gewagt, daß man sie liebte, hatte nicht merken lassen, daß sie selber liebte. Und das Glück war vorübergegangen, ohne daß sie es ergriffen hätte ... Dann ... Doch was nützt es, anderen zu erzählen, was nur für den einen Menschen selber Sinn hat? An soviele winzig kleine Tatsachen dachte sie, die eine tiefe Bedeutung gewonnen hatten: die kleinste Aufmerksamkeit eines Freundes, ein liebes Wort von Olivier, das er, selbst ganz achtlos, ausgesprochen hatte, die wohltuenden Besuche Christofs und die Zauberwelt, die seine Musik erschloß, der Blick eines Unbekannten, ja, sogar mancher unbeabsichtigte Treubruch, den diese prächtige anständige und reine Frau in Gedanken begangen hatte, der sie beunruhigte und über den sie errötete, den sie leise von sich wies, und der ihr dennoch – es war ja alles so unschuldig – ein wenig Sonnenschein ins Herz strahlte ... Sie liebte ihren Mann herzlich, obgleich er nicht ganz so war, wie sie ihn sich erträumt hatte. Aber er war gut; und eines Tages, als er zu ihr gesagt hatte: »Mein liebes Weib, du weißt nicht, was du für mich bedeutest! Du bist mein ganzes Leben –«, da war ihr Herz weich geworden; an jenem Tage hatte sie sich ganz und für immer mit ihm vereint gefühlt, ohne den Gedanken an eine Umkehr. Jedes Jahr hatte sie dann enger miteinander verknüpft. Sie hatten schöne Träume miteinander geträumt, Träume von Arbeit, von Reisen, von Kindern. Was war aus ihnen geworden? ... Ach! ... Frau Arnaud träumte sie immer noch. An ein Kindchen hatte sie so oft innig gedacht, daß sie es kannte, als wäre es wirklich da. Jahrelang hatte sie an diesem Gedanken gearbeitet und ihn unaufhörlich mit allem Schönsten, was sie sah, mit allem, was ihr am teuersten war, verschönt ... Still, still! ...
Das war alles. Und doch waren es Welten. Wieviele Tragödien, die selbst die Vertrautesten nicht ahnen, spielen sich im Grunde des scheinbar ruhigsten, mittelmäßigsten Lebens ab! Und das Erschütterndste liegt vielleicht darin, daß in diesen von Hoffnungen beseelten Leben nichts geschieht, daß sie verzweifelt nach dem schreien, was ihr Recht ist, ihr ihnen von der Natur verheißenes und dennoch verweigertes Recht, – daß sie sich in leidenschaftlicher Angst verzehren und nichts von alledem nach außen verraten!
Frau Arnaud war glücklicherweise nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Ihr eigenes Leben füllte nur einen Teil ihrer Träumereien aus. Sie lebte auch das Leben ihrer jetzigen oder früheren Bekannten; sie versetzte sich an ihre Stelle; sie dachte an Christof und an seine Freundin Cécile. Auch heute dachte sie an sie. Die beiden Frauen hatten Zuneigung zueinander gefaßt. Dabei bedurfte sonderbarerweise die robuste Cécile der Stütze, die sie an der zarten Frau Arnaud fand. Im Grunde war dieses heitere, große und gesunde Mädchen weniger stark als es den Anschein hatte. Sie machte eine Krisis durch. Die ruhigsten Herzen sind vor Überraschungen nicht sicher. Ohne daß sie es merkte, hatte sich ein sehr zärtliches Empfinden in sie eingeschlichen; sie wollte es sich zunächst nicht eingestehen; aber es war gewachsen, bis sie es sehen mußte: sie liebte Olivier. Die warmherzige Milde im Wesen des jungen Mannes, die ein wenig weibliche Anmut seiner Persönlichkeit, alles, was schwach und widerstandslos an ihm war, hatte sie sofort angezogen; – eine mütterliche Natur wird von dem angezogen, der ihrer bedarf. Was sie mit der Zeit von seinen Ehekümmernissen erfuhr, hatte ihr für Olivier ein gefährliches Gefühl von Mitleid eingeflößt. Sicher hätten diese Gründe nicht genügt. Wer aber kann sagen, warum ein Wesen sich in ein anderes verliebt? Oft ist weder das eine noch das andere Schuld daran, sondern die Stunde, die unversehens ein achtloses Herz überfällt und es der ersten besten Zuneigung ausliefert, der es auf seinem Wege begegnet. – Sobald Cécile nicht mehr daran zweifeln konnte, mühte sie sich tapfer, den Angelhaken einer Liebe aus ihrem Herzen zu reißen, die sie als sündhaft und sinnlos verurteilte. Sie bereitete sich lange Zeit viel Leid und heilte sich nicht. Niemand ahnte, was in ihr vorging: sie achtete sorgsam darauf, glücklich zu erscheinen. Frau Arnaud allein wußte, was sie das kostete. Cécile hatte ihr nicht etwa ihr Geheimnis anvertraut, aber sie kam manchmal und legte ihren Kopf mit dem kräftigen Nacken an Frau Arnauds Schulter. Sie weinte ein wenig, ohne zu reden, küßte die Freundin und ging dann lachend weg. Sie empfand eine schwärmerische Liebe für diese zerbrechliche Frau, in der sie eine seelische Stärke und eine Glaubenskraft spürte, die der ihren überlegen war. Sie vertraute sich ihr nicht an. Aber Frau Arnaud verstand, ohne daß die andere es auszusprechen brauchte. Die Welt erschien ihr wie ein einziges, wehmütiges Mißverständnis. Es zu lösen ist unmöglich. Man kann es nur lieben, Mitleid haben und träumen. Und wenn der Schwarm der Träume allzu sehr in ihr summte, wenn sie sich mit den Gedanken nicht mehr vorwärts tasten konnte, setzte sie sich ans Klavier und ließ die Hände aufs Geratewohl in den tiefen Registern über die Tasten gleiten, um den Zauberspiegel des Lebens in das gedämpfte Licht der Töne zu hüllen ...
Aber die tapfere kleine Frau vergaß nicht die Stunde der täglichen Pflichten; und wenn Arnaud heimkehrte, fand er die Lampe angezündet, das Abendbrot bereit und das bläßliche lächelnde Gesicht seiner Frau, die auf ihn wartete. Und er ahnte nicht das Geringste von jener Welt, in der sie gelebt hatte.
Das Schwierige dabei war gewesen, die beiden Wege des Lebens zu gehen, ohne daß sie zusammenstießen: das tägliche Leben und das andere, das hohe Leben des Geistes mit den weiten Horizonten. Das war nicht immer leicht. Glücklicherweise lebte auch Arnaud ein zum Teil erträumtes Leben in Büchern und Kunstwerken, deren ewiges Feuer die Flamme seiner Seele nährte. In den letzten Jahren aber hatten die kleinen Verdrießlichkeiten seines Berufes, Ungerechtigkeiten, Zurücksetzungen, Ärger mit seinen Kollegen oder seinen Schülern ihn mehr und mehr in Anspruch genommen. Er war verstimmt; er begann von Politik zu reden, über die Regierung und die Juden loszuziehen; er machte Dreyfus für seine beruflichen Enttäuschungen verantwortlich. Seine trübe Laune übertrug sich auch etwas auf Frau Arnaud. Sie näherte sich den Vierzig. Sie war in einem Alter, in dem die Lebenskraft Angriffe und Störungen erleidet, und hatte um ihr seelisches Gleichgewicht zu kämpfen. Ihre Gedankengänge waren unterbrochen. So verloren beide für einige Zeit jeden gemeinsamen Daseinszweck; denn sie fanden nichts mehr, ihre Traumgespinste daran zu befestigen, die im Leeren hängen blieben. Jeder Traum bedarf einer wenn auch noch so schwachen Stütze durch die Wirklichkeit. Den beiden fehlte jede Stütze. Sie hätten aneinander einen Halt finden müssen. Aber anstatt ihr zu helfen, klammerte er sich an sie an. Und sie machte sich klar, daß sie ihn nicht genügend aufrecht halten könne: da vermochte sie sich selbst nicht mehr zu halten. Nur ein Wunder konnte sie retten; sie rief es herbei, es kam aus den Tiefen der Seele. Frau Arnaud fühlte in ihrem einsamen und frommen Herzen das erhabene und zugleich unsinnige Bedürfnis erstehen, allem zum Trotz etwas zu schaffen, ihr Netz über den Raum hinzuweben, aus bloßer Freude am Weben, sich dem Winde anzuvertrauen, dem Odem Gottes, der sie dahin tragen sollte, wohin sie gelangen mußte. Und der Odem Gottes führte sie wieder zum Leben zurück, er fand unsichtbare Stützen für sie. So begannen Mann und Frau von neuem, voller Geduld das zauberhafte und eitle Netz ihrer Träume zu spinnen, das aus ihren reinsten Leiden, ihrem reinsten Blut gefertigt war.
Frau Arnaud war allein zu Haus ... Der Abend kam. Die Türglocke ertönte. Frau Arnaud, die dadurch ungewohnt früh aus ihrer Träumerei geweckt wurde, schreckte auf. Sie legte ihre Arbeit sorgfältig zusammen und ging öffnen. Es war Christof. Er war sehr bewegt. Herzlich ergriff sie seine Hände:
»Was ist Ihnen, lieber Freund?« fragte sie.
»Ach,« sagte er, »Olivier ist zurückgekehrt.«
»Zurückgekehrt?«
»Heute morgen ist er gekommen. ›Christof, hilf mir,‹ sagte er zu mir. – Ich habe ihn umarmt. Da weinte er und sagte: ›Ich habe nur mehr dich. Sie ist fort.‹«
Frau Arnaud schlug ganz betroffen die Hände zusammen und sagte:
»Die Unglücklichen!«
»Sie ist fort,« wiederholte Christof, »mit ihrem Liebhaber durchgegangen.«
»Und ihr Kind?« fragte Frau Arnaud.
»Mann, Kind, alles hat sie verlassen.«
»Die Unglückliche!« sagte Frau Arnaud noch einmal.
»Er liebte sie, er liebte nur sie allein,« sagte Christof; »er wird sich von dem Schlag nicht mehr erholen. Er sagt mir immer wieder: ›Christof, sie hat mich betrogen, ... meine beste Freundin hat mich betrogen.‹ Es ist ganz vergeblich, dass ich ihm sage: »Wenn sie dich betrogen hat, dann war sie halt nicht deine Freundin. Sie ist deine Feindin. Vergiß sie, oder töte sie!«
»O Christof, was reden Sie da! Das ist ja entsetzlich!«
»Ja, ich weiß, das erscheint euch allen wie eine vorgeschichtliche Barbarei: töten! Man muß nur hören, wie sich diese feine Pariser Gesellschaft gegen die grob sinnlichen Instinkte verwahrt, die den Mann dahin bringen, das Weib, das ihn verrät, zu töten. Man muß nur hören, wie sie nachsichtige Vernunft predigen! Die guten Apostel! Wie schön, wenn man diesen Haufen zusammengelaufener Hunde gegen die Rückkehr zur Tierheit sich empören sieht; zuerst treten sie das Leben mit Füßen und nehmen ihm jeden Wert; und dann umgeben sie es mit einem religiösen Kultus ... Wie! Dieses Leben ohne Herz, ohne Ehre, ohne Bedeutung, das nichts weiter ist als das Atmen eines Körpers, ein Pulsschlag in einem Stück Fleisch, das scheint ihnen der Ehrfurcht wert! Dies Schlachtfleisch behandelt man ihnen nie zart genug, ein Verbrechen soll es sein, daran zu rühren. Tötet die Seele, wenn ihr wollt, aber der Körper ist heilig« ...
»Die Seelenmörder sind die schlimmsten, aber das Verbrechen entschuldigt nicht das Verbrechen; das wissen Sie auch sehr gut.«
»Ich weiß es, liebe Freundin, Sie haben recht. Ich glaube auch nicht, was ich sage; das heißt wer weiß? Ich würde es vielleicht doch tun.«
»Nein, Sie verleumden sich. Sie sind gut.«
»Wenn die Leidenschaft über mich kommt, bin ich grausam wie die anderen. Sie sehen ja, wie ich mich eben aufgeregt habe ... Aber wenn man den Freund, den man liebt, weinen sieht, wie sollte man da nicht die hassen, die ihn zum Weinen bringt? Und kann man einer Elenden gegenüber streng genug sein, die ihr Kind verläßt, um einem Liebhaber nachzulaufen?«
»Reden Sie nicht so, Christof; was wissen Sie davon.«
»Wie, Sie verteidigen sie noch?«
»Auch sie tut mir leid.«
»Mir tun die leid, die leiden. Die Leid bereiten, beklage ich nicht.«
»Nun, glauben Sie etwa, daß sie nicht auch gelitten hat? Glauben Sie, daß sie leichten Herzens ihr Kind verlassen und ihr Leben zerstört hat? Denn auch ihr Leben ist zerstört. Ich kenne sie ganz wenig, Christof, ich habe sie nur zweimal gesehen und da nur sehr flüchtig. Sie hat mir kein freundschaftliches Wort gesagt, sie hatte keine Sympathie für mich. Und doch kenne ich sie besser als Sie. Ich bin sicher, sie ist nicht schlecht. Arme Kleine! Ich ahne, was in ihr vorgegangen sein muß ...«
»Sie, liebe Freundin, deren Leben so einwandfrei, so vernünftig ist!«
»Ich, Christof. Ja, davon verstehen Sie nichts. Sie sind gut, aber Sie sind ein Mann, trotz Ihrer Güte ein harter Mensch, wie alle Männer, – ein Mann, der allem gegenüber, was nicht wie er selber ist, streng verschlossen bleibt. Ihr ahnt nichts von denen, die neben euch leben, ihr liebt sie auf eure Art, aber ihr bemüht euch nicht, sie zu verstehen. Ihr seid so leicht mit euch selbst zufrieden. Ihr seid überzeugt, daß ihr uns kennt! Ach! ... Wenn ihr wüßtet, wie unsagbar wir oft leiden, wenn wir sehen, nicht, daß ihr uns nicht liebt, aber wie ihr uns liebt! Und was wir gerade für die bedeuten, die uns am meisten lieben! In manchen Augenblicken, Christof, krallen wir uns die Nägel in die Hand, um euch nicht zuzuschreien: ›O, liebt uns nicht, liebt uns nicht! Alles eher, als daß ihr uns so liebt ...‹ Kennen Sie jenes Dichterwort ›Sogar in ihrem Hause, mitten unter ihren Kindern, von erheuchelten Ehrbezeugungen umgeben, erduldet die Frau eine Verachtung, die tausendfach drückender ist als die schlimmsten Entbehrungen.‹ Denken Sie daran, Christof. Da schaudert man.«
»Was Sie mir da sagen, bringt mich ganz aus der Fassung. Ich verstehe Sie nicht recht. Aber wenn ich richtig vermute, ... dann haben Sie selber ...«
»Ich habe diese Qualen kennen gelernt.«
»Ist das möglich? Nun immerhin! Sie werden mir nicht einreden wollen, daß Sie jemals wie diese Frau gehandelt hätten.«
»Ich habe kein Kind, Christof. Ich weiß nicht, was ich an ihrer Stelle getan hätte.«
»Nein, das kann nicht sein, in Sie habe ich Vertrauen, ich schätze Sie zu hoch; ich schwöre darauf, daß das nicht sein könnte.«
»Schwören Sie nicht! Ich war sehr nahe daran, wie sie zu handeln! Es wird mir nicht leicht, die gute Meinung, die Sie von mir haben, zu zerstören. Aber Sie müssen uns ein wenig verstehen lernen, wenn Sie nicht ungerecht sein wollen. – Ja, ich war nur um eine Handbreit von der gleichen Tollheit entfernt. Und wenn ich sie nicht begangen habe, danke ich es ein wenig Ihnen. Es war vor zwei Jahren. Ich machte eine Zeit des Trübsinns durch, der mich zermürbte. Ich sagte mir, daß ich zu nichts gut sei, daß niemandem etwas an mir läge, daß niemand meiner bedürfe, daß sogar mein Mann ohne mich fertig werden könnte, daß ich nutzlos gelebt hätte ... Ich war im Begriff, auf und davon zu gehen, Gott weiß was zu tun! Da bin ich zu Ihnen hinaufgekommen ... Erinnern Sie sich noch daran? Sie haben nicht begriffen, warum ich kam. Ich kam, um Ihnen Lebewohl zu sagen ... Und dann, ich weiß nicht, was sich zugetragen hat, ich weiß nicht, was Sie zu mir gesagt haben, ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Aber ich weiß, daß gewisse Worte von Ihnen ... (Sie haben natürlich nichts davon geahnt) für mich eine Erleuchtung waren ... Vielleicht war es nicht einmal das, was Sie gesagt haben, vielleicht ist etwas ganz Unbestimmtes der Anlaß gewesen; denn das Geringste genügte in jenem Augenblick, um mich ins Verderben zu stürzen oder mich zu retten. Als ich von Ihnen ging, bin ich nach Hause zurückgekehrt, habe mich eingeschlossen, habe den ganzen Tag geweint ... und dann war es gut ... Die Krisis war überstanden.«
»Und heute bedauern Sie es?« fragte Christof.
»Heute?« sagte sie, »ach, wenn ich jene Tollheit begangen hätte, läge ich schon lange auf dem Grund der Seine; ich hätte die Schande nicht ertragen können, ebensowenig wie das Leid, das ich meinem armen Manne damit zugefügt hätte.«
»Also sind Sie glücklich?«
»Ja, so glücklich, wie man in diesem Leben sein kann. Es ist etwas so Seltenes, wenn zwei Menschen sich verstehen, sich achten, wenn sie wissen, daß sie einer des anderen sicher sind, – nicht durch den bloßen Glauben an ihre Liebe, der oft Täuschung ist, sondern durch die Erfahrung gemeinsam verbrachter Jahre, grauer, düsterer Jahre, selbst mit – ja gerade mit den Erinnerungen an solche überstandenen Gefahren. Je älter man wird, desto besser wird es.«
Sie schwieg, und plötzlich errötete sie.
»Mein Gott, wie konnte ich das erzählen! Was habe ich getan ... vergessen Sie es, Christof, ich bitte Sie. Niemand darf es wissen.«
»Fürchten Sie nichts,« sagte Christof und drückte ihr die Hand; »es wird mir heilig sein.«
Frau Arnaud war untröstlich, daß sie über das alles gesprochen hatte und wandte sich einen Augenblick ab; dann sagte sie:
»Ich hätte es Ihnen nicht erzählen sollen ... aber sehen Sie, ich wollte Ihnen zeigen, daß selbst in den glücklichsten Ehen, und selbst bei Frauen, ... die Sie, Christof, achten, ... Stunden nicht allein der Verirrung, wie Sie es nennen, vorkommen, sondern Stunden wirklichen, unerträglichen Leidens, die zu Tollheiten führen, und ein ganzes Leben, wenn nicht gar zwei, zerstören können. Man darf nicht allzu streng sein. Man verursacht einander viel Leid, selbst wenn man sich herzlich liebt.«
»So sollte man also lieber allein leben, jeder für sich?«
»Das ist noch schlimmer für uns Frauen. Das Leben der alleinstehenden Frau, die kämpfen muß wie der Mann (und oft gegen den Mann), ist etwas Entsetzliches in einer Gesellschaft, die für solche Ideen nicht geschaffen ist, und ihnen meistens feindlich gegenübersteht.«
Sie schwieg, beugte sich leicht nach vorn und starrte in das Kaminfeuer; dann sprach sie leise, mit ihrer etwas verschleierten Stimme, die manchmal stockte, innehielt und dann wieder fortfuhr:
»Und doch ist es nicht unser Fehler. Wenn eine Frau in dieser Weise lebt, tut sie es nicht aus Laune, sondern weil sie dazu gezwungen wird; sie muß ihr Brot verdienen und lernen, ohne den Mann fertig zu werden, weil er, wenn sie arm ist, nichts von ihr wissen will. Sie ist zur Einsamkeit verdammt, ohne davon irgend einen Vorteil zu haben; denn sie kann in unserer Gesellschaft nicht, wie der Mann, ihre Freiheit genießen, und sei es auch in der unschuldigsten Weise, ohne einen Skandal hervorzurufen: alles ist ihr untersagt. – Ich habe eine kleine Freundin, eine Lehrerin an einem Provinzgymnasium. Säße sie in einem lustlosen Gefängnisloch, sie könnte es nicht einsamer und erstickender haben. Das Bürgertum verschließt seine Türen vor diesen Frauen, die sich arbeitend durchs Leben mühen; es zeigt ihnen mißtrauische Verachtung; die Bosheit belauert jeden ihrer Schritte. Ihre Kollegen von den Knabengymnasien halten sich fern, sei es aus Angst vor dem Stadtklatsch, sei es aus heimlicher Feindschaft, oder aus Schüchternheit, aus Gewohnheit, im Kaffeehaus herumzusitzen und zweideutige Unterhaltungen zu führen, sei es aus Abspannung nach der Tagesarbeit oder aus übersättigter Abneigung gegen die intellektuelle Frau. Untereinander können sich diese Frauen auch nicht mehr ertragen, besonders, wenn sie gezwungen waren, im Seminar zusammen zu hausen. Die Vorsteherin ist oft am wenigsten fähig, die jungen, liebebedürftigen Seelen zu verstehen, die von den ersten Jahren dieses trockenen Berufes und ihrer unmenschlichen Einsamkeit entmutigt sind. Sie läßt sie heimlich dulden, ohne den Versuch zu machen, ihnen zu helfen. Sie hält sie für hochmütig. Niemand nimmt sich ihrer an. Ihr Mangel an Vermögen und Beziehungen hindert sie, zu heiraten. Die vielen Arbeitsstunden hindern sie, sich ein geistiges Leben zu schaffen, das sie festigt und tröstet. Wenn ein solches Dasein nicht von einem ganz besonders religiösen oder moralischen Empfinden gestützt wird, – (ich möchte sogar sagen, von einem anormalen, krankhaften Empfinden: denn es ist nicht natürlich, sich ganz und gar aufzuopfern), so ist dieses Leben ein lebendiges Begrabensein ... – Und finden die Frauen, die keine geistige Arbeit haben, vielleicht in der Wohltätigkeit mehr Befriedigung? Wieviel bittere Enttäuschungen bereitet sie denen, deren Seele zu aufrichtig ist, um in der öffentlichen oder gesellschaftlichen Wohltätigkeit Genüge zu finden, an den philanthropischen Schwätzereien, an dem widerlichen Gemisch von Leichtfertigkeit, Wohltun und Bürokratie, indem man plaudernd zwischen zwei Flirts mit dem Elend spielt! Welcher fast unerträgliche Anblick bietet sich der Frau, die die unglaubliche Kühnheit besitzt, sich mitten in dieses Elend hinein zu wagen, das sie nur vom Hörensagen kennt? Eine Hölle! Was kann sie tun, um dem abzuhelfen? Sie ertrinkt in diesem Meer von Unglück. Sie kämpft dennoch, sie müht sich, ein paar der Elenden zu retten, sie reibt sich für sie auf, sie geht mit ihnen unter. Und ist es ihr wirklich gelungen, ein oder zwei zu retten, so ist sie noch besonders glücklich zu nennen! Wer aber wird sie selbst retten! Wer wird sich auch nur darum bemühen, ihr zu helfen? Denn auch sie trägt Leid, nicht nur das der anderen, sondern auch das ihre; je mehr Glaubensstärke sie verausgabt, um so weniger hat sie für sich selbst; jedes Elend klammert sich verzweifelt an sie an; und sie selbst hat nichts, woran sie sich halten könnte. Niemand reicht ihr die Hand. Und manchmal wirft man ihr noch Steine nach ... Sie, Christof, haben auch jene wunderbare Frau gekannt, die sich dem niedrigsten und verdienstvollsten Wohlfahrtswerk widmete: sie nahm in ihrem Hause die Prostituierten der Straße auf, die eben entbunden hatten, die unglücklichen Mädchen, von denen die öffentliche Fürsorge nichts wissen wollte oder die vor der Fürsorge Angst hatten. Sie bemühte sich, sie körperlich und seelisch genesen zu lassen, behielt sie und ihre Kinder bei sich und suchte das Muttergefühl in ihnen zu wecken, ihnen von neuem ein Heim zu schaffen, ein Leben in anständiger Arbeit. Ihre ganze Kraft reichte kaum aus für diese dunkle Aufgabe voll Undank und Bitterkeit! (man rettet so wenige, so wenige wollen gerettet sein! Und all die kleinen Kinder, die da sterben! Die unzähligen, die schon bei der Geburt zum Tode verurteilt sind! ...) – Was meinen Sie, Christof, wie man diese Frau, die den ganzen Schmerz anderer auf sich genommen hatte, wie man diese Unschuldige, die freiwillig das Verbrechen des menschlichen Egoismus sühnte, beurteilte? Die öffentliche Böswilligkeit beschuldigte sie, mit ihrem Liebeswerk, ja sogar mit ihren Schützlingen Geld zu verdienen. Entmutigt mußte sie den Stadtteil verlassen und fortziehen ... – Gar nicht grausam genug können Sie sich die Grausamkeit des Kampfes ausmalen, den die unabhängigen Frauen gegen die heutige Gesellschaftsordnung zu führen haben, gegen diese konservative und herrschsüchtige Gesellschaft, die im Sterben liegt und das bißchen Energie, das ihr bleibt, dazu verwendet, die anderen am Leben zu hindern.«
»Meine arme Freundin, das ist nicht nur das Los der Frau; wir alle kennen diese Kämpfe. Ich kenne auch die Rettung daraus.«
»Und die wäre?«
»Die Kunst!«
»Die ist gut für Sie, nicht für uns. Und wie Wenige, selbst unter den Männern, haben etwas von ihr?«
»Sehen Sie unsere Freundin Cécile. Die ist glücklich.«
»Was wissen Sie davon? Ach, wie rasch sind Sie mit Ihrem Urteil fertig! Weil sie tapfer ist, weil sie sich nicht bei dem, was sie traurig macht, aufhält, weil sie es vor anderen verbirgt, sagen Sie, sie sei glücklich! Ja, sie ist glücklich, weil sie gesund ist und kämpfen kann. Aber Sie kennen ihre Kämpfe nicht. Glauben Sie, sie sei für das an Enttäuschungen reiche Leben der Kunst geschaffen? Die Kunst! Wenn man bedenkt, daß es arme Frauen gibt, die sich danach sehnen, durch Schreiben, Spielen oder Singen berühmt zu werden, als gelangten sie dadurch auf den Gipfel des Glückes! Sie müssen wirklich sonst nichts mehr haben, keinerlei Zuneigung, an die sie sich halten können. Die Kunst! Was haben wir mit der Kunst zu schaffen, wenn wir nicht neben ihr alles übrige haben? Nur eines in der Welt kann uns alles übrige vergessen machen: ein liebes Kindchen.«
»Und Sie sehen, wenn man es hat, genügt selbst das nicht einmal.«
»Ja, nicht immer ... Die Frauen sind nicht sehr glücklich. Es ist schwer, eine Frau zu sein, weit schwerer als ein Mann. Das macht ihr euch nicht klar genug. Ihr könnt euch in eine geistige Leidenschaft, in eine Tätigkeit ganz und gar vertiefen. Ihr bringt euch dadurch um mancherlei, aber ihr seid nur um so glücklicher. Eine gesunde Frau kann das nicht, ohne zu leiden. Es ist unmenschlich, einen Teil seines Selbst zu ersticken. Wenn wir auf die eine Art glücklich sind, so sehnen wir uns nach der anderen: wir haben mehrere Seelen. Ihr habt nur eine einzige, eine stärkere, die oft brutal, ja sogar ungeheuerlich ist. Ich bewundere euch. Aber seid nicht allzu selbstsüchtig. Ihr seid es ohnehin mehr, als ihr es ahnt. Und ihr tut uns weh genug, ohne es zu ahnen.«
»Was tun? Es ist nicht unsere Schuld!«
»Nein, es ist nicht eure Schuld, mein guter Christof. Es ist weder eure noch unsere Schuld. Sehen Sie, schließlich ist das alles wohl so, weil das Leben durchaus keine so einfache Sache ist. Es heißt, man braucht nur natürlich zu leben. Was aber ist natürlich?«
»Das ist wahr, nichts ist natürlich in unserem Leben. Das Zölibat ist nicht natürlich. Die Ehe ist es ebenso wenig. Und das freie Zusammenleben liefert die Schwachen der Raubgier der Starken aus. Selbst unsere ganze Gesellschaft ist nicht natürlich; wir haben sie gemacht. Man sagt, der Mensch sei ein Herdentier. Was für eine Torheit! Er hat es wohl werden müssen, um zu leben. Aus Nützlichkeitsgründen, zu seiner Verteidigung, zu seinem Vergnügen, um seiner Größe willen hat er sich gesellig gemacht. Die Notwendigkeit hat ihn dazu geführt, gewisse Verträge einzugehen. Aber die Natur sträubt sich dagegen und rächt sich an diesem Zwang. Die Natur ist nicht um unsertwillen geschaffen. Wir suchen sie zu beschneiden. Es ist ein Kampf, und es ist nicht erstaunlich, daß wir oft die Geschlagenen sind. Dem kann man nur entgehen, wenn man stark ist.«
»Wenn man gut ist.«
»O Gott, gut sein, den Panzer der Selbstsucht abtun, atmen, das Leben lieben, das Licht, seine bescheidene Aufgabe und den kleinen Erdenfleck, in den man seine Wurzeln senkt. Sich mühen, daß man an Tiefe und Höhe gewinnt, was man nicht an Weite haben kann, gleich einem Baum, dem es an Raum gebricht und der zur Sonne emporstrebt.«
»Ja, und vor allem, einer den anderen lieben. Wenn doch der Mann noch mehr empfinden wollte, daß er der Bruder der Frau und nicht nur ihre Beute ist oder sie die seine! Wenn sie doch alle beide ihren Hochmut ablegen könnten und jeder etwas weniger an sich und mehr an den anderen denken wollte ... Wir sind schwach; helfen wir deshalb einander. Sagen wir nicht zu dem Gefallenen: ›Ich kenne dich nicht mehr‹, sondern: ›Mut, mein Freund! Wir werden uns schon wieder herausfinden!‹«
Sie saßen schweigend vor dem Kamin, das kleine Kätzchen zwischen sich, und schauten alle drei ins Feuer, reglos und in ihre Gedanken vertieft. Die allmählich verlöschende Flamme streifte zärtlich mit ihrem flackernden Schein Frau Arnauds feines Gesicht, das von einer ihr ungewohnten Erregung rosig überhaucht war. Sie wunderte sich selbst, daß sie sich so rückhaltslos ausgesprochen hatte. Noch niemals hatte sie so viel über diese Dinge geredet. Nie mehr würde sie so viel darüber reden. Sie legte ihre Hand auf die Christofs und sagte:
»Was machen Sie mit dem Kinde?«
Dieser Gedanke hatte sie von Anfang an beherrscht. Sie hatte geredet, geredet, war eine ganz andre Frau, war wie berauscht. Und nur an dies Eine allein hatte sie gedacht. Schon bei Christofs ersten Worten hatte sie sich in ihrem Herzen einen Roman zurechtgemacht. Sie dachte an das von seiner Mutter verlassene Kind, an das Glück, es aufzuziehen, die kleine Seele mit ihren Träumen und ihrer Liebe zu umhegen. Und sie hatte sich gesagt: Nein, es ist schlecht, ich darf mich nicht über das freuen, was für andere ein Unglück ist. Aber sie konnte nicht dagegen an. Sie redete, redete, und ihr stilles Herz schwelgte in Hoffnungen.
Christof sagte:
»Ja, natürlich, darüber haben wir schon viel nachgedacht. Der arme Kleine! Weder Olivier noch ich sind fähig, ihn aufzuziehen. Die Pflege einer Frau tut not. Ich dachte, eine Freundin würde uns gewiß gern helfen ...« Frau Arnaud atmete kaum.
Christof sagte:
»Ich wollte mit Ihnen darüber sprechen. Da kam gerade Cécile. Als sie von der Sache erfuhr, als sie das Kind sah, war sie so bewegt, zeigte so unendlich viel Freude und sagte: ›Christof ...‹«
Frau Arnauds Herzschlag stockte; sie hörte nichts mehr; alles verschwamm vor ihren Augen. Sie hätte schreien mögen:
»Nein, nein, geben Sie es mir ...«
Christof redete, sie hörte nicht, was er sagte. Aber sie überwand sich, sie dachte an das, was Cécile ihr anvertraut hatte, und sie dachte:
»Sie hat es nötiger als ich. Ich habe ja meinen lieben Arnaud ... Und dann habe ich ja soviel andere Dinge ... Und dann bin ich älter ...«
Und sie lächelte und sagte:
»So ist es recht.«
Aber die Flamme des Herdes war erloschen; und auch die Rosenfarbe des Gesichtes. Und auf dem lieben, müden Antlitz lag nur noch der gewohnte Ausdruck sich bescheidender Güte.
»Meine Freundin hat mich verraten.« Dieser Gedanke drückte Olivier ganz und gar zu Boden. Vergeblich packte ihn Christof aus Liebe hart an.
»Was willst du?« sagte er. »Daß einen ein Freund verrät, ist ein Unglück, das alle Tage vorkommt, wie Krankheit, oder Armut, oder der Kampf mit der Dummheit. Man muß dagegen gewappnet sein. Wenn man dergleichen nicht überwinden kann, ist man nur ein armseliger Mensch.«
»Ach, mehr bin ich ja auch nicht. Ich bin nicht stolz darauf ... Ja, ein armseliger Mensch, der der Zärtlichkeit bedarf, und der stirbt, wenn er sie nicht mehr hat.«
»Dein Leben ist noch nicht am Ende: es gibt noch andere, die du lieben kannst.«
»Ich glaube an niemanden mehr. Es gibt keine Freunde.«
»Olivier!«
»Verzeih, an dir zweifele ich nicht, obgleich ich in manchen Augenblicken an allem zweifele, auch an mir ... Du aber bist stark, du hast niemanden nötig, du kannst ohne mich fertig werden.«
»Sie wird noch besser ohne dich fertig werden.«
»Du bist grausam, Christof!«
»Mein lieber Junge, ich bin hart gegen dich; aber ich bin es, damit du dich endlich einmal auflehnst. Zum Teufel! Es ist schmachvoll, daß du die, die dich lieben, daß du dein Leben hinopferst für jemanden, der auf dich pfeift.«
»Was liegt mir an denen, die mich lieben? Ich liebe nur sie allein.«
»Arbeite! Was dich früher interessierte ...«
»… das interessiert mich nicht mehr. Ich bin müde. Mir ist, als sei ich ausgeschieden aus dem Leben. Alles scheint mir fern, so fern ... Ich sehe, aber ich verstehe nicht mehr ... Wenn man bedenkt, daß es Männer gibt, die nicht müde werden, jeden Tag ihr Uhrwerk wieder aufzuziehen; ihren sinnlosen Beruf, ihre Zeitungsdebatten, ihre armselige Vergnügungsjagd; Männer, die sich für oder gegen ein Ministerium, ein Buch, eine Komödiantin ereifern ... Ach, wie alt fühle ich mich! Ich verspüre weder Haß noch Groll, gegen wen es auch sei: alles ist mir gleich. Ich fühle, es steckt nichts dahinter ... Schreiben? Wozu schreiben? Wer versteht einen denn? Ich schrieb nur für ein einziges Wesen; alles, was ich war, war ich für sie ... Ich habe nichts mehr. Ich bin müde, Christof, müde. Ich möchte schlafen.«
»Nun, so schlafe, mein Junge, ich werde über dir wachen.«
Das aber konnte Olivier am wenigsten. Ach, wenn jeder, der leidet, monatelang schlafen könnte, bis seine Pein von seinem erneuten Wesen abfällt, bis er ein anderer ist! Niemand aber kann ihm diese Gabe schenken; und er würde sie nicht einmal annehmen wollen. Es würde ihn am meisten schmerzen, von seinem Leiden befreit zu sein. Olivier war wie ein Fieberkranker, der sich vom Fieber nährt. Ein richtiges Fieber, dessen Anfälle zu denselben Stunden wiederkehren, vor allem abends, von dem Augenblick an, da die Sonne sinkt. Die übrige Zeit war er dann wie gebrochen, wie von Liebe vergiftet, von der Erinnerung zerfressen, immer nur mit denselben Gedanken beschäftigt, gleich einem Wahnsinnigen, der denselben Bissen beständig kaut, ohne ihn hinunterschlucken zu können, weil alle Kräfte des Gehirns gelähmt sind, ausgesogen von ein und derselben Zwangsvorstellung.
Ihm war es nicht, wie Christof, gegeben, sein Unglück zu bannen, indem er in gutem Glauben alles Übel auf die abwälzte, die es verursacht hatte. Er sah klarer und gerechter, kannte sehr wohl seinen Teil der Schuld und wußte, daß nicht nur er darunter litt: auch Jacqueline war sein Opfer: – sie war sein Opfer. Sie hatte sich ihm anvertraut: was hatte er aus ihr gemacht? Warum hatte er sie an sich gefesselt, wenn er nicht die Kraft besaß, sie glücklich zu machen. Sie war im Recht, wenn sie die Bande zerbrach, die sie unerträglich drückten.
»Es ist nicht ihre Schuld,« dachte er, »es ist meine. Ich habe sie nicht richtig geliebt. Und doch liebte ich sie so sehr. Aber ich habe nicht zu lieben verstanden, wenn ich nicht fähig war, mir ihre Liebe zu erhalten.«
So machte er sich Vorwürfe; und vielleicht hatte er recht. Aber es nützt nicht viel, über Vergangenes den Stab zu brechen: man würde trotzdem wieder genau so handeln, könnte man das Vergangene nochmals durchleben; und man erschwert sich damit nur das Leben. Ein starker Mensch vergißt das Weh, das man ihm zugefügt hat, – und leider auch das, das er selbst andern zufügte, sobald er sich klar macht, daß nichts mehr daran zu ändern ist. Aber man ist nicht aus Vernunft stark, sondern aus Leidenschaft. Die Liebe und die Leidenschaft sind zwei recht entfernte Verwandte. Sie gehen selten zusammen. Olivier liebte! Er war nur gegen sich selbst stark. Die Widerstandslosigkeit, der er verfallen war, machte ihn allen möglichen Krankheiten zugänglich. Influenza, Bronchitis, Lungenentzündung suchten ihn heim. Einen großen Teil des Sommers über war er krank. Christof und Frau Arnaud pflegten ihn aufopfernd, und es gelang ihnen, der Krankheit Herr zu werden. Doch gegen die seelische Krankheit waren sie machtlos; nach und nach empfanden sie die niederdrückende Abspannung, die ihnen diese fortgesetzte Trübsal verursachte, und fühlten das Bedürfnis, ihr zu entfliehen.
Durch das Unglück verfällt man in eine sonderbare Einsamkeit. Die Menschen haben einen instinktiven Abscheu davor. Man könnte meinen, sie hätten Furcht, daß es ansteckt; zum mindesten ist es langweilig. Man rettet sich vor ihm. Wie wenige Menschen verzeihen einem, daß man leidet! Es ist immer wieder die alte Geschichte von den Freunden Hiobs. Eliphas von Theman beschuldigt Hiob der Ungeduld. Bildad von Suah behauptet, Hiobs Unglück sei die Folge seiner Sünden. Zophar von Naema hält das Unglück für die Folge seines Hochmuts. »Aber Elihu, der Sohn Baracheels, von Bus, des Geschlechtes Rams, ward zornig über Hiob, daß er seine Seele gerechter hielt, denn Gott.« Wenige Menschen kennen wahre Trauer. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Olivier gehörte zu diesen. Ein Menschenfeind hat einmal gesagt: »Es war ihm anscheinend angenehm, mißhandelt zu werden. Man erreicht bei solchen Unglücksmenschen nichts! Man macht sich nur unbeliebt.«
Olivier konnte über das, was er durchmachte, zu niemandem reden, selbst nicht zu seinen vertrautesten Freunden. Er merkte, daß er sie damit anödete. Selbst sein treuer Christof wurde durch diese hartnäckigen und lästigen Schmerzen ungeduldig. Er wußte, daß er zu ungeschickt war, um helfen zu können. Eigentlich aber war es so: Diesem Menschen mit dem weiten Herzen, der für sich selbst die Probe des Leidens bestanden hatte, gelang es nicht, das Leid seines Freundes nachzuempfinden. So schwach ist die menschliche Natur! Sei einer noch so gut, mitleidig und gescheit, und hätte er tausend Todesqualen durchgemacht, er wird es nicht mitempfinden, wenn sein Freund Zahnschmerzen hat. Zieht sich die Krankheit hin, ist er versucht, anzunehmen, daß der Kranke übertreibt. Wieviel mehr ist das der Fall, wenn das Übel unsichtbar, auf dem Grund der Seele versteckt ist. Wer nicht selber davon betroffen ist, findet es aufreizend, daß der andere sich so mit einem Gefühl quält, das ihn nichts angeht. Und schließlich sagt man sich, um sein Gewissen zu beruhigen:
»Was kann ich tun? Alle Vernunftgründe führen zu nichts!« Alle Vernunftgründe, – ja das ist wahr. Denn wohltun kann man nur, wenn man den, der leidet, liebt, wenn man ihn ganz rückhaltlos liebt, ohne zu versuchen, ihn umzustimmen, ohne zu versuchen, ihm zu helfen, nur, indem man ihn liebt und ihn bedauert. Liebe ist der einzige Balsam für die Wunden der Liebe. Aber die Liebe ist nicht unerschöpflich, selbst nicht bei denen, die am stärksten lieben; auch sie haben nur einen begrenzten Vorrat. Wenn die Freunde einmal alles ausgesprochen oder geschrieben haben, was sie an herzlichen Worten finden konnten, wenn sie nach ihrer eigenen Ansicht ihre Pflicht getan haben, ziehen sie sich vorsichtig zurück und schaffen eine Leere um den Kranken, wie um einen Sünder. Und da sie sich heimlich ein wenig schämen, weil sie ihm so wenig helfen, helfen sie ihm immer weniger; sie suchen sich in Vergessenheit zu bringen und selbst zu vergessen. Wenn aber das lästige Unglück hartnäckig bestehen bleibt, wenn ein aufdringliches Echo davon bis in ihre Zurückgezogenheit dringt, fällen sie schließlich ein hartes Urteil über diesen mutlosen Menschen, der solche Prüfung so schlecht besteht. Man kann überzeugt sein, daß, wenn er zugrunde geht, in ihrem aufrichtigen Mitleid ein verächtlicher Unterton mitschwingt:
»Der arme Teufel! Ich hatte eine bessere Meinung von ihm!« Welch unsagbare Wohltat kann diesem allgemeinen Egoismus ein schlichtes Wort der Zärtlichkeit bedeuten, eine zarte Aufmerksamkeit, ein Blick voll Mitleid und Liebe! Er läßt den Wert der Güte empfinden. Und wie armselig ist alles übrige neben ihr! ... Sie brachte auch Olivier Frau Arnaud nahe, näher als jedem anderen, selbst als seinem Christof. Indessen zwang sich Christof zu einer anerkennenswerten Geduld: er ließ ihn aus Freundschaft nicht merken, wie er über ihn dachte. Olivier aber, dessen Blick durch das Leid noch geschärft war, merkte den Kampf, der sich in seinem Freunde abspielte, merkte, wie sehr diesem seine Traurigkeit zur Last fiel. Das war genug, damit er sich von Christof mehr und mehr entfernte und die Lust verspürte, ihm zuzuschreien:
»Sieh, daß du fortkommst!«
So trennt das Unglück oft die Herzen, die einander lieben; gleich dem Getreideschwinger, der das Korn ausliest, wirft es auf die eine Seite, was leben, auf die andere, was sterben soll. Furchtbares Gesetz des Lebens, das noch stärker als die Liebe ist! Die Mutter, die ihren Sohn sterben, der Freund, der seinen Freund am Ertrinken sieht, – suchen, wenn sie den anderen nicht retten können, sich selbst zu retten; sie sterben nicht mit ihnen. Und doch lieben sie ihn tausendmal mehr als das eigene Leben ...
Christof mußte trotz seiner großen Liebe Olivier manchmal fliehen. Er war zu kräftig, er war zu gesund, er erstickte in dieser lustlosen Pein. Wie sehr schämte er sich dessen. Er war totunglücklich, daß er für seinen Freund so wenig tun konnte; und da es ihm ein Bedürfnis war, sich deswegen an jemandem zu rächen, grollte er Jacqueline. Trotz Frau Arnauds verständnisvollen Worten beurteilte er sie weiter hart, weil es einer jungen, heftigen und ganzen Seele entspricht, die noch nicht genug vom Leben gelernt hat und daher unbarmherzig gegen seine Schwächen ist.
Er besuchte Cécile und das Kind, das man ihr anvertraut hatte. Das erquickte seine Seele. Cécile war durch ihre Adoptiv-Mutterschaft geradezu verklärt; sie erschien ganz jung, glücklich, feiner und weicher. Jacquelinens Gehen hatte in ihr keinerlei uneingestandene Glückshoffnungen aufkommen lassen. Sie wußte, daß die Erinnerung an Jacqueline Olivier noch weiter von ihr entfernte als Jacquelines Gegenwart. Im übrigen war der giftige Hauch, der ihr Bewußtsein leicht getrübt hatte, vorübergezogen: sie hatte die Krisis überwunden, wohl zum Teil dadurch, daß sie Jacquelines Verirrung mit erlebt hatte; sie hatte ihre gewohnte Ruhe wieder gewonnen und verstand nicht mehr recht, wie sie sie einmal hatte verlieren können. Der beste Teil ihres Liebesbedürfnisses fand in der Liebe zu dem Kinde Genüge. Mit der wunderbaren Einbildungs- und Ahnungskraft der Frau fand sie in dem kleinen Wesen den wieder, den sie liebte; so hatte sie ihn ganz für sich, schwach und abhängig: er gehörte ihr, und sie durfte ihn lieben, leidenschaftlich lieben, mit einer Liebe, die ebenso rein war wie das Herz dieses unschuldigen Kindchens und seine klaren blauen Augen, die wie Lichttröpfchen schimmerten. Wohl mischte sich in ihre Zärtlichkeit ein wehmütiges Gefühl. O, es war nicht dasselbe wie ein Kind vom eigenen Fleisch und Blut! ... Aber es war dennoch gut so. Christof sah Cécile jetzt mit anderen Augen. Er dachte an ein ironisches Wort von Françoise Oudon: »Wie kommt es, daß du und Philomele, die ihr dafür geschaffen wäret, Mann und Frau zu sein, euch doch nicht liebt?«
Françoise hatte besser als Christof selbst den Grund hierzu erkannt: wenn man ein Christof ist, liebt man selten jemanden, der einem wohltun kann; viel eher liebt man jemanden, der einem wehzutun versteht. Die Gegensätze ziehen sich an; die Natur geht auf Selbstzerstörung aus, sie zieht ein starkes Leben, das in sich verbrennt, einem vorsichtigen, das sich aufspart, vor. Und ist man ein Christof, so hat man damit recht; denn das Gesetz solcher Naturen ist nicht, so lange wie möglich, sondern so intensiv wie möglich zu leben.
Da aber Christof weniger scharfsichtig als Françoise war, sagte er sich, daß die Liebe eine blinde und unmenschliche Kraft sei. Sie bringt die zusammen, die sich nicht leiden mögen. Sie reißt die auseinander, die von gleicher Art sind. Was sie aufbaut, ist wenig im Vergleich zu dem, was sie zerstört. Ist die Liebe eine glückliche, schwächt sie den Willen; ist sie eine unglückliche, bricht sie das Herz. Schafft sie jemals etwas Gutes?
Und da er so die Liebe schalt, sah er ihr ironisches und zärtliches Lächeln, das ihm zu sagen schien: »Du Undankbarer!«
Christof hatte es nicht umgehen können, noch einen der Abendempfänge der Österreichischen Botschaft zu besuchen. Philomele sang Lieder von Schubert, von Hugo Wolf und von Christof. Sie war glücklich über ihren Erfolg und den ihres Freundes, der jetzt von einer auserlesenen Gesellschaft gefeiert wurde. Sogar beim großen Publikum drang Christofs Name von Tag zu Tag mehr durch; die Lévy-Coeur hatten nicht mehr das Recht, zu tun, als kennten sie ihn nicht. Seine Werke wurden in Konzerten gespielt; ein Stück war von der »Opéra Comique« angenommen worden. Sympathien, deren Ursprung er nicht kannte, halfen ihm. Der geheimnisvolle Freund, der öfter für ihn eingetreten war, unterstützte auch weiter seine Bestrebungen. Mehr als einmal hatte Christof diese zartfühlende Hand empfunden, die ihm auf seinem Wege half: jemand wachte über ihm und verbarg sich doch ängstlich. Christof hatte versucht, ihn zu entdecken, aber es war, als wenn der Freund unwillig darüber sei, daß Christof sich nicht früher bemüht hatte ihn kennen zu lernen. Und so blieb er jetzt unauffindbar. Übrigens war Christof von anderen Dingen erfüllt: er dachte an Olivier, er dachte an Françoise; gerade an jenem Morgen hatte er in einer Zeitung gelesen, daß sie in San Franzisko ernstlich erkrankt sei; er stellte sie sich vor, wie sie allein in einer fremden Stadt in einem Hotelzimmer lag, niemanden sehen, an keinen ihrer Freunde schreiben wollte, wie sie die Zähne zusammenbiß und einsam den Tod erwartete.
Von solchen Gedanken beherrscht, vermied er die Gesellschaft; er hatte sich in einen kleinen, abseits gelegenen Salon zurückgezogen. An die Wand gelehnt, in einer halbdunklen Ecke, hinter einem Vorhang von Blattgrün und Blumen, lauschte er der schönen, elegischen, warmen Stimme Philomeles, die den »Lindenbaum« von Schubert sang; und diese reine Musik weckte schwermütige Erinnerungen in ihm. Ihm gegenüber warf ein großer Wandspiegel die Lichter und das Leben aus dem anstoßenden Salon zurück. Er sah nichts davon: sein Blick war nach innen gekehrt, seine Augen waren von Tränen umflort ... Plötzlich begann er, ganz ohne äußere Veranlassung, zu zittern, gleich dem alten Baum in Schuberts Lied, durch den ein Schauer geht. Einige Sekunden blieb er so, reglos, sehr bleich. Dann zerriß der Schleier vor seinen Augen und vor sich im Spiegel sah er »die Freundin«, die ihn anschaute ... Die Freundin? Wer war sie? Er wußte nichts weiter, als daß sie die Freundin sei, und daß er sie kenne; und seine Augen in ihre versenkt, stützte er sich gegen die Wand und zitterte noch immer. Sie lächelte. Er sah weder die Züge ihres Gesichtes, noch die Linien ihres Körpers, weder die Farbe ihrer Augen, noch ob sie groß oder klein oder wie sie gekleidet war. Er sah nur eins: die göttliche Güte ihres mitfühlenden Lächelns.
Und dieses Lächeln rief in Christof plötzlich eine entschwundene Erinnerung aus seiner frühesten Kindheit wach ... Er war sechs oder sieben Jahre alt, saß in der Schule und fühlte sich unglücklich, denn ältere und stärkere Kameraden hatten ihn gerade gedemütigt und geschlagen; alle machten sich über ihn lustig, und der Lehrer hatte ihn ungerecht bestraft; er saß verlassen in einem Winkel zusammengekauert, während die anderen spielten, und weinte ganz leise vor sich hin. Da war ein kleines, schwermütig aussehendes Mädchen, das nicht mit den anderen spielte, gekommen, – (er sah sie in diesem Augenblick wieder vor sich, obgleich er seither niemals an sie gedacht hatte: sie war klein, hatte einen großen Kopf, fast weißblonde Haare und Wimpern, ganz blaßblaue Augen, breite bleiche Backen, dicke Lippen, ein etwas aufgedunsenes Gesicht und kleine rote Hände) – sie war zu ihm getreten, war, den Daumen im Mund, stehen geblieben und hatte einige Zeit zugeschaut, wie er weinte. Dann hatte sie ihre kleine Patsche auf Christofs Kopf gelegt und zaghaft, hastig, mit dem gleichen, mitfühlenden Lächeln zu ihm gesagt:
»Weine nicht, weine nicht.«
Da hatte sich Christof nicht mehr halten können, er war in Schluchzen ausgebrochen und hatte seine Nase in die Schürze des kleinen Mädchens gedrückt, das immer wieder mit zitternder und zärtlicher Stimme sagte: »Weine nicht ...«
Kurze Zeit darauf, vielleicht nur einige Wochen später, war sie gestorben; als jener Auftritt sich abspielte, mußte der Tod sie schon gezeichnet haben ... Warum dachte er gerade in diesem Augenblicke an sie? Es bestanden keinerlei Beziehungen zwischen jener vergessenen kleinen Toten, dem bescheidenen Mädchen aus dem Volke in einer fernen deutschen Stadt und der adeligen jungen Dame, die ihn jetzt anschaute. Aber in allen lebt nur eine Seele; und wenn auch die Millionen von Geschöpfen unter sich verschieden zu sein scheinen, gleich den Welten, die im Himmelsraum kreisen, so leuchtet doch derselbe Blitzstrahl des Gedankens oder der Liebe gleichzeitig in den durch Jahrhunderte voneinander getrennten Herzen. Christof hatte jetzt den Lichtschein wieder gefunden, den er einst über die blassen Lippen der kleinen Trösterin hatte huschen sehen ...
Das alles dauerte nur einen Augenblick. Eine Menge Menschen verstellte die Türe, so daß Christof nicht in den anderen Saal sehen konnte. Er zog sich schnell aus dem Bereich des Spiegels ins Dunkel zurück, aus Furcht, seine Verwirrung könne bemerkt werden. Doch als er ruhiger geworden war, wollte er sie wiedersehen. Er bangte, daß sie fortgegangen sein könne. Er trat in den Salon; und sogleich fand er sie unter der Menge wieder, obgleich nicht mehr als dieselbe, die ihm im Spiegel erschienen war. Jetzt sah er sie von der Seite; sie saß in einem Kreis eleganter Damen; einen Ellbogen auf der Sessellehne, den Körper ein wenig vorgeneigt, den Kopf in die Hand gestützt, hörte sie mit klugem und zerstreutem Lächeln dem Geplauder zu; im Gesichtsausdruck und in den Zügen hatte sie etwas vom jungen Johannes auf Raffaels »Disputa«, der lauschend und schauend, mit halbgeschlossenen Augen seinen eigenen Gedanken zulächelt ...
Nun hob sie die Augen, sah ihn und war nicht erstaunt. Und er sah, daß ihr Lächeln ihm galt. Er grüßte sie bewegt und ging auf sie zu.
»Sie erkennen mich wohl nicht?« sagte sie.
In diesem Augenblicke erkannte er sie:
»Grazia ...« sagte er. Vgl. »Johann Christof in Paris«, Erstes Buch: »Der Jahrmarkt«.
Da kam die Gemahlin des Botschafters vorüber; sie gab ihrer Freude Ausdruck, daß es endlich zu der lange gesuchten Begegnung gekommen sei, und stellte Christof der Gräfin Berény vor. Christof aber war so bewegt, daß er nichts hörte: er achtete nicht auf den fremden Namen. Für ihn war sie immer noch seine kleine Grazia.
Grazia war zweiundzwanzig Jahre alt. Seit Jahresfrist war sie mit einem jungen österreichischen Gesandtschaftsattaché verheiratet, der aus vornehmer, mit einem der ersten Minister des Kanzlers verschwägerten Adelsfamilie stammte. Sie hatte sich in diesen eleganten, vor der Zeit verbrauchten Lebemann und Snob aufrichtig verliebt, und liebte ihn noch, so richtig sie ihn auch sonst beurteilen mochte. Ihr alter Vater war gestorben. Ihr Gatte war in die Botschaft nach Paris berufen worden. Durch die Beziehungen des Grafen Berény und ihre Anmut und Klugheit war das scheue Mädchen, das ein Nichts einschüchtern konnte, eine der gefeiertsten jungen Frauen der Pariser Gesellschaft geworden, ohne daß sie sich darum bemüht hätte und ohne sich dadurch befangen zu fühlen. Es liegt eine große Kraft darin, jung und hübsch zu sein, zu gefallen und zu wissen, daß man gefällt. Und eine nicht minder große Kraft liegt darin, ein ruhiges, sehr gesundes und sehr heiteres Herz zu besitzen, das in der harmonischen Übereinstimmung zwischen seinen Wünschen und seinem Schicksal das Glück findet. Die schöne Blüte vom Baum des Lebens hatte sich entfaltet; doch sie hatte nichts von der ruhevollen Musik ihrer lateinischen Seele verloren, die im Licht und im herrlichen Frieden der italienischen Erde gereift war. Ganz von selbst hatte sie in der Pariser Gesellschaft einen gewissen Einfluß erworben; das wunderte sie auch weiter nicht, und in taktvoller Weise verstand sie ihn für künstlerische und wohltätige Werke, mit denen sie zu tun hatte, auszunutzen. Den offiziellen Vorsitz solcher Werke überließ sie indessen anderen: denn wußte sie auch ihre Stellung zu wahren, so hatte sie sich doch aus ihrer etwas ungeselligen Kindheit in dem einsamen, mitten in Feldern liegenden Landhaus ein heimliches Unabhängigkeitsbedürfnis bewahrt; die Gesellschaft ermüdete sie, trotzdem sie ihr oft angenehm war; aber sie verstand es doch, ihre Langeweile unter dem liebenswürdigen Lächeln eines höflichen und guten Herzens zu verbergen.
Sie hatte ihren großen Freund Christof nicht vergessen. Das Kind, das in der Stille von einer unschuldigen Liebe verzehrt worden war, lebte zwar nicht mehr. Die jetzige Grazia war eine sehr vernünftige und keineswegs romantische Frau. Der Überschwang ihrer kindlichen Zärtlichkeit erweckte in ihr eine leise Ironie. Doch die Erinnerung daran rührte sie auch wieder. Das Andenken an Christof war mit den reinsten Stunden ihres Lebens verknüpft. Es bereitete ihr Vergnügen, seinen Namen zu hören; jeder seiner Erfolge machte ihr Freude, als habe sie einen Anteil daran; denn sie hatte diese Erfolge ja vorausgeahnt. Seit ihrer Ankunft in Paris hatte sie versucht, ihn wiederzusehen. Sie hatte ihn eingeladen und hatte auf der Einladungskarte ihren einstigen Mädchennamen hinzugefügt. Christof hatte nicht darauf geachtet und die Einladung in den Papierkorb geworfen, ohne zu antworten. Sie war darüber nicht gekränkt gewesen und hatte, ohne daß er es wußte, seine Arbeiten und sogar ein wenig sein Leben weiter verfolgt. Ihre wohltuende Hand hatte ihn bei den Angriffen, die kürzlich von den Zeitungen gegen ihn geführt worden waren, unterstützt. Die in jeder Hinsicht auf Reinlichkeit bedachte Grazia hatte keinerlei Beziehungen zur Zeitungswelt; handelte es sich aber darum, einem Freund einen Dienst zu erweisen, so war sie fähig, mit listigem Geschick Leute, die sie am wenigsten mochte, zu betören. Sie lud den Hauptleiter der Zeitung, der die Kläffermeute anführte, ein. Und im Nu hatte sie ihm den Kopf verdreht; denn sie verstand es, seiner Eitelkeit zu schmeicheln. Sie bezauberte ihn so sehr, und flößte ihm doch gleichzeitig so großen Respekt ein, daß es schließlich nur einiger Worte verächtlichen Erstaunens über die Angriffe auf Christof bedurfte, Worte, die sie so nebenbei sagte, – um die Angriffe mit einem Schlage zum Verstummen zu bringen. Der Schriftleiter strich den beleidigenden Aufsatz, der am nächsten Morgen erscheinen sollte, und als der Berichterstatter sich nach den Gründen erkundigte, die zu dieser Streichung geführt hatten, wusch er ihm gehörig den Kopf. Ja, er tat noch mehr: er gab einem seiner Leute-für-Alles den Auftrag, in dem zusammenfassenden Bericht der letzten vierzehn Tage einen begeisterten Abschnitt über Christof zu bringen, der so begeistert und so dumm ausfiel, wie man es sich nur wünschen konnte. Grazia war es auch, die den Gedanken hatte, in der Botschaft Werke ihres Freundes aufführen zu lassen, und die Cécile dazu verhalf, sich in größerem Kreise bekannt zu machen, da sie wußte, daß Cécile unter Christofs Schutz stand. Schließlich begann sie ganz allmählich und mit unauffälliger Geschicklichkeit, durch ihre Beziehungen zu der deutschen diplomatischen Gesellschaft das Interesse für den aus Deutschland verbannten Christof an machthabender Stelle zu wecken. Und nach und nach bahnte sie einen Meinungsumschwung an, um vom Kaiser einen Erlaß zu erlangen, der die Pforten seines Landes einem Künstler, der dieses ehrte, wieder öffnen sollte. War es auch für den Augenblick verfrüht, diesen Gnadenakt zu erwarten, so brachte sie es doch wenigstens dahin, daß man inbezug auf seine Reise von wenigen Tagen, die er in seine Vaterstadt unternahm, ein Auge zudrückte.
Und Christof, der die Hand der unsichtbaren Freundin über sich fühlte, ohne erfahren zu können, wer sie sei, hatte sie nun in dem Antlitz des jungen Johannes erkannt, das ihm im Spiegel zulächelte.
Sie plauderten von der Vergangenheit. Was sie redeten, wußte Christof kaum. Die, die man liebt, sieht und hört man nicht. Man liebt sie einfach. Und liebt man sie recht, so denkt man nicht einmal daran, daß man sie liebt. Christof dachte an nichts; sie war da: das war ihm genug. Alles übrige war für ihn nicht mehr vorhanden ...
Grazia hielt im Reden inne. Ein sehr großer, recht gut aussehender junger Mann, elegant, mit glatt rasiertem Gesicht, halb kahlem Kopf und gelangweilter, hochmütiger Miene, betrachtete Christof durch sein Monokel und verbeugte sich auch bereits mit herablassender Höflichkeit.
»Mein Mann,« sagte sie.
Im Saal erhob sich wieder das Stimmengewirr. Das innere Licht erlosch. Christof schwieg, erstarrt und zog sich, nachdem er den Gruß erwidert hatte, sofort zurück.
Welche lächerlichen und unersättlichen Ansprüche, welche kindlichen Gesetze beherrschen die Künstlerseelen und ihr von Leidenschaften bewegtes Leben! Kaum hatte er diese Freundin, die er einst, als sie ihn liebte, vernachlässigt hatte, und an die er seit Jahren nicht mehr gedacht hatte, wiedergefunden, so war es ihm, als gehöre sie ihm, als wäre sie sein eigen, und als sei sie ihm gestohlen worden, da ein anderer sie genommen hatte. Sie selbst hatte seiner Ansicht nach nicht das Recht, sich einem anderen zu schenken. Christof machte sich nicht klar, was in ihm vorging. Aber sein schöpferischer Dämon machte es sich statt seiner klar und gebar in diesen Tagen einige seiner schönsten Lieder voll schmerzlicher Liebe.
Eine geraume Zeit lang sah er Grazia nicht wieder. Oliviers Leid und Gesundheit beschäftigten ihn vollauf. Dann eines Tages fand er die Adresse wieder, die sie ihm gegeben hatte, und ein Entschluß reifte in ihm.
Als er die Treppe hinaufstieg, hörte er, wie man mit lauten Hammerschlägen etwas zunagelte. Das Vorzimmer war in Unordnung, von Kisten und Koffern verstellt. Der Diener antwortete, die Gräfin sei nicht zu sprechen. Doch als Christof enttäuscht seine Karte abgegeben hatte und schon im Fortgehen war, lief ihm der Diener nach und ließ ihn unter Entschuldigungen eintreten. Christof wurde in einen kleinen Salon geführt, in dem die Teppiche aufgenommen und zusammengerollt waren. Grazia kam mit ihrem strahlenden Lächeln auf ihn zu und streckte ihm in einer frohen Bewegung die Hand entgegen. Aller törichte Groll versank. Er ergriff diese Hand in derselben frohen Bewegung und küßte sie.
»Ach,« sagte sie, »wie glücklich bin ich, daß Sie gekommen sind. Ich fürchtete so sehr, daß ich abreisen würde, ohne Sie wieder gesehen zu haben.«
»Abreisen? Sie reisen fort?«
Und wieder sank das Dunkel über ihn.
»Sie sehen ja,« sagte sie, und wies auf die Unordnung im Zimmer, »Ende der Woche werden wir Paris verlassen haben!«
»Für wie lange?«
Sie machte eine Bewegung:
»Wer kann das wissen?«
Er wollte sprechen. Seine Kehle war zugeschnürt.
»Wohin gehen Sie?«
»Nach den Vereinigten Staaten. Mein Mann ist dort zum Botschaftssekretär ernannt worden.«
»Und so ... so ... ist alles aus?« (Seine Lippen zitterten.)
»Lieber Freund!« sagte sie, von seinem Ton bewegt ... »Nein, es ist nicht aus.«
»Ich habe Sie also nur wiedergefunden, um Sie zu verlieren!« Er hatte Tränen in den Augen.
»Lieber Freund,« sagte sie noch einmal.
Er deckte die Hand über die Augen und wandte sich ab, um seine Bewegung zu verbergen.
»Seien Sie nicht traurig,« sagte sie, und legte ihre Hand auf die seine.
In diesem Augenblick dachte er wieder an das kleine deutsche Mädchen. – Sie schwiegen.
»Warum sind Sie so spät gekommen?« fragte sie dann endlich. »Ich versuchte, Ihnen zu begegnen, aber Sie sind niemals darauf eingegangen.«
»Ich wußte doch nicht, ich wußte doch nicht ...« stammelte er. »Sagen Sie, waren Sie es, die mir so oft zu Hilfe kam, ohne daß ich es ahnen konnte? ... Ihnen danke ich, daß ich nach Deutschland zurückkehren konnte? Sie waren mein guter Engel und wachten über mich?«
Sie antwortete:
»Ich war glücklich, etwas für Sie tun zu können; ich schulde Ihnen so viel.«
»Was denn?« sagte er. »Ich habe doch nichts für Sie getan.«
»Sie wissen ja nicht, was Sie mir gewesen sind!« sagte sie; und sie redete von der Zeit, in der sie ihn als kleines Mädchen bei ihrem Onkel Stevens getroffen hatte, wo ihr durch ihn und durch seine Musik alles, was es Schönes in der Welt gibt, offenbart worden war. Und allmählich wurde sie in ihrer milden Art lebhafter, und erzählte ihm in kurzen, deutlichen und dabei doch verschleierten Andeutungen von ihren Kindergefühlen, von dem Anteil, den sie an seinem Kummer genommen hatte, von dem Konzert, in dem er ausgepfiffen worden war, und in dem sie geweint hatte, von dem Brief, den sie ihm geschrieben und auf den er nie geantwortet hatte, da er ihn nicht bekommen hatte. Und während Christof ihr zuhörte, erfüllte er, guten Glaubens voll, die Vergangenheit mit seinem jetzigen Gefühl, mit der ganzen Zärtlichkeit, die ihn für das sanfte Gesicht erfüllte, das ihm nun zugewandt war.
Sie plauderten harmlos, voll herzlicher Freude. Und Christof ergriff, während er sprach, Grazias Hand. Plötzlich aber hielten sie beide inne; denn Grazia wurde es klar, daß Christof sie liebe. Und auch Christof wurde es klar ...
Grazia hatte Christof eine Zeit lang geliebt, ohne daß er sich darum gekümmert hätte. Jetzt liebte Christof Grazia, und Grazia empfand nichts mehr für ihn als eine friedliche Freundschaft: sie liebte einen anderen. Wie so oft im Leben, hätte es genügt, daß eine der beiden Lebensuhren ein wenig schneller gelaufen wäre, und ihrer beider ganzes Leben wäre anders geworden ...
Grazia zog ihre Hand zurück, die Christof nicht mehr festhielt. Für einen Augenblick waren sie bestürzt und stumm. Dann sagte Grazia:
»Leben Sie wohl.«
»Und so ist es also aus?« klagte Christof noch einmal.
»Es ist wahrscheinlich besser, daß es so gekommen ist.«
»Werden wir uns vor Ihrer Abreise nicht noch einmal sehen?«
»Nein,« sagte sie.
»Wann werden wir uns wiedersehen?«
Sie machte eine wehmütig zweifelnde Bewegung.
»Warum haben wir uns dann wiedergesehen? Warum?« meinte Christof.
Aber auf den Vorwurf, der ihn aus ihren Augen traf, antwortete er sogleich selbst:
»Nein, Verzeihung, ich bin ungerecht.«
»Ich werde immer an Sie denken,« sagte sie.
»Ach,« meinte er, »ich kann nicht einmal an Sie denken, ich weiß nichts von Ihrem Leben.«
Ruhig beschrieb sie ihm mit wenigen Worten ihr gewohntes Leben und wie ihre Tage dahingingen. Mit ihrem schönen, herzlichen, warmen Lächeln sprach sie von sich und ihrem Mann.
»O,« meinte er eifersüchtig, »Sie lieben ihn?«
»Ja,« sagte sie.
Er stand auf.
»Leben Sie wohl.«
Auch sie stand auf: Da erst merkte er, daß sie in Hoffnung war. Und in seinem Herzen empfand er einen unaussprechlichen Eindruck von Widerwillen und Zärtlichkeit, von Eifersucht und leidenschaftlichem Mitleid. Sie begleitete ihn bis zum Ausgang des kleinen Salons. An der Türe wandte er sich um, beugte sich über ihre Hände und küßte sie lange. Sie rührte sich nicht und hielt die Augen halb geschlossen. Schließlich richtete er sich auf und ging schnell hinaus, ohne sie noch einmal anzuschauen.
… E chi allora m'avesse domandato
di cosa alcuna, la mia risponsione
sarebbe stata solamente AMORE
con viso vestito d'umiltà ...
Allerheiligentag. Draußen graues Licht und kalter Wind. Christof war bei Cécile. Cécile saß neben der Wiege des Kindes, über das sich Frau Arnaud neigte, die im Vorbeigehen heraufgekommen war. Christof träumte. Er fühlte, daß er das Glück versäumt hatte, aber es kam ihm nicht in den Sinn, darüber zu klagen: er wußte, es gab ein Glück ... Sonne, ich brauche dich nicht zu sehen, um dich zu lieben! Während der langen Wintertage, in denen ich im Dunkel erschauere, ist mein Herz von dir erfüllt; meine Liebe wärmt mich: ich weiß, du bist da ...
Auch Cécile träumte. Sie betrachtete das Kind unentwegt, und schließlich war ihr, als sei es ihr eigenes. O, gesegnete Macht des Traumes, schöpferische Fantasie des Lebens! Das Leben ... Was ist das Leben? Es ist nicht so, wie die kalte Vernunft und unsere Augen es sehen. Das Leben ist so, wie wir es träumen. Der Maßstab des Lebens ist die Liebe.
Christof betrachtete Cécile, deren ländlich derbes Gesicht mit den großen Augen vom Glanz der Mutterliebe überstrahlt war, – eine bessere Mutter als die wirkliche. Und er betrachtete Frau Arnauds sanftes müdes Gesicht. Er las darin wie in einem herzbewegenden Buch die verborgenen Leiden und Freuden dieses Lebens einer Gattin, das oft, ohne daß man etwas davon ahnt, ebenso reich an Schmerzen und Wonnen ist wie die Liebe Julias oder Isoldens, nur reicher an frommer Größe ...
» Socia rei humanae atque divinae ...«
Und er dachte, daß ebensowenig wie der Glaube oder der Mangel an Glauben die Kinder oder der Mangel an Kindern das Glück oder Unglück der Frauen ausmachen, die sich verheiraten, und der, die sich nicht verheiraten. Das Glück ist der Duft der Seele, die Harmonie, die im Grunde des Herzens schwingt. Die schönste Musik der Seele aber ist die Güte.
Olivier trat ins Zimmer. Seine Bewegungen waren ruhig; eine neue stille Heiterkeit erhellte sein Gesicht. Er lächelte dem Kinde zu, drückte Cécile und Frau Arnaud die Hand und begann ruhig zu plaudern. Sie beobachteten ihn mit einem Erstaunen voll freundschaftlicher Zuneigung. Er war nicht mehr derselbe. In der Einsamkeit, in die er sich mit seinem Kummer zurückgezogen hatte, gleich der Raupe, die sich einspinnt, war es ihm nach vieler Mühe gelungen, sein Leid wie eine leere Hülle abzustreifen. Später wollen wir erzählen, wie er glaubte, einen schönen Daseinszweck gefunden zu haben, dem er sein Leben weihen wollte, das dann nur noch einen Sinn für ihn hatte, wenn er es zum Opfer bringen konnte; und wie es immer ist: Gerade an dem Tage, da sein Herz auf das Leben verzichten wollte, war das Leben neu in ihm entfacht. Seine Freunde schauten ihn an. Sie wußten nicht, was sich zugetragen hatte, und wagten nicht, ihn danach zu fragen; aber sie fühlten, daß er sich befreit hatte, und daß weder Trauer noch Bitterkeit in ihm zurückgeblieben waren, um was und gegen wen es auch sei. Christof stand auf, ging zum Klavier und sagte zu Olivier: »Soll ich dir ein Lied von Brahms singen?«
»Von Brahms?« fragte Olivier, »du spielst jetzt deinen alten Feind?«
»Es ist ›Allerheiligen‹,« sagte Christof, »der Tag der Vergebung für alle.«
Und halblaut, um das Kind nicht aufzuwecken, sang er einige Sätze aus einem alten schwäbischen Volkslied:
»Für die Zeit, wo du g'liebt mi hast,
Da dank' i dir schön,
Und i' wünsch', daß dir's anderswo
Besser mag geh'n ...«
»Christof!« sagte Olivier.
Christof drückte ihn an seine Brust.
»Nur Mut, mein Junge,« sagte er zu ihm, »wir haben das gute Teil erwählt.«
So saßen sie alle vier um das schlafende Kind. Sie redeten nicht. Und hätte man sie gefragt, was ihre Gedanken bewegte, sie hätten, das Antlitz von Demut überschattet, nur eines geantwortet: