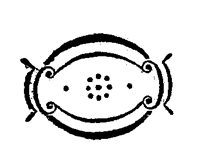|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wieder einmal hatte eine Pariser Saison ihren geräuschvollen, schimmernden und doch so monotonen Kreislauf vollendet, der mit dem Ende der Novemberjagden beginnt und mit den großen Sportturnieren des Sommers abschließt. Wie immer hatte sich das Leben um Kunst und Skandale aller Art, um Liebe und Geschäftsangelegenheiten gedreht, um tiefes Elend und aufdringliche Eleganz. Es hatte Ehescheidungen gegeben und Duelle, schmachvolle Prozesse, Katastrophen und glänzende Erfolge, manches Vermögen und manches Menschen Ehre war kläglich gescheitert. Hier und da war einer gestorben, den man für unentbehrlich hielt, oder an den Theatern und im Gesellschaftsleben war irgend ein neuer Stern aufgegangen. Und jetzt, wo der volle Luxus der Saison sich im sonnenbeschienenen Bois entfaltete, beginnt man allmählich nach der gewohnten Sommerfrische auszuschauen, die Vorsichtigen haben ihre Villa schon längst voraus gemietet, Paris geht in die Ferien, leert sich wie ein Hotel, in dem kaum noch ein Gast zurückbleibt. Vergessen, verweht ist alles, was dieses letzte Jahr gebracht hat, die Skandale wie die ruhmvollen Ereignisse, Glück und Elend, die Zugrundegegangenen wie die Triumphierenden – so rasch und so gründlich vergessen, daß in der nächsten Saison sich keiner mehr ihrer erinnert.
Es war jetzt acht Monate her, daß das Verschwinden der Fürstin von Ermingen die Pariser Gesellschaft in einige Aufregung versetzt hatte, aber auch darüber hatte man sich schon längst wieder beruhigt. Der Anwalt des Fürsten hatte sein möglichstes getan, um die Presse zum Schweigen zu bringen, und sie hatte sich denn auch wirklich fast einstimmig diskret verhalten. Zwei oder drei kleine Skandalblätter hatten eine Mitteilung darüber gebracht, sich jedoch ziemlich in den Grenzen der Mäßigung gehalten. Dann war allerdings in einem Boulevardblatt ein kleiner Artikel erschienen unter der Spitzmarke: » si tu veux, faisons un rêve« – und darin war die Rede von einer Fürstin, die von ihrer Zofe entführt wurde... Aber schon am Tage darauf übernahm es eine der verbreitetsten großen Zeitungen, die Sache richtig zu stellen.
Eine der bekanntesten Erscheinungen unsres Pariser Gesellschaftslebens, – hieß es da – der Träger eines alten und berühmten Namens, ist von einem harten Schicksalsschlag betroffen worden – seine Frau erkrankte an einem schweren Nervenleiden und mußte in eine Heilanstalt des Auslands gebracht werden. Diese einfache Tatsache hat man zu einer geheimnisvollen Geschichte aufgebauscht. Wir hätten uns aus einfacher Diskretion nicht näher damit befaßt, aber es ist unter anderm das Wort ›Flucht‹ gebraucht worden. Allem Anschein nach kann ein Mitglied unsrer angesehensten Kreise nicht von irgend einem Unglück befallen werden, ohne daß man die Gelegenheit benutzt, es sofort zu verdächtigen und herabzuziehen.«
Mit dieser Erklärung: daß die Fürstin sich in einer Heilanstalt befinde, gab man sich allgemein zufrieden.
Christian fürchtete anfangs, Arlette möchte durch plötzliches Wiedererscheinen alles dementieren und wollte im Einverständnis mit seiner Mutter polizeiliche Nachforschungen anstellen lassen. Aber Madeleine und Madame de Guivre waren dagegen, in der Überzeugung, daß Arlette und Martine sicher jeden Skandal vermeiden und sich möglichst verborgen halten würden. Und die Zukunft gab ihnen recht.
Arlette hatte damals, als sie noch mitten in dem geselligen Leben ihres Kreises stand, manchmal das schmerzliche Gefühl gehabt: »Ich stehe ganz allein, kein Mensch kümmert sich um mich.« – Und das fand sie jetzt bestätigt, nachdem man sich, eine Zeitlang über ihr plötzliches Verschwinden unterhalten hatte, beschäftigte sich niemand mehr mit ihrem Schicksal. Sie hatte in »Made's Bande« nur eine Nebenrolle gespielt und wurde rasch vergessen. Ebenso bekümmerten sich weder ihr Vater noch ihre Mutter darum, was aus ihr geworden war. Es gab nur einen einzigen Menschen, der manchmal in Liebe und Besorgnis ihrer gedachte, aber ohne es jemals andern gegenüber zu erwähnen, und das war Jérôme de Péfaut. Es wäre wohl eigentlich an ihm gewesen, ihr nachzuforschen, aber er konnte sich nicht dazu entschließen. Nicht etwa, weil er die Mühe scheute, aber eine Art Schamgefühl hielt ihn davon ab, vielleicht auch, daß ihr Schweigen ihn gekränkt hatte. Sie bedurfte meiner nicht, sonst hätte sie mir wohl ein Wort gesagt, aber sie hat meine Hilfe nicht gewollt.« – So kam es auch, daß er nie von ihr sprach, obgleich er oft im stillen ihrer gedachte.
Christian zog sich fast ganz von der Gesellschaft zurück, solange wie er eine plötzliche Rückkehr Arlettens befürchtete. Sein einziger Zufluchtsort während dieser Zeit waren seine Mutter und seine Geliebte. Die alte Fürstin sah ihn jeden Tag nach Tisch oder gegen sechs Uhr nachmittags bei sich, und jedesmal hatte er mindestens eine Viertelstunde lang ihre Vorwürfe anzuhören, immer über dasselbe Thema: seine unmoralischen Beziehungen zu einer Frau, die nicht seine Gattin war, – ihr unkorrekter Lebenswandel und die Wahrscheinlichkeit, daß sie ihm übel mitspielte. Er hörte es ruhig und gleichgültig mit an, und es tat ihm wohl, aus alledem doch immer wieder ihre etwas rauhe Liebe herauszufühlen. Denn im Grunde fühlte er sich oft einsam und nicht so recht an seinem Platze als Sports- und Klubmann und als Liebhaber einer hyperzivilisierten Pariserin, die ihn im Grunde weit mehr quälte wie die Mutter mit allen ihren Vorhaltungen. Denn Madeleine zwang ihn in Dinge hinein, die seiner Natur ganz fern lagen, zwang ihn nachzudenken, auf alle möglichen Nuancen zu achten, Empfindungen zu analysieren, und seine eignen unter glatten Formen zu verbergen.
Und alles, was ihm an Scharfsinn fehlte, besaß Madeleine im höchsten Maße, sie wußte seine Gedanken bis ins kleinste hinein zu erraten. Er machte ihr gegenüber auch keinen Hehl daraus, daß die alte Fürstin sie haßte, sie der Untreue gegen ihn beschuldigte, ohne sich jemals auf Einzelheiten einzulassen. Sie sah auch, daß seine hypochondrische Eifersucht mit jedem Tage wuchs, und wußte ganz genau, auf wen sie sich bezog. Trotzdem wurde Rémis Name nie zwischen ihnen erwähnt. Aber Madeleine ahnte wohl, was für Gefahren hinter dieser Eifersucht lauerten, es gab ein Bild, das sie nicht loswerden konnte und das allmählich ihr Leben vergiftete: Christian, der sich auf Rémi stürzte und ihn mit brutaler Gewalt zermalmte. Gegen diese entsetzliche Möglichkeit gab es nur ein Mittel: Christian durch seine eigne Sinnlichkeit zu täuschen. Und zu diesem Mittel nahm sie denn auch ihre Zuflucht.
Nach Arlettens Flucht war er halb krank gewesen, und sie pflegte ihn. Und als er wieder genesen war, da gehörte sie ihm mit solcher Hingebung an, wie noch fast nie zuvor. Und wenn sie ihn dann in einem Zustande von seliger Trunkenheit entließ, brauchte sie nicht Komödie zu spielen, daß sie sich selber glücklich fühlte, denn sie wußte, jetzt konnte sie ein paar Stunden, manchmal auch Tage, des Zusammenseins mit Rémi genießen, ohne daß jene quälende Angst sich in ihre Umarmungen drängte.
Rémi war der einzige, der in diesem ganzen Drama seine Sorglosigkeit behielt. Die Gefahr schreckte ihn nicht, vielleicht glaubte er auch nicht an sie, er nahm das Leben überhaupt wie eine Art Theaterprobe, legte jedesmal das Kostüm an, das man von ihm verlangte, und übernahm jede Rolle, vorausgesetzt, daß sie ihn amüsierte. Er war von Natur unglaublich kühl und betrachtete die Liebe nur als angenehmen Zeitvertreib. Madeleine war ihm bisher der angenehmste, weil sie ihn am meisten liebte. Und gerade durch seine perverse Herzlosigkeit und fast feminine Niedertracht hatte er Madeleine – die bisher unzähmbare, zu zähmen gewußt.
Seine einzige wirkliche Leidenschaft, das einzige, was heftige Gemütsbewegungen in ihm auslösen konnte, war das Spiel. Dabei konnte er sogar gelegentlich seine gute Erziehung verleugnen. So war es einmal vorgekommen, daß er einen kürzlich im Klub eingeführten Fremden als Falschspieler entlarvte und, damit nicht genug, ihn an der Kehle packte und beinah in Stücke zerrissen hätte, wären nicht die Klubdiener noch rechtzeitig dazu gekommen.
*
Im Juni dieses Jahres hatte die Marquise d'Entragues den Einfall, auf dem See im Bois de Boulogne ein Fest zu geben. Für Made's Bande war es eine willkommene Gelegenheit, sich zu amüsieren. Apistrol erschien unter den Gästen mit seinem schönen Bart à la Henri IV., und die kleine Madame d'Ars war ebenfalls da. Sie machte den Eindruck einer hübschen blonden Eva, die mit allen Schlangen auf recht vertrautem Fuße stand. Jérôme kam im Boot mit seinen Nichten d'Avigre, Rosa in lichtgelbem, Marguerite in rosa Seidenmusselin, mit leichten Seidenmänteln darüber.
Es war ein feenhaft schöner Juniabend, selbst nachdem die Sonne untergegangen, war alles in wunderbare Klarheit gehüllt, und die Banalität des künstlichen Sees, der kleinen Insel mit ihren unschönen Gebäuden machte sich nicht so fühlbar. Jérôme, die letzte Nummer der Revista Medicale in der Rocktasche, stellte ironische Vergleiche mit Venedig an. Drüben am Ufer standen Rémi de Lasserade, Saraccioli, Apistrol, Madame d'Ars und der dicke Campardon. Sie begrüßten die Ankommenden, man schüttelte sich die Hände, stimmte überein, daß es ein wundervoller Abend sei und beobachtete dann ein Boot, das gerade auf die Gruppe zukam.
»Schau, schau,« sagte Madame d'Ars halblaut, »der Fürst und Made in demselben Boot zusammen.«
»Madeleine kann unmöglich in ein Boot steigen, ohne daß Christian sich ihr sofort nachstürzt,« bemerkte Campardon.
»Sie sind wirklich geistreich heut abend,« sagte Rémi de Lasserade so scharf, daß alle plötzlich schwiegen, während das Paar jetzt in ihrer Nähe landete.
Unter einer Art Schuppen war der Tisch gedeckt, die Damen legten ihre Mäntel ab, und man ließ sich nieder. Madeleine wußte wie immer Leben in die Gesellschaft zu bringen und die gute Laune wieder herzustellen, die Rémis Unliebenswürdigkeit etwas gestört hatte. Sie selbst war in heitrer Stimmung, denn es war ihr gelungen, Christians Zweifel wieder einmal völlig zu beruhigen, und dann hatte sie wieder eine Zeitlang Freiheit.
So hatte sie ihm schon vorher gesagt, daß Rémi neben ihr sitzen würde. »Du mußt ein wenig nett gegen den armen Kerl sein, er ist so nervös, ich glaube, er hat in letzter Zeit beim Jeu entsetzlich verloren.«
»Ja, gestern war ich dabei, wie er fünfzigtausend Franks verloren hat,« war Christians Antwort.
Und gleichzeitig wußte sie durch heimliche kleine Annäherungen, die der schlecht beleuchtete Platz möglich machte, Rémi zu erregen und in eine zufriedenere Stimmung zu versetzen. Gegen zehn Uhr erhob man sich wieder, in der Ferne, am obern Teil des Sees stiegen Raketen auf, um der Stadt Paris den Beginn des Festes zu verkünden.
»Muß man dorthin gehen?« fragte Apistrol.
»Der Herzog hat mir heute morgen gesagt, vor halb elf würde nichts Besonderes unternommen.«
»Dann gehen wir doch noch etwas ins Gehölz.« Auf schmalen Fußwegen, die sich durch das Gebüsch wanden, gelangte man ans andre Ende der Insel, Christian und Madeleine voran, dann Saraccioli, Rémi und Campardon.
»Besteht denn das immer noch fort?« fragte Saraccioli mit einem Blick auf das Paar, das vor ihnen herging.
Campardon wußte ebenso wie die übrige Bande, daß man vor Rémi nicht davon sprechen dürfe und suchte abzulenken.
»In Paris dauert alles lange – man ist hier sehr konservativ. Übrigens kann man es nie so wissen.«
»Pardon,« fuhr der Italiener hartnäckig fort, »ich saß bei Tisch neben der Gräfin, und ich verstehe mich auf dergleichen. Wir Italiener sind alle gute Beobachter.«
»Rémi,« unterbrach ihn Campardon, »du weißt doch, daß in Wirklichkeit die kleine Lievens vom Athenäum das ganze Fest veranstaltet hat. Der Herzog soll ganz toll in sie verliebt sein.«
»Laß Monsieur Saraccioli doch ausreden,« sagte Rémi ungeduldig, – »also es ist Ihnen aufgefallen – –«
»Mit eignen Augen hab ich's gesehen,« fuhr der Italiener geschmeichelt fort, – »als der Fürst ihr den Mantel umhängte, hab ich eine sehr kompromittierende Geste beobacht –«, er kam nicht ganz zu Ende, Campardon hatte ihn heftig in den Arm gezwickt und trat ihn zum Überfluß noch auf den Fuß. Gleichzeitig brüllte er mit Donnerstimme:
»Nicht so rasch, Made, ich kann kaum mehr schnaufen.«
Christian und Made wandten sich um, vom See her kam ein heller Schein, und die beiden standen da wie in vollem Tageslicht. Campardon bereute es sie angerufen zu haben, denn sie und Christian boten wirklich einen peinlichen Anblick – er hielt ihren Arm gewaltsam an sich gepreßt und auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck von Besitzerstolz, so daß Campardon Rémis stumme Wut vollkommen begriff. Aus Gutmütigkeit hielt er sich für verpflichtet zu sagen:
»Der gute Fürst sieht wirklich aus wie der geborne Ehemann.«
»Laß mich in Ruh,« erwiderte Rémi trocken. Dann sprach er kein Wort mehr und blickte nur finster vor sich hin. Im Gedränge des Festes, das die verschiedenartigsten Elemente der großen Stadt vereinigte, wurden sie für eine Zeit getrennt, fanden sich dann aber wieder zusammen. Angesichts der verschiedenen Frauen, denen er den Hof machen konnte, fand Rémi bald seine ganze Gewandtheit und ironische Heiterkeit wieder. Aber Madeleine vermochte trotz aller Anstrengungen ihre Unruhe nicht mehr zu beherrschen. Sie kannte diesen Blick bei Rémi, in dem etwas von wirklichem Haß schimmerte, kannte und fürchtete ihn. – Was mochte geschehen, wenn sie ihn nicht rechtzeitig wieder zu fesseln wußte?
Allmählich wurde Rémi auch wieder schweigsam; an eine Balustrade gelehnt, blickte er gleichgültig auf die antiken Tänze am Rande des erleuchteten Sees. Er war verstimmt, gereizt und hatte Lust, aller Welt unangenehme Dinge zu sagen. Die Hauptschuld an dieser Verstimmung trugen die bedeutenden Geldverluste der letzten Tage. Wo sollte er die fünfzigtausend Franks auftreiben, um seine Spielschulden zu decken? Und so kam es, daß ihm überhaupt alles in einem ungünstigen Licht erschien. Bisher hatte er sich über Christians Eifersucht eigentlich nur amüsiert. Ihm lag im Grunde nichts daran, Madeleine ganz allein für sich zu besitzen, und manchmal hatte er schon gedacht: eigentlich ist das das Ideal – eine Maitresse, die zum großen Teil anderweitig in Anspruch genommen ist. Aber heute sah er alles mit andern Augen an. »Im Grunde bin ich der Hahnrei,« dachte er, und Christian kam ihm weniger lächerlich wie sonst vor. Dagegen schien seine eigne Lage ihm etwas absurd, sich verstecken zu müssen wie ein Knabe, sich als Zofe verkleiden und den Augenblick abpassen, wo der offizielle Liebhaber verschwand. »Und warum kommt er immer in erster Linie? Er ist weder jung noch reich.« – Der Gedanke an Christians Brutalität hatte ihn nie erschreckt, und jetzt lag sogar ein gewisser Reiz für ihn darin.
Dann stieg der Wunsch in ihm auf, seine Feindseligkeit an den Tag zu legen und vor allen andern unliebenswürdig gegen Madeleine zu sein, sie unter ihrer Liebe leiden zu lassen.
Er trat auf die Gruppe zu, wo sie mit ihren Bekannten zusammensaß, spielte den Gutgelaunten und versuchte sie aus dem Kreise loszulösen, unter Christians Augen mit ihr allein zu sprechen. Sie fühlte die Gefahr und gab nach, denn sie baute auf Christians versöhnliche Stimmung. Er schien auch erst nicht weiter darauf zu achten, aber allmählich mußte auch ihm auffallen, was allen andern auffiel: daß Rémi mit einer gewissen zuversichtlichen Vertraulichkeit auf Madeleine einsprach und sie ihre Erregung kaum zu verbergen vermochte. Er redete halblaut, fast ohne die Lippen zu bewegen, wie jemand, der um jeden Preis angehört und verstanden sein will. Für Madeleine war es äußerst kompromittierend, sie machte in ihrer Verwirrung den Eindruck eines verliebten jungen Mädchens, das eine Liebeserklärung anhört. Es frappierte Christian ebenso wie die übrigen Zeugen der kleinen Szene. Hätten sie auch noch etwas von dem Gespräch der beiden Liebenden mit anhören können, so wäre kein Zweifel mehr geblieben.
»So laß mich doch jetzt – ich bitte dich.«
»Nein, ich lasse dich nicht. Das gewohnte Spiel ist mir heute zu langweilig. Ich möchte ihn einmal wieder eifersüchtig sehen.«
»Aber was kann dir das für Vergnügen machen? Du weißt, daß er seinen Zorn nur wieder an mir ausläßt, und daß es mich womöglich einmal das Leben kosten kann. – Höre, Mi – ich Hab dich so lieb – aber ich bitte dich, laß mich jetzt.«
»Ich lasse dich nicht los, ich will dich für mich allein. Ja, es ist wirklich wahr, ich bin jetzt auch eifersüchtig.«
»Ach, du denkst nicht an Eifersucht, du bist ein entzückender Kerl, aber es ist dir ganz egal, ob du mit noch jemand teilst. Also warum mich quälen?«
»Ich will dich für mich allein.«
»Mein Gott, wenn das doch wahr wäre –« sie sah ihn an, sein feingeschnittenes Pagengesicht, die Augen, in denen soviel zynische Neugier liegen konnte, und den Mund, der nur zum Küssen und zum Spotten geformt schien.
»Du – eifersüchtig! – Ach, das wäre so schön. Und dann wäre mir alles gleich, auch wenn man uns alle beide totschlüge. Wenn ich dich einmal in den Armen hätte; rasend vor Eifersucht – wie ihn, den ich nicht liebe. Aber du bist nicht eifersüchtig. Du bist nur heute abend schlechter Laune, und es macht dir Spaß, mich zu quälen. Aber jetzt geh, laß mich, sonst gibt es ein Unglück.«
In ihren Worten lag soviel ungestüme Aufrichtigkeit, daß er endlich nachgab und sich entfernte. Madeleine gesellte sich jetzt zu den kleinen Avigres und plauderte mit erzwungener Heiterkeit. Rémi verschwand, ohne sich von irgend jemanden zu verabschieden. Während das nächtliche Fest seinen Fortgang nahm, mit bengalischen Feuern, mit Musik und Tanz, saß Christian in finstere Gedanken versunken da und sagte kein Wort. Er war traurig, so namenlos traurig, wie er noch nie gewesen war, und es lag wie Bergeslasten auf seiner Seele. Jetzt konnte er nicht mehr zweifeln, daß sie ihn betrogen hatte. Und doch – wie sich den Beweis verschaffen? Sie waren zu schlau für ihn, alle beide, das wußte er wohl. »Aber ich bin der Stärkere,« dachte er, und ein blutdürftiges Leuchten funkelte in seinem Blick, während er Madeleine ansah.
All das Hin- und Herdenken erschöpfte ihn so, daß er kaum imstande war mit Madeleine zu sprechen, als sie schließlich kam und sich zu ihm setzte. Allmählich ging das Fest zu Ende, und die Menschenmenge verlief sich. Halb willenlos ließ er sich zu dem Wagen führen, und wie im Traum hörte er Madeleines Stimme. Sie hing an seinem Arm, als wollte sie ihm ihren Willen aufzwingen, ihn hindern, zu handeln. Er antwortete auch, wußte aber selber nicht, was er sagte. Wie von einer unerträglichen Last gelähmt, saß er während der Heimfahrt neben ihr, und die fixe Idee, die ihn seit Monaten verfolgte, nahm immer festere Gestalt an. Selbst Madeleines Zärtlichkeiten vermochten ihn jetzt nicht zu zerstreuen. Sie bemerkte es mit Schrecken, und als sie an ihrer Tür ankamen, schlug sie ihm vor, mit heraufzukommen, bei ihr zu bleiben. Zu jeder andern Zeit hätte eine solche Gunstbezeugung ihn mit glühendstem Dank erfüllt. Und sie wollte ihn heute um jeden Preis in ihrer Nähe behalten, verhüten, daß er seinen Gedanken überlassen blieb. Aber er entschuldigte sich mit übergroßer Ermüdung.
»Du willst nach Hause?« fragte sie.
»Ja, natürlich.«
»Dann gute Nacht. Telephoniere mich morgen an und laß mich hören, wie es dir geht.«
Nur halb beruhigt durch sein Versprechen, nach Hause zu gehen, stieg sie die Treppe hinauf. Und Christians Beklommenheit wuchs noch mehr von dem Moment an, wo er allein war. »Ich hätte sie fragen sollen. – Aber nein, sie schlug mir ja vor, zu bleiben – also kann sie niemanden erwarten. Oder sollten sie ein Signal haben!«
Es fiel ihm wieder ein, daß Rémi schon frühzeitig verschwunden war. »Ich werde im Klub nachsehen,« dachte er und ließ sich nach der Rue Royale fahren. Dort fragte er den Diener und erfuhr, daß der Vicomte de Lasserade im Spielsaal sei. Nun schickte er das Coupé fort und ging hinein. Ihm war förmlich erleichtert zumute, als er auf den ersten Blick Rémi an dem großen Bakkarattisch entdeckte.
Er spielte schon seit zwei Stunden, erst mit wechselndem Glück, dann fing er endlich an zu gewinnen.
Christian nahm zwischen zwei Spielern Platz und begann zu setzen. Rémi hatte ihn nicht gesehen, da eine Menge von Neugierigen um den Tisch herumstand und er völlig in das Spiel vertieft war. Aber dann fing er plötzlich wieder an zu verlieren, und nun blickte er zufällig auf und sah den Fürsten, der mit vollendeter Ruhe spielte und andauernd gewann. Und Christian war von einem Gefühl der Rache gegen ihn beseelt, er wußte, daß Rémi pekuniär schon fast zugrunde gerichtet war und wußte auch, was auf einen derartigen Zusammenbruch folgen kann, Demoralisation, ja Selbstmord. Und nun hatte er das Gefühl, selber etwas dazu beizutragen, indem er immer stärker gegen Rémi pointierte. Rémi war zu sehr Spieler, um das nicht herauszufühlen – so war ihnen beiden, als sei dieses Spiel ein erbitterter persönlicher Kampf. Als Rémi sich schließlich erhob mit dem quälenden Bewußtsein, noch achtzigtausend Franks Schulden mehr zu haben und dennoch den Kampf aufgeben zu müssen, da kam es ihm vor, als habe Christian ihn besiegt und zugrunde gerichtet.
Und nun spielte sich in diesem prunkvollen Saal mit seinen Marmorpilastern und seiner üppigen Vergoldung eines jener kurzen, mysteriösen Dramen ab, die um so erschütternder wirken, als sich niemand von den übrigen auch nur einen Moment dadurch in seinem Vergnügen stören läßt.
Christian hatte den Spieltisch fast unmittelbar nach Rémi verlassen, die kleine Gruppe von Bekannten, die sich um ihn versammelte, um noch ein paar Worte zu plaudern, zerstreute sich bald wieder, und alles kehrte zu den Tischen zurück.
Und nun schritten die beiden Männer durch den leeren Saal aufeinander zu, blieben stehen und schüttelten sich die Hand wie gewöhnlich, während sie sich gegenseitig mit brennenden Blicken maßen. Rémi war in diesem Augenblick wohl der zornigere von beiden, aber auch der minder brutale, er wartete darauf, daß der andre sich eine Blöße geben möge. – Und das geschah denn auch. Wie von einem inneren Zwange getrieben, aber mit einer Ungeschicklichkeit, die ihn selber überraschte, sagte Christian:
»Sie scheinen ja konsequent Unglück zu haben.«
»Und Sie haben das Glück, das Ihnen zukommt,« antwortete Rémi. Er war plötzlich sehr ruhig geworden, und während Christian erst allmählich die Beschimpfung, die darin lag, begriff, fuhr er fort: »Warum sollen wir also noch länger warten. Es verlangt uns beide danach, ich werde zwei meiner Freunde benachrichtigen und bitte Sie um das Gleiche, damit sie sich gleich morgen bereden können.«
Christian stand immer noch unbeweglich da, und nun fügte Rémi hinzu, um ihn wenigstens noch so empfindlich wie möglich zu treffen:
»Ich bin es Ihnen schuldig und eher zweimal wie einmal. – Das lastet schon seit lange auf mir.«
Dann sah der Fürst seine schlanke Gestalt sich absichtlich langsam entfernen. Wie ein Goliath, den der Stein aus der Schleuder des Knaben getroffen, sank er in einen der breiten Sessel, die vereinzelt im Saale umher standen. »Eher zweimal wie einmal – ja – damit meinte er Arlette und Madeleine – ah – ihn zu töten!« Er sah den Degen vor sich, mit dem er den Körper dieses Gegners durchbohren und ihm den Lebensnerv durchschneiden würde. – Und diese Vision beruhigte ihn allmählich. Als sich dann verschiedene Kameraden um ihn sammelten, war er wieder imstande, über gleichgültige Dinge mit ihnen zu plaudern. Die Spannung seiner Nerven löste sich allmählich, und während er sprach, weidete er sich immer wieder an dem Gedanken, wie das scharfe Eisen jenen weichen jugendlichen Körper durchbohren würde. Dann nahm er zwei seiner Freunde, den Marquis de Larens und Monsieur de Comtat beiseite, setzte ihnen auseinander, daß der Vicomte de Lasserade, durch seine Spielverluste gereizt, ihn beleidigt habe und verabredete, daß sie sich morgen zu Rémi begeben sollten, wo sie zwei von dessen Freunden treffen würden. Christian wünschte, daß die Angelegenheit so rasch wie möglich zum Austrag kommen möchte, vielleicht schon morgen nachmittag, wenn die Formalitäten am Morgen erledigt würden.
Am nächsten Mittag wußten die beiden Gegner, daß sie sich vier Stunden später, mit der Waffe in der Hand, gegenüberstehen würden. Als Rendezvous war ein Reitinstitut in Neuilly ausersehen, wo nur vornehme Duelle ausgefochten wurden. Rémi, den seine Geldangelegenheiten weit mehr beunruhigten wie das Duell, machte sich nach beendigter Unterhandlung im Klubfiaker auf den Weg, um die verschiedenen Wucherer aufzusuchen. Die Idee, Christian zu provozieren, kam ihm jetzt schon ziemlich töricht vor. Was war ihm nur eingefallen, plötzlich auf Madeleine eifersüchtig zu sein? »Aber mein Gott,« dachte er, »schließlich wird es mir Spaß machen, ihm eins auszuwischen.«
Der Fürst nahm die Sache bedeutend ernster. Seit das Renkontre entschieden war, hatte er nur noch zwei Gedanken: Madeleine war doch Rémis Geliebte, und binnen wenigen Stunden würde er vor ihm stehen, seiner Rache anheimfallen. Seit jenem knabenhaften Erlebnis seiner Schülerzeit hatte er nie ein Duell gehabt und kaum je den Fechtsaal besucht, aber er zweifelte keinen Augenblick, daß es anders als mit Rémis Tod endigen würde. Wenn er nur eine tödliche Waffe in der Hand hatte, alles übrige kam nicht in Betracht. Und der Gedanke an den ermordeten Gegner nahm seinen ganzen Zorn mit weg. War Rémi vom Schauplatz verschwunden, so konnte er die Beute, die er ihm streitig gemacht hatte, wieder an sich reißen, und was vergangen war, vergessen. Er wollte sie ausschließlich für sich, und dann würde er Ruhe haben. Je näher die Stunde des Duells heranrückte, um so ruhiger wurde er, fühlte sich beinah glücklich, wie jemand, der endlich der Sklaverei entrinnt und von nun an seine volle Freiheit genießen wird.
Eine Stunde, bevor der Wagen ihn abholte, suchte er seine Mutter auf. Charlotte Wilhelmine saß auf einem niedrigen Sessel, dem einzigen geschmacklos modernen Möbel zwischen der alten aristokratischen Einrichtung, die sie mit aus Deutschland herübergebracht hatte. Ihre lange, magere, etwas grobknochige Gestalt war ganz in schwarze Spitzen gehüllt. Gesicht und Hände, die daraus hervorragten, schienen wie aus Holz geschnitten und hatten etwas von den Gliedern einer überlebensgroßen Marionettenfigur. Dabei sah sie weder vornehm noch besonders intelligent aus.
Christian küßte ihr die Hand, und sie begrüßte ihn auf französisch. Dann sprachen sie deutsch zusammen. Von dem Duell ahnte sie selbstverständlich nichts, was sie grade heute beschäftigte, war die finanzielle Lage ihres Sohnes. Sie wollte gerne wissen, ob er Schulden habe und ob seine Ausgaben jetzt, wo Arlette nicht mehr da war, sich mit seinen Einnahmen deckten. Dann kam sie wieder auf das Thema Madeleine und ließ es nicht an Beschimpfungen und brutalen Ausdrücken fehlen. »Diese Hexe, diese schlechte Frau!« so und womöglich schlimmer bezeichnete sie Madame de Guivre.
Christian ließ sie reden, in seine respektvolle Haltung mischte sich heute beinah etwas wie Zärtlichkeit. Die Fürstin fühlte es und wurde gerührt. Als er Abschied nahm, küßte sie ihn auf die Stirn, und er ging ganz beruhigt fort, als sei der Sieg ihm jetzt noch gewisser wie vorher.
Draußen war heller Sonnenschein, während Rémi de Lasserade und Christian von Ermingen sich in dem Nebensaal des Reitinstituts umkleideten. Die Ärzte hatten ihre chirurgischen Werkzeuge ausgebreitet, dicht daneben standen die Zeugen, um die letzten Dispositionen zu treffen. Monsieur de Comtat, der in seinen Kreisen für eine Art Berufssekundanten galt, gab Christian noch einige Ratschläge von solcher Banalität und Selbstverständlichkeit, daß er sie sich ebensogut selber hätte geben können.
Aber Christian hörte kaum zu, während er ein weiches Hemd überwarf und seine Handschuhe anzog, war er etwa in derselben Gemütsverfassung wie ein Bauer, der mitten in der Nacht aufsteht und sein Gewehr vom Nagel nimmt, um einen Fuchs oder ein andres schädliches Tier zu töten. Er wußte das Wild, dem er nachstellte, in seinem Bereich. Da er nicht antwortete, nahm Comtat an, er sei mit ernsten Gedanken beschäftigt und sagte leise zum Marquis de Larens:
»Der Fürst scheint sehr düster gestimmt – und bei dem Mann sollte man doch nicht denken, daß er Furcht hat?«
Um die Lippen des Marquis spielte ein scharfes Lächeln:
»Nein. Er fürchtet sich nicht – aber ich, und zwar nicht um ihn. Es ist eine dumme Geschichte, und ich bedaure es, gestern abend in den Klub gekommen zu sein.«
Christian war inzwischen in den Gang getreten, wo Rémi in einem leichten, anschmiegenden Hemde stand und anscheinend gleichgültig mit seinen Sekundanten plauderte.
Bald darauf kreuzten sich die Degen, Rémi de Lasserade war der Geschmeidigere und suchte seinen Gegner in die Enge zu treiben, der sich kaum rührte und mit gespanntem Blick jeder Bewegung folgte, wie ein Jäger, der den geeigneten Augenblick zum Losdrücken erspäht. So verlief die erste Minute, bis Halt geboten wurde. Während der Pause verwandte Christian kein Auge von seinem Gegner, der wieder mit seinen Freunden sprach und Monsieurs d'Ars etwas an seinem Degen zeigte. Zufällig wandte Rémi sich um und begegnete Christians Blick. Und jetzt begriff er plötzlich, daß dieser Mann seinen Tod wollte. – In diesem flüchtigen Moment, den das Schicksal ihm noch gewährte, faßte er zum erstenmal die Möglichkeit des Todes ins Auge, und wie in einer jähen Vision zog sein Leben an ihm vorüber – so leer, so kurz und grade jetzt so voller Schwierigkeiten. »Bah,« dachte er, »was liegt denn daran! Ich habe eben kein Glück gehabt, und jetzt verschwört sich alles gegen mich.«
Wieder kreuzten sich die Klingen, trafen sich, verfingen sich ineinander. Rémi war nervös geworden und machte einen heftigen Ausfall, Christian parierte ihn und die Spitze seines Degens berührte Rémi leicht oberhalb der linken Brust. Er wich einen Augenblick zurück, und nun fuhr die Klinge des Fürsten ihm tief in die Brust und durchbohrte die Lunge.
Rémi sah durch das Fenster die roten Ziegelsteingebäude da draußen schwanken – auf sich zukommen, ihn erdrücken – dann kamen noch andre Sachen auf ihn zu – Arme, Gesichter, ein Rockaufschlag mit einer roten Rosette. – Langsam glitt der Boden unter ihm weg, er fühlte eine salzige Flüssigkeit im Munde, an der er fast erstickte, sah einen Kopf mit weißem Haar dicht über sich, auf den er wie hypnotisiert hinstarrte, – dann wurde es Nacht um ihn her, und er stöhnte dumpf.
Christian war mit in das Coupé des Doktors gestiegen. Sie fuhren im Sonnenschein durch das Bois, begegneten unzähligen andern Wagen, in denen manchmal zärtliche Pärchen saßen – Automobilen, Radfahrern und Fußgängern. Die beiden Männer redeten kein Wort, der Doktor spielte nervös mit der Quaste des Türgriffs, schnalzte von Zeit zu Zeit leise mit der Zunge und begann schließlich diskret zu gähnen.
Christian war vollkommen ruhig. Er hatte keinen andern Ausgang erwartet und war weder erstaunt noch bestürzt. Im Grunde fühlte er nur eine große Erleichterung, einmal, weil die schlummernde Brutalität seiner Natur sich endlich einen Ausweg gebahnt hatte, und dann glaubte er jetzt zum erstenmal und für immer Madeleines unumschränkter Herr und Gebieter zu sein.
Als das Coupé in die Champs Elysées einbog, wagte der Arzt endlich zu bemerken:
»Sie wissen, man wird versuchen, die Sache als Unglücksfall hinzustellen, aber trotzdem können Sie vielleicht heute schon vor den Untersuchungsrichter zitiert werden. Und darum war es am Ende besser, wenn Sie jetzt gleich beim Palais vorführen und mit dem ersten Staatsanwalt sprächen.«
»Heute habe ich keine Zeit mehr,« antwortete Christian ruhig.
Dann verabschiedete er sich von dem Arzt und nahm einen Fiaker, um in die Rue d'Offémont zu fahren.
Madeleine war eine halbe Stunde vorher nach Hause gekommen und in trostloser Stimmung, vorgestern hatten sie sich für heute nachmittag verabredet, Rémi hatte vergessen abzuschreiben und sie ihn stundenlang vergebens erwartet. Jetzt eben hatte sie ihre Zofe zu ihm geschickt, um sich zu erkundigen. Sie war noch nicht zurück, als Christian kam. Madeleine empfing ihn freundlich, denn sie hoffte von ihm etwas über Rémi zu erfahren und fragte gleich: »Wo kommst du her, mein Freund? Warst du bei der Gardenparty von St. Clairs?«
Aber schon hatte er sie in die Arme genommen und sah ihr so ernst, so bewegt in die Augen, daß sie ganz überrascht zu sprechen aufhörte, in dem Gefühl, daß irgend etwas Schwerwiegendes bevorstände. Dann stammelte sie, ohne den Mut zu haben, sich loszumachen: »Christian, was hast du?«
»Du bist mein,« sagte er nur.
Sie wußte nicht, konnte nicht wissen, warum er das grade jetzt sagte. – Er betrachtete sie in diesem Augenblick gewissermaßen wie eine Beute – alles andre war gleichgültig, denn jetzt konnte sie nur noch ihm angehören. Leidenschaftlicher wie je trachtete er danach, sie zu besitzen, und während er sonst ihren Launen zu gehorchen pflegte, sollte sie sich jetzt seinem Verlangen fügen, wie er es wollte.
Es lag bei ihm kein Cynismus darin, er liebte sie noch mehr wie sonst, liebte sie bis zum Wahnsinn, seit er seinen Rivalen erschlagen hatte und sicher war, sie nicht mehr mit ihm teilen zu müssen.
Madeleine begriff endlich, was er wollte, und ganz erfüllt von ihrer Sorge um Rémi, sträubte sie sich.
»Nein, nein, Christian – sei vernünftig. Ich bin so müde.«
Aber er achtete weder auf ihre Einwände, noch auf das Sträuben ihres Körpers, der sich ihm zu entwinden suchte. In zorniger Resignation ließ sie schließlich alles über sich ergehen, als plötzlich die laute Stimme ihrer Kammerjungfer ihr die Kraft gab, sich loszureißen.
»Madame, Madame,« rief das Mädchen laut und erschreckt.
Dabei kam sie in das Zimmer gestürzt, ohne die Verwirrung der beiden zu bemerken, die sich rasch erhoben hatten.
»Madame, Madame! Monsieur Rémi –« Als sie dann Christian sah, blieb sie bestürzt stehen und stammelte:
»Er ist – – im Duell – – jetzt eben –«
Und jetzt begriff Madeleine plötzlich alles. Sie stieß einen wahnsinnigen Schrei aus, bäumte sich empor und fuhr dem Fürsten mit ihren Nägeln ins Gesicht.
»Du hast ihn getötet – du!«
Dann taumelte sie halb von Sinnen gegen die Mauer und brach zusammen.
Christian wies dem Mädchen mit einem so drohenden Blick die Tür, daß sie entsetzt hinausfloh und vor Schrecken gegen den Türpfosten anrannte.
Dann lief er rasch zu Madeleine und hob sie auf. Als er sie berührte, schlug sie die Augen auf, Haß und Abscheu flammte in ihnen.
»Mörder!« stammelte sie, »Mörder.«
Christian suchte weder zu erklären noch sich zu entschuldigen, sondern fuhr trotz ihrer Empörung und ihres Widerstandes fort, sie gewaltsam an sich zu pressen.– – Sie schrie verzweifelt um Hilfe, aber ihre Dienerschaft bebte vor Christians Zorn, und niemand wagte herbeizueilen. So mußte sie alles über sich ergehen lassen.
Die Repräsentanten der Religion und Justiz taten ihr möglichstes, um die Duellaffäre niederzuschlagen, da es sich doch um den Träger eines einstmals berühmten Namens handelte. Madeleines Vetter, der Herzog von Langeois, verwendete sich für die Sache und erreichte auch, daß der Staatsanwalt kein Strafverfahren einleitete. Rémi wurde in das Haus des Herzogs gebracht, ohne daß jemand etwas von dem wahren Hergang wußte. Er lebte noch etwa vierundzwanzig Stunden in völlig bewußtlosem Zustande, also immerhin lange genug, daß man sein trauriges Ende einem Unfall zuschreiben und einen Priester holen konnte.
So stand nun auch einem kirchlichen Leichenbegängnis nichts im Wege, das in Notre Dame de Passy abgehalten wurde, einer kleinen unscheinbaren Kirche, zu deren Gemeinde die Familie Lasserade gehörte. Dasselbe klare Sonnenwetter wie an jenem Tage nach dem Fest leuchtete über Paris, unzählige Wagen folgten dem Leichenzuge, und wie immer in Paris, wenn es irgend etwas zu sehen gibt, waren Scharen von Müßiggängern herbeigekommen. Die Feier war auf elf Uhr angesagt, aber um zehn war die Kirche schon gedrängt voll. Die gesamte hohe Aristokratie von Paris war anwesend und zahlreiche Vertreter der Künstler-, Börsen-, Klub- und Lebewelt.
Man unterhielt sich im Flüstern über die wahre Ursache von Rémis Tod, die nicht einmal in die Zeitungen gedrungen war. – Made's Bande war auch erschienen, mit Ausnahme von Christian und Madeleine. Man wollte wissen, daß das Verhältnis der beiden nach diesem Drama noch unlösbarer fortbestände wie früher.
Ja, alles hatte sich hier versammelt, und hätte Rémi durch die blumengeschmückten Bretter seines Sarges hindurchblicken können, so wäre ihm die innere Hohlheit dieser ganzen Lebenssphäre wohl noch klarer zum Bewußtsein gekommen als in jenen letzten Augenblicken vor seinem Tode. Aber er sah nichts mehr von alledem, es war nichts mehr von ihm übriggeblieben als ein traurig verstümmelter Körper, in voller Jugendblüte dahingerafft, ohne das Leben anders kennen gelernt zu haben als von seiner nichtigsten Seite.
Aber unter allen den vornehmen Nichtstuern gab es doch wenigstens einen nachdenklichen Beobachter, und das war Jèrôme de Péfaut. Während der Bischof unter pomphaftem Gepränge die Totenmesse zelebrierte und vom Chor herab die Musik in herzzerreißenden Klagetönen niederschallte, saß er tief in Gedanken versunken da.
»Alle diese schönen Liturgien und Gebete,« dachte er, »die von der Auferstehung und von ewiger Ruhe in Gott reden – wer von allen diesen Leuten hier versteht das überhaupt oder glaubt daran? Er glaubte wohl kaum etwas davon zu seinen Lebzeiten – der jetzt starr und kalt dort im Sarge ruht. Und wer von allen den andern, die ihn heute zu Grabe tragen? Wie manches Mal habe ich die Besten unter ihnen danach gefragt – Männer und Frauen und alle waren unsicher, zögerten mit der Antwort. Sie machen das alles eben mit, ohne darüber nachzudenken, um Ruhe zu haben.«
Er betrachtete die beiden Schwestern Rose und Marguerite, die ganz in seiner Nähe saßen und mit anmutig geneigtem Haupt auf die gefalteten Hände niederblickten. Auch diese beiden wollten nur bis zu einem gewissen Punkt mit der Sprache heraus; und als er weiter in sie drang, wichen sie aus: »Lassen Sie uns in Ruhe, Jérôme, Sie bekehren uns doch nicht zu Ihrem Heidentume.«
Sein Heidentum! Er konnte sich selbst das Zeugnis ausstellen, daß er wirklich kein Heide war, – er, der seinen Moralprinzipien getreu sich jeden Genuß versagte und wie ein griechischer Weiser lebte. Waren die andern, alle diese Campardon, Apistrals und wie sie heißen mochten, etwa bessere Christen?
Während er über diese Dinge nachdachte, fiel sein Blick zufällig auf zwei Frauen, die etwas abseits im Schatten eines Beichtstuhls knieten. Beide waren in tiefer Trauer, die langen Kreppschleier verbargen ihre Gesichter, so daß man sie selbst bei Tageslicht nicht hätte erkennen können. Und diese beiden wenigstens plauderten nicht, wie die übrige Versammlung, lachten nicht und schienen die Kirche nicht als Salon, die Trauerfeier nicht als Theatervorstellung zu betrachten. Die kleinere von beiden hatte das Gesicht in beiden Händen verborgen und weinte heftig, die andre schien in tiefe Andacht versunken.
»Wer mögen die beiden sein?« fragte Jérôme sich, »und weshalb sind sie hier. Von den übrigen scheint niemand sie zu kennen. Sie gehören wohl auch kaum zur Gesellschaft, obgleich sie gut gekleidet sind. Wahrscheinlich sind es Modistinnen oder Schneiderinnen – nicht grade wohlhabend, aber sie sehen auch nicht aus, als ob es ihnen schlecht ginge. Die eine hat sehr viel Kummer, die andre ist nur aus Freundschaft und überhaupt aus Frömmigkeit mitgekommen. Ob es Schwestern sind?« Ihre Schleier waren so dicht, daß man nicht einmal die Haarfarbe erkennen konnte. – Die Weinende hatte sich jetzt etwas beruhigt und ihren Platz wieder eingenommen, nachdenklich saß sie da, die Hände zwischen den Knieen. Es fiel Jérôme auf, daß diese Hände sehr klein und zierlich waren.
Er versuchte sich ihre Lebensgeschichte auszumalen, »es sind sicher Schwestern, die eine hat vor kurzem ihren Mann oder ein Kind verloren, das hier bestattet worden ist, – heute morgen ist sie mit ihrer Schwester hergekommen, um zu beten, ohne zu wissen, daß hier eine andre Trauerfeier stattfindet. Das hat sie dann noch trüber gestimmt. – Aber sicher ist es doch ihr Gatte, den sie verloren hat, eine Mutter würde nur beim Anblick eines Kindersarges so weinen.«
Rose Duclerc, die gefeierte Sängerin von der Oper, stimmte jetzt mit ihrem wundervollen Alt das Pie Jesu an, die gleichgültige Menge erhob die Köpfe und hörte bewundernd zu, wie im Theater. Die beiden Schwestern in Trauer blieben in ihrer vorigen Stellung und schienen dem Gesang wenig Beachtung zu schenken.
Und Jérôme dachte weiter: Der Mann dieser kleinen Pariserin hat wahrscheinlich ein Glück gekannt, von dem alle diese Leute hier nichts ahnen – er ist nicht einsam gewesen, weder im Leben noch im Tode, und sein Andenken lebt in einem treuen Herzen fort. – Wir andern, die wir hier versammelt sind, leiden alle unter dem Gefühl einer entsetzlichen Einsamkeit, die wir selbst bei allen unsren Vergnügen und Festen nicht los werden. Sie läßt uns nicht los, verfolgt uns bis in den Tod. – Ich selbst, zum Beispiel, seit dem Tode meiner Mutter habe ich keinen Menschen mehr, der mir wirklich nahe steht und den ich lieben könnte. Es gab nur ein einziges zartes Wesen, für das ich wenigstens brüderliche Gefühle hegte, und auch das ist verschwunden.
Der Geistliche redete jetzt am Sarge des Verstorbenen, erteilte ihm die Absolution und betete für die Ruhe seiner Seele. Dann wurde der Sarg hinaus getragen, und die Trauerversammlung bewegte sich auf die Sakristei zu. Man hatte die Feier schon viel zu lang gefunden und atmete auf. Während der Zeremonie waren die beiden Geschlechter getrennt gewesen, setzt vereinigten sie sich wieder wie eine Herde lustiger Schulkinder. Madame d'Ars gesellte sich zu Apistral, der dicke Campardon plauderte in einer Ecke mit Rose Duclerc, die eben von der Tribüne herabgestiegen war, um die Huldigungen ihrer Bewunderer entgegenzunehmen.
Saraccioli legte seine Hand auf Jérômes Schulter:
»Eine schöne Feier,« sagte er, »und echt Pariserisch.«
»Aber der, dem sie gilt, hat nichts mehr davon, der Held des Tages zu sein,« erwiderte Jérôme.
»Sie kennen das Geheimnis?« fragte der Italiener.
»Ich weiß niemals Geheimnisse.«
»Dann sagen Sie es, bitte, nicht weiter, es ist wirklich tiefes Geheimnis. Der Vicomte Rémi ist nicht das Opfer eines Unfalls, sondern im Duell gefallen, das heißt, der Fürst von Ermingen hat ihn gewissermaßen im Duell ermordet, weil er ihn mit Madame de Guivres ertappt hatte.«
»Aber ich bitte Sie,« mischte sich die blonde Madame de St. Clair unaufgefordert in das Gespräch, »Saraccioli, erzählen Sie doch keine Romane. Rémi war mit Rose Duclerc liiert, das ist doch stadtbekannt.«
Durch die nachdrängende Menge wurde die kleine Gruppe voneinander getrennt.
Jérôme wußte natürlich um das Geheimnis, es war allgemein bekannt, alle Anwesenden sprachen im Flüsterton darüber, raunten es einander zu, einige bestritten, andre bestätigten es, man fühlte sich bei diesen Gesprächen von der wollüstigen Atmosphäre der gewohnten Liebesabenteuer und intimen Geheimnisse umgeben, während vom Chor herab der Grieg'sche Trauermarsch erklang.
Dann zerstreute die Versammlung sich allmählich, nachdem man zuvor noch der Familie des Verstorbenen kondolierend die Hand gedrückt hatte. Da war zuerst Rémis Onkel, der Herzog de Lasserade, ein schöner, distinguierter alter Herr. Er war sehr bewegt, denn Rémi war sein Lieblingsneffe gewesen. Neben ihm stand irgend ein Verwandter aus der Provinz, ein korpulenter, kahlköpfiger Mann von etwa fünfunddreißig Jahren, und die Brüder des Verschiedenen, Jean, der Dragonerleutnant, und Hubert, der Artilleriehauptmann. Der Zeremonienmeister hatte ihnen ihren Platz links neben der Sakristei angewiesen, alle nahmen eine möglichst ernste und traurige Miene an, während sie an ihnen vorbeikamen, um gleich darauf wieder in den gewohnten leichten, scherzenden Konversationston zu verfallen.
Jérôme wartete noch einen Augenblick auf die kleinen d'Avigres, hier und da kamen Bekannte vorbei, und man wechselte ein paar flüchtige Worte. Bruchstücke von Gesprächen drangen an sein Ohr, unter Plaudern und Lachen. Da war die Rede von einer Baudeville-Première, die morgen zum Abschluß der Saison stattfinden sollte, von Sport-Réunions und Seebädern. Wo von Rémi gesprochen wurde, erwähnte man sein tragisches Ende mit verständnisvollem Lächeln und allerhand pikanten Anspielungen. Der dicke Campardon sagte, während er mit Monsieur de Comtat in den Fiaker stieg:
»Weißt du, Alter, es ist doch schad um den Kleinen, daß er so früh abgeklappt ist. Er war so famos niederträchtig mit den Weibern, daß er uns andre mitgerächt hat.«
»Ja, ja,« dachte Jérôme, »das war wohl die treffendste und lakonischste Leichenrede, die man diesem unseligen jungen Menschen halten konnte.«
Dann wartete er nicht länger, sondern schlenderte langsam, aufs Geratewohl, durch die ziemlich menschenleeren Straßen von Passy weiter. Seine Gedanken waren immer noch mit dem Problem des menschlichen Schicksals beschäftigt, als an einer Straßenecke zwei schwarzgekleidete Frauen vor ihm auftauchten, sie gingen etwa dreißig Schritt vor ihm her in der Richtung nach Auteuil. Jérôme erkannte die beiden aus der Kirche von Passy und folgte ihnen, während er selbst innerlich über seine Neugier spottete.
An der Ecke der Rue Renouard schien die größere von beiden zu bemerken, daß ihnen jemand folgte, sie sah sich um, sagte ein paar Worte zu ihrer Gefährtin, dann verlangsamten sie ihre Schritte ein wenig.
»Sollte ich mich so gänzlich getäuscht haben?« dachte Jérôme, »am Ende sind es nur ein paar zweifelhafte Frauenzimmer, die darauf warten, daß man sie anspricht. Man behauptet ja, daß es hier in Paris Spezialistinnen dieses Berufes für Leichenbegängnisse gibt.«
Er ging jetzt selbst langsamer. Die beiden Frauen schienen darüber zu sprechen, daß sie verfolgt wurden. Die jüngere wandte sich flüchtig um, sie hatte den Schleier jetzt etwas zurückgeschlagen, so daß er einen Moment ihr Profil sehen konnte.
Jérôme fühlte eine heftige Bewegung: »Aber das ist doch nicht möglich,« murmelte er vor sich hin und blieb stehen, die beiden Frauen ebenfalls, als erwarteten sie, daß er näher käme. Und nun entschloß er sich plötzlich und ging auf sie zu. Als er dicht bei ihnen war, schlug die Kleinere von beiden den Schleier ganz zurück und sagte lächelnd:
»Also du bist's wirklich, und es freut mich so, dich zu sehen.«
Er nahm die Hand, die sie ihm darbot und war einen Augenblick nicht imstande, zu sprechen. In tiefer Bewegung vermochte er nur immer wieder diese ihm so wohlbekannten Züge in sich aufzunehmen, die ihm teurer waren, wie er sich selbst jemals eingestanden hatte. Und wie verändert schienen sie ihm, nicht minder schön wie früher, aber so ganz anders, älter geworden, vielleicht nur durch den tiefen Ernst, der jetzt über ihnen lag. Man sah wohl, daß sie viel gelitten hatte, der früher für Arlette so charakteristische kindliche Ausdruck war geschwunden, und man sah ihren Augen an, daß sie viel geweint hatte.
»Es freut mich so, dich zu sehen,« wiederholte sie, und dann etwas unruhig:
»Hast du uns gleich erkannt?«
»Nein, das war bei den dichten Schleiern unmöglich, aber ihr wart mir aufgefallen.«
»Sehen Sie, Arlette, das habe ich doch gleich gesagt,« warf jetzt Martine ein.
Sie hatte auch den Schleier zurückgeschlagen und nahm zärtlich Arlettens Arm, wie um sie zu beruhigen. Jérôme war sichtlich überrascht, daß sie Arlette so ohne weiteres beim Vornamen nannte.
»Aber wir wollen nicht hier stehen bleiben,« fuhr sie fort, »in diesen kleinen Nebenstraßen erregt man sofort Aufsehen.«
In einem gegenüberliegenden Hause lehnte auch wirklich schon ein Dienstmädchen neugierig am Fenster, und ein Mann in Hemdsärmeln erschien in der Tür, um die drei zu betrachten.
»Ja, gehen wir weiter,« sagte Arlette, Jérôme ging neben ihr her.
»Wie ist es dir denn gegangen in all der Zeit?« fragte er.
In Arlettens Augen leuchtete ein wenig von ihrer einstigen Heiterkeit auf, und lächelnd antwortete sie:
»Für mein jetziges Leben würde sich wohl kaum jemand aus meinem früheren Kreise interessieren. Ich wohne mit Martine zusammen, ganz hier in der Nähe. Komm doch mit uns, wenn du dich durch einen Besuch bei bescheidenen Modistinnen nicht zu kompromittieren fürchtest. »Ja, tun Sie das,« bat auch Martine, »ich bitte Sie, Monsieur de Péfaut. Es wird Arlette soviel Freude machen und ihr gut tun nach allen den traurigen Erinnerungen, die der heutige Morgen wieder aufgeweckt hat.«
Schweigend gingen sie weiter, Arlette zwischen den beiden andern. Es lag so unendlich viel zwischen dem Einst und Jetzt, daß es nicht leicht war, gleich einen Übergang zu finden. Aber sie waren alle froh, sich wiederzusehen; und jeder fühlte wohl, was der andre empfand. Bei Jérôme verbarg sich unter aller Freude eine tiefe innere Erregung. Er hätte vorher kaum geglaubt, daß es ihn so ergreifen würde, Arlette wiederzusehen, an ihrer Seite zu gehen. – »Und das Kind?« dachte er plötzlich, aber er wagte nicht danach zu fragen. »Sollte es gestorben sein, weil sie so tiefe Trauer trug? Oder diente der Schleier nur dazu, sie unkenntlich zu machen? Und wie mochte sie leben? Mit wem? – Nein, wenn sie mich bittet mitzukommen, muß ihr Leben einwandfrei sein, wenigstens für den Moment. – O du liebes Kind,« dachte er.
Martine zeigte auf ein kleines, einstöckiges Haus an der Rue de Bouviers, es lag in einem Garten, wo eine Menge Geranien und Astern blühten.
»Da wohnen wir,« sagte sie.
Als sie an die Gartentür kamen, lief ihnen ein kleiner Knabe entgegen, der zögernd stehen blieb, als er den Fremden sah.
»Komm nur, Pierre, du brauchst dich nicht zu fürchten.«
Er kam näher, küßte Martine zärtlich die Hände und begrüßte Monsieur de Péfaut ziemlich unbefangen.
»Das ist mein kleiner Sohn,« sagte Martine mit freudigem Stolz. Dann nahm sie Pierre an der Hand und ging mit ihm voran, die beiden andren folgten. Im Parterre lag das Atelier. »Unsre drei Arbeiterinnen sind grade frühstücken gegangen,« sagte Martine.
Das erste Stock enthielt drei Zimmer, in dem einen standen zwei Betten und eine Wiege, daneben in einem kleineren Raum war Pierres Schlafstätte aufgeschlagen. Alles war so einfach wie möglich eingerichtet, und doch lag ein Hauch von Behaglichkeit, ja beinahe von Eleganz darüber, der erraten ließ, daß die Bewohnerinnen aus einem andern Milieu stammten.
Arlette zeigte Jérôme das winzige Badezimmer, das neben ihrem Schlafgemach lag, und führte ihn dann in den Salon, der zugleich als Empfangsraum für die Kunden diente.
»Jetzt muß ich erst meiner Tochter guten Tag sagen,« sagte sie lächelnd und verschwand.
Jérôme blickte Martine fragend an.
»Ja, das Kind ist glücklich zur Welt gekommen,« sagte sie, »ein entzückendes Kind. Es gleicht seinem Vater, dem Vicomte Rémi, aufs Haar.«
»Und Arlette hat es hier bei sich?«
»Nun freilich, die Fürstin stillt es selbst,« erwiderte Martine.
Dann trat Arlette wieder ein, sie hatte Hut und Schleier abgelegt und erschien wieder viel jünger im Schmuck ihres blonden Haares. Auf dem Arm trug sie ein blondes, anscheinend kräftiges und gesundes Baby, das Jérôme genau so anzusehen schien wie alle andren Babys.
»Da ist es, Jérôme, findest du es nicht reizend?«
Er bewunderte es pflichtschuldigst als echter Junggeselle, der sich bemüht, möglichst viel Verständnis an den Tag zu legen. Dabei war ihm das Herz seltsam schwer, er wußte selber nicht warum. Dann dachte er daran, daß eben ihre Mutterschaft der beste Beweis für ein reines Leben war und wurde wieder froher gestimmt.
»Aber haben Sie schon gefrühstückt, Herr Graf?« fragte Martine plötzlich.
»Ja, gewiß, wenn ich morgens irgend einer öffentlichen Feier beiwohnen muß, sei es eine Hochzeit oder ein Begräbnis, pflege ich immer vorher ein englisches Frühstück einzunehmen.«
»Aber Sie erlauben wohl, daß wir dann in Ihrer Gesellschaft unsern Tee trinken und nehmen vielleicht auch noch eine Tasse.«
Jérôme bejahte dankend, ein blutjunges Dienstmädchen, das unwahrscheinlich klein aussah, trug das Baby hinaus, und Martine folgte ihr, um den Tee zu bereiten.
»Also Martine ist in deinem Dienst geblieben?« fragte Jérôme.
»In meinem Dienst? lieber Jérôme,« sagte Arlette lachend, »so etwas gibt es bei mir nicht mehr. Martine ist meine Freundin, sie hat mein Leben vor dem Schiffbruch gerettet, damals vor sechs Monaten – sie ist mir Freundin, Gefährtin, Schwester – wie soll ich dir das erklären?«
Jérôme betrachtete sie, während sie sprach; ihr Gesicht, das die schönen, rotgoldnen Haare umrahmten, war schmäler geworden und schien um ein paar Jahre älter, und doch sah es fast frischer aus wie früher, jede Nervosität und Gespanntheit war daraus verschwunden. »Sie ist nur noch reizender geworden,« dachte er bei sich.
»Du bist sehr tapfer gewesen,« sagte er dann.
»Tapfer? o nein, – anfangs ließ ich mich nur von Martine leiten und führen, wie ein armes, verwundetes Tier, dessen ein Vorübergehender sich annimmt. Ich war ganz aufgelöst vor Schrecken. – Mein Mann hat mich mit derartiger Brutalität aus dem Hause gejagt –«
»Aus dem Hause gejagt, tatsächlich?«
»Weißt du das nicht?«
»Kein Mensch weiß davon. Man hat nur erfahren, daß ihr euch getrennt habt. Offiziell wurde angegeben, du wärst in einer deutschen Nervenanstalt.«
»So? – um so besser. Damit sind ja alle weiteren Kommentare abgeschnitten. Mir wäre es am liebsten, wenn es hieße, ich wäre tot. Die Fürstin von Ermingen ist auch wirklich tot.– –
Aber ich will dir erzählen, wie es sich in Wirklichkeit abgespielt hat. Nach dem Geständnis, zu dem du mir rietest – und ich danke dir heute noch dafür – hat Christian mich aus dem Hause gejagt, er ließ mich halb ohnmächtig an der Treppe liegen, bis Martine kam und mich aufhob. Sie brachte mich dann nach St. Cloud, wo ihr Kind bei einer alten Frau in Kost war.«
»Und du hast mich nicht benachrichtigt, nicht einmal daran gedacht?« sagte Jérôme leise.
»O doch, ich habe wohl an dich gedacht, und ich hatte volles Zutrauen zu dir. Wir haben oft von dir gesprochen. Aber ich hatte so entsetzliche Angst davor, wiederaufgefunden zu werden, daß ich nicht das geringste zu unternehmen wagte. Diese Furcht hat sich erst nach und nach gelegt – wenn ich dir heute nicht begegnet wäre, hätte ich dir sicher in der nächsten Zeit geschrieben.«
Jérôme gab keine Antwort, eine tiefe Melancholie war über ihn gekommen, ohne daß er sich zu erklären wußte, weshalb. Im Grunde kränkte es ihn, daß sie auch ohne seine Hilfe fertig geworden war.
In ernstem Ton fuhr Arlette fort, und ihre Augen wurden feucht, während sie sprach: »Ich konnte es nicht lassen, heute morgen hinzugehen. O, ich weiß sehr gut, daß er mich längst vergessen hatte, und daß ich nie etwas andres für ihn gewesen bin als ein flüchtiger Zeitvertreib. – Für mich selbst ist jene Erinnerung nur noch ein Rätsel: wie habe ich jemals so handeln können? – Und doch bin ich mehr sein Weib gewesen wie das meines Mannes. Mein ganzes jetziges Leben verdanke ich ihm. – Ist es wirklich wahr, daß er mit dem Pferde gestürzt ist?«
»Nein, der Fürst von Ermingen hat ihn im Duell getötet.«
»Wegen Madeleine?«
Jérôme nickte.
»Mein Gott, was für ein schreckliches Ende!«
Sie hielt die Hand vor die Augen, wie um sich vor diesen Gedanken zu retten.
Martine kam mit einem Tablett, und beide fühlten sich durch diese Unterbrechung erleichtert. Hinter seiner Mutter erschien der kleine Pierre und trug vorsichtig ein Kupfergefäß mit heißem Wasser. Jérôme rief ihn zu sich und sprach mit ihm, während Arlette und Martine auf einem kleinen Tische das Frühstück herrichteten.
»Komm her und plaudere etwas mit mir, wenn du magst.«
»Aber gewiß.«
»Lernst du auch schon, kleiner Freund?«
»Gehst du in die Schule?«
»Nein, ich lerne bei Mama.«
»Und was lernst du denn?«
»Alles, was man im Gymnasium lernt, auch Latein und Griechisch. Mama kann alles.«
»Bitte, glauben Sie das nicht, Herr Graf,« wandte Martine ein, – »vor allem mit dem Griechisch. Aber ich lerne es mit ihm.«
»Also in die Schule gehst du nicht?«
»Nein, aber ich lerne auch bei dem Schlosser nebenan, bei Pigoret, und das macht mir viel Spaß.«
»Martine ist darin ein Genie,« bemerkte Arlette, »sie gibt dem Kleinen dieselbe Bildung wie reiche Leute ihren Kindern, und daneben läßt sie ihn ein nützliches Handwerk lernen.«
»Herr Graf, darf ich bitten,« schnitt Martine das Gespräch ab und reichte ihm eine Tasse Tee. »Pierre, biete dem Herrn ein Butterbrod an.«
Sie war ihrer Rolle durchaus gewachsen und wußte sich zu benehmen wie eine Dame der ersten Gesellschaft, ohne irgendwie gezwungen oder affektiert zu erscheinen.
Während des Frühstücks sprachen sie weiter über Erziehung.
»Ich fange hier auch allmählich an, die Lücken in meiner Bildung etwas auszufüllen,« sagte Arlette, »das verdanke ich Pierre und seiner Mutter. Man hat mich darin früher sehr vernachlässigt.«
Pierre stand am Fenster und sah hinaus.
»Da kommt Martha, und Juliette läuft hinterher.«
»Ah, unsre Arbeiterinnen,« sagte Martine, »ich bitte mich zu entschuldigen, ich muß ihnen jetzt ihre Arbeit zuteilen. Komm mit, Pierre.«
Arlette und Jérôme waren wieder allein. Die Nachmittagssonne schien durch das Fenster herein. Arlette sah, daß das Licht Jérôme blendete, und stand auf, um die Vorhänge herunterzulassen. Unten hörte man eine Nähmaschine rasseln, draußen auf der Straße rollte von Zeit zu Zeit ein Wagen vorbei. Sonst war alles still.
Arlette setzte sich wieder ihrem Vetter gegenüber. Das, was ihn am tiefsten bewegte, konnte er nicht aussprechen, und so fragte er, um irgend etwas zu sagen:
»Könnt ihr denn von eurer Arbeit leben?«
»Ich weiß nicht, ob es dazu reichen würde,« sagte Arlette, »wenn ich nicht noch andre Hilfsquellen hätte. Aber du erinnerst dich vielleicht, daß ich von einer Erbschaft her eine kleine Rente von 2500 Franks besaß. Nach meiner Flucht hatte ich solche Angst, Christian könnte mich wieder holen lassen, daß ich nicht einmal wagte, Martine auf die Bank zu schicken. Aber als das Kind geboren war, fühlte ich, daß meine Pflicht es von mir verlangte. Und Martine hat die Coupons auch ohne weiteres ausgehändigt bekommen.
Aber, wenn es möglich wäre, möchte ich die Papiere verkaufen, weil sie auf den Namen Fürstin von Ermingen lauten.«
»Wenn es dir recht ist, werde ich mich damit befassen,« sagte Jérôme, heimlich erfreut über die Gelegenheit, Arlette helfen und sie gelegentlich wiedersehen zu können.
»Im übrigen kannst du ganz ruhig sein, man denkt nicht daran, nach dir zu suchen.«
Beide schwiegen, es kam Jérôme plötzlich zum Bewußtsein, daß sie hier saßen und um über alltägliche Dinge sprachen, während doch weit ernstere Dinge sie innerlich beschäftigten. Und nun fragte er:
»Sag mir, Arlette, bist du jetzt wirklich glücklich?«
Nach einer Pause antwortete sie:
»Ich bin damals – es ist noch kein Jahr her, so entsetzlich unglücklich gewesen, daß mir zumute ist wie einer Genesenden, seitdem das alles hinter mir liegt. Ich war schon so weit, daß ich den Tod nur als Erlösung betrachtet hatte; jetzt habe ich das Leben auf mich genommen, wie es ist, und glaube mir, ich fühle mich sehr wohl dabei.«
»Das ist Ruhe,« sagte Jérôme, »aber noch kein Glück.«
»Ich möchte es dir noch besser erklären,« antwortete sie, »dieses Gefühl von Ruhe, von überstandenen Qualen ist für jetzt wohl das vorherrschende in mir. Aber es ist doch nicht alles. Martinens Freundschaft bedeutet ein Glück für mich, die Geburt meines Kindes hat mir unendliche Freude gebracht. Diese drei, mein Kind, Martine und Pierre, sind meine Welt, die mir genügt, in der ich nie jenes entsetzliche Gefühl von Einsamkeit habe, unter dem ich früher litt. Das alles ist noch besser, noch mehr als die Ruhe, von der ich vorhin sprach.«
»Wie ich das verstehe,« sagte Jérôme, und das Herz schnürte sich ihm zusammen: »ich bin ganz allein« dachte er, und dann fragte er: »Und das ist alles?«
»Das übrige ist etwas schwerer zu sagen,« fuhr Arlette mit einem reizenden, verlegenen Lächeln fort. »Du hast ja damals alles mit durchgemacht, hast mir den besten Rat gegeben, für den ich dir zeitlebens danken werde – den Rat, immer die Wahrheit zu sagen. – Das hat mich gerettet, mir die Freiheit gegeben, die ich brauchte, um mein Leben von neuem zu beginnen. Alles in allem, ich bin glücklich in meinem jetzigen Leben – ich bin weit davon entfernt, mir heroisch vorzukommen; aber ich fühle, daß ich besser geworden bin.
»Ja, ich verstehe – du hast nach und nach ein moralisches Gesetz in dir entdeckt, hast dich ihm unterworfen, und dieses Gefühl gibt dir Glück und Halt.«
»Ich weiß nicht, ob ich dich ganz richtig verstehe,« erwiderte Arlette – »aber ich vermag mir selbst wohl Rechenschaft abzulegen, von dem, was in mir vorgegangen ist. Kein Mensch hat mich je etwas andres gelehrt, als daß man bei seinen Leidenschaften nur ben äußeren Schein zu wahren habe. Und so habe ich ins Blaue hineingelebt, ohne mich dabei glücklich zu fühlen, bis ich völlig gedankenlos eine schwerwiegende Handlung beging und die Konsequenzen über mich hereinbrachen.«
Sie schwieg, anscheinend in Erinnerungen versunken. Jérôme betrachtete ihr ruhig heiteres Gesicht, dann fuhr sie nach einer Weile fort:
»Damals begann ich zu leiden, aber wie ein Tier leidet, in dumpfer Auflehnung gegen den Schmerz. Es mußte erst vieles dazu kommen, bis ich begriff, daß dies Leiden eine Schuld war, die ich bezahlen mußte, daß es nicht über mich gekommen wäre, wenn ich nicht gefehlt hätte. – Aber damit war mir das Gefühl für Recht und Unrecht noch nicht aufgegangen. Ich sagte mir nur: ich habe eine Dummheit begangen und sann darüber nach, wie ich die Folgen dieser Dummheit von mir abwälzen könnte.
Dann sah ich, daß alle mich entgelten ließen, was ich getan hatte. Zum Beispiel versuchte ich mich meinem Mann wieder zu nähern, und er hat mich so grausam gedemütigt, daß ich mich zum erstenmal auf meine Menschenwürde besann. – Später waren es vor allen zwei Dinge, die zu meiner Umwandlung beitrugen, der Gedanke, daß Christian mich töten könnte, und das Gefühl, daß ein zweites Wesen in mir lebte, das Anforderungen an mich geltend machte. Und als ich an das Kind dachte, fühlte ich mich zum erstenmal schuldig. Christian hatte mir gegenüber von jeher unrecht gehandelt, aber dies kleine Wesen war völlig auf mich angewiesen.«
»Liebe Arlette,« sagte Jérôme, gerührt von der ernsten Anmut, mit der sie über sich selbst sprach.
»Und so,« fuhr sie fort, »ging mir endlich das Gefühl der Verantwortlichkeit auf, ich betrachtete mein bisheriges Leben in einem neuen Licht und erschrak darüber, wie es sich mir jetzt darstellte. Als ich damals zu dir kam, hatte ich den rechten Weg zur Sühne noch nicht gefunden, du hast ihn mich gelehrt: die Wahrheit sagen, mag es kosten, was es wolle.«
»Wie hatte ich nur den Mut, dir diesen Rat zu geben?« murmelte Jérôme.
Es war ganz still im Zimmer, unten im Hause hatte auch die Nähmaschine zu rasseln aufgehört, aber man hörte eine frische Mädchenstimme irgend eine Romanze singen. Der warme Duft der Sommerblumen drang durch das offene Fenster herein.
Jérôme war traurig geworden, er sah Arlette an und dachte, daß sie noch nie so reizend gewesen wäre, und daß er es nicht ertragen würde, sie wieder aus seinem Leben verschwinden zu sehen.
Dann fragte er:
»Und was wirst du dem Kind sagen, wenn es groß ist?«
»Das fragst du mich?« antwortete sie lächelnd. »Die volle Wahrheit werde ich ihr sagen. Sie soll mein Herz ganz kennen und mich danach beurteilen. Glaube mir, ich habe die triumphierende Macht der Wahrheit kennen gelernt.«
Er lauschte einen Augenblick auf den Gesang der jungen Mädchen unten, dann fragte er:
Und Martine ist immer noch sehr fromm?«
»Ja, mehr als je.«
»Hat sie dich noch nicht bekehrt?«
»Sie selbst ist so vollkommen, daß sie mir dadurch ihre Religion liebenswert gemacht hat. Ich gehe manchmal mit ihr in die Kirche, es gibt hier draußen Kirchen, die mir so vorkommen, als wären sie eigens für solche Ausgestoßene, wie wir beiden es sind, gebaut. Ich weiß mir keinen lieberen Zufluchtsort, ich verstehe es noch nicht zu beten, aber mir wird dort so still und friedlich zu Mut.«
»Du wirst noch dahin kommen, selbst zu beten; das ist wie eine Ansteckung, der niemand zu wiederstehen vermag.«
»Wohl möglich,« antwortete Arlette.
Wieder entstand eine Pause, und wiederum blickte er sie lange an. Er fühlte, sie war das einzige Wesen auf der Welt, für das er eine tiefe Zärtlichkeit empfand.
Die Tür ging auf, und die kleine Magd brachte das Kind herein. Es schien ein wenig unruhig, und sein lebhaftes Gezwitscher klang, als ob es demnächst in Geschrei übergehen möchte.
»Sie hat Hunger und verlangt ihre Mahlzeit,« sagte Arlette.
»So, dann will ich dich verlassen,« sagte Jérôme etwas verlegen und stand auf.
»Aber du störst mich nicht im mindesten, ich möchte nur rasch ein andres Kleid anziehen, das mir zum Stillen bequemer ist.«
»Nein, ich muß sowieso gehen,« sagte er.
»So, dann begleite ich dich noch durch den Garten, die Kleine wird sich schon so lange gedulden.«
*
Als sie an dem Atelier vorbeikamen, trat Martine heraus, um sich von Jérôme zu verabschieden. Mit der einen Hand raffte sie ihre Schürze zusammen, die voller Blumen und Tüll war.
»Sie kommen doch hoffentlich einmal wieder, Herr Graf. Arlette wird sich so darüber freuen. Und wenn sonst irgend etwas vorfällt, was sie angeht, so benachrichtigen Sie uns bitte.«
»Ja, gewiß, darüber dürfen Sie beruhigt sein.«
Damit schüttelten sie sich die Hand, Arlette war schon im Garten, sie hatte eine schlichte, kleine Rose abgepflückt und reichte sie Jérôme.
»Zum Andenken an unser Haus.«
Die Sonne blendete so, daß er die Hand vor die Augen hielt, und Arlette sah, wie sie zitterte. Er war kaum imstande, die Blume in seinem Knopfloch zu befestigen. Schweigend gingen sie bis zur Gartentür. Jérôme versuchte nicht mehr seine Erregung zu beherrschen, sie verstanden sich gegenseitig besser, als wenn sie ihre Gedanken in Worten ausgesprochen hätten.
Zuletzt sagte Arlette, obgleich ihre Worte mit allen ihren vorhergehenden Gesprächen in keinem Zusammenhang zu stehen schienen:
»So wie mein Leben sich jetzt gestaltet hat, Jérôme, ist für nichts andres mehr Platz darin, als für die Liebe zu meinem Kinde. So wie ich es jetzt an meiner Brust nähre, so möchte ich auch späterhin mein ganzes Leben mit dem seinen verschmelzen.«
Er nickte mit dem Kopf, als wollte er sagen, »ja, das weiß ich wohl,« und dann fragte er:
»Aber darf ich trotzdem wiederkommen?«
Als ob er keine Antwort auf diese Frage erwarte, hatte er schon bei den letzten Worten die Gartentür geöffnet und war hinausgetreten. Aber als er ihr dann zum Abschied noch einmal die Hand reichte, sah sie ihn mit einem beinah traurigen Blick an und sagte:
»Ja, komm wieder, wenn du willst.«