
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

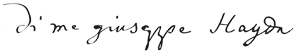
(1732–53)
»Sieh, mein lieber Hummel, das Haus, wo der Haydn geboren wurde, eine schlechte Bauernhütte, wo ein so großer Mann geboren wurde!« dieses Wort sprach 1827 auf seinem Todesbette über den Schöpfer der Symphonie und des Quartetts derjenige, der beiden die schönste Krone aufsetzen sollte, Beethoven.
Es war in dem Marktflecken Rohrau bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich, also hart an der ungarischen Grenze, wo am 31. März 1732 Joseph Haydn das Licht der Welt erblickte. Der kleine Ort gehörte den Grafen Harrach, die denn auch in den 1790er Jahren dem von seinen Londoner Triumphen heimkehrenden Meister in ihrem Park ein Denkmal errichtet haben.
Haydn's Vater war Wagner. Das Geschäft bestand seit langem in der Familie. Er selbst war nach Handwerksbrauch gewandert und soll dabei bis Frankfurt am Main gekommen sein. Seine Ehe war mit zwölf Kindern gesegnet, von denen jedoch nur die Hälfte am Leben blieb. Diese wurden in ihrer katholischen Confession zur Gottesfurcht erzogen und weil sie arm waren, auch zu Sparen und Fleiß angehalten. »Meine Eltern haben mich schon in der zartesten Jugend mit Strenge an Reinlichkeit und Ordnung gewöhnt, diese beiden Dinge sind mir zur zweiten Natur geworden,« sagte Haydn im Alter selbst. Die Mutter war aufs zärtlichste für sein Wohl besorgt, und wenigstens der Vater erlebte auch noch den Lohn solcher braven Erziehung, Haydns Anstellung als Kapellmeister. Die Art, wie dieser viele Jahre später in seinem Testamente auch des Grabes der Mutter gedenkt, bezeugt, daß sie ihm dereinst viel gewesen war.
Der Vater war ein »von Natur aus großer Liebhaber der Musik« mit einem leidlichen Tenor und hatte »ohne eine Note zu kennen« auf der Wanderschaft die Harfe klimpern gelernt. Abends nach der Arbeit sangen sie miteinander, und voll Rührung gedachte noch der Greis dieser musikalischen Jugendergötzung. Er selbst, der kleine »Sepperl«, hatte dabei durch feines Gehör und eine gute Stimme überrascht, ja er sang dem Vater schon bald »alle seine simpeln kurzen Stücke ordentlich nach.« Ebenso ahmte er mit einem kleinen Stecken das Geigenspiel nach, und ein Verwandter aus der Nähe beobachtete bei solcher Gelegenheit das sichere Ton- und Taktgefühl des fünfjährigen Knaben. Dieser Verwandte, welcher Schulmeister und Chorregent in dem nahen Städtchen Hainburg war, nahm ihn, der eigentlich dem geistlichen Stande bestimmt war, dann auch eines Tages mit sich dorthin, um ihn eine Kunst erlernen zu lassen, die ihm die Erreichung jenes Zieles unfehlbar eröffnen werde. Haydn kam seitdem nicht anders als zum Besuche in die Heimat zurück. Aber daß er ihrer und seiner meist unbemittelten Verwandten zeitlebens in Liebe und Achtung gedachte, sagt sein Wort aus alten Tagen: »Ich lebe weniger für mich, als für meine armen Verwandten, denen ich nach meinem Tode etwas zu hinterlassen wünsche.« Er schämte sich seiner niedrigen Herkunft so wenig, daß er vielmehr selbst oft davon sprach, sagen die Biographischen Notizen über ihn. Ebenso gedachte er aber im Testamente des Pfarrers und Schullehrers wie der armen Kinder seines bescheidenen Geburtsortes. Und 1795, als er selbst bei der Einweihung jenes Harrachschen Denkmals dort wieder anwesend war, war er in der väterlichen Wohnstube niedergekniet, hatte die Schwelle geküßt und zugleich selbst auf die Ofenbank hingewiesen, wo er einst die kleinen Spielkünste geübt hatte, die der Anlaß seiner großen Künstlerlaufbahn wurden. »Junge Leute werden an meinem Beispiele sehen können, daß aus dem Nichts doch Etwas werden kann: was ich bin, ist alles ein Werk der dringendsten Noth,« sagte er bei Erinnerung dieser allerdings sehr geringen Anfänge.
Die »musikalischen Anfangsgründe sammt anderen jugendlichen Nothwendigkeiten« erlernte nun in der alten Heunenburg Haydn bei jenem »Herrn Vetter« Matthias Frankh. »Gott der Allmächtige, welchem ich allein so unermessene Gnade zu danken habe, gab mir besonders in der Musik so viel Leichtigkeit, indem ich schon in meinem 6. Jahre ganz dreist einige Messen auf dem Chor herabsang und auch etwas auf dem Clavier und Violin spielte«, sagt er selbst um 1776 in einer autobiographischen Skizze, die sich in den »Musikerbriefen« (2. Aufl. Leipzig 1873) befindet. Aber er lernte zugleich dort sämmtliche üblichen Instrumente kennen und die meisten selbst spielen. »Ich danke es diesem Manne noch im Grabe, daß er mich zu so vielerlei angehalten hat, wenn ich gleich dabei mehr Prügel als zu essen bekam,« lautet hierüber sein späteres humoristisches Bekenntniß. Leider entsprach dieser letzteren Anklage auch die übrige Behandlung im Hause seines Herrn Vetters. »Ich mußte mit Schmerzen wahrnehmen, daß die Unreinlichkeit den Meister spielte, und ob ich mir gleich auf meine kleine Person viel einbildete, so konnte ich doch nicht verhindern, daß nicht dann und wann die Spuren der Unsauberkeit sichtbar wurden, die mich auf das empfindlichste beschämten, ich war ein kleiner Igel,« sagt er wieder selbst. Er trug schon damals »der Reinlichkeit wegen« eine Perrücke, ohne welche man allerdings den »Papa Haydn« sich nicht wohl zu denken vermag.
Von der Art der musikalischen Unterrichtung in Hainburg hören wir auch wenigstens einen Zug. Es war eben in der Charwoche, in welcher viele Processionen abgehalten werden. Frankh war durch den Tod seines Paukenschlägers in große Verlegenheit gesetzt. Er warf also sein Auge auf den kleinen Sepperl, dieser sollte in der Eile Pauken schlagen lernen. Er zeigte ihm die Handgriffe und ließ ihn dann allein. Der Knabe nahm einen Korb, wie ihn die Bauern zum Mehl beim Brodbacken gebrauchen, überspannte denselben mit einem Tuche, stellte ihn auf einen mit Zeug überzogenen Stuhl und paukte nun mit so viel Begeisterung darauf los, daß er gar nicht merkte, wie das Mehl aus dem Körbchen staubte und den Stuhl verdarb. Er bekam wol einen Verweis, allein sein Lehrer war rasch besänftigt, als er mit Staunen bemerkte, daß Joseph so geschwind ein fertiger Paukenschläger geworden war. Da nun aber Sepperl noch sehr klein von Gestalt war, konnte er den bisherigen Paukenträger nicht erreichen und man mußte ihm einen kleineren Menschen geben, der jedoch zum Unglück bucklig war, wodurch selbst in der Procession Lachen erregt ward. Allein Haydn gewann so auch von diesem Instrumente genaue praktische Kenntniß, und bekanntlich spielt der Paukenschlag in seinen Symphonien seine besondere Rolle: Haydn ist der erste, der das Instrument nach seiner vollen Individualität und zu freien künstlerischen Zwecken in der Instrumentalmusik verwendet. Er ließ sich denn auch gern in dieser Kunst loben und gab, wie wir sehen werden, später noch in London dem Paukenschläger Nachhilfe in ihrer Verwendung.
Dieser erste praktische Erfolg aber bestärkte den Schulmeister selbst darin, daß im Grunde Musik Haydns zukünftige Berufsbeschäftigung sei. Sein »gelehriger Fleiß« wurde denn auch bald allgemein belobt und seine angenehme Stimme blieb zudem die beste persönliche Empfehlung. So kam es, daß er bereits nach zwei Jahren in große und man darf sagen, größte musikalische Verhältnisse kam, nach Wien.
Der Stadtpfarrer stand mit dem k. k. Hofcapellmeister Reutter in enger Freundschaft, sie waren Gevattern. Es mußte sich fügen, daß Reutter in Geschäften von Wien durch Hainburg reiste und bei dem Stadtpfarrer auf kurze Zeit abgestiegen war, bei welcher Gelegenheit er auch von dem Zweck seiner Reise sprach, daß er nämlich Knaben suche, welche schöne Stimme und Fähigkeit genug besäßen, um Chordienste thun zu können. Der Pfarrer erinnerte sich sogleich unseres Josephs. Reutter wollte den geschickten Knaben sehen. Er erschien. Reutter fragte ihn: ›Büberl, kannst du einen Triller schlagen?‹ Joseph mochte der Meinung sein, es sei nicht erlaubt mehr zu können als andere ehrliche Leute, und beantwortete daher die Frage mit den Worten: ›Das kann ja der Schulmeister auch nicht.‹ ›Schau,‹ erwiderte Reutter, ›ich will dir einen Triller vormachen, gib recht acht, wie ich ihn mache.‹ Kaum hatte er denselben geendigt, so stellte sich Joseph mit der größten Freimüthigkeit vor ihn hin und schlug nach höchstens zwei Versuchen einen so vollkommenen Triller, daß Reutter vor Verwunderung bravo rief, in die Tasche griff und dem kleinen Virtuosen einen Siebzehner (50 Pf.) schenkte. So erzählt der Maler Dies, der Haydns Umgang von 1805 bis zu dessen Tode genoß und darnach 1810 die so werthvollen »Biographischen Nachrichten« über ihn herausgab.
Der Kleine benutzte nun die Zwischenzeit bis zum 8. Lebensjahre, wo er erst ins Capellhaus eintreten konnte, zu Gesangübungen, – denn dies hatte der Herr Hofcapellmeister, als er dem Vater die Zusage gegeben hatte, für des Knaben Fortkommen zu sorgen, zur Bedingung gemacht, – er bediente sich dazu, da er keinen regelrechten Lehrer fand, aus eigener Erfindung der natürlichsten Methode, schlechtweg die Töne der Tonleiter zu singen, und machte dadurch so rasche Fortschritte, daß Reutter, als der Knabe in Wien ankam, über seine Fertigkeit in Staunen gerieth.
Das Capellhaus war das der Stephanskirche. Allein die Capellknaben hatten auch außer bei den ohnehin sehr häufigen Gottesdiensten noch in auswärtigen Aufführungen mannichfacher Art mitzuwirken und waren dadurch in ihrer eigenen Ausbildung bedeutend gehemmt. Haydn sagt zwar selbst, daß er hier »nebst dem Studiren die Singkunst, das Clavier und die Violine von sehr guten Meistern erlernt« und sowol in der Kirche wie bei Hofe mit großem Beifall gesungen habe. Allein wenn schon das »Studiren« nur der nothdürftige Unterricht in Religion, Schreiben, Rechnen und Latein war und darin zuletzt doch wieder er selbst sein eigentlicher Lehrer zu sein hatte, so stand es mit der Kunst in der Hauptsache noch schlechter. Denn der Herr Hofcapellmeister bekümmerte sich nicht viel um seine Capellschüler und erscheint obendrein als ein etwas hochfahrender Herr. »Ich war auf keinem Instrumente ein Hexenmeister, aber ich kannte die Kraft und Wirkung aller, ich war kein schlechter Clavierspieler und Sänger und konnte auch ein Concert auf der Violine vortragen,« durfte trotzdem Haydn später sagen. Das Singen aber war schon rein praktisch genommen seine Hauptübung und demgemäß auch seine Stärke, weshalb er denn auch als deutscher Instrumentalcomponist zuerst gesangmäßig, das heißt melodiös schrieb. Darum legte er aber auch darauf zeitlebens großen Werth und tadelte es oft, daß so viele Componisten nichts davon verständen. In diesen beiden Dingen bestand also, abgesehen von dem praktischen Musikunterricht, der Hauptsache nach dasjenige, was er in dieser seiner zehnjährigen Capellhauszeit in Wien als künstlerische Jugendschulung genoß: er hörte stets viel a capella, d. h. reine Chor-Musik mit ihrem contrapunctischen Gewebe und lernte ebenso jede Art von Sologesang und Instrumentalmusik kennen, und beides um so eindringlicher, als er selbst bei allem mitwirkte. Doch sind ihm auch ganze zwei Stunden in der musikalischen Theorie von dem »braven Reutter« gegeben worden.
Einzelnheiten über diese Jugendzeit erzählt noch Dies. Joseph sei trotz aller Vernachlässigung seiner Ausbildung mit seinem damaligen Stande zufrieden gewesen, und zwar, weil Reutter von seinem Talente so eingenommen war, daß er dem Vater erklärte, »und wenn er zwölf Söhne hätte, so würde er für alle sorgen.« So kamen noch zwei Brüder, darunter der spätere Salzburger Capellmeister Michael Haydn, der aus der Biographie Mozarts bekannt ist, ins Capellhaus nach Wien, und Joseph hatte die »unendliche Freude« sie unterrichten zu müssen. Schon damals beschäftigte er sich übrigens eifrig mit Componiren. Auf jedes Blättchen Papier, das er fand, zog er mühevoll Linien und steckte sie voll Notenköpfe, denn er meinte, es sei schon recht, wenn nur das Papier recht voll sei. Reutter überraschte ihn einmal in einem Augenblick, wo er ein solches zwölfstimmiges Salve regina d. i. der englische Gruß auf einem mehr als ellenlangen Papiere vor sich ausgebreitet liegen hatte. »He, was machst du da, Büberl?« sagte er, sah aber dann das lange Blatt doch durch, lachte herzlich über die reiche Aussaat des Wortes salve (Gegrüßet seist du), noch mehr über den riesenmäßigen Einfall, als Knabe sich an zwölf Stimmen zu wagen und fügte hinzu: »O du dummes Büberl, sind dir denn zwei Stimmen nicht genug?« »Aus solchen hingeworfenen kurzen Anmerkungen wußte Joseph Nutzen zu ziehen,« heißt es dabei. Weiter rieth ihm aber Reutter, die in der Kirche aufgeführten Stücke auf beliebige Art zu variiren, und diese Uebung brachte ihn früh auf eigene Ideen, welche dann Reutter corrigirte. »Das Talent lag freilich in mir, dadurch und durch vielen Fleiß schritt ich vorwärts. Wenn meine Kameraden spielten, nahm ich mein Clavierl untern Arm und ging damit auf den Boden, um ungestörter mich auf selbem üben zu können,« sagt Haydn selbst.
Wenn also Dies weiter von dieser Jugendzeit berichtet: »Ich mußte jedoch die Umstände errathen, denn Haydn erzählte mit einer Behutsamkeit und Achtung gegen seinen Lehrer, die seinem Herzen zur Ehre gereicht,« so haben wir dies um so höher zu stellen, als wir dabei das Folgende hören. »Was aber für ihn sehr empfindlich war und in seinem Alter schmerzhaft sein mußte, war der Umstand, daß es schien, als ließe man absichtlich mit dem Geiste zugleich den Körper verhungern. Josephs Magen mußte sich an immerwährendes Fasten gewöhnen. Doch suchte er sich bei vorfallenden musikalischen Akademien, wo den Chorknaben etwas zur Stärkung gereicht wurde, für eine Weile zu entschädigen. Sobald Joseph diese für seinen Magen wichtige Entdeckung gemacht hatte, bekam er eine unglaubliche Zuneigung zu den musikalischen Akademien. Er befliß sich so schön wie möglich zu singen, um als ein geschickter Sänger bekannt und überall hingerufen zu werden, damit er Gelegenheit finde, seinen nagenden Hunger zu stillen.« Dabei steckte er sich denn auch gelegentlich die Taschen voll Nudeln oder sonst etwas Gutem. Reutter hatte eben selbst keine große Einnahme für seine Chorknaben. So mußten sie darben.
Gleichwohl fehlte auch diesem so empfindlich eingeengten Dasein der jugendlich heitere Uebermuth nicht. Unser Dies erzählt: »Zur Zeit, als der Hof das Lustschloß zu Schönbrunn erbauen ließ, mußte Haydn die Pfingstfeier hindurch dort in den Kirchenmusiken singen. Außer der Zeit, die er in der Kirche zubringen mußte, gesellte er sich zu andern Knaben, bestieg die Baugerüste und lärmte auf den Bretern umher. Was geschah? Die Knaben erblicken plötzlich eine Dame. Es war Maria Theresia selbst, die sogleich jemanden beorderte, die lärmenden Knaben von dem Gerüst zu entfernen und mit Schillingsstrafe (Prügel) zu bedrohen, wenn sie sich wieder auf demselben sehen lassen würden. Haydn war am folgenden Tage vom Vorwitz getrieben, bestieg allein das Gerüst, wurde erhascht und erhielt richtig den versprochenen Schilling. Viele Jahre nachher, als Haydn schon im Dienste des Fürsten Esterhazy stand, war die Kaiserin einst in Esterhaz (in Ungarn). Haydn stellte sich vor dieselbe hin und machte seine unterthänigste Danksagung für den erhaltenen Schilling. Er mußte den ganzen Vorfall erzählen, worüber viel gelacht wurde.«
Hier sehen wir denn zugleich unseren Helden schon als Meister in Amt und Würden. Wie dornenvoll war die Bahn dorthin!
»Seine schöne Stimme, mit welcher er sich bisher so manchen gesättigten Magen ersungen hatte, ward ihm plötzlich untreu, sie brach sich und wankte zwischen Doppeltönen,« erzählt Dies. Bei den Feierlichkeiten des Leopoldstages in dem nahen Stifte Klosterneuburg erschien gewöhnlich auch die Kaiserin. Sie hatte schon Reutter im Scherz bedeutet, Haydn singe nicht mehr, er krähe! So hatte derselbe zum Singen bei diesem Feste schon den jüngeren Bruder Michael gewählt, der dann der Kaiserin so sehr gefiel, daß sie ihm 24 Dukaten schenkte. Reutter aber war jetzt, wo Haydn ihm »keinen Geldnutzen mehr bringen konnte« und er überhaupt Ersatz für denselben hatte, kurz entschlossen den unnützen Kostgänger zu verabschieden. Eine jugendliche Ungezogenheit beschleunigte die Entlassung Haydns: er hatte einem anderen Chorknaben, der gegen deren Sitte sein Haar im Zopfe trug, denselben abgeschnitten. Reutter verurtheilte ihn hart genug zu Stockschlägen auf die flache Hand. Der Augenblick der Strafe erschien. Haydn, jetzt im 18. Lebensjahre stehend, suchte alle Mittel der Befreiung von derselben und erklärte endlich, er wolle nicht mehr Chorknabe sein, wenn er nicht gestraft werde. »Da hilft nichts,« erwiderte Reutter, »du wirst erst geprügelt und dann marsch!«
Reutter hielt sein Wort. Er rieth aber dem jetzt abgedankten Chorsänger sich zum Sopranisten, wie sie damals soviel galten, herrichten zu lassen. Jedoch Haydn, voll richtigen Mannesgefühls, ging nicht auf den so verführerischen Vorschlag ein, und so trat er denn jetzt im Spätherbst 1749 »hilflos, ohne Geld, mit drei schlechten Hemden und einem abgenützten Rock ausstaffirt in die große Welt, die er nicht kannte«. Sogleich die erste Nacht mußte er, nachdem er von Hunger gequält die Straßen durchirrt und sich endlich erschöpft auf die nächste Bank niedergelassen hatte, bis zum grauenden Morgen in der feuchten Novemberluft im Freien zubringen. Da führte ihm das gute Glück einen Bekannten zu, der ebenfalls Chorsänger und zugleich Hauslehrer war, und obgleich dieser selbst mit seiner Frau und einem kleinen Kinde nur ein einziges Dachzimmerchen hatte, nahm er den hilflos Entlassenen dennoch bei sich auf, – ein Zug jener österreichischen Gemüthsfülle, von der gerade Haydns Kunst später auch in Tönen den schönsten Widerhall geben sollte!
»Seine Eltern waren sehr bekümmert,« erzählt weiter Dies. »Vorzüglich das weiche Mutterherz äußerte bange Besorgniß mit Thränen im Auge. Sie bat den Sohn, er möge doch den Wünschen und Bitten der Eltern nachgeben und sich jetzt dem geistlichen Stande widmen. Sie ließen ihrem Sohne keine Ruhe. Aber Haydn blieb unerschütterlich. Er wußte zwar keine Gründe anzugeben, er meinte sich aber deutlich genug zu erklären, wenn er den ihm unerklärbaren inneren Drang in die wenigen Worte zusammenpreßte: Ich mag kein Geistlicher werden.« – »Seid nur recht brav und fleißig und vergeßt nie auf Gott,« hat der 76jährige Greis noch zu Sängerknaben gesagt, die ihm vorgestellt wurden. Mangel an aufrichtiger Frömmigkeit war es denn auch nicht, was ihn damals von dem geistlichen Stande fern hielt. Er fühlte eben seinen Beruf auf anderem und eigenstem Gebiete, und wir wissen heute, daß sein Gefühl und Wünschen ihn nicht getäuscht hat.
Allein beinahe hätte die Noth selbst ihn dennoch zu jenem so bestimmt abgewiesenen Schritte getrieben, denn das Mitwirken bei den Serenaden und Capellen brachte nicht viel Geld ein und ließ ihm doch andererseits erwünschte Zeit zum Studiren und Componiren. Die stille Einsamkeit in jenem kleinen finstern, unter den Dachziegeln gelegenen Bodenkämmerchen, der gänzliche Mangel an Dingen, die einem müßigen Geiste Unterhaltung gewähren und seine ganze kümmerliche Lage führten ihn daher zuweilen zu Betrachtungen, die oft so ernsthaft waren, daß er sich genöthigt sah zu seiner Musik Zuflucht zu nehmen, nur um die Grillen zu verjagen. »Einst waren diese Betrachtungen ernsthaft genug,« fährt unser Gewährsmann Dies fort, »oder vielmehr peinigte ihn der Hunger so heftig, daß er sich wider alle Neigung entschloß in den Orden der Serviten treten zu wollen, blos um sich satt essen zu können. Dies war jedoch nur sein erster Einfall, der bei seiner Gemüthsart nie zur Wirklichkeit kommen konnte. Haydns glückliches zum Frohsinn geneigtes Temperament bewahrte ihn vor heftigen Ausbrüchen der Schwermuth. Wenn im Sommer Regen, im Winter Schnee durch die Fugen des Daches drang und er durchnäßt oder beschneit erwachte, so fand er solche Vorfälle sehr natürlich und sie dienten ihm als Stoff zu Scherzen.«
Er wußte nun einige Zeit hindurch freilich nicht recht, wozu sich entschließen, und projectirte tausend Dinge, die aber im Entstehen wieder verworfen wurden. Meist war der Hunger die Triebfeder zu irgend einem raschen Entschluß. So zu einer Wallfahrt nach Mariazell in Steiermark. Er ging dort sogleich zum Chormeister, meldete sich als Capellschüler, zeigte einige seiner Musikalien vor und trug seine Dienste an. Der Chormeister traute ihm aber nicht und fertigte ihn, als er immer zudringlicher wurde, mit den Worten ab: »Es kommt des Lumpengesindels soviel von Wien hier an, das sich für Capellknaben ausgibt und wenn es darauf ankommt, keine Note treffen kann.« Haydn ging also am andern Tage auf den Chor, machte Bekanntschaft mit einem der Sänger und bat ihn um sein Notenblatt. Der junge Mann entschuldigte sich jedoch, daß er nicht dürfe. Nun drückte ihm Haydn ein Geldstück in die Hand und blieb neben ihm, bis die Musik anfing. Plötzlich riß er ihm das Blatt aus den Händen und sang dann so schön, daß der Chormeister in Verwunderung gerieth und sich nachher bei ihm entschuldigte. Die geistlichen Herren erkundigten sich dann ebenfalls und luden ihn zur Tafel. Haydn blieb acht Tage und füllte, wie er sagte, für eine Zeitlang seinen Magen, ward auch hinterher mit einer kleinen Summe gesammelten Geldes beschenkt.
In Haydns Testament von 1802 steht unter den Legaten: »Der Jungfrau Anna Buchholz 100 Fl., weil mir ihr Großvater in meiner Jugend und äußersten Noth 150 Fl. ohne Interessen geliehen, welche ich aber schon vor 50 Jahren bezahlt habe.« Dieses für ihn damals ansehnliche Darlehen brachte ihn nun zunächst (1750) zu einer eigenen Wohnung, wo er auch ruhiger zu arbeiten vermochte. Dies erzählt vom Jahre 1805: »Der Zufall führte Haydn vor kurzer Zeit eine seiner jugendlichen Compositionen, deren er sich gar nicht mehr erinnerte, in die Hände, eine vierstimmige kurze Messe mit zwei obligaten Sopranen. Das Wiederfinden dieses seit 52 Jahren verlorenen Kindes verursachte dem Erzeuger eine wahre Freude. ›Was mir an diesem Werkchen besonders gefällt, ist die Melodie und ein gewisses jugendliches Feuer,‹ sagte er und entschloß sich, ihm eine moderne Kleidung anzuziehen.« Die Messe ist dadurch erhalten und als sein erstes größeres Werk zu betrachten. Es stammt also eben aus dem Anfang dieser 1750er Jahre.
Haydn wohnte damals in dem noch heute stehenden Michaeler Hause am Kohlmarkt, also im vornehmsten Viertel der Stadt, jedoch abermals unterm Dach und manchen Unbilden der Witterung ausgesetzt. Das Zimmer hatte nicht einmal einen Ofen und so mußte Haydn winters oft in der Frühe sich vom Brunnen Wasser holen, weil das im Waschbecken befindliche gefroren war. Das Haus selbst barg vornehme Bewohner: die Fürstin Esterhazy, deren Sohn Paul Anton Haydns erster Mäcen werden sollte, den berühmten und hochgebildeten Operndichter Metastasio, welcher ihm bald nachher auf einige Jahre seine kleine Freundin Marianna Martines als Clavierschülerin anvertraute und ihm dafür freie Kost gab. Und das Kind muß hier eine gute Grundlage bekommen haben, denn noch Mozart spielte 30 Jahre später oft mit ihr vierhändig. Der Unterricht selbst nöthigte Haydn nach damaliger Gewohnheit zu kleinen Compositionen. Die ersten Stücke gingen freilich rasch von Hand zu Hand, aber auch fast alle verloren. Er hielt sich sogar für geehrt, wenn man seine Stückchen nur annahm, und wußte nichts davon, daß die Musikhändler gute Geschäfte damit machten, verweilte vielmehr selbst mit Wohlgefallen vor den Musikläden, wo das eine oder andere im Druck ausgestellt lag. Daß aber diese Thätigkeit ihm nicht eben von Herzen ging, sagt seine Aeußerung: »Da ich endlich meine Stimme verlor, mußte ich mich mit Unterrichtung der Jugend ganze acht Jahre kümmerlich herumschleppen. Durch dieses elende Brod gehen viele Genie zu Grunde, da ihnen die Zeit zum Studiren mangelt. Die Erfahrung traf mich leider selbst, ich würde das wenige nie erworben haben, wenn ich meinen Compositionseifer nicht in der Nacht fortgesetzt hätte.« Jedoch ständig in eine der zahlreichen Musikcapellen Wiens einzutreten und so seine ganze Zeit zu verkaufen, vermochte ihn selbst die äußerste Noth nicht. »Freiheit! was will man mehr!« sagte Beethoven, dieses Gefühl wollte auch Haydn wenigstens für seinen Genius haben. Wir vernehmen mehrere Aeußerungen in diesem Sinne aus seinem Leben. Ja er sagte noch im Alter zu Griesinger: »Wenn ich an meinem alten von Würmern zerfressenen Claviere saß, beneidete ich keinen König um sein Glück,« und wir werden noch sehen, daß es weit mehr der Componist als der Virtuose war, der sich hier innerlich glücklich fühlte.
Aber eben dieses Gefühl erhielt ihm auch seine gute Stimmung, das innere Gleichgewicht, und den Haydn der jovialen Menuets und humoristischen Finales erkennen wir deutlich schon aus manchen Jugendzügen. So band er einst zur Belustigung seiner Kameraden, an denen es ihm auch ferner nicht mangelte, den Rollwagen einer Kastanienrösterin an die Räder eines Fiakers und hieß dann den letzteren zufahren, indem er sich unter den Verwünschungen beider Leidträger rasch auf und davon machte. So hatte er einst den Einfall, viele Musiker auf eine bestimmte Stunde zu einer sogenannten Nachtmusik einzuladen. Die Zusammenkunft war im Tiefengraben, wo auch Beethoven in den ersten Jahren nach der Ankunft in Wien gewohnt hat. Die Musiker mußten sich vor verschiedenen Häusern und in den Ecken vertheilen: sogar auf der Hohenbrücke, wo später Mozart wohnen sollte, stand ein Paukenschläger. Die meisten Spieler wußten nicht, warum sie da waren, und jeder hatte den Auftrag zu spielen, was ihm einfalle. »Kaum hatte dieses schreckliche Concert angefangen, als die erstaunten Bewohner die Fenster öffneten und über die verdammte Höllenmusik zu schimpfen anfingen. Unterdessen hatten sich auch die Rumorknechte genähert. Die Spieler entwischten jedoch noch zu rechter Zeit bis auf den Pauker und einen Violinisten, die beide in Arrest geführt wurden, denen man aber, da sie den Rädelführer nicht zu nennen wußten, nach einigen Tagen die Freiheit wiedergab,« endigt Dies die Erzählung dieses Schelmenstreiches.
In dieser Zeit lebendigen Jugendstrebens kam ihm nun, als er eines Tags sich ein gutes Clavierwerk zum Studium kaufen wollte, durch die Empfehlung des Musikalienhändlers ein Werk desjenigen Componisten in die Hände, der zuerst eine freiere und sozusagen dichterische Art der Claviermusik begründet hat, ein Heft Sonaten Ph. E. Bachs. »Mich deucht, die Musik müsse vornehmlich das Herz rühren,« sagt die autobiographische Skizze dieses geistreichen Sohnes des großen Bach, und solchem unwillkürlichen Zuge der Natur hatte ja auch von vornherein die gemüth- und phantasievolle Natur unseres ächten österreichischen Musikanten gehuldigt. »Da kam ich nicht mehr von meinem Clavier hinweg, bis die Sonaten durchgespielt waren,« äußerte noch der Greis in jugendlicher Erregtheit, »und wer mich gründlich kennt, der muß finden, daß ich dem Bach sehr vieles verdanke, daß ich ihn verstanden und gründlich studirt habe: er ließ mir auch selbst einmal ein Compliment darüber machen.« Er sei der Einzige, der ihn ganz verstanden habe und Gebrauch davon zu machen wisse, hatte Bach gesagt. »Ich spielte mir dieselben zu meinem Vergnügen unzählige Mal vor, besonders auch wenn ich mich von Sorgen gedrückt fühlte, und immer bin ich da erheitert und in guter Stimmung vom Instrumente weggegangen,« läßt Rochlitz Haydn von jenen Sachen äußern. »Immer reich an Erfindung, gefällig und feurig in den Melodien, prächtig und kühn in der Harmonie kennen wir ihn schon aus hundert Meisterstücken und kennen ihn noch nicht ganz,« sagt bereits ein Bericht vom Jahre 1764 über diesen Bach.
In der That war hier zuerst die instrumentale Kunst mit einer gewissen Sicherheit und Kraft die freiere Bahn der Oper gewandelt, deren Ziel doch stets, wenn auch damals nur sehr verschoben, die individuelle Charakteristik blieb. Zu einem Trio für Streichinstrumente hat denn auch Ph. E. Bach einmal selbst einen »Vorbericht« geschrieben. Er habe hier versucht etwas auszudrücken, wozu man sonst Stimme und Worte gebrauche, sagt er. Es solle gleichsam ein Gespräch zwischen einem Sanguiniker und einem Melancholiker sein, welche im 1. und 2. Satz miteinander streiten, bis der Melancholiker des Andern Behauptung annimmt. Im Finale seien sie dann endlich einig. Der Melancholiker mache den Anfang mit einem zwar munter tändelnden, doch auch etwas matt leidenden Satz, der zuletzt Traurigkeit zeige, die aber nach einem Halt durch ein Paar lebhafte Triolen vertrieben werde. Der Sanguiniker folge hier »aus Höflichkeit« beständig nach und sie befestigen ihr Einverständniß, indem der eine dem andern alles »bis sogar zur Verwechslung« nachmache. Aus solchen Ansätzen, bei denen allerdings vorerst die geistige Absicht mehr ist als ihre künstlerische Ausführung, hat Haydn dasjenige entwickelt, was ihn zum Hauptbegründer der modernen Instrumentalmusik gemacht hat, deren letztes Ziel also ebenfalls Darstellung der Welt des lebendigen Willens ist.
Die Melodie d. h. »der von der Besonnenheit beleuchtete Lebenswille« beginnt also auch hier ihre sichere Herrschaft, wie denn Lied und Tanz wesentliches Vorbild für diese moderne Instrumentalmusik gewesen sind. Tonart, Tact, Rhythmus, ja die Pausen werden auch hier bewußte Ausdrucksmittel für eine bestimmte Färbung und Stimmung, in der jede Regung, jedes Streben, jede Bewegung unserer Kraft zur Geltung kommt. Die harmonische Modulation hilft den angeschlagenen Ton anhalten und vertiefen. Die Dissonanz vor allem ist keine blos zufällige mehr und gilt nicht dem vergänglichen Reize des Ohres, sondern sie ist durchweg eine zu einer bestimmten Wirkung beabsichtigte und gewählte, bei Bach noch manchmal gesucht, bei Haydn aber schon als poetische Wirkung sich bethätigend. Scheut er sich doch nicht z. B. im Finale der großen Esdursonate Op. 92 den übermäßigen Dreiklang, der bei Richard Wagner eine so treffend charakteristische Verwendung erfährt, wenn auch zunächst nur in Vorhaltsgestalt anzubringen, aber doch frei einsetzen zu lassen! Hier hatten sie denn allerdings den unermeßlichen Schatz bei Seb. Bach vor sich, der sich später bei Mozart und Beethoven auch völlig aufthat und seine herzeinschneidende Macht wiederholte.
Ferner die Verschiedenartigkeit der Tonlage wird stets bewußter verwerthet und die Grundfärbung der Stücke ist schon sehr individuell. Dabei werden ebenfalls nicht entfernt die Wundergaben der heimischen Contrapunktik aufgegeben, vielmehr namentlich bei Haydn in der »thematischen Arbeit« der sogenannten Durchführungspartie im 2. Theile des 1. Satzes und im Finale der Sonatenform erst recht geistreich verwerthet, sodaß auch diese Musik »mit dem Verstande gehört sein will.« Endlich aber das Auszeichnende des ganzen Styles, der der »galante« genannt wurde, weil er nicht der Kirche und Gelehrsamkeit, sondern der Gesellschaft und zwar der feinen angehörte, ist die sozusagen räumlich architektonische Gliederung und Gestaltung des Ganzen, die ihm die feine Ordnung der Theile wie die Symmetrie der Renaissancekunst gibt, als welche die moderne Instrumentalmusik im allgemeinen überhaupt neben der Gothik der deutschen Contrapunktik steht. Wer also wie unser Joseph Haydn seinem Naturell und ganzen Lebensgange nach ganz dem wirklichen Leben und dessen mannichfachen Gebilden und wechselnden Stimmungen angehörte, besaß in dieser Sonatenform das allerbereiteste Gefäß, seinen Reichthum zu bergen und zugleich durch Weiterentwicklung der eigenen inneren Kräfte und Regungen zu vergrößern. Darum spielte er so gern die Bachschen »Sonaten für Kenner und Liebhaber« und saß überhaupt so gern an seinem Claviere, das ihm in freier Bewegung der Phantasie Herzensergießungen in ähnlicher Form ermöglichte.
Ebenso war das Lehrbuch, das Haydn bald darauf kennen lernte, Ph. E. Bachs »Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen,« – 1753 in Berlin erschienen, – nach Haydns eigenem Urtheil »das beste, gründlichste und nützlichste Werk, welches als Lehrbuch je erschien,« und Mozart wie Beethoven äußerten ähnliche Ansichten. Dennoch trat später die drollige Beschuldigung auf, Haydn habe Bach copirt und carikirt, weil dieser ihm feindselig begegnet sei, was vielleicht daraus geschlossen wurde, daß Bach in seiner Autobiographie vom Jahr 1773 dem »jetzt so beliebten Komischen« den Verfall der Musik seiner Tage zuschreiben wollte. Allein dies bezog sich auf ganz etwas Anderes und 1783 schrieb Bach selbst öffentlich: »Nach meinen Nachrichten von Wien muß ich glauben, daß dieser würdige Mann, dessen Arbeiten mir noch immer sehr viel Vergnügen machen, ebenso gewiß mein Freund sei wie ich der seinige. Blos das Werk lobt und tadelt am besten seinen Meister und ich lasse daher jedermann in seinem Werth.« Und Dies erzählt sogar, Haydn sei 1795 von London über Hamburg gereist, um Ph. E. Bach auch persönlich kennen zu lernen, sei aber zu spät gekommen, weil Bach todt gewesen sei. Er war aber schon 1788 gestorben, und sollte Haydn dies nicht gewußt haben? Die Reise über Hamburg hatte einen andern Grund.
Auch das Violinspiel ließ Haydn nicht liegen und wird darin besonders von seinem Landsmann und Freunde Dittersdorf, dem späteren Componisten von »Doctor und Apotheker«, weiter gelernt haben. »Einst durchstrichen beide zur Nachtzeit die Gassen und machten vor einem gemeinen Bierhause Halt, in welchem die halb trunkenen und schläfrigen Musikanten gerade einen Haydnschen Menuet erbärmlich herabfidelten,« erzählt Dies. »Du, da gehen wir hinein!« sagte Haydn. »Beide traten in die Bierstube. Haydn stellt sich neben den ersten Geiger und fragt ganz trocken: Von wem ist denn der Menuet? Dieser antwortete noch trockener, ja sogar bissig: Von Haydn! Haydn stellt sich vor ihn und sagt mit verstelltem Grimme: Das ist ein rechter S...menuet! Was, was, was? schreit der in Zorn gebrachte Geiger und springt von seinem Sitze auf. Die andern Spieler thun desgleichen und alle wollen ihre Instrumente auf Haydns Kopf zerschlagen, was auch geschehen wäre, wenn Dittersdorf, der von großer Statur war, nicht seine Arme über Haydn ausgebreitet und ihn zur Thüre hinausgeschoben hätte.«
Dittersdorf selbst aber gibt in seiner Lebensbeschreibung noch einige Nachricht über dieses Freundschaftsverhältniß. Er hatte 1762 Gluck nach Italien begleitet. Währenddeß war der berühmte Lolli in Wien mit großem Erfolg aufgetreten. Zurückgekehrt nahm er sich vor, Lollis Ruhm zu überbieten, und übte wochenlang, angeblich krank, mit größtem Fleiß auf seinem Zimmer. Dann trat er wieder auf und der Erfolg war sein. »Lolli erregt Erstaunen, Dittersdorf auch, spielt aber zugleich fürs Herz,« so lautete das allgemeine Urtheil. »Den Rest des Sommers und den folgenden Winter brachte er in öfterer Gesellschaft des liebenswürdigen Haydn zu,« fährt er selbst fort. »Ueber jedes neue Stück, das wir von andern Tonsetzern hörten, machten wir unsere Bemerkungen unter vier Augen, ließen jedoch dem was gut war, Gerechtigkeit widerfahren und tadelten, was zu tadeln war.«
Doch wir kehren zu den 1750er Jahren zurück.
»Haydn setzte ungefähr im 21. Jahre seines Alters eine komische Oper in deutscher Sprache,« erzählt Dies. »Sie führte den Namen ›Der krumme Teufel‹ und wurde auf eine sonderbare Art veranlaßt. Kurz, ein deutsches Theatergenie, trieb damals sein Wesen im alten Theater am Kärnthnerthore und belustigte das Publicum als Bernardon. Er hatte von dem jungen Haydn mit vielem Lobe reden hören, das reizte ihn, dessen Bekanntschaft zu suchen. Ein lustiger Vorfall verschaffte ihm bald dazu Gelegenheit. Kurz hatte eine schöne Frau, die so gefällig war, von den jungen Tonkünstlern Nachtmusiken anzunehmen. Auch der junge Haydn, (der dies »Gassatim gehen« nannte und für eine solche Gelegenheit schon 1753 ein Quintett geschrieben hat), brachte derselben ein Ständchen, wodurch sich nicht nur die Frau, sondern auch Kurz geehrt hielt. Er suchte Haydns nähere Bekanntschaft. Dieser mußte dann Kurz in die Wohnung folgen: ›Setzen Sie sich zum Flügel und begleiten Sie die Pantomime, die ich Ihnen vormachen werde, mit einer passenden Musik. Stellen Sie sich vor, Bernardon sei ins Wasser gefallen und suche sich durch Schwimmen zu retten!‹ Nun ruft Kurz einen Bedienten, wirft sich mit dem Bauche quer über einen Stuhl, läßt den Stuhl im Zimmer hin und her ziehen und bewegt sich, während Haydn im 6/8 Tact das Spiel der Wellen und das Schwimmen ausdrückt, mit Armen und Beinen wie ein Schwimmender. Plötzlich springt Bernardon auf, umarmt ihn und erstickt ihn beinahe mit Küssen. ›Haydn, Sie sind ein Mann für mich, Sie müssen mir eine Oper schreiben!‹ So entstand der krumme Teufel. Haydn erhielt 28 Ducaten dafür und hielt sich für sehr reich. Diese Oper wurde mit großem Beifall zweimal aufgeführt und darauf wegen beleidigender Anzüglichkeit im Texte verboten.«
Hier liegt demnach ein überliefertes Beispiel der fruchtbaren Keime zur Erfindung jener Motive und Melodien Haydns vor, die sozusagen persönliches Gesicht zeigen, zu jenen musikalischen Charaktertypen, die sich in Mozart und Beethoven zur treffendsten Lebensähnlichkeit entwickelten und ihrerseits wieder der dramatischen Darstellung selbst eine ganz neue Sprache schenkten. Was die Italiener nur nach der Seite einer allgemeinen typischen Schönheit als Melodie, die Franzosen in ihrem dramatischen Recitativ und ihrer Claviermusik im Gegentheil zu einseitig reflectirend gethan hatten, das thaten hier der deutsche Geist und vor allem das deutsche Gemüth aus unbefangener Aufnahme der Sache selbst heraus. Namentlich ist dabei bereits auch jene humoristische deutsche Ader mitwirkend, die bei Haydn zuerst in der Musik nach ihrer ganzen Unwillkürlichkeit und Fülle aufwallte, sodaß wir jetzt sozusagen sämmtliche Entwicklungsmomente bei einander haben, aus denen sich diese Künstlerindividualität bildete. Damit ist also seine Jugend und erste Bildung der Hauptsache nach abgeschlossen. Ja wir haben ihn sogar schon im ersten selbständigen Schaffen gefunden und demgemäß, ehe wir dieses erste Kapitel abschließen, nur noch einige Nachrichten über die Oper selbst zu geben, um die Bedeutung dieser ersten selbständigen That des Künstlers nach Gebühr zu würdigen.
Wir vernehmen zunächst näher, daß es sich bei jener Probe seines Könnens um das Meer im Sturm und einen Ertrinkenden handelte und daß Haydns Finger endlich unwillkürlich in der Angst in die vom Komiker gewünschte Tactbewegung (6/8) gerathen waren. Im Stücke selbst galt es einen alten verliebten Gecken zu curiren, und dazu muß der gutmüthige Teufel helfen, man findet die Inhaltsangabe wie manche weitere Nachricht über jene Zeitepoche der Wiener Kunst bei C. F. Pohl »Joseph Haydn« I. (Berlin 1875). Die Hauptsache aber war hier eben die innige Berührung der reinen Musik mit der Dramatik und namentlich der Geberde, und da ist es eben die Vollendung der ächten Komik des damaligen Wiener Volksschauspieles gewesen, was Haydns Phantasie zuerst auf diese Bahn der sprechenden Zeichnung in Tönen führte. Als der »krumme Teufel« fertig war und Haydn sie zu Kurz brachte, wies ihn, so wird uns ferner berichtet, die Magd ab, weil ihr Herr »studire«. Wie sehr erstaunte Haydn, als er durch die Glasthüre Bernardon vor einem großen Spiegel stehend Gesichter schneiden und die komischsten Pantomimen machen sah. Es war das »freie kecke Komische,« was in diesem Wiener Hanswurst lag und offenbar in solcher persönlichen Erlebung und Wiedergabe ihm erst nach seiner vollen Eigenart bewußt wurde. Während es aber hier schließlich der eigenen Rohheit und Beschränktheit erliegen mußte, sobald auch in Oesterreich die höhere dramatische Dichtung deutscher Sprache erwachte, rettete sich sein Wesen in veredelter Gestalt in die Musik hinüber, und Haydn ist es eben, der diesen ächten deutschen Volkshumor in unserer Kunst vertritt. Der »letzte Wiener Hanswurst« Bernardon und seine Possen verschwanden, ihr volles und dauerndes Erbe aber ging mit dieser Berührung in der komischen Oper »der krumme Teufel« an Haydn über. Sie selbst ist uns nicht erhalten, allein ihr gesunder und edler Lebenskeim hallt uns allüberall aus Haydns Instrumentalmusik entgegen, zu deren Entstehung wir also jetzt übergehen.