
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
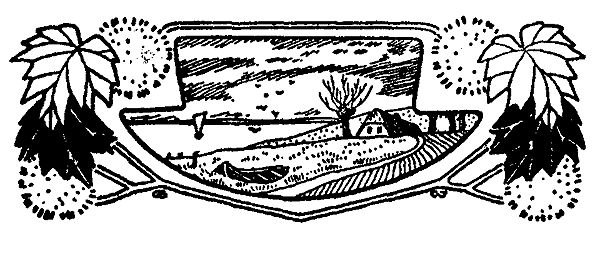
Die Märzwinde fegen von Osten her über das Venn. Ein junges Licht fließt aus dem Winterglanze. Im Moor ein leises Rinnen und Rispeln! Der durchfrorene Sumpfboden hat den warmen Kuß gespürt und zerrinnt in Frühlings-Freudentränen! Eine schimmernde Hand überall und goldene Finger überall! Die zupfen aus den Birken die Knospenhüllen und aus dem Heidegestrüpp einen sanften Farbenflimmer und aus dem Wollgras einen zitternden, weichen, seidenen Flaum. Und freudig klunkst und schluchzt der schwarzbraune Moorgrund dazu!
Frühlingsfeier im Venn!
Am neuen Vennacker steht Alexand und zieht die Gräben tiefer. Von allen Seiten läuft das Grundwasser herein, und der Ostwind kommt und leckt die letzte Feuchtigkeit auf. Trocken und dürr starrt die Ackerscholle. Wenn er darüber geht, bröckelt sie branddürr unter seinem Schritt. Das Venn liegt klar wie in einer Vollmondnacht. Er kann die Dachspitzen der Dorfhäuser sehen. Wenn er die Augen beschattet, kann er sie zählen. Das weiß wohl keiner drunten, daß der Einsame an sie denkt. Aber der Verschollene will ein Zeichen von sich geben, das sie erinnern soll an die neue Zukunft hinter den dunkeln Linien am Horizonte.
Auf seiner Schippe trägt er die Kohlen von der Feuerstelle in einen Torfhaufen. Langsam kriecht die qualmende Glut in den vom Frost zerriebenen Müll, brennt feurige Rände um die Torfkuchen und bläst die Rauchfäden in die stahlblaue Luft. Alexand steht dabei und wirft den glühenden Torf zusammen und läßt nur eine Ritze frei, wo der Wind hineinblasen kann. Der streut die Funken in die Torffasern, steckt rote Lichter auf, läuft in dem glühenden Feuerkreis sich toll und wild und schluckt mit glühendem Atemzuge den hochgetürmten braunen Leckerbissen ein. Und nur mehr eine tosende, feuerwirbelnde Glut ohne Flamme!
Wieder sticht er mit der Schippe hinein und trägt das prickelnde Feuer an die vier Enden des abgegrenzten Heidelandes. Da hat er im Spätherbst das Gestrüpp bis zu den Wurzeln abgesichelt, jetzt stehen nur noch hier und da die Stoppeln der Moormyrte und des Heidekrautes heraus.
Breite Gräben umspannen das braune Moorstück. Da kann das Feuer nicht mehr hinüberspringen und hat nur den einen Weg: aus vier Enden mit Zischen und Knistern zusammenzurennen. In den schwarzbraunen Boden frißt das feurige Brandmal über Handbreite in den Untergrund hinein. Wohin die Funken springen, schlängeln sich immer neue Feuerlinien, vielstrahlige, rotumränderte! Und weiter zieht der feurige Fraß! Brandkreise und Feuerstrahlen ringeln ineinander. Und der Abend taucht mit schwarzen Tinten hinein. In die Nebelwand spritzen die Funken, in das Moordunkel flimmert und knittert der feurig gemusterte Heideteppich.
Am Morgen hat der dichte Qualm die Nebel zerteilt und wälzt sie träge den Sümpfen zu. Der Wind trippelt hinein, reißt das dichte Rauchgewebe zu Fetzen und hängt es in die noch kahlen Ruten der Moorkiefern, die um die Vennhütte stehen, und an die Binsen am Tümpel und deckt damit die Sümpfe und den Morast; und das, was übrig bleibt, setzt er als dicke Wolkenballen an die Grenzlinien des Venn.
Da sehen die Dörfler den Qualm und sagen:
»Das Moor brennt.«
Nach drei Tagen steht der Qualm noch an derselben Stelle.
»Wir müssen unsere Torfhaufen schützen,« meinten die Bauern und zogen weite Gräben darum.
Nach weiteren drei Tagen steht der Qualm dichter.
»So kann es wochenlang weiterbrennen und macht das Moor zum Torfstich unbrauchbar.«
Sie schicken den J'han Marnette in die Vennhütte hinauf und lassen Alexand fragen, ob er ihnen schaden wolle. J'han kommt herunter mit dem Bescheid, nützen wolle er ihnen! Was für den Torfstich unbrauchbar werde, sei fruchtbar für die Saat. Das verdrießt die Bauern, und sie schauen nicht mehr freundlich ins Venn.
Derweil zieht Alexand seine Furchen in den versandeten Acker und setzt die Kartoffeln hinein. An manchen Stellen brennt das Feuer weit genug in die weiß-graue Moorschicht, bis es auf Sand gerät und erlischt. Da kann er in die Asche den Buchweizen säen, schnallt den gefüllten Sack über die Schulter und streut in weitem Bogen die Körner aus. Ein lauer Frühlingsregen sprenkelt hinein. Die brüchige Scholle wird weich und schmalzig, und der nasse Samen quillt auf zu treibenden Keimen.
Träge durchs Gestrüpp und über die braune Heide wälzt sich der Moorbrand, der Regen fährt zischend hinein, aber das sanfte Naß zersplittert auf der glimmenden Feuermasse und verdunstet – die Glut frißt weiter, und der Qualm hängt sich an die blaue Kuppel des Himmels.
Die Bauern schauen ins Venn und murren.
Inzwischen haben sich die Gräben von neuem mit Wasser gefüllt. Bis in seine Hütte hinein hört Alexand das Rauschen und Sickern. Schmutziges Grundwasser ergießt sich über den Acker. Da zieht er die Moorstiefel bis über die Knie herauf, springt in den Graben und schaufelt den zähen Klipp heraus. Das Moor hat sich »gesetzt« und er weiß nun, daß nach einer gewissen Zeit der Graben wieder zu vertiefen ist. Bis über die Schultern steht er darin. Das schäumende Wasser spritzt an ihm hinauf. Die fahlen Sonnenlichter stechen hinunter bis auf den nachtschwarzen Grund und zaubern eine traumhaft phantastische Welt hinein. Und länger und breiter sieht er seine Gräben wachsen – meilenlange Haupt- und Zuleitungsgräben, die wie frisch pulsierende Schlagadern über das Venn hinspannen und seine Sümpfe leersaugen.
Und weit, weit dehnt sich der Ausblick ins Unendliche! Vennhütten sieht er im Nebel aufragen, Feldbaracken – die ersten Ansiedler der Moorkolonie! Und wohnen werden dort jene, für die im Tale kein Raum mehr war und solche, die zum Wanderstecken greifen und über dem Weltmeer die ungewisse Zukunft gründen wollten, und diejenigen alle, die der Weltstrom ausspie als Strandgut und die nur so viel Raum gewinnen wollten, um auf freiem Besitz die allzustürmende Kraft zu zerreiben, die wallonische Kraft, die auf fremdem Boden faulte! Sollte der wallonische Boden faulen und die eigenen Kräfte in der Fremde zerrinnen? Er reckt sich, daß die Muskeln auf seinen nackten Armen wie Saiten straffen und zucken. Das Venn muß ihre herbe, arme, sehnende, traurige Liebe werden!
Und dann lächelt er still, und mit dem Blick nach innen schaut er für seine Pläne die Vollendung. Aber eine reckenhafte Gestalt ragt ihm hinein, und deren Schatten fiel in den seinen: Oberst von Giese.
Eine ruhige Zuversicht kommt in ihn. So bückt er sich und gräbt weiter.
Noch einige Parallelgräben zieht er und sorgt somit reichlich für Abfluß. Nach dem Abbrennen der obersten Moorschicht liegt ihm eine weite zu beackernde Fläche frei.
Er nimmt den Vennbauer mit sich auf sein kleines Anwesen und zeigt es ihm – stolz und freudig.
»Jetzt muß's Zugvieh unter Joch,« sagt er, »das Feld hier läuft mir zu weit, das bring' ich nicht mit'm Spaten 'rum. Leiht mir Euren Kaddèt für'n paar Pflügtage.«
»Der bricht Euch ein in dem Untergrund. Oben auf ist's trocken zum Brechen und 'n paar Spannen drunter sitzt noch der Schlamm – trotz Eurer Gräben. Moor bleibt Moor. Nehmt Euch in Acht, 's ist tückisch.«
»Hört, Tatalle, was tut Ihr, wenn Ihr zwischen den Sümpfen durchgeht?«
»Hm, das wißt Ihr. Wir schnallen uns Bretter an die Schuhe, und wenn wir dann noch'n Springstock haben, kann's nicht fehlen.«
»Genau so mach' ich's mit Eurem Kaddèt. Ich schnalle ihm breitsohlige Holzschuhe an, dann bricht er nicht zu tief ein. Und was das andere anbelangt – ich fürchte das Venn nicht. Mir kann's nicht tückisch werden, mir ist's lieb.«
»Die Mam' hat den Regen in die Sonn' fallen sehen. Das war am Sonnenwendtag. Das bedeutet nix Gutes. Um Euch die Wahrheit zu sagen, 's ist nicht mehr geheuer, seit Ihr im Venn hockt. Alle Anzeichen deuten auf 'n Unglück.«
»Ihr seid abergläubisch. Das überlaßt den alten Weibern und den Kindern.«
»Im Dorf sind sie Euch spinnefeind, sagt der Qwèrin.«
»Ich werd's ihnen zeigen, daß sie unrecht haben.«
»Wenn die nur so lang' warten!«
Da dehnt sich der Giètsohn.
»Wer was von mir will, soll 'raufkommen. Meine Felder sind's, die ich brenne.«
»Seht Ihr denn nicht? Der Qualm geht weiter. Die Bauern kommen um ihren Torf für den Winter. Das ausgebrannte Land ist auch für den Torfstich wertlos.«
»Zum Teufel, wollt Ihr Euer Leben lang im Torf versumpfen? Das Venn kann Euch mehr geben als Torf. Und das will ich Euch zeigen, sonst glaubt Ihr's nicht.
»Mir ist der Torf von diesem Jahr lieber als der Weizen nach zehn Jahren. Ich bin Vennbauer und bleib's mein Leben lang. Aber meinen Kaddèt könnt Ihr haben, schon um Euch zu kurieren. Womit düngt Ihr denn?«
»Mit dem Nächstliegenden. Die Torfstreu liefert mir 'n Stallmist, der mir grad' auf meine Äcker paßt,« und dann lenkt er von dem Thema ab. »War der Qwèrin im Dorf?«
»Gestern. Ihr wißt, er geht auch auf Taglohn. Der Meister Gièt hat ihn für den Torfstich gedungen.«
»Kann er nicht heut' abend 'mal herkommen, ich – möcht wissen, wie's dem Giètbauer geht.«
»Das kann ich Euch sagen; 's geht ihm nicht gut. Der zerfällt wie Backobst.«
Alexand bückt sich und sticht den Spaten ein.
»Ich denk', man hätt' mich gerufen, wenn's zum Schlimmen geht.«
»Man sieht's eben nicht zum Schlimmen gehn. Ich sag' Euch, der zerfällt und man merkt's nicht.«
Sie stehen eine Weile beisammen und schweigen. Dann sagt der Vennbauer:
»Adjüs, Gott behüt',« und geht.
Alexand treibt mit kräftigen Fußstößen den Spaten in den Boden und drängt den pochenden Groll zur Ruhe. Er kann es nicht. In dem Giètkopf hämmert es ihm. Der saugt das Blut all ein und trotzt und kann den inneren Zorn nicht überwinden. Sie werden kommen, wenn es zum Schlimmen ist; das sagt er sich und bleibt und gibt dem versöhnenden Gedanken keine Stimme. Er ist starrer und unversöhnlicher geworden in der Einsamkeit. Dort erst hat er empfunden, wie groß das Glück war, das sie ihm genommen.
Und bis in den tiefen Abend hinein steht er im Moor, zerlegt ein Stück Land durch tiefe Parallelgräben in dreißig und fünfzig Meter breite Beete, wirft Dämme auf und bedeckt sie mit einer Schicht Lehm und Sand. So kann ein junger Frühjahrsfrost den jungen Keimen nichts anhaben.
Und voll Freude schaut er sein Werk.
An jedem Frühmorgen tritt er in den Nebel hinaus, sieht in der Ackerscholle nach, ob nicht schon die Spitzen der Kartoffelblätter durch die Sandlage stechen, ob aus der Asche nicht die Buchweizenkeime heraussprießen. Ungeduld und Erwartung drängen ihn. Ob ihm auch das gelingen wird? Er sieht über seine Äcker. Der Frühlingstau behängt sie mit tausend glitzernden Perlen. Als schmale Linie an ihnen vorüber läuft der weiße Pfad, den er angelegt hat. In Abständen von einigen fünfzig Schritten hat er hohe Pfähle eingelassen, die im Winter den verschneiten Weg nach seinem Anwesen bezeichnen. Zwischen diesen Pfadweisern sieht er im Glanze der aufgehenden Sonne ein Gewühl von Schatten. Anfänglich denkt er, das könnten die Maurer sein, die seine Hütte in festere Fundamente legen. Da bemerkt er die Hacken auf den Schultern und hört laute Stimmen. Sie nehmen die Richtung auf seine Hütte zu. Es fällt ihm ein, was der Vennbauer von den Dörflern sagte, und er hängt seine Jagdflinte um. So geht er den Ankommenden auf halbem Wege entgegen. Einer stapft voraus. Das ist der Krebsenmattes. Ihm folgen Frè Thoumas, der alte Speckschwarte und ein paar junge Burschen.
» Kimint?« (Wie?) ruft ihn Speckschwarte an, »Du kommst mit'm Gewehr gegen uns? Du willst also gleich Feindschaft?«
»Kommt Ihr denn in Freundschaft?« fragt Alexand und steckt die Hand in den Gürtel.
»Wir kommen für unser Recht!« knodert Frè Thoumas, mit Deinen verrückten Ideen verdirbst Du uns 's ganze Venn. Man läßt sich doch nicht so mir nichts dir nichts am eigenen Leibe zwacken.«
»Hört mal, Nachbarn!« Alexand hängt seine Flinte an den Pfahl, »wenn ich Euch hier ein Land ertragfähig mache, sollt Ihr mir's danken und die paar Karren Torf verschmerzen. Brot ist besser als Brand. Aber man kann Euch nicht von Eurer starren Meinung abbringen, und darum laßt mir Zeit, bis Ihr meine Äcker blühen seht.«
Der alte Speckschwarte zerwühlt seinen struppigen Bart.
»Derzeit können wir um Brand und Brot gekommen sein.« Er streckt seinen Arm nach der Richtung, wo der Qualm träge durchs Gebüsch schleicht. »Dahinten frißt's weiter in unsere Torffelder hinein, und das können wir nicht mehr weiter mit ansehen. Darum sind wir hergekommen, nicht um Dich mit der Jagdflinte zu sehen. Wir wollen uns jetzt selbst helfen. Gräben müssen wir ziehen, um die Glut aufzuhalten, das weißt.«
»Das wär' Deine Sach' gewesen,« wirft Frè Thoumas zwischendurch ein, »wo Du aber nur an Dich denkst –«
»Zieht Gräben soviel Ihr wollt,« sagt Alexand, »nur rührt nicht an meine Äcker. Es geschieht nix Gut's, wenn Ihr mir auch nur einen Keim herausreißt.«
»Wir sorgen jetzt zuerst mal für uns, hernach kommst Du.«
»So sorgt also jeder für sich. Ihr könnt Eure Gräben ziehen, und ich bewache meine Äcker – wenn's Not tut, auch mit der Flinte.«
»Schöne Nachbarschaft das!«
»Im Venn lebt man ohne Nachbarn.«
»Tät'st besser dran, im Gièthof Ordnung zu schaffen!« ruft Mattes.
»Krebsenmattes, erinner' mich nicht an den Gièthof! Auf'm Venn ist die Jagd frei!«
»Guter Gott! Der wär' imstand', uns über'n Haufen zu schießen.«
»Ja, ich könnt' zu so was kommen!«
Da stapfen die Bauern quer über die Torffelder zu dem Feuerherd hinüber. Langsam folgt ihnen Alexand, geht die Grenzlinien seines Anwesens auf und ab und hält Wache. Die Bauern kochen vor Zorn. Sie sind gehemmt in ihrer Arbeit, dem Feuer steht immer noch ein Weg zum Weiterglimmen offen. Wenn nicht ein starker Regen niedergeht, wird die Glut auf Schleichwegen ihren Torfvorrat zerfressen. Als sie am Nachmittag hinuntersteigen, lodert der Haß zwischen Dorf und Venn.
Krebsenmattes hat unbemerkt von den anderen den Weg in die Sumpfbüsche genommen. Die Weidenruten schlagen hinter ihm zusammen. Schilfblätter stehen dicht wie aus dem Boden herausgestochene Lanzen. Sumpfpflanzen rascheln um seinen Fuß, eine züngelnde schwarze Natter fiebert durch den Morast. Rispelnde Gasbläschen über den Sümpfen, und ein Dunst von stinkendem Wasser, faulendem Moos; Erdgeruch, Sumpfluft!
Von einem Moorhügel zum andern wagt er den Sprung, nimmt die Entfernung zu kurz und plantscht mit den Füßen in die schwammige Moosdecke ein. Bei ruhiger Überlegung hätte er sich an dem Weidengebüsch flach über den wippenden Rasen hinziehen können, aber in wahnsinniger Angst reißt und zerrt er die Beine aus dem Schlamm und stößt das klucksende Wasser heraus. Das spritzt über ihn hin, der schwarze Grund klebt in seinem Haar, rinnt ihm am Halse herunter – da brüllt er wilde Schreie heraus und pfeift gellend auf den Fingern.
»Alexand! Hilfe!«
An allen Seiten reißt die schlumpfende Moosdecke auseinander. Das Grundwasser gurgelt und sickert heraus.
»Alexand!«
Pfiffe, Rufe! Und kein Echo, und weiche, müde, lautlose Stille! Der Krebsenmattes denkt, es wär' sein Letztes und heult wie ein geschlagener Hund, aber keine Tränen rinnen.
»Hilfe!«
Zwischen den Buschkiefern ein Schatten und ein Rascheln in den breiten Sumpfblättern. Der lange Springstock taucht in den versumpften Boden – der Schatten huscht in weitem Bogen über den Sumpf – auf einem Moorhügel steht Alexand auf den Springstock gestützt, an seinen Füßen klappern die angeriemten Bretter.
»Du bist's, Krebsenmattes? Ich hab's gewußt, daß Du noch kommen würdest. Eine Schlechtigkeit hast mir noch sagen wollen. Jetzt liegst hier fest und kannst faulen.«
»Alexand, mach keine Witze, 's ist mir jämmerlich zumut. Ich saufe hier's Sumpfwasser ein und fühle, wie mir der Klipp die Knochen entzweidrückt. Zieh mich 'raus.«
In dem Zwielicht, das in die Sumpfschatten rinnt, kann er nur undeutlich die Gestalt Alexands unterscheiden. Er zwinkert mit den Augen zu ihm hinüber und sieht, daß der seine Uhr in der Hand hält.
»Meiner Berechnung nach kann's noch eine halbe Stund' zugehen, bis Dich der Sumpf aufgefressen hat. Hab' also keine Angst, Du kannst mir derzeit noch viel erzählen, viel Niederträchtiges, was sollst denn sonst wissen?«
»Was ich sonst wissen könnt'!« Dem Krebsenmattes flackern die Augen auf, »vielleicht könnt' ich doch was wissen – etwas, das Dich vom Venn 'runterfegt wie 'n Feder!«
»Laß Dir's gesagt sein, Krebsenmattes, es müßt' schon stärker sein als das, was mich auf's Venn geworfen hat.«
» Abin, und wenn's stärker wär'! – Im Namen Gottes! Zieh' mich 'raus, zieh' mich 'raus! Der Ekel wühlt mir die Gedärm' auf!«
»An Dir ist nicht viel verloren, Krebsenmattes, also kannst schon mit 'ner Lüg' auf 'm Gewissen in den Sumpf beißen.«
»Im Namen Gottes! Ich lüg' nicht. Den Marnette hab' ich als Zeugen. Der hat im Suff 'was 'rausgeschwatzt –«
»Der Marnette?« Alexand steht kerzengerade. »Was hat Dir der Marnette gesagt?«
»Gelt, für so dumm hältst mich nicht, daß ich Dir 'was sag', eh' Du mir 'rausgeholfen hast. Hör, Alexand, hast denn kein Gefühl mehr?«
»Nein, Mattes, ich hab' keins mehr. Ich könnt' hier stehen und Dich sterben sehen und mich darüber freuen; das merk' Dir. Wenn Dir also 'was an Deinem Leben liegt, schließ 'n Pakt mit mir. Du sagst, was Du weißt, und ich zieh' Dich 'raus.«
»Lieber wär's mir, Du ziehst mich 'raus, und dann sag' ich's.«
»Wo werd' ich denn dem Teufel trauen!«
»Kannst mich ja immer wieder 'reinwerfen.«
Alexand sieht das verbissene Gesicht Marnettes in jener Winternacht vor sich. Der mußte etwas wissen, das von allen Rätseln den Schleier nahm.
Krebsenmattes hat die Augen geschlossen. Der giftige Dunst betäubt ihn. Der Zwielichtdämmer schläfert ihn ein. Da fühlt er einen Stoß auf seiner Brust. Alexand reckt mit dem Springstock herüber.
»Krebsenmattes, schlaf' nicht ein. Mit einem Ruck könnt' ich Dich hinunterstoßen.«
»Wirst schon bleiben lassen. Jetzt halt ich Dich!«
»Glaubst denn, ich wär' nicht Mann genug, den Marnette zum Reden zu bringen?«
»Der wird sich eher die Zung' 'rausreißen. Der tut's schon darum nicht, um meiner armen Tochter ihre Reputierlichkeit nicht wieder zu geben. Bist nicht der einzige Freier, Alexand. Der Marnette war's auch einmal, jetzt ist er wie der Gottseibeiuns um die Gètrou 'rum. Und wenn Du jetzt noch was von mir wissen willst, mach schnell. Die halb' Stund' könnt' längst 'rum sein, ich fühl's.«
Aus Alexanders Blut rinnt das Eis. Heiß und bangend schießt es ihm zu Kopf. Was sollte er hören? Eine große unbezwingliche Unruhe fiebert ihm durch den Körper. Er wirft ein breites Brett vor sich auf den Schlammgrund, ein zweites trägt er unterm Arm. So springt er auf das eine, während er das andere immer wieder vor sich her wirft und sprungweise zu dem Sinkenden vordringt. Er faßt ihn unter den Schultern und hebt ihn – ohne Ruck, ohne gewaltsames Losreißen. Und dann versucht er es, den Körper im Schlamm zu drehen, in schraubenförmigen Windungen herauszuziehen. Der Morast schlumpft um die langen Beine des Krebsenmattes. Die Schlammblasen platzen, und das schmutzige Grundwasser sammelt sich in der Lücke.
»Verhalt' Dich still!« herrscht Alexand ihn an. Unter der gewaltigen Anstrengung fährt ihm der Atem ächzend heraus. Dann noch ein Ruck, als müßten ihm die Muskelstränge reißen! Das Brett sinkt unter der Last der beiden Männer.
»Spring weiter!« ruft Alexand und stößt den Krebsenmattes auf das nächste Brett. Und nun setzt er den Springstock an, löst die Bretter aus dem Sumpfboden und springt nach.
»Bei mir droben kannst Dich trocknen,« sagt Alexand und geht voran. Krebsenmattes sucht in seinen Taschen.
»Naß tut mir besser als trocken.«
Er setzt die Feldflasche an den Mund, nimmt einen langen Schluck und wirft sich in dem letzten fahlen Sonnenstrahl auf den filzigen Boden. »Da, wärm' Dich innerlich.«
Alexand wehrt ab.
»Jetzt lös' Dein Versprechen ein. Von langem Reden bin ich heut' nicht. Was weiß der J'han Marnette von der – von Deiner Tochter?«
»Von der Gètrou nichts, eher von Deinem Vater. Der hat einmal dem Marnette gesagt, er müsse ins Venn rein von wegen dem Moorgespenst – grad' auf 'n Sonntag war's.«
»Kommst wieder auf Umwegen, Krebsenmattes?«
»Nein, meiner Seel', auf'm ganz schnurstracksen Weg bin ich. Mir liegt jetzt daran, eins, zwei, drei, aus dem Teufelsvenn 'rauszukommen. Dem Marnette sollt' ich mit'm Zaubermittelchen das Moorgespenst vertreiben. Da hat's Dein Vater aber viel schneller unschädlich gemacht. Der ging auf die Sonntag Nacht ins Venn, der J'han hat ihn gesehen. Der war auf der Suche nach Schlangenwurz.«
» Bin – und was weiter?«
»Das ist's.«
»Ich seh' nix drin.«
» Abin, vielleicht siehst was drin, wenn ich Dir sag: genau in derselbigen Nacht will der Michi den Meister Gièt bei der Gètrou gesehen haben.«
»Was sagst Du, Krebsenmattes?«
»Und wenn Du mich gleich wieder in den Sumpf wirfst. – Das ist Wahrheit! Im Namen Gottes.«
»Will das der Marnette bezeugen?«
»Wort für Wort!«
»Und der Michi?«
»Auch, Wort für Wort.«
»Siehst Du, Krebsenmattes, wie Du lügst!«
»Ich lüg' nicht. Sag's nur dem Marnette auf den Kopf zu!«
»Einer kann doch nur die Wahrheit gesagt und einer gelogen haben.«
»Da bist im Irrtum, alle zwei haben die Wahrheit gesagt. Der Meister Gièt kam wie'n Wirrer aus'm Venn, und die Haustür war zu. Bin, da mußt er wohl durchs Fenster. Die Gètrou war noch auf – sicola! Warum lachst Du denn?«
»Deine Geschichte ist schön, aber nicht zum glauben.«
»Laß den Marnette schwören. Bei allen Heiligen wird er's tun!«
»Krebsenmattes, Du warst dem Tod nahe gewesen – denk daran und sag' die Wahrheit.«
»Unsern Herrgott will ich niemalen sehen, wenn's erlogen ist. Und jetzt besteh' ich drauf, meinem armen Kind muß seine Reputation wiedergegeben werden, o aie!«
»Um die hast Du Dich nicht zu kümmern, die wird ihm daher gegeben, wo sie ihm genommen worden ist.«
Dem Krebsenmattes läuft ein Schrecken den Rücken herauf. Diese Stimme klingt zum Fürchten hart. Dem da war es zuzutrauen, daß er wie ein Blinder dreinfuhr und nicht um sich sah, wohin die Hiebe trafen. Er steht auf und geht ein paar Schritte weiter.
»Wir sind noch nicht fertig mit'nander, Krebsenmattes. Warum kam der Meister Gièt wie 'n Wirrer heim?«
Mattes geht noch einen Steinwurf weiter, dreht sich um und fragt:
»Wie weit schießt Deine Flint'?«
»Sie könnt' Dir noch eins aufbrennen.«
Da geht er noch weiter und steht an einem Pfahl.
»Der Meister Gièt kam wie'n Wirrer,« ruft er und legt die gewölbte Hand an den Mund, »der kam wie 'n Wirrer aus'm Venn, weil am Tümpel ein Eisenbahner lag und kein Glied mehr rührte. Das war in der Sonntagsnacht. Jetzt geht kein Moorgespenst mehr im Venn um!«
Alexand reißt die Flinte ans Gesicht und zielt. Krebsenmattes rast davon und verschwindet im Nebel. Ein Schuß kracht in die weiße Luft. Ein höhnischer Pfiff aus dem Nebel heraus zur Antwort. Alexand stößt die Flinte auf den Boden. Aus seinem Gesicht weicht die Farbe der Gesundheit. Ein kranker Schatten fällt hinein, grau und düster, fast grauenhaft. Nun fühlt er, daß er in der Sumpfluft wohnt. Sie könnte ihn zum Verbrecher machen. Wie der Vater so der Sohn. Sie waren beide Mörder, mehrfache Mörder; einer an eines armen Mädchens Ehre, der andere an seinem Herzen. Nun schämt er sich hinunterzugehen, und – er muß gehen! Die Nebel rinnen auf ihn nieder. Da steht er noch immer mit tiefgesenktem Kopf in den Abendschatten.
Und er muß gehen. –
Im Dorfe sagen die Bauern, der Giètsohn sei verrückt geworden, und man könne doch nicht gut von einem, der am Verstand gelitten, das Venn in Grund und Boden hinein verderben lassen. Wenn nun nicht bald Regen kommt, ein richtiger, klatschender Landregen, und die glimmende Glut lösche – – – ihre drohenden Blicke hängen an der Rauchwolke im Venn.
Das sagen sie bei vollen Gläsern im Krebsenhaus, und der J'han Marnette sagt es auf dem Gièthof.
»Hast Du's gehört, Gètrou?« fragt der Bauer. Der kauert im Lehnstuhl am offenen Fenster. Gètrou sitzt auf der Bank vor dem Hause und handhabt den Butterstößer. »Hast Du's gehört? Er ist verrückt, grad' wie ich. Es ist 'n Jammer mit den Giètbauern. Gètrou, meinst Du, das käm – davon?«
Er reckt aus dem Lehnstuhl heraus.
»Ich weiß nicht, wovon 's kommt,« sagt sie leise, »ich bin keines vom Gièthof und hab's doch mitgekriegt.«
»Ja, gelt Gètrou, Dir ist's leid geworden?« Er greint es heraus.
»Wenn ich Euch so sehe, kann's mir nicht leid werden. Warum fragt Ihr das immer? Euch und mir tut's nicht gut.«
Er langt mit dem Arm heraus und faßt nach des Mädchens Schulter.
» Bin, weißt, Gètrou, man könnt' sterben!«
»Zum Fürchten ist das nicht, wenn man so viel durchzumachen hat. Ich wollt', ich säß' grad' so alt und krank und zerschrumpft wie Ihr im Lehnstuhl, glaubt's mir.«
»Ich hab 'n Testament gemacht, Gètrou. Ich will nichts umsonst von Dir.«
Sie schüttelt heftig den Kopf.
»Wenn ich nur für's Reisegeld genug hab'! Ich bleib' nicht im Dorf, die Fremd' fürcht ich nicht mehr. Gebt Euer Geld, wem's zukommt. Jesses Mater, Meister Gièt, ich bin die Gètrou nicht mehr, die Ihr vom Tümpel geholt habt!«
Er hält nur den einen Gedanken fest.
»Warum soll ich dem Alexand mein Geld geben? Der läßt mir hier Haus und Hof liegen, der Gamin, der Narr!«
Die Erregung bringt ihn ins Weinen. Gètrou biegt zum Fenster hinein und drängt ihn mit kräftigen Armen in den Lehnstuhl zurück.
»Gelt, jetzt schimpf Ihr 'n nicht. Schwatzt, was Ihr wollt, ich hör' Euch mit Geduld zu, aber schimpfen dürft Ihr 'n nicht, hört Ihr's!«
»Warum kommt er denn nicht, Gètrou?« Er schluchzt wie ein Kind. Sie stützt den Ellbogen auf die Fensterbank und den Kopf in die Hände. So starrt sie ihn an. Das Mitleid rinnt in sie hinein. Dem Meister Gièt hat sie ihre Ehre und ihr Glück geopfert; nun muß sie ihm noch das Eine tun: sie muß ihm den Sohn holen.
Vom Hofeingange her hallt ein Schritt, und mitten im Hof hält er inne. Gètrou dreht sich um und stößt in heftigem Schreck gegen die Fensterscheibe. Die Scherben rasseln herunter.
Der Bauer arbeitet sich aus dem Lehnstuhl heraus. Langsam streckt Gètrou den Arm aus und sagt heiser:
»Da kommt er, Meister Gièt!«
Und dann flüchtet sie um die Hausecke – fort, sie weiß nicht wohin. Die Hände krallt sie ins Haar. Ihr Herz schlägt wild, aber wilder noch lodert der Groll. Ihre Liebe war anders als die seine – sie hätte ihn mit der Schande genommen!
Alexand geht ins Haus, in die Stube, schließt die Tür und sagt:
»Wie geht's Euch, Vater?« Der zwinkert ihn mit verblödeten Augen an, zittert vor Furcht, nestelt mit bebenden Fingern an den Knöpfen seines weißen Wamms.
»Es geht schlecht – siehst das nicht? Mit'm Daumen kannst mich ums Leben bringen. Was willst denn jetzt mit uns anfangen, hai?«
Die hilflose Scheu des alten Mannes erschüttert den Sohn bis ins Innerste.
»Du brauchst vor mir doch keine Angst zu haben,« sagt er weniger hart.
»Wenn ich noch meine Kraft hätt' und der Meister Gièt von früher geblieben wär', braucht' ich vor Dir nicht zu zittern,« klagt der Alte weinerlich und wischt sich mit dem Ärmel durchs Gesicht, »vor Dir nicht und vor den andern nicht.«
»Vater! Nur deswegen nicht, weil Du krank und schwach geworden bist?«
»Was fragst denn nur so? Brauchst mich nicht so anzusehen, so – so – wie 'n Untersuchungsrichter!«
Er wühlt sich in die Lederpolster hinein und möchte den Blick und die ernsten Worte und den Mann da vor sich abschütteln wie etwas Unangenehmes, Unerträgliches. Der beharrt unerbittlich.
»Ich meine, Vater, ob Ihr nicht Grund habt, mich und die andern wegen was ganz Schlimmerem zu fürchten?«
Der Alte sieht sich hilfslos um, will fort.
»Ins Gefängnis möcht' der mich bringen, der! der!«
Alexand drückt ihn behutsam und sanft nieder.
»Soweit ist schon der Riß zwischen uns! In Eurem Sohn seht Ihr 'n Polizist. Habt keine Angst, das Gefängnis ist nicht mehr für Euch; aber mit unserm Herrgott seid Ihr noch nicht fertig.«
»Wenn ich dem was zu sagen hab', ruf' ich den Pastor. Aber ich sterb' noch nicht, gelt, Alexand, ich sterb' noch nicht?«
Er klammert sich an ihn, tastet an seiner Schulter hinauf, zieht und zerrt ihn herunter, bis sein Gesicht dicht an seinem ist. Den keuchenden Atem sprüht er ihm hinein. »Wenn ich sterb', ist ein Testament da. Bis ins Grab 'nein wirst mich verfluchen, aber das Geld mußt ihr geben, sie hat's um mich verdient, hörst? Sie will's nicht nehmen, sie will fortreisen, dann mußt's ihr nachschicken, hörst? Sie hat's um mich verdient!«
»Das hat sie grad' nicht um Euch verdient, das ihr 'n Lohn ausgezahlt wird wie einer Magd. Vater, jetzt bin ich hier und will die Wahrheit wissen! Sagt mir alles! Ich hab' ein Recht drauf, ich muß sie wissen!«
»Gar kein Recht hast! – Gètrou!«
Seine heisere Stimme gellt durch das stille Haus.
»Besinnt Euch, Vater! Ihr ruft die Fremde gegen Euer eigen Fleisch und Blut! Was jetzt geredet wird, ist nur zwischen Euch und mir!«
»Gètrou! – Gètrou!!«
Mit den Armen stößt er in wahnsinniger Angst um sich.
»Hört mir zu, Vater. Ich will nichts weiter von Euch als die Wahrheit. Ich muß sie ja wissen, sonst wird droben im Venn nichts Gutes aus mir. Wenn ich jetzt zurückgehe und weiß die Wahrheit nicht, dann tue ich 'was – im Namen Gottes! Ich tue etwas, was mich ins Gefängnis bringt!«
»Gètrou!!«
Nun brüllt er es heraus und reißt das Polster auf, ballt das herausquellende Seegras in den bebenden Händen und schleudert es gegen den Sohn.
Da weicht der zurück. Sein Gesicht wird kalkweiß.
»Bleibt still, Meister Gièt! Ich geh' schon, – und wenn's Euch beruhigt – ich komm' nie mehr wieder!«
Die Türe knarrt. Gètrou tritt still herein, bleibt mitten in der Stube stehen und sagt:
»Wenn Du gehen willst, um nie wieder zu kommen, dann – gehst eben nicht!«
»Wenn man fortgeschickt wird, geht man,« bebt es aus Alexand.
»Er schickt Dich nicht fort.«
Sie steht neben dem Lehnstuhl und drückt den glühenden Kopf des Bauern zurück. Der wird ruhiger und tastet nach Gètrous Hand.
»Er schickt Dich nicht fort,« sagt sie nochmals in die Stille hinein.
»Frag' ihn die Wahrheit, dann wirst Du's sehen,« preßt Alexand düster heraus.
»Laß ihn in Frieden. Die Wahrheit kann uns wenig mehr nützen,« sagt sie müde.
»Mir wird sie nützen, ebenso wie mir Euere Lügen geschadet haben,« bricht er los.
Da biegt sie zu ihm herüber. Ihre blanken Augen erstarren in der Bitterkeit ihrer Worte:
»Die Lügen, Alexand, die haben mir doch nur geschadet!«
»Warum mußtest Du lügen – mich anlügen, Gètrou?«
»Gelt, Alexand, wie ich dumm war?« Sie lacht kurz und zornig auf. »Ich hätt' Deinen Vater ins Gefängnis bringen sollen und Dich um den ehrlichen Giètnamen. Dann wärst zufrieden mit mir gewesen und hätt'st mich geheiratet und wir hätten glücklich mitsammen gelebt: die Krebsenmattestochter mit ihrer Ehr', der Giètsohn ohne Ehr'. So hätten sie zusammengepaßt. Aber ich hab's anders gemacht – umgekehrt. Der Giètsohn hat seine Ehr' noch, die Krebsenmattestochter hat sie nicht mehr, und darum können sie kein Paar werden. Siehst wohl, Alexand, 's kommt immer drauf an, wer seine Reputation verloren hat. Jetzt weißt die Wahrheit, und nun geh' und laß uns beide in Frieden.«
» Aie,« haucht der Giètbauer verschüchtert.
»Auch Dich soll ich in Frieden lassen?« fragt Alexand sie mit stockendem Atem.
»Ja, auch mich, Alexand, mich zuerst! In mir ist jetzt alles versteinert!«
Mit verschränkten Armen sieht er finster vor sich hin.
»Ich hätt' Dir geglaubt, ich hab' den Verdacht niedergeschlagen, wo immer er herkam. Aber Du selbst hast Dich schlecht gemacht in meinen Augen. Da mußt' ich's glauben.«
»Vielleicht bist Du in Deinem Recht, Du als Mann; aber – ich hätt's doch anders gemacht, ich hätt' zu Dir gehalten, und wenn die Schand' doppelt so groß gewesen wär'. Luk, Alexand, darüber kann ich nicht weg. Jetzt bin ich in der Gewohnheit drin, daß Du mich für schlecht hältst und kann nicht mehr 'raus. Du glaubst nicht, wie man sich an sein Unglück gewöhnen kann. Und jetzt sag' ich's Dir, so wie ich's meine: Die Wahrheit weißt nun, und jetzt laß uns beide in Frieden.«
»Dich laß ich nicht in Frieden!« Die verhaltene Leidenschaft bebt in seine Stimme hinein. »Wem gehörst anders als mir?«
Sie weicht hinter den Lehnstuhl zurück.
»Dem da gehör' ich, dem alten, kranken Mann! Wir haben mitsammen viel ertragen. Von dem da kann ich nicht mehr los, bis er die Augen für immer zumacht. Man tät keinen Hund, der treu war und krank wird, 'was Leids an – und der da ist Dein Vater! Dem hab' ich 'n Schwur geleistet!«
»Weil – er – mein Vater – ist, Gètrou?«
Er biegt über den Lehnstuhl zu ihr.
»Ja, weil er Dein Vater ist! Das war's von Anfang an. Ich hab's nur nicht gewußt. So frei heraus kann ich Dir das jetzt sagen, Alexand, als wär's etwas aus der Vergangenheit 'raus. Jetzt bleib' ich bei ihm, weil ich's gern tue, – und weil ich so gar keinen Antrieb hab', zu einem andern zu gehen!«
Ein Ruck richtet ihn auf. Ein Lächeln verzerrt seinen Mund.
»Siehst Du, wie ich recht habe, wenn man mich fortschickt, muß ich gehen und nie mehr wiederkommen.«
Er steht mitten in der Stube. Seine Arme hängen schlaff an seinem Körper herab. Eine sekundenlange Stille fiebert in ihre Herzen hinein. Da sagt er leise:
»Gètrou, den Alexand schickt man nur einmal fort!«
»Aber der Alexand bleibt auch nicht, wenn man ihn nicht hält.«
Dann geht er bis zur Tür. Ihr ist, als müsse sie etwas sagen, etwas tun, um das Schreckliche, das nun kam und das sie wollte, und das ihr das Herz in Stücke riß, zu verhindern. Und dann weiß sie nichts anderes und sagt:
»Gott behüt'!«
Ob er es gehört hat? Er schließt die Türe hinter sich und geht durch die Küche, und seinen Schritt hört sie im Hofe und dann vor dem Fenster.
»Vater,« spricht er von draußen herein, »Du hast sie mir genommen! Von Dir fordere ich sie wieder! Bis in die Ewigkeit hinein fordere ich sie von Dir!!«
Der Schritt verhallt auf dem Hofe, auf der Landstraße – im Venn!
Der Bauer hastet aus dem Lederpolster heraus.
»Ist er fort, Gètrou?«
»Ja, Meister.«
»Was hat er von der Ewigkeit gesagt?«
Sie steht hinter ihm und antwortet nicht. Die Stimme bricht ihr. Der Bauer reckt mit dem Arm um die Lehne und zieht sie vor sich hin.
»Von mir will er Dich fordern. Siehst, er wird mir ins Grab fluchen.« Er fällt in sich zusammen und stöhnt leise, »sag', Gètrou, warum fordert er Dich? Die Ewigkeit ist lang, weißt, Gètrou; wenn er mir ins Grab flucht, ist's für die ganze Ewigkeit.« Er greint seine Angst heraus. »Hätt' er mir doch nix von der Ewigkeit gesagt! Geh', Gètrou, hol' mir die Anntschenne, die weiß mehr von der Ewigkeit als Du. Geh', hol' sie mir her!«
Es ist wieder der alte Herrenton, und Gètrou geht, weil ihr die Zimmerluft zu schwer, zu dumpf zum Atmen ist, weil sie hinaus muß, um mit sich selber fertig zu werden.
Hinter dem Hause am Brunnen zieht Anntschenne die Wäsche durch die Bläue.
»Anntschenne, Ihr sollt zum Meister 'neinkommen!«
»Zum Meister? Uch, will er wieder nicht 'n Tee trinken? Mußt 'm so zusprechen, wie 'm ganz kleinen Kind, lieb' Mädchen, dann tut er's und ich hab' m' schon mal gesagt, der liebe Gott tät's aufschreiben, jedes Opferchen, auch wenn er 'n Tee gegen seinen Willen nimmt. Das gefällt dem armen, kleinen Meister. Dann fragt er allemal: Meinst, Anntschenne, daß unser Herrgott noch 'was von mir wissen will? Uch, Herr Jemmersch! Der arme, kleine Meister! Unser Herrgott hat 'n so gern – so gern! Der macht seine Rechnung mit ihm all schon auf Erden ab und läßt 'n so viel leiden für seine paar Sünd',« und sie faltet die Hände über der Magengegend, »Herr, hier schneide, hier brenne, nur schone seiner in der Ewigkeit!«
Gètrou sieht ihr nach, wie sie die Treppe hinaufhumpelt. Heute hat sie in dem verrunzelten Gesicht gelesen, daß dies verbogene Mütterchen mehr wußte, als ihre simplen Gedanken verrieten. Ob in diesem zum Grabe geneigten Leben auch nur ein Kampf gewesen war, wie einer schon in ihre frühe Jugend hineintobte?
Gedankenlos geht sie in Haus und Stall umher, bleibt an der Hecke stehen, bis sie den Marnette aus den Wiesen kommen sieht, will den Knecht nach diesem und jenem fragen und steht vor ihm und hat es vergessen.
Am Abend sagt der Giètbauer zu ihr:
»Die Anntschenne spricht wie 'n Pastor. Die hat mir 'was gesagt, Gètrou.« Er streicht mit der Hand über die Stirne. »Hast Du das auch schon gehört? Sie sagt, was man gestohlen hat, muß man zurückgeben, sonst verzeiht einem der Herrgott nicht, und was man einem guten Namen zugefügt hat, muß man wieder gut machen, sonst kann man nicht ruhig sterben. Gètrou!« Er flüstert leise, fast unhörbar, »ich hab' Dir 'was am guten Namen zugefügt, und ich muß 's wieder gut machen.«
Und da sie schweigend das Bett ordnet, dringt der heisere Ruf vom Lehnstuhl herüber:
»Hörst? Das muß man gut machen! Hol mir wieder die Anntschenne 'rein, die muß mir noch sagen, wie man's gut machen kann. – Anntschenne!«
In der Küche ein Klirren. An der Türspalte erscheint der Alten erschrockenes Gesicht.
»Mach' die Tür zu, Anntschenne! – leg den Riegel vor – so! Komm setzt hierher – und auch die Gètrou! Wie macht man's gut, Anntschenne?«
»Wenn einer was gestohlen hat –«
»Das weiß ich! Das Andere!«
»Das von der Ehr'?«
»Ja, das von der Ehr'.«
»Wenn einer seinem Nächsten am guten Namen geschadet hat, muß er ihn wieder zu Ehren bringen.«
»Gelt, sonst verzeiht unser Herrgott nicht?«
»Uch e nee, sonst verzeiht er nicht; sonst kommt man in die Höll'.«
»Anntschenne, ich will nicht noch obendrein in die Höll' kommen, ich hab' genug mitgekriegt mit der Krankheit. Jetzt mach' ich's an der Gètrou wieder gut. Ich hab' ihr 'n schlechten Namen gemacht.«
» Aie, Meister.«
»Ich war in einer Nacht im Venn. Da fiel einer in 'n Tümpel – Gètrou, wo ist Deine Hand? – 'Reingeworfen hab' ich ihn nicht.«
» Aie, Meister.«
»Und zurück kam ich, und Gètrou hat mich durchs Fenster 'reingelassen, aus Mitleid, Anntschenne.«
» Aie, Meister.«
»Ich schmeiß Dich 'raus, wennst weiter nix weißt.«
»Ich weiß schon alles, lieber, kleiner Meister. Der Marnette hat's dem Krebsenmattes gesagt und der sagt's dem Michi und der war froh, daß er wieder 'n Neuigkeit zum Austragen hatte. Der Marnette hat Euch ins Venn gehen sehen, Meister – uch, lieb Mädchen, drück mir die Hand nicht ab, ich hab' alte Knochen.«
»Anntschenne, gelt, das sagst nur so – das vom Marnette?« Gètrou preßt die Hand der Alten, daß der fast die dicken Adern platzen.
»Der Krebsenmattes ist Dein leibhaftiger Vater. Der sagt so 'was nicht von dem Marnette, wenn's nicht wahr ist.«
Da schlenkert Gètrou der Alten Hand weg.
»All' wißt Ihr's – nur ich nicht: Totgeschwiegen habt Ihr alles, was für mich ist und gegen die Giètehre! Was liegt an einer Krebsenmattestochter! Anntschenne, von Dir hätt' ich's nicht geglaubt, weil Du fromm bist.«
Das verschrumpfte Mütterchen kommt ins Zittern und Wanken und stammelt:
»Unrecht leiden ist besser als unrecht tun, lieb Seelchen, meinst, der arme Meister Gièt, der Unrecht tat, hätt's besser gehabt als Du, die zu Unrecht gelitten hat? Und ich hab's auch gewußt, unser lieber Meister stirbt nicht, bevor er's wieder gut gemacht hat, so ist's?«
Sie tätschelt dem Bauer auf den Arm, und der sieht sie aus eingesunkenen, kranken Augen hilflos an.
»Ja, Anntschenne, jetzt ist's 'raus, jetzt kann's das ganze Dorf wissen, und auch das andere, Anntschenne – ich bin an dem Bahnunglück schuld! Dafür hat unser Herrgott mich schon genug gestraft. Hör, Anntschenne, ins Gefängnis können sie mich nicht mehr bringen, ich bin todkrank.«
»Wer wird denn unsern armen, kleinen Meister ins Gefängnis 'reinbringen?« und sie tätschelt wieder seinen Arm. »Zu einem Kranken kommt kein Gendarm mehr. Wißt Ihr, Meister Gièt, wer zum Kranken geht? – Der Pastor! Hört, lieber Meister, den ruf' ich Euch.«
» Aie, aie, ruf'n!« – – – – – –
Im Dorfe lief ein Gerücht um, das fand seine Bestätigung auch durch den Pfarrer. Der Giètbauer hatte seine Schuld eingestanden und wollte zu seinen Lebzeiten noch Gètrous Rechtfertigung bekannt geben. Als der Briefträger die Nachricht nach Robertville trug, war Daditte wieder mit frischgebackenen Fladen auf dem Weg zum Gièthof. Nun aber kehrte sie schleunigst um, und da man den Briefträger ausfragte, was sie für ein Gesicht gemacht habe, sagte er:
»Wie'n nasser Pudel!«
Es gab auch in Sourbrodt viele, die Gètrou weit aus dem Wege gingen; sie hätten den Blick vor ihr senken müssen, und schließlich war sie trotzdem immer nur eine Krebsenmattestochter. Aber der Michi kam ein paar Tage lang um seine Schnäpse. Da ging er de- und wehmütig zu Gètrou und sagte, nun möge sie ihm helfen, seine Reputation wieder herzustellen; und dreist und frech schritt er am Sonntag neben ihr aus der Kirche heim. Sie sah ihn nicht an und sprach auch nichts; aber das war auch nicht nötig. Die Dorfleute wußten jetzt, daß Michi die »Sache wieder gut gemacht hatte«. Für einen täglichen Schnaps tut man schon dergleichen.
» Abin, und was wird nun weiter?« fragte der Krebsenmattes.
» Abin!« meinte Michi und weiter nichts. Er hatte einmal etwas zu viel gesagt, da kam er übel an. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer.
Der Briefträger war jetzt zur Ortszeitung geworden. Er hatte einen großen mit gedruckter Firma versehenen Brief im Postsack, den trug er erst im ganzen Dorfe rund, bevor er ihn an die etwas ungewöhnliche Adresse beförderte. Die Aufschrift war auch dazu, um die Leute in Verwunderung zu setzen; sie lautete:
»Herrn Alexand Gièt, Haus im Moor,
Sourbrodt.«
Als der Empfänger diesen Brief erbricht, ist er eben daran, ein weites Brachfeld zu beackern. Die Ochsen des Vennbauern ziehen den Pflug, einer als Vorspann, von Qwèrin der breiten Furche entlang gelenkt. An den Füßen klappern die angeriemten Holzsohlen, klatschen auf das durchfeuchtete Erdreich nieder und treten die schlümpfende Scholle breit.
» Halté-là!« ruft Alexand dem Qwèrin zu, stemmt die Füße ein und hebt den Pflug an der Handhabe aus der Furche. Die Ochsen wenden in langem Bogen; Alexand wechselt die Streichbretter, dann lehnt er sich gegen die Handhabe und liest wieder das Schreiben, in welchem Oberst von Giese nach einigen einleitenden Worten auf seine bevorstehende Eifelreise zu sprechen kommt. »Es stellen sich unsern Plänen Schwierigkeiten in den Weg, die nicht vorgesehen waren und daher die Ausführung größerer Pläne als die Erweiterung des bestehenden Torfwerkes noch verzögern, so daß wir Ihnen eine endgültige Erledigung der Kaufsangelegenheit erst für das Jahr 1889 zusagen können. Was uns vorerst zu tun bleibt, ist die Vermehrung der Trockenschuppen und Hängegerüste behufs besserer und schnellerer Austrocknung der Sourbrodter Torfstreu. Wir rechnen da auf Ihre Hilfe. Des weiteren müßte ein Feldgeleis für den Materialtransport zum Hand- und Pferdebetrieb angelegt werden. Sie können dann schon mit dem Moortorfstechen beginnen. Zur Vornahme der Entwässerungsanlagen, werde ich demnächst mit zwei Vorarbeitern, Jäger und Vugel, nach Sourbrodt kommen, um das nötige Terrain von der Gemeinde anzukaufen und die Vennwiesen für die weitern Kulturzwecke bearbeiten zu lassen. Gleichzeitig möchte ich Ihnen meine Pläne zur Errichtung von Feldziegelöfen vorlegen, um auch mit dem gegrabenen Lehm praktische Versuche zu machen. Das sind kleine Ursachen, aus denen große Wirkungen erstehen sollen. Es müßte sich aber in jeder preußischen Provinz je eine Genossenschaft für gemeinschaftliche und gemeinnützige Arbeit bilden, welche den Adel der Geburt, des Vermögens und Geistes umfaßt und sich mit ihren speziellen Kulturaufgaben der alleinmöglichen Direktive von Berlin aus fügt, sich auch der Anlage des von dort aus führenden großen Mittelland-Kanals anschließt und somit in einem Zeitraum von nicht mehr denn 28 Jahren das machtvolle Werk der allgemeinen Landeskultur vollenden hilft. Eine große und schöne Aufgabe, die nicht nur durch Unterstützung aller landwirtschaftlichen und industriellen Vereine, Handelskammern, Moorkultur- und Schiffahrtsgesellschaften gefördert wird, sondern geradezu in unseren bescheidenen Entwürfen, die wir auf den öden Vennrücken zeichnen, seine Operationsbasis sieht. Und dabei rechne ich auf die Hilfe und die Erfahrungen eines Mannes – und dieser sind Sie, Herr Gièt. Bleiben Sie begeisterungsfroh, bis ich komme und das Feuer weiter schüre«.
Eine Weile, sieht Alexand noch auf die steile, markige Schrift, möchte sich an den machtvollen Ideen berauschen und vermag es nicht. Einmal hat auch er geträumt von der Kleinarbeit der Bauern, die eingreifen soll in das große Kulturwerk, über dem Venn sah er die sanfte Morgenröte der neuen Zukunft. Die begeisterungsfrohen Ideen hatte er sich heimgeholt aus der Stadt der Intelligenz. Seine tiefe Heimatliebe durchwärmte sie mit dem Feuer der Ausdauer. Er empfand es wie einen Schnitt am eigenen Körper, wenn sie aus den wallonischen Bergen hinauszogen und die Fremde priesen, weil die ihre Nährmutter geworden war. Da stieß ihm ein jauchzendes Wollen in die Brust. Er sah die unendlichen Weiten des Ödlandes vor sich. Warum sollten diese nicht zur Nährmutter ihrer Landessöhne werden?
Und einmal auch träumte er von dem Haus im Venn, das auf festem Fundamente stehe, mitten in der Morgenröte! Glanz von außen und innen! Und aus dem Schornsteine flutterte der Rauch, denn am Herde stand eine – vielleicht sang sie – – – –
Er knittert den Brief zusammen und steckt ihn ein. Ein Bauer träumt nicht. Der geht über die Scholle gebückt wie der Qwèrin mit seinem runden Arbeitsrücken. Und wenn einmal ein Bauer zum Träumen kommt, ist es ihm zum Unheil. Das weiß er jetzt. Aber das Sehnen bleibt und brennt in ihn hinein wie der Torfbrand, der nun schon seit Wochen langsam weiterglimmt und tiefer und tiefer in den Boden hineinfrißt. Wenn ein Funken daraus in die Rohrkolben und Binsen fährt und eine züngelnde Flamme hinüberwirft in die dichten Reihen der Buschkiefern, dann wütet ein Torfbrand verheerend los, und er denkt an Oberst von Gieses Frage: »Welches ist das Signal für Ihre Sprechstunde?« und an seine Antwort: »Wenn Sie das Venn brennen sehen.«
Aber sein Blick nach der Qualmlinie hinüber ist sorgvoll. Er wartet immer noch auf den Regen, der in den Glutboden niederzischt. Ein stoßweise erfolgender Wind kündet ihn an. Der rast in die Weiden und Birken hinein, reißt die Knospenspitzen von den Zweiglein herunter, jagt dem Qwèrin den schlappernden Filz vom Kopfe und wirft ihn zerbeult in den Tümpel mitten in die Laichkräuter. Die feuchten Luftwellen wirbelt er auf und tost übers Venn und faucht in den Glutherd, daß die Funken wie Feuergarben aufstäuben.
Da kommt einer durchs Moor gestampft, kämpft pustend gegen den Wind an und drückt den Hut mit beiden Händen ein. Auf der Höhe bleibt er stehen und schaut in den weiten Umkreis. Vor ihm dacht sich das Moor zu sanftem Abhange ab. Der Mann beschattet die Augen mit der Hand. In der weißen Luft taucht ein ferner, schwarzer Punkt auf, und den Abhang herauf steigt ein ganzes Schattenspiel im schleierlichten Nebel. Allmählich und wie aus der Tiefe heraus erklimmt es den leichtgebogenen Vennrücken. Zuerst ein gehörnter Kopf, ein langgestreckter Rumpf und ein zweiter, jetzt schon die Umrisse eines Pfluges, ein Landmann dahinter, der alles überragt! Der Wind trägt das Knirschen der eisernen Pflugschar zu ihm her. Der Ankommende pfeift zu dem Pflüger hinüber.
Der sieht flüchtig auf, treibt die Ochsen durch einen Zuruf an und kommt pflügend näher. Als die Furche zu Ende gezogen ist, wirft er den Pflug herum und überläßt ihn Qwèrin; dann schiebt er die Mütze in den Nacken, trocknet sich die Stirn und geht dem Dörfler entgegen.
» Luk vola, du Speckschwarte!«
Der junge Fabrikarbeiter mustert ihn kritisch.
»Also 'n richtiger Vennbauer. Weißt Du auch, Gamin, daß ich schon in Aachen von Dir gehört hab'? In der Zeitung hat's gestanden. Das Venn wollten sie beackern, Herren aus Deutschland seien gekommen, und ein Sourbrodter habe schon ein Haus im Venn gebaut. No, dacht' ich, da mußt 'rauf, und hier bin ich!«
Alexand deutete mit dem ausgestreckten Arm hinüber.
»Da steht das Haus im Venn, keine Torfhütte mehr, aber klein ist's noch immer; für mich braucht's nicht größer zu sein,« und dann hastig ablenkend, »wie gefällt Dir's noch in Rote Erde?«
»Gar nicht gefällt's mir. Sie haben mich kaltgestellt. Hab' da 'n Schlägerei mit einem Polacken gehabt und hab' mich geärgert und gab mich ans Saufen; 'n ganze Woche blau gemacht. No, und dann flog ich!«
»Und jetzt bist ohne Stellung.«
»Seit zwei Wochen schon. Ich laufe 'rum und find' nix, und jetzt hab' ich kein Geld mehr und muß heim zu meinem Alten. No, ich hab's satt, das kann ich Dir sagen, Alexand.«
»Wenn's mit Deiner Fabrikherrlichkeit jetzt aus ist, kannst es wieder mit der Landwirtschaft versuchen, hai?«
»No, geh mir vom Leib damit. Mein Alter hat noch zu wenig Arbeit für sich. Was ist denn hier für'n Ackerwirtschaft? Nix ist hier los. Soll ich taglöhnern? Abin merci!«
»Ich könnt' einen wie Dich hier brauchen.«
»Sapristi! Das wär' grad' nur, um meinem Alten aus der Kost zu kommen.«
»Zuerst bloß darum; nachher steckst Du Dir 'n Stück Ödland ab und schaffst Dir ein kleines Anwesen. Dann bist ein Bauer und 'n freier Mann und brauchst Dich nicht in der Fabrik schikanieren zu lassen. Ich hab' Dir's gleich gesagt. Wir wallonische Bauern können nirgendwo sonst aufkommen. Wir sind nicht wie die anderen, wir sind freier. Das Venn macht so. Da sehen wir kein End'.«
» Bin, hör' mal. So mir nichts dir nichts kann man doch hier oben nicht pflanzen, qwai?«
»Mir nichts dir nichts kommst nirgendswo zu etwas. Bleib' nur 'mal 'n Zeit hier oben, dann willst nicht mehr runter.« Er faßt den Schulfreund an beiden Schultern, »hör', Speckschwarte, schlimmer als Du jetzt bist, kannst im Venn nicht werden. Überleg' Dir's und versuch's. Es wird noch manch einer kommen. Da sind noch ein paar Türken in der Welt draußen. Die müssen auch wieder heim. Wenn die erst unser Anwesen blühen sehen, kommt ihnen auch die Lust.«
Speckschwarte denkt nach.
»So 'n Vennkolonie möcht'st hier oben einrichten, bin! Schad' ist's nur, daß der rote Krümmel und der Sauhirt ausgewandert sind. Wenn die aus'm Venn hätten 'n Stück Land ackern können, wär's ihnen lieber gewesen.«
» Luk, da kommst schon auf gute Gedanken. Da! sieh' Dir mein Haus an, 's muß noch austrocknen. Nachher gehst zu Deinem Vater 'runter und sagst ihm Bescheid.«
Sie schlagen beide den Vennpfad ein, und Qwèrin zieht die letzte Furche.
Inzwischen ist der Wind heftiger geworden und wirft sich polternd gegen die Wände des Hauses, als wolle er sie eindrücken, faucht in den Torfbrand und bläst ein lichtblankes, hüpfendes Flämmchen an. Und dem ersten tänzelt ein zweites nach, und ein drittes huscht ins Gestrüpp; und dann ein toller, flimmernder Flammenreigen! Sie umarmen einander in zärtlicher Glut, wirbeln über- und ineinander, flüstern sich brennende dämonische Worte von Verwüstung und Unheil zu, und ein verschwiegenes Knistern und Rascheln läuft durch das Glutmeer, zischt wie Raketen in den nebligen Dämmer des Vennabends und malt einen feuerroten Streifen hinter die dunklen Grenzlinien des Horizontes.
Das Venn brennt!
In der Dorfstraße sammeln sich die Bauern.
Der Flammenschein lodert. Die Wolken säumen sich rot. Hinter der himmelhohen Nebelwand leuchtet transparent eine Fata Morgana von Feuerbergen und farbenglühenden Tälern. Glutstarrende Wälder mit goldflimmerndem Laub! Auf hinschlängelnden Landstraßen aufwirbelnder Funkenstaub! Und dahinter das tote Dunkel des Venn!
Über das Moorhaus fallen die Abendschatten. Alexand zimmert an einem Axtstiel und sieht den Flammenschein nicht. Die Schläge hallen kurz und stumpf aus der Stube in den pfeifenden Wind. Der fegt messerscharf über die Hochebene hin und schlägt mit lautem Knall die angelehnte Haustüre zurück. Ein feuchtes Gesprenkel spritzt herein und Alexand in den Nacken. Da dreht der sich um und sieht jemand in der Türe. Ein nasser Frauenrock flattert gegen den Türpfosten. Aufgestöbertes Haargeringel um ein wirres, bleiches Gesicht! Ein schnelles, kurzes Atemholen, ein Herausächzen unzusammenhängender Worte.
»Da sind sie – die Bauern!«
Ein Windstoß wirft sie gegen die Türe. Die Bretter knarren. Da erst kommt Alexand aus seiner Erstarrung, läßt die Axt fallen und holt das halb ohnmächtige Mädchen herein. Auf die Torfbank legt er Decken und Stroh, setzt sie darauf und stellt ihre Füße in den Glutschein der Feuerstelle.
Und dann steht er vor ihr, bis zum Halse hinauf festgeschnürt und sinnt, was er sagen könne. Ihr Kopf liegt gegen die Wand zurück, ihre Augen sehen ihn weit offen und in jähem Schrecken an.
»Sie kommen!« stößt sie wieder angstvoll heraus. »Das ganze Dorf ist zusammengelaufen. Wenn die Dich hier finden –! Geh', versteck Dich im Venn!« Und als er noch immer dasteht und auf sie starrt, drängt sie ihn fort. »Geh', lauf' zum Vennbauer 'runter, ins Heu versteck Dich. Guter Gott! lauf doch!«
Da reckt er sich und die Arme stemmt er auf die Hüften.
»Wo werd' ich denn aus meinem eigenen Haus 'rauslaufen? Mein Anwesen laß ich nicht im Stich. Das hab' ich groß gezogen wie 'n Mutter ihr Kind. Und die werden's mir wie's liebe Vieh niederstampfen, wenn ich nicht dableibe.«
»Was willst Du denn ausrichten gegen 'n ganzes Dorf? Sie fallen über Dich her, verlaß Dich drauf – und ich bin umsonst 'raufgekommen durch Wind und Regen.«
»Ja, ich glaub', das war umsonst.«
»Alexand, ich kann's nicht mit ansehen,« sagt sie leise.
»Darum eben hätt'st drunten bleiben müssen!«
Da fährt sie auf und schüttelt ihn an den Armen und zischt ihn mit erstickter Stimme an:
»Und wenn ich gestorben wär' vor Angst und Leid? Die Höll' ist drunten für mich! Du kannst kaltblütig hier oben Deine Kartoffeln großziehen und läßt Dich einmal fortschicken und kommst nicht wieder. Dein Stolz geht über die Lieb'! Ich hab' mich zertreten lassen, bis ich keinen Stolz mehr hatte, aber die Lieb' hatt' ich noch. Die ging über meinen Stolz! Jetzt hockst Du droben, ich hock drunten, und alle zwei können wir nicht so leben – Du droben, ich drunten! Aber ich muß 'raufkommen zu Dir, ich muß auf den Knien vor Dir rutschen, und betteln muß ich darum, was Du mir hätt'st nachtragen sollen auf beiden Händen – Deine Lieb'! Bon diu (Lieber Gott)!« sie drückt die Fäuste wider die Stirne, »bin ich denn nur dazu da, um von Euch – Euch Giètbauern zerrieben zu werden!«
»Gètrou, was sprichst Du?«
»Rühr' mich jetzt nicht an. Denk' an Dich! Versteck Dich! Hörst denn nicht, sie kommen!«
Sie stemmt ihm die Hände wider die Brust und drängt ihn fort.
»Jetzt tu's doch!« jammert sie in hellem Weinen, »tu' doch einmal, wie ich will! Du hörst ja, in einer Höll' leb' ich! Willst mich denn noch tiefer ins Elend bringen?«
»Dich, Gètrou? Dich ins Elend? O mi binamé (O, meine Geliebte)! Die Lieb' trag' ich Dir jetzt nach auf den Händen, die Lieb' ohne Stolz! Schlag' den Giètkopf mit Deinen Fäusten weich, schlag' ihn in Stücke! Gètrou, Du kannst aus mir machen, was Du willst. Mach'n Glücklichen aus mir! Gelt, Gètrou, jetzt bist zu mir gekommen, um nicht mehr von mir zu gehen?«
Er hält ihre beiden noch immer zur Faust geballten Hände, löst sanft ihre Finger, streichelt ihr über den Handrücken und legt ihren Arm um seinen Hals und sachte den andern; und nun schließt sie diese Arme fest und fester um ihn und preßt ihn an sich und schluchzt ihre gequälte, stürmische Liebe heraus.
»Alexand, nun halt' mich! Nun denk' dran, daß Du zu mir stehen mußt für's ganze Leben!« Mit erhobenen Händen beschwört sie ihn, »wenn Du noch 'was weißt, was zwischen uns kommen könnt', dann laß mich jetzt gehen – für alle Zeiten von Dir! Küß' mich nicht, Alexand! Wenn Du das einmal getan hast, können wir nicht mehr von einander, das wär' 'n Gelöbnis, Alexand, – das wär' 'n Eheversprechen, Alexand!«
In seinem Kuß erstickt ihr Ruf.
»Das ist 'n Gelöbnis! Das ist 'n Eheversprechen!« sagt er fast feierlich, und ein glückliches Schweigen eilt mit Geisterschritten durch den Raum.
Der Regen plantscht wider die Wände und malt feuchte Linien in den Mörtel. Der Sturmwind rattert im Dach und wirft klatschend einen Ziegel zu Boden.
»Siehst den Feuerschein? Das Moor brennt?« fragt sie.
»Hörst die Stimmen draußen?« fragt er. » Luk, Gètrou, mit der Flinte wollt' ich zu den Bauern 'naus, 's wär' mir auf etwas Gewalttätiges nicht angekommen, jetzt nehm' ich nicht 'mal 'n Stecken mit – Du hast mir ja den Giètkopf zerhauen, jetzt bin ich ein anderer.«
»Meinst denn, ich ließ Dich allein gehen?« Ihre Augen blitzen ihn an. Ein unvernünftiger Wagemut überkommt sie. »Es gibt noch 'n paar Sourbrodter, die machen 'n Umweg an mir vorüber, und die sind jetzt auch dabei.«
»Es sind auch welche dabei, die noch 'n Stein nach Dir werfen möchten. Halt Dich still, wenn's not tut, kannst immer noch wie'n Katz' dreinfahren.«
Er eilt hinaus. Durch die Türspalte lugt sie ihm nach. Aber wie sie ihn davongehen sieht, reckenhaft, selbstbewußt, die Hände im Gürtel, die Moorstiefel über's Knie gezogen, da hat sie eine stolze Beruhigung. Den bellen wohl die Hunde an, aber sie beißen ihn nicht, – und dem darf jetzt die Krebsenmattestochter in Lieb' und Treu zu eigen sein!
In den heulenden Wind hinein ruft sie ihm einen jubelnden Laut des Glückes nach.
Die Gruppe der Bauern hat sich abgezweigt. Einige jagen dem Brand zu, andere wollen in ihrem Groll nach der Vennhütte. Denen kommt Alexand entgegen und – mitten unter sie.
»Jetzt sind wir's müd' mit Dir, hörst Du!« poltert ihn Frè Thoumas an. »So lang' Du auf Deine Rechnung verrückt warst, konnten wir's ruhig zusehen, aber jetzt willst an unseren Geldbeutel. Unser Torfvorrat ist verbrannt, und zwei Jahre lang haben wir hier keine Schaftrift mehr, 'n Schand' und Sünd' ist's!«
»Das Haus stecken wir Dir in Brand!«
» Aie, stampft ihm seinen Acker ein! Der soll's jetzt am eigenen Leib fühlen!«
Sie drängen an ihm vorüber mit furchtbaren Drohungen, aber handgreiflich werden sie nicht. Was der Wallone mit der Zunge abmachen kann, spart er an den Armen.
» Halté-là!« ruft Alexand und reißt ihn zurück, »wenn einer Schaden durch mich hat, ersetz' ich's! Ein Giètbauer läßt sich nix schenken!«
»Oho! Jetzt bist wohl ganz verrückt?«
»So'n großartiger Manschettenbauer! Ein Maul voll Worte und weiter nix!«
»Du da, Weißschnabel! Dir schlag' ich 'n Auge blau!«
»Ffft! Nehmt ihn beim Wort!« Der junge Speckschwarte drängt durch die Reihen, »der Alexand sagt Euch Schadenersatz zu, nehmt's an, nehmt's an! Die Giètbauern haben's ja. Und daß Ihr's wißt, ich,« er schlägt sich mit der flachen Hand wider die Brust, »ich bleib' jetzt auch im Venn und baue mir 'n Acker oder zwei. Der Alexand ist dreimal klüger als Ihr von Sourbrodt. Ja, lacht nur! Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Warum kommen denn die reichen Herren von auswärts und wollen ihr Geld ans Venn hängen? Die sind doch auch nicht auf den Kopf gefallen.«
»Wir haben noch keinen Groschen von ihnen gesehen!«
»Dann werdet Ihr's jetzt!« Alexand zieht das Schreiben Gieses aus seiner Tasche und übersetzt ihnen den Inhalt. »Es ist so etwas wie 'n Vertrag mit Oberst von Giese wegen unserm Torfstich. Eine Fabrik läßt der bauen und eine Ziegelei. Da könnt' Ihr Eure Jungens einstellen und braucht sie nicht mehr aus'm Dorf zu lassen. Luk, so muß man Euch mit der Nase draufstoßen, was Euch zum Nutzen ist.«
»Hm,« sagt Frè Thoumas, »komm' Sonntag ins Krebsenhaus. Da kannst uns 'mal die Sach' explizieren.«
Ein paar Schreier aber knodern.
»Wir sind nicht 'raufgekommen, um hier im Regen zu stehen. Die andern löschen schon. Hört Ihr sie rufen? Sapristi! Los!«
» To dou (sachte)!« ruft Alexand, »was jetzt brennt, braucht im Frühjahr nicht angesteckt zu werden!« Aber er geht doch mit ihnen zum Löschen, um sie nicht von neuem zu erbittern.
Mit der Heidehaue sicheln sie das meterhohe Ginstergestrüpp. Die starren Ruten knoten sie zu Bündeln zusammen und schlagen damit die Flammen nieder. Es ist ein Spiel mit Feuergeistern. Die hüpfen wie Höllendämone zwischen den Ginsterruten durch, lecken an den gebückten Männern hinauf, schießen in Funkengarben auf und zerplatzen in Nacht und Rauch und dunkeln Qualm. Ein strömender Regen zischt und brodelt hinein, mischt den Kohlenstaub mit der schlammigen Erde und füllt die Bodenlöcher mit schwarzem Grundwasser.
Gegen Morgen sind die Flammen gelöscht. Der Rauch zieht in langen Strähnen durch die fallenden Nebel.
Alexand kehrt müde und hungrig zum Vennhause zurück. Aus seinem Schornstein steigt eine Dampfsäule. Da sprengt es ihm fast die Brust vor Glück und Sehnen.
Daheim wartet sie! Daheim! Ob sie auf dem Venn daheim sein will, – das muß er sie noch fragen.
»Gètrou!«
Sie schreckt von der Feuerstelle auf. Die ganze Stube ist angefüllt von dem Dunst gebratenen Speckes.
»Nicht 'mal 'n Pfanne hast hier,« sagt sie ihm über die Schulter herüber. »Hast 'n nette Wirtschaft da geführt. Zeit ist's, daß Dir' 'n Frau 'reinkommt.«
»Ja, darüber müssen wir noch übereins kommen,« erwidert er ernst.
Sie läßt erschrocken das Holzscheit aus der Hand fallen.
»Um Gotteswillen! Kommt jetzt noch 'was?«
»Von Dir hängt es ab, Gètrou.«
»Dann sag' ich gleich ja auf alles, verlaß Dich drauf.«
»Auch wenn ich Dich jetzt frag' ob Du hier oben bei mir bleiben willst für alle Lebzeiten? Im Venn, Gètrou!«
»Und kannst nicht drunten wieder wohnen?« fragt sie leise.
»Wer einmal im Venn gelebt hat, kann nicht mehr 'raus. Aber das begreifst Du nicht, weil Du's nie so schön gesehen hast, wie ich.«
»Ist's so schön?«
»Wie eben jetzt. Die Sonn' geht auf, da ist's am schönsten.«
»Dann zeig' mir's; vielleicht, wenn ich's 'mal durch Deine Augen sehe – –«
Sie stehen vor der Hütte. Sein Arm liegt um ihre Schultern, der ihrige um seine Hüften. Die Sonne fließt mit lichtgoldenem Schimmer durch den zerrinnenden Nebel. Auf dem schwarzen Moorgrunde schwimmen die gelben Sterne der Sumpfdotterblume, eine sternbesäete Au auf gurgelnden Sümpfen! Das Wollgras spinnt silberne Schleier in das leuchtende Grün der Binsen und Seggen. Rötliche Lichter brennen auf den Zweigenspitzen der Buschkiefern, die das Haus umstehen. Da geht durch das Schilf und die Rohrkolben ein Rispeln und Rauschen. Die träge, müde Moorstille schleicht um die Sümpfe, schaukelt in den Nebelwolken und hockt auf der branddürren Scholle der neuen Giètäcker. Wind und Sonne haben das Naß aufgesaugt, und goldene Strahlenfinger zupfen die Blütenknospen auf. Und hinaus in die Weiten der Hochfläche wogt und flirrt ein Meer von Farbe und Licht und loderndem Gold!
»Siehst Du das Venn?« fragt er ganz leise und drückt sie an sich.
»Jetzt hat's mich verhext,« nickt und lächelt sie ihm zu, »jetzt hab' ich 's durch Deine Augen gesehen. Meine Freud' und Lieb' trug ich in's Venn!«
Nun führt er sie zu seinen Ackern, zeigt ihr die Kartoffelblättchen, die aus der Erdscholle springen und die Saat, die grünen will.
Ein blühendes Land muß rund um sein Haus werden, ein neuer Gièthof! Ansiedler werden kommen und dem billigen Boden den Stempel der Fruchtbarkeit aufdrücken. Eine kleine friedliche Moorkolonie, ein versonntes Haus im Moor, und darinnen glückliche Menschen in der Stille und im Frieden!
Hoch im Mittag langen sie im Dorfe an. Der Giètbauer sitzt wieder im Lehnstuhl am Fenster. Da sieht er sie beide kommen mit sonnigen Gesichtern und die Hände zu festem Druck vereint. Aus seinem zerfallenen Gesicht weicht das stumme Gequältsein. Er hört sie mit hellen, freudigen Stimmen um sich reden und nickt und lacht – und lacht und schläft.
*
Hochsommer! Die Erntewagen schwanken durchs Scheunentor. Gewitterwolken in der weißen Luft! Mückenschwärme über den Wiesenbächen! Am Abend lärmen am Tümpel die Frösche. Dann kommt Alexand für eine Stunde oder zwei vom Venn auf den Hof, und dann steht immer schon am Eingang unter dem Bogen der Hainbuchenhecke Gètrou mit dem verlangenden Blick und der ständigen Frage:
»Was bleibst denn so lang, Alexand?«
An einem Abend aber kommt sie ihm schon auf der Landstraße entgegengelaufen und winkt:
»Besuch ist für Dich daheim, 'n ganze Stub' voll. Zuerst 'mal der Oberst –«
»Und dann der Irländer,« fährt er fort.
»Der kommt zuletzt. Zweitens einer aus Westfalen. Sie nennen ihn Jäger; drittens ein kleiner aus Mecklenburg. Der heißt mal komisch: Vugel! Gelt, so'n Name!«
Er ist ihr schon um einige Schritte voraus.
»Ist der Vater bei ihnen drinnen?« fragt er zurück.
»Freilich, wo anders? Sie schwatzen ihm den Kopf voll, und er lacht oder schläft oder fragt sie, warum sie denn eigentlich so viele in der Stub' wären, ob schon die Hochzeit sei, hörst, Alexand?«
»Ja, Gètrou.«
» Nenni, Du hörst ja nicht.«
Da ist er schon im Hause, und durch das Fenster sieht sie ihn in der Stube. Ein lautes, frohes Gerede, Stuhlrücken und dann Stille; einer spricht. Das ist der Oberst. Sie setzt sich auf die Bank vor das Haus und hört zu.
»Wir wollten morgen Ihre kleine Moorkolonie einsehen, Herr Gièt, Sie gestatten uns das doch?«
»Ich bin so stolz darauf, daß ich das ganze Dorf hinführen möchte.«
»Das wäre wohl vergebene Liebesmühe,« meint der Oberst nach seinen Erfahrungen.
»Jetzt ist's anders,« versichert Alexand. Die Vernünftigen kommen zur Einsicht. So war's auch mit der Bahn. Zuerst wehrten sie sich, nachher aber petitionierten sie, um den Bahnhof ins Dorf zu bekommen. Die Sourbrodter müssen's doch wohl glauben, wenn sie's sehen. Mein ganzes Anwesen blüht wie nur ihre besten Felder. Ich werde eine Ernte halten, die den ihren mindestens gleich kommt. Und das sind Moorfrüchte, Herr Oberst. Die brauchen den Vergleich nicht mit anderen zu scheuen. 10 Hektar hab' ich abgesteckt. Für'n selbständigen Betrieb hab' ich damit schon genug. Ein junger Ansiedler hat es droben neben mir mit'm Anpflanzen versucht. Der kann's übers Jahr zum Kleinbauer bringen.«
»Sie, Sourbrodter, Sie sind ein unheimlich korrekter Mensch,« ruft ihm der Irländer zu. »Da zeichnet er ins Venn eine regelrechte Kolonie, läßt die Menschen reden und freut sich an seinen Kartoffeln. Wenn mir die Menschen dreinreden, irritiert das meine Nerven. In Faymonville haben sie mir sehr meine Nerven heruntergebracht, sie reden wie die Papageien. Zum nächsten Karneval wollen sie meine Goldwäscherei darstellen. Abgeschmacktheit! Sourbrodter, Sie müssen mir helfen, wenn das gedeihen soll!«
»Alles hübsch nacheinander,« wehrt der Oberst, »an Ihr Werk sollen wir auch schon herankommen. Vorerst interessiert uns mehr das Wirtschaftliche. – Ich höre, die guten Dörfler wollten Ihnen einmal ihr Haus im Moor in Brand stecken. Alle Achtung vor Ihren Erfolgen, aber mit dem Torfbrand haben Sie eine Dummheit gemacht.«
»Es ist mir sehr lieb, daß der auch 'mal eine Dummheit machen kann,« schaltet der Irländer ein.
»Ich weiß schon, was Sie sagen wollen,« nickt Alexand, »es ist die bequemste Art, das Moor zu brennen und es dadurch urbar zu machen.«
»Ich bitte! Es ist gradezu ein Raubsystem, und ein geordneter wirtschaftlicher Betrieb kann durch das Moorbrennen auf die Dauer nicht zustande gebracht werden. Diese sogenannte Moorbrennkultur arbeitet mit den einfachsten Mitteln. Die oberste Moorschicht wird entwässert, und im Frühjahr zu Asche gebrannt. In diese hinein werfen Sie die Saat, gut! Das können Sie höchstens sechs, sagen wir acht Jahre lang wiederholen, dann gibt Ihnen der Boden ohne Düngung nichts mehr. Was nun? Der Boden bleibt ohne Kultur liegen, und die Heideschicht wächst erst nach 30-40 Jahren wieder an. Sehen Sie, so kann Ihnen Ihr Vorgehen für Ihre Moorkolonie verhängnisvoll werden.«
»Ohne Düngung hätt' ich auch jetzt nicht weiter kommen können, Herr Oberst. Ich bin nur gespannt, wie Sie sich die Sache anders denken.«
»Aus mir selber wäre ich wohl zu dieser Sachkenntnis nicht gekommen. Ich habe keine Gänge gescheut und bei kompetenten Personen auf dem Gebiete der Moorkultur Nachfrage gehalten. Und nun will ich Ihnen in Kürze mein Programm entwickeln. Wir kaufen Ihr Torflager an. Nach Ausbeutung desselben zu Preßtorf, Torfmull, verwenden wir auch die darunter liegende Lehmschicht in der noch zu errichtenden Ringofenziegelei. Das ist der erste Schritt; der zweite wichtigere ist, das ausgetorfte Land zu kultivieren, und damit können wir nur Ihre Nachahmer werden. Durch Verwertung der dünnen oberen Humusschicht und Vermischung mit Abfällen hoffe ich, den Schieferboden hinlänglich wieder zu bedecken und ertragfähig zu machen. Wir können uns also in die Hände arbeiten. Meine zwei Vorarbeiter habe ich gleich mitgebracht, eingeschulte Leute und echte Moorratten. Aber ich sehe, an meinem Plan gefällt Ihnen etwas nicht.«
»Ja, mir als Wallone nicht. Ich bin kein Fremdenhasser, aber ich hab's mir nun einmal in den Kopf gesetzt, daß das Venn von Einheimischen bebaut werden soll. An Ihrem Plan, Herr Oberst, gefallen mir Ihre Vorarbeiter nicht – ich meine, insofern sie hier als Aufseher bleiben sollen.«
»Hören Sie einmal zu, Sie junger Meister Gièt. Es lebt da irgendwo ein Wohltäter der Eifel, dessen dringender Wunsch ist, unbekannt und ungenannt zu bleiben. Nun, Sie kennen ihn, Sie mußten ihn kennen lernen, Geheimer Kommerzienrat Gruson aus Buckau-Magdeburg. Unter seiner Mitwirkung gründete ich diese erste »Genossenschaft der Wohltätigkeit und Nächstenliebe«. Sie soll ein leuchtendes Beispiel für ähnliche gemeinnützige Unternehmungen werden. In allergnädigster Weise hat auch Seine Majestät der deutsche Kaiser der Gründung sein Interesse zugewandt. Unser Streben geht zunächst dahin, auf dem hohen Venn die gemachten Vorschläge praktisch zu verwerten und die dort gesammelten Erfahrungen auf die Kultur aller norddeutschen Ödländereien in Verbindung mit dem bis zur holländischen und russischen Grenze zu verlängernden Mittelkanal zu übertragen. Das ist die erweiterte Perspektive und der entferntere Zweck. Das Nächste und Hauptsächlichste resultiert aus unserer Devise: Wohltätigkeit und Nächstenliebe. Es versteht sich da von selbst, daß den ärmeren Bewohnern der Ödländereien der Arbeitsverdienst zugehen soll. Für das Venn kommen die nächstgelegenen vier wallonischen: Sourbrodt, Weyvertz, Ovifat, Robertville, und die drei deutschen: Nidrum, Elsenborn und Kalterherberge in betracht, und zwar sollen im Winter etwa 70 Arbeiter mit einem Tagelohn von 1,50 Mk. bis aufsteigend zu 2,50 Mk. eingestellt werden, durch Akkordarbeit können sie es bis zu 3 Mk. bringen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, vielmehr ein wichtiger Punkt unseres Vertrages, daß unter diesen Leuten durch meine Vorarbeiter Aufseher herangebildet werden. Genügt Ihnen das?«
Alexand langt über den Tisch hin und ergreift von Gieses Hand.
»Mir braucht's ja nicht zu genügen; ich muß jetzt für die vielen andern reden, und die möchten Ihnen gewiß dankbar die Hand drücken, so wie ich's jetzt tu'.« Und dann lehnt er wieder mit der breiten Brust an dem Tischrand, stützt die Arme auf und redet in seiner ruhigen Weise weiter: »Sie werden trotzdem Mangel an Arbeitern finden. Die Witterung auf dem Venn ist ungünstig, der Boden naß. Der Vennarbeiter muß sein gutes Essen und bessere Kleidung haben, sonst hält er nicht stand. Ich weiß es, ich hab's durchgemacht bei 16 Grad Kälte im Winter, im Sommer unter anhaltendem Regen bei Nord- und Ostwind. Der geht scharf wie 'n Rasiermesser übers Venn. Herr Oberst, mögen Sie noch so viel guten Willen mitbringen, Sie müssen noch viel, viel mehr – Geld haben. Das Venn ist unersättlich und schluckt alles ein, Ihren guten Willen und Ihr vieles Geld.«
»Sie vergessen, daß Herr Gruson nicht nur Finanzpotentat, sondern Wohltäter sein will. Die lautere Freigebigkeit hat immer offene Hand. Außerdem habe ich die feste Überzeugung, daß deutsche Kapitalisten unser Unternehmen unterstützen.«
»Rechnen Sie auch da auf die lautere Freigebigkeit oder wirft sie hohe Renten ab?« fragt der Irländer interessiert.
»Auf das Erstere, lieber Freund. Diese Kapitalisten müssen sich mit der allerdings mäßigen Rente von 4 Prozent begnügen.«
»Dann werden Sie in Deutschland nicht Ihre Kapitalisten zu suchen haben,« meint der Irländer und legt sich in den Stuhl zurück.
»Aber im Gegenteil!« eifert der Oberst, »in Deutschland besitzen wir nachweislich reichlich vorhandenes Geld.«
»Sie mißverstehen mich. Ich meine, die lautere Freigebigkeit wird Ihnen das deutsche Kapital nicht ausliefern.«
»Ich bin der festen Zuversicht, daß das Vorbild des »unbekannten Wohltäters der Eifel« seine Nachahmer findet.«
»Die Geldsache ist keine Gemütssache, Freund Oberst.«
Da wirft sich Herr von Giese in die deutsche Mannesbrust. In seine tief sonore Stimme vibriert der Soldatenstolz des ehemaligen Regimentskommandeurs.
»Mein Herr, Sie haben nicht unter der Flagge des deutschen Kaisers gedient, darum wissen Sie nicht, welche Opfer das Vaterland fordern darf – und hier gilt es dem Wohlstand des Vaterlandes!«
Der Irländer poliert mit dem Daumennagel seine Fingerspitzen, und das will heißen: er erwidert nichts aus Höflichkeit!
Ruhiger fährt der Oberst fort:
»Ich habe ja auch keinen Augenblick gezögert, als es galt, die Salonstiefel des einstigen Prinzessinnentänzers mit den hohen Transtiefeln der Sumpfbewohner zu vertauschen, angenehme, gesellige Verhältnisse der süddeutschen Residenz im Garten Deutschlands zu verlassen, um mich und meine Familie dem ungewohnten Ardennenklima zwischen Jammertal, Sourbrodt und Kalterherberge auszusetzen. Und warum diese Hintenansetzung der Gesundheit, der persönlichen
unleserlich …
Wünsche, diese
und körperlichen Kräfte, um mit
keiten und nicht zum wenigsten mit
Undank zu kämpfen? Aus Eigennutz
Denn wenn durch Staatsdomänen in
dern, die durch Gefangene bebaut werden,
eine zweiprozentige Rente erzielt wird,
sich da spekulative Absichten verwirklichen?
Kapitalisten muß aber der weitere Punkt
… bis hierher???
gramms maßgebend sein, daß eine gleichzeitige und gleichmäßige Inangriffnahme der Kultur, der Kanalisation und Kolonisation aller norddeutschen Ödländereien und der armen Gebirgsgegenden ins Auge gefaßt ist. Der Einzelne fügt sich als kleine unentbehrliche Triebfeder in die große Maschine ein. Die zersplitterten Kräfte formen sich zu dem machtvollen Ganzen, und so wird durch das einheitliche Ineinandergreifen und die gegenseitige Unterstützung die »Allgemeine Wohlfahrt« tatkräftig gefördert; und, meine Herren,« der Oberst ist aufgesprungen. Über sein bärtiges Gesicht zuckt die Erregung tiefer edler Begeisterung, »lassen Sie den idealen Gedanken in seiner ganzen Größe und Ausdehnung sich gestalten. Nicht bloß die öden Gegenden, auch ganz Norddeutschland würde gewinnen: die Städte, die Landwirtschaft, die Industrie, Handel und Verkehr! Und damit wäre auch die friedliche Lösung der sozialen Frage in der einfachsten und natürlichsten Weise gefunden, indem auf diesem Gebiete schwerer, vielleicht freudloser Arbeit die Scheidung gemacht werden könnte zwischen Arbeitswilligen und Arbeitsscheuen, also solchen, die nach Arbeit schreien, weniger der Not als des Skandals – wegen. Ich bin überzeugt, daß die großen Kulturaufgaben den Wünschen aller Ministerien, aller politischen und religiösen Parteien sowie aller Menschenfreunde und wahren Patrioten entsprechen. Warum denn zögern? Warum nicht durch solche gemeinnützige Arbeiten dem Notstande dauernd vorbeugen? Die volkswirtschaftliche Zukunft liegt hinter schweren Gewitterwolken. Es ist das graue Elend als Massenerscheinung, gegen welches der moderne Staat durch eine wirksame Gesetzgebung Front machen muß. Dieser staatlichen Hilfe soll die korporative beispringen durch gut organisierte Wohlfahrtsbestrebungen, solche – wie es der Zweck unserer Gründung ist – welche dem wirklich Arbeitswilligen Raum und Möglichkeit verschaffen, den Kampf ums Dasein in ehrlicher wenn auch schwerer Arbeit auszukämpfen. Und das Gefühl moralischer Verantwortlichkeit, das in solcher Tätigkeit liegt, wird ihm gegeben durch Realisierung unseres Wahlspruchs: Zur Ehre Gottes! Zur Freude des Kaisers! Zum Wohle des Volkes!« Er beugt sich zu Alexand hinüber: »Herr Gièt, hier meine Hand! Schlagen Sie ein – auf zu gemeinsamer Arbeit in diesem Sinne!«
Alexands Stuhl scharrt zurück. Mit leuchtenden Blicken steht er vor dem Oberst und preßt seine Hand.
»Zu gemeinsamer Arbeit!« wiederholt er feierlich. Seine Brust geht heftig. Eine Weile stummer, innerer Bewegung, dann tritt Alexand vom Tisch zurück zum Lehnstuhl Meister Gièts hinüber.
»Es wär' mir lieber, wenn ich die Sach' vorher noch mit meinem Vater besprechen könnte. Von dem Reden um ihn wird er nicht viel Gescheites verstanden haben. Das macht ihn wirr, gelt Vater?«
Er tupft dem Alten auf den Arm. Dem glühen auf den mageren Wangen die roten Fieberflecken, die Mundwinkel hängen herab, die zitternden Hände tasten auf der Sessellehne.
»Schick' die Hochzeitsleut' heim!« flüstert er Alexand zu.
Der Oberst hat sich leise mit dem Irländer besprochen und sagt jetzt:
»Bis Sonntag werde ich noch gehalten sein. Sehe mich ohnehin noch etwas in Malmedy um, da ich dort zu wohnen gedenke. Setzen wir unsere nächste Zusammenkunft also auf Sonntag fest.«
»Einverstanden!« ruft der Irländer. »Bedinge mir aber aus, daß sie in meinem Hause stattfindet, und meine Daisy Ihnen den selbstgebackenen Kuchen vorsetzen darf. Ich sehe, wenn ich nicht meine Angelegenheit auf die Tagesordnung bringe, fällt sie unter den Tisch.«
»Suchen Sie immerzu nach Ihrer Goldader!« erwiderte der Oberst mit gutmütigem Spott. »Ich habe noch nicht das richtige Vertrauen auf die Rentabilität Ihres Unternehmens. Also, mein Lieber, suchen Sie, suchen Sie!«
Nun rückt der Irländer näher zu ihm, schickt mit dessen Erlaubnis die Vorarbeiter hinaus und beginnt eine lebhafte Auseinandersetzung. Anntschenne räumt den Arbeitern die Küchenbank und versucht sich in ihrem fast vergessenen Deutsch mit verlegenem Lachen und vielen Entschuldigungen. Das Gespräch aus der Küche und das aus dem Stubenfenster vermengt sich zu einem Stimmengewirr, und Gètrou versteht nichts mehr.
Durch den Dämmer des Abends sieht sie den Krebsenmattes herüberkommen. Der hört das laute Gespräch auf dem Hof, flucht und bleibt stehen.
»Was willst denn?« fragt Gètrou herüber. Da kommt er mit großen Schritten und setzt sich neben sie.
»Mit dem Alexand müß't ich doch noch mal sprechen, ich, als Vater, mein' ich.«
»Was wär' noch zu besprechen?«
» Bin, für Dich ist jetzt gesorgt, gut gesorgt. Ich kann also darüber beruhigt sein. Wenn der Alexand Dich 'mal geheiratet hat, dann wird er mir lieber auf'n Rücken als ins Gesicht sehen. Das weiß ich, das sagen sie mir alle im Dorf. Darum möcht' ich's jetzt gleich mit'm abmachen. Ich möcht 'n neues Dach aufs Krebsenhaus haben. Das wird manierlicher aussehen, wo doch jetzt bei den vielen Fremden und wegen den Fabriken das einzige Wirtshaus im Dorf in guter Reputierlichkeit bleiben muß. Ich mein', das müßt' er schon tun wegen der Verwandtschaft.«
» Aie, Vater, er wird's wohl tun.«
» Adon! Wie steht's mit'm Getränk zur Hochzeit? Das liefere ich doch, versteht sich.«
»Willst drei Doppelte dran verdienen, und 's Bier wird sein, daß man's einem Esel ins Ohr schütten muß, hai?«
Da rückt der Krebsenmattes gekränkt von ihr weg.
»Jedermann hat sein Ehrgefühl. Du hast jetzt die Giètehr', aber meine als Wirt hab' ich auch. Ich weißt was ich mir schuldig bin, und vorab jetzt! Gleich hat's 'n andern Anstrich, wenn's heißt: Der Krebsenwirt ist der Schwiegervater von Gièt's. – Sapristi! Das hast alles mir zu danken. Wenn ich nicht dahinter gewesen war', hätt'st Dich wie'n Spüllumpen hinauskehren lassen. Respekt muß man sich verschaffen. – Ich hab' mir 'n neuen Anzug in der Stadt bestellt, mit so 'nem Kittel geht's nu' mal partout nicht mehr.«
»Wird das alles auf die Giètrechnung gesetzt?«
»Pfui dä! Wie knauserig!«
»Ich sag' Dir's bloß. Der Alexand ist keiner, der mit sich spaßen läßt, das weißt doch. Sehr gescheit tät'st aber, wenn Du Dir den Michi aus'm Hause schaffst, sonst kommt kein ordentlicher Mensch zu Dir 'rein.«
»Wo denkst Du hin? Den Michi hab' ich 'rausgeworfen, den Söffer! Das bin ich mir schuldig. Der Pékèt frißt dem die Gedärme auf, pfui dä. Ich trinke jetzt Bier, ich kann's ja.«
In der Stube Stuhlrücken. Gètrou springt auf.
»Jetzt wär's mir lieber, Du gingst. Die Herren kommen 'raus.«
»Brauchst Dich mit mir nicht zu schämen, ich mach' was aus, so'n richtiger Bauer bin ich nicht.«
»Deswegen ist's nicht; aber wenn der Alexand kommt und gleich wieder auf's Venn muß, dann – .« Die Röte läuft ihr bis ins Stirnhaar.
» Ah sicola! Dann wollt' Ihr Euch in'n Eck setzen und die andern zum Sankt Jakob nach Galizien schicken. Bei Dir muß es komisch aussehen, wenn'st so versimpelt lachst und gar so lieb und buttersahmig tust. Abin, ich bin kein Spielverderber, adjüs. Denk' ans Dach und ans Hochzeitsgetränk, adjüs!«
Er stapft zum Hofe hinaus. Sie schlüpft um die Hausecke, wartet und neckt und läßt sich suchen und krümmt sich vor Lachen Über den großen, läppischen Giètsohn.
*
Das Dorf liegt im fahlen Glanze des Spätherbstes.
An dem First des Krebsenhauses flattert und raschelt ein bebänderter Zweig. In der Stube ein Gedränge von dunklen Joppen und grellfarbigen Frauenröcken. Ein Juhschrei und Gelächter hintennach. Da guckt der Küster herein.
»Sappermenter Ihr! Man hört's bis in die Kirch'!«
»Horilahoi! Die Türken!«
Die schieben ein verschämtes Paar mit Ellbogenstößen und derben Späßen herein.
» Vive lu maisse jône homme! – Vive Iu maisse jône feie!« Hoch der Meister Junggeselle! Hoch die Meisterin Jungfrau! (Vorbräuter und Vorbräuterin.)
Ein wirrer Stimmenlärm schluckt die Rufe ein. Man strebt durch das Gewühl und strebt dem Paare zu. Über den Köpfen gestreckte Arme mit vollen Biergläsern, und dann von der Küche aus ein Aufkrähen von Weiberstimmen.
»Sie kommen! Abeye! Abeye! (Hurtig)! Ihr Buben!«
Der Schwarm stößt hinaus. Der enge Kirchplatz steht gedrängt voll. Ein Mann ragt über alle hinweg. Das ist der Giètkopf, ein ernstes Gesicht, aber leuchtende Augen darin. Im Krebsenhaus steigen die Bauerfrauen auf das Fensterbrett.
»Du, Bâbe, was die Gètrou wohl für'n Gesicht macht?«
In die Kirchentüre hinein schlängelt die Menge. In der Vorhalle schaffen die Schießbuben freie Bahn für sich. Da sieht es aus wie in einem Arsenal. Flinten, alte und neue, mit langem und kurzem Lauf, lehnen zu Bündeln zusammengelegt an der Wand. Der Förster Klein steht im Sonntagsrock daneben, und um ihn in gespanntester Erwartung die Schießbuben. Ihre Blicke stieren in die Kirche hinein.
Das Brautpaar erhebt sich zum Opfergang um den Altar.
» Abeye!« Sie huschen hinaus.
»Gewehr auf!« kommandiert der Förster. Die Menschen um sie atmen nicht mehr. Die Menge staut, stockt – und eine lautlose Stille drinnen und draußen!
Die Augen hängen an der Reckengestalt des Bräutigams. Der hebt mit einer weiten Bewegung den Arm, und niederrasselt auf den Opferteller das protzige Talerstück.
Der Metallklang flirrt durch die dumpfe Kirchenluft hinaus in den klaren Herbsttag. Da – ein einziger, geschlossener, scharfer Knall aus soundsoviel Gewehren! Und ein Knattern und Knallen, Puffen, Rasseln, Dampfen saust um den Kirchturm in irren, wirren Schallkreisen, dehnt sich weiter über alle Dächer, und nieder an dem First des Gièthofes! Da sitzt einer im Festtagswams und schläft.
Als Anntschenne das ferne Schießen hört, bindet sie die Haube fester, tätschelt den Arm des Bauern und sagt:
»Jetzt ist der Bund fürs Leben geschlossen.«
In die alten Augen laufen Tränen der Rührung.
»Gebe der gute Gott ein reiches Maß von Segen,« betet sie.
Der Bauer schläft weiter.
»Lieber Meister, nun habt Ihr auf'm Hof 'n junge Bäuerin, Ihr zieht mitsammen ins Venn. Der alte Gièthof gehört zur Fabrik, und,« sie tätschelt wieder seinen Arm, »und der gute Gott beschert Euch noch ein paar stille Jahre, Amen.«
Der Bauer schläft weiter – stumm, regungslos.
Nun öffnet sie ihm mit dem Daumen das eine Augenlid und dann das andere.
Da weiß sie, daß der Bauer schläft, um niemals mehr aufzuwachen.
