
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
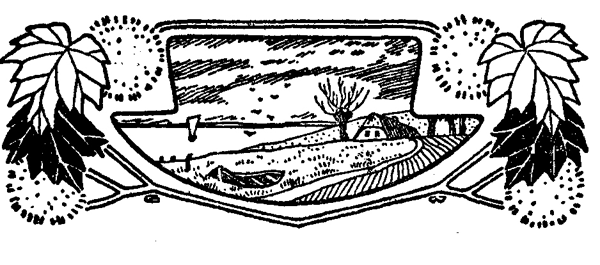
Blitzblanker Sonnenschein auf den Wiesen und den verkümmerten Äckern! Durch die hohen Hainbuchhecken rinnt die heißgoldene Sonnenhitze und sprenkelt mit Lichtpunkten und leuchtenden Arabesken den steilen Hofgiebel und das Scheunendach.
Ein angenehmer Heugeruch schwillt in die weiße Luft. Im Wiesengrund klirren die Sensen. Aus der angelehnten Stalltüre heraus das schläfrige Brummen einer Mastkuh! Auf der Wagendeichsel eine Hühnerfamilie, gackernd, klucksend! Im Schatten der Hundehütte ein grauer Spitz, der nach Fliegen schnappt – und weiter keinen Laut!
Morgenstille!
Das Dorf liegt im Schatten der Heckenwände.
Auf der Straße, die nach dem Ort Robertville abzweigt, schwanken ein paar Schatten, lange Schatten, die bis an die Baumreihen reichen; Riesensilhouetten, mit Kiepen belastet! Dreie sind's, ein junger Bauer voran, ihm folgen zwei Frauen. Massige Torfstücke stehen aus der Kiepe heraus. Die Last ist schwer. Die Frauen keuchen. Ihre Gesichter glühen unter den Kopftüchern. Ein Herr in grauem Staubmantel geht vorüber. Da schielen sie unter den Tüchern heraus nach ihm und grüßen.
»Wohin des Weges, Ihr Leute?« Der Fremde tritt an die Kiepen heran und wägt prüfend die Torfkuchen in der Hand.
»Wird das zum Verkauf ausgetragen?«
Der Bauer schiebt seinen Stecken unter die Kiepe und stützt sie. Die Frauen gehen vorauf.
»Ja, Herr, das tragen wir nach Malmedy. Es ist warm heut, Herr.«
»Ihr könnt hier doch nicht klagen. Die feuchten Luftwellen vom Moor her verkühlen Euch schon die Hitze. – Nach Malmedy sagt Ihr? Also gute zwei Stunden.«
»Annähernd ja, Herr; die Touristen gehen durchs Warchetal an der Ruine Rheinhardstein vorbei.«
»Eine schöne Gegend ist das um Rheinhardstein. Man soll's nicht glauben, so nahe am Moor. Mit dem Torftragen schafft Ihr Euch wohl einen guten Nebenverdienst?«
»Wie man's nimmt, Herr. In der Stadt zahlt man uns für eine Kiepe fünfzig Pfennige; für eine Kiepe und einen Korb drauf, wie ich ihn hier hab', 75 Pfennig.«
»Das ist wenig.«
»Für uns viel, Herr. Ich will Ihnen das einmal vorrechnen. In der Stadt kaufen wir alles um drei, auch um fünf Pfennig billiger. Dafür tut man schon etwas. Mit drei Kiepen kaufen wir uns Vorrat für eine ganze Woche und mehr.«
»Na ja, Ihr seid gute Leute hier in der Eifel, gut und gottesfürchtig – und dumm. Nichts für ungut, adieu!«
»Behüt Gott, Herr.« Der Bauer trollt weiter und ruft die Frauen an:
»Hör', Bâbe! Hör', Tatine!«
»Halt's Maul, alter Magen Gebräuchlicher Ausdruck. und laß Dir die Sohlen nicht heiß brennen.«
»Heh, wißt Ihr, warum ich lache?«
»Warum lacht ein Narr, sicola!«
»Ein Narr ist der da!« Er weist mit dem Stock zurück. »Für dumm hält er uns, der Dumme! Schnüffelt einer wieder um unsere Torfgruben und bildet sich wunder ein, was daraus zu holen ist. Wird der sich schneiden, der Dummkopf, wie alle andern!« Er lacht, daß die Kiepe auf seinem Rücken ins Schwanken kommt. »Eine Kiepe voll läßt sich allenfalls heraushacken, und das ist alles. Das andere ist Spaß – Spaß! Wir Bauern lachen darüber; aber wenn die Herren uns ausfragen, machen wir blöde Gesichter, und dann halten sie uns für dumm. Ist das nicht närrisch, Tatine? Abin, Bâbe, ich hab' ihn 'reingelegt, den da!«
Und weiter keuchen sie im Sonnenbrand.
Der Herr im Staubmantel nimmt den Strohhut ab, trocknet die Stirn und streicht den langen Bart zwei Enden. Er ist sehr frohlaunig, und unter dem Bartwust versteckt sich ein Schmunzeln.
»Wagen wir's. Das Terrain ist sondiert. Aussichten gut. Nun zur Attacke!« Er spricht's laut. Die Worte rasseln ihm im tiefsten Brustton heraus. Er ist überzeugt, seiner Sache sicher und lenkt links in den Weg ein zum Gièthofe.
Die Hämmer der Bahnarbeiter sausen auf die Schienen. Karren rattern auf der Fahrstraße, am Bahndamm entlang Hügel von Steinen, Lehm und Sand, und weithin eine lange Reihe gebeugter Rücken, Männer in verblichenen Samthosen, braune Italienergesichter, listig und verwegen. Fieberhaft wird die Arbeit betrieben. Der Schienenstrang wächst. Im Sommer muß die Bahn dem Verkehr übergeben werden, über die vorletzte Bahnstation Weismes hinaus ist schon der Bahndamm aufgeworfen.
Eine Weile steht der Graue und schaut hinüber. Das Schmunzeln vertieft sich. Er hat heute einen angenehmen Tag. Nun gilt's, mit dem starrköpfigen Bauer zu Ende zu kommen. Dem mußte man die Chancen klarlegen und die volkswirtschaftliche Seite beleuchten, die soziale Frage stellen und so weiter. Na, er hat Dickschädel unter seinen Rekruten gehabt, mit denen wußte er umzugehen. Auch einen Wallonen hatte er. Der war wie eine Springfeder im Reden, Handeln und Denken, mit seinem wallonischen Herzen drei Viertel Schlag dem deutschen voraus im Leben und Lieben. Auf Verständnis und Klugheit durfte er demnach bei den Bauern hoffen.
Er tritt unter den Heckenbogen und mitten in den Hof.
Der Hund schnellt auf und knurrt ihn unter verbissenem Schnaufen an. Aus der Stalltüre drängt ein Kuhkopf heraus, blöde, triefende Augen – mit den krummen Hörnern stößt er in die Lehmwand, und dann reißt eine kleine, energische Hand ihn zurück; in die nun freie Türspalte zwängt sich ein Bauernmädchen, hält behutsam in ihrer Schürze die Eier und will dem Hause zu. Da sieht es den Herrn im Städterrock und ist verwirrt. Er schaut scharf zu ihr her, erkennt sie und winkt ihr grüßend mit der Hand zu. Ein dunkles Rot schießt in ihr Gesicht und färbt die angebräunte Haut um eine Nuance tiefer.
»'n Tag, kleines Wallonenmädel; Du bist also nicht mehr im Venn?«
»Nein, wie Ihr seht, Herr.« Sie will an ihm vorüber die ausgetretene Steintreppe herauf. Da hält er ihr den Stock hin und versperrt ihr den Weg.
»Warum denn so eilig? Ich habe Dir bei den Torfgruben eine Tracht Prügel erspart, dafür könntest Du mir jetzt sagen, wo ich den Hofherrn finde, ob ich ihn sprechen kann, ob er Zeit hat und dergleichen?«
»Den Meister Gièt?«
»Eben denselben.«
»Da ist er.«
Sie deutet nach dem Scheunentor, wo eine Leiter anlehnt. Dort herunter steigt der Bauer, scharrt an der untersten Sprosse seine Schuhe rein und kommt dem Fremden entgegen.
»Guten Tag, Gièt; Euer Anwesen liegt prächtig. Dicht bei der Bahn.« Das sagt er in tadellosem Französisch; aber der Bauer zieht die buschigen Brauen hoch, mustert ihn blitzschnell und geht ihm voraus.
»Kommen Sie in die Stube, Herr.«
Sie treten in die geräumige, von Suppendunst angefüllte Küche, von dort links zwei Stufen höher in die niedrig gestochene Stube. Der Raum mit seinen weiß getünchten Wänden ist sauber und kahl und frostig wie ein unbewohntes Staatszimmer. Neben dem Kruzifix hängt ein altes Papstbild, weiter sieht man keinen Wandschmuck. An dem einzigen niederen Fenster ein Fuchsienstöckchen und daneben der lederne Tabaksbeutel für die Sonntage. Den Alkoven füllt das breite Fremdenbett mit den hochgebauschten Kissen und Decken aus. Ein buntgeblümter Vorhang hängt davor. An die Brandmauer ist der eichene, massive Leinwandschrank, der bis zur Decke hinaufreicht, angerückt.
»Wollen Sie sich setzen, Herr?« Er platscht mit der flachen Hand einladend auf das Lederpolster des Lehnsessels, schiebt sich auf die Holzbank hinter den Tisch und legt die Arme auf.
»Ich bin an Ihrem Torfwerk vorbeigekommen und habe mir die Sache einmal angesehen, interessiert mich; vielleicht hat man's Ihnen schon gesagt, ich bin der Oberst Giese.«
Da der Bauer vor sich hinstarrt und keine Bewegung macht, ihm zu antworten, ihn zu unterbrechen oder gar aufzumuntern, fährt der Oberst fort:
»Wie gesagt, die Sache hat mein Interesse, bin so eine Art Sozialpolitiker, möchte der armen Eifel auf den Damm helfen, sieht hier ja zum Verhungern aus. Keine Lebensidee, keine systematische Kulturarbeit! Sie müssen mehr mit der Außenwelt in Kontakt treten. Es fehlt hier alles, um ein Torfwerk zum Florieren zu bringen. Energie, Unternehmungslust, Geld! Wissen Sie, ein Finanzpotentat müßte sich die Affäre aufhalsen lassen. Für die soziale Kulturarbeit ist da manch einer zu haben – jetzt gerade. Man schwätzt viel um das Volkswirtschaftlich-Soziale herum. Die Menschenfreunde schnappen förmlich danach. – Haben Sie schon einmal etwas von einer sozialen Frage gehört?«
Eine Weile erwartungsvolle Stille. Dann schnellt der Bauer mit dem Kopf auf, sieht seinen Gast scharf an und fragt:
»Wo haben Sie Ihr Französisch her, Herr?« Der stutzt.
»Nun, ich denke, das studiert man.«
» Abin, Herr, dann sprechen Sie, wie Sie's nicht studiert haben, ich weiß nicht, was Sie wollen.«
Ärgerlich trommelt der Oberst mit den Fingern auf den Tisch.
»Jedenfalls haben Sie verstanden, daß es sich um Ihr Torfwerk handelt.«
»Ich hab' kein Torfwerk.«
Die trommelnden Finger spreizen sich.
»Na, erlauben Sie, das sind faule Ausflüchte. Ich war selbst draußen und habe mir Ihr Torfwerk angesehen.«
»Ich hab' kein Torfwerk.«
Der Oberst knöpft seinen grauen Mantel bis zum Halse hinauf zu und räuspert sich.
»Ich erwarte auf eine offene, ehrliche Frage eine ebensolche Antwort. Wenn ich mit selbstsüchtigen Absichten käme, würde ich anders reden.«
»Dann hätt' ich Sie wahrscheinlich nicht angehört, Herr, und nun können Sie es noch einmal wissen: ich habe kein Torfwerk. Was ich an Brenntorf brauche, laß ich ausstechen, und wenn wir genug haben, lasse ich die Mulden versumpfen, und dann warten wir, bis wir wieder Mangel an Brand haben. Dafür brauchen wir keinen Finanzmann und keine soziale Reform und keinen Verkehr mit denen draußen. Wir haben genug mit dem, was das Venn abwirft, wir brauchen nichts weiter und auch niemand, der uns hilft.«
»Aber nun überlegen Sie doch einmal. Eine rentable Ausnutzung der brachliegenden Hochfläche kann Ihnen doch nur Verdienst einbringen. Freilich reichen dazu Ihre Gelder nicht aus, ich meine zu einem solchen Unternehmen großen Stils. Da muß schon ein anderer in Aktion treten, einer, der ein paar hundert Hektar Hochland absteckt, eingelernte, tüchtige Arbeiter einstellt, durch eine Schmalspurbahn mit der Eifelbahn Anschluß sucht, das holländische System der Torfbearbeitung einführt und somit der Kulturträger in dem Ödlande wird. Sie müssen, Herr Gièt, nicht den Blick in die vier Wände Ihrer eigenen Genügsamkeit bannen. Es gilt, den Wohlstand der Eifel, den Aufschwung einer ganzen Industrie –« Er hält inne, ein mitleidiges Achselzucken des Bauern stört seinen genialen Gedankengang. Nun lacht der überlegen in sich hinein, ein kollerndes Lachen, das demütigend und empörend wirkt.
» Tin (so), da haben Sie viel geredet, Herr, aber wir wallonische Bauern verbrennen uns an den Funken, die Sie anblasen, die Finger nicht. Wir bleiben beim Alten und lassen uns nichts dreinreden. Unser Venn gefällt uns so wie es ist. Es gibt uns immer noch mehr als wir verlangen.«
Der Oberst rückt mit seinem Sessel näher heran und beugt sich über die Lehne dem Bauer zu.
»Ist Ihnen überhaupt bekannt, wie mannigfach die Verwendungsfähigkeit des Torfes, den Sie da ohne sachgemäße Leitung herausgraben, für die verschiedenartigsten gewerblichen Zwecke ist? Solange Sie mit wenigen Menschenhänden arbeiten lassen, wird dieser Torfstich kaum zu einer lokalen Bedeutung gelangen. Seine Verwertung als Brennstoff in einigen wallonischen Dörfern darf nicht seine ganze kommerzielle Bedeutung bleiben. Maschinenkraft muß der Menschenhand nachhelfen. Maschinen müssen uns ermöglichen, den Torf in großen Massen und der kürzesten Zeit geformt und gepreßt auf den Markt zu bringen. Was Sie hier mühsam mit dem Spaten herausstechen, muß mindestens zwei Jahre zum Trocknen ausliegen. Die Maschinen besorgen das in wenigen Tagen. Durch das Pressen wird der größte Teil des Wassergehaltes absorbiert und dadurch die Heizkraft der Torfmasse erhöht. Nun besitzt aber auch dieser Preßtorf die Fähigkeit, ein größeres Quantum von Flüssigkeit aufzusaugen. Sehen Sie, Herr Gièt, und daraus ergibt sich dann seine eminent große Verwendung zur Streu. Der erste kulturelle Schritt hier müßte demnach durch Einrichtung einer Fabrik zur Herstellung von Torfstreu und Torfmull gemacht werden. Dadurch würde nicht nur dieser Industrie eine glänzende Zukunft angebahnt, auch den Unternehmern fließt lohnender Verdienst zu. Das ist doch sonnenklar.« Er atmet auf und wartet auf eine Äußerung des Bauern; der liegt weit über dem Tisch und bleibt unbeweglich. Eindringlicher fährt der Oberst fort.
»Und nun fassen Sie einmal die weitere Perspektive ins Auge. Die einfache Pflanzenfaser des Torfes, die Ihnen so unscheinbar dünkt, läßt sich in der verschiedenartigsten Weise ausnutzen. Sie wissen vielleicht nicht, daß die Pflanzenfasern des Torfes hauptsächlich aus Überbleibseln des bekannten Wollgrases bestehen. Die Auffassungsfähigkeit all dieser Teile ist bekannt. Nun, mein Bester, hiermit haben wir schon den neuen Industriezweig: Torfwolle zu Verbandszwecken. Gar nicht sprechen will ich von den weiteren Produkten des Torfes, die auf chemischem Wege hergestellt werden zu spinnbarer Wolle für Trikotgewebe usw. Sie werden nun wohl einsehen, welch ein Reichtum in Ihren Moorflächen steckt, die Sie in unverantwortlicher Weise brach liegen lassen. Das kommende Jahrzehnt muß die Moorkultur in Blüte sehen. Gehen Sie mit denjenigen Hand in Hand, die sich berufen fühlen, die volkswirtschaftlichen und sozialen Aufgaben auch hier in der totarmen Eifel zu lösen. Ihr Widerstand wird den Fortschritt vielleicht verzögern, aber nicht verhindern. Bedenken Sie das!«
Da krampfen sich die Bauernfäuste zusammen, daß die Adern sich wie dicke Drähte über den Handrücken spannen. In die quadratisch plumpe Gestalt kommt ein Recken und Dehnen, daß die Knochen zu knacken scheinen.
Tonnerre! Über meinen Widerstand hinweggehen wollen Sie! Dem dicken Kopf des dummen Gièt noch eine zweite Beule anhauen! Die Eisenbahner haben's getan, warum sollen Sie es nicht auch tun? Bin ich denn nicht mehr Herr über mein Eigentum? Im Namen Gottes! Eher sollt Ihr mich ins Gefängnis schleppen, eh' ich einen von Euch in meinen Torfstich lasse!«
»Aber Herr Gièt!« Beruhigend legt der Oberst seine wohlgepflegte Hand auf die Bauernfaust. »Es liegt durchaus kein Grund vor, sich in dieser Weise aufzuregen. Der Gewalt sollen Sie nicht nachgeben, sondern der Vernunft, den Kulturinteressen. Die neue Eisenbahn kommt unseren Zwecken doch nur entgegen und erleichtert den Güterverkehr. Die neue Bahn ist ein Segen für die arme Eifel.«
Nun springt der Bauer auf und stößt den schwereichenen Tisch zurück.
»Eure schönen Worte verstehe ich nicht, die kennt und spricht man hierorts nicht, die wollen wir nicht! Der Teufel steckt hinter Euren schönen Worten. So haben sie's auch mit der Bahn gemacht, hernach stellten sie das Entwederoder. Ich hasse Euch alle, die Ihr von draußen hereinkommt, um uns zu schulmeistern und die arme Eifel glücklich zu machen. Ich stemme mich gegen Eure verrückten Ideen, so lange ich lebe. Wir wollen Eure Hilfe nicht, Eure Sprache nicht, Euren Handel nicht und Eure Gewalt nicht! Auf meinem Hofe ist kein Gastrecht für – die Fremden!«
Der Oberst erhebt sich.
»Wir geben Ihnen Zeit, sich an die Fremden erst zu gewöhnen; aber die Stunde wird dennoch kommen, wo Sie den Fremden das Gastrecht einräumen. Die Wandlung wird nicht auf heute und morgen sein, aber sein wird sie!«
Da steht der andere mit seinem wilden Bauernstolz vor ihm. Die Schultern weitet er, daß der Kittel sich straff spannt, und dann spricht er es heraus, nicht in wütendem Trotz, sondern in grundehrlicher Überzeugung, in seinem tiefwurzelnden Heimatgefühl:
»Wir sind Wallonen und bleiben Wallonen!«
Dann stampft er hinaus. Die Dielen krachen unter seinen Tritten. Die Türe läßt er weit auf. Von der Küche her dunstet ein Geruch von Kartoffeln und Specksauce. Langsam verläßt der Oberst das Haus. Eine Sorgenlinie vertieft sich auf seiner Stirn. Mit einem vollständig ausgearbeiteten Programm kam er hierher, nun macht ihm dieser unversöhnliche Bauerntrotz den Vernichtungsstrich hindurch. Eine leuchtende Zukunft hatte er aus dem Moordunkel aufblitzen gesehen, nun war's eine Fata Morgana – weit abgerückt. Und wo er heimisch werden wollte, da nannten sie ihn den »Fremden«. Was blieb ihm übrig? Den Staub abschütteln und gehen und – warten! Wenn erst das Mißtrauen schwand, kam die Liebe. Und lieben mußte man sie, die da eigenwillig und stolz und heimattreu ihr königliches Wallonentum anerkannt wissen wollten.
»Der hat's nun!« sagt Daditte vom Herd aus und stößt Gètrou in die Seite. »Und so ist's gut! Unser Meister Gièt läßt sich nicht den Brei über dem Kopf essen.« Sie reißt die Handfasten vom Haken und hebt damit den großen Kessel von der Herdglut. Langsam schurpst sie ihn über die Eisenplatte; die brodelnde Wassersuppe klunkst gegen die Kesselwände. Da fährt sie mit dem langstieligen Holzlöffel hinein, daß der weiße Dampf herausfluttert, ihr über die geglätteten Haare hin und hinauf in den Rauchfang, dort in wirren Fetzen um die klumpigen Schinken und über den Glanzruß der Schornsteinmauer. Unter geschäftigem Hin- und Herrennen schwatzt das alternde Mädchen:
»Ja, siehst Du, unser Meister ist nicht aus dem Holz, aus dem man die Flöten macht. – Gètrou, wenn Du grad' nichts anderes zu tun hast, als Dir den Rücken an der Wand zu schaben, kannst Du den Tisch decken.«
Das Mädchen rührt sich nicht und bleibt, wo es ist, lässig gelehnt an die Kannenbank. Es weiß, wenn es die Hand zu einer Arbeit ausstreckt, kommt ihm schon eine andere knochige, bis auf die rissige Haut ausgedörrte Hand zuvor. Die Daditte hat es nun einmal in der Gewohnheit, zu hasten, zu drängen, zu schikanieren. Ihre eigenen Befehle schluckt sie ein und hat die Arbeit schon halb getan, die sie aufträgt, und dann knodert sie über die Trägheit der anderen. Das ärgert die Krebsenmattestochter und nimmt ihr die Schaffensfreude, die Schaffenslust und das Vertrauen in sich; also bleibt sie faul an dem Brettergestell und schnippt im leichtfertigsten Tone heraus:
»Ich hab' grad' was anders zu tun.«
»Was tust denn, hein?« Die Alte springt herüber, wühlt mit beiden Händen im Torfwinkel, hebt eine Arm voll Torf heraus und wirft's in die Glut.
»Ich hab' immer was zu tun – und wenn's auch bloß Nachdenken ist.«
» Oh sicola! Nachdenken – worüber denn? An die Kinder Deiner Kinder was die für'n schöne Großmutter gehabt haben? Derlei wird's sein, ich mein' derlei Verrücktes, hähähä!« Sie tippt mit dem Daumen an die Stirn. »Den Krebsenmattesleuten hat immer ein Holz im Bündel gefehlt, auch Deiner Mutter. Die hat sich einmal eingebildet, auf den Gièthof zu kommen, nicht als Magd wie Du, o, die hatte Grützen im Kopf. Die wollt' Mam' Gièt werden! Sicola! Das ging ihr an der Nase vorbei, und dann hat sie den Krebsenmattes genommen, irgend einer mußte es sein, um dem Giètbauer aus den Augen zu kommen. Ich glaub', sie hätt' einen Hund mit einem Hut geheiratet. Hähähä!«
Das Mädchen hat ihr den Rücken gedreht und macht sich an der Kannenbank zu schaffen. Von dem obersten Brett nimmt es die zinnernen Schüsseln, in deren blankem Rand die Sonnenstrahlen wie in einem Prisma sich verfangen. Sie sieht wie in einen Spiegel hinein und lacht, denn da sagte Daditte ihren Satz von der schönen Großmutter. Das glaubt sie; sie weiß, daß sie hübsch ist. Und dann ordnet sie auf dem zweiten Brett die drei Kaffeekannen, die rotkupferne, die bauchig herausschwillt und nur zur Kindtaufe gebraucht wird, daneben die aus Porzellan, die für die Kirmesgäste ist, – und dann ein stumpfer Klang! Die dritte von Steingut stößt gegen die andern an. Das war, als Daditte von der Narrheit der Krebsenmattesleute sprach; und dann gleitet die unruhig tastende Hand auf das dritte Brett. Buntbemalte Teller liegen dort gegen die Leisten. Die greift Gètrou heraus und weiß nicht, was ihr in den Sinn kommt. Krach! Über die Steinplatten splittern die Scherben. Daditte hält in ihrer Arbeit inne, reißt den Mund auf, und dann kaut sie an ihren Worten.
Einen Atemzug lang sieht sie zu, wie Gètrou die Scherben mit den Füßen zerstampft, und – hastet weiter in ihrer Arbeit.
» Abin, das geht vom Lohn ab, laß Dir's gesagt sein.«
Ruhig, als wäre nichts geschehen, setzt sich Gètrou auf die Herdbank, zieht die Knie herauf und legt den Arm darüber. Ihre glitzernden Augen haften sich an jede Bewegung Dadittes. Sie bohren sich in ihr stoßweises Hasten fest – glänzend, vibrierend. Daditte fühlt's und möchte es wie etwas Unbequemes abschütteln. Da sagt das Mädchen langsam:
»Gelt, schad' ist's, daß nicht noch ein Krebsenmattes hierherum war?«
»Schad' für wen meinst?«
»Für Dich, Daditte. Dann wärst Du nicht alt geworden und brauchtest nicht zu dienen. Ein Krebsenhaus ist doch immer ein eigenes Haus.«
Der Daditte schwillt der Ärger in den Hals hinein.
»Leute von Eurem Schlage, jawohl, da ist ein Haus im Venn schon grad gut genug.«
Das zuckt in Gètrou hinein wie ein Verbrecherwort. Beklemmend fällt es auf sie, eisig erschauernd, als seien es schon die Nebelklumpen aus dem Moor, die ihr nachjagen.
»Hör', Daditte, es gibt noch andere Wege – weit hinaus. Die geh' ich eher als ins Venn.
»Ich denk', Du gehst, wo man Dich brauchen kann, so ist's!«
»Du kannst mich nicht brauchen, Daditte.«
»Nein, meiner Seel', wahrhaftig nicht.«
»Der Meister Gièt hat's anders gemeint.«
»Wie hätt' der's gemeint haben können?« Die fahlen, verschwommenen Augen stieren zu dem Mädchen hinüber. Das läßt die Beine herabbaumeln und wirft den Kopf zurück.
» Eh bin, er meint, ich könnt' Dir zur Hand gehen und den Haushalt an allen Enden zusammentun, ich könnt' überall da sein – eh bin, wo Du nicht mehr sein kannst; und weil ich jung wär' und Du schon nicht mehr – das wär' so, was er grad braucht. Ich mein', Dich hätt's so gefreut wie den Meister Gièt. –« Ah sicola! Was tust denn? Holst Du den Torfklumpen für mich 'raus?« Sie schnellt herunter, daß die Kannenbank ins Schwanken gerät. An ihr vorbei saust ein Torfstück und mitten in die Hühnerschar hinein, die an der Schwelle sich in der Sonne plustert. Hölzern steht Daditte am Herde, und keine Muskel zuckt in dem groben Gesichte, aber ein Kreischen schrillt heraus, das mißtönend in die lautlose Stille des Hofes hineindringt. » Hai! Da weht der Wind her? Die Krebsenmattestochter will sich auf dem Hofe anpatteln. Weil sie jung ist und ich alt und ich in die Ecke muß und Hilfe brauch' – darum muß die vom Krebsenhaus auf unsern Hof! Keinen Finger rührst Du mir, Du! Du! Du! Gott Deine Seel' und dem Teufel Deine Knochen, um Messerstiele draus zu machen, na!« Diese Verwünschung entlastet sie. Es ist für das wallonische Herz immer eine Freude, wenn es dem Teufel etwas Wertloses gönnen kann; und die Daditte gönnt ihm in diesem Augenblicke, was sie ihm wünscht.
Ein Schatten fällt über die Schwelle, und einer stampft pustend herein, hakt den Briefsack von der Schulter und wirft ihn auf den Schemel.
»Gu'n Morgen, Mam'zelle Daditte und Kompagnie. Usch! heiß heut'. Nein, merci, merci, Mam'zelle, kalter Kaffe ist mir jetzt lieber als Schnaps.« Zu seiner Verwunderung bemerkt er, daß der Klapptisch noch an der Wand herunterhängt, der Stützstempel nicht darunter und seine Butterbrote nicht draufliegen. Weil er nicht fordern mag, sagt er ein bekanntes Reimlein her.
»Zent Bartholemis verbitt' Botter und Kies. – Habt Ihr denn schon in Sourbrodt den St. Bartholemis? In Robertville sind sie noch in der Heuernte, aber freilich, das ist nicht derselbe Himmelsstrich. Ja, und kurzum, Daditte, wie geht's und steht's mit unserm Mann'?«
Die wallonische Hausfrau läßt den Respekt vor dem Familienhaupte nicht außer acht und sagt »unser Mann«. Der Briefträger, der auf ein Zehnuhrbrot angewiesen ist, denkt, es könne einem alten Mädchen nur angenehm sein, versehentlich auch einmal nach »unserm Mann« gefragt zu werden. Da tut die Daditte genierlich, streicht an der steifgefälteten Schürze herum und sieht nach der Decke.
»Guter Gott, was Ihr ein Narr seid. Guter Gott! – Gètrou, geh' und richt' ihm den Tisch her. – Habt Ihr 'was für unsern Meister? Gètrou, stell' ihm auch den Makai hin, ich weiß, er ißt'n gern. – Hört, wenn Ihr wieder 'n Brief von den Eisenbahnern habt mit den breiten Siegellackflatschen drauf, dann nehmt ihn gleich wieder mit. Man hat nur Unfrieden davon und der Meister schlägt uns das Haus zusammen. Der hat jetzt grad genug von der Geschicht', meiner Seel', ja.«
Er kramt in den Briefschaften herum, greift eine Zeitung heraus und wirft sie ihr hinüber.
»Da lest einmal die Malmedyer »Woche«. Die neue Bahn will man feierlich einweihen. Von Aachen herüber kommt ein Waggon hoher Herren, ich glaub' auch ein Minister oder gar ein Oberbürgermeister. Und hier hab' ich auch einen Brief, ist aus Berlin und hat keine Siegellackflatschen, und für Euch hab' ich diesmal nichts, Mam'zelle Gètrou,« schäkert er zu dieser hinüber, »sollst Dir'n Schatz anschaffen, der Dir von den Soldaten schreibt.« Er blinzelt sie an. Da reißt sie ihm den Brief aus der Hand und steckt ihn in der Stube hinter den Spiegel. Von dort ruft sie ihm die Antwort zu.
»Ihr habt recht, Briefträger, wenn's schon ein Brief sein muß, dann sicher ein Soldatenbrief.«
Sie steht wieder auf der Küchenschwelle und funkelt die Großmagd an. Sie hätte dieser jetzt alles zum Trotz sagen können, aber die liest die Zeitungsnachrichten halblaut vor sich hin und knodert: »Das haben sie in Deutsch 'reingesetzt. Warum bezahlt man's, wenn man's doch nicht lesen kann, da werd' einer klug draus. Ich sag's Euch, es gibt ein Unglück, wenn die bis Malmedy 'nauf einweihen wollen. Unser Meister läßt den Zug nicht über seinen Grund und Boden laufen. Guter Gott! Mit dem Armsünderkreuz ist's ihm auf den Leib gefallen wie die Armut auf die Welt! Guter Gott! Sie hätten ihm den Gefallen tun sollen und ein Endchen herum weiter fahren müssen; wär's was gewesen, hai, Briefträger?«
Der schlürft an seinem Kaffee einen Atemzug lang.
» Oh sia, Mam'zelle Daditte, oh sia! Die Schienen wickelt man nicht wie Euer Garnknäuel. Ein Endchen weiter kostet schweres Geld, oh sia! Mam'zelle Daditte, oh sia! Das versteht Ihr nicht. Wir Beamte verstehen das. Wir brauchen jetzt weniger Schuhsohlen. Was man verfährt, das verschleißt man nicht. Das ist so richtig, wie Euer Kaffee gut ist. Gètrou, wenn's gefällig ist, stell' mir die Kanne her. Sapristi, Mädchen, schad' ist's um Dich. Du müßtest nach Malmedy kommen. Da kannst einen städtischen Hut tragen, sogar 'n Feder drauf. Dein Gesicht paßt nicht unter's Kopftuch. Hat Dir schon einer von den Dorfeulen gesagt, daß Du 'n hübsche Fratz' bist?«
Aus dem Kochdunst am Herde dringt ein verärgertes Knodern.
»Briefträger, halt den Mund. Der Pfarrer will keinen Städterhut im Dorf. Setz' der da keine Grützen in den Kopf, die hat sowieso schon ein Holz aus'm Bündel.«
»Briefträger, red' weiter!« lacht Gètrou und kauert wieder auf der Herdbank, »wißt Ihr nicht gleich auch eine Stelle für mich, eine, wo die Mam' Madame heißt und ein Tellerhäubchen auf'm Kopfe hat? Und dann könnt Ihr auch einmal ausschauen, wieviel die Hüt' kosten. Der Krebsenmattestochter kann es weiter an ihrem Renommee nicht schaden, wenn der Pfarrer von der Kanzel 'runter mal von ihr spricht.«
»Willst Du wohl still sein. Du! Du! mit dem sündhaften Geschwätz!« schreit Daditte sie an. Der Briefträger aber hält sich die Seiten und lacht und nickt dem Mädchen ermutigend zu. Da läuft Daditte zwischen den beiden lästerlichen Menschen durch hinaus aus den Hof. In ihrer Schürze hat sie einige Handvoll Körner, die sie den Hühnern hinstreut. Ihr schrilles: Pick! Pick! Pick! gellt in das Gelächter aus der Küche. Gètrou lacht nicht mehr, aber um ihren Mund zuckt die Schadenfreude. Sie hat wieder einen Menschen, den sie hassen muß. Sie freut sich immer, wenn ein Neuer zu ihrem Hasse kommt! Dann weiß sie, daß es einen Grund mehr gibt, das Böse in ihr herauszuwühlen. So muß die Krebsenmattestochter sein, das ist nun einmal nicht anders; und wenn es anders wäre, glaubte man es ihr nicht.
» Ah sicola! Bist Du aber ein Reibeisen! Man könnt' Angst haben, Dich zur Frau zu nehmen; denn man weiß nie recht, ob Du lachen oder beißen willst.«
»Oh – beißen! beißen, Briefträger!« Nun lacht sie ganz unsinnig und trampelt auf die Herdbank. »Ein närrischer Mensch seid Ihr. In Malmedy, scheint's, seid Ihr närrischer wie bei uns im Dorf. Hier gibt es keinen einzigen halbwegs gescheiten Menschen, der so närrisch ist wie Ihr, Briefträger. Ihr seid nicht wie der Hirt, der seinen Verstand vertrinkt, so kann man hier herum viele finden.« Sie reckt die Arme hoch. »Guter Gott! Und ich möcht' immer närrisch sein! Ihr wißt doch, Briefträger, wenn man singt, ist man schon närrisch, und wenn man nicht gerad so'n Tollpatsch ist wie die andern, ist man's auch; und wenn man aus'm Dorf herausmöcht, ist man's auch; und am närrischsten ist man, wenn man glaubt, zum Heiraten sei noch 'was anderes nötig als die Kühe, die Wiesen und das Venn und der Bauer, der das alles mit in die Ehe bringt. Briefträger, wenn Ihr 'mal mit mir tanzen wollt, müßt Ihr zu den Türken 'runterkommen, hier tanzen nur die Hexen auf der Ofenzange in der Walpurgisnacht.«
Der Postmann wälzt sich vor Vergnügen, platscht mit der flachen Hand auf den Tisch, daß die Tasse klirrt, und nickt dem Mädchen zu.
»Das weißt Du auch schon – von den Türken? Aber sieh mal, in Faymonville kannst Du Närrische genug finden. Da denkt einer schon an die vielen Fremden, die mit der Eifelbahn 'rüberkommen und läßt sich aufs Wirtshausschild malen: Café Sultan! Bin! Und nun haben sie ihren Namen weg. Du hast aber recht, die Türken tanzen fein, einer sogar den Walzer. Den hat er von den Soldaten heimgebracht. Hör', Mädchen, das kommt davon. Die Türken wohnen näher zu Malmedy. Da muß man zur Ehe noch viel 'was mehr als Kühe, Wiesen und den Mann, der alles hat, mitbringen. Komm' nur 'mal 'rüber, Du findest schon den Richtigen für Dich. Adjüs, Mam'zelle und Gott behüt'! Dein Käs' hat den richtigen Robertviller Geruch; der könnt' einen asthmatischen Menschen um den Atem bringen. Sag' der Daditte mein Merci und stell' ihr's Rüböl aus'm Weg, damit sie sich nicht noch mehr das Haar einfettet. Sieht ja schon so glatt aus wie'n Billardkugel. Gott behüt', und nun muß ich zu den Vennhäusern 'nauf.«
Er hängt den Postsack um und geht. Draußen flutet die Sonne in blanken Strahlen über die Felder. Die Luft ist weiß und von Blütenduft beschwert. Mit weitausholenden Schritten biegt der Postmann in den Hohlweg ein, der zum Venn führt.
Gètrou schließt die untere Hälfte der zweigeteilten Haustüre und lehnt sich darüber. Um die Hofecke hört sie Dadittes scheltende Stimme und des Hofbauern verlegenes Räuspern. Als sie ihren Namen vernimmt, weiß sie, daß Daditte ihr Schuldregister vor Meister Gièt entrollt. Sie hält den Atem an und horcht – kein Wort des Bauern! Der wird nicht nein sagen, beharrt die Daditte auf dem »Ja«. Wenn die vom Hofe ging, fällt das Dach ein und die Kälber krepieren und die Hühner würden wahrscheinlich ihre Eier selbst auffressen, um sie dem undankbaren Giètbauer nicht zu legen. Aber der Bauer ist dankbar, und wenn er von »unser Daditte« spricht, möchte er gleich die Mütze rücken. Vielleicht wäre auch der Fremde weniger schlecht abgeblitzt, wenn er zum Herde hinüber ein gutes Wort gesprochen hätte.
Das Mädchen drängt den Oberkörper über die Tür hinaus, und ihr Herz geht leiser in atemlosem Hinhorchen. Hört sie des Bauern Stimme nicht? Der schreit in das Gezeter hinein dem Hütjungen ein Scherzwort zu, und beide lachen. Das wird die Daditte erbosen.
Mit einem Sprung sitzt Gètrou auf der unteren Türhälfte, und darüber hinaus möchte sie vor Freude und Jubel und zu dem Bauer wie damals im Venn, und vor lauter Dankbarkeit hätte sie ihm das tollste Zeug vorgeschwätzt. Sie legt den Kopf an den Türpfosten und denkt nach. Wenn der Giètbauer damals nicht gekommen wäre, läg' sie jetzt drunten im Tümpel. Da schwor sie, ihm treu und anhänglich im Haushalt zu sein. Warum sollte nicht die Junge die Alte im Hofe ersetzen können?
Jetzt sitzt sie kerzengerade und atmet kurz – so jubelt der Gedanke in ihr! Und dann – – und dann! Die Krebsenmattestochter wird sagen: »Pack' ein, Daditte, und geh'. Du bist hier überflüssig geworden. Ich bring' das schon allein fertig. Gott behüt'! Und verärgere Dich nicht, daß Dir die Galle 'rauskommt.«
Sie springt von der Türe ab und in die Küche zurück. Eine wilde Arbeitslust überkommt sie. Die Handfasten reißt sie von der Brandmauer und schiebt den Kessel wieder aufs Feuer. Die Dunstbläschen quirlen aus der brodelnden Suppe, und sie lacht in sich hinein. Aber dieses Lachen war gewalttätig. Wenn jetzt die Daditte kam und sie fortschicken wollte – o, sie ging nicht, nein, wahrhaftig, sie ging nicht; und in maßloser Entschlossenheit greift sie nach der Ofenzange.
Ein fester, stapfender Schritt schallt über den füllen Hof, dann auf der Schwelle und auf den Steinplatten, und dann steht jemand hinter ihr. Sie dreht sich um und sieht den Meister Gièt.
» Luk volà (sieh da)«, sagt der nur, als müsse er sich wundern, nickt und geht in die Stube. Drinnen hört sie ihn den Brief vom Spiegel nehmen und öffnen. Die Arme sinken ihr herunter, schwer, als hing an jeder Hand eine Ofenzange. Sie weiß nicht, aber sie fühlt, daß es von dem Briefe ausgeht. Was der Alexand seinem Vater zu schreiben hat, kann ihr gleich sein. Der Alexand wußte nichts mehr von ihr, und sie dachte nicht einmal daran, daß es ihr angenehm sein könnte, wenn der jetzt mit ihr am selben Tische sitze – mit der Krebsenmattestochter zusammen, die bisher zwischen den Sümpfen gehockt. Aber es war ihr doch, als müsse sie nun die dritte sein auf dem Gièthofe, zwischen Vater und Sohn die andere, die Anteil nahm und voll Neugierde warm und dankbar und drängend an dem Briefe hing, der so kurz nach dem andern aus Berlin eintraf.
Da regt's sich in der Stube. Der Bauer schiebt den Stuhl zurück. Er murrt vor sich hin, sie weiß nicht, ob es ein Fluch ist. – Über die Schwelle hüpft ein Huhn herein mit leisem Gegacker auf den Schemel und von dort auf den Tisch. Da pickt es die Brotkrumen auf. Gètrou sieht ihm dabei mit Augen zu, die weit zurückblicken. Der Alexand steht vor ihr, jung und gesund, ein wenig rauflustig, ein Dorfheld! Damals gefiel er ihr. Da war sie noch dumm und blöde, aber sie tanzte schon drüben bei den Türken. Man wies mit den Fingern nach ihr, da tat sie es aus Trotz – tanzen aus Trotz! Das gefiel ihr. Man schüttelte den Kopf. Wie konnte die auch anders sein – die Krebsenmattestochter! Aber die Mutter war doch besser, man konnte ihr die ewige Ruhe gönnen.
In der Stube drinnen rasselt das Feuer auf. Des Bauern Stimme dröhnt über den Hof.
»Daditte!« Aus der Scheuer heraus ein mürrischer Ruf.
» Hai?« Ein scharrendes, langsames Tappen, dann steht diese vor dem Fenster.
»Was hat der Gamin (Junge) geschrieben? Will er Geld? In Berlin braucht er mehr Geld als bei der Kirmes im Dorf. Er soll heimkommen, schreibt ihm das.«
»Er kommt heim – aber als Krüppel. Das hat man davon, von den Fremden! Ich reise nach Berlin, jetzt sollen sie den Meister Gièt kennen lernen, diâle (Teufel)!«
»Bleibt daheim, Bauer, was die da reden, versteht Ihr doch nicht, und dann seid Ihr der Dumme vom Dorf, dem man die Knochen entzwei haut. Hat er den Arm gebrochen oder's Bein? Ist's der linke oder rechte?«
»Warum nicht gleich den Hals, bièsse (Rindvieh)! Den Finger zerschossen hat er sich, nun heilen sie ihn, aber er kann froh sein, wenn er mit seinen zehn Fingern heimkommt.«
» Tin! Wir haben auch für neun Finger noch Arbeit genug.«
Mit einer rüden Armbewegung drückt er das Blumenstöckchen zur Seite. Den Brief ballt er in der Faust zusammen und läßt diese Faust mit den Arbeitsschwielen auf das Fensterbrett niedersausen.
»Ein Stück Land haben sie mir ohne meinen Willen abgeschnitten, das Kreuz weggerückt und meinen Sohn verstümmelt. Sie werden mich in Stücke schneiden, wenn ich mich nicht wehre. Aber ich wehre mich! Im Namen Gottes, ich wehre mich!«
»Geht und laßt Euch vom Krebsenmattes ein Sälbchen für den Gamin zurechtmachen. Das Wehren hilft Euch doch nichts.«
Da wirft er das Fenster zu und macht zwei dröhnende Schritte in die Stube hinein – steht und stutzt. Gètrou hält die Türe in der Hand.
» Tonnerre! Was willst Du hier? Dich geht's nicht an!«
»Wenn schon nicht, aber leid kann's mir doch tun. Da hat mir keiner 'was drein zu reden.«
»Was geht Dich der Alexand an, meiner Seel'?«
»Der Alexand nicht und Ihr nicht und alle nicht, aber wenn's mir leid tut, kann ich nichts dafür.«
Seine buschigen Brauen glätten sich, sein Blick wird freundlicher.
» Bin! Du kannst nichts dafür, magst recht haben, Gètrou. Man kann nicht immer dafür, wenn's in einem so ganz anders wird als es immer war. Wenn es so Wetter geht, kommt's zu einem Unglück, aber dann kann ich nichts dafür. Ja, Mädchen, erschrick nicht, der Meister Gièt redet nicht in den blauen Dunst.«
Er packt sie an beiden Schultern, dreht sie mit grober Hast der Türe zu und drängt sie in die Küche.
»Hepp, mach' den Mähern den Tisch zurecht; da kommen sie.«
Über die Schwelle ein Scharren und Räuspern. Die Sensen werden klirrend neben dem Türpfosten eingehakt und der Gurt mit dem Wetzstein abgeschnallt. Dann schurfen sie über die Steinplatten mit schwerbenagelten Schuhen dem Klapptische zu. Hinter ihnen her kommt Daditte aus dem Stalle, läßt vor der Tür die Holzschuhe und trampft auf den Strümpfen herein.
Als sie den Bauer mit dem Mädchen aus der Stube treten sehen, mucken die Männer mit den Köpfen auf, und ihre Stirnhaut schnellt mit leichtem Gekräusel zurück. Das war schon ein Erstaunen mit Verdachtsgründen. Und auf dem Tische kein Essen! Der eine murrt dem andern zu. Daditte fährt mit lautem Schelten dazwischen. Da tritt der Bauer an den Tisch und spricht das Gratias. Es wird lautlos still, nur die Flamme prasselt wider den Kessel. Der weiße Dampf fluttert über die Köpfe hin, und weit von der Hecke her ein Hahnenschrei. Die Frauen füllen die Schüsseln. Mit ihren breiten Rücken liegen die Männer über dem Tisch und schlürfen die heiße Suppe. Der Schweiß tropft ihnen herunter.
Durch das offene Küchenfenster herein scheint die Sonne und brennt den stickigen Kochdunst zur beengenden Glut. Dann schleppt Gètrou die bauchige Musschüssel vom Herde her und läßt sie auf die Tischplatte niederplumpsen. Die Männer rücken zusammen, wischen mit dem Daumen über ihren Löffel und tauchen ihn in die Schüssel. Rund um den Rand höhlen sie das Mus aus, und jeder nimmt darauf Bedacht, immer wieder in dasselbe Loch einzutunken. Gètrou sitzt zwischen zwei Türken und muß weit bis zur Schüssel hin ausholen. Sie sind die Haupttänzer der Maclotte (Nationaltanz) und wispern dem Mädchen ihre Schäkereien zu. Aber wenn sie dann von der Schüssel her das Mus über den Tisch sprenkeln, stößt es sie an den Arm.
»Gib acht, Esel!« Sie blasen mit vollen Backen in den dampfenden Löffel und auch wie versehentlich in das Haargekräusel, das dem Mädchen aus den Flechten herausquirlt. Sie dreht den Kopf zur Seite und verzieht das Gesicht nicht. Das ärgert die Burschen. Die Krebsenmattestochter, na!
In die leeren Schüsseln rasseln die Löffel. Der Bauer holt weit aus zum Kreuzzeichen, steht auf und geht hinaus. Bank und Schemel werden zurückgeschoben. Die Türken räkeln sich auf der Haustürschwelle, die andern steigen in den Heustall und ruhen. Denen sagt der Bauer, daß der Alexand heimkommt und warum. Sie glotzen ihn an und sagen: »Oho!« Der Wallone betont dabei die erste Silbe und drückt dadurch seine Verwunderung kurz und kräftig aus. Dann strecken sich die Männer im Heu aus. Durch die Dachritzen rinnt der Sonnenschein herein und sprenkelt die Lichtpunkte in das Heudunkel. Da werfen sie die Kittel ab, krempeln die bunten Hemdärmel bis zur Schulter herauf und schlafen.
Die Maclottetänzer vor der Haustüre pitschen schläfrig die Augen, und einer ruft in die Küche hinein:
»Wenn der Alexand kommt, wird er hier manches verändert finden, hai?«
Der andere tritt mit dem Fuße nach ihm.
» Bièsse! Halt's Maul und verbrenn' Dir nicht die Zunge!«
Mit einem Eimer saurer Milch und eingeweichten Kartoffeln stößt Daditte an ihnen vorüber. Wenn sie die andern ruhen sieht, hastet sie am tollsten zur Arbeit. Zwischen den dünnen Lippen hervor murrt sie:
»Ich will Euch schon sagen, was geschieht, wenn der Alexand kommt: einer von Euch kriegt 'n Fußtritt und geht. Der Alexand schafft für zweie.«
Die Brühe schlampft über den Rand des Eimers hinaus, und weiße Milchflecke zeichnen den Weg, den sie nimmt. Die Männer rücken ein Endchen weiter in den Schatten der Hainbuchenhecke und schieben die Arme unter den Kopf. Da biegt Gètrou aus dem Küchenfenster heraus und fragt herüber:
»Hör', Nonard! Was soll denn anders hier sein?«
Der Maclottetänzer reißt die Augen auf. In der grellen Sonne scheint des Mädchens Gesicht wie in Glut getaucht. Er lacht verlegen. »Was brauch' ich Dir zu sagen, was Du weißt! Der Alexand wird's schon herauskriegen, verlaß Dich darauf. Vielleicht geht er dann wieder nach Berlin und wird Fabrikarbeiter wie der Speckschwarte in Rote Erde. Überleg' Dir's noch, ein Junger mit neun Fingern ist immer noch besser als so 'n alter Rauhborst.«
Das Küchenfenster ist leer, aber über die Schwelle huscht sie und schlüpft hinter den Schwätzer. Mit der braunen, unruhigen Hand schnellt sie nach dem Spundloch des Regenfasses und reißt den Zapfen heraus. Ein Gurgeln und Schlumpern in dem Fasse – und dann ein Schuß armdick heraus noch bevor die Männer aufspringen können. In ihr Patscheln und Schimpfen knallt die Haustüre, die Töpfe rasseln in der Küche und dazwischen ein helles, trotziges Lachen!
Sie drohen zum Küchenfenster hinein, da singt sie. Ihre Kittel hängen sie in der Sonne zum Trocknen auf, holen die Sensen her und sitzen am Dengelstock nieder, um sie zu schärfen. Der schrille Klang der Dengelhämmer schwirrt in die Mittagsschwüle. Die Sonnenhitze liegt bleischwer und lähmend über den Höfen, knistert in den Heuhaufen und sticht mit ihren blanken Lichtern in die rotgründigen Wiesenquellen und in die schlammschmutzigen Tümpel am Torfstich. Ein weißer, federnder Dunst ballt sich über der fernen grauen Horizontlinie, das Moor haucht seinen Sumpfatem aus. Schwarze Punkte taumeln darin, Krähen, die über den Sümpfen kreisen.
Vom Heustall steigen die Mäher herunter und reden mit dem Bauer. Der stemmt die Arme in die Seite.
»Morgen fangen wir mit der Grasmahd im Venn an. Das Gras ist da noch dürftiger als im Vorjahre. Sprecht mit der Daditte wegen dem Essen, das müßt Ihr mitnehmen. Wenn's not tut, müßt Ihr auch zur Nacht da bleiben. Richtet Euch danach ein.«
»Werden wir, ja, Meister Gièt.«
Sie drücken das grobe Strohgeflecht in die Stirne, hängen ihre Kittel an den Rechen, werfen diesen über die Schulter und ziehen nach den Wiesen aus. Von den Schweineställen her ruft Daditte nach dem Hütbuben. Mit Schnauben und Grunzen zwängt sich ein hochbeiniges Mastschwein durch die niedere Stalltür: vor ihm, hinter ihm eine wimmelnde, patschelnde Schar winziger Ferkel auf unsicheren, taumelnden Beinchen; der glatte, schwammige Fettrücken rosarot, baumelnde Ringelschwänzchen putzig daran – ein knoderndes, schmatzendes, unruhiges Kindervolk um die im ersten Phlegma grunsende, behäbige Nährmutter! Schläfrig trollt der Hütjunge hinter ihnen her, eine Weidenrute unter dem Arm, ein Loch in der Hose.
Der Bauer steht mit eingestemmten Händen neben Daditte und lacht sein stolzestes Lachen.
»Prächtige Kerle!« Damit meint er die Ferkel. »So 'was gedeiht nur auf'm Gièthof. Der Alexand wird seine Freud' dran haben, armer Teufel! So 'was haben sie in Berlin nicht, mag er auch vier Briefseiten vollkritzeln, wie's die Leut' da leichter haben, und sich nicht abzurackern brauchen und Maschinen haben – sicola! Maschinen,« er schüttelt seine gespreizten Hände. » Das sind unsere Maschinen. Was könnt' ehrlicher arbeiten als die eigene Hand? Da – hinterm Haus wird auch eine Maschine herlaufen, die hat noch keinen Segen gebracht. Einem Eisenbahner ist die Hand schon zerquetscht worden, und zweimal haben sie die Schienenschwellen gesenkt, und mir – daß der gute Gott sie straft! mir haben sie's Leben vergällt. Eh bin!« er dreht sich kurz um und geht zum Stall, »wenn man den Stoß hat, ist's zu spät zum Heulen.« Daditte stampft hinter ihm drein, wischt die Hände an der sackleinenen Schürze und schwatzt.
» Nenni, Meister, nenni; ich will Euch sagen, woher das Unglück alles kommt. An einem Freitag haben sie die Schienen gelegt, an einem Freitag!« sie stockt vor innerem Entsetzen, »und an einem Mittwoch ging die alte Anntschenne über die Schienen zum Torfstechen, und am selben Tage verbeulte sich der arme, kleine Teufel, der Italiener, die Hand.«
Der Wallone ist schnell zum Mitleid geneigt und dann sagt er: »Der arme, kleine Teufel!«
Dadittes Mitleid verflüchtigt mit dem Wortklang, dann räsoniert sie wieder.
»Die alte Anntschenne solltet Ihr nicht in unserm Torfstich lassen. Die bringt kein Gedeihen hinein. Wenn Ihr's nicht glauben wollt – bin, sie hat mir's Neujahr angewünscht, und rein alles Unglück kommt über mich; ist's nicht so? Zuguterletzt bringt man mir noch die Krebsenmattestochter ins Haus –«
Da fliegt die Stalltüre zu und sie hört den Meister drinnen mit seinen Ochsen reden. Verärgert stößt sie die Scheunentüre auf und schwatzt weiter.
Inzwischen schlendert einer über den Hof in weiten schlampernden Samthosen, ohne Rock und Kragen, um die Hüften einen breiten, roten Gürtel, schlenkert ein Blechgefäß in der Hand und schaut sich überallhin um. Im Hofe ist's so still, als schliefen sie alle. Da pfeift er. Am Küchenfenster funkeln Gètrous nachtdunkle Augen heraus. Sein braunes Gesicht zeigt alle Linien freudiger Überraschung. Mit einem Sprung sitzt er rittlings auf der Fensterbank und läßt die langen Beine herunterbaumeln. Gètrou flüchtet mit einem leisen Aufschrei in die Küche zurück; dort schwingt sie das Spültuch und droht:
»Hinaus, Italiener, hier gibt's nichts zu holen für Dich, hier ist der Gièthof. Da darf kein Eisenbahner 'rein!«
»St! Signorina! Nur Kaffiwasser ei bisseken. Dalli, dalli, Signorina, hab'n vill serr durschtig, durschtig oh!« und dann pfeift er wieder und hält ihr das Blechgefäß hin. In heller Verlegenheit wickelt das Mädchen das Spültuch, schlenkert's aus und wickelt wieder.
»Du hast aber Mut, Italiener!« sagt sie aus der Ecke heraus, »gleich kommt der Bauer und schmeißt Dich 'raus.« Sie stützt den Ellbogen gegen die Wand und den Kopf in die Hand, »ich für meinen Teil brächt' Euch gern den ganzen Kessel voll Kaffeewasser 'rüber –!«
»O Signorina, nix ei bisseken Furcht vor die Bauer,« er streckt die verbundene Linke vor, »half kaput ist sie, gelt, arme, kute Italiener? Aber,« er schwankt unternehmend seine Blechkanne, »mit fünf Fingern mach' ich kapüter noch die Bauer. Her mit die Kaffiwasser, Signorina!« Er legt die kranke Hand auf die halbentblößte Brust, wirft schmachtend den Kopf zurück und singt ihr mit harten R-Lauten sein Italienerlied. – Dann stockt er jäh und zischt einen Fluch heraus. Des Bauern grobe Hand zerrt ihn herunter.
» Tonnere! Was will der Vagabund hier?«
»Was, Vagabondi? Dalli, dalli! da hab's!« Wütend schlägt er dem Bauer das Blechgefäß wider den Kopf. »Klotz, grobes Du! Per dio! Jetz geb's mich Kaffiwasser und scher Dich!«
Da kneift der Bauer die Lippen ein, schüttelt den Italiener, als wolle er ihn in Stücke reißen und schleudert ihn mit einem machtvollen Ruck zur Toreinfahrt hinaus. Schweigend rafft der Italiener sich auf, sagt kein Wort, keine Drohungen, aber um seine Lippen kräuselt sich ein leichter, weißer Schaum, seine Augen rollen in tödlich drohenden Blicken nach dem Bauer zurück. Seine Kinnbacken mahlen wie das Gebiß eines Raubtieres. Er will sprechen und kann nicht. Die Wut erstickt ihn. So geht er und heult innerlich vor Raserei.
»Meister Gièt,« sagt Gètrou, und ihre Knie schlottern, »das hat 'was zu bedeuten. Der kommt wieder, der Italiener, und dann steckt er Euch den Hof in Brand. Guter Gott! Der tut Euch etwas an.« Und als er noch immer unbeweglich steht, zupft sie ihn am Ärmel. »Meister Gièt, der lauert Euch im Venn auf. Nehmt einen von den Türken mit, wenn Ihr abends heim müßt, die sind handfest. Ja, das müßt Ihr, so lange die Eisenbahner noch hier herum sind. Gute Gott! Ihr habt ihm beinahe die Knochen gebrochen – und wegen dem bißchen Kaffeewasser!«
Da streckt er den Arm aus, dessen Muskeln wie Drahtbündel zusammenlaufen und auf dem Handrücken ruckweise herausschwellen – eine weit ausholende Armbewegung, und er fegt sie hinweg wie eine Feder.
»Wegen dem bißchen Kaffeewasser!« spricht er ihr grimmig nach, »'s ist kein Kaffeewasser mehr, 's ist Gift, Gètrou!« Er macht zwei lange Schritte, steht wieder und läßt den Kopf hängen, den Giètkopf, der viereckig ist und gegen die Mauern anrennen möchte, » hai, ja, was bin ich einer geworden. Das kommt von dem Gift! Ich kann den Dampf nicht mehr riechen, der von drüben herzieht – Fremdengeruch – püff!« Er spuckt aus, und dann wieder mit zwei Schritten zurück zu dem Mädchen. Die Hand legt er ihm vertraulich auf die Schulter und zischt ihr ins Gesicht: »Meinst wohl, ich ließ mir von der Lokomotive über's Dach pfeifen? Ich könnt's hören, wie das Tag und Nacht an meinem Hofe vorbeirasselt? Nenni da! Eher steck' ich – ich meinen Hof in Brand und laufe ins Venn, in die Torfhütte der Mäher. Dann hab' ich mein Haus im Moor und hör' sie nicht und seh' sie nicht und kann meine Tage in Ruhe verbringen,« sein Griff wird fester auf ihre Schulter; sie muß stille halten, wiewohl es sie schmerzt, »vielleicht kommt auch der Alexand heim und versteht's besser und kann den Dampf riechen und die Dampfpfeife hören und die Fremden sehen. Dann mag er auf'm Gièthof der Meister bleiben und sein Vater, der Starrkopf, geht – na, jetzt weißt wohin. Ja, Mädchen, sieh mich nur an, wunderst Dich über den Meister Gièt, den alten Schwätzer.« Er dreht sich kurz um, faßt nach der Wagendeichsel und will die schwere Karre aus den tiefen Rinnen des Jaucheplatzes herausziehen. Ihm ist, als müsse er seine Kraft an irgend einer Unmöglichkeit stumpf reiben. Gètrou, die nach dem Gehörten starke Zweifel hat, ob der Bauer seinen richtigen Verstand noch besitze, springt ihm bei und greift in die Radsparren. Ein Ruck und Knirschen in den Karrenwänden, die Räder schälen sich aus dem durchfeuchteten Boden; in die leeren Rinnen sickert und schurpft das Jauchewasser. Noch ein Anstoß, ein Plantschen, ein Schurfen der Räder, die sich herausheben, und die Karre rollt über den harten, ausgedorrten Hofboden.
Daditte kommt mit mürrischem Gesicht vorbei und fällt über die Küchenarbeit mit einer Schaffensgier her, die verdächtig ist.
Die Wassereimer plumpsen auf die Herdbank, der Schemel fliegt zurück, auf der Anricht' ein Rücken und Scharren mit Kaffeemühle und der Blechdose; und dann steht Gètrou mitten in der Küche, überwindet ihren Groll und sagt:
»Mit dem Meister Gièt scheint's mir schlimm zu stehen.«
»Ja, guter Gott! Das mein' ich auch. Es muß sehr schlimm mit ihm sein, wenn er im Hof steht und mit der Krebsenmattestochter tuschelt.«
Da scharrt das Mädchen auf den Absätzen herum, legt sich ins Küchenfenster, stützt die Arme auf, das Kinn in die Hände und sagt's in verzweiflungsvoller Ruhe:
»Ja, die Krebsenmattestochter – die Krebsenmattestochter, die muß wieder ins Venn, eher geben sie ihr die Ruh' nicht!«