
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
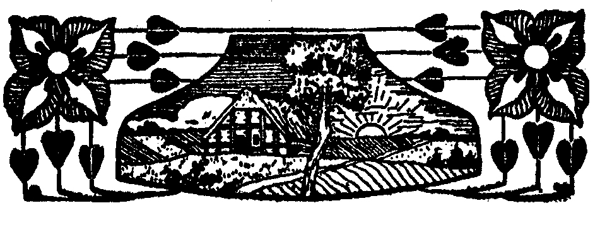
Über dem verfilzten Vennboden schwamm die Glut der niedergehenden Sonne.
Ein Moorhuhn klagte im Weidengebüsch am Tümpel. Ein schwerer, feuchtwarmer Dunst sickerte in das blaßgrüne Torfmoos. Die Unendlichkeit des Himmels lag auf der unendlichen Weite der Moorfelder.
Von dem neuangelegten Schienenstrang der Eifelbahn her ein ferner Schall! Der verlor sich wie ein wirrer, stumpfer Laut im Moor. Todeseinsamkeit! und darüber ein heiterer Himmel – und hier und da eine Gruppe schweigsamer Menschen mit gekrümmtem Rücken und straffem Haar, herbe Linien in den strengen freudlosen Gesichtern – eine triste Heidestimmung versteinert in den scharfen Zügen!
Das sind die paar Frauen in dem Sourbrodter Torfwerk. Die Sumpfluft hat ihnen das heiße Wallonenblut ausgetrocknet. Das Venn verschlang ihre Stimmen; im Moor lachte keiner. Leichendunst steigt aus den Sümpfen. Wer kann denn zwischen Gräbern lachen?
Feuchtwarme Luftwellen fluttern in ihre langen, sackleinenen Hemdkittel und stöbern sie auf. Die schwarzen Hutbänder flattern um die steife Strohhaube und den weißen, gemusterten Nackenschleier. Zu zweien und dreien stehen sie in der langen Furche, die den schlammigen Boden spaltet, stechen mit den Spaten die Torfstücke aus und werfen sie zum Trocknen in Haufen. Tiefer graben sie die Mulden, bis über die Hüften stehen sie schon darin. Unter ihnen sickert und plantscht das Sumpfwasser. Da schnallen sie die Bretter an die Holzschuhe und graben weiter in dem schwanken Boden.
In das Gerüst, wo die Torfkuchen zum Trocknen aufliegen, rinnt die Sonnenglut in roten Tinten und auch um die schmale Gestalt, die an den Trockengestellen hantiert. Ein Luftzug bläst ihr den Hut in den Nacken. Da greift eine braune, kleine Hand danach – keine Bauernhand und auch kein Moorgesicht ist's. Die Sonne leuchtet hinein und vergoldet die Haarsträhne, die ihr um die leichtgerötete Wange streicht. Mit ärgerlichem Aufzucken knotet sie die Strähne in die Haarflechte ein, und dann ein schneller, lauernder Blick nach dem aufgeworfenen Torfhaufen hinüber.
Dort steht einer in blauer, kurzer Leinenjoppe, den breiten, schwarzen Filzhut in den schmalen Kopf gedrückt, – unbeweglich, scharf ausblickend; stiere, graugrüne Augen in dem gelben, verlederten und bartlosen Gesichte. Wie ein einsamer Schatten ragt er in dem Moore empor. Mit einer hastigen Bewegung stellt er den einen Fuß höher auf den Torfhaufen, stützt den Arm darauf und neigt den Oberkörper vor. So lauert er zu dem jungen Mädchen hinüber.
» Abin?« Seine Stimme ist blechern hart, fast herausfordernd. Der Wallone hat ein Wort, in das alle seine Gemütsbewegungen hineinfließen und das doch nichts bedeutet. Es liegt ihm so handlich, daß es in jede Redelücke hineinpaßt. Das ist » Abin«. Der Aufseher glaubt damit alles gesagt zu haben und wartet. Die Menschen im Venn reden nicht viel. Die junge Wallonin zuckte beide Schultern hoch, schielt zwischen den Gerüststangen durch und fragt:
»Was willst?«
»Könnst längst hier fertig sein. In die Grube 'runter, hepp!«
» Aie sicola!« (Ja, warum nicht gar.)
»Hast Dir hier nichts 'rauszunehmen, bist wie die andern.«
» Sicola!«
»Hier bin ich der Meister, Du gehst, hai?«
»Schweig, Meister Marnette, ich geh' nicht, tin (so)!
Er macht einen langen Schritt zu ihr hinüber.
»Du willst mich ärgern, hai, Gètrou?«
»Grad' das nicht. Hätt' ja nichts davon.«
» Hoûte (hör') Gètrou, so kenn' ich Dich. Würdest nicht den Finger krumm machen, wenn Du nichts davon hast.«
»Würdest Du 's?«
Sie fährt mit einem Ruck herum, verschränkt die Arme über die Brust und lacht – lacht gellend, es schallt schreckhaft in das Moor hinein, und hinten – ganz hinten im Weidengebüsch am Tümpel zittert der Nachhall wie ein wirrer Schrei. Die geduckten Köpfe in der Mulde fahren empor. Große, dummstaunende Augen starren zu dem Paare herüber. Das erbittert den Aufseher, dem der Ärger in den Hals steigt. Aus dem Torfhaufen reißt er einen feuchten Klumpen los und schleudert ihn in eine Mulde.
» Hai-là (heda), dummes Weibsvolk!«
In dem Sumpfwasser klatscht es auf. Der Morast spritzt den Frauen bis zum Ärmel herauf, über der Mulde sieht man nichts mehr; nur ab und zu flattert ein Hutband heraus.
»'s ging daneben, J'han Marnette,« sagt sie und dreht ihm den Rücken, »hättest den Kopf treffen müssen, die dummen Bauernköpfe; die sind hart wie Kuhköpfe. Die Hörner fehlen, meinst, nicht auch, J'han Marnette? Dann könntest uns an den Hörnern fassen und schütteln, aie (ja), Meister Marnette. Aber bleib' mir drei Schritt vom Leib, nimm Dich in acht, ich kratze!«
Sie hat die Arme auf die Querstange gelegt und steckt den Kopf zwischen die Latten durch; so lacht sie ihn spöttisch an. Die innere Wut vibriert ihm bis in die Kinnbacken hinein. Mit kauenden Bewegungen würgt er seine abgerissenen Bewegungen heraus, greift in die Latten und rüttelt an dem Gerüst.
» Abin, wart' Du – Du! Wirst auch den Alexand Gièt (spr. Tschiä) kratzen, wenn er wiederkommt, hai? Daher nimmst gar die Hochnäsigkeit, hai? Der Alexand – hör' Du, Gètrou« – und nun sickert's ihm blutrot unter der graugelben Haut bis in die Schläfen hinein, »der Alexand hat Dich einmal in die rechte Backe gekniffen, da warst stolz. Wenn er jetzt vom Militär heimkommt, zwackt er Dich wahrscheinlich in die linke. So was macht man mit der Mam'zelle vom Krebsenmattes, hernach heiratet man die Bâbe. Aie, Gètrou, und nun weißt, worauf Du stolz sein kannst – auf'n Backenzwacker, pfui!« Er spuckt aus.
Nun zieht sie bedächtig den Kopf zurück, streckt die Faust durch die Öffnung, daß sie fast seine Schulter berührt und sagt es ihm dreist ins Gesicht:
»Grad' noch besser, als hätt' er mir eins auf die Backe gehauen!«
Er steht wie angenagelt, den Mund zusammengepreßt und durch die breiten Nasenflügel atmend. Da tritt sie vorsichtig einen Schritt von dem Gerüst weg und lacht ihn an.
»War's die linke oder die rechte, J'han Marnette? Der Alexand hat 'n gute Handschrift. Vielleicht hast's noch im Gefühl.«
Nun tut sie schon einen Sprung beiseite, denn er stürmt um die Ecke mit unheimlicher Schnelle auf sie zu. In plötzlichem Schreck kreischt sie auf und jagt um die Torfgerüste mit flatterndem Kittel und Hutband.
Mitten im Lauf hält er inne, wendet sich und läuft ihr entgegen. Sie prallt zurück, stolpert und fällt, blitzschnell aber wieder auf und quer in die Torffelder hinein. Leise stöhnt sie dazwischen und erstickt fast an der Schnelligkeit ihres Atems. Am Bein hat sie sich die Haut abgeschürft, und es brennt schmerzhaft. Hinter ihr her stampfen die schweren Schritte, da jagt sie über die Torfhügel in die ausgemergelten Mulden, auf allen Vieren an den steilen Wänden hinauf und dann über den verfilzten, harten Moorboden nach dem engen Feldweg hinüber. Die Holzschuhe klappern ihr an den Füßen, einer bleibt in dem Grubenschlamm stecken, den andern schleudert sie davon. Die Strümpfe reißen ihr in dem rauhen Gestengel des Heidekrauts, ihr Kittel verwickelt sich in den Ginstersträuchern, und dann fällt sie der Länge nach nieder. Ein Torfstück saust über sie hinweg, ein zweites plumpst ihr auf den Rücken. Als sie sich aufrichten will, steht er hinter ihr und greift ihr ins Haar.
» Halté-là! Jetzt zurück in die Mulden und Deinen Tagelohn abverdient, nachher kannst Dich meinetwegen zum Sankt Jakob nach Galizien scheren! Hepp, Mam'zelle vom Krebsenmattes! Hepp, Katz! Z'erst schneiden wir Dir die Krallen ab, dann wirst's Kratzen schon von selbst d'rangeben.«
Sie stemmt die Arme gegen ihn.
»Erst recht nicht!«
Da reißt er sie am Haar empor.
» Abin, ich soll Dich zwingen.«
» Oui don! oui don!« Schmerzenslaut. klagt sie und umkrallt seine Hand. Nun ringen sie miteinander! Er ist der Stärkere und rüttelt sie wie eine Strohpuppe zusammen. Da hängt sie an ihm wie eine Wildkatze und reißt ihm die Leinenjoppe entzwei und versucht in heller Verzweiflung loszukommen. Mit der derben Faust drückt er ihr fast die Schulter aus den Gelenken. Da reckt sie das Gesicht zur Seite und beißt ihn in wildem Zorn in die Hand. Ein verrohter Zug verzerrt sein knochiges Gesicht. Mit verbissenem Schnaufen bäumt er zurück, legt ihr die Faust an den Hals und drückt – drückt – sie schnappt nach Luft und kreischt in gellenden Tönen der Todesangst.
Aus den Torfmulden heraus arbeiten sich die Frauen und beschatten die Augen. Zu einer Gruppe drängen sie zusammen, und weithin sieht man ihre Nackenschleier flattern. Sie lehnen an die langen Spatenstiele und warten. Einer muß nachgeben; schließlich konnte die Krebsenmattestochter froh sein, wenn der J'han Marnette »Absichten« hatte.
Der war im stande, ihr einen Denkzettel zu geben, daß sie dran um die Ecke ging – so einer in seiner Wut!
Was war das? Ein Pfiff durchgellt das Moor. Von dem Feldweg her steigt einer den lehmigen Abhang zu den Torffeldern herauf. Ein Kopf mit breitkrempigem Filz, ein Vollbart, der in zwei buschigen Enden seitlich hängt, und höher steigt er – breite Schultern, über dem Arm ein Regenmantel, in der andern ein Stock. Mit dem fuchtelt er durch die mählich verdüsterte Abendluft und eilt in langen Schritten näher. Fast hat er die Ringenden erreicht, da läßt der Aufseher von dem Mädchen ab und schleudert es zurück. Es schnellt empor, duckt den Kopf ein, und dann husch! an dem Fremden vorüber, immer geradewegs dem Feldweg zu. J'han Marnette stemmt die Hände in die Seite und sieht an dem reckenhaften Manne, den er nicht kennt, hinauf. Seine zusammengezogenen Brauen sträuben sich wie Bürstenhaare.
»Hierherein darf keiner,« sagt er in grobem Bauernwallonisch. Der Fremde pfeift durch die Zähne und lächelt.
»Na, Mann, verstehe ich nicht. Ihr könnt doch deutsch sprechen, was?«
»Deutsch? Nenni (nein)!« schnarrt er heraus und dreht ihm den Rücken. Der Fremde klopft ihm leicht mit dem Stock auf die Schulter und fragt weiter:
»Aber französisch sprecht Ihr ja wohl.« Dann fängt er an, sich mit einigen Buchvokabeln abzuquälen. Marnette versteht ihn und nickt.
»Wenn ich nicht dazwischen gekommen wäre, hätten Sie das Mädchen wahrscheinlich umgebracht, was?«
»Wir Wallonen sind keine Vagabunden. Ihr Deutschen glaubt das? sack –,« er hält in seinem Fluch inne.
»Na, Mann, ein Deutscher seid Ihr doch wohl auch?«
»Ich bin Wallone.«
Der Fremde lenkt ab und fragt:
»Laßt Ihr hier auf eigene Rechnung und Gefahr austorfen?«
Ein Blick hellen Mißtrauens.
» Nenni!«
»Also nur Aufseher.«
»Meister.«
»Ein strenger Meister – hm; vielleicht habt Ihr auch einen strengen Herrn, was?«
» Meice (Meister) Gièt ist ein gutes, dummes Herrgottstier!«
»Oho, wieder ein Meister!«
Die buschigen Brauen schnellen in die Höhe.
»Wir nennen die Hofbauern alle Meister.«
Nun schreitet der Fremde einige Schritte voraus den Torfgruben zu. Ihm nach folgt J'han Marnette wie ein knurrender Köter, der von dem drohenden Stock zurückgehalten wird.
»Ihr habt gute Arbeit heute geschafft, aber viel könnt Ihr damit nicht konsumieren. Euch fehlt der Betrieb, die Ausnutzung, das Großkapital, was?«
J'han Marnette reißt die Augen auf.
» Tin (So)! Daran denkt keiner. Wir torfen soviel wir brauchen. Und Meister Gièt braucht viel. Für den schaffen wir Torf genug zur Feuerung und Brand. Was übrig bleibt, tragen wir nach Malmedy.«
»Na schau, da habt Ihr's ja furchtbar unbequem; Sourbrodt ist reichlich zwei Wegstunden von Malmedy. Wenn die neue Eisenbahn fertiggestellt ist, werdet Ihr's leichter haben.«
Mit energischem Ruck steht Marnette still, die langen Arme hängen ihm schlaff zur Körperseite herunter, der Kopf ist vornübergeneigt und mit düsterem Blick zu Boden.
»Wir Bauern brauchen keine Eisenbahn.«
»Ei nicht? Für ein paar Groschen seid Ihr drüben in Malmedy und braucht Euch nicht den Atem auszulaufen.«
»Wird nichts,« beharrt er, »für drei und fünf Pfennige billiger laufen wir zum Einkauf nach Malmedy, für unsere Bequemlichkeit haben wir keine Groschens. Die Deutschen können die Bahn wieder nach Aachen zurücklaufen lassen, sie holen uns keinen Zentimes aus der Tasche.«
»Na, Mann, Ihr vergeßt es nur, Ihr seid ja auch Deutsche.
»Wir sind Wallonen.«
Der geduckte Kopf fährt zurück. Aus den graugrünen Augen funkelt's wie Stolz. Über den nächsten Torfhaufen steigt er hinweg und kümmert sich weiter nicht mehr um den Fremden. Der stemmt den einen Arm in die Seite, stützt sich mit dem andern auf seinen Stock und schaut prüfend über die weiten Torffelder.
»Man müßte etwas daran wagen,« murmelt er, »die Zeit ist da, der armen Eifel ihre dürftigen Produkte abzuringen. Die neue Bahn erleichtert uns den Verkehr. Es müßten Aktionäre gewonnen werden.« Mit schneller Bewegung, als blitzte ein Gedanke in ihm hinein, wirft er den Regenmantel über die Schulter und stapft weiter in das Moor.
»Ist's gefährlich hier?« fragt er zu Marnette hinüber, der wieder unbeweglich bei den arbeitenden Frauen steht.
»Die Sümpfe liegen tiefer im Venn – drüben hinter Baracke Michel. Aber auch hier können Sie in Morast geraten, halten Sie sich rechts.«
»Ich danke Euch – adieu – und heh – Freund Marnette, vielleicht komme ich wieder.«
» Abin, dann wär's mir lieb, Euren Namen zu wissen.«
»Auch gut; ich bin Oberst a. D. Giese, adieu!«
Die Abendschatten nehmen ihn auf. J'han Marnette stampft auf einen Torfhügel hinauf, beschattet sich die Augen mit der Hand und späht über die zerstückelten Rasenflächen hinweg in den Dunstkreis, der übers Venn niedergeht. Trübrote Lichter hängen darin, eine lange Reihe, die in geradem Winkel von der Landstraße abbiegt. Das sind die Fackeln der Eisenbahner, die an dem Bahndamm arbeiten. Wenn das Schürfen der Spaten in den Moorgründen einmal absetzt oder nicht gerade ein Torfkuchen in das Grubenwasser niederplumpst, hört man deutlich das metallscharfe Klingen der Hämmer auf den Geleisen.
In den milchweißen Dünsten schwankt der Umriß einer Mädchengestalt. Sie hat die Holzschuhe in wilder Eile zusammengerafft und läuft irr und wirr über die graugrünen Moorfelder hin. Ihre Füße streifen zwischen den harten Stengeln des Haidekrauts hindurch; es schurft und raschelt, und unter ihren eilenden Tritten wappt der schwammige Rasen. Hier ein klaffender Spalt – da springt sie drüber weg! Dort eine Wildnis von hohen Binsen und Sumpfschachtelhalmen – da umgeht sie's in weitem Bogen, ein Geruch von faulendem Wasser und Morast stößt ihr entgegen. Unversehens flacht der Vennboden jäh ab. Ein weiter, kreisrunder Ausschnitt im Moorgrund; mitten drin ein Tümpel. Das Wasser ist schwarz und grundlos und unbeweglich wie ein Totenauge. Eine schleimige, weißgraue Haut liegt in langen Fetzen darauf. An den Rändern sickert das rote humussaure Wasser ein und saugt sich in die braune Moorschicht fest. – Müde vom Laufen setzt sich Gètrou auf den Rand und läßt die Füße den Abhang hinunter baumeln. Die lehmkörnige Erde bröckelt ab und rieselt in den Tümpel hinunter. In das stille Wasser schießen ein paar Kreise, dann erstarrt's wieder zur Unbeweglichkeit. Die junge Wallonin schaut hinunter, krause Gedanken frösteln ihr durch die Seele.
Wie ein ungeheuer großes, schwarzes Brillenglas sieht's aus. Ein Fußtritt darauf – ob's klirrt? Unsinn! Das Wasser wird aufplantschen – das stille, dunkle, unbewegliche Wasser! Aber vielleicht könnte man hinunter sehen, wo es zu Ende ging – tief drunten im Schlamm. Sie schüttelt sich. Was dort für ekliges Getier hausen mochte! Hier oben kroch schon widerliches Gewürm genug herum, wo man stand und saß, frech die Kleider hinauf, und Beulen stach es in die Beine. Aber stiller noch war's drunten als hier oben. Mußte das eine fürchterliche Stille sein!
Sie zieht die Knie ein, legt die Arme darüber und das Kinn darauf und sieht hinunter, neugierig – es war zu dumm, aber es zog sie wie Heimweh hinunter; ein inners Quälen und Unbefriedigtsein drängt sie. Sie weiß keinen Grund und kommt doch nicht aus der Unruhe. Sie ist müde, fast zu müde, um die Augen von dem großen schwarzen Brillenglas loszureißen. Der Abendhimmel leuchtet darein in violetten Farben, eine rote Spreu dazwischen, ein wirres, zitterndes Farbengeblinzel! Das bohrt sich in ihren stieren Blick fest. Und dann schießt eine dicke Wasserspinne über den Tümpel – kreuz und quer darüber hin. Und wo sie mit den fadendünnen Beinen in das schwarze Wasser hineintippt, läuft ein kaum merkliches Zittern über die dunkle, sumpfige Fläche, und die schlammgraue Haut fältet sie zu vielstrahligem Geäder – ein Ruck! und spannt sich wieder, straff, schlammglatt!
Das Mädchen zieht die Schultern hoch, streckt den Kopf lange aus und rutscht ein Endchen den Abhang hinunter. Das Heimweh zieht, das Unbefriedigtsein drängt. Morgen mußte sie zu den Torfgruben zurück, mußte! Der Krebsenmattes würde sie mit den Haaren dahinschleppen – und dann der J'han Marnette mit gespreizten Beinen und dem bösen Lächeln um den bartlosen Mund! Morgen würde dasselbe geschehen wie heute, und alle Tage so weiter, bis er sie einmal am Genick faßt und in die Mulde wirft. Vielleicht blieb sie da tot liegen oder brach irgend etwas, das Bein oder den Arm. Das war schlimmer; sterben mußte das Angenehmere für sie sein. Es war also jedenfalls besser, im Tümpel da drunten einmal nachzusehen, ob er wirklich so tief sei – so grundlos – und ob es still da drunten war – stiller noch als im Moor! – Zögernd schiebt sie die Füße weiter, stemmt die Arme ein und rutscht nach. Die Erde löst sich rechts und links von ihr und rinnt zwischen dem niederen Ginstergestrüpp durch in das Wasser. Es klukst und quirlt und zieht einen Wirrwarr von Kreisen ineinander über einander wie lange Wasserarme, die sich weiten und dehnen und in offener Umarmung sich umfangen. Mit gewölbtem Rücken beugt sie hinab, der Kopf bäumt in leisem Schaudern zurück; ein übelriechender Dunst legt sich ihr auf die Augen; giftige Gasbläschen gurgeln aus dem Sumpfwasser heraus und betäuben sie. Mit schreckhaftem Blick reißt sie die Augen auf. Ein Gesumme von unzähligen Mücken umtost sie. Sie wirbeln wie eine Staubwolke in dem mattroten Schein, den der Abendhimmel wirft. Ihr scheint fast, als sei sie schon drunten – und über ihr wölbe sich das große, ungeheure, schwarze Brillenglas – – und ganz still war's und kein Streit – – und kein Unbefriedigtsein – und nur fern, weltfern die Rohrdrommel mit melancholischem Seufzen – – ach! und wenn dann einer käm ...
Sie ist ganz willenlos; sie fühlt zwei Arme über ihre Schultern herlangen und biegt hinein, und wenn's der J'han Marnette wäre! Aber der ist's nicht. Die harten Laute der wallonischen Sprache rollen an ihr Ohr; so kann nur der Bauer Gièt reden. Sie hastet auf, da hält er sie. Die Stirn runzelt er, daß die buschigen Brauen zu einer schnurgraden Linie zusammenrücken.
»Sapristi! Hätt'st bald dringelegen, wenn mich nicht grad' der liebe Patron vorbeigeführt hätte.«
»Ja, Meister Gièt, ich hätt' bald drin gelegen.«
Sie klettert den Abhang hinauf und setzt sich wieder auf den Rand. Er steht unten, stemmt die Arme in die Seite und schnarrt sie an:
»Hör', faule Kröte, Dich jag' ich fort, wenn Du Dir die Zeit stiehlst, um Dein Gesicht im Sumpfwasser zu besehen, aie.«
»Ja, Meister Gièt, jagt mich fort – sonst spring' ich doch noch 'runter.«
Er stutzt, da schaut sie an ihm vorüber, fast sehnsüchtig in den Tümpel hinein.
»Ihr hättet doch vorbeigehen sollen, der liebe Patron meint's nicht gut mit mir.«
Jetzt hackt er die benagelten Schuhe in den Lehmboden ein und steigt zu ihr hinauf.
»Was ist's mit Dir, Gètrou?« Mit dem Knie auf den Rand gestützt, steht er neben ihr: »Du kannst mit mir schon frei reden, ich hab' fast graue Haare.« Er schiebt den Bauernfilz zurück. »Da schau, an den Schläfen fängt's an. Man fühlt's Altwerden, und daß man einen großen Sohn hat und sonstwie allein steht in der Welt und die Wirtschaft durch fremde Hände besorgen lassen muß. Luk, Gètrou, all das fühlt man, wenn man anfängt, alt zu werden. Und nun kannst Du im Vertrauen reden; alte Leute ehrt man dadurch.«
Sie stiert noch immer vor sich hin.
»Ihr habt's ja gehört, Meister Gièt, jagt mich fort, oder – na, Ihr wißt's ja, heim gehe ich dann nicht.«
»Hast Du Streit mit irgendwem gehabt, sag'?«
»Geht nur zu dem J'han Marnette, der wird's Euch sagen, wie schlecht und niederträchtig und verworfen ich bin.«
»Mag der Marnette zum Sankt Jakob nach Galizien geh'n,« bricht er los.
Da schlägt sie die Augen zu ihm auf, die dunkeln, wirrfragenden Augen, die jetzt fast kindlich verklärt ihn anstrahlen.
» Bon diu (Guter Gott)! Glaubt Ihr dem J'han Marnette denn nicht?«
Er findet nicht gleich die Antwort darauf; es beengt ihn etwas, der helle Blick ist's aus dem Dunkeln, – fast zu hell aus dem düstern Verschlossensein! Er fühlt etwas wie Verantwortlichkeit diesem Mädchen gegenüber, das er am Rande des Tümpels dem Leben erhalten hat, und nun sagt er das Zärtlichste, was der Wallone an milder Innigkeit ausdrücken kann: »Alte,« sagt er, »Alte, ich schlage dem Marnette zwei Beulen an die Stirne, wenn er Dir was antut.«
»Wenn er mir was antut, was liegt denn dran? Es ist am gescheitesten, Meister Gièt, Ihr jagt mich fort.«
Ihr Widerstand stachelt seinen Eifer auf.
»Ihn jag' ich zum Teufel! Zwanzig Kerle wie diesen da finde ich schon!«
»Das tut's nicht, Meister Gièt, denn mit allen zwanzig werde ich das selbe anfangen, und Ihr müßtet sie alle zwanzig fortjagen.«
Da weiß er nichts mehr und sieht sie ehrlich besorgt an. Ob ihr Verstand gelitten hat?
»Wenn ich nur wüßte,« beginnt er langsam und reibt sich das unrasierte Kinn, »was man Dir eigentlich tun könnte.«
Das Verklärtsein ist aus ihren Augen gewichen, eine wilde, weinende Sehnsucht spricht daraus. Sie langt mit den Armen zu ihm hinauf, umspannt mit krampfhaftem Druck seine Hüften und schreit ihm die leidenschaftlichen Worte zu:
»Laßt mich aus dem Torf hinaus! Ich will nicht in die Gruben, ich will nicht zu den Torfweibern. Ich hasse diesen langen, häßlichen Kittel! Ich will aus dem Moor! Aus dem Moor! Hört Ihr, Meister Gièt, ich ersticke im Moor!« Und dann klammert sie sich an ihn wie eine Flüchtende, die Schutz sucht.
»Ihr habt andere Arbeit, die Ihr mir geben könnt. Laßt mich auf Euren Hof, Meister Gièt!« Ihre Stimme erstickt im Schluchzen. »Auf Euren Hof nehmt mich mit, und dann laßt den Marnette im Venn. Ich glaub', ich hasse ihn nicht einmal so sehr wie die Moorluft. Die wird mein Gesicht so gelb trocknen wie seins, und mein junges Gesicht hab' ich nur, Meister Gièt, das will ich halten – das muß die Krebsenmattestochter haben – bon diu, sonst weiter hat sie nichts!«
Er steht in hölzerner Unbeholfenheit vor ihr und begreift und versteht sie nicht, aber das eine weiß und will er, so schnell als möglich aus diesen weichen Armen herauskommen, ehe ein Menschenauge ihn erblickt, ihn, den Andri Gièt, den reichsten Bauer in Sourbrodt. Er packt sie sachte bei den Schultern; da fallen ihre Arme schlaff herab, ihre Augen weiten sich schreckhaft und sehen über seine Schulter weg. Jenseits des Tümpels taucht ein struppiger Kopf auf. Der Krebsenmattes grüßt herüber und springt dann in den Feldweg hinein, der zur Landstraße führt. Gètrou drückt den Hut in den Kopf und will gehen. Ein Zittern läuft ihr über den Rücken bis in die Haarwurzeln. Ein unangenehmes Gefühl quält sie, und das war das Bewußtsein, von ihrem Vater überrascht worden zu sein. Aber sie hatte doch nichts Böses getan. Vielleicht war's nicht recht, dem Bauer an den Hals zu springen wie eine Wildkatze. Ob er böse war? Sie schielt zu ihm hinüber. Da begegnet sie seinem Blick. Der war ernst, fast mitleidig, aber die buschigen Brauen standen wie Bürstenhaare ab und vibrierten mit der zuckenden Stirnfalte.
»Hör', Alte,« sagt er rauh und patscht ihr mit der Hand auf die Schulter, daß sie fast in den Knien zusammenknickt, »meinetwegen kommst Du morgen auf'n Hof und gehst mit zur Mahd. Mähen kannst Du doch?«
»Vor drei Jahren konnt' ich's schon. Jetzt könnt's mich wieder einer lehren.«
»Wieder einer? Wer war vor drei Jahren Dein Lehrmeister?«
»Der Alexand.«
»So, der Alexand. Wenn der von den Soldaten heimkommt, ist die Mahd vorbei, auf den kannst Du also nicht warten.«
»Dann müßt Ihr mir's zeigen; denn wenn man mir's schlecht vormacht, kann ich es nicht gut nachmachen. Der Alexand hat es mir nach einem Gang beigebracht.«
»So, der Alexand. Wie alt warst Du damals?«
»Jetzt bin ich neunzehn.«
»Warst also noch ein Kind.« Das schien ihn zu befriedigen. Er stapft über den unebenen Boden zum Feldweg hinunter, und sie geht neben ihm her. Ab und zu sieht er sie von der Seite an; er traut ihr noch nicht und fürchtet eine neue Verzweiflungstat.
»Gètrou,« sagt er und bleibt mitten im Wege stehen, »in der Hauswirtschaft fehlen mir zwei gesunde, kräftige Arme. Du kannst der Daditte zur Hand gehen. Komm also morgen auf den Hof.«
Er schurft weiter, die Hände auf dem Rücken unter dem Kittel.
»Und machst, daß Du mit der Daditte zurechtkommst,« knurrt er, ohne nach ihr zu sehen.
»Ja, Meister Gièt, ich mach's.«
Er geht weiter auf dem holprigen Lehmweg. Da verengt sich dieser zum Pfad, und sie tritt hinter ihn.
»Und wegen dem Lohn kannst Du Deinen Vater schicken,« spricht er über die Schulter zurück.
»Ja, Meister Gièt, ich schick'n.«
Mit den breiten benagelten Sohlen stampft er große Fußeindrücke in den aufgeweichten Boden. Sie tritt mit den klumpigen Holzschuhen in diese Spuren hinein und sieht, daß sie die Fußabdrücke des Bauern immer noch nicht ausfüllen. Ihr Blick gleitet an seiner Gestalt hinauf, an dem breiten Rücken, dem stämmigen Nacken und dem Kopf, der fast viereckig ist – an der Stirne stehen ihm förmlich die Ecken heraus. Das alles fällt ihr auf, als sie hinter ihm hergeht und die ungewöhnlich großen Fußspuren sieht. Sie weiß keinen anderen wallonischen Bauer, der so groß und trotzig und stämmig ist. Und gerade so ist der Alexand; um einen Kopf höher als die übrigen kleinen Wallonenburschen. Sie ist ordentlich stolz darauf; denn nun gehört sie zum Hausstand der Gièts und freut sich, daß sie die reichsten und größten sind. Sie möchte dem rauhen Mann vor ihr etwas Liebes sagen und ruft ihn an:
»Meister Gièt!«
» Hai?« Er überspringt eine Wasserlache, wendet halb den Kopf und sagt, »brich' den Hals nicht!« Nun findet sie den Mut nicht und schweigt. Zur Rechten taucht die Landstraße wie ein weißer Streifen in dem Abenddunst auf, weiterhin einige Dorfhütten, links fluttert der Qualm aus den Fackeln auf. Der Bauer steht und beschattet die Augen. Da tritt sie dicht an seine Schulter.
»Meister Gièt!«
» Hai?«
»Habt Ihr auch in Berlin bei den Soldaten gestanden, wie der Alexand?«
Er fährt herum, daß die Schuhsohlen im Lehmboden knirschen. Sie weicht vor seinem Gesichte zurück. Der Kopf scheint alles Blut aus dem Körper aufgesogen zu haben.
» Tonnerre!« flucht er, faßt mit zwei Fingern die Falte seines Kittels und schüttelt ihn, »den hab' ich meine Lebenszeit getragen und niemalen den bunten Rock.«
Mit weitausholenden Schritten stapft er weiter und bricht stoßweise los – fast mehr zu sich selber.
»Ein wallonischer Bauer soll nicht aus dem Kittel heraus, und er soll nicht in den Soldatenrock. Dann messen sie ihn nach dem deutschen Maß, und das ist ein anderes; nach den deutschen Knochen taxieren sie ihn, und das sind andere. Besser, der Alexand wäre 'n Krüppel geworden, als nach Berlin gekommen. Deutsche Worte würfelt er in die Briefe ein. Die versteht keiner von uns, die decke ich mit dem Daumen zu, damit mir der Alexand nicht fremd scheint; und dann lese ich und bin nicht befriedigt und fühle es mehr, als ich's sehe: Den haben sie nach deutschem Maß gemessen!« Er schüttelt die Fäuste über dem Kopf. »Im Namen Gottes! Wenn sie ihm nun auch das wallonische Herz verdorben haben … Im Namen Gottes!«
Sie prallt zurück. Er sprach den ärgsten Fluch, der im Wallonenlande widerhallen konnte. Das hört man nicht gern, ohne im Stillen dem Herrgott die Schmach abzubitten.
» Sicola. Im Namen – –« Sie wagt's ihm nicht nachzusprechen. »Oh, Meister Gièt!«
Er packt sie schweigend an der Hand, so fest, daß sie glaubt, die Knöchel müßten ihr knacken, und nun biegt er mit ihr ab zu dem Bahndamm hinüber. Die Fackeln stäuben und lassen noch ab und zu einen rötlichen Schein über den Schienenstrang hinzucken. Hacken, Schaufeln und Stemmeisen liegen übereinander, daneben auf einer Schiebkarre leere Säcke und Hämmer. Von den Arbeitern niemand mehr. Er drängt sie an das Geleise und tritt mit den genagelten Schuhen darauf, daß ein schrilles Klinken heraustönt.
»Gètrou, das ist's, was mich erbittert. Ein Messer, da siehst Du's, haben sie mir an die Kehle gesetzt, ein langes, zweischneidiges Messer. – da liegt's – so lang, daß Du kein Ende sehen kannst! Ein Stück Land haben sie mir abgeschnitten damit. Der Starke dem Schwachen! Sie hatten ein schönes Wort dafür: Enteignung! Hörst Du's, Gètrou, ein deutsches Wort! Hast Du seit Menschengedenken bei uns ähnliches gehört? Und jetzt schau da herüber.« Er faßt sie an den Schultern und dreht sie dem Hause zu, das kaum fünfzig Schritte weit von ihr mit steilem Dach in den Abendnebel ragt. Ein Wiesenland, das zur Kuhweide dient, füllt den Zwischenraum aus. Ein einfaches Kreuz aus Eisen und mit kurzer französischer Inschrift besagt, daß es alldort für die arme Seele des alten Paskal Gièt errichtet worden sei. In einem Glasgehäuse brennt an jedem Samstag der Gottesmutter zu Ehren ein rotes Ampellicht. »Armsünderkreuz« nennen sie es, und das kannte man in der ganzen Umgegend bis nach Malmedy hinunter.
» Luk, Gètrou, da steht nun das Armsünderkreuz des alten Paskal Gièt. Dreißig Jahre hat's an derselben Stelle gestanden – dort!« Er tritt wieder mit dem Schuh gegen die Schienen. Ein Funke blitzt heraus. »Dort stand es; das weißt Du. Wer den Wiesenpfad ging, blieb drei Herzschläge lang stehen und tat einen Seufzer für die arme Seele meines jäh verstorbenen Vaters. Mit der Sense über der Schulter kam er heim und fiel hier tot zusammen. Kein Gras haben wir mehr an der Stelle wachsen lassen, ein Kreuz stellten wir darauf; und dann kamen die deutschen Ingenieure und rückten es weg, fünf Hasensprünge ab von der Totenstelle; da sei's auch gut – auch gut! Hörst Du's, Gètrou? Und nun weißt Du's, warum ich das Deutsche hassen muß und warum ich fluchen muß. – Geh' jetzt heim, und morgen kommst Du her auf meinen Hof und bringst den Krebsenmattes mit, daß ich mit ihm red'.«
»Gut' Nacht, Meister Gièt, und Gott behüt'!«
Sie steht noch und sieht ihm nach, wie er unter dem Torbogen, der in die hohe Hainbuchenhecke hineingeschnitten ist, verschwindet.
Aus dem Venn herauf steigen die schwarzen Schatten und decken sich über die Dorfhäuser. Die Fackeln sind bis zu einem kleinen Stumpf niedergebrannt und verlöschen. Eine züngelnde Flamme leckt noch über den abgegrasten Boden hin und verglimmt knirschend in einer Pfütze. Dann eine Säule von Qualm und Funken, ein scharfer Teergeruch und nichts – mehr. Mit ein paar Sprüngen ist das Mädchen auf der Landstraße drüben. Die Holzschuhe klappern ihm an den Füßen; sie schurft die sandige Straße weiter an vereinzelten Dorfhütten und Höfen vorüber und mitten durch Sourbrodt. Die Bauern liegen vor den Türen und rauchen, die Bäuerin hockt daneben beim Kartoffelschälen. Die Haustüre steht weit offen, und der Feuerschein aus dem Herd zuckt in langen Lichtsträhnen über die Steinfliesen bis zur Schwelle, sonst kein Licht in der Stube. Rechts biegt sie ab, der Dorfkirche zu. Als sie die lange Hecke des Pfarrgartens entlang geht, sieht sie in den Abendschatten die hohe, breitschulterige Gestalt des Dorfpfarrers. Die Hände hat er auf dem Rücken, den Daumen in das Brevier eingeklemmt, da, wo er zu lesen aufgehört. Man vernimmt seine festen Schritte im Gartensand und sein Gebetsmurmeln in der Stille des Abends. Ihre helle Stimme klingt ehrfürchtig zu ihm hinüber: »Gute Nacht, Herr Pastor,« und ein gesenkter Kopf schwebt längs der Hecke hin.
Zwischen Pfarrhaus und Kirche zwängt sich ein Häuschen ein, vorlaut und frech wie sein Bewohner. Dort hinein verschwindet das Mädchen. Ein blechernes Wirtshausschild baumelt über der Tür, und hinter dem Hause her führt ein kürzerer Weg über die Felder und weiterhin nach der Baracke Michel auf das Venn. Manch einer im Dorf setzt den Kirchgang durch das Wirtshaus fort oder kehrt da hindurch hurtig vom Felde heim. Es war eine gut angelegte Falle, und bisher wußte man keinen im Dorfe, der nicht schon einmal hineingegangen war. Dem Pfarrer war dieser Nachbar unbequem, aber der Krebsenmattes, der in gleicher Distanz von der Kirchentür wohnte, behauptete, unserm Herrgott kein unwillkommener Anwohner zu sein. Wer sein Gebrechen an Leib und Seele hatte, ging zum Krebsenmattes. Der murmelte Zaubersprüche und gab Salben. In des Teufels Namen tat er's nicht, das machte er den Bauern klar. Des lieben Herrgotts Namen wollte er auch nicht in seinen Zauberkram hineinziehen, so nannte er es seine Kunst, und die war das fünfte Evangelium der Sourbrodter.
Wie das Mädchen in die Küche eintritt, liegt der Krebsenmattes der Länge nach auf der Herdbank, raucht aus der kurzen Wallonenpfeife und stiert zu den Querbalken der Decke hinauf. Die ist von Ruß und Rauch glänzend schwarz gebeizt und zeigt die nackten Bretter des Speicherbodens. Neben ihm auf der Dorfmauer hockt der Dorfhirt Michi (spr. Mitschi) die Füße auf der Herdbank und die Ellenbogen breit auf dem Knie. In der zwischen den Knien herabhängenden Hand hält er das Schnapsglas und leckt von den Lippen den brandigen Geschmack.
»Gott behüt', Michi, gut' Nacht,« sagt sie, schlüpft aus ihren Holzschuhen heraus und kommt auf Strümpfen über die unbehauenen, unregelmäßigen Steinplatten. »Schon wieder Dein Kosttag heut' hai, Michi?«
Er blinzelt zu ihr hinüber und klunkst den Rest seines Glases hinunter. Michi hatte als Schafhirt sein faules Unterkommen. Die Schafe, die nicht sein waren und die er doch seine Schafe hieß, mußten ihn ernähren, wie die Kinder den Vater. Wer ihm drei zur Weide gab, beköstigte ihn einen Tag. Der Krebsenmattes hatte nur ein Schaf, ein schwarzes, das er zur Nacht an einem Pflock in der Wiese festband, und stellte dem Michi das Abendbrot und drei Schnäpse, genau drei! Sie zählten beide gewissenhaft. Der Michi wollte nichts verlieren und der Krebsenmattes auch nicht. Wenn von den 365 Tagen einmal sein letzter war, weiß Michi nicht, wo man ihm die Augen zudrückt. Beim Krebsenmattes hätte er sich im Tod gar noch heimisch gefühlt. Wenn dem Krebsenmattes ein niederträchtiger Gedanke kam, hatte der Hirt für einen ganzen Weidtag genug, um ihn weiterzuspinnen; und sauber war's auch gerade nicht bei ihm – kurzum zum Leben und Sterben für den Michi vortrefflich.
Er pitscht die Augen zusammen, als müsse er an dem scharfen Fusel, für den sie im Wallonenland den Namen Pékèt haben, ersticken.
» Tin volà (so, hier!), Gètrou!« schnalzt er zu dem Mädchen hinüber, »gieß mir noch eins ein. Wer den Teufel im Leib hat, muß ihn schmoren. Dein Pékèt, Krebsenmattes, brennt ärger wie die Hölle. Was hast für Kräuter dazu gebraut? Distelwasser oder Brennesselsaft? Sapristi, Alter, und klein sind Deine Gläser, laß sie eichen!«
»Zwei!« zählt der Krebsenmattes und legt zu dem ersten Span einen zweiten auf die Herdmauer. Desgleichen knöpft Michi den zweiten Knopf seines Wams zu und schneidet sich ein Primchen Kautabak zurecht. Die Krebsenmattestochter geht zum Mauerschränkchen, holt einen Krug heraus und füllt das Gläschen. Ein Überguß rinnt ihr über die Finger, den schlenkert sie mit Widerwillen ab.
» Bièsse (Rindvieh)!« schreit sie der Vater Wirt an, »trink's ab! So 'was leckt man bis zum letzten Tropfen. Hör', der Michi hat nichts dagegen, wenn Du den Rand frei trinkst, n'est don (nicht wahr), Michi?«
»Ich trinke keinen Pékèt – Deinen nicht!« Sie schnippt angeekelt die Lippe auf.
»Grad' wie die Mam',« beeilt sich der Hirt einzuschalten und langt schon mit einer gewissen Gier nach dem Glas, »grad' wie die Mam', Eure Selige. Die wollt auch Deinen Pékèt nicht trinken und mußt' doch sterben.«
Der Krebsenmattes hat sich kerzengerade auf die Herdbank gesetzt und stellt den Mund nach dem, was er sagen will. Aber erst muß das Mädchen dort in seiner Art zu hasten und zu arbeiten inne halten, damit ihm kein Wort verloren geht. Seine kleinen, nichtssagenden Augen, die unter weißgelben Brauen unstät herrollen, heften sich an jede ihrer Bewegungen. Er wartet in gespanntester Aufmerksamkeit, bis sie das Blasrohr vom Herdhaken heruntergenommen und damit in das Feuer eingeblasen hat; dann sagt er zwischen der Pfeifenspitze durch, die er unter den Zähnen hält:
»Von meinem freilich nicht. Auf dem Gièthof gibt's besseren, ohne Distelwasser und Brennesselsaft. Vielleicht legt der Meister Gièt Dir noch ein Stück Zucker hinein, und dann kannst es ohne Bitternis trinken. Ja, Michi,« ruft er zu dem hinüber, »der Meister Gièt hält was auf meine Tochter. Den schimpfiert's nicht, mit ihr aus'm Venn heimzukommen, ihn nicht, den Meister Gièt! Was meinst Du, Michi, mich schon eher, quai (was)? Ich bin Vater, quai?«
Er hält inne, gleichsam um die Wirkung seiner Worte zu erproben. Mit grellen Blicken stiert er sie erwartungsvoll an. Ihr Mund liegt am Blasrohr, so bemerkt er nicht das geheime Zucken desselben. Und nun bläst sie ihren Zorn und ihre Empörung und den ganzen Widerwillen, der in ihr gärt, in den engen Rohrlauf hinein. Die Glut im Herd faucht auf, die Funken spritzen und sprenkeln heraus; hüpfen über die Herdmauer und weiter wie lose Irrlichter auf die Herdbank und auf die Steinplatten hinunter, wo sie verkohlen und weißlich verglühen. Die zwei Männer sind aufgesprungen. Michi stäubt sich die Funken aus der Schafwolle seines Wams und schimpft leise. Dem Allerweltskostgänger glaubt keiner seinen Ärger, warum soll er ihn also heraussprechen? Über des Krebsenmattes Gesicht zerrt und reißt ein ganzes Heer böswilliger Absichten. Er sucht geradezu nach dem Gemeinsten, womit der Wallone seinen Worten Nachdruck gibt und sagt:
»Willst Du aufhören, ti (Du)!« Da bläst sie mit aufquellenden Backen in die Glut und freut sich des roten Sprühregens, der in die dunkle Küche hineinstäubt, und der Wut, die in platten Schimpfworten gegen sie anprallt. Mit einem hellen Auflachen schleudert sie dann das Blasrohr in den Torfwinkel neben dem Herd und springt die Leiter hinauf zum Speicherboden in ihre Kammer. Sie halten will der Krebsenmattes, da knistern schon die Bodenbretter unter ihren Tritten. Er sieht nach der Decke hinauf. Zwischen den Ritzen pulvert Staub und Heusamen herab, und dann hört man nichts mehr. Sie liegt im Heu und wühlt den schlanken Körper hinein und lacht und – lacht. Die Männer horchen auf. Es konnte auch sein, daß sie weinte. Der Krebsenmattestochter war so etwas zuzutrauen, so etwas Närrisches, Unverständliches, das kein Mensch begriff.
Der Hirt schiebt sich wieder auf die Herdbank und denkt nach, was in diesem Falle das Vernünftigste war – reden oder schweigen? Es fällt ihm das Wort ein, das nichts besagt und nichts bedeutet und doch auf alle Gemütsstimmungen des wallonischen Herzens paßt.
» Abin!«
Da fährt der Krebsenmattes los.
» Abin? Und was weiter? Willst Du jetzt Deinen dritten?«
»Das auch.« Er gießt den Rest die Kehle hinunter, stülpt das Glas in die flache Hand um, schlürft dort den letzten Tropfen heraus und reichts dem Mattes. »Ich meine, Cousin, Dein Unkraut wächst gut,« er weist mit dem Daumen die Decke hinauf, »das wirst Du nicht mehr beschneiden können.«
Der Krebsenmattes schenkt ein, stellt für sich ein zweites Glas daneben und räkelt sich wieder auf der Herdbank.
»Michi, Du hast mir noch eine Antwort zu geben.«
»Hast Du denn etwas gefragt, Cousin?«
»Ja, meiner Seel'! vorhin, ehe die Katze uns mit ihrem Feuer davonblies. Meinst Du, ich als Vater kann es zulassen, daß der Großbauer Gièt mit meiner Gètrou aus'm Venn kommt?«
» Sia, das kannst Du,« blinzelt der Hirt, »das Venn ist weit, da kann jeder herkommen, da laufen hundert Wege zusammen. Warum nicht auch der vom Gièthof und Krebsenmatteshaus. Jede Fußspur ist'n Pfad im Venn. Mach Dir kein Kopfzerbrechens, Cousin, das reicht nicht hin, um ins Dorf 'n Gered' zu bringen.«
»Ja, Michi, der Meister Gièt müßte schon seine dicken Bauernarme auftun und mein Mädchen hineindrücken, daß es aussieht – hai, Michi –, als hätt' er sie umarmen wollen!«
»Ffft! Das tut der Meister Gièt nicht.«
»Warum nicht, Michi?«
»Weil sie die Krebsenmattestochter und Du der Krebsenmattes und er der Meister Gièt ist.«
Nun beugt sich der Mattes mit gekrümmtem Rücken und eingeducktem Kopf vor.
»Er hat's getan, tin!«
Der Hirt lacht gleichmütig in sich hinein.
»Wie Du spaßig bist, Cousin!«
»Im Namen ... Es ist wahr!«
»Wer hat's gesehen?«
»Ich.«
»Wo?«
»Am Wasserloch, heut' abend.«
»Du warst wahrscheinlich betrunken, dann sieht man manches, was man gern möchte.«
» Hoûte, Michi, schau' nach der Tür 'nüber, die ist auf, da kannst Du noch 'rausfliegen, Sèze (weißt Du), Michi.«
» Abin, wenn ich dann zum Gièthof ging –«
» Sicola! wirst Dich hüten. Wenn Du ein gescheiter Narr sein willst, dann gehst Du eher schon zum Schöffen und zum Pfarrer und dann zum alten schwarzen Speckschwarte Spitznamen, die niemand im Wallonenlande übelnimmt. und dann zum Weißschnabel und zum großen Blutegel. Du kommst ja vielerorts herum, und man ist versessen auf Deine Geschichtlein. Es ist nur Dein Vorteil, wenn Du denen eine saftige Neuigkeit bringst, weißt, Michi, eine solche, die man nur tuscheln darf, bei der man die Köpfe zusammensteckt und die Augen verdreht und Leibgrimmen vor Pläsier hat. Da kommt's auf einen Pékèt mehr oder weniger nicht an – auch mir nicht; hai, Michi, trink' aus.«
»Auf Deine Gesundheit, Cousin!«
Durch die offene Tür drängen die Abendschatten, es wird völlig dunkel in der Küche. Ein scharfer Wind stößt vom Venn herüber und in die Turmluken der Dorfkirche hinein. Aus dem düstern Moorgrund hebt sich schwer und nebelfeucht die Nacht.