
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ein feiner Regen umstäubte das zarte Grün der Küste vor Yokohama, nachdem wir einige Stunden vergeblich im Nebel den Eingang in die Bucht gesucht hatten. Es war der poetische Frühlingsregen, den Japaner anhimmeln, der mir aber gar nicht dichterische Begeisterung entlockte, schon deshalb nicht, weil zu meiner Reiseausrüstung wohl die Erika, nicht aber ein Regenschirm gehörte. Erstens bin ich von überflüssigem Tragen kein Freund, und dann sind Schirme heimtückische Gebilde, die sich zu Unzeiten zwischen die Beine schieben und diesen wie dem eigenen Rückenmark dadurch gefährlich werden, und nebstbei fehlt ihnen auch noch der nötige Takt, wenn zufällig nicht gleich mitgenommen, sofort »hier« zu schreien. Wenn ich aber in dichterischen Höhen schweife, vergesse ich gegen Ladentische lehnend, etwas so irdisch Nebensächliches wie einen Schirm. Ich tröste mich damit, daß man tiefer als bis zur Haut nicht naß werden kann, und kaufe lieber Hüte, die gegen eine gelegentliche Durchweichung nichts einzuwenden haben.
Kaum waren wir auf dem Land, so wurden die Russen gesprächig. Wir aßen zusammen Curry und Reis in einem kleinen Gasthof europäischer Art, durchwanderten ganz Yokohama und nahmen erst am Abend Abschied. Ich fuhr nach Tokio und übernachtete im Seyvkken-Hotel. Auf dem Bahnsteig gewann ich den ersten Einblick in japanisches Denken. Der Träger Nummer 3 war ein nettes Bürschchen und schleppte alle unsere Sachen zu den verschiedenen Zügen. Als ich nun als Letzte den Tokiozug erwartete, fragte er nach einigem Zögern und mit seinem freundlichen östlichen Lächeln:
»Ich bitte um Entschuldigung, aber sind Sie ein Mann oder eine Frau?«
Bis auf den Bubikopf ist nichts Männliches an mir als meine männliche Seele, die wenig weibliche (und meine Feinde würden wohl behaupten, überhaupt keine) Tugenden entwickelt hat. Ich erwiderte daher etwas erstaunt: »Ich bin eine Miß.«
»Das dachte ich mir auch,« meinte er sichtlich befriedigt, »aber Sie standen nämlich immer bei Männern.«
Himmel, wenn es so einfach wäre, sich zu verwandeln, wollte ich gern den ganzen Rest meines Lebens immer neben Männern stehen …
Die Erfüllung eines Wunsches.
Ich hatte den Wunsch gehegt, bei Russen zu wohnen, um wieder einmal Sprachübung zu haben, und mit Freuden las ich daher, daß ein Zimmer in einer russischen Pension unweit der Ginza in Yurakucho Sanchome zu haben war. Ich steuerte denn auch los, diese Pension zu finden, doch anstatt wie ein denkendes Wesen mit Fragen irgendwo zu beginnen, fuhr ich drei Stunden auf der Elektrischen rund und rund durch ganz Tokio, immer in der Hoffnung, durch Zufall in das Europäerviertel zu gelangen. Ich gelangte nie dahin, weil es kein solches Viertel gibt.
Zum Schluß hatte ich einen Geistesblitz beim Vorbeifahren an der Druckerei des englischen Blattes, in dem ich die Anzeige gelesen hatte, und dort erfuhr ich die Lage von Yurakucho. Eine Viertelstunde später geleitete mich ein sehr höflicher Japaner in einem Rock (so erschien mir im ersten Augenblick die aus gelegten Falten bestehende Studentenhose, Hakama genannt) bis an das Haus, und wieder eine Viertelstunde später hatte ich ein Zimmer ohne Kost in der russischen Pension erhalten. Es kostete vierzig Yen monatlich (achtzig Mark), besaß nur Bett, Tisch und kleinen Schrank und ein einziges Fenster, das die Aussicht auf die Eisenbahnbrücke, die grauen Dächer Tokios und auf ein japanisches Gasthaus frei ließ. Daraus kann man ersehen, daß für Europäer das Leben ungewöhnlich teuer ist.
Die Russin war eine gebildete, ältere Dame, die Tochter sehr schön, lieb und ganz jung. Sie nahmen sich meiner mehr an, als dies sonst unter Fremden der Fall ist, und die Tochter machte gegen Abend lange Rundgänge mit mir, wobei sie mir allerlei Interessantes zeigte.
Nach Bezahlung der Wohnungsmiete blieb mir ein geringer Betrag, aber ich war bei guten Leuten und vor allem unter Europäern, und daß es mir gefallen würde, merkte ich sofort.
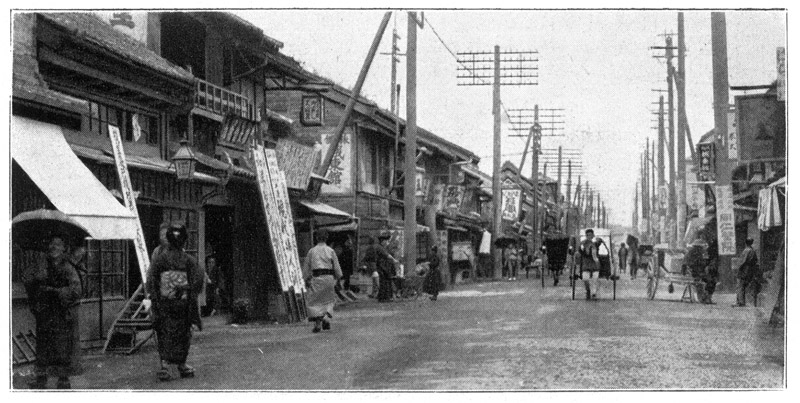
Japan: Eine Hauptstraße in Tokio
Der Tee im Amt.
Alle, an die ich Empfehlungsschreiben hatte, kamen mir lieb entgegen, besonders wo es sich um Japaner handelte. Vicomte Sh. forderte mich auf, ihn in seinem Amt zu besuchen, und als ich dort eintraf, brachte uns der Diener sofort Tee in kleinen henkellosen Tassen. Das ist immer so bei jeder Geschäftsunterredung und jedem förmlichen Besuch. Trinkt man die Schale leer, so wird damit angedeutet, daß der Besuch sein Ende erreicht hat.
Japaner interessieren sich sehr für Politik, und er erkundigte sich sofort nach meiner eigenen politischen Einstellung. Er machte mich mit sehr reizenden Polen bekannt, und durch diese kam ich mit Dr. B. zusammen, einer Reichsdeutschen, die mir außerordentlich entgegenkam, und der ich viele Annehmlichkeiten und später viele Schüler verdankte. Ihr Gatte war Hochschullehrer an der Handelsakademie, sie selbst arbeitete im Laboratorium der größten chemischen Fabrik Tokios. Sie war herzensgut, aber im Gegensatz zu meinen Honolulufreunden, die alle Geisterseher waren, durchweg stofflich in allen Anschauungen, und wenn ich von physischen Vorempfindungen sprach, schrieb sie das meinem Magen – eigentlich der darin vorherrschenden Leere – und nie meiner Seele zu. Sie fußte ganz im Natürlichen und zog mich wahrscheinlich schon durch den unbedingten Gegensatz an, denn in mir steckte immer ein gewisser Hang zur Mystik, den der Osten und besonders die Südsee mit ihrem Zauberwesen noch vertiefte.
Der Mann in der Wanne.
Durch Vicomte Sh. erhielt ich die Anstellung für einen Ferienkurs an der Meiji-Universität, die sich besonders mit fremden Sprachen beschäftigt. Frau M., eine Japanerin, die in Frankreich aufgewachsen war, und die sich von ihrem japanischen Gatten geschieden hatte, weil sie behauptete, daß die sechs Jahre an seiner Seite verlorene gewesen waren (man sieht, wie sehr Erziehung auch auf das Rassentemperament zurückwirkt), hatte mich um fünf Uhr zur ersten Unterredung bestellt. Fünf Uhr bei Japanern bedeutete gegen sechs, so daß ich im ganzen Gebäude nicht eine Seele zu entdecken vermochte. Ich gelangte endlich in den großen Hof, in dem in einer Ecke eine große Tonne und darin ein Mann stand oder saß. Er erblickte mich ebenfalls und kroch langsam aus dem heißen Wasser, nichts als das schmalste weiße Stoffstreifchen als Lendentuch um. Wir verbeugten uns sehr förmlich voreinander und ich gab mein geringes Japanisch, das aus »bitte« und »verzeihen Sie gütigst!« bestand, zum Besten. Da sein Englisch meinem Japanisch glich, sprachen wir nur mittels Zeichen; dann verbeugten wir uns wieder sehr höflich. Er sprang in die Tonne zurück, und ich begab mich über eine der Treppen in den zweiten Stock hinauf.
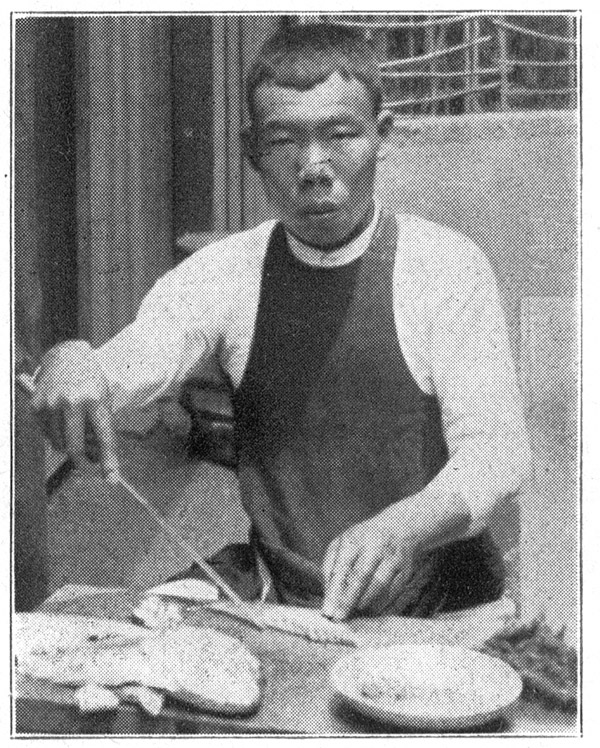
Japanischer Koch
Unter Duplikaten.
Die dunkelste Zeit meines Japanaufenthaltes war, als ich die Anstellung bei einer reichsdeutschen Maschinengesellschaft erhielt. Das dort verdiente Geld ermöglichte es mir, meine Honoluluschuld, die eine Ehrensache war und mir deshalb schwer auf dem Herzen lag, zu decken, während die Einnahmen vom Abendkurs einerseits und einigen Stunden, die man mir in der Pension verschafft hatte, andrerseits hinreichten, um mein Zimmer zu bezahlen und kärglich zu leben.
Ich bin nie im Leben für den kaufmännischen Teil einer Sache gewesen; ich habe weder richtig zu rechnen, noch meine Arbeiten praktisch in Geld umzusetzen gewußt; mir ist alles, was mit Kaufen und Verkaufen zusammenhängt, in die Seele hinein zuwider. Am meisten Maschinen. Und dazu war bei diesem Handelshaus ein Herr, dessen Erscheinen mir das Mark in den Knochen gerinnen ließ. Er warf mit »Schweinehund« herum, und seine Augen gingen mir wie der Dorn eines Kandelaberkaktus durch und durch. Wenn er mich ansah, erstarben alle Gedanken in meinem Gehirn.
Aber vielleicht hätte ich mich in diesen Betrieb, in dem die Schreibmaschinen unaufhörlich klapperten, die Befehle über mich hinsurrten, die Fernsprecher klingelten und die Japanerinnen trippelten, hineingefunden, wenn nicht so viele Umstände, die nichts mit der Firma zu tun hatten, ungünstig eingedrungen wären.
Erstens die Sommerhitze. Die Tropen sind kühl gegen Tokio im Juli und August. Ein Ofen, aber nicht ein trocken heißer, sondern ein Dampfofen! Die Kleider schimmelten und veränderten die Farbe; die Schuhe wurden grün, das Haar hing in Strähnen, die Kleider klebten an der Haut, und die Nächte mit den zahlreichen Stechmücken und der ungenügenden Luftmenge waren so furchtbar, daß die schöne Zina und ich eines Abends draußen auf dem Hinterbalkon schliefen. Erst quälten uns die Mücken tot, und gegen Morgen fiel ein so starker, ungesunder, kaltnasser Tau, daß wir Gliederschmerzen davon hatten, und das frischere Lager aufgeben mußten. Am Tage seufzten wir mit Frau K., so oft wir uns trafen:
»Ach, kako zarkoje!« (Ach, wie heiß es ist!)
Ich aber mußte ins Amt, und zwar um halbzwei Uhr nachmittags, nach einem Weg von zwanzig Minuten am heißen sonnebeschienenen Kai und hierauf saß ich hinter einem Vorhang, der glühend zu sein schien und ein der Sonne zugekehrtes Fenster notdürftig verdeckte. Da saß ich von zwei bis sechs oder halb sieben, denn bei Reichsdeutschen gibt es in dieser Hinsicht keine Ordnung. Man bleibt, so lange Arbeit ist, und wenn die Stunde noch so lange geschlagen hat. Bei Amerikanern und Engländern wird man nicht nur weit höflicher behandelt, besser bezahlt und mit mehr Vorteilen aus dem Hause (Preisermäßigung usw.) bedacht, sondern man geht immer pünktlich auf die Minute weg und erhält Ueberzeitgeld, falls man wirklich einmal bleiben muß.
Drittens war ich – ohne mir dessen ganz bewußt geworden zu sein – seelisch noch so erschüttert, daß ich meine Gedanken nicht vollkommen zu sammeln vermochte. Nur in der Schriftstellerei – vermutlich weil mein ganzes Herz dabei war – vergaß ich nichts: sonst flog alles aus mir heraus wie Spreu vor dem Wind, und ein Festhalten irgend einer Sache kostete mich furchtbare Anstrengung.
Viertens, und alles hing möglicherweise damit zusammen, war ich hochgradig unterernährt. In San Francisco Brot und Tee, in Honolulu ebenfalls und nun, in Japan, folgende Nahrung:
Zum Frühstück ein Stück Salsenbrot um zehn Sen; mittags Bohnenröllchen – fünf, wieder um zehn Sen; abends um zehn Sen rote Pfirsiche, und der Mann, von dem ich sie erstand, wußte so gut, daß es mir auf Menge und nicht auf Güte ankam, daß er mir immer eine Anzahl halbverfaulter als Uebergewicht schenkte. Diese Bohnenröllchen aber waren das Entsetzlichste, was ich mir denken konnte. Ein unangenehmer, dünner, süßlicher, breiiger Teig und darin eine blauschwarze Masse aus zerdrückten süßen Bohnen! Aber sie waren billig und füllten den Magen. Dennoch, wenn ich dem Schrecken des Maschinenbetriebs gegenübersaß, der eben von einem reichlichen Mittagsmahl kam und seine Verdauungszigarre rauchte, dachte ich mir nicht selten:
»Ich möchte gern wissen, was du leisten würdest, wenn du nach schlaflosen Nächten vom frühen Morgen an unterrichten, in der größten Hitze mit leerem Magen auf der Maschine klappern und abends Studienwanderungen von zwei Stunden Dauer machen müßtest, auf die nichts als rote harte Pfirsiche und ein heißes Bett folgen durften!«
Niemand wußte davon, und selbst daheim in der Pension machte ich immer ein Gesicht, als ob ich mich richtig satt gegessen hätte.
Der »Asahi Shimbun«.
Dr. B. machte mich mit der Reporterin des » Asahi Shimbuns«, des bedeutendsten Blattes von Tokio, bekannt, und dadurch wurde ich nicht nur eingehend besprochen, was mich mit vielen Leuten zusammenführte, von denen ich lernen konnte, sondern ich schrieb von da ab öfter für die Zeitung selbst oder die Beilagen und verdiente dabei genug, mich endlich aus dem Morast des Mangels zu winden. Mein Bild, das eines Tages erschien, glich einer kraushaarigen Asiatin mit einem Mund wie ein Ofentürl, aber dennoch schrieb mir ein junger Mann aus dem Norden und bat mich, mein Reisebegleiter werden zu dürfen. Ich solle ihm indessen heimlich antworten, da er mit mir zu entfliehen gedenke, weil sein Onkel, der ein Sardinengeschäft betreute, ihn nicht ziehen lassen wolle. Ich riet ihm liebevoll, weiter Sardinenbändiger zu bleiben, und erhielt so einem Onkel seinen kostbaren Neffen.
O ye, who tread the narrow way
By Tophet flare to Judgement Day,
Be gentle when the heathen pray
To Buddha at Kamakura.
R. Kipling.
Eine Stunde von Yokohama liegt das stille Fischerdorf Kamakura. Die mächtigen langgezogenen Wellen des Stillen Ozeans rollen feierlich heran und benetzen den Strand, außer wenn die unterirdischen Mächte grollen, die Erde erbebt und die wütende Springflut den Ort zu zerstören sucht.
Nicht immer war Kamakura so still wie heute. Nach dem Fall der Fujiwara, die sich zu sehr verweichlicht hatten, kam der stolze Krieger Yoritomo Minamoto und gründete Kamakura, die Ritterstadt. In dieser Zeit entwickelte sich der Ritterstand mit seinen Vorzügen und Nachteilen. Dem Ritter zu folgen, dem Fürsten die Treue zu bewahren, alles Schwache zu meiden, waren die führenden Ideale. Auch in der Religion war das sanfte Anrufen Amida Buddhas der Yodo-Sekte in die Angst vor der Hölle mit all ihren Strafen übergegangen, denn für so furchtlose Krieger bedurfte es eines stärkeren Halts als den hoher Ideale im Glauben. Der ungeheuere Gingkobaum, dessen Blätter wie Fächerchen sind die sich im Herbst lichtgelb verfärben, hat das Entstehen und den Verfall Kamakuras mitgemacht, und das Rot der neueren und älteren Tempel und Schreine leuchtet aus dem tiefen Sommergrün.
Was aber heute noch Kamakura berühmt macht, ist der Riesenbuddha, dessen Tempel die Springflut dreimal davongetragen und der auf einer geringen Anhöhe Wind, Wetter und dem verheerenden Erdbeben trotzt. Er sitzt auf einer sich öffnenden Lotosknospe, und die beiden Opferbecken zu seinen Füßen sind so groß wie ein Mensch. Wie ein Berg ragt er empor, und sein Anblick wirkt überwältigender, je länger man davor verweilt.
Er ist der beste Ausdruck des Buddhismus, den ich irgendwo gesehen habe. Die lose gelegten Finger verraten Ruhe, die Haltung ist natürlich, frei, ohne Steife, mit einem leichten Versinken, wie ich es liebe. Die Glieder haben die weiche Rundung des Weisen und Denkers, nicht die harten Schwellungen des Muskelmenschen, der die meisten Europäer so begeistert. Durch diese nachlässige Haltung entstehen denn auch die drei Bauchfalten, die dem Japaner größter Kunstausdruck sind, zeigen sie doch an, wie gut der Künstler eben die Ruhe, das etwas Kraftlose des Philosophen, das überwiegend Geistige seiner Gestalt dadurch festgehalten hat. Der tätige Westen freut sich wie ein Kind seiner Körperkraft, doch der denkende, sich vertiefende Osten sucht nach der Macht des Geistes, dem der Körper nur Gefäß, einzig Behelf und Ausdruck ist.
Der Buddhismus sucht Befreiung vom Zwang der Sinne. Ein allmähliches Hinauswachsen der Seele über das rein Körperliche, Stoffliche, das Aufgehen (nicht Auslöschen) in der Allseele, in der allein alle Erfahrung und alle Weisheit zu finden sind, dabei jene nirwanische Ruhe, die nichts länger erschüttert, die in sich alles gefunden hat, was die Welt in all ihrer Unbegrenztheit bieten kann.
Das alles drückt das Buddhagesicht aus. Eine übernatürliche erschütternde Ruhe liegt auf den stillen Zügen, und um den Mund ist ein feiner Zug – nicht Lächeln und doch der Anflug einer weichen Belustigung, der zu sagen scheint:
» Nichts, was da ist im wechselvollen Spiel des Veränderlichen, berührt mich, aber ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung heraus das Sehnen eines Menschenherzens, und nun lächle ich über den Trug, der dich gefangen hält und all dein Denken umnachtet, und bemitleide dich, bis du den Weg gefunden, der zu Nirwana führt!«
Man steht vor der ungeheuren Eisengestalt und fühlt etwas von dieser überweltlichen Ruhe, die uns schwermütig macht, weil unser schwaches Herz an das Vergängliche gebunden ist.
Hinter Kamakura führt eine lange Brücke zum Schrein von Enoshima, der in die Klippen eingebaut ist. Japanerinnen in ihren Kimonos, ein Kind auf dem Rücken, nähern sich, schlagen in die Hände, werfen eine Opfermünze und verschwinden wieder. Hier haust die Göttin der Schönheit, des Reichtums und der Kunst, und ihre Dienerin ist die Schlange, weshalb die Verehrer Bentens weder Schlange noch Eidechse, ja nicht einmal eine Schnecke töten wollen.
Etwas Weiches, Sonniges liegt über dem Glauben der Japaner. Auf meinen Wanderungen durch Stadt und Land stieß ich oft auf einen Fuchsschrein. Er ist der Erntegöttin Inari geweiht, und ihre Diener sind die Füchse. Sie tragen im Schwanz den Schlüssel zur Schatzkammer und bewachen nachts, unter dem scharlachroten Torii, dem Tempeltor, die Schatzkugel der Göttin. Zu ihnen betet man um Geld, und daher findet man immer einen Fuchsschrein hinter einem Geishaviertel. Ob den Füchsen oder dem Schicksal zu Dank – jedenfalls hatte ich immer genug Geld in Japan.
Die schönste Gestalt der Götterlehre ist Jizo. Er war der Lieblingsjünger Buddhas, und er verwirft niemand, wie sündhaft er auch sein mag. Sein Lächeln erlischt nie, und daher steht sein Bild auf dem Grab der Selbstmörder und der Ermordeten. An Straßenecken findet man ihn, auf der sich öffnenden Lotosblume stehend, und Mütter binden ein Kimonorestchen an seinen Arm oder werfen Kieselsteine in das Steinbecken, um den Jünger zu erinnern, daß er den Kleinen im Flußbett des Himmels helfe, wenn der böse blaue Teufel Oni und die Hexe Shodzukano-baba herbeifahren, um die Steinhaufen umzuwerfen, die jedes Kind für die Eltern errichten muß, ehe es in den ewigen Frieden eingehen darf, und zwar immer ein Steinchen für eine Sünde des Vaters, eins für eine Sünde der Mutter.
Das Totenfest.
Am liebsten wanderte ich abends auf der hellerleuchteten Ginza auf und ab und freute mich über die Enichi oder Abendmärkte. Da konnte man um wenig Geld sehr hübsche Sachen erstehen, und all das Treiben spiegelte den Charakter des Volkes. Da lernte man alle Schichten der Bevölkerung kennen und auch die Bedürfnisse des Einzelnen.
Anfang Juli hatte man das Fest des Ochskönigs und der Weberprinzessin gefeiert, und im Hain um Ueno hatten die Studenten Gedichte zu Ehren des Liebespaares an die Zweige gebunden, denn nur in dieser einen Nacht konnten die verbannten Liebenden von einem Ende der Milchstraße zum anderen gelangen, und zwar nur bei schönem Wetter, wenn die Elstern eine Brücke bildeten, über die hierauf die Liebenden zueinander wandern konnten. Kurz darauf feierte man das Bonfest – früher am siebenten Tage des siebenten Mondes – und die Ginza war an diesem Tage nicht nur abends voll Buden, sondern schon vom frühen Morgen an, und man sah in den hübschen Körben alle Erstfrüchte, viele davon noch unreif, die den Toten geweiht werden sollten. Noch ganz grüne, unbedingt frische Tatami oder Strohmatten lagen zusammengerollt da, und in Bambusvasen standen Lotosknospen.
Durch den ganzen Osten ist die Lotosknospe nämlich das Sinnbild der Seele; denn wie sich diese beim ersten Morgenstrahl mit einem Knall dem Lichte öffnet, so öffnet sich auch die Menschenseele beim ersten Strahl des ewigen Lichts erst zu voller Blüte.
Am Abend vor dem Bonfest werden die frischen Matten vor der Tokonoma oder Ehrennische des Hauptraumes ausgebreitet, die Erstfrüchte nebst Sake oder Reiswein und frischem Reis in kleinen Täßchen vor die Ahnentafel gestellt und im Hof zwischen Eingang und Haustüre ein Feuer angezündet, damit der Rauch den Seelen heimwinke. Sie werden nicht schreckhaft empfunden, diese heimkehrenden Geister; es sind die nächsten Verwandten, die an allem Anteil nehmen, die helfen und raten sollen und so gut zu allen Festen gehören wie die Lebenden selbst.
Den Sumidafluß hinab (durch Tokio) läßt man kleine Entchen aus Metall oder Papier, eine angezündete Kerze enthaltend, meerwärts treiben, damit auch die Seelen der Ertrunkenen eine Opfergabe haben, und daher wirft man auch alle Totenfrüchte endlich ins Wasser.
Ueberall sieht man ein warmes Erinnern, doch nirgends Trauer, die das Sein anderer Menschen verdüstern könnte. Es ist Grundzug des Japaners, seinen Kummer für sich zu behalten und niemand damit lästig zu fallen. Selbst wenn sie eine Trauerbotschaft ankündigen, tun sie es immer lächelnd. Sie sind Meister der Selbstbeherrschung, ohne dadurch streng zu scheinen.

Japan.
Links: Musikanten.
Rechts: Japanische Braut
Meine Nikkofahrt.
Durch Herrn Dr. B. erfuhr der englische Dichter und Professor E. Speight von mir und lud mich in sehr liebenswürdiger Weise ein, mehrere Tage in Nikko zu verbringen, und da ein Bankfeiertag sich angenehm zwischen Sonntag und Wochentag schob, konnte ich eines Abends abreisen.
Man fährt vier Stunden von Tokio nach Nikko, immer über eine fruchtbare Ebene langsam den nordwestlichen Bergen zu.
Auf dem Bahnsteig drängte sich die Menge. Mütter sprangen in die Luft, um damit das auf den Rücken geschnallte, laut heulende Kind zu beruhigen; andere Kinder, ruhig und mit tiefernsten Augen, die wie Glanzkohlenstückchen aus dem gelben Gesicht stachen, wischten sie ihre Tropfstumpfnase in Mutters frischgeöltem Haar; andere klammerten sich an die Kimonofalten und die allerreifsten trugen Bündel. Männer und Frauen überkugelten sich förmlich beim Einsteigen, und kaum hatten sie Plätze gefunden, so flogen die Sandalen von den Füßen und verschwanden die Füße unter dem Kimono. Alle steckten ihre kleinkopfigen Pfeifchen in Brand, taten zwei oder drei Züge und steckten sie vergnügt in das Gürtelband zurück. Alte Frauen mit mehr Glatze als Haar und mit schwarzleuchtenden Zähnen (in früherer Zeit mußten sich alle verheirateten Frauen die Zähne schwarz polieren, um fremde Männer nicht länger in Versuchung zu führen) schenkten Sake in kleine Täßchen, die sie auch irgendwo aus ihren Falten hervorzauberten, und tranken sich gegenseitig zu. Den verstauten Körben entströmte ein Sammelgeruch von Daikon, Bohnenkuchen und Fischen.
Die Kiribäume mit ihren Fächerblättern und dem seidigen leichten Holz, aus dem man die Getas oder Holzsandalen macht, begrenzten die Strecke, und immer wieder zeigte sich ein Lotosteich mit seinen weißen und seltener rosa Blüten und den riesigen tellerartigen Blättern. Nicht nur der heiligen Blüte wegen zieht man die Lotos. Die Wurzel ist, wenn in Scheiben geschnitten, ein hübsches und gutes Gemüse (weiß und durchlöchert wie ein Schweizerkäse), und die gebratenen Körner (der schwarze Same, so groß wie Mais) schmecken gut.
Allmählich, als der Zug an Geschwindigkeit und die Luft an Wärme zunahm, begannen die alten Männer ihren Kimono, unter dem nur das Lendentuch war, zurückzuwerfen und sich den Bauch zu fächeln und als dies keine fühlbare Erleichterung brachte, streckten sie der Reihe nach die Beine bis zum Oberschenkel zum Fenster hinaus. Hei, wie die frische Luft da das erhitzte Fleisch entlangflog! Kurz war indessen diese Freude; denn gar bald zeigte sich ein demütiger Schaffner und bat, »sich gütigst herabzulassen und die geehrten Beine hereinziehen zu wollen, denn ein vorübereilender Zug oder sonst ein unvermutetes bedauerliches Vorkommnis könnte die sehr ehrenwerten Beine mitnehmen« und so weiter. So kamen die Oberschenkel wieder unter die Kimonos und nur die Fächer flogen.
Mir gegenüber saß ein junger Mann mit viel gutem Willen und wenig Englisch. Er starrte mich lange an und fragte dann todernst:
»Meinerlieber fährt wohin?«
Zuerst wußte ich nicht genau, was er sagen wollte, doch lange Uebung mit Ausländern hat mich sprachgewandt gemacht, und so erriet ich, daß ich »Meinerlieber« war, woraufhin ich ihm mitteilte, daß ich nikkowärts steuerte. »Sag' nicht » kekko« (schön) vor Nikko«, das japanische » vedere Napoli e morire« wurde natürlich angeführt und mehreres über Meinerlieber gefragt. Plötzlich fuhren wir in einen Bahnhof ein, und der junge Mann warf mir den blauweißen Fächer, den er getragen, zu, indem er überstürzt über die Schulter zurückrief:
»Meinerlieber hat den Fächer!«
Sprach 's und verschwand auf immer aus meinem Leben. Ich fächelte mich noch jahrelang mit meiner Nikkogabe.
Um Japans Geschichte zu verstehen, muß man – ob man nun will oder nicht – ein wenig von Götterlehre einflechten. In alter, alter Zeit, als ein Gott sein Schwert in den Urschlamm steckte, zog er damit Japan an die Oberfläche, und weil der Schlamm noch wegspritzte, entstanden all die Inselchen, die den Zutritt erschweren. Amaterasu-o-kami, die Sonne, ließ später die beiden Himmelskinder Izanagi und Izanami herabsteigen und die Insel richtig formen. Izanagi als Mann, tat dies gewissenhaft, doch Izanami verweilte sich und überhastete ihr Werk, daher ist diese Küste auch voll Unebenheiten. Als sich die beiden Prinzen trafen, sagte er: »Wie angenehm, eine schöne Frau zu treffen!« und sie erwiderte: »Wie angenehm, einem hübschen Jüngling zu begegnen!« So geschah, was nach solchen Erklärungen gewöhnlich geschieht, und aus dieser Verbindung entstand Jimmu Tennu, der erste menschliche Herrscher von Japan, von dem alle anderen abgeleitet sind. Amaterasu-o-kami schenkte ihm die drei Schätze – den Spiegel als ihr eigenes Sinnbild, die Schatzkugel, die Ebbe und Flut regiert, und das Schwert, das dem Harun al Raschids ähneln soll. Diese drei Dinge sollen noch im heiligsten aller Shintoschreine, in Ise, aufbewahrt werden.
Da der Kaiser indessen von der Sonne abstammt und über alle Maßen heilig ist, schickte es sich lauge nicht für ihn, seine Füße bildlich oder wirklich auf den Erdboden zu stellen, und daher wurde er immer auf Händen getragen, gefüttert und blieb so eine Gestalt, die viel Ehren, doch keinerlei Macht hatte. Der Shogun oder Herzog – oder erster Minister in unserem Sinne – regierte in der Tat durch die vielen Jahrhunderte, und das Haus, dem er entstammte, war zur Zeit das mächtigste. So war es bei den Ashikagas, den Fujiwaras, der tragischen Familie Heke, bei dem Eroberer Toyotomi Hideoshi, der Nikko erbaute, und bei den Tokugawas, deren erste Regenten, Jemitsu und Inyatsu, in Nikko begraben sind und die das geschichtliche Nikko wirklich ausmachen. Während andere Anhänger prachtvolle Tempel (im wild überladenen, aber sehr wirkungsvollen Stil des goldliebenden Toyotomi) erbauten, legte ein Daimyo oder Prinz die herrlichen Kryptomeria-Alleen zur Erinnerung an. Diese sind nun dreihundert Jahre alt und eine Sehenswürdigkeit. Nicht so stark wie die kalifornischen Rotholzbäume, sind sie doch ebenso gerade und von prachtvollem Bau, überdies nur in Japan zu finden.
Durch diese lange Allee und den frischen, ganz ländlichen Ort hindurch erreichte ich die rote Brücke, die als Scharlachbogen das blaue Bergwasser überspannt, und wanderte durch den ansteigenden Wald, durch den man einen Ausblick auf die Tempel hat, bis zur echt japanischen Behausung Mr. Speights, der mir sehr herzlich entgegentrat und mit dem ich später und den ganzen folgenden Vormittag oben auf der Holzveranda saß, über alles Denkbare plauderte und seinen Gedichten lauschte. Ich schlief nach japanischer Sitte auf Steppdecken auf den Matten ausgestreckt und fand das im Sommer sowohl weich wie auch kühl, nur empfand ich ein gewisses stilles Heimweh nach den Schuhen, die nach japanischer Sitte unten geblieben waren.
Seltene Blumen, fremde Sträucher wiegten sich im Morgennebel, zuzeiten durchschnitt der Anschlag eines Tempelgongs lang und feierlich die Ruhe und starb im Schweigen unhörbar dahin, dann kreisten wieder die weißen Nebel und zwitscherte ein japanischer Fink im nahen Geäst.
Nachmittags stiegen wir höhenwärts, erblickten unten im Tal die hellgrünen Reisfelder, die aufschwirrenden Enten, die vereinzelten Torii, die buntgekleideten Menschen und bewunderten die figurenüberladenen Säulen, die geschwungenen Dächer, die flimmernden Nischen der reichsten Tempel von Dai Nippon, doch für mich war die fließende Beschwörung vor einem Bauernhäuschen bedeutungsvoller als all die Tempelpracht. Das war die Seele des Volkes, die sich hier äußerte. Eine Mutter war im Kindbett gestorben, und da hatte der Gatte der Sitte gemäß ein Seidentuch im nächsten Tempel gekauft, die vier Zipfel an einen Pfahl gebunden und darunter auf eine Bank einen Eimer und einen Schöpfer gestellt. Jeder, der vorüberging, sollte ein Gebet für die Tote sprechen und Wasser in das Tuch gießen. War das Tuch von Wind und Wetter ganz vernichtet, so war die Seele frei …
Bis dahin aber durfte man die Wäsche des Kindes nicht im Freien trocknen, denn da kam sie und weinte in diese Kleidchen, und da jammerte das Kind, sehnte sich fort und starb ebenfalls.
Eigentümlich ist ein japanischer Wald mit seinen Föhren und Bambus, fremdem Strauchwerk und farbigem Ahorn. Zuzeiten findet man lichtgelbe Affen, doch um sie zu sehen, muß man tiefer eindringen. Man ahnt den Tengu – den Luftgeist mit der langen Nase, der zuzeiten seine Bürde daranhängt, nachdem er die Nasenspitze einem anderen Tengu auf die Schulter gelegt hat – und den Shojo, der die Gewässer bewacht und oben, an Stelle von Haaren, eine Flüssigkeit trägt, die ihm Kraft verleiht. Er ist sehr gefährlich, doch hat er eine Schwäche: er will so höflich wie sein Nachbar sein, daher tut man gut, sich tief zu verbeugen, denn da muß er es auch tun; dabei rinnt die Flüssigkeit aus und läßt ihn kraftlos, und ehe sie sich neuerdings gesammelt hat, ist man schon über das Wasser hinweg und in Sicherheit.

Japan.
Oben: Oberpriester mit seinen Gehilfen.
Mitte: Die Teezeremonie.
Unten: Begrüßung des Hotelgastes
Im Yoshiwara.
Hinter dem Abendmarkt liegt der Kwannontempel, der zu den besuchtesten Tokios gehört und der Göttin der Barmherzigkeit geweiht ist. Als man sich nämlich nach der Naraperiode (um das Jahr tausend unseres Zeitalters) mehr an das Weltfremde des Buddhismus gewöhnt hatte und der Glaube eingebürgert war, bemerkte man, daß sich die Urkraft des treibenden Weltalles nicht nur als etwas Unvorstellbares äußerte, sondern auch durch Eigenschaften kundtat wie durch Licht, Güte, Barmherzigkeit und so weiter, und daher wurden diese Eigenschaften bildlich dargestellt und endlich auf diese Weise zu bestimmten Gottheiten.
Die Besucher trieben wie vom Wind getragene bunte Herbstblätter in den dunklen Tempel hinein, warfen Münzen in den Opferstock, verbeugten sich lächelnd und fluteten zum entgegengesetzten Tor hinaus. Jeder Beter riß am Gongseil, klatschte in die Hände, ließ die Gottheit teilnehmen an seiner Freude und empfahl sich ihr, um wieder davonzuflattern, vom Strom des Seins erfaßt. Draußen reihten sich die Theater und Erfrischungshallen um den Tempel, und dahinter, zu Fuß erreichbar, war die verbotene Stadt, das Yoshiwara.
Ein Maler – mein Zeichenlehrer, denn ich wollte gern etwas von japanischer Malart erlernen – begleitete mich. Am Schutzmann vorbei, der den Eingang bewachte, und am Liebestempel, an dem die beiden Sinnbilder geschlechtlicher Liebe in Relief zu sehen sind, gingen wir durch die vielen Straßen, und obschon wir am Ort der Sinnenlust waren, muß ich lobend betonen, daß die Freudenstadt in Japan bedeutend sittlicher als der beste Stadtteil einer südamerikanischen, besonders peruanischen Stadt es im grellen Mittagslicht ist – und auch weit sicherer! Ich wurde von niemandem belästigt, angesprochen oder irgendwie unangenehm angestarrt. Nur die alten zahnlosen Männchen in den Käfigen an jedem Eingangstor lächelten mir zu und forderten mich auf, einzutreten, indem sie die Preishöhe nannten. Selbst die Mädchen, die sich oben über die Galerien und Veranden neigten, waren tadellos gekleidet und betrachteten mich mit sichtlichem Vergnügen. Ich trug ein rosa Kleid von Pfirsichblütenfarbe, und man rief mir daher »hübsch, hübsch« zu. Wie sehr ich das Gegenteil war, ließ sich aus der Entfernung nicht erkennen, und das Kleid, ganz vorwiegend indessen die helle Farbe, war hübsch …
Die Häuser sind darin von den üblichen Bauten verschieden, daß sie keinen Zaun herum haben, mehrere Stockwerke tragen und die beiden Eingänge an jeder Hausecke mit einer Galerie verbunden sind, in der man die lebensgroßen Bilder der Schönen studieren und sich die wählen kann, die einem am besten gefällt. Früher saßen die Mädchen selbst hinter dem Gitter. Die Preise wechseln nach dem Wert der Frau. Eine enge, glattpolierte Treppe führt in den ersten Stock, und die Schuhe bleiben unten. Oben sind die Zimmer, und da die armen Mädchen ungenügend gefüttert werden, so ist es Sitte, daß der Mann zuerst ein Abendbrot bestellt. Es gibt auch Stammgäste, die sich untertags anmelden. Auch erfordert es die Sitte, solch einem Mädchen irgend eine kleine Gabe mitzubringen, daher besteht die Stadt aus einer breiten Mittelstraße, wo man alles, was man wünscht, kaufen kann.
Die Mädchen werden – das erfuhr ich erst viel später genau, als ich bei einem Japaner wohnte, der sich mit Geisha- und Yorobefreiungen beschäftigte und ewig mit der Polizei aus dem Kriegsfuß stand – sehr ausgenützt; denn wohl bindet sie der Vertrag nur zwei oder drei Jahre, aber sie machen unterdessen so viel Schulden (müssen sie, von der Not gezwungen, machen), daß sie in Wahrheit nie frei werden. Wollen sie infolge eines Sterbefalls in der nächsten Familie ausgehen, so werden sie von einem alten Weibe begleitet, sonst ist ihnen jedes Verlassen des Ortes verboten. Eins haben sie unseren unglücklichen Mädchen voraus: Es wird nicht als Schande angesehen, im Yoshiwara zu dienen. Viele verkaufen sich, um den darbenden Eltern zu helfen; viele, um einen begabten Bruder in Europa studieren zu lassen, und da die Ehen früher immer von den Eltern geschlossen wurden und die Eheleute sich wohl achteten, nicht aber liebten, spielen in Japan die Liebesgeschichten stets im Yoshiwara, und nicht selten gehen zwei Liebende zusammen in den Sumidafluß, um im nächsten Leben vereint bleiben zu können.
Mein Begleiter wiederholte mir immer, daß dies ein »ungezogener Ort« war, und auch, daß man Bekannte nie grüßen solle, weil man sich, der Yoshiwarahöflichkeit entsprechend, nicht erkennen dürfe. Er empfahl mir oft, mir die Schönen auf den Balkonen anzusehen, kniff indessen selbst die Augen zu oder starrte geradeaus, wohl der Versuchung wegen.

Japan: Musizierende Geishas
Die sieben Herbstgräser.
Ende September, die Zeit der sieben poetischen Herbstgräser, die man draußen auf der weiten Ebene um Tokio suchen, in die Vase der Tokonoma (Ehrennische) stellen und andächtig bewundern soll. Sie gehören zum Herbst- oder Erntemond, der immer tiefrot ist, weil sich der Ahornbaum auf dem Mondacker verfärbt und Glück bringt.
Ich hatte viele neue Schüler und war recht zufrieden. Einige lernten Englisch, andere Französisch und mehrere, ungewöhnlich nette, Deutsch. Sie waren alle sehr höflich, fleißig und angenehm, und überdies lernte ich eine Menge von ihnen. Zuerst lasen und schrieben wir, doch zum Schluß der Stunde mußte gesprochen werden, eine dem Schüler peinliche Aufgabe, da alle Lernenden behaupteten, es wäre so schwer – nicht nur sprachlich, sondern auch gedanklich – mit uns Europäern zu sprechen. Daher wählte ich immer etwas von Japan, und da der Schüler den Stoff beherrschte, ungemein gern über sein Land sprach und sich sehr bemühte, alles erdenkliche Wissen auf diesem Gebiet zu sammeln und auszukramen, waren wir beide sehr befriedigt von den Stunden. Ich erfuhr dadurch sehr viel und kam der Seele Japans so nahe wie ein Bewohner des Westens dies irgend kann; über die Schranke springt niemand.
Hierauf begann ich nachzudenken, warum wir so schwer zu verstehen sein sollten, und kam, nach langem Prüfen, zu folgendem Ergebnis:
Die Japaner sind viel unbeweglicher im Denken als wir, dafür aber ausdauernder und tiefer. Oft begann ich ein Gespräch, fand das Fortbewegen schwer, weil mein Zuhörer aus irgend einem Grunde nicht mitkonnte und ließ es fallen, um zu etwas völlig anderem überzugehen. Da starrte mein Schüler gewiß unsehend in das Zimmereckchen und antwortete nach geraumer Weile, nicht auf das, was ich seit vielen Minuten sprach, sondern auf das frühere Gespräch, das er mit Beharrlichkeit zurechtgeknabbert hatte. Die Japaner sind nicht für 's Sprunghafte. Die beste Art sie zu verwirren – auch wenn sie die Sprache gut beherrschen – ist das Springen von einem zu einem ganz anderen Gegenstand. Sie können nicht zehn Gedanken auf einmal wie eine Menge lauflustiger Jagdhunde an einer Leine halten; aber wir vermögen uns nicht so zu vertiefen. Gedanken zu sammeln, sie lange ausschließlich auf einen Gegenstand zu richten und alles Nebensächliche auszuschalten, ist für uns eine ebenso schwierige Leistung.
Einen einzigen Schüler mußte ich aufgeben, weil ich nicht imstande war, ihn länger anzuschauen. Er kam früh am Morgen vor dem Frühstück und gehörte der niedrigeren Volksschicht an. Höflich war auch er, doch von einem Taschentuch hatte er nie gehört. Seine Nase rann wie die Adelsberger Grottenbildungen. Mein Magen war der Nase nicht gewachsen. Ich erklärte, zu beschäftigt zu sein, und ließ Geld und Nase laufen. Die übrigen Schüler schnüffelten so lange es ging und benutzten hierauf Papiertücher, die im Kimonoärmel verschwanden. Dankbar und entgegenkommend waren sie weit über das europäische Mittelmaß hinaus, und wenn ich ein Volk zu den Engeln zählen wollte, müßte ich das unbedingt bei den Japanern tun.
Wann immer ich auf der Straße gehen mochte, nie wurde ich belästigt, zu jeder Zeit half man mir gern mit ausführlicher Erklärung und praktischem Beistand, und wenn mich jemand am Tage ansprach, so war es nur ein Schüler, der gern vier Sätze Englisch an den Mann brachte und sich über alle Maßen klug vorkam. Dann verbeugte er sich und verschwand, stolz mit einem waschechten Ausländer in des Ausländers trügerischer Sprache verkehrt zu haben.
Nicht minder belustigte mich, wenn es nicht regnete, das Warten auf die Elektrische. Japaner stehen da nicht wie wir, sondern sie kauern sich nieder und empfinden das als Ruhestellung. All diese kauernde Menschheit, manche Männer schon in europäischer Tracht, um einen Laternenpfahl geschart zu sehen, war sehr lustig, und heute kann ich auch kauern und mit einem Händler einen Fuß über dem Erdboden verhandeln, während ich die auf der Erde ausgelegten Waren betaste (schauen und nicht berühren gibt 's im Osten nicht) und um den Preis feilsche.
Eins empfand ich bis zur Unerträglichkeit: meine Kost. Ich arbeitete nicht mehr im deutschen Handelshaus, hatte meine Schuld beglichen und verdiente genug, um mein Zimmer zu zahlen, aber nicht in solchen Mengen, um mir die teure Pension leisten zu können. Etwas Reis täglich, eine Suppe oder etwas Gemüse hätte ich mir gern vergönnt, konnte mir diese Sachen indessen nicht beschaffen, denn im japanischen Hotel zweiter Klasse zu essen, hätte jenes unangenehme Aufsehen erregt, das ein Europäer gern vermeidet und hätte mich vielleicht in den Augen der Gelben, sicher in jenen der Weißen hoffnungslos herabgesetzt. Ich kaufte Sardinen, bis ich sie haßte, und lief um europäisches Gebäck bis weit über die Ginza; da schlug mir die Russin vor, ihre Tochter im Englischen für die Prüfung vorzubereiten und dafür von ihr einfach, wie sie selbst aßen, verköstigt zu werden. Ich ging begeistert darauf ein und hatte mich gerade in das vormittägige Schriftstellern, das nachmittägige Unterrichten, das abendliche Erfahren und Lernen hineingefunden, als mein Leben eine unerwartete Wendung erhielt.
Im Schatten des Adlers.
Mrs. F., meine Amerikabekannte, die nun in Japan bei einer großen Firma Korrespondentin war, fragte an, ob ich geneigt wäre, bei einer deutschen Gesellschaft, deren Name nicht verraten werden durfte, eine Stellung anzunehmen, und ich sagte glatt »nein«; denn so gern ich die Deutschen sprachlich habe, so wenig begeistern mich die reichsdeutschen Arbeitsverhältnisse. Dazu muß man geboren sein. Oder vielleicht habe ich doch etwas von reichsdeutscher Begeisterung für die Arbeit, nur liegt mein Feld dem Handel zu weit entfernt; denn wenn ich schreiben darf, bin ich so glücklich und gehe so sehr darin auf, wie der Deutsche in seinem Geschäft. Da mich indessen Maschinen und Duplikate bis zum Steifwerden langweilen, war mein »Nein« ein sehr entschiedenes.
Und dennoch wollte ich gern verdienen.
Zwei Tage später traf ich die Dame zufällig wieder.
»Sie wollen wirklich nicht?«
»Nicht um die Welt!«
»Warum wollen Sie eigentlich nicht? Man zahlt wenigstens 150 Yen für die paar Morgenstunden.«
»Ah – und gibt 150 Yen Grobheit dazu! Ich kann mich an den Ton nicht gewöhnen. Ich habe zuzeiten für Reichsdeutsche nach Diktat glatt in die Maschine geschrieben. Himmel, wie unfreundlich sie immer waren und wie sie knurrten! Dagegen waren die Engländer reizend. Kühl, gelassen und durch und durch höflich. Ich gehe nicht.«
»Es ist kein Handelshaus. Wenn ich wüßte, daß Sie annehmen wollten – – ich soll eben nicht – –«
Ich war zufrieden, nur unterrichten zu dürfen – ein zweites Feld unbedingter Höflichkeit – und sagte das. Frauen aber beharren auf einem Gedanken, und gerade als wir uns trennen wollten, bemerkte sie:
»Man wäre gewiß sehr höflich gegen Sie. Man sucht eine Hilfe bei der Deutschen Botschaft.«
Bei einer Botschaft!! Nun denke ich lachend zurück, was ich mir darunter vorstellte. Ein halbes Himmelreich! Geheimnis, Zauber, Kabale, Gefahren, vermummte Damen und maskierte Fremdlinge, Wunderschränke und eine Weisheit, die gewissermaßen aus den Schränken hervorquoll. Zum Glück schloß dieses magische Bild auch eine unbedingte Höflichkeit ein, denn nur die besten aller Sterblichen kamen zur Botschaft, und das bestimmte mich. Der Reichsdeutsche, der mich einzuführen bestimmt war, meinte allerdings als Dämpfer auf meine jäh entfachte Begeisterung, daß alles auf Erden, also auch eine Botschaft, seine Licht- und Schattenseiten habe. Natürlich legte ich es mir so aus, daß man auf den Stufen ermordet werden könne, was nicht ohne Reiz der Romantik – wenigstens für die Hinterbliebenen – war.
Am folgenden Morgen erschien ich im Amtsgebäude, das nicht wie ein Maschinenfolterwerk auf staubiger Straße, sondern richtig wie ein Märchenschloß, von hoher Mauer umgeben, in einem entzückenden Park lag, wurde von meinem Beschützer wie von einer liebenden Gluckhenne empfangen und hierauf vor den Kanzler geführt, vor dem ich, da er so aussah wie ein Mann auszusehen hat (jedenfalls in meiner Einbildung), der die Geschicke der Völker wie Bälle durcheinanderwirft, gehorsamst zusammenklappte. Er blickte mich mit jenem Adlerblick an, den überhaupt zu entwickeln nur ein Reichsdeutscher imstande ist, gewann aber mein Herz durch die weise Bemerkung (siehe das Diplomatentalent!), eine Kritik meines Romans irgendwo gelesen zu haben und er wünsche das Werk zu lesen.
Meiner Anstellung stellten sich politische Hindernisse entgegen, denn selbst als Oesterreicherin hätte man über mich irgend einen Halt gehabt, doch als Südslawin war ich – außerhalb der Botschaft – nicht zu packen. Da ich jedoch meine Werke in Deutschland verlegte, meine Aufsätze in reichsdeutschen Blättern erscheinen ließ und niemand, der gerade tauglich gewesen, in Tokio war, so wollte man bis zur Ankunft des Botschafters Dr. Solf ein Auge zudrücken. Ob ich auf eine Woche zur Probe kommen wollte?
So begann mein Botschaftsdienst. Lange Zeit flößten mir die altehrwürdigen Kasten eine große Ehrfurcht ein, doch je mehr ich von dem Inhalt zur Abschrift erhielt, desto mehr schwand die Ehrfurcht. Selbst Sachen, die sich mit den Schicksalen der Völker befassen, können recht langweilig sein, und die aufregendsten von allen sah der Kanzler ganz allein. Als Ausländerin durften mir gewisse Sachen ja auch nicht übergeben werden, und alles, was zum Beispiel halbgeschrieben vernichtet wurde, mußte zu Fetzchen zerrissen in den Papierkorb oder direkt ins Feuer wandern; denn die Japaner sind sehr schlaue Diener und stellen Akten leicht wieder zusammen. Hier muß ich auch erklärend einschieben, daß ich einer Botschaft wohl alle Wichtigkeit zuschrieb, indessen von keiner Neugierde befallen war. Meine eigene Arbeit war und ist noch immer das, was mich zu sehr erfüllt, und daher vergaß ich so häufig den Anlagestrich – jenes geheiligte Zeichen, das, über dem Schreibrand hinausgestellt, andeutet, daß hier dem Text eine Beilage hinzugefügt wurde.
Was ich hier schriftlich niederlege, wird keine Behörde beleidigen, ja die, die es lesen und mich gekannt haben, werden gern unterschreiben, was Andeutung und nicht Verrat ist. Eine Botschaft ist etwas Großartiges. Es ist ehrend, dort tätig gewesen zu sein, der Aufenthalt ist lehrreich, aber man muß im Leben von einer Erfahrung nicht notwendigerweise zu oft haben. Alles hat seine Licht- und Schattenseiten, und wo so viel Licht ist, haben die Schatten einen finsteren Anstrich. Am ärgsten sind die Botschaftsnasen. Nicht die in Menschengesichtern, denn diese waren sämtlich gut gewachsen, sondern die amtlichen. Man vergißt einen Beistrich oder einen Buchstaben oder den schrecklichen Anlagestrich, und der unmittelbare Vorgesetzte lenkt die Aufmerksamkeit des Schuldigen auf das Versehen. Dann kommt damit der Kanzler, der Gesandtschaftssekretär, der Gesandtschaftsrat, der Botschaftsrat und zum Schluß, wenn man Pech hat, Seine Exzellenz selbst! Bis man alle Phasen mitgemacht hat, sind Tage verstrichen und die Nase wie die eines Tengu, nur daß man seine Lasten nicht daranhängen kann. Schweigen ist bei einer Botschaft Gold: gegen Außenstehende, wenn sie fragen, gegen die Vorgesetzten bei der Nasenverteilung, bei späteren Erzählungen – und mit diesem Gold war ich verschwenderisch, weshalb ich auch ersucht wurde, noch drei Monate länger zu bleiben, als ich es wollte. Und noch eins: Nasen ohne Ende, denn wenn man bei einer reichsdeutschen Behörde einmal nicht brummt, so bedeutet das schon »ausgezeichnet«. Es geschieht selten! Aber die Nasen werden in so liebenswürdiger Weise erteilt, und man wird mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt, verkehrt mit Menschen, die wirklich zu den besten des Volkes gehören, auch darin, daß sie alle tadellose Umgangsformen haben, daß man sich bei einer Botschaft – was immer sonst an Schatten auftauchen möge – wohl fühlt. Zwischen Maschinen und Diplomatie liegt die ganze, bei allen heutigen Anschauungen unüberbrückbare Kluft zwischen Adel und Volk. Schon die Botschaftshuthänger scheinen zu sagen:
»Ich bitte um das Vorrecht, deinen Hut entgegennehmen zu dürfen!«
Im Geschäftshaus hatte es vom Nagel geheißen:
»Du Urschl, da häng' deinen Gehirndeckel auf!«
Der Ton war es, der mich alles vergessen ließ; ich zappelte immer gern durch den schönen Park, denn wen man darin auch treffen möchte, der war und blieb, selbst wenn verärgert, Ritter.
Ich hatte viele Japaner kennen gelernt, einige aus sehr vornehmem Hause, und wenn ich mich auch morgens vier Stunden tüchtig abplagen mußte, so verbrachte ich zur Entschädigung die Abende auf japanischen Entdeckungsfahrten (in Gasthöfen, bei häuslichem Schmause) oder saß auf dem Koffer der Russin, hörte ihren Erzählungen zu und ließ mir von ihr wahrsagen, während O Take san (das ehrenwerte Fräulein Bambus) in der Küche ihr Unwesen trieb oder trockenen Fisch für unsere schwanzlose Katze rieb. Zuzeiten zeigten sich noch die Giftflecken – Reste meiner Perutage – und auch eine gewisse Schwäche, meine Gedanken klar zu sammeln, doch sonst wurde ich allmählich wieder, was ich einst gewesen …
Der Septembersalon.
Zu den schönsten Vorkommnissen jener Zeit rechne ich mein Zusammentreffen mit japanischen Künstlern bei Tadaichi Okada san. Ich traf da die Hofschauspielerin Suzuki, viele moderne Maler, einige hohe Staatswürdenträger und durchweg Männer und Frauen, die einen weiten Blick und etwas zu sagen hatten. Der junge Okada erklärte mir die japanischen Gedichte und erzählte die vielen Sagen, die sich an den Tanuki knüpfen. Das ist ein Tier des Landes, eine Kreuzung zwischen Waschbär und Dachs, der die Gabe besitzen soll, sich in eine alte Frau oder in einen Mönch zu verwandeln, der nachts, wenn er sich einsam fühlt, mit seinem dicken Schwanz an eine Hütte pocht, und der einen Riesenbauch hat, auf dem er, wenn er sich zufrieden fühlt, trommelt. Viele Märchen handeln von ihm, und er paßt in die herrlichen japanischen Herbstabende wie ein Stern an die Himmelswölbung: er belebt.
Durch diese Bekanntschaft erhielt ich Einblick in das japanische Kunstideal, das sich von dem unsrigen so weit entfernt und doch auf seine Art ebenso groß ist.
Das Ideal des Japaners in der Kunst wie im Leben ist das Einheitliche, Eingedankliche. Er geht bei allen Dingen auf das Unpersönliche, Ewige, Allgemeine zurück, daher hat er auch ein so ausgeprägtes Farbenharmonie-Empfinden. In einem japanischen Hause sind die Matten weißgelb, die Papierfenster gelbweiß, die Holzwände licht, die Decke dunkler, der Pfeiler ganz dunkelbraun. Eine einzige Vase, ein einziges Bild unterbricht den von Gelbweiß zu Braun laufenden Ton. Selbst das Feuerbecken, der Hibachi, paßt sich an, und die Seidenkissen, die als Sessel dienen und ganz dünn sind, liegen so, daß alles einen gefälligen harmonischen Eindruck macht.
Sie malen auch nur eine Sache auf einmal und nie im Verhältnis zu anderen Dingen. Einen Kirschblütenzweig aus dem Nebel brechend; einen Vogel, einen kahlen Ast, einen rauhen Fels – Begriff Winter. Alle losgelöst von ihrer Umgebung, doch ohne daß man den Mangel an Hintergrund empfindet. Am schönsten sind die Sumibilder – japanische Tusche. Es liegt etwas geheimnisvoll Verträumtes in diesen Bildern. An Stelle unserer Schlagschatten haben sie Schatten im Gegenstand selbst und Gauffrage. An Stelle der Perspektive Verkleinerung, und da meist kein ausgesprochener Hintergrund ist, fühlt man keinen Mangel. Feinste Ausführung und dennoch plastische Fernwirkung.
Sie pflegen den Schönheitssinn in jeder Weise; durch die bunte Tracht, vorwiegend bei Kindern, durch das Schmücken der Geschäfte, durch die Blumenfeste, das Ziehen von Zwergbäumchen, das Malen zur Freude nach einem Festessen, die Wanderungen ins Freie, durch die Schönheit im eigenen Heim, durch das Ankaufen der billigen Farbendrucke, die der Ukiyoeschule angehören und Arbeiten großer Meister sind, und durch tausend andere Dinge.
Weihnachten.
Der Herbst ist die schönste Jahreszeit Japans, und jeder Tag war eine Freude. Ich brauchte gute zwanzig Minuten von Yurakucho bis zur Deutschen Botschaft und durchquerte da den Hibiyapark. Das Laub der Ahorne schwamm als rote Flotte über den Teich, über den die Enten trieben, und das Immergrün vieler Bäume verlieh dem Weg etwas Sommerliches. Die Gärtner wickelten die Bananen in Stroh und schützten die Subtropenpalmen. Die Chrysanthemen waren in vielen schnell errichteten Buden gezeigt worden. Eine solche Blumenpracht kennt man bei uns nicht. Es gab Stöcke mit zweihundert Blüten, und einzelne, gelbe, die zu einer Krone gezogen waren, doch die Chrysanthemen, die sich wie ein Wasserfall niedergossen, und die spärlich flockigen weißen gefielen mir am besten. Die Leute kamen und besprachen sie sachlich, prüften die Form der Zweige und die Zahl der Blüten und immer schaute das Männchen zuerst und rief dann um die Meinung seiner demütig gebeugten Hälfte über die Schulter zurück. Immer sind die besseren Hälften übrigens nicht demütig gebeugt; denn der Hausmeister der Botschaft stand sehr unter dem Pantoffel seiner keifenden Alten, und das Gebot des dreifachen Gehorsams – dem Vater, dem Gatten und dem Sohne gegenüber – erfährt bei aller östlichen Demut manche Trübung.
Die Morgenländer kennen begreiflicherweise keine Weihnacht, aber die Europäer lassen sich das Friedensfest nicht nehmen, und die ganze Botschaft war von Pfefferkuchenduft und Vorfreude erfüllt. Die Russinnen sparten jeden Yen, weil sie beabsichtigten, nach Deutschland zu ziehen und die Pension langsam aufzulösen, doch kam ich nicht um den Anblick eines Weihnachtsbaumes. Mein Rundbesuch am Weihnachtsvormorgen (ein Sonntag) war ein wahrer Hamsterzug. Jede der Damen und auch der Kanzler, der damals noch Junggeselle war, gaben mir Pfefferkuchen und Marzipan, und von Dr. Solf erhielt ich Seide zu all dem Zuckerzeug. Drei Wochen lang aßen wir drei (die lieben Russinnen und ich) an dieser Pfefferkuchenmenge.
Es war auch Sitte – ich glaube, nur in Japan, da ich es sonst bei Reichsdeutschen nicht bemerkt habe – Seife zu schenken, und ich wusch mich und alle meine Sachen ein halbes Jahr lang mit Weihnachtsgeschenken.
Am Christtag arbeitete nur der Kanzler einige Stunden vormittags, aber am zweiten Feiertag kamen alle schon für den Vormittag, und da ich auch zur Vormittagsgesellschaft gehörte, kam ich auch. Den Feiertag habe ich noch nicht entdeckt, an dem man bei Deutschen gar nicht arbeitet. Ich erinnere mich noch – nicht ohne Belustigung – einmal an einem Feiertag gekommen zu sein, von dem ich nichts wußte. Die beiden unmittelbaren Vorgesetzten waren da, und ich arbeitete in voller Unschuld bis nach elf und wunderte mich, daß niemand sonst ins Zimmer trat. Da meinte der Kanzler mit seinem feinen Diplomatenlächeln:
»Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, daß heute eigentlich Feiertag ist!«
Er, der nie etwas vergaß!!
Da er indessen immer gut gegen mich war (Nasen abgerechnet) und mich fütterte, wenn mich ein feindliches Geschick zum Bleiben verdammte, so fügte ich mich klaglos ins Unvermeidliche.
Neujahr.
Das ist das größte Fest des Jahres. Alle Schulden müssen bezahlt sein, sonst wird man unglücklich im neuen Jahre, neue Kimonos werden gekauft, neue Entschlüsse gefaßt, die Ginza ist ein einziger endloser Kaufladen, voll von Wunderdingen, und die Geschäfte prangen im herrlichsten Schmuck.
Vor jedem Haustor steht ein Bambus – das Sinnbild der Rechtschaffenheit und Treue, der Ausdauer – und eine Föhre, das Sinnbild des langen Lebens. Die Strohschnur versperrt gleichsam den Eingang, und hat den Zweck, Krankheiten abzuhalten, und der Krebs, als scharlachroter Punkt aus umgebendem Grün brechend, erinnert wieder an den Herzenswunsch des Fernöstlers: endlose Jahre. Die bittere Orange spricht von »Geschlecht auf Geschlecht« und auf roten Lacktassen sieht man die henkellosen Sakeschalen zum Banzai (Prosit) und die Götterkuchen oder Mochi. Das sind furchtbare Gebilde aus klebrigem Reis, die – je länger man sie ißt, desto größer im Munde werden, und wie Gummi unzerreißbar, dabei klebrig wie Kleister sind, zu Neujahr überall angeboten werden und denen man, wenn man nicht sehr unhöflich sein will, nicht entgehen kann. Das beste ist, sie möglichst schnell mit aasgeierartigen Schlingversuchen in den Magen zu befördern und sich der Hoffnung hinzugeben, daß aus dem Magen alles wieder herauskommt.
Alles, was man zu dieser Zeit tut, ist sinnbildlich. Man ißt »Heringskinder« (Fischlaich), weil dies das Sinnbild der Fruchtbarkeit ist, man kocht vor den Festtagen, doch nicht in der Neujahrsnacht, und man begibt sich auch nicht zur Ruhe; das Haus darf nicht gefegt werden, um das Glück nicht fortzufegen, und man erwartet Neujahrsgäste von Mitternacht an. Alle müssen ein Täßchen Sake trinken, und an diesem Tag hat jeder das Recht, angeheitert zu sein. So lebhaft der Nachtmarkt, so stark die Ellbogenstöße, die einem die gutgelaunte Menge gibt, so still ist der Neujahrstag selbst. Nur die männlichen Gäste fahren in Rikschas, die rückwärts ein Fähnchen angebunden haben, um ihre Besuche zu machen, und zwar immer der Untergestellte dem Uebergestellten. Die Frauen des Hauses bewirten nur.
In dieser ersten Nacht des Jahres muß man auch ein Bild mit dem Schatzschiff, begleitet von den sieben Glücksgöttern, drei Falken und oben der Ansicht des heiligen Berges Fujiyama unter das Kopfkissen legen, um von einem dieser Dinge zu träumen. Man besucht einen Tempel in der Richtung, die für diesen Zeitabschnitt die glückliche ist, und man merkt sich das Tier, das dieses Jahr bestimmt. Der Kreis besteht aus zwölf Tieren, dem Tierkreis angepaßt, und je nach dem Tier richtet sich der Charakter des in dem Jahre Geborenen. Wir waren eben vom Rattenjahr in das Hahnjahr gekommen, und alle Wunschkarten trugen dieses Federvieh.
In der ersten Woche spielen alle Leute daheim Gesellschaftsspiele mit den Kindern und auf der Straße ebenfalls alle Federball. Die Schläger werden in besonderen Buden massenhaft verkauft, und die meisten haben zum Schmuck, aus echter Seide und schön gemalt, Gesichter berühmter Schauspieler, doch findet man auch Kirschblütenzweige und andere Verzierungen. Die Größe schwankt ebenfalls zwischen leichten Kinderschlägern und solchen, die wie ein Tennisschläger sind.
Noch hatte die Kälte nicht eigentlich eingesetzt, wenn auch der Hibiyapark schon ziemlich entlaubt war und der graue Dunst trübselig um die langen Föhrennadeln kreiste. Grau hingen die Winterwolken auch über Tokios graue Dächer, graue Straßen, den graubraunen Sumidafluß, die winterlichen Japaner in ihren wattegefütterten, abgesteppten Kimonos, in denen das Kind stak und mit dem unbedeckten Kopf wie ein vergessenes Ackerrüblein herausspähte. Feierlich aß man die sieben heilsamen Kräuter und verlas am achten Tage das vom Kaiser selbst preisgekrönte Gedicht des Jahres. Der Herrscher stellte das Thema, und jedermann konnte am Wettbewerb teilnehmen. Auch Prinzen beteiligten sich. Die besten Gedichte legte man am Morgen des Preistages vor, und aus diesen wurde wieder das beste gewählt und gekrönt.
Jeder Japaner schenkt etwas am Neujahrsabend, und auch ich erhielt von allen Schülern und Bekannten ganz reizende Gaben, die alle meiner Sammlung einverleibt wurden. Bambusschachteln mit Lack überzogen, Seidentäschchen, japanische Kalender, ein Kakemorro (Wandbild) und auch praktische Sachen, wie Kuchen, Reis, Tee. Bei einer Engländerin feierten wir ein Nachchristfest, und auch sonst war ich so viel geladen, daß ich eine Unmenge fremder Speisen kennenlernte. Immer saß ich ganz pflichtschuldigst auf den Matten, erst mit den Fersen unter mir, später seitlich vorgestreckt, um nicht ganz und gar steif zu werden. Das schlimmste war das Aufstehen, denn da kippte ich immer einige Male um, ehe ich wieder ins Gleichgewicht kam und der Blutkreislauf neuerdings hergestellt wurde.
Eins empfand ich stets unangenehm: das Verlieren der Schuhe. Es war mir, als bliebe mit ihnen all mein Selbstvertrauen auf der eisigen Schwelle zurück, und dann in die durchfrorenen Schuhe die Füße stecken zu müssen, gehörte zu den Schattenseiten des Festes. Beim Sitzen versteckte man die Füße schon aus zwei Gründen: erstens der Sitte und der Wärme, und zweitens, weil man immer ein böses Strumpfgewissen hatte. Wie neu solch ein Wirkwarending auch sein mag, Löcher entwickeln sich schnell wie die Sünde.
Dagegen saß ich ganz gewandt an den kleinen Tischchen, nahm meine noch nie gebrauchten Hashi oder Eßstäbchen aus der Papierhülle, fischte alles, was aus den einzelnen Tellerchen und in Näpfchen war, in mein Reisschälchen und schaufelte die Kugeln gewandt in den Mund. Ich aß gern mit diesem östlichen Schanzzeug, und der herrliche trockene Reis, der das Brot ersetzt, fehlt mir noch heute. Man mußte die Schale mit einem Heben der flachen Hand der abseitssitzenden Hausfrau (Damen essen auch in den vornehmsten Häusern nicht mit, sondern bedienen die Herren und die Gäste überhaupt) übergeben und von ihr mit einer ebensolchen Gebärde und dem Ausruf »demütig nehme ich an!« entgegen genommen und an die Stirn gehoben werden. Ich begnügte mich mit einer Verkürzung, denn ich wollte nicht den Reis auf mich und die Matten als Sternschnuppenfall herabregnen sehen. Wohl aber kniete ich beim Erscheinen der Hausfrau immer richtig nieder und schlug mit der Stirn dreimal nach rechts hin (rechts, um ein Zusammenstoßen der Köpfe zu verhüten!) auf die Matten. Das machte den Japanern sehr viel Spaß, weil mein kurzes Haar dabei wie ein Federwischer umflog. Sie finden, daß wir Augen wie Affen haben (so rund und licht), und daß wir überhaupt sehr unterhaltend sind (als Wilde). Gewiß hat man mich oft nur eingeladen, um mein komisch fremdes Tun aus der Nähe zu beobachten. Da mir aber die Fernöstler ebenfalls unterhaltend vorkamen, dachte ich mir, daß unsere gegenseitige Belustigung nichts Verletzendes an sich hatte, wir uns also nur gegenseitig sozusagen »anspaßten«.
Die Geistervertreibung.
Anfang Februar röstet man in jedem Hause Japans Bohnen – die Zahl ist vom Alter des Hausherrn abhängig – und wirft sie abends unter viel Geschrei und zum Jubel der Kinder in alle Ecken. In Tempel dagegen kommen Schauspieler auf Wunsch der Priester. Sie tragen altmodische Gewänder und Masken und werfen ganze Säcke voll gerösteter Bohnen in alle Ecken, weil dadurch die Geister verscheucht werden sollen. Am wildesten geht es dabei im Gogogujitempel her.
Etwas Eigentümliches sind die Haarsträhnen, die man so oft in einzelnen Tempeln an das Gitter um eine Fudostatue geknüpft sieht. Sie stammen von Frauen, die ein schlechtes Leben geführt haben und nun geloben, keine Sünde mehr zu begehen. Will jemand – zum Beispiel ein Handwerker – recht geschickt werden, so nimmt er ein Stückchen seines Kimonos und knüpft es mit der linken Hand an das Gitter der Göttin Benten. Wer eine Prüfung bestehen will, schreibt diesen Wunsch auf ein Zettelchen, das er sorgfältig kaut und dann mit aller Kraft durch das Gitter hindurch der Göttin auf die Biwa, die japanische Laute, spuckt. Bleibt der Zettel haften, so erfüllt sich der Wunsch.
In Handfertigkeit sind uns die Fernöstler unbedingt voraus. Sie haben eine rührende Geduld, sich mit einem Gegenstand lange zu befassen. Ihre prachtvollen Lackarbeiten, bei denen jedes Stück zwanzig-, dreißig-, ja hundertmal bestrichen und poliert werden muß, ihre Cloisonnévasen, ihre winzigen Edelsteinschnitzereien sind Zeuge davon. Aber auch im täglichen Leben widmen sie sich liebevoll der einfachsten Arbeit und gebrauchen dabei zehn Finger extra, denn ihre Zehen sind fast ebenso nützlich und gewandt wie die Hände. Sie rühmen unsere technischen Errungenschaften und machen sich diese Werte zunutze, doch ihre Auffassung der Arbeit ist wohl die richtige: schön, gediegen und nicht überhetzt. Das Leben ist schließlich eine Reise und wird dadurch nicht angenehmer, daß man sie im Expreß zurücklegt. Wer mit dem gemischten Zug fährt, sieht und genießt mehr von all dem, was an der Strecke liegt.
Wir erreichen in unserem Lebensexpreß auch das Ziel – das Grab – schneller, doch ist dies Zweck der Reise?
Im japanischen Haus.
Es war mitten im Winter – die Pflaume, kaum in Blüte, mischte ihr weißes Flockengewoge mit dem des wirbelnden Schnees – als die Russinnen die Reise in die Heimat antraten und ich dadurch mein Heim verlor. Es kam nach einem großen Erdbeben, bei dem sich die Wände des alten Baus geöffnet und die Häuser sich genähert hatten. Im europäischen Hotel zu wohnen, war mir zu teuer, in einem japanischen, das keine Oefen und bloß Schiebetüren kennt, zu kalt und ungemütlich. Wer mochte mein nächster Nachbar sein?
Endlich, als ich schon ganz verzweifelt war, sagte mein Schüler Ito:
»Wenn Sie mit einem japanischen Zimmer von zweieinhalb Matten zufrieden sind, können Sie um 15 Yen monatlich bei mir wohnen. Ich lebe im Haus meiner Tante, und nur eine nahe Verwandte mit ihrem kleinen Kinde wohnt auch noch da.«
Nichts anderes war zu finden, und da er mir einen Gasring zur Heizung und als Küche versprach, der Raum einen Tisch und Stuhl besaß, so daß ich nicht auf dem Boden zu kauern brauchte und ich mir sagte, daß ich viel lernen, wenn auch nicht behaglich leben würde, packte ich meinen bescheidenen Kram und siedelte um. Billig war es ja, und da ich später dafür unterrichtete, vermehrte der Wechsel meine Ersparnisse, wenngleich nicht das Körpergewicht, denn für das Kochen bin ich nie gewesen: erstens, weil ich fast nichts kann, und zweitens, weil mir nie die Zeit dazu bleibt. Es gibt meiner Ansicht nach Wichtigeres zu tun, und in Tokio war ich in der Tat sehr angestrengt. Ich arbeitete den ganzen Tag bei der Botschaft, unterrichtete nachmittags bis sieben und schrieb dann und am Sonntag meine Beiträge für verschiedene Blätter. Nirgends ist es mir so klar geworden wie in Tokio, wie unheilvoll es für Schriftsteller (nicht einfach Journalisten) ist, Geldarbeit zum Neben- oder gar Hauptberuf zu haben. In dem einen Jahr in Japan schrieb ich nicht eine einzige rein belletristische Sache, obschon ich Sonderkorrespondent eines der bedeutendsten Textilblätter Deutschlands wurde und journalistisch nicht zurückblieb. Viele werden sagen, daß man aus der Erinnerung heraus schreiben kann. Das beweist mein Japanroman. Indessen gibt es Augenblicksstimmungen, kleine Nebensächlichkeiten, denen gerade der tiefste Lebenszauber anhängt, die man erfassen muß, während sie noch andauern. Ein Maler erinnert sich an tausend Nebellandschaften, die er gesehen, und malt sie gewiß auch getreu aus der Erinnerung, doch den Nebel, aus dem er – eigentlich gestimmt – das leuchtende Herbstrot eines jäh von der Sonne herausgefundenen Baumes brechen sieht und gleich malt, wird etwas viel Lebendigeres sein. Ich erwähne dies nur, um dem Leser verständlich zu machen, warum mich später die Notwendigkeit, nicht durch mein Schreiben, sondern auf anderen Gebieten Geld zu verdienen, so sehr erbittert hat. Damals war die Mark noch unsichtbar, die Krone unsichtbarer und ich ganz bereit, immer und alles im Ausland zu verdienen.
Es klingt so romantisch, wenn ich heute von meinem Wohnen in einem Papierhäuschen schreibe, aber damals war es Februar und sehr kalt, wenn der Tokiowinter auch hinter dem unsrigen weit zurücksteht. Ich schlief in dem kleinen Zimmer auf zwei Steppdecken Herrn Itos und deckte mich mit zwei Erbstücken der Russin zu. Ein altes Sofapolster wurde Kopfkissen, und morgens rollte ich alles wieder zusammen und ließ es in die Wand verschwinden. Die Futon liegen zu lassen gilt als sehr übelbedeutend, weil man nur bei Schwerkranken das Bett unberührt läßt.
So dicht auf dem Boden war es so kalt, daß es mir immer schien, als fiele ich in einen Keller, und wenn ich morgens aufsprang, war ich aus aller Kältenot, sobald ich aufrecht stand. Mein Frühstück, auf dem Gasring zubereitet, bestand aus Tee und Zwieback, und ich wusch mich in der Küche.
Um acht Uhr mußte ich das Haus verlassen, um gewiß um neun Uhr bei der Botschaft zu sein, und mit dem Laufen war es zu Ende, denn man fuhr eine Stunde mit der Elektrischen. O, diese Fahrten! Die Wagen waren so voll, daß man oft nicht einmal bis aufs Trittbrett gelangte. Eroberte man sich indessen Raum für einen Fuß, so war man sicher; denn der Schaffner wies nie ab, und der Lenker ließ den Wagen manchmal wie ein störrisches Pferd jäh nach hinten ausschlagen, wodurch drinnen alle Leute wie Bohnen geschüttelt wurden, was Raum machte, und draußen fiel auch noch irgend jemand ab und machte auf diese Weise Platz. Man war meist derart eingequetscht, daß man alle menschlichen Formen durchfühlte und in keinem Lande als in Japan wäre ein Fahren dieser Art möglich gewesen. In Peru hätte man der Frau vermutlich vor Gier die Kleider vom Leibe gerissen, aber die Japaner sahen mit ganz kalten Fischaugen über mich hinweg und waren sich scheinbar nicht bewußt, daß ich Weib war. Das machte das Fahren erträglich.
Unangenehm war es auch, meine Schuhe jeden Morgen vom poetischen Frühlingsregen ganz verschimmelt zu sehen. Als grüne Frösche hockten sie vor der Haustür oder in dem kleinen Fach, das zwischen der äußeren und der inneren Schiebetür liegt und für Schuhe bestimmt ist. Nur die Tür im Bretterzaun wird verriegelt. Abends, das heißt, gegen Sonnenuntergang, wird das Haus, das tagsüber alle Schiebewände offen hat, zugeschoben, und zwar mit einem Lärm, der glauben macht, es stürze alles ein oder es fahre ein vom Erdbeben erfaßter Möbelwagen vorüber. Der gleiche Lärm kündet früh morgens das Oeffnen der Schachtel an.
Das größte Abenteuer war indessen – für mich wenigstens – das Bad. Bei der Russin hatten wir eine Art Wanne und heißes Wasser zum Ueberschütten gehabt. Hier näherte sich mein Hausherr vorsichtig mit der Frage, ob ich auch einmal baden wolle (Europäer stehen im Rufe, ungeheure Schmutzfinken zu sein, die sich nie waschen), und als ich bejahte, sagte er mir, daß ich im Hause seiner Tante quer durch den Hinterhof baden könne, und daß er mich holen werde. Ich gab mich damit zufrieden.
Am Abend kam er. Ich mußte die Schuhe durch das Haus tragen, vor der Hintertür anziehen und durch den schneenassen Hof in das Nebengebäude wandern. Im offenen Gang saß die alte Dame im Lendentuch und mit nacktem Oberkörper und fächelte sich die verschrumpften gelben Brüste. Es war ihr heiß nach dem Bad.
Im kleinen Baderaum brannte kein Licht, und ich konnte nur durch die Milchscheibe der Schiebetür einigermaßen erkennen, wo ich war. Endlich wurden die Umrisse einer Holztonne immer klarer, und ich entdeckte eine Art Leiter von drei oder vier Stufen, die zum Tonnenrand führte. Der Hahn der Wasserleitung war über einem Becken in der Ecke.
Zuerst wusch ich mich japanischer Sitte gemäß mit warmem Wasser und Seife gut ab, hieraus versuchte ich, in die Tonne zu steigen, aus der sich hohe Dampfwolken wälzten. Vergeblich! Krebsrot zog ich mein linkes Bein zurück und versuchte es mit dem rechten, mußte dieses retten und steckte das andere hinein. Vierzig Grad kochten die Haut zu Bohnenfarbe.
Nie, nie würde ich in diese kochende Tonne hineingelangen, und doch sehnte ich mich nach dieser Wärme, die ich so sehr entbehrte, seit ich die Tropen verlassen hatte. Da fragte Herr Ito, die Hand auf die Schiebetür legend:
»Ist es Ihnen zu heiß? Soll ich kaltes Wasser nachgießen?«
Das half! Mit einem Satz war ich in der Tonne, rot wie ein Krebs und ohne Atem, aber drinnen. Dankend lehnte ich ab, froh, im Fall eines Aufgehens der Tür wenigstens in Dampf gehüllt zu sein. Von da ab badete ich mindestens dreimal wöchentlich, obschon ich die letzte Badende war. Nach Landessitte kommen zuerst die Männer, dann alle Frauen und endlich kam ich – denn Europäerinnen sind schmutzig (Japaner baden oft zweimal täglich) und vertragen überdies keine so große Hitze, so daß man das Bad etwas kälter machen muß. Immerhin kochte ich in vierzig Grad. In öffentlichen Badeanstalten wäscht der Badwaschler die Frauen. Das finden sie ganz natürlich. Meines Hausherrn Gattin (denn als das entpuppte sich die nahe Verwandte) hätte nichts dagegen gehabt, wenn er mir auch den Rücken geschabt hätte …
Die Mahlzeiten blieben skizzenhaft. Auf dem Heimweg kaufte ich um zehn Sen Brot und um zehn Daiken den langen japanischen Rettich und machte ein Mittagessen daraus. Abends kaufte ich Zwieback und verspeiste ihn im Bett, während ich las und Tee trank. Der Gasring stand neben dem Kopfkissen, so daß ich Küche, Lager und Bücherei an einem Fleck von einem Meter Umkreis hatte. Oft war ich eingeladen, und damit erhielt ich mich am Leben. Alles, was ich bei der Botschaft einnahm, legte ich in der Yokohama Specie Bank an, und lebte von dem, was ich durch das Unterrichten verdiente. Erinnerungsstücke und die nötigen Kleider erstand ich von meinen journalistischen Arbeiten für japanische Blätter.
Das erinnert mich an das Hemdhosendrama. In Yokohama kann man fertige Unterwäsche für Europäerinnen finden. Da ich ungewöhnlich klein und vorne wie ein Brett, hinten wie ein Fensterladen bin, waren alle fertigen Sachen für mich Säcke, in denen ich verschwand. Endlich erstand ich in Tokio selbst eine Kinderhemdhose, und nach diesem Muster ließ ich von der Tante meines Hausherrn mehrere Stücke machen. Wir lagen alle drei – er als Dolmetsch – auf den Matten und besprachen die Herstellung. Nach einigen Tagen kam Herr I. und brachte mir die Sachen.
»Wieviele Kleider tragen Sie übereinander?« fragte er, denn Japaner tragen je nach der Temperatur vier, fünf oder mehr Kimonos, einen auf dem anderen. Am Abend fragte er, ganz ohne bösen Hintergedanken und nur aus wissenschaftlichem Interesse heraus, ob ich ihm zeigen könnte, wie die Hemdhosen stünden. Leider konnte ich dem Wunsche nicht gut willfahren.
Japanerinnen tragen ein rotes Tuch um die Mitte und bis zum Knie reichend; es wird so fest gebunden, daß die Beine nicht auseinandergehen und der Gang beeinträchtigt wird. Begeht eine Frau Selbstmord, so bindet sie eine Schnur um die Knie, damit sie auch nach dem Todeskampfe in keiner unanständigen Stellung angetroffen werde. Männer tragen nur ein ganz kurzes Lendentuch, das sie auch nachts umbehalten. Sie schlafen in ihren Tagkimonos, und jeder Schläfer hat nur Anspruch auf seine Mattenlänge und -breite. Es können vier oder sechs Personen in einem mittelgroßen Raum schlafen, Kinder bei den Eltern. Alle Japanerchen tragen in den Tropfjahren Guttaperchaeinlagen, so daß nie ein Geruch bemerkbar und der Seidenkimono der Mutter, auf der das Parasitchen lebt, nie in Gefahr ist.
Durch den Frühling.
Ich könnte ein ganzes Buch allein von Japan füllen, und mit Ueberwindung kürze ich die Beschreibung der ferneren Monate im Land der aufgehenden Sonne ab.
Im Mai – wenn im Hibiyapark die Azaleen und die Glycinien in erstaunlichen Massen und erstaunlicher Schönheit blühen, wehen die großen Seidenfische vor jedem Haus, in dem Knaben sind. Dann feiern die Japaner das Knabenfest. Der Karpfen ist das Sinnbild des starken Mannes, denn nur er fließt den Strom gegen alle Hindernisse aufwärts, wie es der Kraftvolle im Leben soll; aber man findet auch um die Familienflaggen herum die Figur des Kintaro, der einen Hasen und einen Bären zum Spielgenossen gehabt hatte und in der Einsamkeit groß geworden war, und die Momotaros des Pfirsichkindes, das einem alten Ehepaar in einem roten Pfirsich geschenkt worden war, und ihnen aus treuer Sohnesliebe später einen eroberten Schatz heimbrachte. An diesem Tage füllen sich die Augen der Mütter, die keine Söhne haben, mit bitteren Tränen …
In dieser Zeit aber regnet es auch mit einer Ausdauer, die nur einen Fernöstler nicht aus der Fassung bringt; alles schimmelt und man bleibt im Straßenschlamm geradezu stecken. Dieses feinfadige Naß bewundern die Einheimischen und nennen es poetisch, weil es so weich auf Blüten und frisches Grün fällt. Man macht trotzdem Tempelausflüge, bringt allerlei Anhänger mit, besucht die Gräber der siebenundvierzig tapferen Ronin oder fahrenden Ritter, die aus Liebe zu ihrem verratenen Herrn alle Harakiri begingen, opfert vor Tenjin, dem Gott der Schulkinder, der einmal ein weiser Lehrer war und nun – aus weiß der Himmel welchem Grunde – in Ochsengestalt verehrt wird, und pilgert zum Erfinder des japanischen Alphabets, der gekürzten Katakana, zu Kobo Daishi. In jenem Tempel sieht man überall auf den Tischen der Buden Dharmas ohne Augen. Man kauft solch einen Dharma, nimmt ihn heim und malt ihm erst die Augen ein, wenn der Wunsch, den man geäußert hat, erfüllt wurde. Dharma war ein buddhistischer Weiser, der sieben Jahre mit dem Gesicht einer Mauer zugekehrt saß, um besser über die Welträtsel nachdenken zu können und dem, da sie überflüssig geworden, die Beine abdorrten. Im Anfang fiel ihm das Wachen schwer, und als der Schlaf sich seiner immer wieder bemächtigen wollte, riß er sich Augenwimpern und Augenlider aus und warf sie erzürnt auf die Erde. Daraus entsprang die Teestaude, damit Leute, die wachen wollen, sich nicht länger die Lider auszuzupfen brauchen.
Vor Fujiyama.
Zu den nettesten meiner Schüler gehörten zwei Herren, die beide große Freunde und in sehr hoher Stellung, dabei aber so bescheiden waren, daß ich erst kurz vor meinem Abschied aus Japan von der Ernennung des einen zum Finanzminister erfuhr. Sie lernten Deutsch, lasen Faust und konnten so herzlich wie Kinder lachen. Eines Tages nahmen sie ihre Köchin und ich meine Kamera mit, und so zogen wir hinaus nach Odawara, wo der eine der Herren ein Landhaus hatte. Odawara ist eine uralte Stadt mit einer von großartigen Wällen umgebenen Festung und mit Häuschen und Mühlen, wie man sie sonst nur in Bilderbüchern findet (die in Japan von hinten nach vorn und von oben nach unten gelesen werden!).
In der Schlucht, durch die wir am nächsten Tage auf Fujiyama zu kletterten, liegt der berühmte Badeort Miyanoshita mit seinen heißen Schwefelquellen, und dahinter verschwindet man in das sogenannte Teufelstal. Der ganze graue Abhang ist eine einzige Rauchwolke, denn es sind da viele siedende Schwefelquellen, deren Rauch so erstickend ist, daß man das Gesicht verhüllen muß, wenn man dicht an ihnen vorbeigeht, um davon nicht etwa betäubt in die heiße Quelle zu fallen, in der Eier gekocht werden und Wasser in kürzester Zeit siedet.
Ein schauriger Wind blies an diesem Tage über den Berg hin, und je höher wir kletterten, desto mehr verrann das Grau schleppender Wolken mit dem seltsamen Weiß der dampfenden Bergabhänge. Als wir zum Asahisee niederstiegen, heulte der Sturm durch das hohe Bambusrohr, das unheimlich ächzte und krachte, und knisterten die Föhren, wie von mächtigen Geisterhänden gerüttelt. Der heilige Berg lag hoffnungslos in einer dichten Nebelmasse, die sich zu klatschendem Regen verdichtete, so daß wir am Ufer in einem Gasthof eingeregnet wurden. Der See warf Wellen wie ein bewegtes Meer, und nirgends konnten die sonst verkehrenden Schifflein auslaufen. Der Nachmittag floß in den Abend, und immer noch saßen wir im Hotelzimmer, das gleichzeitig unser Speiseraum war (in Japan sind die Hotels in sehr viele Zimmer geteilt, so daß jede Gesellschaft für sich allein ist und nur die gegen die Veranda offenen Türen bleiben).
So unbedeutend dieser Frühlingsregen war, so entschied er über ein Menschenschicksal und brachte zwei andere in eine schmerzhafte Verkettung. Als wir nämlich so vereinsamt im Zimmer saßen, begann ich Herrn A. zuzusprechen, nach Europa zu reisen und seine Kenntnisse zu verdoppeln. Er erkundigte sich genau nach den zu erwartenden Ausgaben, und wir wurden vom Eifer so fortgerissen, daß wir Pläne entwarfen, Reisestrecken festsetzten und Studienzwecke besprachen. Später fuhr mein Schüler von seiner jungen Frau, die ihm eben eine Tochter geschenkt hatte, auf zwei Jahre weg nach Europa, besuchte meine Mutter, meine Verwandten und Freunde und kehrte schon wieder in sein Land zurück, alles, ehe ich – sturmgebrochen – in den eigenen Hafen einlief. Er aber gab mir ein Empfehlungsschreiben an jemand auf Formosa … doch ich will nicht vorgreifen.
Spät nachts fuhren wir im Wagen über Berg und Tal im strömenden Regen nach Odawara zurück. Wir schliefen in den leeren japanischen Räumen, nur durch Schiebetüren getrennt, und ich erwähne nochmals zu großem Lobe der Japaner, daß ich das nicht einmal mit Weißen gewagt hätte. Ich lag auf vier Futon unter und vier über mir und wirkte auf und unter all den Stoffmassen wie eine Erbse unter Matratzen. Nichts als ein Haarschwänzlein sah vor.
In Fischerdörfern.
Wieder flossen Tage wie die Perlen eines Rosenkranzes durch meine Finger. Manchmal betete ich den freudenreichen, wenn ein großes Blatt meine Beiträge annahm, zuzeiten den schmerzhaften Rosenkranz, wenn mich das Gefühl meiner Einsamkeit überkam. Mitten unter Menschen war ich allein. Diese vielen Menschen der eigenen und der fremden Rasse waren nur Schiffe, die der Wind des Schicksals an meinem eigenen Schifflein vorbeitrieb und die ich bald aus dem Gesicht verlieren mußte.
Der englische Dichter, der da sagt, daß die Sonne nur ein Licht ist und es über Millionen Sterne gibt und dennoch das ganze Licht der Welt mit der hinsterbenden Sonne stirbt, hat recht. Die laue Zuneigung der Bewohner der ganzen Erde würde an Wert nicht der vollen Liebe eines einzigen Menschen gleichkommen, und ich liebte niemand, und niemand auf der Welt liebte mich – weder Kind, Weib noch Mann. Ich meine in dem Grad, in dem allein ich es gewünscht hätte, und so wanderte ich die Kugel auf und ab, wie der bewußte rollende Stein, der kein Moos sammelt: völlig ungebunden und völlig einsam. So oft ich Freunde machte, mußte ich weiter. Das war in meiner frühesten Jugend so gewesen, war es auf der Weltreise und wird es immer sein. Für die Seele einer Frau ist es schlecht, weil sie kalt und wurzellos wird und allmählich die Fähigkeit einbüßt, mit anderen Lebewesen vereint zu leben. Heute hause ich in meiner Klause wie ein Eremit. Wenn jemand an der Glocke reißt und ich ihm öffne, möchte ich ihm – da ich aus fernen selbstgeschaffenen Traumwelten zurück muß in eine Umgebung, die jeden Reiz für mich verloren hat – am liebsten » Memento mori« zurufen und die Türe zuschlagen. Da ich aber einmal bei einer reichsdeutschen Botschaft war, wo man seine Jugendlehren vom »Es schickt sich nicht« wieder auffrischt, so verbeuge ich mich an Stelle dessen und frage, vielleicht nicht zu hinreißend liebenswürdig, nach dem Begehren des Besuchers.
Einmal nahm mich jemand in ein japanisches Theater mit, in dem ich in einer Loge, die wie eine umgekippte Kiste war, auf Matten saß und dem Spiel zusah, das so völlig anders als bei uns ist und wo der Szenenumbau mit Hilfe von sogenannten »schwarzen Männern« (schwarzgekleideten Bedienten) geschieht und von den Zuschauern weggedacht werden soll; wo die (Musiker oben auf der Bühne selbst sitzen und außer den japanischen Instrumenten noch die beiden »harmonischen Hölzer« eine große Rolle spielen, wo die Handelnden meist Yoros aus dem Freudenviertel und alte Ritter darstellen oder wie in » Kirare Yosaburo« einen aus Liebe und Weltverachtung zum Räuber gewordenen Helden verhimmeln.
Manchmal sah ich Tanzstücke, und nichts geht über die Ausdrucksfähigkeit der Hände östlicher Künstler. Jeder Finger redet, jede Handbewegung hat den Reiz einer Melodie, und gerade der Umstand, daß die Züge so unberührt bleiben, erhöht in meinen Augen die Schönheit der Darstellung. Tragik liegt nicht in Grimassen, sondern in den feinen, abgetönten Bewegungen, wie sie Menschen im höchsten Schmerz machen, in jenem hoffnungslosen Sichgehenlassen, wenn man merkt, daß es so ist, immer zukünftig so bleiben muß …
Manchmal führten mich meine Schüler hinaus an die Küste, um das Leben der Fischer kennen zu lernen, den Zauber der verborgenen Tempel, die aus Föhrengewirr über den unbegrenzten Ozean schauten und deren graugrüne Dächer in ihrem Schwung an die langen, graugrünen Wellen des Meeres erinnerten.
Der Bonitofisch wird, nachdem ihm Kopf und Schwanz genommen wurden, getrocknet, und zwar auf luftigen Hürden, die mitten auf der Straße stehen und auf deren stark gesenkte Fläche Sonne und Staub fallen. Nach und nach wird der Fisch so hart, daß er sich zwanzig und dreißig Jahre lang hält, ohne sich irgendwie zu verändern. Er dient, auf einem besonderen Reibeisen geschabt, zur Würzung von Reis und Gemüse. Solch einen harten Fisch verschenkt man zum Abschied als Sinnbild, daß sich der Beschenkte so gesund erhalte und so unverändert wie ein trockener Bonito bleibe. Auch muß jede Gabe mit dem Noshi und der Doppelgabenschlinge versehen sein. Nur bei Trauergeschenken ist die Schlinge einfach, weil auch der Tote nicht zurückkehrt.
Seegras oder Nori wird ebenfalls getrocknet und als Gemüse gegessen, und auch eine Algenart scheint verwendet zu werden. Die künstliche Perlenindustrie ist dagegen ein Geheimnis und wird unweit des heiligen Ise betrieben. Man legt ein winziges Ding – einen so kleinen Buddha, daß man ihn nur mit dem Vergrößerungsglas wahrnehmen kann, oder ein anderes winziges Dingelchen in die Auster hinein, legt sie zurück ins Meer (in abgegrenzter und an wohlbezeichneter Stelle) und nimmt sie erst nach drei oder vier Jahren heraus. Dann ist die Perle oder der umsponnene Gegenstand fertig. Echt sind die Perlen ja auch, aber künstlich sind sie, und so schön und stark wie die natürlichen sollen sie doch nicht sein.
An einer Stelle im Meer bei Kotsuura findet man ganz rote Fische. Diese dürfen nicht gefangen werden, sie wagen sich daher dicht an das Boot heran, und man füttert sie.
Bei der schönen Nihonbashi, der größten Brücke Tokios, findet täglich der Fischmarkt statt. Da trägt man auch den Fischgott spazieren, der auf goldenem Thron in prachtvoller Turmsänfte sitzt, und hier herrscht Ebisu, der getreue Glücksgott, der im Oktober auf Erden bleibt und nach dem Wohl der Menschen, besonders der Fischer sieht, während die übrigen Götter zur jährlichen Versammlung in den Himmel fahren.
Sayanora.
Musik, Aberglaube, Zwergbäumchen, Hunde und der schöne japanische Hahn mit seinem Riesenschwanz, Märchen, Geister und Götter, die Ainus auf Hokkaido, die heißen Quellen auf Kiushiu, die ich besuchte, und in denen man ein sonderbares Skelett, halb mit Mensch-, halb mit Tiergesicht aus dem heißen Schwefel zog, Beppu, wo man die Tücher in den verschiedenen Erdquellen färbte, und Kokura mit seiner Fabrik, wo die Mädchen wie in einer Schule untergebracht und ebenso gut beaufsichtigt sind; die prachtvolle Inlandsee mit ihren tausend Inseln, Kobe, Osaka – die Handelsstadt, Kioto, Nara – – sollen sie alle unerwähnt bleiben? Nein, die beiden letzten Orte darf ich nicht ganz übergehen.
Dr. Solf war nicht nur äußerst beliebt bei den Japanern, die ihn klug und leutselig fanden und deren Anteilnahme für Deutschland er in hohem Maße erregte. Wenn diese Freundschaft nicht politisch auffälliger an den Tag trat, so war das in dem Umstande zu suchen, daß die Japaner Angst vor England haben und vor allem danach trachten müssen, sich mit dieser Großmacht richtig einzustellen. Sonst aber war Japan – gewiß durch die Erfahrung und den Takt des Botschafters – sehr geneigt, den Deutschen entgegenzukommen. In den Blättern las man immer wieder von der Armut der lernenden Jugend in Deutschland, und viele Gaben von kleinen und oft unbemittelten Schülern liefen ein. Ja, ein armer Bauer, der in die Großstadt kam, fand den Weg zur Botschaft und trug sein Scherflein bei, um der deutschen Not zu steuern, und früher als andere Völker gaben es die Japaner zu, daß Deutschland in jeder Hinsicht zu stark war – auch an Wissen, Geist und Charakter, was einem Lande mehr als Kriegskraft zu Ehren gereicht – um jemals zu Grunde zu gehen.
Auf die Bitte Dr. Solfs hin war ich noch drei Monate über meine ursprüngliche Zeit geblieben, und, so sehr man mir zusprach, vermochte ich nicht länger zu verweilen; denn der Weg vor mir war steinig und lang. So nahm ich denn mit ehrlich schwerem Herzen Abschied von der Deutschen Botschaft, froh, auch das Leben bei einer politischen Behörde kennen gelernt zu haben. Mit Empfehlungsschreiben versehen, mit Geschenken von überall beladen, verließ ich am 1. Juli 1923 das Land, von dem ich, wie von keinem sagen darf:
»Niemand hat mich beleidigt, niemand mir ein Leid zugefügt!«
Ist das nicht das schönste und ehrendste Denkmal, das man einem Volke setzen kann, und ist nicht die echte Vaterlandsliebe die, so zu leben, daß der Fremde mit solchen Ansichten scheidet? Man spricht den Japanern große Sinnlichkeit nach. Wie hoch einschätzbar eben deshalb ihre vornehme Kühle im Lande der Schiebetüren! Gesegnet seien sie!
In Kioto.
Kioto ist die alte Königsstadt (Yedo, das heutige Tokio, ist das Werk der Shogunen). Der Zauber des Mikado umgibt das stille Städtchen mit seinem inneren Kranz alter, gekrümmter, dunkelgrüner Föhren und seinem äußeren Kranz von blauschimmernden Bergen. Hier sind verschlafene Tempel am Ende verschlafener Gassen, und die Unberührtheit vergangener Zeiten liegt wie ein schützender Prunkmantel über allem.
Unweit von Kioto ist Uji, wo die jungen Leute Leuchtkäfer im Juni fangen und auch ihre Herzen gegenseitig einzufangen trachten. Da befindet sich auch, im Grün verloren, der schönste Tempel aus der Fujiwaraperiode, der glücklichen Zeit Japans, in der die Frauen hochgeehrt und frei waren, wo Männer prunkvolle weibliche Trachten anlegten, wo es genügte » Amida Buddha« in unzähliger Wiederholung zu rufen, um selig zu werden und wo das Leben mit sanftem Fächerschwingen verging. Uralte Fresken bedecken die Wände und weichlinige Dewas oder Engel stehen in Stein im Halbdunkel. Das Tempeldach bildet mit den Umbauten einen Phönix mit ausgestreckten Flügeln, und der ganze Reiz des Mittelalters liegt wie ein staubiger Goldmantel auf allem.
Nara.
Nara ist heilig. Das ist die Stätte des Buddhismus, und der prachtvolle riesige Buddha, obschon nicht so ansprechend wie der von Kamakura, ist aus der Naraperiode – über 1000 Jahre zurück. Hier entwickelte sich das Volk zuerst zu Kunstempfinden, zu neuem Glauben und zum Bewußtsein eigener Macht. Es ist die Wiege der Kultur, die hier Fremdes abstreifte und die eigenen Bahnen zu gehen versuchte.
Nara macht auch auf den, der sich weder mit Religion, noch mit Kunst befaßt, einen ganz eigenen Eindruck, denn die Häuser sind vom Hauch des Westens, der alle Poesie in kalte Prosa zieht, noch unberührt, und durch die breiten, aber altmodischen Straßen laufen unbehindert die heiligen Rehe. Sie kommen aus dem riesigen Narapark mit seinen zahllosen Tempeln und Schreinen, laufen aus die Rikschas, die gemächlich dahinrollen, zu, und beschnuppern fragend den Fremden, geben ihm einen gutmütigen Stoß mit der Nase, wenn er geizig genug ist, ihnen nichts zu geben, und laufen wieder davon. Früher war auf das Töten eines solchen Rehs die Todesstrafe ausgesetzt, und auch heute würde das Verletzen für den Täter ernste Folgen haben. Wer aber wollte solch hübschen Tieren etwas Böses zufügen wollen?
Osaka ist dagegen die kalte Handelsstadt mit vielen Elektrischen, großen Geschäften und schon unhöflich gewordenen hastenden Japanern. Ist Eile und blindes Geldsuchen wirklich Hauptzweck eines Menschen? Ist die vornehme Gelassenheit, die in stilleren Städten an den Tag tritt, nicht die bessere, echtere Lebenskunst?
Im Land der Morgenstille.
Jedermann kennt Japan, wenigstens aus Bildern und Beschreibungen heraus, doch kaum acht Stunden von Moji entfernt liegt Fusan an der Küste Koreas, und damit gleitet man in Gebiete, die wenig besucht und weniger beschrieben werden. Kaum sind wir über die Grenze und unterliegen der üblichen Plage von Paß- und Gepäckuntersuchung, so verwandeln sich die heimkehrenden Studenten, die bis hierher in graue Kimonos gehüllt waren, in das steife, durchsichtige Weiß ihrer Landestracht und lächeln zum ersten Mal selbst mit ihren schwermütigen Augen unter hochgeschweiften Brauen. Alle Völker, die unfrei sind, – Korea ist nun unter japanischer Herrschaft – haben diese eigentümliche Schwermut im Blick. Als ob sie immerwährend auf eine tote Vergangenheit schauten, und vielleicht sind sich die wenigsten dieses Umstandes bewußt.
Mir gegenüber sitzt ein altes Weiblein in kurzem weißen Leibchen und einem sehr weiten, durchsichtigen Rock aus Hanfgewebe, unter dem ein zweiter, ebenfalls weißer und steifer Unterrock vorschaut. Darunter kommt eine weite, unten gebundene Hose und an den Füßen trägt sie komische Schnabelschuhe, teils aus Gummi, teils aus Stoff. Ein alter Mann hat sie nur aus Stroh und wirft sie mit den Zehen wie Bälle auf und ab. Die Kinder haben das Haar geflochten, die Erwachsenen geknotet. Beim obersten Haarschopf pflegen unzufriedene Ehefrauen ihre ungehorsamen Gatten zu ziehen. Ob man die Sitte bei uns einführen sollte?
Die weiche Sanftheit japanischer Landschaft war wie weggewischt. Näherrückende, hierauf wieder zurückweichende Bergrücken, seltsamförmig und schwachbewaldet, wurden sichtbar, und alles wirkte herber, frischer, unberührter, selbst die Reisfelder, aus denen sich oft Kraniche erhoben. Die Bauernhäuschen hatten flach wirkende, strohbedeckte Dächer, die wie mit einem großen Fischernetz übersponnen schienen, und einige von diesen Hütten waren nur aus Lehm irgendwie zusammengeworfen. An den Aeckern entlang, wie stumme Wächter, liefen Pappeln, und nackte Kinder wechselten mit halbnackten Leuten. Alle Naturvorgänge spielten sich angesichts des fahrenden Zuges ab.
Ich faßte eine unerklärliche glühende Zuneigung zu Korea. Es heimelte mich an, und der Eindruck des unberührten Landes ließ Geschichten wie Mücken durch mein von Anlagestrichen etwas verdorrtes Gehirn fliegen. Da ritten auf holprigen Feldpfaden Männer auf winzigen Pferden, trugen schwarze Roßhaarhüte, die wie umgekippte Ofenröhren am Ende der langen gelben Gesichter saßen; oder es schliefen koreanische Feldarbeiter im Schatten eines Heuschuppens, die lange Pfeife mit dem winzigen Köpfchen neben sich, den Hut seitlich auf dem Ohr ruhend; unter dem Vordach eines einfachen Gasthofes speiste ein besserer Mann, mit seinen Stäbchen den Reis in den Mund werfend, und hatte auf Kopf und Schultern den ungeheuren Hut, der wie ein umgestülptes Waschbecken aussieht, und ein Ueberbleibsel vergangener Tage ist. In den guten alten Zeiten schlugen sich die Koreaner nämlich so gern gegenseitig die Köpfe ein, daß ein weiser Regent den Entschluß faßte, dem abzuhelfen, indem er anordnete, daß jedermann einen irdenen Hut tragen mußte. Entstand nun ein Streit, so zerbrach der Hut, und da man mehrere Monate arbeiten mußte, ehe man genug Geld zu einem neuen Hut hatte, wurden die Leute sanftmütiger und anstatt sich halb oder ganz totzuschlagen, beschimpften sie sich gegenseitig mit wachsender Gewandtheit, so daß – obschon die Hüte heute aus Roßhaar sind – diese schöne Sitte noch geblieben ist.
Den ganzen Tag hindurch raste der Zug durch die fruchtbaren Ebenen, an Bahnhöfen vorüber, denen der pfefferige Duft fremder Kost und fremder Rasse entströmte, und am Abend näherte man sich Seoul (Saul) oder, wie die Japaner nun sagen, »Keijo«.
Eine Bekannte Herrn A.'s, eine hübsche Japanerin, erwartete mich, und in einer Rikscha rollten wir ihrem Hause zu. Männer mit dem » Tsige« oder langen Rückenbrett, an dem riesige, ganz untragbar scheinende Lasten befestigt sind, stolperten an uns vorüber, Frauen in ihren durchsichtigen schneeweißen Kleidern mit Körben auf dem Kopfe kreuzten unseren Weg, und vor den niedrigen Geschäften standen mächtige Eisentöpfe, die das Sauerkraut der Koreaner und ihre stark riechende Pökelware enthielten. Auf langen Schnurvorrichtungen, die Mauern entlang, und auf dem Fußboden, trocknete überall Pfeffer, und gelungen war es, daß für Hunde ein niederes Loch in der Hausmauer gelassen worden war, durch das sie ein- und ausschleichen konnten, ohne jemand zu belästigen. Katzen, die seit altersher verachtet sind, standen fauchend auf den dicken Strohdächern und wurden von ihren menschlichen und hündischen Feinden verfolgt.
Was ich auf Reisen so anziehend und zuzeiten doch so schwer finde, ist das ewige Sichumstellen. Heute lebe ich japanisch, morgen koreanisch oder wieder als Weiße, und selbst da nie unter den gleichen Verhältnissen. Kaum war ich in mein vorläufiges Heim gekommen, so brachte man mir eisgekühlten Gerstentee und führte mich sodann ins Badezimmer, wo in einem Bambuskorb der übliche Yukatajikimono und ein Obi bereit lagen, und daher erschien ich, sehr zur Belustigung und Befriedigung meiner Gastgeber, als Japanerin. Nur mußte ich den Kimono von links nach rechts (also nach unseren Begriffen verkehrt) schließen, denn von rechts nach links schließt man ihn nur bei Toten, vielleicht weil da das Herz, das im Leben frei sein soll, mehr bedeckt wird.
Das hat bei mir wenig Gefahr; das Herz wirkungsvoll umzubringen, haben sich zu viele Leute von Kindheit an bei mir bemüht. Nun ist es der Muskel, der das Blut umherschießen läßt und nicht einmal in der Eigenschaft sonderlich hervorragend …
Die nächsten Tage vergingen mit dem Besichtigen der Sehenswürdigkeiten, und obschon ich es eigentlich vorziehe, aufs Geratewohl durch die Straßen einer fremden Stadt zu pilgern und den fremdartigen Duft – körperlich und seelisch zu nehmen – einzuatmen, so fügte ich mich hier höheren Wünschen, durcheilte das Museum, sah die alten Buddhagemälde (noch mit runden Augen, ein Zeichen, wie alt sie waren und wie fremd noch der neue Glaube), die seltsamen Dachziegel mit der veralteten Schrift, die Porzellanvasen, der Stolz koreanischer Kunst, die sich hauptsächlich in der Keramik hervortat, und durfte, geleitet von haselnußbraunen Offizieren, die schönen Parkanlagen der königlichen Gärten besuchen und selbst die Wohnräume im alten Palast, in dem die schöne Königin Ji getötet worden war. Die Quelle im Park ist von schön geformten Steinen umgeben und heißt Paradiesquell. Die Offiziere tranken eifrig, doch mich hat Wasser immer kalt gelassen. Man soll nach Genuß dieses Wassers lange, lange leben. Gott schütze mich davor.
Im Pagodenpark steht die dreizehnstöckige Pagode. Die obersten drei Stockwerke stehen daneben, weil die Japaner sie fortzuschleppen beabsichtigten. Es gelang ihnen jedoch nicht. Unter der Pagode sitzen alte Männer und rauchen Pfeife – im Nichtstun sollen die Leute stets großartig gewesen sein – und spielen ein Würfelspiel, während die Kinder in losen Jacken und kurzen Höschen umhertollen.
Am liebsten hielt ich mich auf dem Markt auf. Da standen die schlanken einheimischen Männer in ihren priesterlich wirkenden, weißen Gewändern stolz und wortkarg hinter den flachen, runden Körben, die mit Bohnen, Kastanien, Passanianüssen, Satokartoffeln und anderen Landeserzeugnissen gefüllt waren oder mit hellgelbem, grellrotem oder schwarzem Zuckerwerk, das wie zerstampfte Kohle in Wurstform aussah und von dem ich, bei allem Wissensdurst, nichts kostete. Niemals priesen die Händler ihre Ware an, doch kaufte man, so lächelten sie plötzlich und waren sehr höflich.
Von den Haken der Fischhändler hingen zu Kränzen gebundene Fischlein, trockene Bonito, faserige Teufelsfische und Körbe voll Haifischflossen; es gab auch Geschäfte, in denen man Rüstungen aus Bambus erstehen konnte – Armstützen, Brustpanzer, Kragenersatz und Beinhüllen, doch war das ohne kriegerische Bedeutung, sondern diente lediglich dazu, die steifen Gewänder vom schweißnassen Körper abzuhalten, um sie länger weiß und frisch zu erhalten. Das Waschen dieser Gewänder mit Hilfe von flachen Brettchen, mit denen sie am Flußrand bearbeitet werden, und das gleichmäßige Anschlagen der glatten Hölzer, mit denen sie gestrichen werden müssen, um glatt und steif zu sein, – was tägliche Frauenarbeit ist –, gibt den Takt, das Hohelied könnte man behaupten, von Seoul an. Ueberall ertönte das einförmige Klapp, Klapp, Klapp der Hölzer.
Das Jugendherstellmittel.
Korea hat eine Pflanze, die nirgends sonst auf der Welt erfolgreich gebaut werden kann, noch wild gefunden wird – Ginseng. Es ist ein Würzlein, das – mit Zuhilfenahme einer starken Einbildungskraft – tatsächlich wie ein Männchen mit Kopf, Armen und Beinen aussieht, und das, zu Tee verkocht, angeblich die Gabe besitzt, von allen Uebeln zu heilen und einen alten Mann wieder jung zu machen. Das schätzen vorwiegend die Chinesen hoch ein, für die das Leben nur Wert hat, wenn die drei Hauptdinge – Geld, Frauen und dadurch Söhne, gepaart mit hohem Alter – in ihren Besitz gelangen.
Man findet Ginseng zuzeiten wild in den unwirtlichen Bergen, wo noch der Tiger umschleicht (der indessen nie einen Betrunkenen angreift, weil ihm, wie man behauptet, vor so einem graust), und wenn ein Mann das Glück hat, Ginseng zu entdecken, so baut er sich eine Hütte daneben, denn für eine echte Ginsengwurzel, über die alle Kräuterbäche der Erde gelaufen sind und die zwanzig Jahre die Ströme der Erde in sich aufsaugt, zahlen die Japaner tausend Yen (2000 Mark!). Man pflanzt aber Ginseng auch an, sieht, daß er genug Schatten findet, und wartet vier bis fünf Jahre, ehe man die Wurzeln herausnimmt, sorgfältig reinigt, trocknet, zählt und in Schachteln packt. Jede Wurzel hat eine rote Papierkrawatte wie bei uns die Zigarren und darf auch nur in Apotheken verkauft werden; denn Ginseng ist Staatsmonopol und trägt der japanischen Regierung mehrere Millionen Yen ein. Ginseng wird von Chinesen in Massen erstanden und auch nach Ansiedlungen verschickt, die, wie Nordborneo, vorwiegend von Chinesen bewohnt werden. Die Vereinigten Staaten versuchten, mit sehr mittelmäßigem Erfolg, Ginseng anzupflanzen.
Nun wollte ich auch gern Ginseng trinken, denn wenn ich gleich keiner Verjüngung bedurfte, würde mir eine Kräftigung nur wohl getan haben, und am folgenden Morgen brachte mir mein liebenswürdiger Gastgeber in der Tat eine Schale Ginseng. Der Tee roch wie Fleischsuppe, in der Mohrrüben eingekocht wurden, und ich glaube mich zu entsinnen, daß Ginseng tatsächlich in die Klasse der weitesten Verwandtschaft mit diesen mir nicht übermäßig angenehmen Wurzeln gehört. Sonst war das hellgelbe Getränk leicht zu nehmen, und im Augenblick verspürte ich keinerlei Wirkung, doch da ich an diesem Tage in heißer Sommersonne der Subtropen sieben Stunden ohne Anstrengung lief, schreibe ich dies doch dem Genuß des Altmännerwürzelchens zu. Wer indessen diesem Verjüngungsmittel zu häufig zuspricht, der soll dem Wahnsinn verfallen.
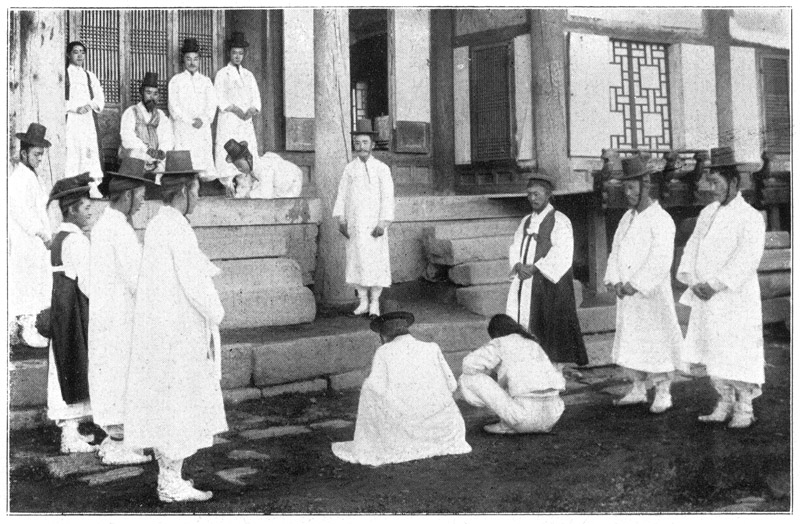
Koreanische Gerichtssitzung
Bei einem Edelmann.
Herrn Y., dem es gelungen war, einen höhergestellten Beamten dafür zu interessieren, verdankte ich den Besuch bei einem alten koreanischen Edelmann, wodurch ich die Inneneinrichtung in einem vornehmen Hause dieser zurückhaltenden Rasse kennenlernen konnte.
Die Gebäude waren von einer hohen, feindlich wirkenden, etwas gesenkten Mauer umgeben. Wir traten durch das alte Tor in einen sonnentrunkenen Hof und durch ihn weiter in einen zweiten, ebenso stillen, ebenso schimmernd weißen und von da aus, von einem Diener geleitet, in das eigentliche Herrenhaus mit seinem polierten Fußboden, der schon an und für sich eine Sehenswürdigkeit war, und über ihn hinweg zum erhobenen lagerähnlichen Sitz des Hausherrn, der ein dreieckiges Polster als Rücken- und ein Holzgestell als Armstütze hatte. Er begrüßte uns sehr höflich, seine lange Pfeife zur Seite legend, und führte uns persönlich durch die hohen Gemächer, um uns die kostbaren alten Schränke mit ihrer verschlungenen Einlegearbeit aus Edelsteinen und Perlmutter zu zeigen. Bald war der Grund ebenholzschwarz, bald scharlachrot, und Kraniche und Schildkröten jagten sich da in unglaublichen Stellungen durch üppige Blumenranken und verworrenes Blattgewirr. Der Kranich ist das Sinnbild langen Lebens, die Schildkröte – wenigstens in Japan – des weiblichen Gehorsams, denn so wie die Schildkröte bei der leisesten Berührung einer Hand Pfoten und Kopf einzieht, so sollte jede Frau demütig Kopf und Pfoten einziehen, wenn ihr Herr und Gebieter sie berührte.
Herrliche Kakemono berühmter koreanischer Meister, meist Tiere in sinnbildlichem Zusammenhang mit der Natur darstellend, zierten die Nischen, und runde oder trommelartige Porzellansitze luden zur Ruhe ein.
Der Edelmann mit seinem langen, schütteren Barte und der längeren, dünneren Pfeife, geleitete uns als besondere Gunsterweisung durch einen langen, kalt wirkenden Gang zu dem Eingang der Frauenräume, wies mit der Hand auf einen Hof, der voll großer Eisentöpfe war, zeigte dunkle Spalten dahinter (aus denen es hervorkicherte) und erklärte dies für die Küche. Dann ließ er uns Kehrt machen; denn Frauen sind nichts für neugierige Augen.
Heute erfreuen sie sich ohnedies einer größeren Freiheit als einst. Sie gehen unverhüllt, obschon ganz Wohlerzogene noch begehren, daß die Frauen bei ihrem Erscheinen den breiten Aermel vor das Gesicht schlagen. Sie nehmen auch an Unterhaltungen teil. In alter Zeit mußten sie tagsüber fleißig arbeiten, abends jedoch von neun bis Mitternacht durften sie sich gegenseitig besuchen, und das war die » hora regalis« für die Männer. Es ertönte der Gong, und wer nach der neunten Stunde auf der Straße war, der wurde vom Schutzmann tüchtig verprügelt; denn es war »Damenstunde«.
Zum Abschied schenkte mir der Herr zwei schöne koreanische Fächer, das Lebensgrundgesetz darstellend, » In Yo« oder Licht und Schatten, Ruhe und Bewegung, das Schaffende und das Erschaffene.
Ich dankte auf Englisch, verbeugte mich tief und hielt mich am Seil an, während ich wieder in meine Schuhe schlüpfte, doch dann mußte ich mich nach westlicher Art hinhocken, um sie zuzuknöpfen. Wir können unsere Schuhe füglich nicht nur mit der großen Zehe zum Gehorsam bringen.
In Heijo.
Heijo liegt eine weitere Tagereise mit dem Schnellzug gegen Norden. Es war einst die Hauptstadt und ist geschichtlich viel wertvoller als Seoul. Wohl stieg angeblich zur Zeit des Kaisers Yao in China, also um 2332 vor Christi, Whanung, der Sohn des Schöpfers, vom Himmel herab, begleitet von 5000 Geistern, und gründete, unter einem Paktalbaum, das Reich der Erde, seine Minister Wind, Regenbeherrscher und Wolkenlehrer an ihre Stellen schickend. Doch erst im Jahre 1766 vor Christi wird die Geschichte etwas glaubwürdiger, als der Nero Chinas, der furchtbare Kaiser Chu, alles beherrschte, was damals von der östlichen Welt bekannt war. Er liebte seine jüngste Nebenfrau, die wunderschöne Tal-geui und schlug ihr nie einen Wunsch ab, wie blutgierig er auch sein mochte, daher planten die Mandarine (Minister) ihren Untergang, doch fand sie den Schuldigen immer heraus und ließ ihn kurzerhand um einen Kopf kürzer machen. Da folgte ihr der weise Ki-dscha von ferne, als sie ihren monatlichen Spaziergang in vollkommener Einsamkeit antrat, und da sah er sie in einem Fuchsbau verschwinden. Er tötete, nachdem sie in den Palast zurückgekehrt war, sämtliche weißen Füchse darin und warf ihre Felle um. Als er so bekleidet vor Tal-geui und dem hohen Rate erschien, erkannte sie ihre Verwandten, fuhr zusammen, verwandelte sich blitzschnell und sprang als neunschwänziger Fuchs zum Fenster hinaus, um nie wieder aufzutauchen. Chu jedoch, der Ki-dscha weder dafür enthaupten lassen konnte, noch ihn belohnen wollte, sandte ihn nach dem heutigen Korea und befahl ihm, es sich zu unterwerfen und urbar zu machen. So wurde der Weise der Gründer von Heijo.
Einst war die Stadt sehr groß und erfuhr wechselnde Geschicke; heute ist sie klein, sonderbar verschlafen und tot. Sie liegt zwischen niederen Hügeln und malerischen, von kleinen braunen Dörfern unterbrochenen Feldern, und die Leute sind gar nicht gewöhnt eine Europäerin zu sehen. Sie starren aus aller Kraft, und die Kinder verschwinden beinahe furchtsam vor der Fremden.
So still fließt das Leben, daß man sich in einem Bild glaubt. Die Sonne liegt müde auf dem grauweißen Staub, und die Weiden lispeln schläfrig vor alten grauen Mauern. Kraniche erheben sich aus den feuchten Reisfeldern, und die Frauen am Flußrand schlagen eintönig ihre zerstreuten Wäschestücke. Hinter einem Baum steht ein Ochse mit dem Ring durch die Nase, und auf den Hüften der Frauen sitzen nackte Kinder und suchen nach der Brust unter dem losen Jäckchen, das den Schatz ohnehin nie verbirgt.
In Pyengyang (Heijo) ziehen die Brotjungen mit ihren Körben dahin und rufen:
» Yamayo pan!« (Brot gibt es).
Auf einem Hügel ist ein hübscher Park mit Sitzen, und dahin kommen morgens die Studenten und wiederholen ihre Aufgabe.
Vielleicht erzählen sie sich von den drei Weisen, die auf Quelpart, der Insel, landeten, und alles mit sich brachten, was zum irdischen Glücke gehört: ein Pferdchen, ein Kalb, ein Schwein, einen Hund und eine – – Frau! All das steht in der Geschichte Koreas geschrieben. Oder sie erzählen sich vom Maulwurfsvater, der für seine Tochter einen Gatten gesucht, Sonne, Mond, Himmel, Wolken, Sterne und den großen Berg angesprochen hatte, und zum Schluß zur Ueberzeugung gelangt war, daß ein Maulwurf doch das größte Ding auf Erden sei. Oder vom Tokgabi, dem Hauskobold, der gern den Deckel in den siedenden Reistopf fallen läßt und alles Glänzende, sogar Silber, haßt? Wer weiß es!
Ich verließ Heijo tief durchdrungen von dem stillen Zauber dieses unbekannten Landes. Wieder erwartete ein Dampfroß mich und meine getreue Erika, und wieder fuhren wir einer neuen Grenze, neuen Erfahrungen entgegen.
Durch die Mandschurei.
Ich nahm Abschied von japanischer Höflichkeit und stand unter groben Flegeln in Mukden. Man gewöhnt sich vielleicht an die Chinesen. Das mag sein. Sechs Monate China waren für mich jedenfalls nicht genug. Ich ehre vieles, was ich bei ihnen antraf, und ihre geheimnisvollen Tempel, der Schatten des Mystischen, Düster-Grauenhaften, der zauberhafte Aberglaube, der in fremde Welten versetzt, zogen mich wie nur noch in der Südsee an; aber nichts wird mich abhalten zu sagen, daß sie als Volk gegen Ausländer grob sind, abscheulich herumspucken (so daß Europäer auch mit der Zeit dieses Laster annehmen) und daß man von der Reinlichkeit des Nachbars keinen Begriff hat.
Mukden scheint stark europäisch. Die schmucklosen Steinbauten, die von Winterkälte sprechen, die breiten Straßen mit Baumgängen an jeder Seite, in denen nichtsdestoweniger der Fuß bald im Staub, bald im Schlamm versinkt, die kleinen Karren, die Träger mit ihren Schulterstangen, die schicksalsverschlagenen Russen, die kleinen Mädchen in chinesischen, enganschließenden Hosen.
Ich sah mir Mukden von oben bis unten an, trieb am alten Tempel vorüber, der wie eine wissende alte Steinunke am Wegrand sitzt, und erwischte durch eine Fügung des Geschicks gerade noch den einzigen Zug, der einmal täglich Peking zusteuert. Niemand dürfte »zurollen« sagen, denn er läßt sich Zeit.
Die Gegend war öde bis zur Mundverstauchung durch Gähnen. Nichts als Kaoliang, die chinesische Hirse, die billiger als Reis ist und im Norden gut gedeiht; später einige ausgedehnte Maisfelder und erst vor Tientsin Gärten und Abwechslung, aber dazwischen doch wieder öde, graue Erdstriche, Lehmbauten, zerlumpte Menschen und langsam dahinwandernde Kamele. Man fährt fast vierundzwanzig Stunden, dann hält der Zug in einer Halle und man liest Chi'ien Men. Das ist Pe-King, die Hauptstadt.
Durch die Gunst der Götter.
So etwas muß man mitgemacht haben. Erst die Zollbehörde, dann die Hotelschreier, die Kulis, die um das Gepäck kämpfen, und endlich vor dem Riesentor, auf dem Riesenplatz die Rikschas!! Ein Mann wollte dem Kuli den Weg zeigen, ein anderer mein Gepäck überwachen, ein dritter … kurz, fünf Männer wollten mit, und dazu drängte sich noch eine krätzebedeckte, triefäugige Alte heran und wollte mir fächeln. Fächeln, während aus ihrem zahnlosen Mund die Gerüche stiegen, die man sonst nur im innersten Raum des Zwischendecks findet. Ich danke!
Sie waren nicht zu beherrschen, und mein Chinesisch beschränkte sich auf die unnütze Frage »Sind Sie Chinese?« und die überflüssige Antwort, noch vor dem Weltkrieg einstudiert, »Ich bin Oesterreicherin!«, was gar nicht mehr richtig stimmte. So sprang ich in der Rikscha auf, erklärte auf Englisch, lieber zu Fuß gehen zu wollen, und machte Miene, mein Gepäck herabzuziehen. Die Grobheit wirkte; ich hatte die richtige Art gefunden, und wir trafen nach zwanzig Minuten in dem mir empfohlenen Hotel ein. Die menschlichen Aasgeier wollten zwei Dollar für die Fahrt, die fünfzig Kupferstücke wert war. Der Wirt riet mir, fünfzig Goldcents zu geben, und jagte sie dann mit dem Stock hinaus …
Am lautesten kläffte die krätzige Alte, die mich angestänkert hatte.
Das Hotel war voll. In ein mir empfohlenes Haus, wo Russen billig wohnten und das mir jemand im Zuge geraten hatte, verspürte ich keine Lust zu gehen, und für eine englische Pension hatte ich mich beinahe schon entschieden, als der Herr sagte:
»Wissen Sie was, versuchen Sie Foo-Lai. Das ist ganz nahe in der Chuan Pan Hutung und wird von einer netten deutschen Dame, die mit einem Chinesen vermählt ist, geleitet.«
Eigentlich dachte ich mehr an die englische Pension, aber ansehen konnte ich mir die Sache ja. Der Diener zeigte mir das Tor, ich glitt hindurch, traf eine zarte Deutsche und wurde nach oben geführt, um das Zimmer in Augenschein zu nehmen. Es bildete die Dachwohnung des Hauses und hatte drei Fenster, jedes von anderer Lage und anderem Bau; aber es war so friedvoll still oben, daß ich sofort begeistert war und den hohen Preis (ich glaube fünfzig Dollar monatlich) bei all meiner sonstigen und notwendigen Sparsamkeit erlegte. Das war nur Zimmermiete und schloß keinerlei Kost ein, doch mich entzückte die winzige Veranda vor dem Fenster, der Umstand, daß ich keinen Nachbarn hatte, und die Mauer, die das Grundstück wie ein Kloster umzog und allen chinesischen Häusern eigen ist, so daß man in der Tat wie ein König in seinem eigenen Reich lebte.
Ich wartete unten im Salon, bis das Zimmer instand war, – eine kleine, sehr schmutzige Gestalt, denn seit Heijo hatte ich mich nirgends mehr zu waschen vermocht – im Zug trotz der ersten Klasse aus Furcht vor Ansteckung nicht, denn in China gibt es so viele Hautkrankheiten (Aussatz, Beulen, Krätze, den sogenannten roten Hund, allerdings mehr im Süden, und den schrecklichen Ringwurm, der eine kahle Stelle hinterläßt, wo immer er den Haarboden angreift) – und meine erste Handlung war denn auch, eine Treppe hinab ins Bad zu pilgern.
Ein so unbedeutender Schritt – das Zögern zwischen zwei Pensionen, ein flüchtiges Fragen, und das entscheidet oft über eine Zukunft, ein Menschenleben. Diese winzig kleinen Vorfälle haben mich oft beim Rückblick schwermütig gemacht. Es kann nicht reiner Zufall sein, der so einschneidend für ein Leben wird. Anderseits: Ist jede unserer Handlungen schon ein Fruchtkeim im Schoß der Zukunft, der nur aufzugehen braucht?
Foo-Lai wurde mir zum Paradies der Reise. Es blieben noch genug Schatten und Einsamkeiten des Herzens, genug Leid, das keine Sonne zu verscheuchen vermochte, aber ich hatte ein ruhiges Zimmer – ein heißersehntes und seltenes Ding! – und Menschen, die mich lieb hatten (von denen ich es mir jedenfalls einbildete). Dazu eine geheimnisvolle Umgebung, genug erspartes Geld, um für den Augenblick ganz meinen Studien leben zu können, und gute Nachrichten aus der Heimat. Ich schrieb für 23 Zeitungen und Zeitschriften, teils in Deutschland selbst, teils in Oesterreich und arbeitete während meines Pekinger Aufenthaltes an einer Novellensammlung, die mein ganzes Denken erfüllte. Das aber bedeutete schon Ferien vom wahren Ich. Oder ist der Mensch in mir nur Schatten und das wahre Ich der Künstler, der in seinem Schaffen aufgeht? Heute glaube ich es …
Die Pfirsiche.
Was ich da schreibe, ist ein Blick in die Zukunft. Die erste Woche in Peking verriet nichts von all dem Glück. In jedem Geschäft wurde ich übers Ohr gehauen, immer mußte ich für die gleiche Sache verschiedene Preise zahlen, und immer stürzten sich die Rikschakulis auf mich, wenn ich aus dem scharlachroten Tor trat, denn zu gehen ist unfein für Weiße. Ich aber danke Gott zu herzlich für meine Gehmaschinen und träume zu gern wandernd vor mich hin, spinne zu oft meine Werke so aus, als daß ich mich einem laus- oder ringwurmgesegneten Kuli anvertraut hätte, außer wenn Unkenntnis eher als Entfernung diesen Entschluß zur Notwendigkeit machten.
Indessen habe ich durch beständige Entbehrungen und durch das unfreiwillige Achselreiben mit den niedersten Volksschichten einen Kennerblick für billige Geschäfte oder Kaufleute entwickelt und schon am zweiten Tage hatte ich einen Chinesen ermittelt, der mir für zehn Cents, die ich ihm wortlos hinhielt, (sagte ich nicht, daß ich Anlage zum Trappisten habe?), das rosa Säckchen mit Pfirsichen füllte. Wohl waren es nicht die besten ihrer Art, wohl stand die Bude mitten auf der Hatamenstraße nur wenige Schritte vom »erhabenen Tor des Wissens«, das grau und drohend von der Pekinger Mauer emporragte, wohl rasierte ein Wanderbarbier neben meinem Obsthändler seine Opfer und sammelte die abrasierten Haare auf einem vom Opfer selbst gehaltenen Federfächer, wohl zerschnitt nebenan der Wanderkoch kleine Fleischstückchen (möglicherweise von Hund oder Ratte stammend, aber als Schweinefleisch verkauft) für seine seltsamen Gerichte, die nach Sesam- oder Saubohnenöl rochen, wohl fingen sich zwei alte Weiber in einer Hausecke Läuse und spuckten alle Kinder der Himmlischen Mitte nach allen Richtungen hin, während die schwerfälligen Kamele aus der Gobiwüste dicht an uns vorbeizogen, ein Tier immer mit der Nase an den Schwanz des Vordermannes gebunden, – aber Pfirsiche um zehn Cents ohne Aerger waren es …
Mit dieser Pfirsichlast ging ich dreimal täglich an den Dienern vorüber, – am dicken Torhüter, der sich nie aus der Eingangswölbung rührte und verantwortlich war, kein Gesindel und niemand Verdächtigen durchzulassen, und an den beiden Boys oder Kellnern, die in ihren lichtblauen Ischangs (talarartigen Uebergewändern) sehr gut aussahen und sich immer tief verbeugten. Nicht immer konnte ich unbemerkt an Frau L. vorbeigleiten, und jedesmal sagte sie, daß man in Peking Obst nur mit Vorsicht und nur mit siedendem Wasser abgespült essen solle, was ich andächtig anhörte. Da mir aber im Zimmer das Kochen auf einem Spirituskocher gewiß verboten gewesen wäre, da ich kein Wasser trinken durfte, (weil es abgekocht sein mußte) und daher nichts essen wollte, was Durst erzeugte, so aß ich dreimal täglich Pfirsiche. Zum Schluß schien mir mein Bauch wie der des Wolfes, dem die Steine an Stelle der Geißlein eingenäht worden waren. Frau L. wurden gleichzeitig die Pfirsiche, die als wandelnde Cholera in mir und mit mir herumzulaufen schienen, zu bunt, und sie schlug mir vor, morgens mit dem Boy eine Kanne heißen Wassers zur Teebereitung heraufsenden zu wollen.

Chinesische Händlertypen
Bei der Gesandtschaft.
Wie versprochen, hatte mir der deutsche Botschafter in Tokio in liebenswürdigster Weise ein Empfehlungsschreiben an den Gesandten in Peking mitgegeben, der indessen gerade im berühmten Seebad Pei-tai-ho weilte und mich ziemlich kalt wie einen unliebsamen Akt erledigte. Auch sonst war man – bis auf eine Dame – bei der Gesandtschaft kalt wie die oft genannte Hundeschnauze, und nachdem ich einige Male an den Steinlöwen vorbei hinein- und wieder herausgegangen war, gedachte ich des Rates, der mir geworden (nicht ohne innere Freude und zu meinem dauernden Glück, so daß ich dem Gesandten für seine Kälte noch heute dankbar bin), und wandte mich dem Gegenlager zu, was mir verboten gewesen war, so lange ich noch – durch irgend ein Band – mit der Behörde zusammenhing.
Ich hatte nämlich ein Empfehlungsschreiben an Herrn Erich von Salzmann, den bekannten Korrespondenten der Berliner Morgenpost, der Kölnischen Zeitung und vieler anderer deutscher Blätter, der seit zwanzig Jahren in China ansässig und eine im Osten sehr bedeutende Persönlichkeit war. So oft ich seinen Namen auf der Messingplatte las, gab es mir einen Ruck, hineinzugehen, aber die deutschen Steinlöwen, wie ich sie nennen muß, warnten mich. Nun man mich aber wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen hatte, brauchte ich keinerlei Rücksicht zu üben, und eines Nachmittags, nach – wie mir wohl scheint – vorheriger Anfrage, zog ich die Glocke des berühmten Journalisten.
Sprich: vom Fegefeuer ins Himmelreich kommen! Wenn man bedenkt, was im Osten dazu gehört, sich politisch auf dem Laufenden zu erhalten, wieviel Scharfsinn, wie unzählige Gespräche, entweder persönlich oder über den Draht, ein wie unaufhörliches Ueberwinden von Tücke und absichtlichem Irreführen, und überdies erfährt, daß Herr von Salzmann so schwer augenleidend ist, daß er einer Sekretärin bedarf, so wird man begreifen, wie entzückt ich war, daß er nicht nur alle Arbeit zur Seite schob und mich noch an jenem Abend in die Seitengäßchen Pekings führte, um mir alles zu erklären, sondern daß sein Empfang so herzlich war, wie man ihn ganz selten einer Fremden entgegenbringt. Er hatte sogar mein jüngstes Werk in Händen gehabt und sprach darüber, kurz, ich wandelte wie auf Wolken von ihm heim.
Er tat – was keine Behörde so schnell für mich getan hätte – er gab mir Empfehlungen an die drei englischen Blätter, und obschon zwei Schriftleitungen zu arm waren, um Beiträge zu entlohnen, so nahm die Far Eastern Times sechs Aufsätze über Südslawien an und bezahlte hundert Dollar. Dies machte mich überdies in Peking einigermaßen bekannt und führte zu weiteren Vorteilen, und am folgenden Tage machte mir der liebenswürdige Korrespondent, der mich kaum kannte, den Vorschlag, ich möge auf eine Woche zu seiner Frau nach Peitaiho fahren …
In Pekings Hintergäßchen.
Die auserwählten Reichsdeutschen, die irgendwie mit der Politik zusammenhängen, wohnen im Gesandtschaftsviertel, und zwar jeder auf dem seiner Behörde angewiesenen Fleck. Auf dem Lazarettgrund wohnte Herr von Salzmann, und die Gesandtschaft lag etwa fünfzig Schritte weiter an der Gesandtschaftsstraße. Viele politische Vertretungen, besonders Amerikaner und Japaner, hatten sehr viel Militär mit und regelrechte Kasernen an die Amtsgebäude anschließend. Deutschland hatte nach dem Friedensschluß viele Vorteile verloren. So mußten sich die Deutschen vor den chinesischen Gerichten verantworten, wenn sie etwas verbrochen hatten, nicht vor denen der eigenen Behörde, und das führte zu allerlei Qual und Mißbrauch. Es schadete aber nicht nur den Deutschen – es setzte alle Europäer in den Augen der Asiaten herab – und mag der erste schwere Anstoß zu der heutigen Auflehnung gegen fremde Rechte in China gewesen sein.
Hinter dem Gesandtschaftsviertel liegt das Ch'ien Men, das zur echten Chinesenstadt führt, die so ist, wie man sich das daheim vorstellt. Peking war der einzige Ort, der mich nicht enttäuschte. Da hingen die roten, mit goldenen Buchstaben verzierten Streifen tatsächlich aus den Fenstern, da waren die geschnitzten alten Tore grün und goldig im Ton, da schoben phantastische Tiergebilde, die nie gelebt haben konnten, ihre Steinhäupter aus Mauervorsprüngen, und da war das Straßenbild so, wie man es sich geträumt hatte und wie es vor tausend Jahren schon gewesen sein mag: langsam dahinschreitende, sich wiegende Kamele, die meisten dunkelbraun mit Haarfetzen, die herabhingen wie Wolle von einem sich schabenden Teppich; manche Tiere waren weiß. Eilende Diener mit spitzen Hüten, die einer Privatkutsche mit geschlossenen grünen Jalousien voranliefen; Rikschakulis, die gebeugt dahinklapperten mit irgend einem steingesichtigen dicken Chinesen im zweirädrigen Gefährt; ein Vater, der stolz sein nacktes Söhnchen führte, das nichts als eine viereckige Haarfranse vorn auf dem glattrasierten Kopf hatte; Lamamönche in brauner oder gelber Kutte, die man schon von weitem roch, und Frauen, »die öffentlich lachen«, in weiteren Hosen, als es sonst Sitte, und mit schwerduftenden Blumen im Haar. Vor allem Bettler, die sich mit widriger Zudringlichkeit heranschoben, einen am Arm zupften, sich vor einem in den Staub warfen, einen »Vater« und »Mutter« nannten, und die greulich verstümmelt waren, so daß man sich am liebsten losgekauft hätte, wenn nicht eben das Verteilen von Almosen sie erst recht angelockt hätte. Ueber all dem lag der »Duft des Ostens«, das heißt, jenes zauberhafte Gemisch von Gerüchen und Gestänken, das man nicht vergessen kann: Weihrauch, Sandelholz, Harze, Honigkuchen, fremde Gewürze, allerlei Oele, der Schweiß halbnackter Menschheit, Unrat in den Ecken, die Ausdünstungen eines Kranken, das nasse Fell räudiger Hunde, und dann wieder der Duft feinen Tees, frischer Seide, alter Rosenkränze, trockener Fische und neuerdings hinab zu dem Odem von Leichen und Fäulnis. Die Gerüche greifen ineinander und sind überdies durchwoben von dem feinen Rassengeruch, der einem sofort verrät, daß man sich unter Menschen befindet, die doch irgendwie chemisch anders zusammengesetzt sind.
In den Hintergäßchen flaut all dies ab, und man sieht nur die abweisenden grauen Mauern, die etwas Geheimnisvolles an sich haben. In diese festen Wände eingelassen findet man auf einmal schwere Messingplatten, von Blumen umgeben und von Schleifen umflattert. Daneben grinst ein scharlachrotes Tor, und in dem breiten Torweg sitzen mehrere Diener. Ein Tisch zeigt sich, auf den ein eben Eintretender einen Silberdollar legt.
Hier hausen die Freudenmädchen, eher wie Königinnen, die Gunst verteilen als wie arme Sklavinnen, die sich verkaufen müssen. Wer hier eintritt und seinen Dollar zahlt, ist noch lange nicht am Ziel seiner Wünsche. Er wird einfach vorgelassen, erhält im allgemeinen Salon, zusammen mit vielen anderen Herren, sein Täßchen Narzissen-, hier Wasserlilientee, oder vielleicht ein Schälchen Reiswein mit einem unerträglich süßen, breiigen Kuchen. Er wird von der schönen Wirtin unterhalten, geistreiche Reden fliegen hin und her, und wen sie am meisten liebt, der darf zum Schluß bleiben. Die anderen sind um eine schöne Stunde reicher und einen Dollar ärmer, aber ihr Liebesdrang bleibt ungekühlt. All das erinnert mehr an das griechische Hetärenwesen. Solche Frauen müssen ebenso sehr durch ihr Wissen, ihren Geist und Witz, wie durch ihr Aeußeres wirken. Wie in Japan, so auch in China erklärt sich die Macht solcher Frauen durch den Umstand, daß Ehen bestimmt werden, in der Freiheit indessen das Herz sprechen darf.

Zwei kleine Chinesen
In Peitaiho.
Die kleine Chinesin in Seidenjacke und Hose stand am offenen Wagenfenster und machte Spritzbewegungen, – die Art des chinesischen Winkens, die mehr an der Luft gegebene Nasenstüber erinnert. Zwei ältere Frauen, ziemlich aus dem Leim gegangen, saßen mir gegenüber, und die eine versuchte, mich in ein Gespräch zu verwickeln, das bei meinen Sprachkenntnissen bald in den Furchen der Unkenntnis endete; aber wir unterhielten uns nach Art der einstigen Neandertaler weiter, indem wir allerlei Handbewegungen nach oben und nach unten machten und Grimassen wie Kinoschauspielerinnen schnitten. Als wir in einem größeren Orte hielten und man Pfirsiche brachte, kaufte mein Gegenüber einige goldgelbe, wunderbar saftige, verlockend wie die Sünde aussehende und bazillengespickte, und reichte mir eine Frucht.
Immer wieder hatte ich Gelegenheit, zu erkennen, daß die Frauen der ganzen Welt mit nur geringen Ausnahmen herzensgut sind, und zwar je niederer in gesellschaftlicher Stellung, desto gutherziger. Entweder können die Armen leichter aus ihrer Schale heraus, oder sind sie so gut, weil sie den Mangel am eigenen Leibe kennen gelernt haben? Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte und mit Gott und der Welt zerfallen war, hat mich immer wieder solch ein Beispiel der Nächstenliebe vor völligem Seelenverfall gerettet. Es war stets, als ob ich auf dem trostlosen Weg einer unbegrenzten Wüste aus einmal eine Oase mit Blumen gefunden hätte.
Ich aß die Pfirsich ohne Rücksicht auf ihre Choleramöglichkeiten in der wohltuenden Erinnerung, daß mein Magen schon Iguanaeier, Schlangen, Okalehau und japanischen Mochi verdaut hatte, und tatsächlich waren die Folgen nur ein » Tutsehe buhau« (Unruhen unter dem Gürtel).
Dicht neben den Dörfern sah man runde Hügel von halbem Hausumfang, die ungeschmückten Gräber der Toten, schwarze Schweine, trabende Kamele, zahllose Maultiere und Esel und komische, blauüberdachte zweirädrige Wagen, deren schwere unförmige Räder in den Furchen versinken, und in denen die Reisenden nur gebückt und mit untergeschlagenen Beinen sitzen können. Auf einer Handkarre führte ein Mann seine zwei Frauen samt Koffer in ein Nachbardorf, und die beiden besseren Hälften (machen zwei Hälften in dem Fall ein Ganzes?) hockten sehr geschickt über dem einzigen breiten Rad.
Erst abends, wenn die Knochen schon die neunstündige Fahrt spüren, und die Berge über die weite Ebene wie wandernde Mönche langsam und vornehm heranrücken, hält der Zug in einer baumbeschatteten Station, und jemand ruft:
»Peitaiho!«
Das ist das berühmteste Seebad des Nordens. Es wird von allen Europäern mit Begeisterung aufgesucht, aber man darf dabei ja nicht an Ostende oder Abbazia denken. Die kleine Zweibahn, der ich mich anvertrauen mußte, lud mich im ersten Abendschatten vor einem Ort ab, der aus sehr gewöhnlichen, zerstreuten Bauten bestand und in keiner Weise großartiger als die üblichen Landdörfer schien. Ich nahm die beiden mir anvertrauten Erdbeersaftflaschen und trat ins Freie …
Meine Last diente draußen als Erkennungszeichen.
Auch am folgenden Morgen, bei hellem Licht betrachtet, war Peitaiho kein Kurort. Zwischen Mais- und Kaoliangfeldern lagen ebenerdige Häuschen mit auffallend breiter Terrasse und herabrollbaren Strohmatten, die bestimmt waren, die schier unerträgliche Hitze einer- und die strömenden Regenmassen anderseits abzuhalten. Wohl gab es an einer Straßenbiegung eine Art Markt, den ich mit Freuden besuchte; (denn schon das zwecklose Wühlen in all der chinesischen Pracht war angenehm), doch fehlten Kurpark und Kursalon und selbst ein allgemeiner Sammelplatz. Der Strand zog sich über drei Meilen dahin, und ebenso zerstreut waren die kleinen Landhäuschen, die die Europäer bewohnten. Die Straße selbst war furchenreich und staubig und der weichsandige Teil gehörte ausschließlich den Eseln. Man fährt in Rikschas oder reitet in Peitaiho, und nur der ganz Gewiegte geht auf des lieben Herrgotts Gaben – den eigenen Gehmaschinen. Schlecht genährte und übermüdete Esel drücken ihre Weltverachtung gern damit aus, daß sie plötzlich den Kopf tief senken und dem ungeübten Reiter zum Purzelbaum verhelfen, und die Rikschakulis riechen nach dem Schweiß Adams bis auf den heutigen Tag herab.
Was man braucht, das kommt ins Haus – vielleicht mehr, als man es wünschen würde. Der Wasserkuli füllt das große Holzfaß im Hofe, die Gemüsekrämerin legt das Gemüse vor der Verandastufe auf die Waage und betrügt, wenn es nur irgend geht, der Holzträger bringt seine Bürde, der Spitzenmann – o Versuchung! – zeigt sich, wenn man im Verdauungsdösen gerade geneigt ist, alles was er auf dem Boden ausbreitet, zu betrachten – und man kauft, ob man will oder nicht …
Verwirrend ist das Geld. Ein Silberdollar hat hundert Silbercents, aber schwankend hundertachtzig bis hundertneunzig Kupfertungsel. Das nur in Shanghai im Umlauf befindliche Drachengeld hat höheren Kurs. Ein Tungsel kann groß (2), klein (1) oder ein Postkupfergeld mit einem Loch sein und kann im letzten Fall auch nur wieder beim Postamt angebracht werden. Das Drachen-Zehncentstück hat 20, das gewöhnliche Zehncentstück nur 13 bis 19 Tungsel. Die Obsthändler rechnen nach vier, andere nach fünf Tungseleinheiten, und immer gibt es Geschrei, wenn man sich irrt.
In China kochen nie Frauen, und man hat daher ausschließlich männliche Dienstboten – ein wundes Kapitel. Sie stehlen, sie sind ungehorsam, und wenn man den Koch entläßt, verschwinden meist alle seine Gesellen. Auch hat man für verschiedene Arbeiten verschiedene Diener, und kein Chinese tut mehr, als in sein Fach schlägt. Der Waschmann wäscht die Wäsche und zerreißt sie mit viel Geschick, der Wassermann bringt das nötige Wasch- und Trinkwasser, der Pförtner ruft die Rikschakulis, bewacht den Eingang, zahlt kommende Boten, nimmt Briefe entgegen, der Hausjunge trägt aus, springt zu und lernt. Der Hauskuli trägt Kohle, wischt die Fußböden auf, tut Botengänge, begießt die Blumen, der Diener serviert bei Tisch, hält die Herrenwäsche in Ordnung, öffnet die Türen, bringt den Tee. Die Amah besorgt die Kinder, hält die Damenwäsche in Ordnung und verrichtet leichte Dienstleistungen, wenn sie von den Kindern abkommen kann. Sie haßt das Bad und trägt im Winter wattierte Gewänder, die selten gewechselt werden. Jeder Dienstbote erhält 12 bis 15 Dollars monatlich, verköstigt sich indessen selbst. Der Koch ist ein Kapitel für sich. Von jedem Händler, der etwas absetzt, fordert der Boy Prozente, und was man kauft, wird immer um einige Cents höher berechnet. Nirgends, höchstens noch in Indien, wird der Europäer so unglaublich ausgebeutet, und dennoch lebt man selten irgendwo so königlich behaglich wie in China. Oder lebte, denn heute ist der Ausländer die Null vor der Ziffer …
Endlich hat man noch unter den Krankheiten der Diener zu leiden. Schmutzbeulen im Nacken sind wohl das mildeste Unding. Sie beginnen, Eiter auszuscheiden, eine Fliege setzt sich daran fest, vergiftet die Beulen noch weiter, und der Chinese stirbt an Schmutz. Dann kann Cholera ausbrechen, allerlei Würmer treten auf, oder der Boy ist Opiumraucher, hat ein gelbes, eingefallenes Gesicht, sein Verstand bleibt auf Stunden verwirrt, er ist müde, arbeitsunlustig und oft böswillig. Niemand ist so heimtückisch, rachedurstig wie ein Chinese; aber er kann lange zu einer Beleidigung ein ruhiges Gesicht machen. Die Behandlung seitens der Weißen hat übrigens sehr viel zu wünschen übrig gelassen und erklärt den heutigen Haß.

China: Arbeit im Reisfeld
Der Sturm.
Ich habe selten mit jemandem zusammengelebt, der so grundverschieden von mir in allen Lebensansichten gewesen wäre wie Frau von S. Dennoch kamen wir sehr gut aus; denn ihre betont materialistische Weltauffassung machte mich auf das Praktische des Alltags aufmerksamer, als ich es sonst war, und rüttelte mich ein wenig aus meiner idealistischen Verträumtheit und meiner damaligen Sehnsucht, alles allen zu schenken, auf und sie fand Unterhaltung an meinem Wesen, das für sie wahrscheinlich einem modernen Don Quijote glich. Am Abend, bei Windlichtern, wenn der Mond wie ein gerefftes Segel über das Schwarz der zitternden Weiden emporschwamm, sprachen wir über das Sein, sie es im Sichtbaren, ich, mit dem durch den Aufenthalt unter Dunkelfarbigen vertieften Hang zum Mystischen, im Unsichtbaren verankernd.
Eines Nachmittags, während ich auf der Terrasse schrieb oder malte, Frau von S. aber schlief, klatschten die Strohmatten so drohend, daß ich mich bei dem wachsenden Dunkel ins Zimmer zurückzog. Bald zischte, surrte, schnarrte und kochte es da draußen, als ob der Himmel zur Hexenküche geworden wäre. In den Schnüren der befestigten Matten wimmerte und krachte es, Blitz folgte auf Blitz, Donner auf Donner, und der bleischwarze Himmel, der auf unser Häuschen zu fallen drohte, spie einen Strom warmen Wassers aus, der wie ein dammbrechender See herniedertoste. In einer Viertelstunde war es indessen so klar, daß wir es wagten, durch die Pfützen und unter treibenden Wolken dahin, nach dem Hauptteil des Ortes zu gehen. Je näher wir kamen, desto mehr staunten wir, denn überall waren die Dächer weggefegt oder zersplittert, die Fenster aus den Angeln gehoben und die Türmchen der Villen in die Gärten verschleppt. Riesige Bäume lagen entwurzelt, und wir erfuhren zu unserem Erstaunen, daß nicht eine Meile von uns das Schwanzende eines Taifuns gewütet, Himmel und Erde auf zehn Minuten verbunden und all diese Verheerung durch die Windhose angerichtet hatte. Viele Budenbesitzer fanden nur noch Schutt vor, und eine große Menge Menschen war obdachlos. Viele Europäer packten und fuhren sofort nach Peking oder Tientsin zurück. Wir bewiesen, daß uns der Journalismus im Blut steckte, denn Frau von S. stürzte sich aufs Briefpapier, um ihren Gatten zu verständigen, und ich flog atemlos zu meiner Erika, die ich natürlich nach Peitaiho mitgenommen hatte und die nachts auf dem Stuhl neben meinem Bett stand.
Unter Tempeln.
Wenn ich nur ein Land zu beschreiben hätte, so würde ich über alles gern bei den Tempeln verweilen; denn jeder Tempel ist ein Gedicht von Stein, das in vergangene Jahrhunderte reicht und das einen Teil der Volksgeschichte in sich schließt, eine Seite des Volksdenkens offenbart – so aber sind meine Hände gebunden. Der Himmelstempel allein verschlänge mit Leichtigkeit Bände. So still und vornehm liegt er inmitten der weiten sonnetrunkenen Ebene hinter der berüchtigten Diebsbrücke, wo die »Funde der Nacht« vor dem Morgengrauen oft um einen Spottpreis feilgeboten werden. Das kobaltblaue Dach, das ins Violette sticht, hebt sich aus grüner Mauer, denn Blau ist das Sinnbild des Himmels, Grün das der fruchtenden Erde. Rund ist alles, was den Göttern, viereckig oder fest begrenzt alles, was dem Menschenreiche angehört. Daran reiht sich die wundersame chinesische Zahlensymbolik, die fast so großartig ist, wie die der Hebräer und ebenfalls 3 x 3, also in neun die heiligste aller Zahlen sieht. Daher führen je drei und drei Stufen zum Himmelsaltar mit den Sinnbildern der Erde – Wind, Wolken, – der höheren Luftschichten – Phönixen – und denen des Himmels – dem Drachen – auf der breiten marmornen Mittelfläche, über die der Kaiser, der zu vornehm war, um Stufen steigen zu dürfen, gehen mußte. Auf diesem Altar, gegen Süden gewandt, weil die Sonne wohl im Osten aufgeht, aber ihre Höchstkraft im Süden erreicht, brachte der Kaiser in der Neujahrsnacht ein tadelloses schwarzes Tier, meist eine Ziege, zum Opfer dar. Der Mittelstein ist von neun Reihen von Marmorfliesen umgeben, die zusammen 36 Steine bilden. An den Himmelstempel grenzt der Erntetempel, ebenfalls durch und durch sinnbildlich, in seinen äußeren roten Lacksäulen die zwölf Monate, in seinen vier inneren, prachtvoll verzierten die vier Jahreszeiten, im eingebauten Viereck, das in der Kuppel liegt, den Segen des Himmels auf die Erde, ohne den nichts gelingen kann, darstellend.
Das ist vielleicht der vornehmste Tempel, eben weil der Glaube, der so viele Anklänge an den der Inkas hat, erloschen ist, wenn man nicht den Fünfeckentempel vor dem Tor und auf dem Weg nach der Edelsteinpagode nennen will. Im Lamatempel herrscht zu viel Geldsucht – immer wieder Mönche, die eine schmutzige, langnagelige Klaue vorstrecken, und trotz der vielen Sehenswürdigkeiten (dem lachenden Riesenbuddha in der Vorhalle, den seltsamen Buddhas unter Glas in dunkelnden Kapellen, dem Sor oder den Opferpyramiden aus Butterteig und den Mönchen, die unaufmerksamen Jüngern mit dem Fliegenwedel aus Yakschwänzen eins übers Ohr geben) nicht so mystisch reizvoll wie zum Beispiel der Mahakala Miao (Shiva in seiner Eigenschaft als Zerstörer alles Sinnlichen), in dem überlebensgroße Gebilde, allerlei Geister verkörpernd, und Vogel-, Tier- oder Menschgestalt tragend, aus dem unheimlichen Dämmern riesiger Tempelhallen brachen. Ein Weib kniete da vor einem unerbittlichen Manne und hielt ihm stumm die Opferschale hin. Es war das Weibliche, das alles dem Männlichen opfert, das auf die Gabe der Zeugung wartet, die allein die Welt erhält …
Der Ta Chung S'su, wo man das Geheimnis des Lebens kennen soll, hat die größte hängende Glocke der Welt. Ihr Anschlag sagt: Schie, Schie (mein Schuh, mein Schuh!), weil sich eine liebende Tochter in ihren Guß gestürzt hat, um dadurch das Gelingen der Glocke herbeizuführen, was nur durch das Blut einer Jungfrau erreicht werden konnte. Die herbeigeeilte Dienerin erhaschte nichts als den einen Schuh. Darum klagt die Jungfrau, wenn die Glocke läutet, um ihr verlorenes Pantöffelchen.
In Tung Yü Miao, gegenüber dem Tempel der aufgehenden Sonne, knien die unglücklichen Frauen vor der Prinzessin der farbigen Wolken, und die Göttin, die einmal in der endlosen Reihe der Wiedergeburten auch Weib gewesen ist, erinnert sich mit dem begreiflichsten Gruseln an diese eine Erfahrung und kann keinem Weibe eine Bitte abschlagen. Eine Nische ist dem Yüh Hsia Lao Erh – dem Mann vom Monde – geweiht, der die Füße der künftigen Eheleute mit einem roten Faden zusammenbindet, und bei dem man sich für den Knoten bedanken soll. Da er meine Füße vergessen hat, ging ich grußlos an ihm vorüber. Neben der Eingangstür hängt eine ungeheure Rechenmaschine, und wenn Gläubiger und Schuldner sich gar nicht einigen können, so schlafen sie nachts vor der Rechenmaschine, und am frühen Morgen steht die richtige Zahl oben. Da fügen sie sich schweigend dem Richterspruch.
In den Nischen des Innenganges sieht man die Richter der Unterwelt und deren Entscheidungen, aber das Schrecklichste dieser Art ist der angrenzende Shi Pa Yü oder die achtzehn Höllen des Buddhismus, in denen in hochlebenswahrer Art Leiber auseinandergeschnitten, Köpfe gebraten, Augen herausgerissen und Zungen gespalten werden. Die dreizehnte Hölle zeigt, wie Kinder vor den Augen der Eltern auseinandergeschnitten, erwürgt oder getreten werden und scheint mir der furchtbarste der achtzehn Marterorte zu sein.
Im Po Yün Kuan, einem taoistischen Tempel, zeigt man – ohne ein Trinkgeld zu fordern – die schönen alten Steininschriften, die Tempelhallen, die Gärten mit ihren Felsanlagen, und hier verteilt der dritte der acht Genien am Tage der Hundertgottfeier Geld an die, die er schätzt. Und hier muß ich auf meinen Götzen aus Peru zurückkommen. Dr. Lessing, der bekannte deutsche Archäologe, der damals in China weilte und in Foolai wohnte, erkannte in meiner Specksteinfigur Li Tie Guai, eben den dritten der acht Genien, über den ich seither viel geschrieben habe und der überdies der Held meines Romans »Der Götze« ist. Als ich durch die friedlichen Höfe des alten Klosters ging, mußte ich unwillkürlich denken, daß es die Pflicht Li Tie Guais (Li mit der eisernen Krücke) wäre, mir für all meine Anhänglichkeit Geld zu schenken, aber er schwieg. Schriftsteller gehören einmal zu den Wesen, denen niemand gern Geld gibt (geschweige denn schenkt).
Den tiefsten Eindruck machte mir der gelbe Tempel » Huang Ssu« jenseits eines der mächtigen Pekingtore, die immer aus zwei Teilen bestehen und ganz krumm gebaut sind (das heißt, schrägliegende Höfe haben), damit die Geister den Weg nicht hindurch finden. Die weite Ebene dehnt sich als gelber Sandteppich davor, und die Westberge schimmern wie Saphire durch den leichten Schleier eines Frauengewandes. Die Tempelkuppel sticht in die klare Herbstluft, und die Trauerweiden werfen ihre gelben Blättchen wie verstreutes Gold auf die stillen, grünlichen Wasser des Kanals, über die mit leichten Bewegungen, die weiche Halbkreise werfen, Mandarinenten schwimmen.

China: Inneres eines Tempels
Ein Lamamönch mit schwarzen Klauen – Nägeln, die wie bei dem Weisen auf dem sagenhaften Augenbrauenberg schon fast rund um ihn wachsen – öffnete die Pforte. Wir glitten hindurch. Ueberall Verfall, das Schwinden der Größe vergangener Tage. In den Tempelhallen hingen noch modernd die seidenen Tücher, die Anbeter aus dem fernen Tibet brachten, und die Götter in ihren Glassärgen schienen mitzutrauern um das tote Einst. Tor auf Tor öffnete sich, und endlich waren wir im innersten Hof, der schneeweißen, mit Reliefbildern verzierten Pagode gegenüber, unter der in einem goldenen Kästchen die abgestreiften Gewänder des heiligen Lamas ruhen, der an den schwarzen Blattern gestorben und dessen Leichnam in einem goldenen Sarg nach Tibet zurückgeschickt worden war. Ein ruhender Löwe aus Stein wischt sich die Augen, und eine vergoldete Kuppel krönt die dreizehnstöckige Pagode.
Schlimmer als das Eintreten war der Ausgang; denn nun stand der klauenreiche Mönch in seiner übelriechenden Kutte mitten auf der Schwelle und versperrte den Weg, um ein reichliches Trinkgeld zu erpressen. Einmal sperrte jemand von draußen das Tor zu, aber da kam er gut an. Frau von S. nimmt das Leben vom Menschen-, nicht vom Geisterstandpunkt, und wenig hätte gefehlt, so würde der Lamamönch auf seinen heiligen Fingern und vielleicht auf seinem noch heiligeren Haupte den harten Stock aus gutem deutschen Holz verspürt haben. Er öffnete also Tor auf Tor und erst vor dem letzten Tor gaben wir ihm zwanzig Cents. Wir hätten mit weniger Erpressung mehr gegeben.
Ich trug Verlangen nach dem Tsan-tsan – das Geheimnislüsterne in mir jedenfalls – und obschon meine Gefährtin sonst mehr für das rein Körperliche war, ließ sie sich bewegen, den Tsan-tsan mit mir zu besuchen. Wir durchschritten die sanddurchwehten, krummen Gassen, die nur aus gewundenen Mauern bestanden, bis wir endlich ein Tor erreichten, das – von einem noch schmutzigeren Mönch geöffnet, dessen Nägel ganze Spiralen bildeten – in einen Hof führte, der nur ein Kohlenlager schien. Jenseits dieses Haufens kleiner Kohlenbälle (die Staubkohle wird befeuchtet, zu Bällen geknetet, an der Sonne getrocknet und so verkauft) fanden wir wieder einen düsteren Holztempel. Als der Schlüssel im Schloß knirschte und das Tor aufflog, kam uns ein starker Verwesungsgeruch entgegen. Im düsteren Raum, den selbst die goldene Herbstsonne kaum zu erreichen vermochte, stand Kiste an Kiste. Sie hatten sämtlich gelbe Deckel und erinnerten an breite Nachtkästen, doch waren sie etwas niedriger. In jeder Kiste saß ein verwesender Mönch. Wenn nämlich ein Mönch vom Hoang Ssu den Tod herannahen fühlt, nimmt er, noch lebend in den Sarg steigend, sofort die Stellung ein, die er in der anderen Welt aus der Lotosblüte einzunehmen wünscht. Sobald er tot ist, schlägt der Mönch, der den Rundgang macht, den Deckel zu, und die Verwesung schreitet vor, bis der Gestank nicht mehr zu ertragen ist und man Kiste und Inhalt auf dem Hofe verbrennt. Dazu ist ja die Nähe des Kohlenhändlers, dessen Nerven und Nase ganz besonders beschaffen sein müssen, sehr vorteilhaft. Der Mönch sagte mir etwas, und Frau von S. übersetzte, daß er bereit wäre, um einige Kupfermünzen einen Deckel zu heben. Da sprang ich aus dem Tsan-tsan ins Freie, sehr zur Belustigung meiner Begleiterin, die schon angenommen hatte, ich wollte die Seele des Lamamönches noch in der faulenden Masse suchen.

China: Priester im Tempeleingang
Meine Chinesin.
Vater und Mutter hatten lange in Deutschland studiert und waren westlich angehaucht. Sie kamen oft zu Foo-lai und ersuchten mich endlich, ihr Unterricht im Englischen zu geben. Sie war ein zartes junges Mädchen von etwa zwanzig Jahren und hübsch selbst für europäische Begriffe. Das lange, schwarze Haar war gut geölt und im Nacken zu einem Knoten geschlagen. Sie trug eine enge, seitlich geknüpfte Seidenjacke, die bis zu den Hüften reichte, enge, schwarze Seidenhosen und öfter auch ein kurzes enges Seidenröckchen – das Modernste, bunte Seidenstrümpfe und reizende Pantöffelchen, in denen sie gewiß nicht zwanzig Schritte auf staubiger Straße gehen konnte, aber sie ging ja nicht. Sie kam in der eigenen Rikscha und fuhr in ihr zurück. Wenn sie manchmal schlimm war, sagte ihre Mutter:
»Warte nur, ich werde dich schon verheiraten!«
Das schließt das Schlimmste ein, was man einem Wesen weiblichen Geschlechts androhen kann, denn da ist man unter einem Manne, den man nie gesehen, einer Schwiegermutter, gegen die man viele Pflichten und keine Rechte hat, und auf immer von den Seinen getrennt. Selbst wenn die junge Frau später ihre eigene Mutter besucht, was nur einmal monatlich geschehen darf, muß sie eine Handarbeit mitnehmen und daran sticheln, zum Zeichen, daß sie nun nicht mehr nach Hause gehört, sondern die Arbeitskraft, der Besitz, kurz, die Ware eines anderen Hauses ist. Deshalb trägt man daheim Weiß, die Trauerfarbe, und fegt nach ihr das Haus wie nach einer Toten, sobald man die junge Braut in ihr neues Heim getragen hat.
Wenn ich mich zum dritten meiner Fenster, das hoch oben in der Wand war, aufschwang, so konnte ich drei Höfe übersehen, und einmal war im Nachbarhaus zur Rechten eine Hochzeit. Vor dem Eingang stand der Baldachin, die Musikanten trommelten, flöteten, pfiffen, schrillten und fiedelten flott darauf los, und endlich erschien vor der scharlachroten, goldgestickten Sänfte die verhüllte Braut mit einer prächtigen Krone und dem roten Seidentuch vor dem Gesicht. Hier durfte sie allein einsteigen, aber im neuen Heim würden die Diener sie über die Schwelle tragen und vor dem Hausaltar niedersetzen, und sie würde das Antlitz ihres künftigen Herrn und Gebieters erst sehen, nachdem sie zusammen die drei Tassen Sake, die mit einem roten Faden verbunden waren, geleert hatten.
Nichts ist so traurig wie eine sohnlose Familie. Fehlt der Edelstein, so fehlt auch das häusliche Glück, und ich fragte mich oft, wieviel heimlicher Kummer im Herzen der Mutter meiner kleinen Schülerin verborgen sein mochte; denn sie hatte nur drei Töchter, und wegen dieses Mangels nannte man die jüngste Tochter immer »kleiner Bruder«. Dadurch täuschte man sich über das Unvermeidliche hinweg.
Ihre Wohnung – ich besuchte sie einmal – lag im Erdgeschoß, und die Türen und Fenster gingen auf den schön gepflegten Garten zu, so daß niemand mit der Straße kokettieren konnte. Im Garten gab es Zwergpagoden und Nachahmungen von Felsen, Tempelchen, Reisfeldern – alles sehr schön und sehr fremd, und in den Räumen standen die schwarzen Möbel (alle aus geschnitztem Ebenholz) feierlich steif an den Wänden. Das Auffallendste waren die roten Spuckschalen.
Auf den Seidenjacken der Mädchen sah man häufig das Tier des Geburtsjahres eingestickt. Die Füße waren nicht verkrüppelt, aber angeboren klein, und obschon sie gut gebaut waren, hatten sie keine Freude am Gehen. Das ist in China auch bei den Europäern der Fall. Die Rikschas sind die wahren Unheilstifter, denn sie stürzen sich einem entgegen, und man muß in der Tat geheifrig sein, wenn man sich dazu entschließt, die gewundenen staubigen Straßen auf des Apostels Rappen zu durchreiten.
So viel über Chinesenfamilien.
Nun noch ein Wort über die Mischehen. Die einzig glückliche Ehe war die, die ich in Foo-lai kennen lernte und die möglicherweise dem Umstand entsprang, daß dieser Chinese zwanzig Jahre in Europa gelebt hatte und von den Ansichten der Weißen durchdrungen war. Selbst da kamen in seiner Eigenschaft als Vater Dinge zutage, die für westliche Begriffe undenkbar schienen. Alle anderen Ehen – es gab sechzehn in Peking allein – waren durchweg unglücklich. Dennoch waren einzelne dieser Chinesen an und für sich sehr liebenswerte, höchst angenehme Bekannte (nicht Gatten!). Ich hebe zwei Fälle – ohne Nennung der Namen – hervor. Die eine Dame war Oesterreicherin und hatte ihren Gatten bei der Gesandtschaft in Wien kennen gelernt. Sie lebte sechzehn Jahre an seiner Seite, ohne sich ganz bewußt zu werden, warum sie immer stärker voneinanderglitten. Da erfuhr sie allmählich, daß er nicht nur eine Nebenfrau, sondern drei verschiedene Familien in drei verschiedenen Stadtteilen Pekings hatte. Sie verließ ihn; denn mit der Scheidung geht es in China unendlich schwer, wird die Europäerin doch durch die Ehe selbst Chinesin. Bei der heutigen Unsittlichkeit in Europa scheint das kein krasser Fall; aber man muß in China gelebt haben, um zu verstehen, daß eine weiße Frau unmöglich die Herz- und Betteilerin eines Mannes bleiben kann, der sich mit ungewaschenen, vielleicht angesteckten, in jeder Hinsicht auf einer viel tieferen Stufe befindlichen Frauen in engste Gemeinschaft begibt und später von der weißen Gattin fordert, was eine Sklavin allein zu tun bereit sein mag …
Der zweite Fall war der einer sehr hübschen Französin. Sie wurde schwanger, und bei der Geburt eines toten Kindes wurde dem Gatten und auch ihr selbst gesagt, daß sie keine Kinder haben durfte, wenn sie nicht in dauernder geistiger Umnachtung sterben solle. Der Gatte wollte einen Sohn, unbekümmert um das Wohl der Frau, und um ihn zufrieden zu stellen, willigte sie ein. Das Kind – ein Mädchen – wurde geboren, und am neunten Tage nach der Geburt ging die Mutter mit einem Besen durch das Lazarett: rettungslos wahnsinnig. Sie verbringt den Rest ihrer blühenden Jugend im Irrenhaus.
Ich erwähne all das, um junge Europäerinnen, die in Europa der Zauber der östlichen Welt lockt, zu warnen. Nicht nur passen die Charaktere nicht zusammen – die Europäerin, die einen Asiaten heiratet, verliert auch bei den eigenen Rassenangehörigen ihre Kaste und lebt als gesellschaftlicher Paria. Das ist viel bitterer, als man es sich daheim vergegenwärtigt. Sie ist auch schutzlos dem Haß der fremden Rasse ausgesetzt und wenn sie sich hilfesuchend an die Behörden der Weißen wendet, heißt es unwillkürlich:
»Um Himmels willen, wie konnten Sie auch …!«
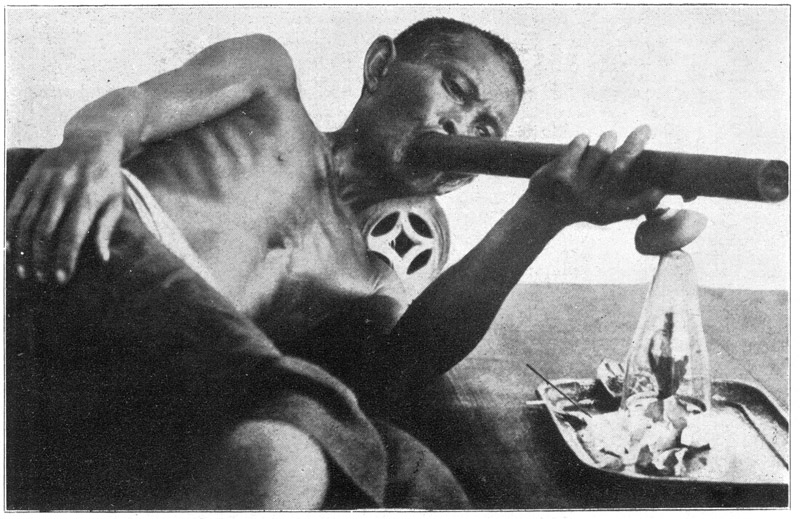
China: Ein Opiumraucher
Spaziergänge.
Am liebsten ging ich gegen Abend oben auf der Pekinger Mauer spazieren. Zwischen dem Hata Men einerseits und dem Chien Men anderseits dürfen Chinesen diesen, von belgischem Militär bewachten Teil der Mauer, der das Gesandtschaftsviertel überschaut, nicht betreten, denn von hier aus wurde auf die Flüchtlinge in den Gärten der Europäer geschossen. Nur einige Amahs in weißer Tracht mit der kleinen weißen Schutzbefohlenen wandern da auf und ab, sonst hat man den breiten, sonnenbeschienenen Weg für sich allein oder teilt ihn höchstens mit den Pekinger Raben, die überall zu finden und noch unverschämter als Raben gewöhnlich sind.
Nirgends auf Erden – so kam es mir vor – scheint die Sonne wie im Herbst in Peking. Der Himmel ist wolkenlos blau, die Westberge schimmern ins neblige Violett, die Wüste dehnt sich bis zu den Minggräbern mit ihrer Reihe von ungeheuren Steintieren gelblich glitzernd aus, und dicht zu Füßen liegt die Stadt selbst mit dem Tartarenviertel, in dem Europäer und andere Fremdrassige wohnen dürfen, und die Chinesenstadt, die nur für die Söhne der Himmlischen Mitte bestimmt ist. Man sieht die Kuppel des Ahnentempels neben dem schimmernden Himmelsaltar, die Tore, die sich dräuend erheben und deren offene Fensterbogen dazu bestimmt sind, die Geister hindernislos durchzulassen, die Straßen mit all ihrem unbeschreiblichen Hasten und Treiben, mit ihren Ausdünstungen und ihrem Zauber des Seltsamen.
Eines Abends fand ich das Tor geschlossen und wußte nicht, wie ich von der Mauer herunter sollte. Da riet mir ein böser dicker Geist in Gestalt einer Frau, mich durch die Eisenstäbe durchzuquetschen, da ich so schlank sei, und als ich meinen Kopf versuchsweise durchgesteckt hatte, war ich auch sicher, mit dem Rest des Körpers hindurchzugleiten. In dem Augenblick, in dem ich mein Schwergewicht glücklich durchgeschoben hatte, kam die belgische Wache und verhaftete mich. Nach langen, höflichen Erklärungen auf Französisch, und einem Versprechen, das Stelldichein am folgenden Tage bestimmt einzuhalten, wurde ich freigegeben, und lange Zeit hindurch sah mich die Pekingmauer mit den hübschen Tsao, den chinesischen Dattelsträuchern, nicht mehr …
Ich hätte nicht die Hälfte meiner Novellen geschrieben, wenn ich nicht so viel durch all die Hintergäßchen, in denen es von Verborgenem wogte, geirrt wäre. Da lag ein Toter in einer engen Stube, und man verscheuchte eben die Tiere (Hund und Katze) ängstlich aus dem Raum; hier saß ein Chinese auf der staubigen Erde und verklebte gewöhnliche Weidenkörbchen mit einer dünnen Masse, die – wenn getrocknet – das Körbchen wasserdicht machte: drüben schnitten zwei Männer Holz, der eine hoch oben in der Luft, der andere unten auf dem Boden. Sie zogen an einer langen Säge, der eine nach oben, der andere nach unten. Ich spähte in eine Cloisonnéfabrik, sah die blendenden Farben, merkte, wie sorgfältig die kleinen Stückchen eingefügt und wie schnell darüber glättend gewischt wurde; ich beobachtete den kleinen Zuckerkrämer mit seinen Honigwaren, auf denen mehr Fliegen waren als Honig, und blieb vor dem Reisladen stehen, dessen Zeichen ein weißer Haarwedel war, um zu schauen, wie der Reis geschüttet, gewogen, aus Mattensäcken gerollt wurde. Ich durchwanderte auch die berühmte Passage, in der man alles kaufen konnte, was es in China überhaupt gab: die reizendsten Figürchen von Nagelgröße, größere Darstellungen von Bettlern aus Lehm, Fächer, Götter aus Seide, Seidenlaternen, Schmuck, Lackwaren (nicht so einfach vornehm wie in Japan, sondern eher überladen, doch ebenfalls sehr schön in ihrer Art) und vor allem die wunderschönen, schweren chinesischen Gold- und Silberbrokate.
Zur Zeit des Herbstmondes feierte man die Mondprinzessin. Man sah daher kleine Figuren der Sagenhaften zu Dutzenden auf dem Boden zum Verkauf aufgestellt, und in scharlachroten Tonbecken übersandte man weiße Kuchen in Vollmondform. In alter Zeit war einem alten und grausamen Ehegatten von einem Weisen ein Lebenselixier gegeben worden, das er seiner Frau zur Aufbewahrung übergab, ehe er sich zum Schlafe niederlegte, doch sie – von Neugierde erfaßt – kostete die teuren Tropfen, die sie so eigentümlich froh und leicht machten, und ehe sie es wußte, war das Fläschchen leer. Der erzürnte Gatte verfolgte sie mit dem gehobenen Pantoffel von Raum zu Raum. Im letzten Zimmer stand das Fenster offen, und sie flog hinaus, – flog und flog und hörte in ihrer Angst nicht zu fliegen auf, als bis sie den nahen Mond erkannte und auf der weißen Scheibe landete, wo der Mondhase sie freundlich empfing und die Mondfeen sie zu ihrer Prinzessin erwählten. Zur Herbstzeit aber erinnert sie sich noch an die Erde, und segnet die Früchte, und wenn der Mond rot geworden ist, danken ihr die Chinesen …
Einmal erlebten wir auch einen Sandsturm. Erst wurde der Himmel fahlgelb, so daß er die Augen blendete und das Herz mit sonderbarer Furcht erfüllte, hierauf tauchten hinter den Westbergen ungeheure schwefelfarbige Wolken auf, ballten sich zu dräuenden Massen zusammen und wurden in Peking selbst zu einem feinen Sandregen. Man mußte alle Fensterritzen verstopfen und alles zudecken, dennoch kroch dieser Sand, der Hauch der Gobiwüste, durch die feinsten Oeffnungen und erschwerte selbst das Atmen. Draußen aber heulte der Sturm und wirbelte wie ein Wahnsinniger in seinem Sterbetanz. Es war so finster, daß man Licht brennen mußte, und gegen die Fenster schlug die knisternde Wolke in unheimlichem Takt. Nach wenigen Stunden war die Gefahr vorüber und alles, alles gelb.
Ein anderes Mal stand ich auf der Straße und bemerkte, wie alle Vorübergehenden eine Wolke am Himmel beobachteten – – oder einen Schwarm von Schwalben, wie ich zuerst dachte. Da kam die Wolke näher und lichtete sich – – es waren Heuschrecken, und sie fielen wie ein Regen in alle Höfe hinab. Mushi, der kleine Pekineserhund, sammelte sie und fraß sie auf, doch die Kinder sammelten sie eifrigst und lachend in Körbchen und Säcke. Daheim wurden ihnen dann die stacheligen Beine und der Kopf abgerissen und der fingerlange, dicke grüne Körper geröstet. Er soll sehr gut schmecken. Ich beteiligte mich weder am Fang, noch am Genuß. Am Morgen fraßen die Raben vom äußeren Drahtgitter meines Fensters, an das sich die Heuschrecken geklammert hatten, diesen grünen Braten mit Begeisterung weg.
Der Sterbefall.
Es wäre zu grausam, es ein Glück zu nennen; aber es war für mich ein guter Zufall, daß der Vater meines Hausherrn (wenn er schon sterben wollte), eben gerade starb, während ich in Peking war; denn auf diese Weise konnte ich Einblick in die tausend Sitten und Gebräuche gewinnen, die dabei ans Tageslicht treten und die man nie erfahren, die man eben, vom Zufall begünstigt, sehen muß.
Der Osten ist eigentümlich. In unserem klaren, nüchternen, sehr materialistischen Westen passen gewisse Ansichten nicht, bleiben einzelne Vorkommnisse unerklärlich; aber der Osten mit seiner Mystik sagt dem tieferen Ich etwas, das für mich in jedem Fall über all dem steht, was der abgeklärte Westen (oder ist es nur der unaufgeklärte?) auf diesem Gebiete eingesteht.
Der Vater Herrn L.s, ein alter Diplomat, der die Schleichwege der Volksführer in vielen Ländern studiert hatte, war ein hoher Siebziger, sehr rüstig, sehr gutherzig und noch immer lebenslustig. Eines Morgens ging er wie üblich nach der Verteilung von Almosen an die Blinden seines Viertels in der Chinesenstadt spazieren und kam zufällig an einem alten Tempel vorbei, der in einer der winkeligen Hintergassen liegt und in dem man erfahren kann, welche Stelle ein Verstorbener in der Schattenwelt einnimmt. Gerade als er an dem großen Tor vorbeischritt, fühlte er einen jähen Schüttelfrost das Rückgrat entlang und sagte, als er heimkehrte, zu seinem Diener:
»Klingle meinen Sohn an und bitte ihn, hierher zu kommen, denn ich werde diese Welt bald verlassen.«
»Fühlt sich mein Herr nicht wohl?«
»Ich befinde mich nicht schlecht, aber mir ist bekannt geworden, daß der Ruf ergangen und meine Stelle für mich bestimmt ist.«
Er legte sich nieder, und der Boy klingelte erst am folgenden Morgen um sieben, einer plötzlichen Unruhe gehorchend, an. Herr L. begab sich gegen acht nach der Chinesenstadt, fand seinen Vater scheinbar ganz wohl an und lachte über die Geschichte. Um zehn war der alte Herr einem Herzschlag erlegen.
Nun kamen die Trauerfeierlichkeiten. Die Gattin mußte von Shanghai berufen werden, und hier ging es an die Verfertigung der Trauergewänder. Pelze und Seiden wurden verpackt, auch alle Schmucksachen, die drei Jahre lang nicht getragen werden durften. Während dieser Zeit würde auch keins der beiden Mädchen heiraten dürfen. Die ersten Trauerkleider waren für alle aus gröbstem Grasleinen, das nicht eingesäumt wurde, sondern in Fransen (Gleichmut gegen alles Irdische) herabhängen mußte. Niemand sollte sich waschen, kämmen oder die Nägel putzen, und ehe ein Besuch kam, zerraufte sich Herr L. stets das Haar. Essen sollte man nur mit den Fingern und schlafen durfte man gar nicht. Im Trauerhause spielte die Musik ununterbrochen, um alle Geister zu verscheuchen, und der Sohn mußte ohne Unterlaß am Sargende hinter dem langen grünen Vorhang knien. So oft ein Vornehmer den Ehrenknicks vor dem Sarge machte, schlug er in der Regel auch den Vorhang zurück und hob den Trauernden auf.
Und in dem Zimmer, das der breite Vorhang trennte und in dem man als Besucher nur das Kopfende des hohen Sarges sah, wieviel Vorbereitungen! Alle Nägel mußten aus der Wand gerissen oder mit scharlachroter Seide umwickelt werden; denn am Abend kam der Wächter mit der Seele, die von dem Duft der Opferspeisen nahm, und war ein Nagel unbedeckt, so hängte der Geisterwächter die Seele daran und aß von den Speisen lieber selbst. Vor dem Tisch mußte das Becken für das Papiergeld stehen, denn je mehr Papiergeld gebrannt wurde, desto reicher und vornehmer wurde der Geist in der nächsten Welt, und auf dem Opfertisch standen neben den Speisen auch Räucherstäbchen und brannten scharlachrote Kerzen. Die Wahl von Scharlachrot wird durch die Furcht der Geister vor dieser Farbe begründet.
Es folgt die Ueberführung in einen Tempel, in dem der Sarg neun Mal mit Gips bestrichen, neun Mal mit teurem Lack überzogen werden muß, ehe man ihn beisetzen darf, und auch das hängt nicht vom eigenen Willen ab, sondern wird vom Zauberer an dem für den Toten glücklichsten Tage festgesetzt. Oft muß der Sarg monatelang stehen, ehe er sein Grab findet, und wenn die Kosten zu sehr anwachsen, bleibt er gar stehen, so daß er endlich, eingesponnen in Spinngewebe und Staub (eine Schande für den Toten und noch mehr für die Hinterbliebenen), in einer verborgenen Nische bleibt, wo das Sonnenlicht und die Mondstrahlen den Sarginhalt allmählich beeinflussen, bis ihm angeblich Flügel wachsen und er nachts umherstreifen kann. Leute, die an einem unglückbringenden Tage sterben, haben den Kopf nicht fertig, tragen ihn unter dem Arm und stiften allerlei Unheil.
Der Sarg selbst ist eine Sehenswürdigkeit. Erstens soll er aus gutem Catalpaholz, geräumig, trocken und bequem sein. Ein aufmerksamer Sohn schenkt seinen Eltern schon rechtzeitig einen Sarg, der im Hause wie irgend ein Möbel aufbewahrt wird und in den sich der Besitzer von Zeit zu Zeit zur Probe legt. Auch kauft man sich gern schon zu Lebzeiten das seidene Totenhemd und überwacht die Anfertigung der zehn Decken, die alle Seidenüberzüge haben müssen und in den Sarg gehören – fünf unter den Toten, mit der roten Decke obenauf, fünf darüber, mit einem Ausschnitt fürs Gesicht. Schmuck, Erinnerungsstücke, Gewänder werden oft mitgegeben, und damit die Leiche sich nicht bewegen kann, legt man mit Seide umwickelte Gipsrollen zu jeder Seite mit hinein. Mit feinstem Leim, keinem Nagel, wird der Sarg geschlossen. Ein Silberknopf, der durch das Schlagen zum Stern wird, muß von den Verwandten mit je drei Schlägen in den Sarg getrieben werden.
An bestimmten Tagen finden Empfänge statt – man verbeugt sich vor dem Toten und wird dafür von den Lebenden bewirtet; Ehrenschleifen aus Seide werden geschickt, bei jedem neuen Besuch spielt die Musik, und immer kniet der trauernde Sohn neben dem Sarge. Es wird auch Geld übergeben, um die Leichenkosten, die außerordentlich hoch sind, zu vermindern. Außer all dem schon Genannten müssen bei der feierlichen Beisetzung alle Gegenstände, die man ins nächste Land schickt, aus Papier dargestellt und verbrannt werden: ein Haus mit voller Einrichtung, ein Pferd, ein Kraftwagen, Frauen, Obst, Lieblingsspeisen, Diener und Dienerinnen, und das Verbrennen dieser schönen Gegenstände, die nur aus Papier und Bambus, aber äußerst geschmackvoll hergestellt sind, ist etwas sehr Feierliches. Es erfolgt in der Regel am Vorabend des Begräbnisses.
Die Fahnen-, Laternen-, Lampionträger und so weiter sind alles Bettler in geborgter grüner Uniform mit einer roten Feder im spitzen Hut. Der Leichenwagen ist aus herrlicher roter Seide, reich mit Gold bestickt, und unter einem Baldachin geht der von zwei Männern gestützte Sohn, weil er vor Gram allein weder den Weg noch die Kraft fände. Lamapriester in Weiß gehen voran, die Musik pfeift ihr Schrillstes, und die Töne sind wirklich angetan, den Geisterglauben zu erwecken, sie haben etwas unheimlich Nervenaufreizendes. Die Trommeln wirbeln, der Staub kreist in feinen Wolken um den Zug …

China: Leichenbegängnis
Mary.
Alle waren gut gegen mich bei Foo-lai, selbst die Gäste, die dahin kamen, und nirgends auf der ganzen Reise waren die Reichsdeutschen netter. Wenn sie nämlich nett sind, dann sind sie es in ungewöhnlichem Grade …
Aber die liebste Gestalt in Foo-lai, obschon ich Charlotte, die ich unterrichtete, und meine gütige Hausfrau, die mich ganz als zur Familie gehörig betrachtete, sehr gern hatte, ist Mary. Sie leuchtete still, wie nur echte Sachen leuchten, bescheiden, aber selbst im Dunkel erkennbar. Sie trat immer zurück, um andere vorzulassen, sie war das Gewissen des Hauses, sie rechnete abends mit dem dicken betrügerischen Koch ab (es gab ihrer viele, aber sie waren alle dick und sie betrogen alle, weshalb sie dem Küchengott Tsao Wang yi sicher Honig um die Lippen schmieren mußten, wenn er zur jährlichen Götterversammlung in den Himmel fuhr), und allmählich wurde es mir zur Gewohnheit, dabei zu sitzen und zuzuhören. Es war gut für meinen Einblick in chinesisches Tun und Handeln, und in die Sprache, und es gab mir ein Gefühl der Wichtigkeit, wenn Marys Augen die meinen trafen.
Seit ich Charlotte unterrichtete, speiste ich abends unten. Das nahm mir nicht allein das brennende Gefühl der Einsamkeit, das mich nur spät am Abend überkommt, sondern war auch gut für meinen Körper, der sich mit Brot, Tee und Pfirsichen wohl genügen ließ, dabei aber nicht an Kraft oder Rundlichkeit zunahm. Zuzeiten schickte man mir tagsüber einen Leckerbisten hinauf, doch was ich am meisten schätzte, war die mir gezeigte Liebe. Ich blühte darin auf. Die Mystik Pekings und das Leben in Foo-lai übten eine so starke Anziehungskraft auf mich aus, daß ich halb entschlossen war, den Winter dort zu verbringen. Das Erdbeben in Japan, das den schwer ersparten Yen fallen machte, und der Umstand, daß ich genötigt gewesen wäre, mich ganz auszurüsten, da der Pekinger Winter außerordentlich kalt sein sollte, bewogen mich, – aber mehr als alles das Bewußtsein, etwas unternommen zu haben, was durchgeführt werden mußte – dennoch, Anfang November abzureisen.
Gegen Mitternacht fuhren Herr, Frau und Fräulein L. nach Hause; Mary, die älteste Tochter, Tsinling, das Goldglöcklein, ein echter brauner Pekineser mit einer entzückenden Stumpfnase und meine Wenigkeit blieben zurück und kletterten auf den Zehen an den Türen der Gäste vorbei in unser Dachbodenbereich. Tsinling und ich erhielten noch einen Kuchen oder ein Festüberbleibsel, Mary legte sich ihrer Magenkrämpfe halber ins Bett, und beim Licht einer Kerze plauderten wir, wie nur zwei junge Mädchen über das Leben plaudern können, ich etwas aus der Bitterkeit meiner Reiseerfahrungen heraus.
Tsinling lag uns andächtig zu Füßen und tat von Zeit zu Zeit, als beiße ihn ein Floh, eine plebejische Gebärde, die wir sofort entmutigten.
Am Nachmittag fuhren wir wohl auch zusammen aus, jede in einer Rikscha sitzend, einen warmen Fußteppich umgeworfen, denn es war kalt. Mary spielte Klavier bei Freunden, während ich ein Schnäpslein trank (man schnäpselt gar arg im Fernen Osten!) und mich dem Kunstgenuß hingab. Oder wir besuchten zusammen den Markt und waren froh, wenn wir ohne Schmutzflecken wieder heraustraten. Wir besuchten Theatervorstellungen, und Mary ließ sich mir zu Liebe die Ohren mit chinesischer Musik vollklirren, und einmal nahm uns Herr L. in ein chinesisches Restaurant mit, wo wir alle um einen runden Tisch saßen und mit den Stäbchen etwas aus allen Schüsseln fischten, um es in unseren eigenen Napf zu werfen. Knochen flogen unter, Saft auf den Tisch. Als ich mein Befremden über diese Eßart bescheiden ausdrückte, wurde mir erklärt, daß in alten Zeiten der Gastgeber von allen Gerichten zuerst kosten mußte, um die Gäste zu überzeugen, daß nichts vergiftet war, und daher hatte sich die Sitte bis auf den heutigen Tag erhalten. Bei großen chinesischen Gastmählern verlangt die Sitte auch, daß man ausstößt, um zu beweisen, daß man genug gegessen hat. Man beginnt mit Kuchen und hört mit Suppe auf. Eigentlich ist alles sehr gut gewürzt und schmackhaft, und was man ißt, soll Ente sein. Man tut am besten, zu essen und nicht viel zu fragen, denn »wer viel fragt, der bekommt viel Antwort«, sagt das englische Sprichwort …
Was möchte ich alles noch erzählen – von den heißen Tüchern im Theater, die man um fünf Kupfermünzen bestellen kann, die einem aus der Orchesterrichtung über alle Köpfe geworfen werden und mit denen man sich Gesicht und Hände waschen soll (sie sind aus heißem Wasser gezogen); von den gezuckerten Lotosscheiben, die feilgeboten werden, den schweren Duftblumen im Haar der Chinesinnen, dem eigentümlichen Haarschmuck, der Symbolik auf der Bühne und vielen anderen Merkwürdigkeiten. Oder soll ich von der großen Mauer berichten, die sich von der Meeresküste von Shanhaikuan bis zur Grenze von Tibet erstreckt und ihre herrlichste Gestalt beim Nankonpaß, nicht allzuweit von Peking, erreicht, wo der Zug bei Ching Lung Ch'iao stehen bleibt (der hellen Drachenbrücke) und von wo aus man die Ebene von Chihli und in der Ferne die schneebedeckten Berge erblickt. Zwei Jahrhunderte vor Christi ließ ein Herrscher diese Mauer errichten, um dem verwilderten Heer, das sonst in Räuberbanden umhergeirrt wäre, wieder Arbeit und Zucht zu geben. Siebenhunderttausend Mann arbeiteten daran, und heute, nach zweitausend Jahren, merkt man kaum eine Veränderung.
Oder soll ich vom Sommerpalast schwärmen, dem riesigen Steinboot, den prachtvollen Säulengängen, den kunstvollen Bronzen vor dem Eingang? Oder vom Zauber der Edelsteinpagode und der Stille der Dörfer, durch die man geht? Oder von der verbotenen Stadt, deren einen Teil man jährlich mit besonderer Erlaubnis betreten darf und in dem ich die schöne Buddhapagode sah? Von der Chrysanthemenschau, zwar lange nicht so schön wie in Dai Nippon, meinem geliebten Japan, oder den Wundern der Kung Fu Tse-Halle, wo der große Philosoph verehrt wird?
Viel lieber möchte ich vom Aberglauben erzählen, von den Schritten der Fuchsfee, dem Gu, der das Leben ungeborener Kinder nimmt, der Geistermauer …, doch das Schönste davon ist ohnedies in meinen Pekinger Novellen festgehalten. Ich erzähle indessen nur von dem, was – auf dieser endlosen Studienreise – mein Herz stark berührt hat und wie sich das Leben der Menschen gerade mir gegenüber entrollte.
Abschied.
Es war Mitte November, und der blaue Herbsthimmel trug einen seinen Nebelschein, der sonst selten sichtbar wird, als ich zur Bahn geleitet wurde und, nachdem ich von allen Abschied genommen, nochmals in Marys gute Augen sah. Dann fuhr der Zug an den elenden braunen Lehmhütten der Dörfer vorüber und erreichte zum Schluß Tientsin, die Stadt, in der »mein kleiner Chinese«, der Held meines Erstlingswerkes, leben sollte. Aber da ich nicht sicher war, mit welcher Art Messer er mir bei einer Begegnung den Hals durchschneiden würde, gab ich mich damit zufrieden, nur das Europäerviertel zu durchstreifen, ein fragliches Vergnügen, mit dem scharfen Wind aus Sibirien um die Ohren, das noch weit fraglicher wurde, als es zu schneien begann.
Der Maru (irgend ein Maru, denn jedes japanische Boot gehört zu dieser Maruvereinigung) fuhr erst am folgenden Tage ab, und mein Mißmut über diesen Umstand, als ich frierend im Bett lag, wurde nur durch das Wettern gemildert, mit dem ein Amerikaner, der einzige andere Mitreisende, um zehn Uhr abends in Hörweite seinen Gefühlen Luft machte. Das ersparte mir, ebenfalls Lärm im Weltall zu schlagen.
Tientsin ist eine so typisch östliche Hafenstadt wie Yokohama oder Shanghai, nicht recht europäisch, nicht recht chinesisch, aber beides von der unvorteilhaftesten Seite. Ich schweige mich darüber aus. Mein Mitreisender erzählte mir am ersten Abend alle seine Liebesabenteuer (jedenfalls so viele davon, daß sie gut für ein Menschenleben genügen konnten), und ich hörte ihm andächtig (schriftstellerische Fundgrube) aber kalt mit Fischaugen, wie die der Japaner in der Elektrischen, zu, bis er davon gewissermaßen hypnotisiert war und gewiß in sein Kopfkissen schwor, daß ich entweder im Astralkörper neben ihm gesessen, der gefühllose Geist einer Ertrunkenen, oder daß ich zum kommenden Geschlecht gehörte – das sächlich sein würde und also streng genommen geschlechtlich nicht zählte.
Ganz wie erwartet folgte auf so viel erotische Poesie die Alltagsprosa und während ich die Poesie vergessen habe, ist mir die Prosa, vielleicht der häufigen Wiederholung wegen, gut in Erinnerung geblieben, denn sie bestand aus Stoßseufzern, die sich kaum änderten und die lauteten:
»Ob der Riemen, den ich um den großen Koffer geschnallt habe, halten oder reißen wird?«
Da der beweinte Koffer in Schiffstiefen ruhte und an der Sache nichts zu ändern war, schien mir die Jeremiade überflüssig. Sie würzte unsere Mahlzeiten, und ich kann zur Beruhigung der Leser mitteilen, daß der Riemen, meinem Trostspruch gemäß, wirklich gehalten hat …
Durch das Gelbe Meer.
Ein Sprichwort sagt: »Man heult, wenn man nach Peking kommt, und man schluchzt, wenn man scheidet,« und das hatte sich bewahrheitet. Während der ganzen kalten Fahrt sah ich nur Foo-lai und fühlte zum erstenmal Erbitterung darüber, daß mich etwas immer weitertrieb, gerade wenn ich Freunde, dieses höchste irdische Gut, gefunden hatte.
Gegen Mittag kroch der Maru an Takoo, der Landspitze mit ihren Schnepfen und Wildenten, den zahllosen Seemöven und den Krabben auf dem schlammigen Grund vorbei. Der Wind blies rauh aus dem schon schneeigen Norden, Segelboote bildeten ferne weiße Punkte, die Küste blieb zurück, und wir steuerten nordöstlich auf die Mandschurei zu …
Nach langer, langer Zeit fuhr ich wieder einmal in der Ersten, die als solche indessen leider einer schlechten Zweiten glich.
Vierundzwanzig Stunden später lag das vielumfochtene Port Arthur mit seinen Kriegergräbern und den grauen Felsen vor uns, über die sich die breitkronigen japanischen Föhren ausbreiteten, und von da an rollten die Hügel ebenmäßig landwärts bis Dairen, dem Haupthafen der Mandschurei, die wohl China gehört, das aber Dairen und Port Arthur an Japan abtreten mußte. Auch die mandschurische Eisenbahn ist in japanischen Händen.
Und wieder erfuhr ich, gleich nach der Landung, wie begründet meine Japanschwärmerei war. Ich hatte in einem Laden eine Kleinigkeit gekauft und mein Geldtäschchen liegen lassen, das mir ein wildfremder Junge eine ganze Straßenlänge hinterher trug. Ich hatte ein Empfehlungsschreiben an einen Bankbeamten, und dieser bestand in liebenswürdiger Weise darauf, mich ans Land zu nehmen, da der »Kohoku Maru« drei Tage lang Bohnenkuchen – diese nützliche, aber arg stinkende Düngermasse – verschiffte. Früh morgens führte er mich, als Sprachkundiger, bis zur Tür des Badezimmers, ließ mich niederknien und zeigte mir sodann, die Pforte öffnend, Schwamm, Zahnpulver, heißes Wasser und so weiter und befahl »Waschen!« Noch köstlicher war es, wenn er am Abend, ehe seine Frau die weichen seidenen Futon für mich entrollte, ebenso gebieterisch »Abort gehen!« sagte. Ich ging und fand die Strohsandalen im ersten, dem Herrenraum, zog sie des Steinbodens halber an und betrat das höher gelegene eigentliche Heiligtum und entdeckte neben der Tür wie immer das Becken zum Händewaschen und das blauweiße Handtuch. Vor der Tür standen wie immer die Schuhe, mit dem Feuer im Hibachi spielte ich, und alles, worüber ich einmal kindisch gelacht hatte, war mir nun lieb und vertraut.
Am dritten Tage verließen wir diesen Hafen der Oele (Bohnen, Erdnüsse usw.), der sehr schön und ganz modern angelegt ist und von sehr vielen Dampfern besucht wird. Schöne, weite Straßen führen zum kreisförmigen Mittelpunkt, und trotz der japanischen Geschäfte und der chinesischen Rikschas macht die Stadt einen vornehmen, europäischen Eindruck. Sie entbehrt allerdings jedweden Zaubers des Ostens, außer in kleinen Nebengäßchen.
O, dieses Gelbe Meer! Nie war mein arggeprüfter Magen daseinsmüder als vor Chifu, dem berühmten Spitzenort, wo man in jedem Hause Filet hergestellt, vor Weihaiwei, wo eine ausgezeichnete Schule für Europäerkinder ist, und vor dem einst reichsdeutschen Tsingtau, dessen Hafenanlagen noch von deutscher Tüchtigkeit zeugen. Ich lag in alle erreichbaren Decken gehüllt auf dem Bett und verwünschte die erdschaffenden Götter, die zu viele leidige Pfützen gelassen …
Nach drei Tagen (zum Glück hat alles ein Ende auf dieser gebogenen Welt) wurde das Meer schlammig und beruhigte sich. Segelboote und Dampfer umgaben uns, Ufer rückten näher; wir waren in der Yangtsebucht und passierten den Wassung. Ringsumher Schiffe aller Länder, an den Ufern niedrige Lehmhütten, zerzupfte Weiden: das ist Shanghai.
Man riet mir, keine Rikscha zu nehmen und auf die Richtung zu achten. Wer sich in Shanghai nicht gut auskannte, konnte von irgend einem Kuli leicht in ein falsches Viertel gerollt werden, und den Auskünften Fremder war keinerlei Glauben zu schenken. Ich dankte den Ratenden für die Warnung, dem lieben Herrgott für meine Füße und machte mich zu Fuß auf den Weg – eine gute halbe Stunde festen Laufens. Der »Bund«, die Hauptstraße dicht am Meer, hat hohe europäische Bauten und wirkt einladend vom Wasser her. Die auslaufenden Straßen sind im Anfang ebenfalls sehr hochbautig, voll schöner Geschäfte im Erdgeschoß, gehen indessen allmählich in kleine Chinesenhütten über. Was mich an Shanghai so sehr enttäuschte, war, daß der europäische wie der chinesische Teil wie der Aufbau einer Bühne ist, den Eindruck des Gesuchten macht und weder von unserer noch von der asiatischen Seite befriedigt.
Touristen bewundern vielleicht die Geschäfte oder die Pagode jenseits des Flusses; ich finde die französische Mission bemerkenswert, die so herrliche Meßgewänder und andere Sachen stickt, daß aus der ganzen Welt die Aufträge einlaufen. Die Waisen, die da im Kloster Aufnahme finden, wachsen in dieses Sticken, das den Chinesen liegt, hinein. Sie sticken als Kinder, als heranwachsende Leute, als Gatten und Gattinnen (denn es sticken auch Männer), und sie hören erst mit dem Sticken auf, wenn ihre Augen matt geworden sind wie regenblinde Laternen. Manche Jungen schnitzen auch die berühmten chinesischen Schränke aus wertvollen Hölzern und nach uralten Mustern. Die Kinder der Begüterten gehen ebenfalls in dieses Kloster, um die üblichen Schulgegenstände zu erlernen. Ausgesetzte Mädchen findet man gar oft in der Nähe des Klosters, besonders zur Zeit einer Hungersnot.
Es bedarf kaum der Erwähnung, daß Shanghai wie andere große Seestädte der Welt seine Opiumhöhlen, unterirdischen Tingeltangels und Lasterorte hat, wo die Seeleute der vier Weltenden sich gegenseitig ihre Erfahrungen mitteilen, aber was heute betrübt, ist die Zahl der Russinnen – achtzigtausend, wenn ich nicht irre –, die völlig nach Art der niedrigsten Chinesinnen leben, in den schrecklichsten Löchern bei Chinesen hausen, und – obschon Weiße – für jeden gelben Mann zu haben sind. Viel ist die Armut schuld, aber auch wo solchen Frauen ein anderer Erwerb geboten wird, stößt man auf Absage. Die Anwesenheit dieser Russinnen ist aber nicht nur vom sittlichen Standpunkt eine Gefahr, sondern auch vom politischen. Sie dringen mit ihren Ansichten in die niedersten, daher größten Volksschichten aufwiegelnd ein; sie setzen aber – und das ist der größte Krebsschaden – die Achtung des Asiaten für den Weißen als Weißen herab und gefährden dadurch die Zukunft der weißen Rasse im Osten, vielleicht in der Welt überhaupt.
In der glücklichen Gegend.
In Shanghai kamen Missionare an Bord ( English Presbyterian Church) und ein amerikanisches Globetrotterpaar, das sich sehr ernst nahm und die Welt mit Hilfe von Cook und Son ordentlich abschnupperte. Sie fuhren nach Siam und Birma weiter und grasten alles vorschriftsmäßig ab – sahen vom Lande genau so viel wie jemand bei einer Kinovorstellung: nichts als Bilder ohne Seele darunter.
Wir hielten uns zwei Tage lang dicht an der Küste, dann steuerte der Kapitän geradeaus auf einen Berg zu, drohte ihm den Bauch zu spalten und glitt – nicht wie der Rattenfänger von Hameln in eine Bergöffnung – nein, nur in einen breiten Fluß ein. Das war der Mingfluß.
Braune Segel von merkwürdig breiter Form, hundertmal geflickt, malerisch gebunden, kreuzten unsere Bahn. Vielsegelige, breite Dschunks, die großen Segelschiffe Chinas, rückten näher, und wir sahen die gemalten Augen vorn am Bug. Kein Schiff fährt ohne Augen in die See hinaus, und meist ist das Schiff als irgend ein Ungeheuer – Drache, Gespenst, Schlange, Skorpion oder Meerweib – dargestellt, hat das grause Haupt vorn und den stacheligen Schwanz hinten und flößt daher den Seemächten und Winden die gebührende Ehrfurcht ein. Die Berge sind hoch, die Dörfer zu Füßen langgestreckt, von Reisfeldern umgeben, auf denen der dreiviertel nackte Bauer mit seinem Schlammbüffel arbeitet. Gräber von Hufeisenform schimmern weiß aus dem Goldbraun und dem saftigen Grün. Ein langer Brautzug bewegt sich die Feldstraße entlang.
Breit wie ein See windet sich der Ming von Vorgebirge zu Vorgebirge, verschwindet, um breiter aufzutauchen, und trägt die unendliche Zahl der Segel mit warmem, väterlichen Stolz. Falken fliegen über die breitkronigen Föhren, Büffel wälzen sich im Schlamm – es ist schon der Süden, der da ruft …
Nach mehrstündiger, großartig schöner Fahrt in eine neue Welt sieht man, um eine Ecke biegend, die breite Ansicht des Sharp Peak, der wie ein Zuckerhut endet und auf dem die Foochower im Sommer Schutz vor der Hitze suchen.
Foochow (Futschau) bedeutet »glückliche Gegend«. Es liegt auf einer schwer erreichbaren Landzunge. Hier kann der große Dampfer nicht mehr weiter, und Dampfbarkassen und Sampans kämpfen um Fahrgäste. Diese Sampans sind kleine Boote mit Bambusdächern und dem Anfang eines Zimmers darunter. Hübsche Götterbilder hängen an den Wänden, irgend ein drachengemustertes Tuch bedeckt manchmal sogar eine Bank. Das ist das Wohnzimmer der Schiffer. Da essen, leben, schlafen und sterben sie. Die Küche ist hinten, mit einem Holzkohlenherd und einigen Kisten und Schüsseln. Der Hund und das jüngste Kind sind mit einer Leine versehen, damit man sie schnell aus dem Wasser ziehen kann, falls sie ins Wasser fallen. Meist rudern Männer, doch hier nahten ausschließlich Frauen. Und wie sie sich gegenseitig anschrieen, ja, sich in die Haare fuhren, wenn die eine der anderen einen Fahrgast wegschnappen wollte! Wie sie sich der Glieder der Reisenden bemächtigten und sie wie ein Stück Tuch hin- und herzerrten! Die Missionare forderten mich auf, mitzugehen, und mit Freuden sprang ich mit ihnen in die flinkere Dampfbarkasse. Eine Stunde später landeten wir auf der Nantaiinsel und von da führt die »Brücke der Zehntausend Jahre«, die zwar etwas zerlempert scheint, aber den Riesenverkehr dennoch gut aushält, nach Foochow selbst.
Wir besuchten zuerst das Hospital (der Mann mit dem fragwürdigen Riemen blieb draußen, weil er sich vor Ansteckung fürchtete) und sahen die Kranken auf einfachen Holzbänken, auf denen eine Strohmatte lag. Das ist nicht aus Armut so. Die Chinesen wollen nun einmal nicht auf weichen Betten ruhen. Es ist unglaublich, was sie an Schmerzen ertragen und wie unendlich ruhig sie Operationen aushalten. Ihre Nerven sind nicht wie die unseren, oder liegt es am Ende am starken Genuß von Opium? Ich sah Lichtbilder (also nicht Zeichnungen!) von Männern, denen die Brust aus dem Leibe gerissen wurde (Strafe für Vatermörder), und die dabei so gelassen ausschauten, als ob man ihnen einfach eine Warze entfernte.
Langwieriges Siechtum empfinden sie scheinbar am tiefsten. Durch die körperliche Hilfe gewinnt der Ausländer auch die größte Macht über sie. Dann erst fragen sie, warum er ihnen eigentlich hilft …
Später, nach sehr guter Jause, begaben wir uns auf den Rundgang, besichtigten die düsteren Tempel, auf deren Toren langnägelige Götter im Zwiegespräch standen, schlüpften durch eigenartig runde Tore, die einen Vollkreis aus Stein bildeten, lasen verwischte Inschriften aus chinesischen Weisheitsbüchern und bewunderten die verborgenen Gärtchen mit blutroten Poincettasträuchern und Kamelhufbäumen (Eugenia).
Foochow selbst ist der Traum eines Dichters des Grotesken. So enge Straßen, daß man mit ausgestreckten Armen fast die gegenseitigen Mauern berührt; Kulis mit Hüten wie ein Strohzuckerhut und dunkelfarbiger als die Nordchinesen; aus dem verdunkelnden Oberbau der Häuser spähen Mädchen mit Blumen im Haar herab; auf der Straße, mühselig humpelnd, alte Frauen auf Fußstümpfen in hübschen Pantöffelchen, vielleicht noch ein Männerherz mit diesen goldenen Lilien entzückend; Sänftenträger mit ihrer Last, Rikschas mit lautem Geklingel, rund herum der Duft des Ostens, die anziehenden Läden, die herabhängenden Anzeigeschilder, die Eßstellen mit Kochtöpfen, Näpfen und Schüsseln und der auf dem Boden kauernden Menschheit, die da mit Stäbchen die fragwürdigsten Speisen in den Mund wirft. Alles ist südlicher, nackter, fremder, farbenbunter als in Peking, stärker von Sandelduft und Weihrauch durchzogen, noch unberührter, noch altmodischer. Da sitzen Männer und reiben Lack auf kleinen Hockern, machen Schalen und Vasen; drüben feilen Silberarbeiter an entzückenden Filigrandingen; da macht man Möbel aus unbekannten, fremdriechenden Hölzern und schnitzt Götter mit unheimlichen Fratzen. Der Arzneiladen mit seinen Hunde- und Tigerknochen, Ginseng, Gelbwurz, Seegras und anderen unfehlbaren Mitteln ist voll von Menschen; in dämmeriger Bude erzählt ein Berufserzähler seine wundersamen Geistergeschichten, während quer über den Weg ein alter Mann mit einem Bartansatz (daher furchtbar ehrwürdig) jemandem die Wahrsagestäbchen wirft. Wohin man auch schaut, goldene Zeichen auf rotem Grunde, goldglitzernde Schauspielerpuppen in seidenstrotzenden Schaufenstern, Würste aus Katzenfleisch, breitgedrückte, geräucherte Enten, grellrotes Zuckerwerk in Stangenform und darüber all das Schreien!
In Foochow sieht man auch die südlichen Feldarbeiterinnen, die über die Achsel angesehen werden, weil sie körperlich so schwer arbeiten müssen, die aber eine Sonderstellung einnehmen, weil sie freier sind und zu dem Manne nicht so sehr wie zu einem heiligen Wesen aufschauen. Sie tragen das Haar nicht ganz so tief im Nacken geknotet und haben überdies sehr schöne lange Silbernadeln darin, wodurch der Knoten zur Spinne in einem breiten silbernen Netz wird.
Ein vorzügliches Abendbrot (nicht zu verachten) bei der Mission, hieraus eine stille Fahrt an schweigenden Dschunks vorüber über den breiten Ming, in dem der Mond seine Schleppe wusch, – und wieder der »Kohoku Maru«.
Die Insel der Träume.
»Formosa« – die Wunderschöne – nannten die Portugiesen die Insel, die von den Japanern heute Taiwan genannt wird. Der Sturm, der uns auf sie zutrieb, war entsetzlich. Selten habe ich Aehnliches erlebt. Der gute Maru hatte das Deck bis hoch hinaus mit schweren Baumstämmen beladen, und dennoch sah ich, da mein Fenster hinaus aufs Deck ging, wie die Meereswellen nicht nur über diesen Wall sprangen und zischend niederstürzten in die kleinsten Vertiefungen der Stämme oder des Decks, sondern wie sie auch diese vierzig Meter langen Massen zu bewegen versuchten. Mehr als einmal befürchtete ich, daß sie überhaupt durch meine Luke ins Innere stechen würden. Die Chinesen, die Nacht auf Nacht rücksichtslos Grammophone losgelassen und ihr lärmendes Mahjong gespielt hatten, lagen (alle Asiaten sind schlechte Seefahrer) regungslos in ihrer Kabine, und die Freude darüber, meine lärmmachenden Feinde so niedergefällt zu wissen, ließ mich die Seekrankheit überwinden. Immer wieder stand ich am Fensterchen und schaute in die vom Mond erhellte, perlgraue Nacht, in der die Wolkenkämme als Silberbogen hinter den Holzmassen auftauchten. Der »Kohoku Maru« stöhnte und ächzte, und keuchte wie toll vor dem Winde daher …
Doch als es tagte, zeigten sich viele zackige, dicht bewaldete Berge, und ein nie gefühltes Glücksempfinden durchzitterte mich. Hier mußte ich etwas Schönes erleben! Froh lief ich auf Deck.
Die Missionare landeten ebenfalls hier, um mit dem Zug weiter nach Tainan, der südlichen Hauptstadt zu fahren. Ich aber sollte nach Taihoku, dem Regierungssitz und eigentlichen Mittelpunkt, zum Freunde Herrn A.s, meines Schülers, der jetzt schon nach Europa gondelte. Alles was ich von dem Unbekannten wußte, war, daß er eine »Art Christ« war, wie ich es mir also auslegte, einem religiösen Wahnsinn irgend welcher Gattung unterlag. Das kümmerte mich wenig, mich, die ich der Ansicht bin, man solle alle Menschen nach ihrem eigenen Glauben selig werden lassen. Das Seligwerden war ohnedies in dieser oder einer anderen Welt eine verteufelt schwere Sache …
Auf dem Bahnsteig, der den Hafendamm entlanglief, sprach mich jemand an und sagte kurz:
»Ich bin Herr I.«
Er war so lieb gewesen und hatte mich sogar abgeholt.
Das Gepäck war schnell herbeigeschafft, aber ich kam nicht so schnell aus den Händen einer Polizei, die alles wissen wollte: »Woher? Wohin? Weshalb? Wie lange? Aus welchem Grunde? Für welche Blätter? Und warum Gast Herrn I.'s? Wie kannte ich ihn? Was wußte ich über ihn? Nichts?!!«
Erst später erfuhr ich, daß Herr I., der die Geishas befreite, sich der Formosaner annahm, Weltbeglückungspläne braute und an Straßenecken Reden hielt, die mehr weltliebend als vaterländisch kräftig waren, in den Augen der Polizei als nicht einwandfrei angesehen wurde. In glücklicher Unwissenheit gab ich die richtigen Antworten und zeigte das Empfehlungsschreiben an die Behörden in Taihoku, das mir der Gesandte Japans in Peking auf Bitten Herrn von Salzmanns gegeben hatte und das mir sehr zustatten kam.
Wir verließen Keelung gegen zehn Uhr früh und waren gegen Mittag in Taihoku. In einer Rikscha fuhr ich dem neuen Heim zu.
Im Reich der farbigen Hennen …
Das Haus war aus Stein und stand an einer Straßenkreuzung. Um den ersten Stock lief eine breite Veranda, und der Vorderteil des Baues war in europäischem Stil mit bescheidener europäischer Einrichtung, das Hinterhaus dagegen japanisch. Ich wohnte im Vorderhause, und meine Futon ruhten nachts auf einer Holzbank. Unter mir waren die Schulräume, in denen ein Lehrer »Lang, lang ist 's her« zu spielen versuchte. Hundertfünfzig arme Formosanerkinder, die sonst nirgends eine Bildung erhalten können, erhielten hier unentgeltlich Unterricht, und wer litt, der durfte kommen und in diesem Hause Rat, Hilfe und auch Zuflucht suchen. Geishas, die ihr schreckliches Leben, das sich unter einer so lächelnden, gleißenden Außenseite verbarg, aufzugeben wünschten, wurden nicht selten da versteckt, und Haussuchungen gehörten mit zur Tagesordnung. In diesem Kreis drehte ich mich, sprachlich abgeschnitten, in der eigenen Aura und erfuhr erst nach und nach, was sich um mich regte.
Blickte ich aus dem Fenster, so sah ich in chinesische Wohnungen und lernte mehr über den Osten, als wenn ich drei Jahre lang in einem erstklassigen Hotel gelebt hätte. Alles eignet sich nicht zur Wiedergabe, aber alles war menschlich und komisch und tragisch zugleich, auch die kleinen, oft kaum elfjährigen Mädchen, die schon die Straßen durchwanderten, und die schon »ausgeliehen« wurden. Nur ganz jung hatten sie Wert …
Die Säulengänge schräg gegenüber waren ebenfalls eine Quelle der Weisheit für mich. Dort ruhte sich, die Fußgänger verdrängend, öfter eine braunweiße Kuh aus; da wurde in großen Kesseln Reis oder Kaoliang gekocht, da flickte der Schuster Schuhe, die aus lauter Flicken bestanden, da wurden Kinder gewaschen und Männer von Rückenschmerzen geheilt, indem ihnen jemand auf dem Rücken herumsprang oder indem sie ein großes schwarzes Pflaster aufgeklebt erhielten, das von der Sonne beschienen werden mußte, bis es seine Pflicht tat. Es krochen Entchen aus den Eiern und wurden in flache Körbe geworfen, um unter einem Netz gefüttert zu werden, und es ging abends der Nachtwächter mit seinen »harmonischen Hölzern« durch die Straßen und verscheuchte die Diebe – angeblich. Was ich weiß, ist, daß er einem jede Stunde pünktlich den Schlaf verscheuchte …
Eins konnte ich mir nicht erklären: warum die Hühner, die bei uns daheim bescheidene Farben trugen, in Taihoku blau, violett und fleischrot waren. Endlich fragte ich Herrn I.
»Damit die Besitzer sie auseinanderkennen!«
Und ich hatte mir eingebildet, eine neue zoologische Abart entdeckt zu haben …
Vor höheren Mächten.
Am Abend hatte sich Herr I. mir gegenübergesetzt und wir hatten besprochen, was alles zu sehen war. Ich interessierte mich vorwiegend für die Kopfjäger in Kapansan und für die Märchen der Wilden. Außerdem für Textilwaren, die Teeindustrie und sonst für das Leben, Treiben und Denken des Volkes. Um die Tier- und Pflanzenwelt wollte ich mich nach Kräften selbst kümmern.
Am folgenden Tage, einem Sonntag, besuchten wir das Museum, und der Direktor zeigte mir in freundlichster Weise alle Schätze der Insel, erklärte an Hand von Karten die verschiedenen Volksstämme, besprach ihre Waffen, erläuterte ihre Sitten und empfahl mir alle die Bücher, die ich in der öffentlichen Bücherei studieren sollte. Auch gab er mir ein Stück eines Textilmusters, das noch in altmodischer Art ausgeführt und mit menschlichen Gliedern gemustert war. Wieder war ich aufgelöst vor Rührung über die Japaner.
Als wir indessen am darauffolgenden Tage im Ministerium vorsprachen und ich auf Grund meiner Empfehlung um das Vorrecht bat, die Kampferfabrik, die Staatsmonopol ist, besuchen zu dürfen, war diese Rührung nahe daran, zu erfrieren, denn wir gingen von Pontius zu Pilatus, und immer waren die Leute von geradezu herzbrechender Höflichkeit (wie ein Panzer) und von einer noch Herz- und geduldbrechenderen Fragelust.
Zum Schluß kam ich vor den Allmächtigsten von Formosa in seinem Allerheiligsten und blieb sogar mit ihm allein. Ich hatte schon an die dreißig Fragen beantwortet und sogar den Taufnamen meiner Urgroßmutter genannt und fühlte meine Geduld wie ein altes Miederband krachen, als der Mächtige, dem ich gern eine Unhöflichkeit gesagt hätte, sich feierlichst erhob und bemerkte:
»Würden Sie mir die Freude machen, unten im Gebäude einen kleinen Imbiß mit mir einzunehmen?«
Da wußte ich, wie weise es ist, auf Reisen den Mund zu halten, selbst wenn die Geduld schon im Krachen der Auflösung ist.
Herr H., der sehr viele Europäer kannte und der durchblicken ließ, daß wir eine sehr unterhaltende, weil völlig unberechenbare Rasse waren, zeigte sich von da ab als mein rettender Engel. Er fand Gefallen an dem besonderen Wahnsinn, der bei mir durchbrach, und schlug mir vor, ihn im Französischen und Deutschen weiter zu unterrichten, ein Vorschlag, den ich umso lieber annahm, als durch den Sturz des Yens mein erspartes Kapital nicht so lange auszuhalten versprach, wie ich es erhofft hatte. Auch empfahl er mir einen weiteren Schüler aus dem chemischen Laboratorium, der ebenfalls – wie alle Japaner – ein höchst angenehmer, fleißiger Schüler war. Ich sah mich also unvermittelt vor neuen Freunden, von Ehren und Geld umgeben. Sogar eine Stellung in Staatsdiensten wäre nicht unmöglich gewesen, wenn ich mich zum Bleiben entschließen würde, wozu mir Herr I., der behauptete, es wäre doch alles eins, ob jemand in meinem Zimmer schliefe oder ob es leer stünde, sehr zuredete. Der Formosahimmel hatte keine Wolke, und anstatt der gedachten vierzehn Tage (der Dampfer lief nur alle zwei Wochen von der Südspitze nach China ab) entschloß ich mich, bei so günstigen Angeboten einige Monate zu bleiben, obschon mich ein innerer Drang zum Weiterfahren anspornte.
Es war sehr schön, und ich frohlockte, aber in unschuldiger Art. Der »geschwollene Kopf« war eine überwundene Krankheit. Blind lebte ich in den Tag hinein. Wen die Götter verderben wollen, den schlagen sie ja bekanntlich zuerst mit Blindheit.
In der Kampferfabrik.
Jeden Vormittag besichtigten wir etwas anderes, Herr I. und ich. Jeden Nachmittag schrieb oder malte ich im kleinen Zimmerchen mit dem Blick auf den geheimnisvollen Säulengang. Heißer Tee stand immer auf meinem Tisch, und daß wir Europäer im Gerüche der Fleischfresser standen, ersah ich aus dem Umstand, daß ich oft schon zum Frühstück ein Schnitzel mit Krautsalat (oder das diesem Gericht japanisch Entsprechende) erhielt. Zu jener Zeit konnte ich indessen alles verdauen und ausgehungert, wie ich in der Regel war, immer essen.
Eine kleine Fliege fiel in das Freudenöl meines Taihokuseins, als mir berichtet wurde, daß man mich im weitesten Umkreis »die rote Frau« nannte. Mich mit meinem echt kastanienbraunen Wuschelkopf! Aber für die Japaner sind alle lichten Frauen rot, und rot blieb ich. Zudem trug ich ein rostbraunes Samtkleid, in Peking von einem chinesischen Schneider gemacht, von Frau L. und Mary gut geheißen und beinahe noch neu. Mein einziges warmes Kleid. Aber Rot gilt den Japanern als Kinderfarbe und ist nicht beliebt. Dennoch waren meine Gefühle wie Kienholz zersplittert, als mich Herr I., der doch ein erdferner Weltbeglücker war, Schuhe wie Boote trug und seine Kimonogürtel unter dem Kasten suchte, also gegen Frauenreize, insbesondere bei Weißen, teilnahmslos bis zum Stumpfsinn sein sollte, eines Morgens fragte:
»Haben Sie nichts … nichts Schöneres zum Anziehen?!«
Auf Honolulu war ich halbtot gequält, bei der deutschen Botschaft sanft geneckt, in Peking liebevoll ermahnt und auch mit neuen Kleidern versorgt worden, aber der echte Anstoß zu ewiger Besserung in Kleidersachen wurde mir durch den Weltbeglücker. Wenn selbst ein Apostel fragte:
»Haben Sie nichts Schöneres?«
Ich tauchte also in die Tiefen meines Koffers und schwamm mit einem blauen Waschkleid mit Knöpferln an die Oberfläche. Persönlich gefiel mir das rostbraune Samtkleid bester, und was Wärme anbetrifft, war es das Richtige für einen selbst auf Formosa kalten Dezembertag, aber der Weltbeglücker fand mich »wie eine Fee« aussehend, und für dieses Feentum bezahlte ich später mit einem Schnupfen wie ein Taifun und mit 38 Grad Fieber durch mehr als eine Woche …
Apostel mögen Schönheitsgefühl haben, praktischen Verstand haben sie so wenig wie Schriftsteller.
In diesem blauen Kleid ging ich zuerst einmal in die Kampferfabrik. Formosa ist der Herd, die Heimat, das Land des Kampfers. Japan liefert der Welt jährlich 2 000 000 Pfund, Formosa 9 000 000, China 1 000 000 (und zwar zusammen mit dem synthetischen Kampfer), so daß Formosa die führende Kampfermacht ist. Ein Flächenraum von 60 000 Morgen Landes ist mit Kampferbäumen bewachsen. Ein einziger großer Kampferbaum von 26 Fuß Umfang kann eine Destillerie jahrelang beschäftigen und gibt eine Einnahme von über 8 000 Yen (16 000 Mark).
Wahrscheinlich waren es die Kampferbäume, die Japan so sehr geneigt gemacht hatten, gerade Formosa den Chinesen um jeden Preis wegzunehmen. Aber auch auf der Insel selbst hat die Gewinnung schon eine Menge Blut gekostet, dauerte es doch sehr lange, ehe sich die wilden Tayalen damit abfanden, die Fremden in ihren Wäldern die Bäume schlagen zu lassen. Viele, viele Köpfe wurden genommen, ehe die Japaner durch zahlreiche Kleinkriege, klug eingeführte Tauschgeschäfte und endlich durch die Anlage des elektrischen Zauns um das gefährlichste Kopfjägergebiet so weit gekommen waren, sich wenigstens am Rande dieser Gebiete niederzulassen. Das Innere der Insel ist an diesem (dem Nord-) Ende noch nicht ganz erforscht.
Die Kampferfabrik, die einzige auf Formosa, liegt in Taihoku selbst, unweit des riesigen und prachtvoll erbauten Regierungsgebäudes, das ebenso gut in London oder Paris stehen könnte, und verbreitet an manchen Tagen einen weithin fühlbaren, doch mir nicht unangenehmen Geruch.
Der Direktor führte uns selbst. Die Formosaner erhalten einen Yen zwanzig täglich, die leitenden Japaner natürlich weit mehr. Hier sei hinzugefügt, daß unter Formosanern Chinesen zu verstehen sind, die schon Jahrhunderte lang auf Formosa ansässig und die sich – in vereinzelten Fällen – mit den sanfteren der Eingeborenen verehelicht haben. Sie sind Südchinesen und von dunklerer Gesichtsfarbe als die Leute des Nordens, auch nicht ganz so wasserscheu und ebenso arbeitsfreudig und entbehrungsgewöhnt.
Wunderschön ist es, in den großen Eisenkammern den aufgestapelten Staubkampfer zu sehen. Er schneit von der Decke herab, er liegt in sich türmenden Haufen auf dem Boden, und der Geruch ist so stark, daß er betäubt und Kopfschmerzen erzeugt. Frauen werden nicht angestellt, weil die Kampferherstellung Frauen unfruchtbar machen soll, und die Männer müssen sich erst eine Weile lang einarbeiten, ehe sie ohne Kopfschmerzen ihren Pflichten nachzugehen vermögen. Wenn man das bedenkt, ist die Bezahlung allerdings sehr gering.
Das Oel wird in den üblichen Blechbüchsen, der Kampfer in mit Blech ausgeschlagenen Kisten verschifft. Der Direktor schenkte mir ein Päckchen echten Formosakampfers in Würfeln und ein Fläschchen Kampferparfüm. Der Rundgang hatte über eine Stunde gedauert.
Bei den Kopfjägern.
Ein Herr des Ministeriums und Herr I. begleiteten mich in das vielbesprochene Kopfjägergebiet. Es gibt auf der Insel neun verschiedene Stämme, von denen die Tayalen, die achtzigtausend Seelen umfassen sollen, die gefährlichsten sind. In früheren Jahren nahmen sie über tausend Formosanerköpfe jährlich, doch die Japaner schafften das ab – Köpfe sind dort wertvoller – und heute sind die Ausfälle selten. Auch darf das Kopfjägergebiet nur mit polizeilicher Bewachung betreten werden, und diese zu erhalten, ist nicht leicht.
Im Wagen mir gegenüber saß ein buddhistischer Priester, ein goldgesticktes Seidenviereck auf der Brust, er selbst dick und selbstzufrieden. Die übrigen Reisenden waren echte Formosaner mit Palmenstrohhüten und Körben. Draußen zog die Ebene hinter Taihoku vorüber mit den Sträuchern der Teeduftblüten – Jasmin, Ylangylang – und auch einzelne Teestauden. In Toyen verließen wir den Zug und bestiegen den Schiebwagen, ein breites viereckiges Brett auf Rädern, mit einer Kiste oder zwei als Sitzen, und in manchen Fällen selbst mit einem Segel. Unser Wagen hatte kein helfendes Segel. Der Formosaner mit seinem zuckerhutartigen Dach und seinem Anflug von Hose sprang rückwärts auf, nachdem er den Wagen durch schnelles Laufen und Schieben erst gut ins Rollen gebracht hatte. Die Felder lagen schon brach, und vereinzelte Krähen flogen darüber hin. Die Hügel schoben sich neugierig heran, verschlangen uns allmählich, zogen uns hinauf auf die Kämme. Hier standen Liebesbäume, so genannt, weil die Blätter in Paaren an den Zweigen saßen. Es waren eine Art Weiden mit krummem Stamm. Später, in den warmen Einschnitten, trafen wir Teesammlerinnen mit weißem Tuch in Hutform und mit flaschenartigen Körben am Arm, und endlich kreuzten wir eine Brücke, deren Pfeiler aus Bambus, viereckig aufgestellt, und mit Kieselsteinen gefüllt waren.
Wir speisten zu Mittag im Klubhaus von Taikoi, wo wir sehr gut bewirtet wurden und von wo aus wir das Gebiet des Tamsinflusses mit den Bewässerungskanälen der Reisfelder, die darauf befindlichen Wasserbüffel und die halbnackten Bauern überschauten. Bald nach Taikoi aber verschlang uns der Busch mit seinen Kampferbäumen, wilden Bananen, unbekannten Blumen und, an freien Stellen, dem Suzukigras, dessen lange Halme sich eigentümlich bewegten und dessen lange, weißliche, fedrige Samenhülse an einen Geisterwedel erinnerte. Hinter solchem Gras verborgen, oft drei Tage lang regungslos ausgestreckt, lauern die Tayalen, bis ein Opfer vorübergeht. Dann schießen sie erst einen Pfeil darauf ab, stürzen dann auf den Getroffenen zu und schneiden das Haupt ab, den Körper zurücklassend. Es kann nämlich kein Jüngling heiraten, der nicht wenigstens einen Kopf heimgebracht hat, denn das ist das Zeichen seiner Reife, ebenso gut wie kein Mädchen Gattin wird, bevor sie nicht das seltsame Tätowierungszeichen erhalten hat. Es reicht vom Ohr zum Mund und wieder zurück in zwei großen, breiten, blauschwarzen Streifen.
Es gibt mehr als zweihundert Arten von Giftschlangen auf Formosa, und so oft der Wagen eine große Heuschrecke, einen der großen blauen Falter oder sonst etwas Lebendes aufschreckte, glaubte ich schon, eine Schlange zu treffen. Der Wagen selbst gab zu denken; denn er sauste in tollster Fahrt die Zickzackwege hinab, um noch etwas Schwung zur Hinauffahrt zu behalten, und jede Wegkrümmung zeigte ein neues Bild, denn wir fuhren hinter den Hügeln in immer weitere Hügelketten hinein und stiegen allmählich zu den echten Bergen auf. Sentansträucher mit gelben Beeren begrenzten den Pfad, von mächtigen Urwaldbäumen oder von den langblättrigen Bananen unterbrochen. So erreichten wir die Warnungstafel: »Gefahr!«
Wir fuhren nun im Kopfjägergebiet, und mir war 's, als verstummten meine Gefährten mehr und mehr …
In der Ferne brannten Teile der Abhänge. Der Rauch wälzte sich als Lindwurm der Straße entgegen. So bearbeiteten die Wilden ihre Felder. Einige Frauen, klein, braun, mit runden Augen, standen in einem Hanffeld. Wir erreichten eine Kampferdestillerie einfachster Art und stiegen aus. In einem Ofen wie bei unseren Köhlern wurde das klein zerschnittene Kampferholz ausgekocht. Der heiße Saft floß durch Rohre, die im Wasser lagen, um schnell auszukühlen, und das Oel tropfte in die Behälter, die zum Verschicken gewählt waren. Der rohe Kampfer sank auf den Boden der Rohre und wurde ebenfalls herausgenommen und in Behälter getan. In Taihoku wurde erst alles verarbeitet.
Höher und höher, weiter und weiter, von Bild zu Bild. Früh am Nachmittag erreichten wir das Polizeidorf von Kapansan. Es gibt dort keine Frauen. Auch keinerlei Zivilpersonen. In den dreißig Häuschen, zu denen die geräumige Schule gehört, in der ebenfalls ein Schutzmann jene Tayalkinder unterrichtet, die zu kommen und bei ihm zu wohnen wünschen, leben nur Japaner, die als Wache hier an der schlimmsten Grenze der Kopfjägergebiete stehen. Sie kochen, waschen, flicken, putzen selbst, und wir schliefen alle auf den Matten im Hause des Polizeiinspektors, die Herren im ersten, ich, hinter Schiebetüren, im zweiten Raum. Nie überkam mich aber das leiseste Gefühl der Unsicherheit. Ein sehr unangenehmes Abenteuer, das ich mir nicht in allen Ländern wünschen würde, hatte ich vor dem Schlafengehen. Wie immer pilgerten wir alle der Reihe nach ins Bad. Das Badezimmer hatte Licht und war sehr sauber, die Wanne, weil für so viel Gerechtigkeit bestimmt, auffallend groß. Ich entkleidete mich, legte die Sachen auf ein Bänkchen, kletterte die paar Stufen empor und verschwand nach mehreren »Aii« und »Auuu« im heißen Wasser. War es die Erschütterung durch einen Vorübergehenden oder war die Schiebetür nicht richtig eingefügt gewesen – kurz, kaum saß ich in der Wanne, als die Tür mit einem Krach umfiel. So oft ich indessen herausspringen wollte, um sie zurückzustellen, vernahm ich Schritte und hüpfte ins Wasser zurück. Was sollte ich tun? Ich mußte um Hilfe rufen und – den Kopf in einer Dampfwolke – höflich ersuchen, die Tür wieder einzuschieben. Niemand fand etwas dabei, und ich trachtete auszusehen, als ob ich täglich ohne Kleider solch einem Vorgang beiwohnte. Von da ab unterzog ich indessen die Schiebetüren immer einer Untersuchung, ehe ich ins Bad stieg.
Auf meine Bitte stiegen wir den ganzen hohen Berg in das Tal hinab, bis wir eine jener unheimlichen Hängebrücken aus Rattanranken erreichten, die wie eine Schaukel den Fluß über spannen. Zwei schmale Bretter bildeten alles, woraus man festen Fuß faßte, und zum Anhalten gab es in höchster Fingerhöhe ein Seil, das natürlich nachgab. Man schaukelte wie eine Seiltänzerin über die Brücke, und je mehr Leute gingen, desto verzweifelter schaukelte die Brücke. Um mich zu entmutigen, verbeugte sich der Inspektor und ließ mich vorangehen, in der Erwartung, mich heulend Kehrt machen zu sehen, doch ich dachte mir damals nichts dabei oder höchstens, daß man eben da gehen müsse und ich folglich gehen würde.
Nie in meinem Leben hat mich das Gefühl bemeistert, irgendwo ganz fern von der Welt zu sein, wie hier in diesem Ort, dem »Zusammenlauf der Flüsse«. Die runddachigen Häuschen, die grellgrünen Bananen, der grüne, rauschende Fluß, die hohen, hohen Berge, die alle Aussicht verhinderten, die Sonne auf den fernsten Abhängen, die goldene Stille … da sehnte ich mich, bei den Kopfjägern zu bleiben und die Welt, die voll Tücke und Schriftleitungen war, ganz zu vergessen. Ohne Ehrgeiz zu leben, ohne Zweck, nur in sich und die allernächste Welt versunken.
Aber die Japaner, die ihren Kopf behalten wollten und sich nach der unruhigen Welt zurücksehnten, trieben mich bald aus dem Paradies wieder fort, so gern ich die Tayalfrauen mit ihrem schwarzen Gesicht, dem stechenden Blick und den steifen Hanfgewändern noch betrachtet hätte. Der Berg vor mir schien zu wachsen, und je länger wir kletterten, je eifriger die Schutzleute im Anspornen wurden, desto höher erschien er mir. Unter den Füßen wuchs er ins Stahlblau des Abendhimmels.
»Wenn es dunkel wird, ehe wir die Höhe erreichen, können die Kopfjäger kommen! Bei Tage wagen sie nichts, doch nachts …«
So biß ich wieder ins Knie, und endlich standen wir auf der kleinen Hochebene und blickten auf das Schwarz der Wälder zurück, durch das sich tief unten, wie ein mattes Silberband, der Fluß schlängelte …
Die Freuden der Wilden.
Früh, früh kroch ich aus den weichen, warmen Futons und ging ins Freie. Der Platz war sonnegefegt, und zwei Männer näherten sich mir. Sie waren in ein Tuch wie in einen Poncho gehüllt und hatten das lange Haar zu einem Zopf geflochten. Mitten auf dem Kopf saß ein Geflecht, das, wie ich später merkte, allen Zwecken diente: als Hut, als Trinkbecher, als Speisenbehälter, als Getreidemaß und als Läusenest. Die Augen waren sanft und schwermütig. Nie hätte man darin die Lust nach Köpfen geahnt.
Unten, in dem kleinen Tauschladen, saßen ihrer viele, alle bezopft, sanft und still. Sie brachten Tsuso, die schöne Staude, aus der man das bei uns als Reispapier bekannte Material mit krummem, runden Messer schnitt, ein herrliches, seidig schimmerndes Papier, das die Chinesen mit kleinen Figuren bemalten. Die Staude erreicht eine Höhe von fünf Metern und einen Armumfang an Dicke im besten Fall ( Aralia papyrifera). Sie brachten auch das ungewöhnlich zähe Hanftuch und einige Früchte der Höhen und verlangten dafür Tabak, Reis, Zündhölzchen. Leere Flaschen schienen ihnen so wertvoll wie Gold.
Ihre Hütten sind sehr einfach, fast ohne Einrichtung, mit dem Herd in der Mitte und einigen Brettern als Lagerstätte. Die Toten werden in den vier Ecken des Hauses begraben, und wenn alle Ecken voll sind, gilt das Haus als unglückbringend, und man baut ein neues. Junge Leute, die ihre Flitterwochen ungesehen verbringen wollen, ziehen sich in die Luft zurück, das heißt, sie wohnen in einem Bau zwanzig Fuß über dem Erdboden.
Sehr feierlich wird ein Kopf aufgenommen. Die schönsten Jünglinge halten die Ehrenwache um das Geisterhäuschen und singen und tanzen zur Ehre des hohen Gastes. Nach einer Woche wird ein Fest abgehalten, Gäste kommen von weit und breit, man gießt dem Kopf Hirsebier zwischen die Lippen, man bedankt sich für die Ehre, man bittet den Geist, doch auch die Freunde heranzulocken, und man bewahrt den Kopf später in dem Geisterhäuschen auf, oder mauert ihn, wie bei den Bunum, in das Gestein des Hauses, aber immer dem Nahenden erkenntlich. Ich hatte schon Lust, meinen Kopf dazulassen, denn wer würde sonst irgendwo solche Geschichten mit ihm machen? Aber der Gesandte Polens, der eben am Morgen nach Kapansan gekommen war, wollte seinen Kopf lieber hinabtragen, und die Japaner, die sich für den meinen verantwortlich hielten, waren ebenfalls dieser prosaischen Meinung, und so wurde ich nach dem Mittagsmahl samt Kopf auf die Kiste des Schiebwagerls gehoben und schschsch! ging es talwärts durch die unvergeßlichen Kampferhaine. Ein Hauch von Herbst und von Sterben, wehmütig schön in dem goldenen Dezemberlicht, lag selbst über dieser Tropenlandschaft, und im hohen Suzukigras raunte warnend der Wind …
In den Teehäusern.
Die größte Teefirma ist die Mitsui Company. Händler kommen aus allen Weltteilen, vorwiegend aus den Vereinigten Staaten, angefahren, um die jährliche Teeprobe zu nehmen und bedeutende Bestellungen zu machen. Ein großer Teil von Daito-tei, dem echten Formosanerviertel, in dem auch ich lebte, gehört den Teegesellschaften, und eines Morgens führte Herr J. mich ebenfalls durch diese Hallen, in denen viele Frauen und Kinder mit dem Durchduften des Tees und mit dem Packen beschäftigt waren. Sie arbeiteten da etwa zwölf Stunden täglich und erhielten dafür zwanzig Sen.
Die beste Teeart ist der Oclong-Tee. Man erzählt sich, daß ein Farmer aus Fukhien in Südchina eines Morgens auf den Berg Bui stieg und eine schwarze Schlange um eine Teestaude gewunden fand. Er nahm einige dieser Blätter mit nach Hause und fand den Geschmack vortrefflich.
Oclong bedeutet »Drache« oder »Schlange, so schwarz wie eine Krähe«. Mit dem Ceylontee hält er den amerikanischen Markt. Der beste Oclongtee kostet in Formosa 2 Yen das Pfund. Die Chinesen ziehen jedoch die durchdufteten Teearten vor, und daher nimmt man die frischen Blüten des Tropenjasmins und einer anderen gelbweißen Blume, die wie Tuberose riecht, und mischte sie unter den fertigen Tee, trocknet alles vorsichtig über dem Hibachi, dem Wärmebecken, und packt es als » Wrapper Tea« das Pfund von 8O Sen bis zu einem Yen.
Der beste Blütentee heißt Hoshi cha oder Po shien cha.
Es war wunderschön, unter den dämmerigen Säulenbogen zu gehen und den Duft all dieser Räume einzuatmen; ich sah nicht nur all das Teetreiben, sondern tausend Sachen, die mich begeisterten: ein Opferschwein vor einem kleinen Altar, die Eingeweide und das Herz in verschiedenen Gefäßen, und in der Schnauze eine goldgelbe Orange! Ich ertappte einen Mann dabei, wie er einen falschen Zahn mit der großen Zehe aufklaubte und sich in die Hand fallen ließ; in einem Seitentempelchen, vom fahlen Licht der roten Kerze beleuchtet, warfen Chinesinnen das Orakelhorn, zwei Holzhörnchen mit einer gebauchten und einer flachen Seite. Fielen die Hörnchen beide richtig, so war der Wunsch erhört; lag eins richtig, das andere nicht, so schwankte der Gott, und im breiten, gähnenden Opferofen mußte mehr Papiergeld gebrannt werden. Wenn beide Hörnchen unrichtig lagen, waren und blieben die Götter stumm. Auf einem nahen Felde (die Häuserreihen teilten sich unvermittelt zu Feldern und schlossen sich wieder) sah ich einen kleinen Wasserbüffel, noch ganz rosa und unbeholfen, und hinter einem Strohvorhang aß ein kleines Mädchen Bohnennudeln mit so viel Geschick und Anmut wie ein Neapolitaner seine Maccaroni.
Der Abgrund.
Am liebsten durchwanderte ich vor den Stunden bei Herrn H., dem Allmächtigen der Insel, die stets sehr angenehm waren, den botanischen Garten und skizzierte die reiche einheimische Pflanzenwelt; oder ich besah mir die Textilsachen im Museum, oder ich durchbummelte, nach dem Morgenstudiengang, die Straßen der Stadt, weil man da immer wieder etwas sah, wovon man lernte. In den Geschäften sah man das Leben der Leute, die darin aßen, nähten, sprachen, lasen, sangen und selbst starben; unter den Bogen opferte man den Göttern, erzeugte man allerlei schöne und nützliche Sachen, lagen Kuchen und andere Dinge zur Schau. Einmal gab es eine Anbetung vor dem Schweinegottaltar – eigentlich der Göttin, die so gern Schweine in Empfang nimmt – einmal ging ein Trauerzug vorüber, und einmal hatte der Lieblingsgott Ausgang. Fahnen mit Bildern und Stickereien kostbarster Art wurden ihm vorausgetragen. Drachen, Phönixe, Götter, Dämonen mit flatternden Bärten und mit Seidenleibern zogen an mir vorüber. Die Musikanten rührten die Trommeln, wimmerten in Flöten, schlugen Schellen gegeneinander, und Männer in Göttergewändern und mit schauriger Maske tanzten voraus, während ihr Haar, aus gelben Papierstreifen bestehend, wie ein Drache durch die Luft wirbelte.
Nach Tisch schrieb und malte ich, von vier bis sechs unterrichtete ich, morgens machte ich Entdeckungsreisen mit Herrn I. und abends allein. Früher hatte ich bis zehn Uhr nachts durchgearbeitet, doch in letzter Zeit kam Herr I. und erzählte mir von dem Aberglauben der Tayalen, unter denen er jahrelang gelebt hatte, von ihren Märchen und Sagen, und ich schrieb nieder, was er erzählte. Manchmal verbesserte ich sein Englisch. Mit seiner greisen Mutter, vor der mir ein wenig graute, und seiner kalten, förmlichen Schwester konnte ich nur die mir eingeleierten Höflichkeitsreden wechseln. Bei ihnen fühlte ich, trotz sehr aufmerksamer Bedienung, ein entschiedenes Rassenvorurteil gegen mich.
Ich bin eine Gans. Es tut mir leid, das sagen zu müssen und mehr leid, es nicht wenigstens in der Mitvergangenheit ausdrücken zu dürfen, aber ich wage es nicht. Man kann in manchen Sachen nicht nur eine Gans sein, sondern sie leider auch bleiben.
Aber ich bilde mir ein, psychisch zu sein, also Seelenwellen zu verspüren. Als ich wieder einmal am mächtigen roten Tor vorbei aus dem japanischen ins formosanische Viertel einbog, das voll Romantik und voll Gefahren war, überkam mich das Gefühl einer nahenden Qual so sehr, daß ich zu den Göttern aufwinselte und ein echter Kummer mich befiel, daß ich das letzte Schiff, das an dem Tage gefahren war, nicht genommen hatte. Und dennoch war alles so unbedingt sonnig: Ich verdiente, ich hatte allerlei ehrende Aussichten, ich lernte, und Formosa war ein Märchenland.
Aber ach – in Märchenländern laufen bekanntlich die Hexen um, und man stößt auf Märchenprinzen …
Ich bin eine Gans, und natürlich stolperte ich über den Märchenprinzen in einem Lande, in dem es nur Schiebetüren gibt.
Die Flucht.
Das war noch einmal Peru, aber irgendwie aus dem Baß ins hohe Moll übertragen. Immerhin so nervenaufreizend, daß ich nach achtundvierzig Stunden Wachen zur Ueberzeugung gelangte, daß meine Gefühlsstränge nicht mitkonnten und auch nicht dagegen, wenn es so weiterginge. Ich bat eine Deutsche, die mit einem Japaner verheiratet war, zu ihr kommen zu dürfen. Was ich bei ihr gelitten habe, spottet jeder Beschreibung. Ins Hotel konnte ich nicht, weil ein Hotel in diesem Fall, unter solchen Umständen, keine Gewähr des Schutzes vor anderen oder mir selbst geboten hätte. Ich erinnerte mich an den Missionar in Taiwan. Er lud mich ein, zu ihm zu kommen.
Dies ist nicht die Geschichte meiner Herzensangelegenheiten, aber wenn man damit dem Gouverneur einer fremden Rasse auf fremder Insel lästig fallen muß, ist die Geschichte eine Tragikomödie. In der Erinnerung jedenfalls. Damals weinte ich Eimer voll Tränen, eben weil die Japaner selbst in der höchsten Leidenschaft Selbstbeherrschung bewahren und gerade diese Eigenschaft mir die größte Bewunderung abzwingt.
Wir weißen Frauen aber dürfen nicht die Rasse verraten. Es geht nicht! Es ist ein Verbrechen an uns und an den anderen. Es führt auch nie, nie zum Glück. Ich mußte alles lassen und fliehen. Sämtliche Schüler schenkten mir, der wandelnden Niobe, Taschentücher zum Abschied, große leinene! Herr I. erkrankte. Trotzdem brachte er mich zum Zug.
Ich mußte, was immer die Zukunft barg – Fernsicht gewinnen. Unter Europäern leben und hierauf endlich die Entscheidung fällen. Und er auch. In sieben Monaten vergaß ein Mann zehn Frauen, nicht nur eine. Das war mein Trost.
Und wieder fuhr ich weiter in die unbekannte Welt hinein – einsam, mit abnehmenden Mitteln, vom Fluch meines Geschlechtes begleitet.
Wie unendlich leicht reist dagegen ein Mann!
Im Schatten der Tempel.
Die Waggons waren lang, mit Doppelsitzern wie in den Vereinigten Staaten. Man brachte den Reisenden Pantoffel, damit sie imstande waren, die westlichen Lederschuhe auszuziehen und die Füße nach Belieben unter die Schinken zu stecken. Draußen sah man nichts als Reisfelder, Zuckerpflanzungen, später Bambus und Tee mit zurückweichenden Bergen. Ein junges Mädchen saß auf einem Handwärmebecken. Auf einsamer Landstraße plötzlich eine Sänfte. Fremde Grasarten, wohl zur Tatamiherstellung, bedeckten lange Strecken. Dann wieder ein Tempel unweit einer Ortschaft. Dumpf besah ich mir all das. Es hätte mir mehr behagt, in mich selbst zu schauen, wo das Leben als solches seine unerwarteten Furchen zog, aber meine Pflicht hielt mein Auge an das rollende Bild gefesselt. Dazu war ich gefahren; deshalb litt ich. Das, was ich an klarer Weisheit dazu erwerben mußte, war die traurige Draufgabe der Götter, der sich auch jene nicht immer entzogen, die daheim bleiben und Strudel backen durften.
In Augenblicken großer seelischer Erschütterungen habe ich immer diejenigen meiner Landsleute beneidet, die in weiblichen Tugenden leuchteten und nur die Geheimnisse der Kochkunst, nicht jene des Weltalls zu ergründen trachteten.
In Tainan waren die Missionare rührend nett gegen mich. Ich speiste bei den Damen und wohnte im allgemeinen Missionshaus, das die Leute des Ortes das »Haus des Morgenniesens« nannten, wahrscheinlich, weil die vom Garten herkommende, kaltnasse Luft dem, der zu früh auf die offene Veranda trat, das Niesen gab.
Die Tempel von Tainan sind älter als die von Taihoku, denn Tainan war früher die Landeshauptstadt; ihr Gepräge ist rein chinesisch, und es fehlt nicht an Steindrachen, Wolken- und Windsinnbildern und kleinen, nur von brennenden Weihrauchstäbchen erhellten Schreinen, in denen einer Göttin, die gut im Fruchtbarwerdenlassen ist, Opfer gebracht werden. Was wünscht eine Chinesin mehr als Edelsteine, um sie ihrem Gatten demütig zu Füßen legen zu können? Das gibt ihr Macht über alle Nebenfrauen oder – wenn sie fruchtbarer als die Hauptfrau ist – Macht selbst über die.
Von hier geht es hinauf in die Berge zu den Ami, die auf den Klippen hausen, die, ungemein steil und hoch, jäh ins Meer abfallen, zu den Bunum, deren Häuser alle Schieferdächer tragen und den Tsuou. Doch weiß ich nicht genau, welcher dieser drei Stämme es gewesen ist, der einmal zur Mission herabkam (in der guten alten Zeit, ehe die Japaner sich ansiedelten und gegen Menschenfresserei und Kopfjägertum etwas einzuwenden hatten) und vom Missionar, der die armen Heiden gern gewonnen hätte, bewirtet wurde. Von allem war das fette Schwein der Glanzpunkt des Anfreundungsfestes und der begeisterte Häuptling lud den Missionar mit einigen englischen Herren ein, auch bei ihm oben in den Bergen ein Friedensmahl einzunehmen. Die Herren gingen, und der ganze Stamm war versammelt. Der Duft bratender Bananen erfüllte die Luft, und die Blätter, die als Teller dienen sollten, bildeten einladende und vielversprechende Haufen. Der Häuptling lobte das unvergeßliche Schwein, und der Missionar sah zum Hüttenfenster hinaus, wo der Sohn des Häuptlings, ein dicker, etwa zwölfjähriger Junge, herumlief. So stramm waren die jungen Beine und so gelenk die Bewegungen, daß der Missionar sich umwandte und zum Häuptling sagte:
»Was für ein schönes, kräftiges Kind!«
Der Häuptling sagte etwas zu einem der Anwesenden, der die Hütte verließ, und der entsetzte Missionar wurde eine Minute später Zeuge eines Mordes. Der große Krieger schwang seine Keule, und der Kleine brach mitten im Spiel röchelnd zusammen.
»Himmel – – man mordet – –!«
»Laß nur,« bemerkte der Häuptling kaltblütig, »du sollst nicht sagen können, daß wir Bunum zurückstehen in unserer Gastlichkeit. In kurzer Zeit wird er gebraten sein und nicht weniger knusprig schmecken als dein Schwein!«
Man sagt, daß die fünf Herren, der Missionar voran, den Berg hinuntersausten und nicht innehielten, als bis sie wieder in Taman waren. Lange Zeit hindurch aber feierte man keine Friedensfeste mehr, weder mit, noch ohne Schwein …
Nur bei den Yami auf Botel Tobago, der letzten Insel hinter Formosa, die schon mit den Philippinos Verwandtschaft verraten, hat es nie Menschenfresser gegeben. Sie wohnen in Häusern, die sie unter der Erdbodenhöhe anlegen und in denen sie sich verkriechen.
Auf Seeräuberwassern …
In Takoe schiffte ich mich ein. Der »Soshiu Maru«, ein alter Seeklepper, der schon längst den Stall verdient hätte, fuhr nachmittags aus und kam abends zurück, denn es pfiff draußen auf dem Meere, und der Klepper hatte keine Seebeine. So hatte ich eine sechsstündige Gratisfahrt. Um sechs Uhr früh machte er sich nochmals auf den Weg und legte nach einigem Keuchen die hundertachtzig Seemeilen bis Amoy zurück. Das ist das allergefürchtetste Piratenloch der ganzen Küste. Man merkt das auch den dort verkehrenden Schiffen an. Die Kabinen (hier fuhr ich immer Erster, denn eine andere Klasse kommt für Europäer nicht in Frage) haben alle sehr vergitterte Fenster, und der Boy brachte mir vor Amoy einen Schlüssel, den ich zuerst für den Sankt Peters vom Himmelstor hielt, der sich indessen nur als mein Kabinenschlüssel entpuppte, und sagte:
»Kann tun!«
Diese kryptische Bemerkung wollte indessen nur bedeuten, daß ich besser daran täte, mich mit diesem Schlüssel in die Kabine einzusperren. Was wußte der Arme von dem traurigen Los reisender Journalisten! Ich »kann tun« von draußen und besah mir von Deck aus das Seeräuberloch. Es lag über niedere Hügel ausgestreckt recht malerisch da, und man konnte gut begreifen, daß die Höhlen in den Klippen, die Verzweigungen der Bucht und die Steile der anklimmenden Stadt eine gute Schule sein würden.
Als sich ein Kuli mit einem Boot zeigte und wir eine Viertelstunde lang über den Preis verhandelt hatten, – das stärkt das gegenseitige Vertrauen – kletterte ich in sein Sampan hinab und ließ mich ans Land rudern. Was lernt man denn über Amoy vom Wasser aus?
Sehr viel lernt man leider auch am Lande nicht. Ich bin so klein, und meine Feinde behaupten, ich hätte etwas so Asiatisches im Aussehen (unbestimmbare Häßlichkeit wollen sie wohl ausdrücken), daß ich eigentlich nie wie die meisten Europäer auffalle. Ich gehe auch immer durch die Straßen, als ob ich in ihnen groß geworden sei und daher war ich nie einem Anfall ausgesetzt, noch wurde ich übermäßig angestarrt. Mit zusammengekniffenen Augen eile ich durch das enge Winkelwerk und sehe doch alles. In Amoy sah ich vorwiegend Hunde: viele, hungrige, räudige. Die Hunde schienen mir noch schmutziger als die Menschen, und das war wirklich schwer zu erkennen. Die ganze Stadt stank nach einer Prachtauflage von Cholera, aber der Zauber war nicht ganz abzuleugnen. Diese engen Straßen, die ohne Plan da hinauf-, dort hinabklettern, die roten Sänften, die Seidenläden, die Wachsgeschäfte, die trockenen Fische, die Wurstläden, die Frauen mit ihren unergründlichen Zügen, weder Kummer noch Freude ausdrückend, und nur in den kreischenden Stimmen eine scheinbar ärgerliche Erregung verratend; die Kunstblumen, die Catalpasärge, die schon wartend auf der Straße stehen …
Die Hauptindustrie (außer nicht gestatteter Seeräuberei) ist die Entenzucht. Die Entlein werden in großen Mengen in Brutofen angebrütet, am 26. Tage getötet, ausgestopft und nach Osaka geschickt, von wo aus sie als japanisches Spielzeug auf den amerikanischen Markt gelangen.
Nach einer Weile konnte ich den Anblick der räudigen Hunde, denen das Blut an den hautlosen Gliedern niederrann und die jeder Händler mit Stockhieben verscheuchte, nicht mehr ertragen und begab mich über das schlüpfrig nasse Pflaster hafenwärts. In einem Fleischergeschäfte hingen neben geräucherten, flachgeschlagenen Enten auch geräucherte Frösche, poetisch umschrieben »Erdhasen« genannt, und Litschinüsse, Drachenaugen, Dattelpflaumen und Pomelos deckten die Tische der Obstbuden.
Die wenigen Europäer, die ein unfreundliches Geschick nach Amoy verbannt hat, leben auf einer anderen Insel in ganz netten Häuschen.
Da man fürchtete, es könnten uns die Seeräuber angreifen, und da man nie weiß, ob die harmlos scheinenden Fahrgäste der Dritten nicht plötzlich in Seeräuber verwandelt auf das Oberdeck stürzten könnten, wird ein regelrecht starkes Gittertor vor dem Aufgang in die Erste geschlossen, die Wache steht vor diesem Tor, und der Kapitän hält scharf Ausschau. Alle Japaner sind bewaffnet, die Kabinenfenster müssen geschlossen bleiben, und so schloß und schraubte auch ich mich in mein kleines Reich ein und schlief den Schlaf des Gerechten …
Aber gar so ruhig war er nicht. Mein Formosaaufenthalt hatte zuletzt allzu sehr einem Hürdenlaufen geglichen. Ich wischte mir also Augen und Nase in die schönen Taschentücher, die mir meine japanischen Schüler in freundlicher Anerkennung geschenkt hatten. Und der Gouverneur war um ein Beispiel westlichen Irrsinns reicher geworden, was gar nicht in meiner Absicht gelegen hatte.
Dennoch sage ich: Zwischen Südamerika und Japan liegt die ganze ungeheure Tonleiter einer aussteigenden Kultur. So war es also einem Japaner gegeben, mir den Glauben an das Beste im Manne zurückzugeben. Ich dachte an das Sprichwort in meinem Kinderlesebuch:
»Sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg,
Sich selbst besiegen ist der schönste Sieg.«
Muß ein Mann wirklich erst Apostel sein, bevor er dieses Kunststück zusammenbringt?!
In Swatow kaufte ich mir ein Paar Niederschuhe. An und für sich wäre das nicht etwas, das nur auf Reisen geschehen kann, doch erwähne ich es, weil es auf Formosa so gut wie unmöglich gewesen wäre. Schon in Tokio war es ein Kunststück, in Taihoku aber, wo alle, alle, die europäische Schuhe trugen, der Ansicht waren, daß man aus den Schuhen, ohne sie aufzuschnüren, auch herausfahren muß, wäre es unausführbar gewesen, Schuhnummer vierunddreißig zu entdecken. In China, wo chinesische Krüppelfüße Leute zu einer Schuhverkürzung gezwungen hatten, fand ich das Gesuchte. Leider waren sie auch hinten kürzer als wir das gewöhnt sind, und daher trug ich sie nur dort, wo ich mit absatzlosen Gummischuhen nicht gehen konnte: in kaltnassen Gegenden. Sie hielten daher drei Jahre lang. Andere Schuhe vernichtete ich in drei Monaten.
Viel Spaß hatte ich auch mit dem Begraben meiner alten Schuhe, deren ich mich schämte. Ich warf sie weg, und sie fanden sich wieder; ich wollte sie über Bord werfen, selbst um 2 Uhr nachts, und immer stand jemand an der Reeling; ich stopfte sie zuletzt in ein Schiffsloch, in dem sie hoffentlich liegen blieben, bis nichts an ihnen mehr an einen Europäerfuß erinnerte, aber die Sucht, mich ihrer zu entledigen, war die eines Verbrechers, der sein corpus delicti verbirgt.
Swatow hat wunderschöne alte Tempel, über deren stark geschwungene Dächer (angeblich die Form des ursprünglichen Nomadenzeltes) grüne Drachen mit grausen Windungen laufen. Sonst ist das Straßenbild wie in jeder südchinesischen Stadt – räudige Hunde, halbnackte, schmutzige Männer, Frauen mit langen Silbernadeln im Haar oder bescheiden mit pomadisiertem Kopf und hellseidenen Pantöffelchen in einer Rikscha fahrend, alte ehrwürdige Männer in einer Sänfte und das arbeitende Volk bei seinen tausend Beschäftigungen.
Zwei Dinge besonderer Art erzeugt Swatow: die schönen Durchzugsarbeiten, ähnlich dem norwegischen Hardanger, und Ansichtskarten, die aus beschnittenen Marken zusammengestellt sind. Allerlei Handwerker Chinas sind sehr geschickt aus allerlei Marken verschiedener Art und Färbung dargestellt und jede Karte kostet zwanzig Cents. Die hübsch bemalten Vierecke aus Tsuso ( Aralia papyrifea) bekommt man überall im Süden.
Im wohlriechenden Hafen.
»Ort der Gestanksverminderung« wäre ein möglichenfalls verzeihlicher Name gewesen; die obige Uebersetzung, obschon richtig, ist zu hochtrabend. Die Bucht ist großartig – daher war sie den Engländern ja so willkommen! – und leicht zu verteidigen, weil sie in weitem Bogen von Hügeln umgeben ist, und mit dem Peak, auf den die Stadt hinaufklettert, ihren Abschluß findet. Die Nachtansicht ist noch schöner als bei Tage, weil da tausend unerwartete Lichter einen Wasserfall vom Gipfel des ansehnlichen Berges herab bilden, während tagsüber ein feiner, grauer Dunst zu oft das Bild in einen Schleier hüllt. Der »Soshiu Maru« blieb zwei Tage lang liegen, und ich hatte Gelegenheit, mir die Stadt genau zu betrachten. Die Gassen sind – mit Ausnahme der europäischen Hafenstraße mit modernen Geschäften und freien Plätzen – sehr eng und ganz chinesisch. Die Straße auf den Peak sehr breit und schön, doch lassen sich die meisten Europäer hinauftragen. Mein erster Gang war zu Cook and Son, wo ich die Karte nach Australien, mit Unterbrechungsmöglichkeiten in Manila und in Nord-Borneo löste, um einigermaßen zu wissen, wieviel mir bleiben würde, denn zum zweitenmal träumte ich vom Eindringen in das schwer erreichbare Südseeinselreich. Hatte ich einmal die Menschenfresser hinter mir, so war das Schwerste überwunden – das ging mir wie eine Vorhersagung durch den Sinn.
Eine Hoffnung, durch mehrere Jahre gehegt, zerrann in Hongkong. Das Bündel Briefe in Händen – o der Zauber eines Postamtes! – durchtrollte ich langsam die Gassen. Hier hackten Jungen das Holz für den kleinen Haushalt, dort nähten Frauen, drüben suchten Bettler nach den lästigen Einwohnern ihrer Lumpen, und wo man auch ging, fächelten einem die herabhängenden, an eine Bambusstange gebundenen Wäschestücke Luft und … Duft zu. In den Fleischerbuden sieht man die üblichen luftgeselchten Enten, Hunde, Frösche, Vögel und Würste aus unbekannten Massen, immer flach wie ein schlechtes Rattanrohr und zu endlosen Schnüren gereiht, in denen die Fliegen ihr Abendlager aufschlagen und dadurch den Fleischvorhang noch verdichten.
Unheimlich ist Hongkong für den Einsamen. Ich war froh und traurig zugleich, daß mein Maru am Damm selbst verankert war, denn wer sich ein Sampan nahm, um allein zu einem fernliegenden Dampfer zurückzufahren, der kehrte oft nicht mehr zurück. Wer wußte, welches von all den kleinen Booten er genommen hatte? Wann? Von welcher Stelle? Sein Leichnam taucht selten auf, denn ihn behalten die Fische; was er besessen, behalten die Räuber …
Schön aber ist Hongkong früh am Morgen, wenn man die Peakstraße hinaufgeht und in all die Pracht der Bougainvillia, der Poincettas, der zitternden Baumfarne blickt, an Fächerpalmen vorbei die Höhen erreicht und die Bucht mit ihren tausend Schiffen vor sich sieht. In keinem anderen Hafen ganz Asiens können sich so viele große Schiffe gleichzeitig versammeln. Eine ganze Kriegsflotte fände darin Platz.
Kämpfe um Kanton verhinderten ein Weiterfahren mit der Bahn, und so wartete ich geduldig drei Tage, bis der gute Maru leer geworden war und gegen Abend weiterfuhr. Man irrt sich, wenn man annimmt, die Hauptstadt Südchinas liege sofort hinter Hongkong. Man fährt auf dem breiten »Perlenstrom« eine ganze Nacht, ehe man sich Kanton nähert. Es war acht Uhr früh, als wir Anker warfen. Das Schiff blieb mitten im Strom.
Fa Fong Hsüh – das duftende Dorf.
Ich hatte – wieder durch Herrn von Salzmann – ein Empfehlungsschreiben an Herrn Wohlgemuth, den Leiter der Berliner Mission in Kanton, und es war mir die Erlaubnis geworden, im Missionshaus die Abfahrt meines Maniladampfers zu erwarten. Nun spähte ich auf den Fluß hinaus und wußte nicht, wo ich Fa Fong Hsüh zu suchen hatte.
Der Polizeiinspektor aber wußte es. Er zeigte es mir jenseits des Flusses, wo zwei spitze Türme hervorragten und ein grüner Landungssteg sichtbar wurde, und bald saß ich im Sampan und ruderte darauf zu. Ich traf Herrn Wohlgemuth beim Frühstück und verschwand bald selbst in Kaffee und Butterbrot. So herzlich war die Aufnahme, daß ich darüber ganz vergaß, wie sehr man gerade um Kanton kämpfte und wie furchtbar die schwarzen Blattern wüteten. Später starrte ich aus dem Fenster meiner augenblicklichen Behausung hinaus auf den Dschu Klang, den Perlenstrom, auf dem nicht nur viele der dreitausend darauf ständig schwimmenden Sampans vorbeitrieben, sondern man auch Dinge sah, die einem den Appetit am Tee, auch wenn er dreifach filtriert war, wie man mich tröstete, vereitelten. Leichen erschossener Soldaten, Esel- und anderes Tieraas, kleine weggeworfene Kinderkörperchen, Unrat und Abfall jeder Art schwamm hier dem Meere zu.
Gegen Mittag nahmen mich die Herren der Mission unter ihre Fittiche und führten mich über den Perlenstrom nach Shameen, wörtlich »auf dem Sande«, der merkwürdigen Fremdenkolonie, die ganz auf einer Insel angelegt und von einem schmutzigen, mit Sampans übersäten Wallgraben umrandet ist. Nach dem Boxeraufstand wollten die Chinesen diesen Graben verschütten, doch der britische Konsul soll den Revolver gezogen und das Bleiben des Grabens befohlen haben, worauf auch einer der Chinesen nach seiner Waffe griff. So erbittert aber die Gelbgesichtigen darüber noch immer sind, ich kann dem britischen Konsul gut nachfühlen Der Graben trennt Shameen vom Festland, trennt Asien von Europa, Schmutz von Reinlichkeit …
Alle Menschen sind Brüder. Zugegeben: Aber es ist doch schön, wenn jeder Bruder sein eigenes Schlafzimmer hat, und ich habe schon als Kind auf die Frage »Möchtest du eine Schwester?« in tiefer Welterkenntnis geantwortet: »Ja, aber in einem anderen Haus!«
Peking ist mir persönlich lieber. Die hohe Mauer, der gelbe Sand, die scharlachroten Tore, die sacht trabenden Kamele und die Lamapriester, denen – wie den Kamelen – der Duft der Mongolei anhaftet, dies alles versetzt in eine eigene Gemütsstimmung Indessen hat auch Kanton seinen völlig ursprünglichen Reiz, und wäre ich geblieben, so würden in mir so viele Geschichten wie im Norden entstanden sein.
Schon das Fahren auf den Hausbooten war ein Vergnügen für mich, denn im Bootszimmerchen, in dem man auch bei der Ueberfahrt saß, war irgend ein schauriger Gott an die Wand gemalt oder brannte ein Licht unter einem dickbauchigen Glücksgott in der finstersten Ecke; draußen wurde gekocht und an einer gespannten Leine trockneten – genau wie Enten flachgedrückt und enthäutet – dicke Ratten. Das war die billigste Luftselcherei. Die Sonne trocknete, und vom Kohlenherd stieg oft etwas Rauch auf. Diese engen, oft leicht überdachten Straßen hinter dem Shameen, die man nach Ueberschreiten einer Kamelrückenbrücke erreichte, diese Geschäfte hinter uralten geschnitzten Torbogen, bleiben unbeschreiblich. In Elfenbeingeschäften zum Beispiel vielerlei Kugeln, immer die eine in der anderen, ohne daß man sagen könnte, wie sie hineingekommen waren; oder im Laden nebenan Fächer aus herrlich blauen Königsfischerfedern, Broschen aus Nephrit, Gehänge aus Bernstein, Ochsenblutporzellan, Cloisonné, Ketten und Kämme aus Perlmutter, Seiden mit Kranich- und Blumenmuster, goldgestickte Pantoffel und so weiter. Manche Straßen beginnen und enden mit einem einzigen Handwerk, so die Ebenholz- und die Möbelstraßen überhaupt, wo man die schönsten Waren dieser Art billig erstehen kann (billig vom Wertstandpunkt aus).
Das ist das Innere der Geschäfte, doch der Zauber ist ebenso stark draußen wie drinnen. Männer mit Strohhüten wie der Fujiyama, mit breiten Schulterstangen und breiteren Kisten bahnen sich Weg, Sänften wollen durch die engen schlüpfrigen Gäßchen hindurch, Kinder zwängen sich an den Beinen entlang, in einem Hause ist Hochzeit, in einem anderen liegt eine Leiche so nahe der Tür, daß ich beinahe über die toten Füße gestolpert wäre, und bei all dem Gestoße, Gestinke, Geschrei erinnert man sich plötzlich an die lauernde Pest und Cholera, die gefürchtete Tropendysenterie, an die gerade wütenden schwarzen Blattern, an Malaria und andere Tropenfieberarten, doch ich gehe unbekümmert durch das enge, übelriechende Häusergewirr, denn ich fürchte auf meinen Reisen nur zwei himmelverschiedene Dinge: ein Mannszweibein mit leidenschaftsroten Augenrändern und – – den Ringwurm.
In der Totenstadt.
Es gibt in Kanton eine eigene Stadt für die Toten. Die Lebenden wohnen jahrein, jahraus auf Sampans oder in elenden Lehmhütten, schlechter als unsere Ställe, und selbst die Häuser der reichen Chinesen sind, jedenfalls für unsere Begriffe, höchst ungemütlich. Die Totenstadt dagegen, die man durch ein weißes Tor betritt, ist sehr hübsch und gleicht mit ihren vielen niederen Bauten und den zahllosen Zellen eher einem weitverzweigten Kloster. In jeder Zelle steht ein Sarg und vor dem Sarg der Opfertisch mit den Lieblingsspeisen des Verstorbenen, hier meist aus Zuckerteig oder Wachs nachgeahmt; Nebenfrauen flankieren das Kopfende des großen Sarges (das immer dem Besucher zugekehrt ist) und an den Wänden hängen die Schleifen aus Seide, auf denen die Vorzüge des Toten, sein Name und so weiter geschrieben stehen. Räucherkerzen in Stäbchen- und in Schlangenform hängen von der Decke und brennen in weiten Becken, und da und dort wird auch noch Papiergeld verbrannt. Die Zellen samt Bedienung sind so teuer wie ein gutes chinesisches Hotel – drei bis vier Dollar täglich. Es gilt als hohe Schande, die Toten nicht vornehm zu »verköstigen«. Der Priester aber verschiebt und verschiebt die Beerdigung und sucht monatelang nach dem günstigen Tage. Manch ein Angehöriger verarmt, ehe er den Vater begraben hat, und manche Leute sparen ihr ganzes Leben, um mit viel Prunk begraben zu werden.
Im Leben ist alles gut genug; das ist typisch für Asien.
Ein Pfund fürs Herz.
Am folgenden Tage besuchten wir – Herr Schwarm und ich – einige der Tempel, die leider schon recht verfallen sind. Alles Geld geht in Pulver auf (auch unweit der Totenstadt hatten wir bei unserem Gang über etwas freieres Gebiet Scharfschüsse in geringer Entfernung vernommen), und zur Erhaltung kostbarer Altertümer wurde nichts getan.
Im Tempel der fünfhundert Lohan sieht man sie alle in Holz geschnitzt dasitzen – Götter mit so ernsten, gelangweilten Gesichtern, daß es einem schwer wird, Glücks- und Schutzgeister darin zu erblicken – und ganz im Anfang einer Reihe, noch recht erkenntlich im Dämmern der riesigen Halle, steht – – Mungo Park, der Forscher und Reisende, ebenfalls unter den Göttern. Ob ich auch einmal irgendwo als Schutzgeist aufgestellt werde? Hm, nicht einmal bei den Menschenfressern, die in mir nur das Gespenst der Hungersnot sehen würden … Indessen verdankte Mungo Park diese Ehre weniger seinem Geist als seinem Barte.
Der Fünfgenientempel ist beinahe zerstört. Er trägt seinen Namen nach den fünf Genien, die angeblich eines Tages über das Wasser hergeschwommen kamen, auf Widdern reitend in Kanton einzogen und den Leuten fünf kostbare Gräser – Reis, Kaoliang, Kaffee und am Ende gar Opium – schenkten. Nach ihnen heißt die Stadt die »Stadt der Widder«. Als die Berliner Mission die beiden spitzen Türme der Kirche aufsetzen wollte, weigerten sich die Chinesen, indem sie behaupteten, daß dies ein Unheil bringen könnte, doch der Missionar sagte schnell, »ei was, das sind ja nur die Hörner des Widders!« und sofort war aller Widerstand beseitigt.
Ueberhaupt bewegt sich das Denken der Asiaten (nicht wie voreingenommene Menschen glauben in niedrigeren) in anderen Kreisen als das unsrige. Das läßt eine Kluft, die sich immer wieder vor einem öffnet und vor der man erschrocken zurückweicht. Ein Missionar sollte ins Innere abreisen, aber die chinesische Behörde wollte (weil der Krieg erklärt worden war), nicht die erbetene Erlaubnis geben. Alles Betteln, alles Schmieren half auf einmal nichts. Hier mangelten die Lebensmittel, im Innern war alles leichter. Da sagte Herr S. ernsthaft zum Chinesen:
»Ich muß weg – ich kann hier nicht länger bleiben, und wenn mein Wunsch unerfüllt bleibt, so muß ich eben hier, auf Ihrer Torschwelle Selbstmord verüben.«
Früh am nächsten Morgen kam die erbetene Erlaubnis. Nichts fürchtet der Chinese mehr, als einen »Geist« vor der Türe zu haben. Bei uns verwandeln die Verbrecher umgekehrt die Menschen in Geister, um sie nicht mehr fürchten zu müssen.
Sehr interessant ist der Rest des einstigen Stadttores unweit der Totenstadt, von wo aus man die Weißenwolkenberge bewundern und die fünfstöckige Pagode beschauen kann, die einst das Stelldichein aller Dichter und Denker des Südens gewesen und die nun, wie alles in Kanton, dem Verfall entgegengeht.
In der allein gut erhaltenen Blumenpagode, inmitten reizender kleiner Gärtchen, nahmen wir Din Sam – ein Pfund fürs Herz – das heißt einen Imbiß ohne Reis zur Stärkung ein. Niedliche Zwergbäumchen umgaben uns, und vor der Glasveranda blühten schon die Kamelien. Es war Januar.
Was ich aß? Gefülltes chinesisches Brot, das weich und warm ist und an Nudelteig erinnert, süßen Eierkuchen und mit Schweinefleisch gefüllten Teig (auf gut Glück hingenommen), ein Pastetchen, Inhalt nicht ergründet, doch schmackhaft, und dazu Wassergenientee.
Im Seegeschmacksladen.
Am liebsten war ich in der Chinesenstadt. Einmal gingen wir in den Hoyme oder Seegeschmacksladen, wo man alles kaufen konnte, was aus dem Meer kam – Haifischflossen (zwei bis acht Dollars das Kan), getrocknete Austern, in der Suppe gekocht, Bohnennudeln und Lotossamen, Melonenkerne und Hong tse (eine Art Hagebutten), Krabben, Tintenfische, Schwämme (Baumohren, wie die Chinesen sie nennen), Fut tsey, ein seltsames Gras, das sich wie gehacktes Roßhaar anfühlte, Bao yü (Muschel in zähe Scheiben geschnitten), Bambusschößlinge, Erdhühner (Frösche) und Matai (Pferdehufe).
In einem Porzellangeschäft kaufte ich die winzigen Figürchen, die in Shekwan gemacht werden und 40 000 Arbeiter beschäftigen, und lernte allerlei Götter kennen. In einem Teeladen schenkte man mir Drachenbrunnentee und zeigte mir (auch geruchlich) den Wassergenien-, den Ahorn-, den Jasminblüten-, den Ziegeltee aus Honan, der so gut zum Haarwaschen sein soll, und andere Teearten, an denen die Namen das Allerschönste waren.
Im Laden »zu den fünf Glückseligkeiten« sah ich sehr schöne Torschnitzereien und Schilder.
Die schwarzen Blattern.
Fünf Tage weilte ich in Kanton, und die Blattern nahmen beständig zu. Europäer erkrankten und starben nach wenigen Tagen. Ehe ich abreisen durfte, mußte ich zum achten Male geimpft werden. Nichts half! Ich mochte meine Schrammen herzeigen, wie ich wollte. Der deutsche Arzt behauptete, mir ohne wirkliche Impfung kein Zeugnis geben zu können. Zum Schluß sagte er:
»Wenn Ihnen der Arm leid tut, kann ich Sie ja auf dem Oberschenkel impfen!«
Ich aber wollte mir nicht noch einen bis dahin verschonten, wenn auch sehr verborgenen Teil meines Ichs verunstalten lasten. Ich wurde am Arm geimpft und verbunden, und während an mir geschnitzelt wurde, sprachen wir über China. Die Impfung machte mich um einen Dollar ärmer und sonst nicht reicher, doch die mir dabei erteilte Ansicht über das chinesische Eheleben war den Dollar wert, und ich bringe sie hier ohne jedwede Randbemerkung (da ich Gott sei Dank nur in meinem Roman mit einem Chinesen verheiratet war) zu Papier.
»Der Chinese,« meinte der Arzt und rieb Karbol in meinen Arm, »mag viele Frauen haben, aber eins weiß ich aus persönlichem Erfahren: Er hat mehr Zeit für seine siebente Frau und behandelt sie besser als der Durchschnittseuropäer seine erste und einzige.«
Trotz dieser Versicherung war und bin ich der Ansicht, daß ich weit lieber die erste und einzige Frau eines Europäers als die siebente (oder selbst die erste!) eines Asiaten bin. Unsere weißen Männer (besonders wenn sie die Tür für uns aufmachen, die Jacke tragen oder die Tasche aus dem Waggonnetz heben) haben Vorzüge, die mir wenigstens angenehm ins Auge stechen. Auch vergaß ich die Frage, ob der Chinese diese Zeit am Ende nur für die siebente (als letzte und neueste und vermutlich jüngste seiner Frauen) übrig habe.
Ein offengelassener Punkt.
Ich erkrankte nicht an den Blattern (begreiflich) und nicht an Malaria, die im duftenden Dorf auch leicht zu haben war.
Eine Sänfte und ein böser Konsul.
Die Missionare waren alle sehr gut gegen mich gewesen, und ich schied mit den wärmsten Dankesgefühlen von Herrn Wohlgemuth und mit wachsender Dankbarkeit für Erich von Salzmann, der so ohne jede Verpflichtung auch aus der Ferne noch mein Schutzengel blieb.
In Hongkong begab ich mich zum amerikanischen Konsul. Warum sind alle Behörden, mit Ausnahme der britischen, in der Regel so borstig, wenn man zu ihnen kommt? Sind die Behörden zur Luftveränderung für ihre Angehörigen im Ausland oder für das reisende Publikum? Der Konsul war ein Flegel – Gott hab' ihn selig! Ich hoffe nämlich, zum Wohl seines Volkes, daß er in der Nähe von Hongkong schon grüne Kleider trägt.
Im letzten Augenblick, zwei Stunden vor Dampferabfahrt, hetzte er mich zu einem Photographen. In einer Sänfte, da ich den Weg nicht kannte, wurde ich den Berg hinangetragen, eine interessante Bewegung und Erfahrung, der ich aber das Wandeln auf eigenen Gehwerkzeugen vorziehe, und zu Fuß, im Galopp, raste ich wieder talwärts, schneller als alle Rikschakulis. Den Schein, daß ich abgenommen, ausgenommen, weggenommen war und so weiter, ließ ich ihm. Hoffentlich war mein Bild an Häßlichkeit verdoppelt und gab ihm einen Magenkrampf nach Erhalt.
Unten, den Paß, der mich zwanzig Dollars (!) gekostet hatte, in der Hand, dachte ich bis zum Atemholen darüber nach, wie ich ihn am besten dauernd und wirksam verfluchen könnte. Auf einmal sagte ich:
»Mögest du als Weib wiedergeboren werden, du Menschborste aus dem Sternen- und Streifenland, und mögest du als Journalistin die Welt umsegeln müssen!«
Das genügte mir. Ich lächelte, wie es nur der tun kann, der weiß, daß der andere in diesem Falle »versorgt« ist.
Abfahrt aus dem Fernosten.
Ein langsamer Kuli, ein langsameres Sampan brachten Gepäck und mich ans Schiff. Der erste Offizier packte die Erika bei einem Ohr und mich bei dem anderen, zog uns hoch und erklärte, nur auf uns gewartet zu haben. Der Dampfer pfiff dreimal »Leb' wohl«, und wir verließen die Bucht. Der Ferne Osten lag hinter mir.
Schlußwort.
Nach nahezu vier Jahren einer ungewöhnlich gefahrvollen und entbehrungsreichen Forschungsfahrt sollte ich endlich das ersehnte Südseeinselgebiet betreten und da Erfahrungen entgegengehen, wie man sie nur erleben kann, wo Völker auf niedrigster Entwicklungsstufe gewissermaßen ein Urzeitdasein führen, wo die seltsamsten Sitten und Gebräuche herrschen, das Menschenfressertum noch nicht erloschen ist und wo man – einzig noch auf diesem abgelaufenen Erdball – ganz abgeschnitten von der Außenwelt bleibt.
Ich betrat dieses höchst eigenartige, gefährliche und zum größten Teil außerordentlich ungesunde Gebiet seelisch und körperlich geschwächt, mit allzu knappen Mitteln und mit einer ungenügenden Vorkenntnis von den ungeheuren Verkehrsschwierigkeiten. Ich wollte nur sechs oder acht Monate in der Südsee verweilen; ich verließ sie erst nach mehr als zwei Jahren ungeahnter Erlebnisse, mit einer aus immer gebrochenen Gesundheit und nach haarsträubenden Schrecknissen, aber jeder einzelne Tag war eine Schule, ein Weiten meines Gesichtskreises. Die Menschen, die Tiere, die Pflanzen sind so völlig verschieden von allen übrigen Erdstrichen, und der Aberglauben vieler Jahrhunderte liegt wie eine Weihrauchwolke auf diesen unzählbaren Inseln und Inselchen des Stillen Ozeans.
Ich möchte mich daher gern dem Hoffen hingeben, daß die Leser, die bis hierher geduldig meinen Schicksalen gefolgt sind, mich nun auch auf den weiteren Etappen meiner Forschungsreise begleiten werden, deren Erlebnisse in den beiden Büchern » Im Banne der Südsee« und » Erlebte Welt – das Schicksal einer Frau« niedergelegt sind.