
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
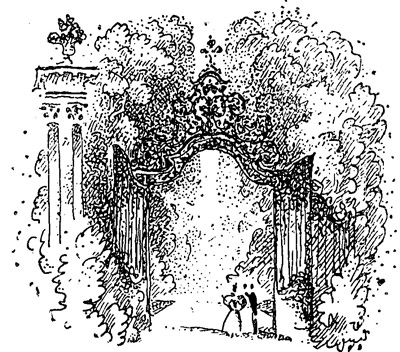
So ein richtiger Sonntag Mittag, da »bei« Potsdam dauerte für Fritz Eisner von zehn Uhr vormittags bis zehn Uhr nachts, ja selbst bis zwölf Uhr. Und er legte noch wie eine prosperierende Firma kleine Nachmittagsfilialen in der Woche an mit köstlichen Spaziergängen.
Für Eginhard Meyer war er nicht ganz so häufig, der Sonntag Mittag, und nicht ganz so ausgiebig.
Denn Egi Meyers Familie – die nähere! – redete stets gleich von Entfremdung, wenn er Sonntags fehlte. Und die weitere Familie im wohlsituierten Umkreis, die schon als Abzahlung auf die Hochzeitsgeschenke hin mit Einladungen nicht geizte, begann, wenn auch langsam und etwas skeptisch, Hannchen in ihren Kreis aufzunehmen. Was Hannchen eine Unmenge neuer Tanten und reizender Freundinnen einbrachte, zu denen sie mit Blumenbukettchen und Handarbeiten stürzte, und die sich nach ihr rissen, – wie sie glaubte.
Außerdem aber hatte sich Eginhard Meyer eine Doktorarbeit gewählt und bestätigen lassen, was ihm durchaus unmöglich machte, fürder im Hause seiner Eltern zu wohnen, allwo man auf einen geistigen Arbeiter keine Rücksicht nähme; – wie überhaupt die Eltern ihm in der tiefen Verständnislosigkeit, die einfache Seelen für das Genie stets haben, gegenüberständen. Und er hatte deshalb seine stille, abgeschlossene Arbeitsklause in der elterlichen Villa mit einer unsagbaren Studentenbude vertauscht, die nach Kohl und Kindern roch, eingekeilt zwischen den Behausungen zweier Skalen übenden Musikhochschülerinnen lag und nach einem Hof herausschaute, auf dem von morgens um Sieben bis abends um Neun Teppiche geklopft wurden.
Da Eginhard Meyer aber, um sechs Zeilen schreiben zu können, um die Inspiration sozusagen hierzu herbeizulocken, stets dreimal die Mauern der Stadt umkreiste – Gedanken wollen ergangen und nicht ersessen sein! –, war er eigentlich hierdurch nicht allzu gestört. Beim Konzipieren selbst trug er außerdem Gummipfropfen in den Ohren.
Es würde von dem Raum dieses Romans nicht viel mehr übrig bleiben, wenn ich etwa ausführlich über die Bedeutung dieser Doktorarbeit mich vernehmen ließe, die in der wissenschaftlichen Welt nicht ihresgleichen finden dürfte und in etwas erweiterter Form sofort als Habilitationsschrift gelten sollte, ja Eginhard Meyer eine Professur in Aussicht stellen müßte, wenn nicht etwa die alten Perücken, die hierüber zu bestimmen hätten, ganz und gar vertrottelt und vermottet wären. Bei den außerordentlichen Werten, die hier für die internationale Wissenschaft auf dem Spiel standen, wird man entschuldigen und begreifen, daß Egi Meyer nicht mehr ganz die Zeit erübrigen konnte, sich ausreichend der Lappalie seines Brautstandes zu widmen.
Fritz Eisner hingegen, bei dem Beruf und Leben nicht getrennt, sondern aufs engste miteinander verflochten waren – denn sein Beruf war ja das Leben – tat das, wie schon oben bemerkt, skrupellos und in ausgiebigster Weise.
Und alles, was ihm der erste Rundgang versprochen, wurde eingelöst mit Zins und Zinseszins.
Der kleine Seitenweg, der von der breiten Lindenallee abzweigte, erwies sich als äußerst schätzenswert. Menschenfüße hatten ihn geschaffen. Er war nicht schön, er war ungepflegt, ging durch Buschwerk hin, an das nie eine Heckenschere gekommen. Er war auch nach dem Regen lange noch aufgeweicht; aber er hatte zwei Bänke aus Birkenästen, – und wilde Veilchen und Himmelschlüssel wuchsen an seinem Rand, die man sich anstecken lassen konnte. Und später dann, an Juniabenden zogen über die Silberteller der Holunderbüsche die Glimmerfünkchen der Leuchtkäfer in melancholisch schwerer Sinnlichkeit.
Und die Baumgruppen, die erst noch zerfasert waren im Park, wurden wie festgeschlossene hohe Burgen, einsame Plätze beschützend, die niemand fand als der, so sie kannte. Und Fritz Eisner und Annchen Lindenberg kannten sie bald.
Vorzüglich war da ein Platz bei einem kleinen, von Glyzinien überrankten Zierbau, den sie sehr liebten und immer wieder suchten. Über einem Marmorsarkophag, auf dessen Rand Masken mit erstarrten Schmerzensaugen lagen, und aus dessen weißem, stets von abgefallenen Blüten überschneitem Grund sich eine kleine, spielerisch bewegte Bronzegruppe mit den jagenden Seepferden des Poseidon hob, ... über dem hielten vier schwere dorische Säulen, stolz, hochragend, angetan eine Welt zu tragen, ein lockeres Dach luftiger Holzstäbe, auf dem die grünen flatternden Polster der Schlinggewächse ruhten. Lieblich und feierlich in eins war die Stelle, ausgesetzt Lüften, Winden und Regen, wundervoll unwirklich, wie der Traum von Heiterkeit und Schwermut, den der Mensch des Nordens von der griechischen Antike in seiner Seele trägt. Und nie kam jemand hier in diesen Parkwinkel.
Und die Maiblumenfelder warteten kaum ihre Zeit ab, um zu blühen, und dufteten aus tausend und abertausend ihrer weißen Glöckchen. In den Abendstunden jedoch (kurz bevor der alte Wächter das quarrende Eisenpförtchen schloß) verschmolz dieser grelle Duft mit dem Trillern der Nachtigallen, die ringsum in den Büschen nisteten und sich eifersüchtig von hüben und drüben zu übertönen suchten in ihren Gesängen, die Lust, Schmerz und Wehmut mischen ... verschmolzen Duft und Klänge nun erst so nervenpeitschend, so wild und begehrlich, daß man doch die weise Vorsicht der Parkvorschriften zu verstehen begann, welche anordnet, daß mit Einbruch der Dunkelheit etwa noch im Park vorhandene Spaziergänger aus demselben zu weisen und die Pforten dieses Paradieses hinter ihnen zu schließen sind. Um die Gazellen nebenbei kümmerte sich Fritz Eisner kaum noch. Er übersah sie.
Ja und drüben, was gab es da alles für Wege! Durch den Wald, dicht an dem grasenden Damwild vorbei, das ein ganzes Stück mitzog, Waldwege, die schütter und licht waren wie die Frühlingsmorgen, und andere, dunkel wie eine Herbstnacht. Ein bißchen unheimlich. Da kamen gewiß die mächtigen Hirsche aus dem Dickicht. Erst neulich hatten sie wieder einmal einen Landbriefträger angegriffen. Auf die hatten sie es abgesehen. Sie hatten wohl keine guten Erfahrungen mit der Post gemacht. Aber gerade dann war es so nett, wenn ein anderes bei einem Hilfe suchte. Man hätte einfach das Tier beim Geweih gepackt und zu Boden gerungen. Sollte es nur kommen! Trotzdem atmete Fritz Eisner erleichtert auf, wenn man erst ein Stück weiter war.
Oder man erlebte die Begegnung mit hundert Fasanen, alten, glänzenden und bunten, und jungen, schmucklosen, grauen, die im welken Laub scharrten, und deren König ein merkwürdiger gelbhäutiger, starrhaariger Zigeuner war, in Schaftstiefeln, Schnürrock und mit einem betroddelten Deckelchen auf dem Kopf. Ein König, der als Zepter eine Rohrflöte führte, auf der er mit monotonen Trillern seine Untertanen lockte, ihm zu folgen.
Man sah den Kuckuck wie eine langgeschwänzte, unbehilfliche Taube über die Schonungen ziehen und zählte seine Schreie, bis es einem langweilig wurde. Gott, so alt konnte man doch gar nicht werden. Der Kuckuck aber brüllte immer weiter ... denn es war sein Beruf.
Und Wege erschlossen sich, von denen Fritz Eisner keine Ahnung gehabt hatte. Man konnte zum Beispiel herüber zu dem Berg gehen. Da war Dörflichkeit und ein Wirtshaus mit überragenden Schinkenbroten. Man konnte auch in einen Krug gehen, ein Sommerlokal, das an verschilfte schwere Wiesen grenzte, und von dem aus man über die Havel fort nach Werder mit seinen Fabrikschornsteinen hinübersah. Und auch hier saß man schattig unter alten Bäumen. Und wenn einem auch die Hühner den Kuchen wegpickten, sowie man sich umdrehte, so zahlten sie ihn bereitwillig in Eiern wieder zurück, groß, frisch und überaus preiswert.
Das Obst blühte allenthalben. Und nur Uneingeweihte suchten es drüben in Werder zwischen Staub, Lärm, Kremsern, Radfahrern, Fruchtweinen und Betrunkenheit. Fritz Eisner wußte, daß es am Pfingstberg und in der russischen Kolonie auf ihn und Annchen Lindenberg sittsam, strahlend und bescheiden wartete; – »wie Kinder, die mit Spruch und Strauß, so köstlich, blöd und dumm«, sagt Peter Hille von blühenden Kirschbäumen.
Da gab es ein paar Flecke, wo von der ganzen Welt nur der Rasen mit den gelben Miniatursonnen der Butterblumen und die weißen und rosigen Wolken der Obstblüten, soweit man blicken konnte, und der blaue Himmel darüber mit Schwalbenflug und Vogelgesang übriggeblieben war. Aber – was war das eigentlich gegen die Rotdornbäume in der Waisenstraße, die vor den alten gelben Bauten in ganzen Reihen sich hinzogen und so mit der Rotglut ihrer Blüten überschüttet waren, daß Ast, Zweig und Blatt darunter verschwanden? Er kam zusammen mit dem Flieder, der Rotdorn, Flieder, von dem man meinen konnte, daß er hier seine eigentliche Heimat hätte, so üppig war er. Und sie bereiteten eigentlich nur auf die Rosenzeit vor. Denn wegen seiner Rosenparterres war ja dieser Teil des Parks schon von alters her berühmt; und jeder riet Fritz Eisner, sich ja sie anzusehen. Das wäre das Schönste.
Aber man hätte das Fritz Eisner und Annchen Lindenberg gar nicht raten brauchen; sie versäumten schon so nichts. Denn vier Augen, und vier Augen, die verliebt sind, sehen vielleicht nicht mehr als zwei, die das nicht sind, aber sicher ist, daß sie das, was sie sehen, intensiver und leuchtender und strahlender erblicken als andere. Denn jeder blühende Zweig, jede weiße Wolke am Himmel, jeder taumelnde Falter über Beeten, jedes Flügelzittern der Libellen über dem Schilf, jeder Dufthauch des Flieders muß ihnen ja dazu dienen, ihr Glücksempfinden zu steigern, muß Resonanzboden für ihre Gefühle sein, der die schwingenden Töne ihres Ichs aufsammelt, nur um sie in verstärkter und vertiefter Klangfülle wieder zurückzuwerfen.
Natürlich war nicht immer schönes Wetter und eitel Sonnenschein. Es regnete auch mal, was vom Himmel wollte. Es gab sogar auch Tage, wo es nur einmal regnete, wie man sagt, nämlich von früh an bis spät in die Nacht hinein. Tage, die kühl und unfreundlich waren. Aber Regen, der in die Baumwipfel hineinsummt, der auf die Büsche tropft, dem das Gras sich entgegenstreckt, den der Boden trinkt, ist doch lange nicht so sinn- und hoffnungslos wie der Regen in der Stadt, der aufs Pflaster platscht, durch Dachrinnen gluckst, an Scheiben trommelt und die langen Zeilen hasterfüllter Straßen mit seinen Flortüchern verhängt. Man blieb dann eben hier draußen zu Hause auf dem Balkon oder unten in der Laube unter den Bäumen, – und das war auch schön genug.
Annchen und Hannchen mußten abwechselnd die Wirtschaft führen und kochen; damit sie es lernten, wie Frau Luise Lindenberg meinte. Und während Annchen sich dieser Aufgabe intuitiv mit einer gewissen Genialität entledigte – (sie kaufte für billiges Geld die schönsten Dinge, die sie gern aß, und legte den Rest heimlich zu – fragte dann aber so lange, wie man sie zubereite, bis Frau Luise Lindenberg, die alles, nur nicht Fragen vertragen konnte, sie vom Herd wegstubste und mit geschürzten Ärmeln selbst sich an den Kochtopf stellte – worauf Annchen, scheinbar beleidigt, aber innerlich tief befriedigt, diese ihr unsympathische Arbeitsstätte verließ) ...
Betrieb Hannchen hingegen die Küche, wie alles, theoretisch: sie führte Buch in fünf Heftchen mit Bruchteilen von Pfennigen; bevorzugte den Materialwarenhändler, bei dem alles nach Petroleum schmeckte; erklärte, ein Mittagessen dürfte bei ihr später nie mehr als eine Mark siebenundzwanzig Pfennig kosten; und war stolz auf ein selbstkomponiertes Gelee, das dreizehndreiviertel Pfennig kostete, wie Tuschwasser aussah und genau so schmeckte, für menschliche Nahrung sich als ungeeignet erwies, von Mohrchen – der Rumtreiber hatte um zwölf Uhr an der Tür wieder gewinselt – von Mohrchen aber trotzdem mit Vergnügen verspeist wurde.
»Ihr füttert Mohrchen zu gut,« sagte Fritz Eisner, »das einzig Nette an ihm war seine schlanke Taille, und die hat es auch schon eingebüßt.«
»Ja, man wird«, meinte Frau Lindenberg nach einer bänglichen Pause, »den Hund weggeben müssen.«
Aber Hannchen erklärte, daß sie diese Roheit nicht überleben würde.
Auch Annchen meinte, sie wolle ihn behalten.
So sind Frauen, sagte sich Fritz Eisner. Erst wissen sie gar nicht, was sie mit solchem Tier aufstellen sollen, und nach vierzehn Tagen ist es ihnen schon über.
Überhaupt hatte sich manches im Hause geändert. Selma war verschwunden und, wie Hannchen nachher behauptete, mit ihr drei Paar seidene Strümpfe. Aber da die ganz ruhig in Berlin im Kasten lagen und überhaupt nicht mit hinaus in die Sommerwohnung gezogen waren, so brauchen wir dieser Beschuldigung kein Gewicht beizulegen. Immerhin ist festzustellen, daß Selmas Abgang von dieser Sommerbühne unter einer merklich kühleren Temperatur sich vollzog als ihr Auftritt, und daß kein Verehrer Kränze mit Schleifen warf.
Hingegen hatte Hannchen schon wieder eine neue Selma im Hintergrund, die demnächst in Erscheinung treten sollte, da Tante Trautchen vorerst geschrieben hatte, sie wollte doch noch erst das Sängerfest in Melsungen abwarten. Diese neue Selma hieß Lucie und hatte ein sehr schweres seelisches Erlebnis gehabt, wie sie es nannte; und es war deshalb nur Pflicht der Menschlichkeit, ihr Gelegenheit zu geben, hier in der schönen Umgebung über ihren seelischen Schmerz hinwegzukommen.
»Aber verzeihe, Hannchen, das ist doch nun bald ein Jahr her,« meinte Fritz Eisner.
»O, du meinst ja das von damals,« rief Hannchen mitleidig, »nein, das hat sie schon längst überwunden. Aber jetzt müßtest du das arme Mädchen einmal sehen. Überhaupt nur noch ein Schatten von dem, was sie früher war.«
Die brave Lucie ging nämlich alle Halbjahr an einem andern Manne seelisch zugrunde.
So lange aber, bis diese neue Selma in Sicht war, an der sich Hannchen mitfühlend als Vertraute bewähren konnte, hatte sich Hannchen einen erzieherischen Wirkungskreis an den Kindern der Kapitänswitwe geschaffen, die ja als Halbwaisen einer führenden Hand ganz besonders entbehrten. Denn die Kapitänswitwe schien Hannchen, wie sie in Gesprächen festgestellt, gänzlich ungeeignet zur Kindererziehung, über die sie sich auch theoretisch noch keinerlei Klarheit geschafft habe.
Über die Anlage der Kinder war sich zwar Hannchen nicht ganz im Reinen. So hatte sie Lieschen, den Südseetyp, neulich dabei überrascht, wie sie die Puppe ihrer Freundin während deren Abwesenheit heimlich aus dem Wagen nahm und verprügelte. Ein gutes Kind tut so etwas nicht!
Und Lottchen mit der mongoloiden Augenfalte hatte in ihr Poesiealbum die schönsten Verse geschrieben, die dicksten Oblaten dazu geklebt und die Namen von allerhand eigens zu diesem Behuf erfundenen Freundinnen daruntergesetzt; was nach Hannchens Ansicht einen zur Unwahrheit neigenden Charakter verriet.
Sie würde zwar vor nicht leichten Aufgaben stehen! Aber gerade das reizt ja die geborene Pädagogin besonders.
Hannchen beschäftigte sich also zuerst mit dem Südseetyp und versuchte ihn zu belehren, daß ein Sandhaufen etwas sehr Gleichgültiges wäre und zum Spielen nicht genüge, und daß rote und grüne Flechtbänder ihm vorzuziehen wären. Aber der Südseetyp glaubte es nicht. Dann ließ sie den Südseetyp nach gelben Papierbällchen greifen, was das Kind auch gutwillig tat, ohne recht zu verstehen, warum, weshalb und weswegen es das tun sollte. Hannchen jedoch ging theoretisch vor und begann bei diesem unverantwortlich vernachlässigten Wesen von der Pieke an ... mit den Übungen, die Fröbel für ein Kind im Alter von sechs bis neun Monaten vorschreibt. Nur so hoffte sie noch bei ihm – langsam sich steigernd – zu einem vollen Erfolge zu kommen.
Auch die Art, wie die Kapitänswitwe den Schulunterricht von Lottchen (mongoloide Augenfalte!) in abgekürzter Form bisher beeinflußt hatte, indem sie nämlich die Hefte ansah und ohrfeigte, wenn die Noten schlecht waren, schien Hannchen vom pädagogischen Standpunkte aus altmodisch und verwerflich. Und Hannchen übernahm deshalb die Leitung der Hausarbeiten, saß mit Lottchen Nachmittag für Nachmittag eine Stunde in der Laube und brüllte durch den Garten: »Sieben und fünf sind elf! Sieben und fünf sind elf! Sieben und fünf sind elf!«
Was Lottchen in der Meinung bestärkte, daß große Leute ihre durchaus eigene Rechenmanier hätten, die aber für Kinder, die keine Ohrfeigen zu Hause bekommen wollten, ungeeignet sei.
Auch dem Wikingerkind war Hannchen bei dem Aufsatz »Friedrich der Große und der Müller von Sanssouci« behilflich, was dem Wikingerkind, das bisher stets »eins bis zwei« unter seine Aufsätze bekommen, »vier bis fünf! – Stil!« einbrachte und Hannchen bewies, daß die Lehrerin der ??? V°- für ihren Beruf vollkommen unbrauchbar sei. Sie hatte das nebenbei schon von Anfang an vermutet.
Am schwierigsten jedoch wäre der Fall der Ältesten (der Mittelmeerrasse); denn gerade jetzt wäre der Augenblick in ihrem Dasein, da ungeeignete Lektüre einfach Verheerungen in der sich eben entfaltenden Frauenseele anrichten könne. Hannchen beschloß, nicht die Lektüre zu überwachen (das wäre unklug), sondern sie zu beeinflussen, ... indem sie dem jungen Wesen die passenden Werke der Literatur in die Hände spielte, wie sie in vorzüglicher Zusammenstellung für ihr Alter vom »Kunstwart« und vom Hamburger Lehrerverein geboten würde, mit Jeremias Gotthelf, Otto Ludwig und Luise von François, die dem halben Kind sicherlich verständlicher wären, als »Im Liebesrausch« von Heinz Tovote, das sie, lesehungrig, wie sie wohl war, der Mutter heimlich entwendet hatte.
Annchen schätzte diese Tochter der Mittelmeerrasse schon richtiger ein, indem sie sie belehrte, daß, wenn man das Haar halb offen trüge, es noch eindrucksvoller wäre, eine Strähne davon nach vorn über die linke Schulter zu nehmen. Aber auch Annchen unterschätzte – wie wir noch sehen werden – die Tochter der Mittelmeerrasse; wie es ja überhaupt öfter vorkommen soll, daß begabte und gut veranlagte Schüler weiter vorgeschritten sind als die Lehrer.
Frau Luise Lindenberg aber meinte, sie sollten sich doch nicht so viel mit den Kindern der Kapitänswitwe abgeben, da wären die von der Frau Direktor doch ein ganz anderer Schlag.
Fritz Eisner konnte das nicht finden, denn das waren armselige, vermickerte und verputzte Äffchen, quarrig und für alle kindlichen Betätigungen immer zu fein angezogen, in Seidenröckchen und Hängelöckchen; Kinder, mit denen die Mutter nicht direkt verkehrte, sondern denen sie nur ihre Wünsche durch eine gelbe Französin übermittelte, die sie recht unfreundlich mit » va vite« durch die Welt stubste.
Frau Luise Lindenberg war nämlich gerade auf die Kapitänswitwe nicht sonderlich gut zu sprechen. Das wäre eine Kanaille, meinte sie. Er, Fritz Eisner, erinnere sich doch deutlich, wie die Glocke und Zylinder von dem Gasarm ausgesehen hätten.
»Ja,« meinte Fritz Eisner, »ganz genau.« (Keine Ahnung!)
Also, es wäre doch wahrlich ganz billiger Schund gewesen. Und jetzt hätte die Kapitänswitwe für ihre Rechnung eine Glocke gekauft, die schönste, die in ganz Potsdam aufzutreiben gewesen wäre, mit einer Rosengirlande und tanzenden Engelchen. Und einen ganz teuren Marienglaszylinder mit 'nem Rädchen darüber ...
»Nächstens wird sie noch das Haus für meine Rechnung streichen lassen.«
»Ja,« meinte Fritz Eisner. »und auch sonst scheint sie mir etwas fraglich. Ich glaube, mit dem Kapitän, da stimmt irgend etwas nicht. Jedenfalls fuhr ich da neulich abend mit einem Potsdamer, der solche Andeutungen machte.«
»Ach Gott,« meinte Frau Luise Lindenberg etwas spitz, »die Leute reden ja über jeden. Und über niemand lieber als über eine arme alleinstehende Frau. Das weiß ich am besten. Das ist nun mal eben nicht anders. Ich habe mir das eine mit den Jahren angewöhnt: nie auch nur das geringste auf den Klatsch und das Gerede der Leute zu geben. Und wenn du keine üblen Erfahrungen machen willst, Fritz, so trage nie das Gerede der Leute weiter!«
Fritz Eisner war einigermaßen erstaunt, gerade aus dem Munde von Frau Luise Lindenberg diese Weisheit zu vernehmen, deren sie selbst in so hohem Grade bedürftig war. Denn das hatte Fritz Eisner schon herausbekommen, daß Frau Luise Lindenberg bei ihrer regen Anteilnahme an Personen die Toten und die Lebenden miteinander verklatschte. Naja – endlich kann der Mensch doch nicht lauter gute Eigenschaften haben!
Fritz Eisner schwieg mißlaunig, und die Stimmung wurde etwas angebrannt.
»Ach hört doch mal,« rief Annchen lachend, »also ratet mal, wen ich heute hier gesehen habe! Ganz früh. Wer sich in aller Herrgottsfrühe schon hier herumgedrückt hat? Ich habe mich sicher nicht getäuscht. Er war sogar unten im Garten. Was der wohl hier draußen will?«
»Wie sollen wir das wissen, wen du gesehen hast?« rief Hannchen, nachdem sie verschiedentlich – etwas ängstlich (warum nur?) – vorbeigeraten hatte.
»Also der kleine Doktor Martini. Du weißt doch: der von dem Ball des ANV., der die ganze Nacht nur mit mir getanzt hat.«
»Doktor Martini,« meinte Frau Luise Lindenberg nachdenklich, »ach, das wird wohl doch nur ein Irrtum von dir gewesen sein. Was soll der wohl um diese Zeit hier wollen? Hat er dich denn gegrüßt?«
»Nein,« meinte Annchen, »aber gesehen hat er mich. Sicher. Ich hab's ja gemerkt, wie er zusammenfuhr. Aber dann hat er getan, als kenne er mich nicht. Ich finde das sehr albern von dem Menschen. Wenn ich mich jetzt nicht mit ihm verlobt habe, deswegen sind wir doch keine Feinde, da kann er mich doch grüßen.«
Fritz Eisner war das Gespräch unsympathisch. Er stand überhaupt den früheren Tänzern Annchens mit ausgesprochener Abneigung gegenüber. Wenn er auch, so er gerecht sein wollte, sich sagen mußte, daß seine Verlobung für Annchen unmöglich ein Gesetz mit rückwirkender Kraft sein könne.
Da schlug Mohrchen an. Wachsam war es. Es klopfte, und die Kapitänswitwe rauschte herein. Sie rauschte unterirdisch mit Knitterröcken. Sie hatte ein wundervolles rotes Sammetkostüm mit Stuartkragen und Schinkenärmeln an, einen schrägen Rembrandthut und ein kleines sandfarbenes, bekurbeltes Cape über den breiten Schultern. Sehr teuer alles. Sie sah aus wie eine Königin darin – aber wie eine aus einer Maskengarderobe.
»Ich komme gerade einen Augenblick hier vorbei,« sagte die Kapitänswitwe, »ich will nämlich nachmittag in die Loge gehen.«
Wie sie da bei Lindenbergs, die über ihr wohnten, vorbei mußte, war unklar, da die Loge ja nicht auf dem Trockenboden lag.
»Und bei der Gelegenheit können wir doch gleich das einmal besprechen, was Sie neulich anregten, gnädige Frau. Sie meinten, ob Sie nicht noch einen Raum für Ihren Logierbesuch im Haus bekommen könnten. Und ich sagte damals, daß es leider nicht ginge. Und denken Sie, wie glücklich sich das jetzt fügt: Heute bekomme ich einen Brief von den Mietern aus dem Gartenhaus, sie könnten leider den Sommer zum Angeln nicht mehr herauskommen. Die Dame hat Gelenkrheumatismus. Und da der Herr selbst Arzt ist, so sagte er: er könne Angeln für seine Frau keinesfalls mehr verantworten. Es wäre direktemang Gift für sie.«
»Wie hieß der Herr doch?« fragte Frau Luise Lindenberg.
»Das war ein Doktor M... Meyer. Sie werden ihn nicht kennen. Ein älterer Herr. Es gibt ja in Berlin so viele dieses Namens. Ja, aber was die Hauptsache ist, da der Doktor schon die ganze Saison vorausbezahlt hat, so stehen mir natürlich jetzt die Zimmer zu jedem Preis zur Verfügung. Was der Herr Doktor herausbekommt, ist für ihn gefunden. Aber ich möchte Ihnen gern den Gefallen tun. Vor allem, da ja auch Ihr Fräulein Tochter immer so liebenswürdig sich meiner Kinder annimmt.«
Frau Luise Lindenberg griff natürlich mit beiden Händen zu, und unter vielen Verbeugungen verabschiedete man sich.
»Die Kapitänswitwe ist doch eine entzückende Frau, geradezu eine Dame,« rief Frau Luise Lindenberg, als die Königin herausgerauscht war. »Hätte das wohl eine einfache Vermieterin gemacht, diese selbstlose Großzügigkeit?«
Draußen tropfte der Regen in das bunte Frühlingslaub der Parkbäume vor dem Fenster, und Annchen setzte sich ans Klavier und spielte, von einem ins andere kommend, nett und unterhaltsam. Sie hatte jede Note im Kopf und in den Fingern, die sie jemals gespielt hatte, und verstand über Schwierigkeiten, die ihr entfallen, so hinwegzutäuschen, daß es immer voll, rund und angenehm klang. Auf sehr sauberes Spiel legte sie keinen Wert, aber Musik lag bei ihr in jedem Anschlag und in jedem Übergang. Sie empfand eben das Wesenhafte der Musik. Für Fritz Eisner war das eine neue Welt, denn er hatte wenig Musik in seinem Leben gehört und nie selbst welche getrieben. Er erinnerte sich ganz dämmrig, daß man ihn auf den Schoß genommen und mit seinem Finger so lange auf den schwarzen und weißen Zähnen des Polisanderungeheuers umhergetippt hatte, bis aus dem Klingklang, das erst gar keinen Sinn gab, plötzlich ein Lied geworden war, zu dem man singen konnte: »Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut«. Und das hatte ihm Spaß gemacht. Dann aber war bald danach bei dem Zusammenbruch des Elternhauses auch das Klavier mit fortgekommen, und damit war seine musikalische Erziehung ein für allemal beendet gewesen. In der Schule hatte er nicht mal die Noten lesen gelernt.
Und nun, da sein ganzes Leben bisher ohne Musik verflossen war, gab es da so plötzlich jetzt Melodien, die ihn wundersam erregten, Melodien wie von Wassertropfen, die in ein silbernes Becken fielen. Und das war Mozart. Und andere kamen daher wie Herbststürme durch den Forst, und es klang dazwischen, als ob ein Mann in der Nacht einsam weinte und sich doch seiner Tränen und seines Schluchzens schämte. Und das war Beethoven. Und andere, als ob ein Fieberkranker am frühen grauen Morgen von seiner Liebsten Abschied nehmen will und sich immer doch wieder in ihre Arme wirft, wie wenn er darin vergehen müsse. Und das hieß dann: Chopin.
Aber Frau Luise Lindenberg meinte, Annchen sollte etwas singen: die feuern Stunden, und sie verlerne es. Sie wollte » la brune Thérèse«, » Thérèse ma mignonne, tu deviendras baronne« von ihr hören und »Übers Jahr, mein Schatz, übers Jahr« von Meyer-Hellmund. Auch schwärmte sie für die Rosenlieder, besonders für das eine: »Aus des Nachbars Haus trat mein Lieb heraus, hielt ein Rööschen in der Hand«. Und da Fritz Eisner das Verlogene in diesen Dingen fühlte, so ging er hinaus auf das eiserne Vogelnest von Balkon, das durch irgendein kümmerliches Aperçu von Markise – es war aus einem alten gestreiften Bettbezug improvisiert – so halb und halb gegen den Regen geschützt war.
Hier war schon Hannchen, die die Straße herabblickte, als erwarte sie jemand dort zu sehen und erwarte es doch wieder nicht – es gibt solche Art des Sehens – und die merkwürdig zusammenschrak, als Fritz Eisner hinter sie trat. Was hatte sie denn?! Egi kam doch heute nicht heraus. Er hatte geschrieben, daß er sich einer Fahrlässigkeit schuldig mache, die er vor ihrer Liebe nicht verantworten könnte, wenn er sich seiner Arbeit, die gerade in eine wichtige Phase trete, auch nur für Stunden jetzt entzöge.
Auf der anderen Hälfte des Vogelnestes aber stand die Frau Baumeister mit einem Kind auf dem Arm, einem kleinen Wesen von neun, zehn Monaten, das eben gerade so sitzen konnte, wenn man es gut stützte, und das mit großen, ernsten, aufgerissenen Augen, die wie von tiefem Staunen und von tiefem, letztem Verstehen erfüllt waren, in die Absonderlichkeit der Erdenwelt starrte. Und die Frau Baumeister schäkerte mit dem Kind, preßte es an sich, wuschelte sich an das weiche Köpfchen, küßte es und blickte es dann wieder an, traurig und glücklich in eins. Aber das kleine Wesen ließ all das über sich ergehen und verzog nur hin und wieder zu einem leisen schmerzlichen Gegenlächeln den Mund. Es war wie ein Christkindlein auf alten deutschen Bildern, das auch immer so abgründig ernst dareinschaut, als wüßte es schon um all das Elend der Welt, das es auf seine kleinen schwachen Schultern genommen hat.
Und wie Fritz Eisner jetzt zu der Frau Baumeister hinüberblickte, da wurde es ihm plötzlich klar, wie hundertmal er doch Marienbildern – von frühchristlichen Elfenbeinen, mönchischen Buchminiaturen an bis zu Raffael und Michelangelo – betrachtet und in den Seminarien kunsthistorisch seziert hatte (Kind auf dem linken Arm oder auf dem rechten? Die starre romanische Gebundenheit setzt sich hier zuerst zaghaft in eine Antipostenbewegung der beginnenden Gotik um!), hundertmal betrachtet, beurteilt und besprochen hatte, ... und wie er dabei doch gar keine Ahnung von dem eigentlichen Sinn und Wesen des Marienbildes gehabt hatte. Wie so eine von Liebe, Glück und Angst durchseelte Bewegung einer jungen Mutter tausendmal mehr sagt als die schönsten Kommentare und Spitzfindigkeiten vor Photographien und in Museen, und eigentlich alles in Trümmer schlägt, was selbst das höchste menschliche Können danach sich zusammenbuchstabiert hat.
Herr Gott: die Frau Baumeister! – Fritz Eisner hatte sie noch nie gesehen und in letzter Zeit war auch ihr »Fliegenschmalz, Fliegenschmalz lülü lalaa« durch die Wand immer seltener, leiser und scheuer geworden – die Frau Baumeister war doch noch ein ganz junges Ding, sicher nicht älter als Annchen. Sie war sehr schlank und sehr anmutig, von der kühlen, silbrigen Anmut eines Seerosenblattes und mit großen, braunen, seitlich geöffneten Augen unter hohen, geraden Brauen, die nach den Schläfen zu sich verbreiterten; den Augen des achtzehnten Jahrhunderts, den Augen Bouchers und Tiepolos, Augen, wie sie das erstemal bei den Gespielinnen der Leda von Correggio in die laubgrüne Welt blicken. Ein schönes, großgliedriges Menschenwesen war es, mit kleinem Köpfchen auf schlankem Hals, ganz fertig und ganz scheu und schüchtern dabei: ein Mensch, der sehr früh Kummer gehabt hat und nun immer um sein bißchen bescheidenes Glück bangt.
Fritz Eisner verstand nicht recht, warum eigentlich Frau Luise Lindenberg stets so wenig freundlich von der Frau Baumeister sprach, sie eine gewöhnliche Person nannte und sagte, sie begriffe nicht, wie ein Mann wie der Baumeister sie hätte heiraten können – denn das wäre doch ein durchaus vornehmer Mensch. Das sähe sie auf den ersten Blick, wenn sie auch noch nie mit ihm ein Wort gewechselt hätte. Und außerdem hätten sie ja ein unglückliches Kind.
Nun ja, sie war wohl nicht aus so etwas, was man gemeiniglich ein Haus nennt, war wohl eher von ganz einfacher Herkunft: die Frau Baumeister. Aber es war doch über sie so viel weiche und liebenswürdige Anmut ausgegossen, so viel natürlicher Adel, daß man schon ziemlich hart über Menschen urteilen mußte, wenn man sich diesen Argumenten verschloß. Aber Frauen urteilen über Frauen ja immer ungerecht.
»O,« sagte die Frau Baumeister zu Hannchen mit einer weichen, sich wie entschuldigenden Stimme, »bei Ihnen wird so schön musiziert.«
»Das ist meine Schwester,« meinte Hannchen, »vielleicht kommen Sie ein wenig zu uns herüber« – denn Hannchen forderte jeden sofort auf. Aber obgleich Hannchen mit der Baumeistersfrau sprach, verwandte sie dabei keinen Blick von der Straße.
»O, wenn der kleine Schreihals hier zur Ruhe ist,« versetzte die Baumeistersfrau und wiegte das Kind auf den Armen hin und her, das gleich wie eine welke Blume das Köpfchen auf die Seite legte und die Lider vor die ernsten großen Augen zog. »Sie warten wohl auf Ihren Herrn Bräutigam?«
»Herr Bräutigam« sprach für Fritz Eisner ohne Kommentare. Er war im Bild.
»Ich warte auch auf den Herrn ... auf ... auf meinen Mann ... er hat geschrieben, er wollte kommen, aber er hat wohl zu tun. Und das ist der Herr Bräutigam von Ihrem Fräulein Schwester – nicht wahr?«
Hannchen stellte vor und Fritz Eisner verneigte sich. Povretta, dachte er. So etwas könnte man nun vierundzwanzig Stunden am Tag streicheln. Man wüßte gar nicht, was man sonst damit tun sollte.
Da kam Annchen heraus: wo sie blieben, es gäbe gleich Kaffee; sie hätte eigens vom Konditor Weiß noch Kuchen geholt. Bis zum Wilhelmsplatz wäre sie hereingelaufen, heute vormittag.
Die Frau Baumeister wollte zuhören, wenn sie spiele?
Sie solle auch zum Kaffee herüberkommen, und Annchen drängte sich an die hölzerne Scheidewand und versuchte, herumgreifend, das kleine Wesen zu streicheln, das schon in ruhigen Atemzügen ganz eingebettet in die Arme der Mutter – sie hatten sich weich wie ein Schmeichelwort um das Kind gelegt – in die letzte weiße Dämmerung seiner kleinen Kinderseele hinabgeglitten war. Denn Annchen hatte an Kindern ein rein subjektives Interesse, während das von Hannchen mehr objektiv und theoretisch war.
»Ach,« rief Hannchen, »seht mal, da unten kommt Lucie,« und zeigte auf eine kleine junge Dame, die mit einem grauen Staubmantel durch den Regen daherstapfte und mit einem Ledertäschchen nach oben winkte, als wollte sie sagen: »Freut ihr euch nun? Da bin ich!«
»Also, Frau Baumeister, Sie kommen dann gleich herüber,« rief Annchen und huschte herein, denn es galt, Frau Luise Lindenberg schonend auf Lucie vorzubereiten. Hannchen aber blieb auf dem Balkon und sah immer noch mit der gleichen halb ängstlichen Aufmerksamkeit wie vorhin auf die nasse Straße hinab.
Frau Luise Lindenberg, die jetzt die Zimmer dieses ominösen Doktors Meyer – wie war sie nur auf Martini gekommen? – mit zur Verfügung hatte, zeigte sich Lucie gegenüber umgänglicher, als Annchen und Hannchen erwartet hatten. Denn da Frau Luise Lindenberg, wie sie sich einredete, in ihrer Jugend eine unglückliche Liebe gehabt hatte, so brachte sie den Seelenschmerzen Lucies nachfühlendes Verständnis entgegen.
Lucie selbst bestand nur aus Augen und Löckchen. Alles an ihr war Augen und Löckchen, oder auf Augen und Löckchen gestimmt. Sie war sehr gut gekleidet, hatte Stil im Reden, in Mienen und Bewegungen und hatte auch einige Bildung, da sie mit ihrem dritten Freund – das heißt von rückwärts gezählt – (welche Zahl er erhielt, wenn man von vorwärts zählte, wußte niemand außer ihr selbst) – heimlich in allerhand Vorlesungen der Universität gelaufen war. Aber das schwamm nur obenauf wie ein paar unzusammenhängende Fettaugen auf einer Wassersuppe. Ihr Vater war nach ihren Aussagen ein Tyrann, ein verständnisloser Emporkömmling, der die Individualität seiner Kinder nicht achtete und sie mit seiner Rücksichtslosigkeit aus dem Hause trieb.
In Wahrheit war es ein kleiner, bescheidener Mann, dem sie tiefen Kummer bereitet hatte und immer wieder von neuem bereitete, der aber sie überreichlich mit Geld unterstützte und gleichmäßig freundlich blieb, was sie auch anstellte. Jetzt war sie für Befreiung der Frau aus dem Joche des Mannes, sagte, die Frau müsse einen Beruf haben, und war seit einem Jahr beschäftigt, sich einen solchen zu wählen. Da ihr das zu Hause unmöglich war, war sie vorerst in eine Pension gezogen. Sie schwankte noch zwischen Sängerin und Bibliothekarin. Frau Luise Lindenberg trug den unerquicklichen Verhältnissen im Elternhaus, unter denen das arme Mädchen litt, voll Rechnung.
Lucie hatte die Kunst, für jeden sein Gespräch in petto zu haben. Mit dem Mediziner sprach sie von Schutzimpfung, mit dem Maler von der Sezession, mit dem Ingenieur von Überlandzentralen oder Dynamomotoren, mit dem Architekten über Frührenaissance unter besonderer Berücksichtigung Pietro Lombardis, und den Bankbeamten fragte sie, was Terminhandel eigentlich sei. Und sie machte das so, daß sie zuerst ihre paar Kenntnisse als Köder auswarf, dann aber den andern reden ließ und, mit dem Kopf nickend, zuhörte, so daß der zum Schluß die Meinung hatte, daß sie doch eine sehr gebildete und interessierte Person sei, ... reizend, ... geschaffen zur Mitarbeiterin des Mannes ... ein ernstes Wesen und kein Durchschnitt ... kurz ein durchaus »wertvoller Mensch«; indem er ganz vergaß, daß sie ja eigentlich gar nichts gesprochen, sondern nur mit Augen und Löckchen Zustimmung genickt hatte. Bei dem nächsten aber hatte sie ihren Köder wieder um einige Bröckchen bereichert.
Fritz Eisner gegenüber hieß dieser Köder nun sofort Literatur. Und Lucie prasselte mit einem Feuerwerk von Namen gegen ihn los, wie ein Verlagskatalog; zum Ärger von Annchen, die die Absicht spürte, daß sie ausgestochen werden sollte, und die Lucie zu hassen begann; zur Freude von Hannchen, die es nur gerecht fand, wenn ihrem Schwager einmal bewiesen würde, wie ungebildet doch eigentlich ihre Schwester sei; und zum Entzücken von Fritz Eisner, der sofort begeistert einschnappte, Bücher empfahl, lobte, über Bücher verachtungsvoll absprach und tief bedauerte, nicht schon lange dieses feine, ästhetisch durchgebildete Mädchen näher kennengelernt zu haben.
Die Frau Baumeister aber saß dabei, angstvoll und verschüchtert, dankte für jedes Stückchen Kuchen und wagte nicht recht den Mund aufzutun. Denn d'Annunzio, Shaw, Gorki und was da alles umherflog, waren ihr böhmische Dörfer und nicht mal unter den Pferdenamen begegnet, auf die der Baumeister Geld setzte.
Nur wenn Hannchen sie belehrte, daß jetzt bald die geistige und Willenserziehung ihres Kindes zu beginnen habe, und Frau Luise Lindenberg sie tröstete und ihr versicherte, daß sie bei Hannchen, die auch nicht recht gedeihen wollte, mit Nestles Food und Doktor Amrains Knochennahrung die besten Erfahrungen gemacht hätte (natürlich gegen den Willen des Arztes; wenn sie auf den gehört hätte, hätte sie das Kind nie groß bekommen: »Und sehen Sie, da ist es, Gott sei Dank!«) – nur dann wagte sie schüchtern und lächelnd ein Wort einzuwerfen. Aber sie wäre ja eigentlich gekommen, um ein bißchen Klavierspielen und Singen zu hören. Das frische sie auf, und Fräulein Annchen möchte nachher noch etwas spielen.
Und dann setzte sich Annchen an das Klavier und schüttete das bunte Füllhorn ihrer musikalischen Erinnerungen aus, was ihr einfiel. Ihr Kopf war ein Notenschrank, aus dem man herausziehen konnte, wonach man Lust verspürte: Mendelssohn und Schumann, Griegs »Peer Gynt«, Tschaikowskys » Chanson triste«, Rubinsteins »Melodie« oder Offenbachs Ouvertüren – er lag ihr sehr – Straußsche Walzer und Nicolais »Lustige Weiber«, ... was man immer nur wollte an melodiösen Dingen.
Die Frau Baumeister saß in einem der abgenutzten Sessel des Salons – es waren, wie gesagt, Möbel mit Erlebnissen – und nahm ihre großen, halb schalkhaften, halb angstvollen Rokoko-Augen nicht von Annchens Händen, die mal langsam, mal schnell, mal wirbelnd über die Tasten tanzten. Sie hörte ganz still zu, während Frau Luise Lindenberg und Hannchen durch jahrelanges Training gewöhnt waren, das Spiel Annchens vollkommen zu überhören, und Lucie nach rechts und nach links irrlichterierte wie eine Maus in der Falle. Weiß der Teufel, was in ihrem kleinen und verderbten Köpfchen gerade vorging.
Fritz Eisner aber bedauerte, sein Gespräch mit diesem mitfühlenden Wesen vorerst nicht weiterführen zu können, denn er war gerade bei dem für ihn interessantesten Teil der modernen deutschen Literatur angelangt, bei seinen eigenen Werken – nicht etwa denen, die er geschrieben hatte (das wären nur halbmißglückte Versuche), sondern bei denen, die er noch zu schreiben gedächte.
Hannchen aber ging merkwürdigerweise hin und wieder an den Tisch, nahm einen Teller und trug ihn hinaus und verweilte bei der Rückkehr aus der Küche stets einige Augenblicke, wie um Luft zu schöpfen, auf dem Balkon. Was hatte sie nur? Sie hoffte wohl, daß Egi doch noch herauskäme, meinte Fritz Eisner. Und als es jetzt draußen schellte, fuhr sie mit einem leisen Schrei vom Stuhl auf.
Aber es war nur der Baumeister. Er entschuldigte sich wegen der Störung; er hätte drüben umsonst geklingelt und hätte sich gleich gedacht, daß seine Frau hier wäre; denn sie hätte Musik so gern.
Der Baumeister war ein großer, schwerfälliger Mann von vielleicht einigen vierzig Jahren, mit dem kleinen wolligen Kopf des Herkules Farnese. Er machte den Eindruck eines Menschen, der von jung an schwer körperlich gearbeitet hatte, und seine Hände waren groß, rot und mächtig, hatten wohl nie eine Reißfeder, einen spitzen Faberstift, sondern höchstens mal einen breiten Zimmermannsblei gehalten. Sein grobzügiges, gutmütiges Gesicht hatte den Ausdruck, wie man ihn bei einem Jungen findet, der in der Schule Sorgen hat und sich vor dem Zensurentag ängstigt, den auch die Lehrer nicht recht mögen, der aber bei seinen Mitschülern als verläßlicher Kamerad gilt. Er war ein einfacher Mann, das hörte Fritz Eisner, sowie der Baumeister den Mund auftat, ein Maurerpolier wohl, der jetzt selbst baute, irgendwie zu Geld gekommen war, oder von irgendeiner Terraingesellschaft geschoben wurde, so lange bis sie ihn fallen ließ; und der sich nun »Baumeister« nannte. Aber er wußte sich doch leidlich zu benehmen und vergaß nie »gnädige Frau« zu sagen.
Die Frau Baumeister aber – doch ein seltsames Paar, dachte Fritz Eisner –, die bisher von der kühlen, silbrigen Anmut eines Seerosenblattes gewesen war, wurde plötzlich wie eine Lotosblume von einem rosigen Lächeln überhaucht, und ihre eben noch traurigen großen Augen wurden ganz warm vor Glück. Es war reizend zu sehen, wie sie, trotzdem sie ganz, ganz ruhig im Stuhl blieb und dem Baumeister kaum die Hand reichte, doch diesem großen, schwerfälligen Menschen, mit allem, was sie war und hatte, entgegenflog und sich an ihn schmiegte. Man fühlte, so lange war das Zimmer für sie leer gewesen. Und auch der Baumeister suchte über alle fort ihre Blicke und streichelte sie mit den Augen, halb verzagt und schuldbewußt und halb froh, mit mehr Weichheit und Zartgefühl, als man diesem schweren, äußerlich etwas brutalen Manne zugetraut hätte. Es war ein stummes, unauffälliges Spiel zwischen ihnen, und man mußte schon ziemlich grobe Nerven haben, wenn man seinem Zauber verschlossen blieb.
Lucie überlegte eben, ob sie nicht mit ihrem Gespräch Nummer vier (Frührenaissance: Pietro Lombardi) den Baumeister attackieren sollte, und es wäre ganz lustig gewesen, denn der hätte gewiß sehr erstaunte Augen gemacht, von diesem merkwürdigen Kollegen zu hören, der noch vor der Erfindung der sechsten Hypothek, der Rabitzwände und des Schiebevertrages sich im städtischen Bauwesen ausgezeichnet hatte – als die Baumeistersfrau meinte, sie müsse jetzt hinübergehen und das Kind zur Nacht zurechtmachen.
Hannchen bat, ihr zeigen zu dürfen, wie man das in ihrem Kinderhort gehandhabt hätte: – »antiseptisch«. Annchen sagte, sie liebe Kinder; und Frau Luise Lindenberg meinte, sie könne vielleicht mit ihren Erfahrungen in der Kinderpflege – was man zu geben hätte, um dem Kleinen aufzuhelfen – der jungen Frau zur Seite treten. Lucie aber, die sich aus Kindern gar nichts machte, im Gegenteil sie als irreale Werte betrachtete, von denen es höchst peinlich sei, wenn man sie als reale Werte in Rechnung stellen müsse, blieb zurück. Und ebenso Fritz Eisner, der durch Geschlecht und Zivilstand als Bräutigam bei solchen Dingen vorerst durchaus noch ausgeschaltet war.
Fritz Eisner war teilweise erfreut und teilweise doch etwas bänglich berührt ob dieses plötzlichen Alleinseins mit Lucie. Es war leer im Zimmer, unheimlich leer und still. Und Lucie mit ihren Augen und Löckchen verstand es vorzüglich, solche Stille noch saugender und prickelnder zu machen, sie ganz mit den Ausstrahlungen ihres Wesens anzufüllen. Immerhin war Fritz Eisner der Meinung, mit der Fortsetzung des literarischen Gesprächs von vorhin – und es fehlte ja noch der wichtigste Teil: die eigene künstlerische Produktion – dieser etwas fatalen Stimmung Herr zu werden. Aber Lucie war durchaus der Meinung, daß jedes Ding an seinen Platz gehöre, und daß sich ein gesellschaftliches, vorbereitendes Gespräch keineswegs für eines unter vier Augen eigne. Und sie ermordete es also mit brüsker Hand schon im Keime.
»Ich bin sehr unglücklich,« sagte sie, stand auf, seufzte mit Mund, Augen und Löckchen und stellte sich vor Fritz Eisners Sessel. »Sie ahnen gar nicht, wie unglücklich ich bin,« fuhr sie fort, während sie sich mit halbem Körper so ganz leise auf eine Sesselwange (sagte ich nebenbei schon: es waren Sessel mit Vergangenheiten; davon bleibt etwas haften!) halb setzte, halb lehnte. Denn Lucie hatte eine köstliche Art, Männer, sowie sie mit ihnen allein war, verständnisvoll zu behandeln.
»O,« sagte Fritz Eisner.
»Sie glauben gar nicht, wie schwach ich bin.«
»Nein,« sagte Fritz Eisner.
»Mich müßte auch einmal einer nehmen und leiten, wie Sie es mit meiner Freundin Annchen tun.«
»Mein Wesen ist im Kern enklitisch,« – das war eine Reminiszenz an den dritten Freund von rückwärts gezählt – »ich brauche einen männlichen Geist, an den ich mich lehnen kann,« und damit rutschte Lucie langsam von der Sessellehne herunter auf Fritz Eisners Schoß.
»Wenn ich Ihnen meine Geschichte erzählte,« sagte Lucie und schob ihren rechten Arm hinter Fritz Eisners Nacken, »da könnten Sie auch ein Buch darüber schreiben.«
»Ich weiß nicht,« sagte Fritz Eisner.
»Man hat immer verständnislos an mir gehandelt. Und gerade die Männer, denen ich meine ganze Seele, denen ich alles gegeben habe, was wir armen Frauen euch geben können ...« Lucie brachte den Satz nicht zu Ende. Die Erinnerungen waren zu stark, sie überwältigten sie.
»Ich denke –« sagte Fritz Eisner, nicht ohne Befangenheit.
»O, nur einmal ganz still wie ein Kind in dem überlegenen Geiste eines Mannes ruhen können,« rief Lucie, und damit legte sie auch den anderen Arm fest um den Nacken Fritz Eisners, kuschelte sich an ihn und tat es wirklich.
Und da es ihr nicht gelang, Fritz Eisners Kopf zu sich herunterzuziehen, so zog sie den ihrigen in langsamem Klimmzug an ihm hoch und brachte Augen und Löckchen langsam in überaus verwirrende Nähe zu ihm. Alles Körperliche war für Lucie wohl nur ein Symbol für das Seelische.
Fritz Eisner kam sich ziemlich dumm vor. Die Lage war peinlich. Nicht etwa, daß er sich nicht als der überlegene männliche Geist fühlte, in dem Lucie ganz still wie ein Kind ruhen könnte; aber der Zeitpunkt schien ihm hierfür ebenso falsch gewählt wie der Ort. Und richtig, da hörte man schon draußen Schritte.
Lucie war im Augenblick von Fritz Eisners Schoß herunter, und alsbald hatte sie Mohrchen, das in der Ecke faul auf einem Kissen lag, gepackt und kugelte und zergelte und zog sich mit ihm im Zimmer herum, daß ihre Löckchen und Mohrchens Schlappohren nur so durcheinanderflogen unter Gebläff und Koseworten, ganz verjachert und atemlos, als ob sie überhaupt seit zwei Stunden nichts anderes getan hätte; während Fritz Eisner ganz vertieft einen Artikel in der Sonntagsbeilage der »Voß« über die Hochzeitsgebräuche der Kamtschadalen und Tungusen las. Auf einer hohen sittlichen Stufe schienen beiläufig, wie der Verfasser schamhaft andeutete, in diesen Dingen weder die Kamtschadalen noch die Tungusen zu stehen. Feine Leute waren das anscheinend nicht.
Annchen aber kam zu Fritz Eisner und tippte ihn auf die Schulter.
»Hör' mal,« sagte sie mit etwas veränderter Stimme, »könnte ich dich mal einen Augenblick allein sprechen?«
Fritz Eisner folgte Annchen sehr bedeppert in das Nebenzimmer, wo im fahlen Halblicht die Betten geisterten. Also wirklich, er war doch ganz unschuldig dazu gekommen. Das mußte Lucie ja bezeugen können.
Aber Fritz Eisner kam gar nicht dazu, sich in wohlgesetzter Rede zu verteidigen, denn Annchen sagte:
»Du tätest mir einen großen Gefallen, wenn du mal Hannchen einen Augenblick begleiten wolltest. Es will sie da jemand sprechen, und ich möchte sie mit diesem Menschen nicht allein lassen.«
»Wer ist es denn?«
»Ach Gott, weißt du, es ist ein Jugendfreund von Hannchen« (Hannchen hatte deren ja ein ziemlich reich assortiertes Lager), »und möglich, daß Hannchen ihm wirklich versprochen hat, ihm treu zu bleiben, bis er so weit ist, daß er sie heiraten kann; möglich, daß dieser verrückte Mensch sich das nur einredet; aber nun hat er depeschiert, er käme heute abend, und sie solle ihn erwarten. Und wenn sie nicht käme, würde er sich etwas antun. Und da muß doch Hannchen zu ihm heruntergehen. Und eben hat er schon ein Kind mit einem Zettelchen heraufgeschickt. Hannchen ist sehr unglücklich. Sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Wenn sie nicht geht, schießt er sich vielleicht tot; – und wenn sie geht, schießt er sie vielleicht tot. Aber sie hat gesagt: sie geht.«
»Ist denn das immer noch der Heinrich Heine redivivus von neulich?« fragte Fritz Eisner.
»Wo denkst du hin?« rief Annchen lachend, »der hat sich ja letzten Montag mit Emmchen Liebmann verlobt, und heute steht's schon richtig in der Zeitung.«
»Ließe sich das mit dem Herrn da unten nicht vielleicht brieflich abmachen?« meinte Fritz Eisner unschlüssig. Er hatte eine tiefgehende Abneigung gegen Revolver.
»Das habe ich ja Hannchen auch gesagt,« meinte Annchen, »aber sie will nicht. Sie behauptet, es wäre ihre Pflicht, diesem Menschen Rede und Antwort zu stehen. Und du weißt doch, wenn Hannchen sich mal so etwas in den Kopf gesetzt hat, dann redet sie sich in solche Sache so hinein, daß man weder mit Gutem noch mit Bösem bei ihr etwas ausrichten kann.«
»Aber was soll ich denn dabei tun?« meinte Fritz Eisner unsicher. (Zu was man doch alles kommen kann, wenn man Bräutigam spielt.)
»Meine Schwester schützen!« rief Annchen mit Nachdruck.
»Also gut,« meinte Fritz Eisner, »dann werde ich Hannchen schützen!«
Und er suchte sich auf dem Flur seinen dicken Eichenstock mit der langen Eisenspitze, der noch aus seiner Turnerzeit stammte, ihn sonst nur auf nächtlichen Wanderfahrten begleitet und nun hier draußen für Wege über Land eine Unterkunft gefunden hatte. Den aber nahm er fest in die Faust.
»Ach Gott,« rief Hannchen draußen und reckte sich, »ich bin den ganzen Tag heute nicht an die Luft gekommen. Ich halte das nicht aus. Ich muß noch ein bißchen heruntergehen bis zum Abendbrot. Ich bin bald wieder da. Kommst du mit, Annchen?« Diese Frage war rhetorisch gemeint, indem Hannchen keine Antwort erwartete. »Na, dann begleite du mich ein bißchen, Fritz? – ja?«
»Aber kommt bald wieder,« meinte Annchen, »denn ihr wißt ja, Muttchen wird sehr ungnädig, wenn die Kartoffeln kalt werden.« Und Annchen sah den beiden mit einem traurigen Blick nach, denn sie wußte ja gar nicht, ob sie sie nicht nur noch in ramponiertem Zustand wiedersehen würde.
Hannchen lenkte ihre Schritte ziemlich gerade über die Straße fort ihrem Schicksale entgegen, nach dem gußeisernen und quietschenden Parktürchen, und patschte unbekümmert ? trotzdem die sprühende Nässe von oben schon genügt hätte ? mit ihren kleinen Halbschuhen durch die Wasserlachen, die reichlich auf dem Wege standen ... wie ein Soldat auf dem Marsche, der weiß, daß es drei Tage Kasten gibt, wenn er einer Pfütze etwa feige und unmilitärisch ausweicht. In Hannchens Antlitz bebte unter der Maske heroischer Entschlossenheit eine nur schwer verhaltene Erregung. Aber da Hannchen Sensationen liebte und jegliche Art Aussprache aus einem seelischen Bedürfnis heraus stets suchte und herbeisehnte, so war ihr das nicht einmal unangenehm. Man konnte, wie Jacobsen in »Niels Lhyne« von der Frau Boje sagt, auch von Hannchen sagen: eigentlich liebte sie Szenen! Was sie zu Fritz Eisner in Gegensatz brachte, der Szenen haßte.
Drüben hinter dem Parktürchen ging ein verregneter junger Herr mit einem verregneten Strohhut mit großen Schritten und Gesten auf und nieder. Er war ein harmloses kleines Individuum, überaus dürftig körperlich, und Fritz Eisner bedauerte, den eisenbeschlagenen Knüppel mitgenommen zu haben. Das sah so nach Angst aus. Immerhin, man müsse ihn vielleicht doch unschädlich machen, um ihm die Mordwaffe zu entwinden.
»Gestatte, daß ich dir meinen Schwager vorstelle: ? Herrn Fritz Eisner,« sagte Hannchen und schnitt damit die schöne Rede ab, die der verregnete junge Mann mit dem verbogenen Strohhut, von dessen der Form einer Acht angeähnelter Krempe es sacht kluckernd tropfte, sich soeben zum siebenten Mal halblaut hergesagt hatte. Schwäger aber waren in seinem Voranschlag nicht mit einbegriffen gewesen und waren angetan, ihn vollkommen umzustoßen.
Der Name Fritz Eisner war dem jungen Herrn nicht fremd. Denn es ist merkwürdig, daß junge Kerle, die versuchen, die verrammelten Tore der Literatur sich aufzustoßen, und von denen sonst kein Mensch auch bisher den Namen gehört hat, von ihresgleichen immer gekannt und beachtet werden. Und auch Fritz Eisner erinnerte sich, von jenem gehört zu haben und den Namen Johannes Hansen ? es war ein Pseudonym für einen Namen, der aus weit südlicheren Ländern stammte ? vernommen zu haben ... als von einem etwas wirren jungen Herrn, der, von vielem Idealismus erfüllt, irgendwo in Süd- oder Westdeutschland mit Hilfe eines Druckers (der ihn mörderlich übers Ohr hieb und ihm tausendmarkscheinweise sein väterliches Erbe für dünne, schlechtgedruckte grüne Heftchen aus der Tasche zog) eine Zeitschrift herausgab, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Kultur zu fördern, und die dieser Aufgabe dadurch gerecht zu werden glaubte, daß sie alle vierzehn Tage, also in jeder Nummer, mit einem neuen Programm und mit Kulturmanifesten, in denen viel von der gärenden Zeit gesprochen wurde, sich an die harmlose Menge wandte ... ein Programm, das sich ? wie die meisten ihrer Art ? weniger durch Klarheit der Ziele als durch eine trunkene Überschwenglichkeit des Stils auszeichnete, der zum Selbstzweck geworden zu sein schien.
Und der kleine verregnete Herr stand also nun vor Fritz Eisner, schüttelte ihm kommentmäßig die Hand und erklärte, er wäre, wie er versichere, eigens die Nacht über aus Frankfurt am Main heraufgereist, um sich Klarheit zu schaffen, wie es um Hannchen und ihn stände.
Und Johannes Hansen bemerkte nun würdig ? im Glacéhandschuhton, jeder Zoll ein Kavalier ?, daß es ihm lieb wäre, wenn er einen Augenblick Fräulein Hannchen Lindenberg unter vier Augen sprechen könnte, da er einige über Sein und Nichtsein entscheidende Fragen an sie zu stellen habe. Fritz Eisner entgegnete ebenso, daß er das nicht zugeben könnte, und sah sich schon ohne Hannchen zurückkehren, während die bestürzte Frau Luise Lindenberg und Annchen weinend in seine Arme sanken ... als wider Erwarten Hannchen mit der Miene eines geschulten Duellanten ihn bat, einen Augenblick beiseite zu treten, da sie diesem Herrn durchaus Rechenschaft schuldig wäre.
Also ? was blieb Fritz Eisner anderes übrig, als einige Schritt von den beiden Aufstellung zu nehmen und, den Stock fest in der Hand, im Halbdunkel unter tropfenden Bäumen auf den Augenblick zu harren, wo der alias Johannes Hansen sein grauses Mordwerk beginnen würde. Jedenfalls hatte er sich rechts von ihm gestellt, um zuzuspringen und den Arm hochzuschlagen, wie er das immer so schön auf den Umschlägen der Nick-Carter-Hefte gesehen hatte: »Hallo, alter Freund,« rief der berühmte Detektiv jovial und schlug mit Blitzesschnelle den Browning des roten William nach oben, » goddam, das hätte beinahe jemand treffen können!«
Aber der Johannes Hansen tat zwar nichts desgleichen, war aber, soweit Fritz Eisner hörte, sehr wortreich, wenn sich auch Fritz Eisner, der nur Brocken des leisen Gesprächs vernahm, kein rechtes Bild machen konnte, um was es sich denn eigentlich drehte. Denn es vertrug sich doch nicht recht miteinander, wenn Johannes Hansen erst in tiefer Zerknirschung bemerkte, daß er stets gewußt hätte, daß er Hannchens unwürdig wäre, und dann in gleichem Atem emphatisch ausrief, daß er Hannchen verachte. Und ferner fand Fritz Eisner die Anrede »Ungetreue« etwas theatralisch. Auch schien es ihm nicht klar, warum Hannchen mit tränenerstickter Stimme feststellte, daß das Schicksal stärker sei als sie; ? etwas, das keineswegs besonders neu ist und jeder auf sich anwenden kann ? und dabei ihren rechten Arm traurig auf alias Johannes Hansens Schulter legte, den dieser mit brüsker Bewegung abschüttelte, nur um mit wilder Glut im nächsten Augenblick Hannchens Hand zu ergreifen und an seine Brust zu pressen. Er sagte etwas von: »höhnend dein Andenken aus dem blutenden Herzen reißen« und dann: »nie vergessen können, was du meinem Leben bedeutet hast«; während Hannchen etwas von »glatter Lebensrechnung« sprach, und wünschte, man möge » ihr nie etwas vorzuwerfen haben« (was zweifelsohne etwas viel fordern hieß), und des weiteren der Hoffnung Ausdruck gab, er würde »ihr Bild in Reinheit bewahren«.
Von Hannchens Bräutigam Eginhard Meyer hatte dieser alias Johannes Hansen aber – genau wie Heinrich Heine redivivus – eine wenig gute Meinung. Was sie nur alle gegen Egi Meyer hatten! Aber er nannte ihn einen »chronischen Analphabeten« und gleich darauf einen »Kulturkretin von bourgeoiser Dünkelhaftigkeit« (das war ungerechtfertigt und zu viel!) und bemerkte fürder, daß es nur »wahnsinnige Verblendung« sein könnte, wenn man Eginhard Meyer einem Manne wie ihm vorzöge. Dann spielte er den unbekannten, grauen Fremden aus der »Frau vom Meer« ? was ihm nicht mißlang, denn er sah wirklich wie aus dem Wasser gezogen aus ? und erklärte, daß heute nacht elf Uhr siebenundzwanzig Minuten sein Zug noch nach Frankfurt am Main zurückführe; und er stellte Hannchen vor die Entscheidung, ob sie ihm aus freier Entschließung für dieses Leben folgen wolle oder nicht.
Was Hannchen leise, traurig, aber bestimmt ? sich auf die Pflichten ihrem Bräutigam gegenüber berufend ? ablehnte.
Das wäre der kritische Augenblick, meinte Fritz Eisner und trat unwillkürlich einen Schritt näher, wie er das immer auf den Amschlägen von Nick-Carter gesehen hatte: » Good evening, old boy.«
Aber Johannes Hansen meinte, kühl und wieder ganz Weltmann, daß er dann Hannchen nichts mehr zu sagen hätte; was nun Hannchen wieder nicht wahr nehmen wollte, sondern sich bei ihm einhing und meinte, daß ihre seelische Freundschaft davon unberührt und für ihr späteres Leben erhalten bleiben müsse.
Alias Johannes Hansen aber begann, langsam zum dämmrigen Park hinauswandernd, zu Fritz Eisner von den Kulturaufgaben seiner Zeitschrift zu sprechen. Er würde sich freuen, ihn im Kreise seiner Mitarbeiter begrüßen zu können, vorerst mit Berichten über die Ereignisse im hiesigen Kunstleben ... unter besonderer Berücksichtigung südwestdeutscher Künstler.
Und händeschüttelnd und unter dem Ausspruch gegenseitiger Hochachtung nahm man befriedigt voneinander im Regen Abschied, nicht ohne daß Fritz Eisner noch einmal diskret zur Seite trat und in andere Richtung blickte, um Hannchen und alias Johannes Hansen das Wort, oder was sie sonst noch wollten, zu einem letzten Lebewohl zu geben. Alle drei kamen sich in diesem Augenblick sehr groß vor.
Als sich aber Fritz Eisner wieder umdrehte, da leuchtete schon die geschweifte Krempe des Strohhuts des Johannes Hansen in der dämmrigen Ferne der Straße.
Hannchen aber war ganz vergnügt, frisch und munter. Diese Aussprache, sagte sie, hätte ihr wohlgetan. Nun hätte sie mit allen, aber auch mit allen, eine glatte Rechnung, und nichts mehr könne sie von dem Wege abbringen, den sie zu gehen hätte.
Da aber die Zeitschrift mit der übernächsten Nummer ihr Erscheinen einstellte (Frau Jakob, der Mutter von Johannes Hansen, war die Sache doch zu dumm geworden, und sie sperrte mit Hilfe eines Gerichtsbeschlusses ihrem Sohne die Gelder), so sah Fritz Eisner leider nie die Früchte seiner Bemühungen um die südwestdeutsche Kultur, die aus diesem Grunde vielleicht noch heute etwas im argen liegt.
»Wo seid ihr denn so lange bei dem Regen gewesen?« rief Frau Luise Lindenberg, »die Kartoffeln sind schon ganz kalt.«
»O, es ist sehr schön unten,« rief Hannchen, »es war eine wundervolle Luft.«
Aber Frau Luise Lindenberg war mißgestimmt. »Kalte Kartoffeln« war das Stichwort, auf das sie unausstehlich wurde. Und sie sprach von der armen kleinen Baumeistersfrau, die ihrer Meinung nach eine ganz gewöhnliche Person sei und das Kind in unverantwortlicher Weise vernachlässige.
Und als Annchen einwarf, daß doch fast alle Tage der Arzt zu dem Kleinen käme, rief Frau Luise Lindenberg mit Emphase: daß ein Arzt niemals die Liebe einer Mutter ersetzen könne. Und damit ging sie deklamatorisch in das Gebiet des Sentimentalischen über und plätscherte wohl- und selbstgefällig darin umher: sie hätte auch ihr Leben sich anders gestalten können, wenn nicht eben die Rücksicht aus ihre beiden Kinder ... und so weiter, und so weiter.
Lucie aber, mit ihren Augen und Löckchen, lag Hannchen im Arm. Fritz Eisner mit seinem überragenden Geist des Mannes schien für sie nicht mehr vorhanden zu sein. Als er aber bat, Annchen möchte noch etwas spielen, wurde er überstimmt. Man hätte genug Musik heute gehört, und so gingen Fritz Eisner und Annchen auf den Balkon hinaus unter das improvisierte Regendach und blickten zusammen über den dunkeln, dampfenden Park mit seinen sich leise in sich rührenden Laubmassen hinweg. Hin und wieder wimmerte ein Waldkauz in der Ferne, und ein Vogel zwitscherte drüben im Schlaf. Für Nachtigallen war es wohl zu kühl heute.
Wo die Schlösser lagen, war ein Lichtschein, und die abgerissenen Klänge einer altmodischen Militärmusik schwirrten in Abständen, monoton sich immer wiederholend, herüber, die Töne irgendeines seltsam-primitiven und doch zwingenden Marsches, unter dem vielleicht einst friderizianische Bataillone in die feuerspeienden Spontons russischer Stellungen gelaufen waren, und der manchem gewiß schon zum Trauermarsch geworden war – ehern, urtümlich in seinen harten Tonbildungen, und den man doch nie vergessen konnte, wenn man ihn einmal gehört hatte.
Auf der andern Hälfte des eisernen Vogelnestes sprachen ganz leise und scheinbar sehr bekümmert der Baumeister und die Baumeistersfrau. Die Baumeistersfrau schien sogar zu weinen. Sie hatte wohl Sorge um das Kind, das ja nicht gedeihen wollte, meinte Fritz Eisner. Ach nein, sie sprachen ja von etwas anderem. »Und was hat denn nun deine Frau da gesagt?« schluchzte die Baumeistersfrau.
(Gott – das arme Ding!)
Dann aber wurde nebenan die Tür geschlossen, und man hörte das Rascheln sich vorziehender Gardinen. Für ein Brautpaar aber ist es nicht angenehm, wenn nebenan ein Ehepaar die Fenster schließt und Nacht macht. Nein, angenehm ist das nicht.
»Hör' mal, Fritz,« sagte Annchen, »fahr' lieber mit dem nächsten Zug! Du kommst mit dem letzten Zug wieder so spät nach Hause, und Mutti ist schlechter Stimmung. Da ist es am besten, sie kommt früh zu Bett. Wir haben es nachher nur auszubaden. Und wir müssen auch noch Lucie unterbringen. Immer Hannchen mit ihren abscheulichen Freundinnen. Ich mache mir gar nichts aus Lucie.«
Und Fritz Eisner ging hinein, um sich zu verabschieden.
Nein, Annchen solle aber bei dem Regen ja nicht mit zur Bahn gehen, rief Frau Luise Lindenberg; sie neige sowieso zu Erkältungen.
Dann also auf Wiedersehen.
Unten im Halbdunkel neben dem Haus an der Gartentür, dort wo es von den Bäumen bung, bung, bung, bung auf die vier Laubendächer tropfte – der Regen selbst hatte inzwischen seine Tätigkeit eingestellt – standen die Kapitänswitwe und Doktor Fischer. Sie schienen eine sehr erregte Auseinandersetzung gehabt zu haben. So etwas merkt man an der Art des Schweigens.
»Und ich kann dir ja den Brief der Frau Major von Dorgelow morgen zeigen, wenn du es nicht glaubst,« sagte die Kapitänswitwe etwas schrill. »Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ich muß auch noch zur Apotheke, bevor ich zu ihr gehe.«
Und damit wandte sich die Kapitänswitwe, ging fort und ließ den Doktor Fischer stehen, ohne sich noch einmal nach ihm umzublicken. Sie war wohl eine etwas energische Dame.
Fritz Eisner aber zog den Hut, um an Doktor Fischer vorbei auf die Straße zu gelangen, der da mit breiten Schultern und dem mächtigen Kopf, von dem die Haare lang herabhingen, wie immer in seinem langen halboffenen Flauschmantel und seiner Samtweste schwerfällig und melancholisch im Halblicht stand.
»Sie gehen zur Bahn vor,« sagte er müde. »Sie haben noch Zeit, junger Freund. Ich werde ein Stück mitkommen. Wer spielt bei Ihnen so hübsch Klavier?«
»Das ist meine Braut,« sagte Fritz Eisner mit mehr Stolz, als wenn er es selbst wäre.
»So? Sie wollen heiraten? Sie haben Mut.«
Fritz Eisner lachte.
»Ja, die Ehe ist ein Arbeitshaus für den Mann, eine Leibrente für die Frau und eine Futterkiste für die Kinder. Wozu wollen Sie ins Arbeitshaus gehen?« Er sprach so ernst, monoton, knurrend und schwer, wie er selbst war.
»Aber, wenn man eben ein Mädchen so gern hat, daß man ...«
»Ich habe noch keine Ehe gekannt, die gut war. Entweder ist die Frau tüchtig, gescheit, modern, dann geht die Ehe kaputt. Oder sie ist es nicht, dann geht der Mann kaputt.«
»Aber es heiraten doch trotzdem immer wieder ...«
»Das beweist doch nur, daß die Menschen unverbesserlich sind. Alle großen Dinge dieser Welt, an die sie glauben, sind doch ein Bluff und ein fauler Schwindel, wenn man dahinterkommt. Das werden Sie auch noch sehen, junger Freund. Die Wissenschaft ist eine euphemistische Umschreibung für die menschliche Unkenntnis. Das Vaterland ist ein von den Regierungen erfundenes Ammenmärchen.«
»O,« rief Fritz Eisner ungläubig. Er verachtete zwar alle Politik, aber das stimmte wohl doch nicht so ganz.
»Ja, das einmal so und einmal anders erzählt wird, je nach Nützlichkeit. Die Erwachsenen unterscheiden sich von den Kindern gerade durch den Mangel an Anteilnahme für die wirklich erlebenswerten Dinge des Daseins; Mangel an gutem Willen und Mangel an Anständigkeit der Seele ... das sehe ich täglich vor mir ... und durch ein Übermaß an all jenen Gaben, die sie den Kindern abzuerziehen versuchen. Die meisten Erwachsenen sind einfach entgleiste Kinder. Die Liebe jedoch ist eine Mausefalle. Wenn man endlich mal herauskommt aus ihr, ist man müde und weh, nur noch eine einzige schrindende Wunde. Die Ehe aber frißt einen Mann stückweise auf. Sie ist einfach dem Tod gleichsetzen. Das einzig Versöhnliche an der Ehe ist, daß der Mann meist vor der Frau stirbt.«
»Sie ermuntern mich gerade nicht, Herr Doktor.«
»Was sind Sie doch?« meinte Doktor Fischer, in seiner schwerfälligen Art ganz langsam dabei einen Fuß vor den andern setzend.
»Ich bin Schriftsteller.«
»Sie haben studiert, Herr Eisner?«
»Ja, ich habe mich besonders mit Kunstgeschichte ...«
»O, das ist schön.« Fritz Eisner sah, wie die schwarzen großen Leonberger Augen Doktor Fischers Feuer bekamen. »Man sollte für den Denkmenschen, den sich auf sich selbst besinnenden Schreiber Klöster bauen, hochgelegen, mit einem Blick über Wälder, Flüsse und Städte fort. Sie können dort hingehen, aber sie können auch jede Minute wieder in die Welt zurückkehren. Zellen müßten die Klöster haben. Refektorien, Bibliotheken, Kreuzgänge und Gärten, Gärten vor allem. Frauen wäre jeder Zutritt verboten ... aber jede Zelle müßte eine Hintertür haben, eine ganz geheime Hintertür, die zu einer ...«
Doktor Fischer schwieg. In der Ferne hörte man den Zug heranbrausen. Er heulte immer wie eine Sirene durch das letzte Stückchen Wald. Sie waren noch weit vom Bahnhof.
»Ich muß mich aber sehr eilen, wenn ich den Zug noch –«
»Lassen Sie nur, junger Freund, Sie bekommen ihn doch nicht. Den nächsten bekommen Sie dafür sicher. Wozu wollen Sie eine komische Figur werden? Der Mann, der den Zug versäumt, ist immer eine komische Figur. Sehen Sie mich an! Kommen Sie! Gehen wir noch!«
Also, es war wirklich zu spät für den Zug. Fritz Eisner hätte nur allein eine Stunde auf der Bahn warten müssen. So hatte er wenigstens Gesellschaft.
»Sie machen sich wohl auch nicht viel aus Büchern?« begann Doktor Fischer wieder. »Das tun die meisten, die bildende Kunst lieben. Ich finde, die jeweilige Literatur ist vor allem der Dolmetscher für die Erotik ihrer Zeit. Alles andere kommt für sie erst in zweiter Linie. Und das ist mir eigentlich zu wenig.«
Aber Doktor Fischer solle doch nur an die Großen von heute denken, an Tolstoi und Ibsen mit der Vielseitigkeit ihres Weltbildes; an Goethe oder etwa an Schopenhauer, was sie uns geben.
»Ob das wirklich so viel ist?« meinte Doktor Fischer und blieb stehen und atmete in tiefen, hörbaren Zügen zwischen den Sätzen. »Mit den meisten Großen geht es doch dem Bewunderer, wie es Faust in der Walpurgisnacht geht, als die nackte Schöne mit geschlossenen Füßen an ihm vorübertreibt und er meint, es wäre sein Gretchen – denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor. Jeder findet sich nur in seinen Großen wieder, sucht sich ein Eckchen, ein Winkelchen, einen Ausschnitt von ihm. Seinen Goethe, seinen Nietzsche, seinen Schopenhauer, und auch dieses Winkelchen formt er noch nach seinem Bilde. Und kaum einer fühlt, daß da nackt und unverhüllt die uralte, geheimnisvolle, tausendspältige Lilith an ihm vorübergezogen ist, die den Kopf auch unter dem Arm tragen kann. Denn eigentlich kennt unser Leben ja doch nur eine Frage. Der junge Mensch stellt sie, der Mann stellt sie, und der Greis stellt sie. Es ist immer die gleiche Frage; nur der Ton, mit dem wir sie vorbringen, ändert sich. Je näher wir der Antwort kommen, desto leiser und unsicherer wird er.«
»Aber,« warf zaghaft Fritz Eisner ein (diesem Mann steht doch das Wort seltsam zur Verfügung: das muß auch einer vom Bau sein!), »unsere Dichter ...«
»Nennen Sie Dichter die, die Bücher schreiben und Verse machen?« rief Doktor Fischer in die Nacht hinaus. Sie waren jetzt über den Bahnhof hinausgekommen und gingen auf der Landstraße, die in die Dunkelheit führte. »Sie glauben wohl auch, wie die meisten jungen Menschen, daß Dichten darin bestände, daß man Verse mache? Sie halten sich wohl auch für einen verhinderten Goethe?«
»Ich mache keine Verse,« sagte Fritz Eisner trotzig.
»Ich habe eigentlich nur einen Dichter kennengelernt in meinem Leben,« rief Doktor Fischer (was erregte den Mann nur so?), »das war ein Dachshund. Ich hatte da in der Gärtnerei eine Hündin, ein hübsches Luder, aber sie taugte nichts. Und immer brannte sie durch des Nachts, und immer mußte man irgendwelche Spitze oder Doggen mit Stöcken aus der Gärtnerei jagen und alle paar Tage mal die Löcher flicken, wo sie durch den Zaun krochen. Nur ein Dachshund lag Tag für Tag draußen – verstehen Sie, draußen auf der Straße – matt, müde, melancholisch, ungepflegt, mit hängenden Ohren, ein ziemlich altes Tier schon. Immer wenn ich vorbeiging, kam es herangekrochen, wedelte und ließ sich bemitleiden und sagte mit den Augen: Schicksalsgenosse! Das ist der einzige Dichter, den ich je kennengelernt habe.«
Fritz Eisner verstand zwar nicht, was jener Doktor Fischer eigentlich damit meinte, aber ihn begann dieser unheimliche, unglückliche Mann zu interessieren. Der Literat in ihm wurde hellhörig. Das war ja geradezu eine »Figur«.
»Welch eine Narrheit eigentlich,« rief Doktor Fischer und blieb wieder stehen. »Wir streiten um Höchstes, um Besitz, um Erkenntnis, um den Kitzel der Kunst und gehen an dem Tier in uns, an der Unmöglichkeit, das Leben ohne jenes andere Tier mit den langen Haaren, das von allen jenen Dingen nichts weiß, zu ertragen, daran gehen wir zugrunde.«
Fritz Eisner (er wußte ja noch sehr wenig vom Leben: kaum ein paar Zitate und Randbemerkungen) hatte das unabweisbare Gefühl, als ob das, was dieser etwas skurrile Herr da vorbrachte, in irgendeinem unklaren Zusammenhang mit der Kapitänswitwe stehen müßte.
»Sie haben Ihre Braut aufrichtig gern, nicht wahr?« rief Doktor Fischer, »und wie könnten Sie auch jetzt schon verstehen, daß man eine Frau bis zur Raserei lieben und bis zum Ekel dabei verachten kann! Ich wünsche Ihnen, daß Sie es nie verstehen lernen. Gott ja, zum Schluß liegt es wohl in uns, daß wir das hassen müssen, was wir anbeten. Gott ja, Gott ja, ich begreife: es ist wohl Apachenart, einem ins Gesicht zu treten, wenn man ihn niedergestochen hat. Aber ein anständiger Mensch begnügt sich doch eigentlich damit, den anderen einfach hinterrücks niederzustechen.«
Doktor Fischer schwieg. Eine ganze Weile ging er dann stumm, schwarz und schwer neben Fritz Eisner, der auch nicht recht wußte, was er sagen sollte. Endlich war der Mann da neben ihm doch fünfundzwanzig Jahr älter als er. Vielleicht war er auch noch gar nicht so alt, war nur ein früh gealterter Mensch. Das empfand Fritz Eisner. Aber sie konnten doch nicht zueinander, wenn auch Fritz Eisner so dumpf etwas fühlte und verstand von dem, was da in dem drüben vorging. Denn Gefühl ist ja die unter dem Bewußtsein sich vollziehende Denkäußerung der Seele. Nein – sie konnten nicht zueinander, denn man kann nicht über zwei Jahrzehnte springen.
»Man will doch saubere Finger haben. Ich bin gegen Mord. Nur einen Mord könnte ich begreifen.« Das aber sagte Doktor Fischer mehr für sich als zu seinem Weggenossen.
Fritz Eisner spitzte die Ohren. »Sie sollten sich losmachen und fortreisen. Sie sind doch unabhängig.«
»Ich reise nur noch einmal ... nach Hamburg ... bevor ich den Rest meines Daseins in einer Konservendose verbringe, nicht viel größer als eine solide Zweipfundpackung von Stangenspargel ... Es gibt in Geschäften, die Bettfedern verkaufen, solche Glastrommeln, die immer rundherum gehen und die Federn sinnlos durcheinanderwirbeln. Davor bleibe ich stets stehen. Das ist das Leben. Man wird sinnlos herumgeschleudert, bis man liegen bleibt. Und dabei nehmen wir uns doch so unendlich wichtig, wie Kinder, die Mühlräderchen im Bach bauen und sich und andere glauben machen, sie brächten wirklich etwas zuwege. Kennen Sie das Wort: ›Wer sich der Einsamkeit ergibt, ach, der ist bald allein?‹«
»Ja, gewiß,« lachte Fritz Eisner.
»Ach nicht, daß Sie es gelesen haben und wissen, wo es steht; das weiß jeder Backfisch. Ob Sie es verstanden haben? Der Begriff der Zeit ist ein anderer, wenn man allein ist, als wenn man zu zweien ist oder mit vielen zusammen. Aber den Morgen einsam in der Gefängniszelle eines Hotelzimmers in einem Hotelbett erwachen, zwischen hundert Menschen, die man nicht kennt, und wenn der Regen dann noch gegen die Scheiben trommelt, ebenso gut könnte man schon in seinem Grab liegen.«
»Sind Sie viel gereist, Herr Doktor?« sagte Fritz Eisner. Er fühlte, das Gespräch hatte den Berg überschritten und wandte sich langsam zur gleichmäßigen Ebene.
»O ja, aber ich reise jetzt anders. Wenn ich in meinem Warmhaus ein Adiantum – Sie kennen Pflanzen? – oder irgend solch ein exotisches Farren zur Hand nehme und es betrachte, und nachher zu meinen Chrysanthemen hinübergehe, dann bin ich durch hunderttausende von Jahren gereist. Früher war ich viel in Italien, und ich denke sehr oft daran. Aber ich möchte es nicht mehr wiedersehen. Wenn ich Dichter wäre, würde ich ein Gedicht machen auf die Mädchenköpfe, die in Italien von Mori an bis nach Syrakus auf den Bahnhöfen oben aus den Fenstern sehen. In dem kleinsten Nest, überall eins oder ein paar, und immer andere. Nie daß eine dein Lächeln erwidert. Sie beachten dich nicht; sie beachten niemand. Aber sie sehen jeden. Sie sind alle verschieden. Und sie sind meist sehr jung. Ich möchte wissen, was in ihren Köpfen hinter den hohen Stirnen da ist. Oder ich möchte ein Gedicht schreiben auf einen melancholischen Abend bei Messina, wie so langsam sich das Trajekt vom Hafen löst und drüben die Küste sucht, während die Reihe von Palästen vor uns in das Nichts zurückgleitet. Ja, ich möchte einmal doch wieder das Museum in Neapel sehen. Ich möchte nicht Hinreisen, ich möchte da sein. Alle anderen Museen der Erde sind endlich nur ein paar letzte verklungene Töne einer verhallten Zeit. Das ist noch eine ganze Welt: mit seinen Bronzen, Marmorbildern, Fresken und Mosaiken; und es gibt nichts, das über sie hinausreicht.«
Wundervoll, das war ja ein Kunstgespräch! Und Fritz Eisner hakte erleichtert ein.
Wirklich, er könne das kaum glauben. Wie seltsam – ob ihm das einmal aufgefallen – überhaupt das Gefühl in den Dingen der Kunst: Es gibt etwas, das über sie hinausweist. Was wir gerade sehen, lesen, hören, ist nicht das Letzte, das Vollendetste. Woraus schließen wir das? Haben wir in uns die Vorstellung des Diamanten? Wissen wir von Urbeginn an um den feinsten Klang der Worte, der Töne, um den verborgenen Rhythmus, der im Leben und in den Dingen steckt?
Und von da kam Fritz Eisner auf den Naturalismus. Er haßte alle Stilisten und Ästheten, von denen er sagte, daß sie im besten Fall nur die eine Form gefunden hätten, nämlich die sich lächerlich zu machen. Es war seine Puschel, daß es keinen Stil gäbe, und daß man die Kunst immer wieder neu aus dem Leben ableiten müsse. Nur so könne man sie und sich vor Erstarrung bewahren. Und Fritz Eisner tat sich viel darauf zugute, trotzdem er so ganz geheim sich doch sagen mußte, daß Dürer und Leonardo vor ihm das Gleiche schon besser ausgesprochen hatten.
Aber der Doktor lachte breit und schwerfällig, reichte Fritz Eisner eine Zigarre und brannte sich selbst eine Zigarre an. Jetzt war er ein ganz anderer.
Fritz Eisner gefiel dieses Lachen nicht. Dieser Mann nahm anscheinend seinen Naturalismus nicht ernst. Er war eben wohl doch etwas unmodern, gehörte zum alten Eisen. Aber der Doktor lachte immer noch.
»Junger Herr, Sie haben ganz recht,« rief er. »›Kunst und Natur sei eines nur.‹ Ich hatte das nie so recht begriffen. Aber plötzlich verstand ich es. Es war damals in Rom. Eine Malerin stand da unten vor dem Portal des Französischen Instituts, auf dem Platz direkt über der Spanischen Treppe. Klein, schwarz, lachend, vollbusig, mit Schnecken und einem leinenen Malkittel, beschmiert, beklext, betupft in allen Farben des Regenbogens, von oben bis unten, vorn und hinten. Und die war umstanden von dreiundzwanzig spitzbärtigen Malkollegen, den zukünftigen Bonnats und Gérômes Frankreichs – denn die Manets kriegen keine Staatspreise –, die alle mit großen Handbewegungen ein eifriges Kunstgespräch mit ihrer Kollegin führten und alle doch nur die Natur meinten. ›Denn das Naturell der Frauen ist so nah mit Kunst verwandt!‹«
Langsam gingen sie wieder – Fritz Eisner wußte gar nicht, wo sie durch die Nacht hingelaufen waren – gingen sie wieder zum Bahnhof zurück, dessen Lichter wie ferne Zeichen winkten.
Der Doktor Fischer sprach wenig, wie einer, der das Gefühl hat, daß er zu viel gesprochen habe.
»Gott,« sagte er mehr für sich, »endlich gibt es doch Blumen, denen man gut sein kann und die dankbar sind und Kinder. Wozu also? › Il faut cultiver son jardin,‹ das war schon Voltaires letzte Weisheit.«
An dem Bahnhof aber reichte er Fritz Eisner die Hand:
»Wenn Sie einmal für Ihre Braut ein paar Pflanzen haben wollen, so was Besonderes, was Sie nicht bei jedem Gärtner kriegen, kommen Sie ruhig zu mir. So oft Sie wollen. Ich habe immer was für Sie.«
Und damit – hinten kam wieder der Zug mit Sirenengeheut durch den letzten Waldstreifen gebraust – wandte sich Doktor Fischer und tappte in seinem riesigen Flauschmantel mächtig und schwerfällig davon.
Fritz Eisner war müde und doch nicht müde, war überrege. Dieser ganze Tag, und der Mann dann noch mit seiner Verbissenheit und seinem Unglück (denn er war unglücklich, es klappte da irgend etwas nicht) hatten seine Nerven in Schwingungen gebracht, daß sie nicht so bald zur Ruhe kamen.
In Potsdam stieg noch ein Bursche mit Kränzen von Kirschlorbeer ein und brachte zudem noch den Geruch von Friedhof, den jeder haßt, der ihn kennt, in den Abteil, in dem sonst nur noch ein abgeflattertes, letztes Pärchen müde weiterduselte und kaum ein Wort und einen Blick füreinander fand.
Als aber Fritz Eisner nachher noch seine Schritte – es war zwölf Uhr in der Nacht – in irgendein Beisel von Café lenkte, wo allerhand bescheidene und noch völlig unabgestempelte Bohême verkehrte, in deren Mitte Fritz Eisner sich heimisch fühlte, da saß dort mit unruhigem Augenzwinkern hinter seinen Kneifergläsern Egi Meyer und spielte wieder einmal hoffnungslos verbiestert Schach. Er hatte das seit drei Uhr nachmittags getan.