
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
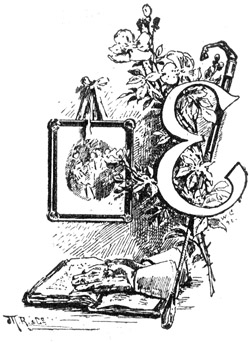 Es ist ein Sonntagnachmittag im März. Draußen schneit es, der Wind treibt die Flocken vor sich her, kleine scharfe Flocken, die wie glitzernder Staub in dem vereinzelten Sonnenstrahl flimmern, der aus dunklem Gewölk lugt wie verwundert über das garstige Winterwetter, das von Rechts wegen dem Januar, aber nicht dem März zukommt. Die Hyazinthen und Krokus zwischen den Doppelfenstern sehen ganz gemütlich in das Schneetreiben; sie wissen, es schadet ihnen nichts. Sie sitzen wie vornehme Damen hinter den durchsichtigen großen Glasscheiben.
Es ist ein Sonntagnachmittag im März. Draußen schneit es, der Wind treibt die Flocken vor sich her, kleine scharfe Flocken, die wie glitzernder Staub in dem vereinzelten Sonnenstrahl flimmern, der aus dunklem Gewölk lugt wie verwundert über das garstige Winterwetter, das von Rechts wegen dem Januar, aber nicht dem März zukommt. Die Hyazinthen und Krokus zwischen den Doppelfenstern sehen ganz gemütlich in das Schneetreiben; sie wissen, es schadet ihnen nichts. Sie sitzen wie vornehme Damen hinter den durchsichtigen großen Glasscheiben.
Es ist entsetzlich einsam um mich; Besuch kommt nicht, ich weiß es. Es ist ein Wetter, bei dem man nicht gern ausgeht, und sonntags hat auch jeder etwas vor – der eine dies, der andre das in der Familie, und wer keine Familie hat, muß sich ins Alleinbleiben fügen. – Was beginnen? Ei, wühlen wir in alten Erinnerungen!
Ich nehme einen Schlüssel und will den Kasten des Schreibtisches öffnen, in dem Briefe längst vergangener Zeiten ruhen; da fällt mein Blick auf eine Photographie an der Wand, ein recht unansehnliches Bild in schwarzem Rahmen, und sehr verblaßt, denn es ist dreiundzwanzig Jahre alt; eine verblichene rosa Schleife hält es am Nagel.
Sonderbar, das Bild hängt dort jahraus, jahrein, ich sehe es täglich und beachte es so selten. Nun nehme ich es herunter und wie ich es so betrachte, treten mir plötzlich Thränen in die Augen. Ach, du schöne goldene Zeit, der es sein Entstehen verdankt, in der die kleine verblichene Schleife noch rosenrot war und von dem kurzen Aermel meines ersten Ballkleides flatterte, goldene Zeit, wo bist du geblieben!
Sieben junge Mädchenköpfe heben sich ab von den straffen Falten eines Ateliervorhangs, vor dem wir malerisch gruppiert waren vom Herrn Photographen Hans Eyler am Schloßberg in der alten guten Stadt R., wo ich meine erste Jugend verlebte. Und wir sieben bildeten »das Kränzchen«. Eine harmlose Mädchenbande sind wir gewesen, glücklich und fröhlich wie die Fischchen in der Berbe, dem kühlen rauschenden Gebirgsfluß, der an unserm Städtchen vorüberströmte.
Auf all diesen Gesichtern liegt Daseinsfreude, aus all diesen glänzenden Augen blickt ein Träumen von künftigen seligen Tagen, um jeden Mund zuckt das Lachen, das herzliche helle Lachen der Jugend. Die dort, die kleine Blasse, ist Julchen; die Brünette Doris; jenes schelmische Stumpfnäschen Selma und jenes schöne schlanke Geschöpf ist Franziska; da ist Röschen, da Minchen und da bin ich.
Was hat uns das Leben gebracht? Nun, sie sind fast alle recht und schlecht auf ihren Bahnen gewandelt, jede hat ihr Päckchen zu tragen. Die meisten besitzen einen braven Mann, haben jetzt nahezu erwachsene Kinder, nennen ihren Gatten gemütlich »Mein Alter«, wenn sie von ihm sprechen, und denken an künftige Schwiegersöhne. Alljährlich zum Geburtstag erinnert man sich der Kränzchenschwestern und teilt in einem Gratulationsbrief gleich mit, daß noch alles beim alten sei, daß freilich die Kinder wieder krank gewesen und daß man allmählich graue Haare bekomme, sonst aber, Gott Lob und Dank! nicht klagen könne.
Ja, wir wissen untereinander genau, wie es bei uns aussieht, ist auch die eine hier-, die andre dahin verschlagen. Nur von einer wußten wir jahrelang nichts. Sie war anders wie wir alle und entschieden der Glanzpunkt unsres kleinen Kreises, die »schöne Franzi« mit dem wundervollen kastanienbraunen Haar und den klaren schwärmerischen Blauaugen.
Sie war auch die Lebhafteste, voll von tollen Einfällen und Launen; Franziska von Schlehen hieß sie. Ihr Vater hatte ein großes Gut gehabt und war nun, nachdem er dasselbe seinem Sohne übergeben hatte, mit Frau und Tochter in die Stadt gekommen, wo er ein hübsches altertümliches Haus erwarb. Hinter diesem Hause breitete sich ein schöner Garten aus, der bis zum Flüßchen reichte, auf dessen andrer Seite der weite Schützenplatz lag, der jedes Jahr vierzehn Tage lang zur Zeit des Vogelschießens in eine bunte lustige Zeltstadt verwandelt wurde.
Die älteste Schwester war schon verheiratet; die Franzi ward auf Wunsch ihrer Mutter eines Tages feierlich in unser Kränzchen aufgenommen. Die Mutter starb aber, als Franzi kaum zweimal in unserm Kreise geweilt hatte, und ihr Tod und Begräbnis rührte eine Menge Stadtklatsch auf: Herr von Schlehen habe sie gegen den Willen seiner Familie geheiratet; sie sei irgend etwas »Sonderbares« früher gewesen. Nach seiner Heirat habe Herr von Schlehen sich gänzlich von allen Bekannten und sogar von seiner Familie zurückgezogen, um mit seiner jungen Gattin auf seiner einsamen Besitzung zu leben; einige Leute wollten sogar wissen, daß die Baronin von Schlehen tief melancholisch gewesen und nur hie und da einmal zu lichten Augenblicken erwacht sei, und daß sie grausam gelitten habe unter dem Stolze ihres Mannes. Bestimmtes wußte jedoch niemand.
Vier Wochen lang nach dem Tode ihrer Mutter erschien Franzi nicht in unserm Kränzchen, dann kam sie wieder, in tiefer Trauer natürlich, und das schöne, tiefgebeugte Mädchen ward nun förmlich verhätschelt. Wir standen sämtlich im achtzehnten Lebensjahr, nur sie hatte bereits den achtzehnten Geburtstag gefeiert. Wir kannten sie damals noch wenig, aber sie war unsäglich interessant für uns.
So allmählich taute sie denn auch auf, und ein Vierteljahr später wurden wir feierlichst durch den alten Kutscher der Schlehens von Franzi zum Kränzchen eingeladen.
Wir waren natürlich äußerst gespannt, die freiherrliche Häuslichkeit kennen zu lernen, und staunten alles an, die vornehme Einrichtung des Hauses, die geschnitzten wappenverzierten Möbel, die Familienbilder, das Silberzeug, die Teppiche, selbst das geräuschlose Walten des Dieners. Am meisten entzückte uns aber der herrliche Garten, in dem die Trauben gerade reisten. Wir fanden den Gartensaal großartig mit seinen gemalten Wänden, aus denen die Geschichte von Paul und Virginia dargestellt war. Was mir indessen am allerbesten gefiel, war die Aussicht von dem Platze unter den Linden aus die Schützenwiese jenseit des Flusses.
»Höre, Franzi, du mußt nächstes Jahr zum Königsschießen das Kränzchen nehmen,« schlug Doris vor, »da können wir hier alles beobachten.« Und wir andern stimmten ein.
Franzi lachte. »Wenn es der Vater erlaubt! – Er ist so grimmig über das ganze Fest, denn im vorigen Jahre sind ein paar Männer, von solcher Schaubude wißt ihr, über die Berbe gekommen, um sich das Gemüse für ihr Diner zu stehlen.«
»Wie haben sie denn das angefangen?« fragte Selma.
»Als ob das ein Kunststück wär',« antwortete Franzi, »die Berbe ist ja keine zwei Fuß tief an dieser Stelle.«
»Das ist ja unheimlich,« meinte ich.
»Papa will diesmal wachen lassen im Garten; ich hab' dem Peter, unserm Kutscher, schon eine Tracht Schläge prophezeit.«
»Nun, ich danke! – der Schlagtot!«
»Aber die Gewandtheit von solchen dagegen!« rief sie.
»Ich habe Furcht vor dieser Menschenklasse,« bemerkte Doris, die eine sehr ängstliche Mutter besaß.
»Ich gar nicht!« erklärte Franzi, »ich war sogar einmal drauf und dran, mich in einen Kunstreiter zu verlieben.«

Wir lachten sämtlich aus vollsten Herzen.
»Es ist, bei Gott! wahr,« beteuerte sie, ohne eine Miene zu verziehen.
»Wo denn? Du warst doch immer auf dem Lande?« fragte ich.
»Nicht immer,« antwortete sie leise, und ein zartes Rot färbte ihr blasses Gesicht, »ich war eine Zeit lang in Braunschweig bei meiner Tante.«
»Aha! Und deshalb bist du eins – zwei – drei wieder nach Hause spediert!« neckte Minna.
»Bitte sehr!« rief sie heftig, »ich kam, weil Mama Sehnsucht nach mir hatte!« Und jetzt war sie sehr blaß.
»Hein Gott, du erzähltest es ja neulich selbst, daß du Hals über Kopf abgereist bist,« entschuldigte sich die kleine Blondine.
»Wißt ihr,« nahm nun die verständige Doris das Wort, »in unsern Kränzchenstatuten ist geschrieben, daß wir uns einander nichts verheimlichen sollen. Kommt in die Stube, und Franzi erzählt uns die Geschichte.«
»Ich weiß nichts zu erzählen,« sagte diese barsch, »aber du hast recht, unser Creme wartet und Papa schenkte mir in Anbetracht der Herbstkühle ein Fläschchen süßen Ungarwein; es wird für jede ein Fingerhut voll darin sein. Also vorwärts!«
Als der Creme im erhellten Zimmer verspeist und das Liqueurglas – es war gerade genug Wein darin, um uns in eine angeregte Stimmung zu versetzen – ausgetrunken war, sagte Doris plötzlich zu unsrer reizenden Wirtin: »Weißt du, Franzi, die Kunstreiteridee ist doch zu dumm; wenn du Pferde liebst und einen heiraten möchtest, der damit zu thun hat, verliebe dich doch in einen Husarenoffizier!«
Franzi warf den Kopf zurück. »So reizend, wie der war, gibt's gar keinen Husarenoffizier!« rief sie schnell, verstummte dann aber jäh, denn der alte Baron von Schlehen und seine Schwester, die schon vor dem Tode der kranken Frau dem Hause vorgestanden hatte, traten ein, uns zu begrüßen.
Nie wieder habe ich ein so schönes altes Geschwisterpaar gesehen. Er, noch immer ein stattlicher Mann, obgleich schon an die Siebzig, gab so recht das Bild eines Kavaliers: etwas still, unnahbar, voller Artigkeit und etwas – etwas sehr stolz. Es ging überall die Rede, daß er seine Einwilligung zur Verheiratung der ältesten Tochter mit einem bürgerlichen Gutsnachbar erst nach jahrelangen Kämpfen gegeben habe, erst dann, als die Tochter in eine schwere Krankheit verfiel, und daß er jetzt noch mit auffallender Kühle von dieser Verbindung spreche.
Die Schwester, fein Ebenbild, war noch aristokratischer, noch stolzer, obgleich sie mit gewinnenden Worten die Freundinnen Franzis bewillkommnete.
Wir blieben stumm und verschüchtert wie die Spatzen, solange die alten Herrschaften zugegen waren, und beantworteten leise die Fragen, die uns vorgelegt wurden. Wie wir dasaßen, entstammten wir der Reihe nach bürgerlichen Familien und duckten uns schüchtern vor so viel Stolz und Vornehmheit. Die einzige, die die Stille unterbrach, war ich, als ich bei dem Gedanken an Franzis Kunstreiterliebe in ein kurzes, nervöses Lachen ausbrach; wie mich dann der verwunderte Blick des alten Herrn traf, schwieg ich, purpurrot, still und beugte mich über meine Handarbeit.

Nach einer Viertelstunde waren wir erlöst. Wir machten den Hinausschreitenden – der alte Herr bot seiner Schwester dabei ritterlich den Arm – unser vorschriftsmäßigstes Kompliment und atmeten auf. Am meisten Franzi; sie streckte sich im Sessel und machte »Puh!« indem sie sich mit dem Taschentuch Kühlung zufächelte.
»Bist du so erhitzt?« fragte eine von uns.
»Mir ist immer heiß in Gegenwart der Tante. Eigentlich sollte mir kalt sein, aber ich muß immer so an mich halten, daß ich nicht mit den Füßen stampfe und einen Schrei thue, wenn sie so unnahbar dasitzt. Es prickelt mir bis in die Fingerspitzen, ich möchte irgend etwas beginnen, das sie aus der Fassung bringt, aus dieser großartigen, steifleinenen, gräßlichen Fassung, die sie als ,guten Ton' bezeichnet.«
Das schöne Gesicht sah förmlich erbost aus.
»Ich wollte es einer jeden von euch wünschen,« fuhr sie fort, »nur einmal vierundzwanzig Stunden lang hier leben zu müssen mit dem sogenannten ,Anstand', aber ihr hieltet selbst diese vierundzwanzig Stunden nicht aus. Ach und ich, die ich in meinen Kinderjahren ein heimliches Freundschaftsbündnis hatte mit den Töchtern von Papas Schafmeister und kein größeres Glück kannte, als meiner Gouvernante davonzulaufen in den dichtesten Wald hinein, wo der alte Holzknecht Gottlieb seine in der Asche gebratenen Kartoffeln mit mir teilte – ich sitze nun hier in dem alten Hause, unter den Augen der Tante, und dieses Haus steht in dem erbärmlichsten Krähwinkel der Welt, und ich habe nichts, nichts als den langweiligen Garten, und – «
»Aber du hast doch uns!« sagte ich vorwurfsvoll.
»Doch nach welchen Kämpfen! Hätte nicht meine goldene kranke Mutter gesagt: ›Egon, sie muß Jugendverkehr haben, erlaube ihr doch‹ – ich hätte nicht mithalten dürfen.«
Wir schwiegen, mehr oder weniger gekränkt.
»Wißt ihr,« fuhr sie auf, »ihr braucht das nicht übelzunehmen; Papa sowohl wie die Tante wissen genau, daß ich mich lieber morden ließe, ehe ich mein Kränzchen hergäbe.« Und sie bot der Nächstsitzenden die Hand, und mit Thränen in den Augen sah sie die andern an.
»Es war dumm, daß ich's euch erzählte, aber ich hatte erst heute wieder einen Streit mit Tante; sie hielt es nämlich für nötig, von A bis Z bei uns zu bleiben während des Kränzchens, und da – da bin ich so heftig geworden.«
»Aber wozu denn das? Bedürfen wir einer Aufsicht? Wir wollen doch unter uns sein?« fragte Doris.
»Nun, seht ihr wohl! jammerte Franzi, »ich war so böse, so bös, ich habe erklärt, dann lieber das Kränzchen abzusagen, und da ist sie dann schließlich – weggeblieben.«
Unser Entzücken über das freiherrliche Haus war etwas gemildert, und auf dem Nachhauseweg gestanden wir uns, daß wir »auch nicht auf der Straße gefunden«, und daß unsre Väter hochangesehene Männer der Stadt seien, und daß dieselben mindestens ebensoviel bedeuteten wie der Freiherr von Schlehen. Natürlich sollte die Franzi, das arme Ding, nicht unter unserm Verdruß leiden.
Wir verzogen sie von Stund' an desto mehr, und da sie unsre Vergnügungen, unsre reizenden Waldausflüge, die Picknicks im Mondenschein, bei denen wir mit unsern Brüdern, den jungen Beamten und Kaufleuten des Städtchens tanzten', die Bälle und Gesellschaftsabende nicht teilen durfte, so hatten wir uns das Wort gegeben, ihr nicht mit einer Beschreibung all dieser Herrlichkeiten das Herz schwer zu machen. Der Freiherr hatte sich bei unsrer sogenannten ersten Gesellschaft gar nicht eingeführt. Die Geschwister verkehrten nur in den drei adligen Familien, die unser Städtchen aufzuweisen hatte. Die eine bestand aus einem Ehepaar mittleren Alters, einem pensionierten Offizier, der sich der Billigkeit halber hierher zurückgezogen hatte, in Anbetracht einer Kinderschar von fünf Buben und vier Mädchen, von denen das älteste erst vierzehn Jahre zählte. Die ganze Stadt wußte, daß es den Leuten schlecht ging, und glaubte der Frau Hauptmann nicht, wenn sie versicherte, daß sie Mehlsuppe für gesünder halte als Fleisch.
Das Oberhaupt der zweiten Familie war ein russischer adliger Herr, der hier kleben geblieben war, weil seine Frau auf der Reise in unserm Städtchen starb und begraben ward. Er hatte einen stark verwachsenen Sohn, der das Gymnasium besuchte, und außer mit Schlehens verkehrte er mit niemand.
Dann war noch die alte Freifrau von Berlewitz, eine prächtige Dame, die gar gern in unsre Häuser kam mitsamt ihren sieben ältlichen Baronessen, welche gar kein Hehl daraus machten, daß sie sich ihr Taschengeld mit Handarbeit verdienten. Da aber die jüngste bereits achtunddreißig zählte, so hatte Franzi an diesen verblühenden Rosen auch keine Freude und schmachtete lieber einsam weiter.
Außer bei diesen drei Familien hatte Herr von Schlehen noch beim Landrat Besuch gemacht, und da besagter Landrat mein Onkel war, so hatte ich den besondern Vorzug, auch außerhalb des Kränzchens zuweilen Franzi zu empfangen und mitunter durch Peter ein Zettelchen zu erhalten: ›Komm, ich bitte dich, ich sterbe vor Herzenseinsamkeit!‹ – Zu einer richtigen Freundschaft kam es jedoch so recht nicht; die Franzi hatte etwas, das mich anzog und abstieß zu gleicher Zeit.
Eine furchtbare Leidenschaftlichkeit steckte in diesem Mädchen; manchmal meinte ich, die Flammen in ihrer Seele müßten den zarten Körper verzehren; und dann, es war so etwas Eigentümliches dabei, etwas, das ich nicht kannte und das mich rot werden ließ, ohne daß ich es verstand.
Uns war ja der Lebensweg so einfach vorgezeichnet. Erst die Schule, dann die Hauswirtschaft, dann der Freier in Amt und Würden, die es ihm möglich machten, eine Familie zu ernähren, endlich der Traualtar u. s. w. Daß es andre Lebenswege geben könne, kam uns nicht in den Sinn. Franzi meinte, das sei spießbürgerlich! Sie wollte eine große Liebesleidenschaft; sie hatte »Werthers Leiden« bei der Hand und las mir daraus vor, und dann hatte sie noch ein Buch, Gott weiß woher? – das Verrückteste, was ich je las. Titel und Verfasser habe ich vergessen, aber es handelte von einer Grafentochter, die sich in einen schönen Räuberhauptmann verliebte und seinetwegen das väterliche Schloß und allen Glanz ihrer hohen Geburt verließ, um mit ihm in den Wäldern zu leben.
»Sei doch nicht komisch,« sagte ich, »so etwas gibt's ja gar nicht mehr. Das ist ein Buch für alte Spinnstubenweiber.«
»Das gäbe es nicht? Allerdings für euch nicht; ich aber bin keine Alltagsseele. Uebrigens mit einem Räuberhauptmann davonzulaufen, das ist ein bißchen stark, indessen – – «
»Am Davonlaufen selbst findest du also nichts?« fragte ich.
»Nein!« antwortete sie kurz. »Wenn man einen – sehr lieb hat, dann – «
»O, Franzi, Franzi!«
Sie antwortete nicht. Nach einer Weile begann sie von andern Dingen zu sprechen. –
Allmählich, bei öfterem Zusammensein, entrollte sich vor mir ein Bild ihrer Jugend auf dem alten Harzschloß, fern von jeglichem Verkehr, in der starren aristokratischen Abgeschiedenheit. Ich sah das Kind stundenlang von dem Fenster aus in die Ferne starren mit fragenden, sehnsüchtigen Blicken. Ich sah sie im Walde, stundenlang sich selbst überlassen träumend unter den Buchen, und ich sah sie in der Dämmerung des Wintertages heimlich in die Bibliothek huschen, um sich eines der Bücher mit in das Schlafstübchen zu nehmen, eines jener verderbten wahnsinnigen Werke, die ihr den schönen kleinen Kopf verdreht hatten. Die Mutter war krank, den Vater sah sie nur bei Tische, ach – und die Bonne besaß einen Liebhaber. Franzi hatte es schon als Kind gesehen, wie sie sich küßten, wenn ihr geheißen ward, Blumen zu pflücken. Und dann die Gouvernante! – »Du denkst wohl, Marie, ich wußte nicht, daß sie ein Stelldichein hatte, wenn sie sich abends den Regenmantel umhing und zu mir sagte: ›Schlafen Sie, Mademoiselle, ich bin in drei Minuten zurück; Sie müssen eingeschlafen sein, wenn ich wiederkomme!‹ O, du kannst glauben, um zwölf Uhr war sie noch nicht wieder da. Ich weiß auch, wer – aber Papa warf sie aus dem Hause; er wollte keine Gouvernante als Schwiegertochter.«
»O, ich mag nichts weiter wissen,« bat ich, peinlich berührt von dem Gehörten.
»Und meine arme Schwester! Sie war so thöricht; ich hätte es ganz anders gemacht, ich hätte mich mit Rudolf heimlich trauen lassen, eines schönen Tages wäre ich fortgewesen. – Sie war böse auf mich, als ich ihr das riet, und grämte sich lieber zwei Jahre und mußte sterbenskrank werden, ehe Papa ›ja!‹ sagte. Und Papa – ihm – «
»Zeige mir doch einmal das Bild deiner Mutter,« bat ich. Und auf den Zehen schlichen wir uns ins Haus zurück – die alten Herrschaften waren just im Garten – und huschten die Treppe hinauf in das Zimmer des Barons. Es war ein großes Gemach; einzelne Möbel, der Kronleuchter, selbst Bilderrahmen waren aus Geweihen zusammengefügt. Ueber dem Schreibtisch hing das große Oelbild.

»Wie wunderschön!« flüsterte ich und betrachtete die lebensgroße Figur der schlanken Frau im knappen Reitkleid, eine große Dogge zur Seite. Unter dem breitkrempigen federgeschmückten Filzhut schaute Franzis süßes Gesicht hervor, ähnlich zum Verwechseln, Zug für Zug, dieselbe Nase, der kleine blaßrote üppige Mund, das Grübchen im Kinn, die Blauaugen.
»Meine Herzensmutter!« seufzte das Mädchen. »Sie war immer krank, sie empfing nie Besuch; ich kenne sie gar nicht anders als auf der Chaiselongue. Wir hatten uns so sehr lieb; Tante aber, die hat meine Mutter gehaßt!« Die Hände des Mädchens ballten sich. »Glaube mir, wäre Tante nicht gewesen, Papa hätte die Mama und uns ganz anders behandelt.«
Leise schlichen wir wieder hinunter.
»Gib mir mal deine Hand,« forderte sie ein andermal, als sie mich mit verweinten Augen besuchte in der Dämmerung eines Juniabends.
Ich reichte ihr die Hand.
»So, ich danke dir! Du darfst keinem Menschen verraten, was ich dir jetzt anvertrauen will. Weißt du, ich halte es zu Hause nicht mehr aus, ich gehe fort!«
»Ums Himmels willen, wohin denn?«
»Das weiß ich noch nicht.«
Ich bat und beschwor sie, von ihrem Vorhaben abzustehen. Und ob sie meine Angst rührte, ob ich die richtigen Worte fand, ihr Herz zu bewegen – sie fiel mir mit Thränen um den Hals, versprach, solche Gedanken aufzugeben, aber ich müsse auch ihr versprechen, öfter zu kommen, ihr eine treue, verschwiegene Freundin zu sein. Mit achtzehn Jahren ist das Herz so edel gesinnt, so opferwillig, es glaubt noch an Wunder, die es vollbringen kann – ich beschloß, die Freundin zu retten.
»Franzi,« begann ich, »du mußt vernünftig werden, du mußt nicht so viel lesen; arbeite etwas im Haushalt.«
Sie lachte. »Es ist alles verteilt, unsre Leute sind vorzüglich und ich fände nichts zu schaffen. Papa würde es auch nicht leiden, ebensowenig wie Tante.«
»Dann unterrichte ein paar arme Kinder, oder wir thun es gemeinschaftlich; willst du?«
»Ja, ja!«
Zwei-, dreimal war sie mit Feuereifer dabei; in der vierten Stunde erschien sie nicht. »Ach, Goldherz,« schrieb sie zur fünften, »sei nicht böse, wenn ich nicht komme, mich spannt es so ab, und die Kinder, die du ausgesucht hast, sind so gräßlich dumm!«
Ich sah mitleidig die kleinen flachsblonden Dinger an. Ja, freilich, Geduld war hier vonnöten, aber darin hatte ich ja meinen schönen Strudelkopf just üben wollen. Sie kam andern Tages, nicht im mindesten bekümmert, ob ich ihr Fernbleiben übelgenommen hatte oder nicht, und erzählte mir voll Ironie, sie seien gestern in einem Kaffee gewesen bei der Baronin Berlewitz, sie und die Tante, und die sieben alten Jungfern hätten dagesessen und andächtig der Unterhaltung der beiden ganz alten Damen gelauscht. Die alte Berlewitz habe von vergangener Pracht und Herrlichkeit geredet, und sie und Tante Bärbchen – Barbara hieß die Tante Franzis – hätten eine Unmasse gemeinsamer Bekannten entdeckt und seien schließlich in einen wahren Feuereifer geraten. »O, ich bin beinah gestorben vor Langerweile! Gott im Himmel, Marie, wenn ich hier auch so versauern soll wie die Berlewitzschen Baronessen – – «
»O behüte,« tröstete ich, »du wirst schon in die Welt hinauskommen.«
»Wie denn?«
»Ihr macht doch gewiß Reisen.«
»Bewahre! Das gestatten unsre Verhältnisse nicht mehr, dafür hat mein Bruder gesorgt,« antwortete sie bitter.
»Nun, dein Bruder macht als Erbe eurer Besitzung doch gewiß ein Haus?«
»Papa und wir – wir sind ja böse mit ihm, weil er – bah, was geht's mich an – «
»Ach so!«
»Nein, ich sehe keinen Ausweg, keinen; ich werde ein Schlafmittel einnehmen, damit ich meine Jugend verschlafe.« Sie lachte. »Oder soll ich – – « Sie sah mich schelmisch an.
»Was denn?«
Sie kam mir ganz nahe. »Du, soll ich ihn nehmen?«
»Wen denn?«
»Den Pastor von Mühlen!«
»Himmel!« sagte ich und riß die Augen weit auf, und eine große Helligkeit erleuchtete urplötzlich meinen Kopf. Herr von Mühlen war ein junger Geistlicher, der seit einigen Monaten als zweiter Prediger unserm alten Superintendenten beigegeben war, ein stiller, ungelenker Mann, mit blassem Antlitz und langem blondem Haar, der zahllose Zuhörer in die Kirche lockte, denen er von der Kanzel herunter gehörig die Meinung sagte, nicht anders, als ob unser solides Städtchen ein Sodom und Gomorrha sei. Er suchte in seinem jugendlichen Glaubenseifer die Leute in ihren Wohnungen auf und hielt ihnen vor, daß sie den Sabbat nicht genug heiligten, wenn sie nachmittags spazieren gingen; er stiftete Jünglings- und Jungfrauenvereine und wußte genau, wer aus der Gemeinde am Sonntag beim Gottesdienst gefehlt hatte. Uebrigens war er ein Ehrenmann durch und durch und die ganze Stadt darüber einig, daß, wenn der Feuereifer einer kühleren Anschauung Platz gemacht, er ein guter Seelsorger und der beste Redner sein werde, der je auf der Kanzel zu St. Servatius gestanden habe.
»Der?« fragte ich. »Will der dich?«
»Das käme nur auf mich an,« erwiderte sie. »Seit vierzehn Tagen ist er ja unser täglicher Gast; Papa und Tante und er sind ein Herz und eine Seele!«
Sie setzte sich an das Fenster meines Stübchens, und ehe ich etwas erwidern konnte, sagte sie: »Laß uns doch ein Stückchen spazieren gehen, es ist so herrlich draußen.«
Meine Mutter gab die Erlaubnis und wir wanderten um die Wälle der Stadt, die zu einer Promenade umgeschaffen waren. An der Kirche St. Servatii blieb sie stehen; es war ein grüner stiller Platz, an dem die Promenade vorüberführte. Ehemals war es ein Friedhof, jetzt schmückten ihn noch alte köstliche Linden, die im ersten Grün schimmerten; darunter befanden sich steinerne Bänke, auf denen, neben einem greisen Mütterchen, das dort Luft schöpfte, einige Kinder spielten. Die Kirchenthür stand offen, damit die warme Frühjahrsluft in das hohe Gebäude einziehe. Das Pfarrhaus lag still daneben mit seinen spiegelnden Fenstern, hinter denen die schneeweißen Gardinen der Frau Superintendent im oberen Stock leuchteten. Unten wohnte der Hilfsprediger, Herr von Mühlen.

»Schau,« sagte sie, »von diesem Haus in die Kirche, und von der Kirchthür wieder in das Haus, das wäre dann mein Lebensweg.«
»O, auf dieser kurzen Bahn liegt doch das Leben nicht, Franzi! Hinter jenen Fenstern wäre deine Welt, und sie kann in ihrer Kleinheit doch so groß und schön sein.«
»Meinst du?« fragte sie und sah mich ernsthaft an. »Manchmal denke ich es auch,« fuhr sie fort, »aber dann – dann ist's mir, als fielen die Mauern dieser engen Stadt über mir zusammen. Ach, ich glaube, ich bin verdorben, ich bin ganz verdorben zu etwas Gutem.«
Sie war währenddem rasch weitergeschritten, und als wir wieder in die Promenade einlenkten, prallten wir hart an der Biegung der Allee mit Doris zusammen, und Doris ward plötzlich feuerrot.
»Wie kommst du denn daher?« fragte Franzi.
»Ich will zu Tante Rosemann,« stotterte Doris.
Franzi lachte. »Das ist der nächste Weg, du kleiner Schlaukopf!« – Sie wohnte am entgegengesetzten Ende der Stadt. – »Du hast wohl St. Servatius mit St. Marien verwechselt?«
Doris hatte sich schon gefaßt. »Jeder kann gehen, wo er will,« sagte sie.
»Richtig!«
»Ich habe euch ja auch nicht gefragt, wie ihr hierher kommt.«
»Freilich!«
»Wir wollen spazieren gehen,« schaltete ich ein und mußte Doris forschend ansehen. Sie würde sich doch nicht etwa für unsern jungen Pastor interessieren?
»Viel Vergnügen!« sagte Doris, sich kurz verabschiedend.
»Adieu!« riefen wir und gingen weiter.
Im nächsten Kränzchen war eine Spannung nicht zu verkennen.
»Ich denke, ihr gehört zu St. Marien?« fragte Franzi anscheinend harmlos Doris.
»Thun wir auch!« antwortete diese und sah an ihr vorüber.
»Wie kommst du denn da so oft nach St. Servatius?«
»Ich kann doch in diejenige Kirche gehen, welche mir paßt?«
»Natürlich – entschuldige nur, Doris.«
Doris' Augen standen voll Thränen; ich glaube, sie hätte Gott weiß was darum gegeben, ein Pfarrkind von St. Servatius zu sein, um ihr Herzensgeheimnis besser hüten zu können.– –
Franzi saß Sonntag für Sonntag mit dem nämlichen blassen Gesicht im Kirchstuhl neben Tante Barbara, und Sonntag für Sonntag speiste der Pastor von Mühlen am Tische des Freiherrn von Schlehen.
»Franzi,« sagte ich eines Tages – sie hatte mich zu sich bitten lassen und wir saßen unter der Linde in ihrem väterlichen Garten und plauderten – »sag' mal, wie steht's denn mit dir und Mühlen?«
Sie lag lässig in einem der tiefen Gartenstühle und schaute über die niedrige Mauerbrüstung nach der Wiese hinüber, wo eine Menge Arbeiter beschäftigt war, die Buden für das Schützenfest zu errichten. »Nun,« erwiderte sie, »es wird wohl so kommen.«
»Hat er dir seinen Wunsch gestanden?«
»Mir nicht, aber der Tante.«
»Und du?«
»Nun, ich habe mir Bedenkzeit ausgebeten bis – bis zum ersten August.«
»Heute haben wir erst den zwölften Juli – ist er damit einverstanden?«
»Was soll er denn machen?« sagte sie. Und von etwas anderm sprechend, setzte sie hinzu: »Das wird ein schönes Gedudel werden da drüben. – Sieh nur, sieh! Und diese riesigen Wagen, diese Wohnhäuser auf Rädern! Es mag ein ganz lustiges Leben sein, so durch die Welt zu karren. Schau, Marie, die haben ordentlich Blumen und Gardinen vor den Fenstern ihrer Räderhäuschen und, wahrhaftig! einen Kanarienvogel! – Kannst du erkennen, was an dem größten Wagen geschrieben steht?« fragte sie dann.
Ich blickte scharf hinüber, wo um eine der stattlichsten Buden eine förmliche Wagenburg stand. »Cirkus von Giacomo Arditi« las ich.
Sie antwortete nicht. Mit keinem Gedanken war ich je auf Franzis Aeußerung zurückgekommen, daß sie sich einmal beinah in einen Kunstreiter verliebt habe; auch in diesem Augenblick dachte ich nicht daran, sondern erst viel später fiel sie mir ein. – Wir sahen beide der alten Dame entgegen, die in Begleitung des Herrn Pastors von Mühlen würdevoll den Gang daherkam.
Sie nahmen Platz bei uns im Schatten der Linde.
Es war ein warmer, wonniger Nachmittag. Drunten – das Ufer fiel hier steil ab – rauschte das Wasser Kühlung herauf, die Wiese lag im vollsten Sonnenlicht und die lustigen Stimmen der Leute klangen herüber; das bunte Bild war eingerahmt von hohen Bäumen, hinter denen die nicht allzufernen Berge aufragten.
»Da hält wieder der Teufel des Genusses seinen Einzug,« sagte Tante Barbara mit einem schiefen Blick auf die Arbeiter, die unter lautem Zuruf eine mächtige Leinwandplane über den Cirkusbau befestigten. »Da geben die tollen Menschen ihre paar Notgroschen aus,« fuhr sie fort, »und ihre Gotteshäuser lassen sie verfallen. Wie denken Sie über diese Volksfeste, Herr Pastor?«
Aber der antwortete nicht; seine blauen stumpfen Augen sahen innig begeistert und so scharf, wie die Brillengläser es zuließen, nach dem schönen Mädchen hinüber; er war so in ihren Anblick versunken, so ganz Verliebter und so wenig zur Askese und Verdammung geneigt, daß er auch Tante Barbaras Hüsteln jetzt nicht vernahm.
»Hm! hm!« machte diese noch deutlicher.
Er fuhr empor mit einem erschreckten: »Ja, ja, gnädigste Baronin – die Bibel sagt – – – «
Aber was sie in diesem Falle sagt, blieb uns verborgen, denn drüben auf der Wiese sprengte ein Reiter dicht bis ans Wasser heran, ein eleganter schlanker Mensch auf einem Schimmel von offenbar vorzüglicher Rasse; der seidige Schweif des Tieres streifte fast den grünen Boden. Es war, obwohl man ihm ein gewisses Alter ansehen konnte, noch immer bildschön und trug den herrlichen kleinen Kopf so stolz und hob die schlanken Füße so graziös – einstmals mußte es von unschätzbarem Werte gewesen sein. Und der, der drauf saß, war ganz eins mit dem Tiere; man hätte sich einen vollendeteren Reiter kaum denken können. Offenbar sollte das Tier bewegt werden, denn der Cirkus war noch nicht fertig, und so genossen die hier Versammelten eine kleine Schaustellung, die jeden Kenner entzücken mußte.
Dann kam ein Mann gelaufen und rief dem Reiter zu: »Herr Arditi, der Zimmermeister will Sie sprechen!« und in einem wahnsinnigen Galopp stürmte das Pferd dort hinüber.
»Bravo!« sagte der Freiherr, der gerade herzugetreten war, und sah mit eigenartigem Schimmer in den Augen dort hinüber; und dann begann er eine ziemlich verworrene Erzählung – fast als spräche er zu sich – daß dieser Schimmel da ganz dem ähnlich sei, den er vor Jahren – kann jetzt nicht mehr leben – bei Renz gesehen, und für den er einen wahnsinnigen Preis geboten habe. »Wollte ihn als Damenpferd für – na – für eine Dame,« fuhr er fort, »die erste Reiterin im Cirkus ritt ihn damals in der hohen Schule – – Nicht hergegeben das Tier, war auch gut – – hat seine Reiterin auf dem Gewissen – abgeschleudert mit Kopf gegen Barriere, auf dem Fleck mausetot.«

»Ein schreckliches Ende!« sagte Tante Barbara, ihrem in Erinnerungen versunkenen Bruder einen zornigen Blick zuwerfend.
»Ein schöner Tod,« behauptete Franzi, »so in der vollsten Kraft, aus dem herrlichsten Lebensgenuß hinaus – «
Der junge Pastor räusperte sich.
»Wir beten alle Sonntage: ›Bewahre uns vor einem schnellen unbußfertigen Tode!‹« sprach die Tante.
Franzi senkte errötend den Kopf und warf mir einen hilfeflehenden Blick zu.
Herr von Mühlen empfahl sich bald, auch meine Zeit war gekommen. Einen Augenblick blieb ich noch zurück bei Franzi; die sah mit gerunzelten Brauen der hageren Gestalt des Geistlichen nach, um dessen eckige Glieder der lange Gehrock so unschön wie möglich flatterte.
»Ach, Marie, ich bin schlecht, ich bin schlecht,« sagte sie, »jetzt schreit alles in mir: ›Nein! Nein!‹ – Paß nur auf, wenn ich ihn nehme, da gibt's ein Unglück, ein großes Unglück!«
»So sprich ›nein‹! wenn das deine Meinung ist.«
»Ja, du hast recht! Aber sieh, ich habe eine so schreckliche Sehnsucht nach Frieden, nach Sonnenschein, der durch helle Fenster in ein trautes Zimmer leuchtet, nach jemand, der gut ist, so recht herzensgut, der sagen könnte zu mir: ›Meine arme kleine Franzi, ich bin ja bei dir‹ – an dessen Brust ich meinen dummen wilden Kopf lehnen und mir alles das, was hier sitzt« – sie faßte nach dem Herzen – »ausweinen könnte.«
Sie sah in diesem Augenblick so jammervoll aus, daß ich die Arme um sie schlang. »Arme kleine Franzi, da nimm ihn doch; gut ist er, sehr gut – glaube es mir!«
Sie legte die Hände vor das Gesicht und die Thränen liefen ihr durch die Finger. »Ja, ja, das ist er, und vertrauenerweckend auch, und eine feste Hand hätte ich so nötig – aber – aber – – «
»Aber?«
»Ach Gott, wenn er nur ein bißchen hübscher wäre!«
Ich mußte, obgleich ich ärgerlich wurde, doch lachen. »Ach, du Kindskopf du!« schalt ich. »Mach', was du willst!«
»Geh nicht so böse fort!« bettelte sie, neben mir her schreitend und sich die Thränen abwischend.
»Nein, nein! Auf Wiedersehen! Bring' dein Herz zur Ruh', sage ›ja‹! Etwas Abgemachtes bringt Frieden.«
Sie seufzte und sah zu Boden, und als ich die Hausthür schloß, sah ich sie noch in dem großen dämmernden Flur stehen.
Ein paar Tage später war das Schützenfest im vollsten Gange. Das Städtchen stand fast auf dem Kopfe, den Festplatz mußte man besucht haben, auch wir wollten natürlich hingehen. Ueberall an den Straßenecken klebten riesenhafte Zettel mit Ankündigungen der Schaubuden, der Cirkuszettel aber übertraf alle an Größe und greller Farbe.
»Es soll famos da sein,« sagte mein Bruder, der Primaner, »heute abend gehe ich hin. Ein Parforcereiter ist da – alle Achtung!«
Mein Vater wollte Mama und mir auch Plätze kaufen, ich weigerte mich aber mitzugehen, denn ich habe mein Lebtag vor Pferden Angst gehabt.
Am andern Tage stand ein großes Lob über den Cirkus im Wochenblättchen.
Nachmittags war das Kränzchen bei mir; Herr von Schlehen hatte seiner Tochter, angesichts des Treibens hinter seinem Garten, nicht erlaubt uns einzuladen, und so saßen wir in unserm Garten, der keinerlei Aussicht bot, als auf die Rückseite von Scheuern und Häusern, und tunkten ehrbar unsern Zwieback in den dünnen Kaffee; starker schadet dem Teint, sagten unsre Mütter.
Als es Abend ward, kam Peter, um die Baronesse abzuholen. Sie flüsterte mir zu: »Widersprich nicht!« dann sagte sie laut: »Komm um zehn Uhr wieder, Peter, ich bleibe heut abend hier.« Und Peter zog ab. Das hatte mir gerade recht gepaßt, denn meine Eltern waren zu einer Silberhochzeit eingeladen, und mein Bruder befand sich auf dem Schützenplatz. Ich drückte ihr also voll Freude die Hand, als die andern gegangen waren.
»Das ist lieb von dir, Franzi.«
»Ach was, ich bleibe nicht hier – du mußt mit mir kommen.«
»Wohin denn?«
»In den Cirkus.«
»In den Cirkus? Wir beide allein? Du, ich glaube, das geht nicht. – Und denke nur, du als angehende Frau Pastorin – «
»Ach, das ist's eben! Papa und die Tante haben mir einfach verboten hinzugehen. Ich will aber hin und du mußt mit; es wird uns niemand erkennen, wir nehmen Schleier um. Ich bitte dich, einzige goldene Marie, thue mir den Gefallen und komme mit – ach, ich bitte dich! Nie wieder will ich dich zu etwas verleiten, nur dies eine Mal, bitte, bitte!«
Sie quälte und bat, als hinge ihre Seligkeit davon ab. Ich ließ mich endlich beschwatzen und holte richtig ein paar alte Umschlagetücher, und mit Hilfe von Schleiern waren wir in wenig Minuten unkenntlich und schlüpften auf die Straße. Wir wählten den Weg um die Promenade. Unter der Lindenallee war die Dämmerung so tief, daß es unmöglich war, erkannt zu werden. Am Pfarrhaus von St. Servatius blieb ich stehen.
»Schau, er hat Licht,« sagte ich.
»Ja, ja,« antwortete sie, »laß nur – ich werde ja vielleicht noch oft dieses Licht mit ihm teilen – sprich jetzt nicht davon. Ich will – ach, Marie, ich will den andern nur noch einmal sehen, nur noch einmal!«
Atemlos stand ich in der feuchten Allee still. »Den andern?« stammelte ich.
Sie faßte meine Hand und zog mich vorwärts. »Ja, den andern,« flüsterte sie, »ich erzählte euch ja damals davon – von – ach, du weißt ja – er ist hier, ich erkannte ihn vom Garten aus. – Goldene Marie, ich thue ja nichts Böses, nur sehen, sehen muß ich ihn ein einziges Mal noch!«

»Den – den Kunstreiter?«
»Ja doch – wenn du ihn so nennen willst.«
»Ich gehe nicht mit – bei Gott, ich gehe nicht mit!« rief ich außer mir.
»So laß es bleiben! – Wenn das deine Freundschaft ist – «
Sie wendete sich stolz ab; da lief ich ihr nach, ich durfte sie nicht allein gehen lassen, meinte ich. Was war es denn auch? Wir gingen in den Cirkus, einen Ort, den zu besuchen mein Vater selbst die Erlaubnis gegeben hatte, und – und – –
Wir befanden uns schon mitten im Gedränge des Schützenplatzes. Mir ward ganz elend zu Mut; der Bratwurstduft, vermengt mit dem Geruch der kleinen in Fett gebackenen Kuchen, die Ausdünstung einer unglaublichen Menschenmenge, der Geruch nach Oellampen und Pechfackeln, das Kreischen der Orgeln und der Mordgeschichtensänger, die Musik des Karussells, vermischt mit dem Brüllen der Ausrufer und den Glockenschlägen der Schaubuden, alles drang auf meine geängstigte Seele mit verstärkter Gewalt ein. Dazu das Gewimmel um mich, das Gedrängtwerden, das Durchwinden durch die Menge, die Dämmerung trotz des Mondscheins, die rohen Stimmen einiger Trunkener, ich war meiner selbst nicht mächtig. Hätte Franziska mich nicht so fest am Arme gehalten, ich glaube, ich wäre zu Boden gestürzt.
In der Nähe des Cirkus ward es stiller, ich möchte sagen, vornehmer. Die Wagen hatte man im Kreise darum aufgefahren, und aus dem Innern des großen Zeltes schallte Musik, dann Bravorufen; die Vorstellung hatte schon begonnen. Franzi zog mich nach einem Seiteneingang.
»Wo willst du hin?«
»Hierher, tritt nur ein!«
Wir kamen in einen verdeckten Gang, er schien nach den Ställen zu führen. Dort war die erleuchtete Manege. Ich sah eine Unzahl Menschenköpfe im Halbkreis, ich sah eine Reiterin im kurzen Röckchen auf dem Pferde stehend vorübergaloppieren – sie sprang gerade durch einen Reifen – dann hatte Franzi mich in eine Thür hineingezogen – ich befand mich vor einer steilen kurzen Treppe.
»Hinauf!« flüsterte sie, und nach einem Augenblick standen wir auf der Galerie für zwanzig Pfennig Entree. Zum Sitzen war es nicht.
»Ich gehe!« stieß ich entsetzt hervor – dann blieb ich doch.

In der Manege stand jetzt ein ungesatteltes Pferd, der Schimmel war es von neulich, und ein Mann in blauem Jockeyanzug schwang sich eben auf seinen Rücken, ein »Bild« von einem Menschen, ich mußte es selber anstaunen. Diese Schönheit! Machtvoll drang er auf mich ein, der Zauber der Persönlichkeit; die Menge, welche den geräumigen Cirkus gedrängt füllte, schien mit uns den Atem anzuhalten, es war ein eigenartiges, unbeschreibliches Schauspiel, dieses Pferd und dieser Mann. Was er alles that, weiß ich nicht, ich weiß nur, daß es schön war, wunderschön, daß ich die zitternde Wonne des ganzen Publikums teilte, die sich, als er vom Boden auf das Tier sprang, das in rasender Carriere die Erde kaum berührte, in wahnsinnigen Beifall auflöste.
Aus Franzis Mund kam ein halberstickter Schrei, ich hatte es ganz deutlich gehört – dann war sie verschwunden. Ich merkte es erst, daß sie nicht mehr neben mir war, als ein Clown die Manege mit einem nicht gerade zarten Witze betrat und ich sie zum Weggehen auffordern wollte. Ich stürzte das steile Treppchen hinunter, in heller Angst. – Dort unten am Eingang zum Stalle stand sie, Franziska, Baronesse Schlehen! Der Schleier war ihr vom Kopfe gefallen, das dicke Tuch zurückgeglitten, die Hände hielt sie auf die Brust gepreßt und schaute ihn, den Kunstreiter, mit leuchtenden Augen an. Und er – er machte sich scheinbar an dem Araber zu schaffen, den schon ein Stallknecht am Zügel hielt, und blickte zu ihr hinüber, verwundert, befangen fast.

Ich schüttelte sie angstvoll am Arme; da schickte sie sich an, mir zu folgen, aber ihr Kopf wandte sich wieder zurück und als auch ich zurückblickte, da sah ich ihn uns nachstarren mit dem nämlichen verwunderten Blicke, sah ihn mit respektvoller Verbeugung die kleine blau und weiß gestreifte Mütze abnehmen.
»Franzi, du bist wahnsinnig!« stieß ich hervor. »Um Gottes willen komm, komm!«
Sie folgte mir wortlos, und ich – als ich zu Hause in unsre einsame friedliche Wohnstube trat, ich begann zu weinen wie ein Kind in meiner Herzensangst.
»Was ist denn geschehen?« murmelte sie, »ich that doch nichts – «
»Doch, doch!« rief ich.
»Marie, ich gebe dir mein Wort, er kennt mich nicht, er hat keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe ihn in Braunschweig gesehen, habe all mein Taschengeld für den Cirkus ausgegeben, aber – was denkst du denn? Ich – ich – er gefällt mir eben nur, weiter nichts.«
»Und ist das noch nicht genug?« stieß ich hervor. »Dir soll keiner mehr gefallen.«
»Ist denn das etwas Böses?« fragte sie fast demütig. »Ich darf mich doch freuen über eine schöne Blume, über ein schönes Pferd, warum nicht über einen schönen Menschen?«
Ich antwortete nichts darauf. So saßen wir stumm am Fenster, bis Peter kam. Der Kuß, der heiße brennende Kuß auf meinen Mund, das war alles, was wir uns noch mitteilten, war auch das letzte auf lange Jahre.
Ich ahnte noch nicht, was sich nun entwickelte im dunklen Garten Franzis, unter den Linden am rauschenden Flusse. – Wir sahen uns nicht in den nächsten acht Tagen; dann, ich weiß es noch wie heute, an einem regnerischen Mittwoch, einige Tage nach dem Vogelschießen, kam mein Vater vom Gericht und mein Bruder aus der Schule, und sie trugen uns die unglaubliche Kunde ins Haus, die mir das Herz stillstehen ließ vor Schreck.
»Denke dir – lieber Gott, das Mädel ist mir immer exaltiert vorgekommen – – «
»Wer?« fragte meine Mutter.
»Die Franzi!«
»Nun, er ist ein famoser Kerl,« fiel mein Bruder ein.
»Denke dir, arme kleine Marie, die Franzi – «
»Franzi?« stammelte ich. Es war heute der erste August! Meine Gedanken flogen, wie Kraft suchend, zu dem Pfarrhaus, zu dem blassen, unschönen jungen Prediger.
»Die Franzi – vergiß sie, mein gutes Kind – ist auf Irrwege geraten – sie ist – es thut mir leid, daß es vor deine reinen Ohren kommt – sie ist mit dem Signor Arditi, dem Bruder des Direktors – «
»Futschi – futschikato!« sagte mein Bruder lachend.
Ich aber war ohnmächtig geworden.
Was ich damals gelitten habe, ich kann's nicht sagen. Meine Eltern brachten mich fort zu einer befreundeten Familie in eine größere Stadt; in der Heimat konnte ich nicht gesunden, weil mich alles an die verlorene Freundin erinnerte. – Wie Franzis Sippe es aufnahm, weiß ich nicht; aber ich erfuhr, daß ihre Mutter einst Kunstreiterin gewesen war, daß der Baron Schlehen sie gegen den Willen seiner Verwandtschaft geheiratet hatte und sie leidenschaftlich geliebt habe, die schöne Künstlerin. Diese Thatsache gab mir etwas wie einen Trost. Warum? vermochte ich nicht zu sagen, wohl weil ich gewissermaßen eine Entschuldigung für Franzis unerhörtes Thun darin erblickte.
Die Wogen ebneten sich auch über diesen Vorfall. Die einzige, die am Hochzeitstag von Doris und dem Pastor von Mühlen an Franzi dachte, war vielleicht ich. Sie lebte sehr glücklich, die stille ernste Doris, mit ihrem Gatten, der jetzt so mild geworden war wie das Mondlicht am Himmel, und so duldsam mit den Fehlern der lieben Pfarrkinder. Er ist rund und stattlich, und Doris hat uns alle fünf Kränzchenschwestern einmal zu Paten gebeten. Von Franzi wurde grundsätzlich in unserm Kränzchen nicht geredet; sie galt bei allen als eine Ausgestoßene, nur ich dachte zuweilen noch an sie. Herr von Schlehen war fortgezogen, wir erfuhren nicht, wohin.
Die Kränzchenschwestern haben unsre Photographie, auf der wir noch alle sieben waren, vernichtet; mit Franzi wollten sie nicht einmal im Bild mehr vereinigt sein. Ich aber habe das Bild behalten. Ich fühle mich wie mitschuldig, nicht weil ich sie damals in den Cirkus begleitete, sondern weil ich ähnliche Empfindungen hatte wie sie, als ich ihr Idol erblickte, weil auch ich mich, wenn auch nur für einen Augenblick, von jenem Zauber bestricken ließ, der sie ganz verblendete.
Ich bin überhaupt aus der Art geschlagen; anstatt eine solide tüchtige Hausfrau zu werden, bin ich Schriftstellerin geworden, ohne einen braven »Alten« und eine Stube voll Kinder. Aber ich zweifle ja nicht im mindesten daran, daß die andern das bessere Teil erwählten; sie bedauern mich wenigstens der Reihe nach, daß ich nicht ihren Lebensweg eingeschlagen habe.
Ich ziehe viel in der Welt umher, und vor kurzem, da fand ich – aber das muß ich eingehender erzählen:
Es war in einer großen Stadt am Rhein, und ich spazierte mit einer meiner Nichten über die Schiffbrücke. Ich dachte an alles andre, nur nicht an Franzi.
»Tante,« fragte das zehnjährige Mädchen an meinem Arme, »gehst du einmal mit mir in den Cirkus?«
»Ja, er kommt, Tante; die Wagen sind schon da.«
Es war auch so, und das Herz stand mir still, als ich an der nächsten Anschlagsäule las: »Cirkus Arditi«. – Franzi! Franzi! klang es mir durch den Sinn, Franzi, lebst du noch? Es wollte Abend werden nach einem heißen Sommertag; ein wahrer Goldglanz lag über dem Rhein, in Scharen strömten die Leute zum Thore hinaus. Gedankenvoll schlenderte ich dahin.

»Tante,« rief die Kleine, »ich habe ja vergessen das Band zu kaufen, das Mama haben wollte; komm noch mal mit in die Stadt.«
Ich ging mit ihr zurück durch die dämmernden Gassen und trat hinter dem Kinde in das Putzgeschäft. Eine Dame stand vor dem Ladentisch im Trauerhut, zierlich, schlank, in einem dunklen Kleide, sie schien mir so bekannt.
»Lächerlich!« sage ich mir, weil die Franzi mir gerade im Sinne liegt. Dann stutze ich – das ist ihre Stimme, diese eigentümlich verschleierte Stimme, die nur sie hatte.
Und nun wendet sie sich um – das ist das feine Antlitz, das sind die braunen Haare und vor allem die Augen, und doch so anders, ach, so anders die Züge, entstellt vom Weinen und gramgefurcht.
»Franzi!« sage ich leise, »kennst du mich noch?«
Sie sieht mich erstaunt an, sie kennt mich erst, nachdem ich den Namen genannt. Dann bricht sie in leidenschaftliches Schluchzen aus, dessen sie vergebens Herr zu werden sucht.
»Geh nach Hause,« sage ich zu dem Kinde, »bestelle Mama, ich hätte eine Bekannte getroffen und käme nicht zum Essen.« Dann wende ich mich um. »Komm, Franzi, ich gehe mit dir.«
Sie folgt mir. – »Wir sind im Wagen,« sagt sie, »ich weiß nicht – ob – «
»Ja natürlich!« sage ich rasch.
»Daß ich dich heute gerade finden muß – heute – « murmelt sie.
»Du bist in Trauer, Franzi, welcher Verlust betraf dich?«
»Der größte!« sagte sie leise. »Er – er – « und sie preßte das Tuch an den Mund, um einen Schmerzensschrei zu ersticken.
In dem wunderlichen Raume, den der Wagen bot, diesem schaukelnden engen Heim, das sie sich erwählt hatte anstatt des ehrwürdigen Pfarrhauses, saß ich neben ihr. Es befand sich Gott weiß was alles darin, Sofa, Tische, Stühle, Blumen, ein Kanarienvogel, Nähtischchen, Ofen, ach, ich erinnere mich nicht all dieser Gegenstände. Dort Lorbeerkränze und welke Sträuße, hier ein buntes Atlasjäckchen, Programme, Reifen, und mitten drin die trauernde Frau, ihre Hand in das Fell eines prächtigen weißen Pudels vergraben, eines echten Cirkuspudels; und so heiß, so schluchzend, wie Doris auch nicht heißer würde um ihren Pastor schluchzen können, sollte ihn das Schicksal ihr entreißen.

»Er ist schon auf dem Kirchhof,« flüsterte sie, wieder in herzzerreißendes Schluchzen ausbrechend.
»Franzi, wann starb er?«
»Heute früh!«
»War er lange krank, arme Seele?«
»Er stürzte in Köln bei der Vorstellung und – der Arzt meinte, es habe nichts zu bedeuten, und heute früh – da – auf einmal – «
»Armes Kind!«
»Er ist schon auf dem Kirchhof,« flüsterte sie, wieder in herzzerreißendes Schluchzen ausbrechend »ich konnte ihn nicht hier lassen.«
»Hast du Kinder?«
»Einen Sohn!« Sie richtete sich auf. »Marie, du mußt ihn sehen – er ist so schön, so schön wie sein Vater.«
Sie winkte aus dem Wagenfenster und nicht lange darauf trat ein junger Mensch von achtzehn Jahren ein. Schön ist er, ja sie hat recht, sehr schön; gut ist er auch, denn unbekümmert um mich fällt er seiner Mittler um den Hals, und beide weinen. »Wir hatten uns so lieb, wir drei,« entschuldigte er sich dann gegen mich.
Draußen im großen Zelt hebt die Musik an zu spielen – die Vorstellung beginnt. Er ist gegangen, sie sitzt und brütet wortlos vor sich hin.
»Weißt du noch,« fragt sie endlich, »wie du mit mir gegangen bist, als ich ihn sehen wollte?«
»Ja, Franzi, und tausend Vorwürfe habe ich mir gemacht darüber.«
»Warum? Ich bin so glücklich gewesen, so glücklich! Ich wollte dir auch immer schreiben, aber – hättest du einen Brief von mir angenommen?«
»Ich? Ja – aber – «
»Aber die Deinigen nicht! Ich dachte es mir.«
Und wie ich mich unwillkürlich umschaue, da hängt auch das Kränzchenbild dort. Himmel – was würde die Frau Pastorin für ein Gesicht machen, wenn sie sich in dem Cirkuswagen wüßte! dachte ich.
»Nur deinetwegen habe ich das Bild aufbewahrt,« sagte sie, als hätte sie meine Gedanken erraten.
»Und war dir das Leben hier in dieser Umgebung nicht ein bißchen ungewohnt und schwer, Franzi?«
»Alles Leben ist schwer,« sagte sie ernst, »aber ich bin glücklich gewesen, glücklich bis heute. Er war so gut und so fleißig und so treu und – ich liebte ihn.«
Es war spät, als ich mich erhob; die Menge aus dem Cirkus längst heimgegangen.
»Uebermorgen früh begraben wir ihn,« sagte sie, »ganz früh.«
Da ging ich hin und habe auf dem taufeuchten Friedhof am Grabe dessen gestanden, der so gut, so fleißig und so treu war. Gibt's ein besseres Lob?
Dann ist sie weitergezogen. Ob ich ihr jemals wieder begegnen werde?
Als ich später einmal das Heimatstädtchen auf einer Harzreise berührte, vereinigte Doris das alte Kränzchen, soweit es möglich war, im Pfarrhaus; auch Minchen war zufällig anwesend. Sie hatte einen Offizier geheiratet und verlebte die Manöverwochen bei der Mutter; sie war so bleich und still, kaum wiederzuerkennen.
Wir schwatzten hin und her. »Kinder,« sagte ich, denn ich dachte plötzlich an Franziska, »wißt ihr, wen ich am Rheine traf? Unsre Franzi.«
Neugier, Achselzucken. »Na, erzähle doch!«
Und ich that es. Sie wurden still, eine nach der andern, nur Frau Doris hatte eine Thräne im Auge. Als ich geendet hatte, stand ihr Mann in der Thüre, er wandte sich rasch ab.
»Arme Franzi!« murmelte irgend eine.
»Ja, sie hat's nicht besser gewollt!« die andre.
»Man liegt, wie man sich bettet,« erklärte Frau Julie, und man sah es ihr an, daß sie sich recht bequem gebettet hatte auf dem schönen Rittergut ihres Mannes.

Minchen, die so blaß und zart und ernst geworden war in ihrer Ehe, flüsterte etwas – ich weiß nicht, ob ich es recht verstanden habe. – »So gut, so treu,« wiederholte sie, »glückliche Franzi!«
Selma aber mußte auch etwas sagen. Sie zählte halblaut die Maschen an ihrem Kinderstrumpf, und eine neue Nadel beginnend, seufzte sie mit höchst zufriedener Miene: »Ja, ja, das Leben! Kunterbunt geht's zu. Gott sei Dank, daß man so etwas nur vom Hörensagen kennt.«
Sie hatte recht; sie steckte das ganze Jahr über das Stumpfnäschen nicht aus ihrer Wirtschaft heraus und war berühmt geworden wegen der tadellosesten Wäsche und der artigsten Kinder.
»Für dich aber,« fuhr sie fort, »ist's natürlich ein gefundener Bissen, denn du bist ja Romanschriftstellerin, und suchest, was du verschlingest.«
