
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
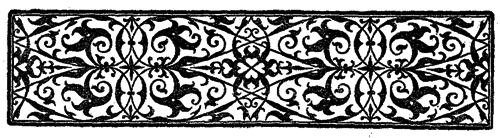
Rom.
Die Sixtinische Kapelle.
Ungeheure Gerüste versperren einen Teil derselben. An den Wänden und an der Decke sind Fresken angefangen. Gewisse Partien erscheinen vollendet; an manchen Stellen wird die bloße Zeichnung, mehr oder minder fertig, sichtbar. Michelangelo, stehend; er arbeitet eifrig. Granacci sitzt einige Schritte von ihm entfernt auf einem Schemel, unter Kalkhaufen, Farbentöpfen, Balken und Gerätschaften aller Art.
Granacci. Eure Betrachtungen sind nicht heiter, Meister.
Michelangelo. Ich sehe die Dinge so.
Granacci. Die Künste sind nie so in Blüte gewesen! Nie sind so schöne Werke zu Tage gefördert worden! Wie viele glänzende, übermenschliche Maler, Bildhauer, Baumeister! ...
Michelangelo. Ich kenne keine übermenschlichen Menschen. Das sind lächerliche Redensarten. Lästert Gott nicht.
Granacci. Lästerung, wenn Ihr wollt; ich halte Euch für einen Halbgott, und wie ich, denken auch andere.
Runzelt nicht die Stirne, und laßt mich fortfahren. Fast jeden Tag erlebt man Feste, wie ihresgleichen nie geschaut worden. Hier in Rom, wie in Florenz, wie in Venedig, in Mailand, in Bologna, in Neapel sind die großartigen Erfindungen der Alten in dieser Art Herrlichkeit weit überboten worden. An Gelehrten, Dichtern, Schriftstellern mangelt es nicht. Unaufhörlich treten neue auf: da ist Sannazaro, da ist Sadoleto, da ist Bembo, Navagero, der unnachahmliche, hehre Ariosto, da ist Bibbiena mit seiner Calandra und Meister Niccolo Machiavelli mit seiner Mandragola. Was soll ich Besseres oder mehr anführen? Papst Leo X. und seine Kardinäle erscheinen meiner entzückten Phantasie als die ebenbürtigen Genossen des großen Jupiter und der Götter des Pantheon, und noch dazu wohnen sie in einem unendlich viel schöneren Olymp als der ihrer fabelhaften Vorgänger, denn diesen ehemaligen Olymp, den hatte der alte Coelus eingerichtet, ein armseliger Gott ohne Geschmack und ohne Arg; während heute, da haben wir Künstler das Firmament geschaffen, wir verschönern es, indem wir es unaufhörlich mit wundervollen Farbentönen ausmalen, es von funkelnden Sternen erstrahlen lassen, und ich sage Euch, daß da, wo Ihr Hand anlegt, da, wo Meister Raffael, Andrea del Sarto, Sansovino, Tizian und so viele andere arbeiten, das Werk unsterblich ist.
Michelangelo. Ihr seid ein Schwätzer, Granacci, und ein Blinder, unfähig, die Dürftigkeit dessen zu begreifen, das Euch bezaubert, und die krasse Schwachköpfigkeit der Leute, die Euch entzücken und doch so wenig wert sind.
Granacci. Dann beweist mir, daß ich unrecht habe, da Ihr so durchaus alles tadeln wollt.
Michelangelo. Das wird nicht schwer sein. Tragt mir Eure Narreteien vor, und ich will Euch antworten.
Granacci. Der Papst ist der leidenschaftlichste Beschützer der Kunst, den die Welt jemals gekannt hat. Ihr könnt nicht leugnen, daß seine Wohltaten auf uns herabregnen wie ein unversiegliches und höchst schmackhaftes Manna.
Michelangelo. Papst Leo X. liebt nicht die Künste. Er liebt den Luxus, und das ist etwas ganz anderes. Alles was glänzt und ihm Lobsprüche einbringt, scheint ihm seines Schutzes würdig, und für ihn sind die Künste Werkzeuge der Eitelkeit. Was sie ausdrücken, danach fragt er nicht. Der erste der Sterblichen, der dem Luxus huldigte, hat vielleicht angefangen, den Weg zu ebnen, auf dem die Künste in die Welt gekommen sind; aber der zweite hat diese wieder über den Haufen geworfen, um den Schwulst und die Lüge an ihre Stelle zu setzen.
Granacci. Ach! teurer Meister, was Ihr doch für ein Vergnügen daran findet anzuklagen! Diesen Papst, unseren großen Papst Leo, wie hart beurteilt Ihr ihn! Zöget Ihr denn den wilden Sinn seines Vorgängers vor?
Michelangelo. Julius II. ist der einzige wahre Fürst, den meine Augen je geschaut haben! Er war nicht der Mann der Sinnenfreuden. Er faßte nur das, was Ehrfurcht einflößt, und ließ nur das Gewaltige gelten. Sein einziges Sinnen und Sorgen war bei allen Anlässen, in der heiligen Kirche die Siegerin zu schaffen und zu hinterlassen, die den Widerstand der Gottlosen mit nervigem Fuße zerträte. Er hätte den gesamten geistlichen Stand zum Guten zurückführen mögen; er wollte, daß die Barbaren aus Italien verjagt würden; wie er die Empörungen der Barone, der Colonna, der Vitelli, der Orsini, unterdrückte, so litt er ebensowenig, daß Ordnung und Sicherheit der Stadt gestört wurde, und zu seiner Zeit durfte – was man nie erlebt – nicht ein Dieb, nicht ein Beutelschneider sich mit seinem gemeinen Gesichte auf die Straßen Roms hinauswagen! Von seinen Künstlern verlangte er gewaltige Denkmäler, ungeheure Fresken, mächtig große Gemälde; er sann nur aufs Gigantische, wie es einem Herrschergeiste gleich dem seinigen anstand. Ich habe alles verloren, da ich diesen erhabenen Herrn verlor; aber die Kunst, ich meine die Himmelstochter, sie, die Venus Urania, und nicht die liederliche Göttin der Gassen, diese Kunst hat noch mehr verloren!
Granacci. Ich sehe durchaus nicht ein, worauf Ihr Euch stützt, um so gewagte Dinge zu behaupten. Kaum hat das Konklave Leo X. die Schlüssel des heiligen Petrus eingehändigt, da umgiebt sich der Papst mit vortrefflichen Gelehrten und Dichtern; er beruft und wählt zu Geheimschreibern den liebenswürdigen Sadoleto, von dem ich soeben sprach, den feinen Bembo. Euch läßt er die begonnenen Arbeiten fortsetzen ...
Michelangelo. Er hat mir das Grabmal Julius' II. aus der Hand gerissen, mein Lieblingswerk, daran ich mit ganzer Seele arbeitete und das nun niemals das Licht des Tages erblicken wird. Da wird es bleiben, in meinem Haupte ... ein totgeborenes Kind ... glaubst du, daß das ein geringer Kummer sei?
Granacci. Ich gebe zu, es ist ein großes Unglück; aber es beweist nur, daß der Papst, wie alle Leute, die die Künstler bezahlen, seine Launen hat. Er will Euch lieber zu seinem Ruhme und seinem Vergnügen, als zur Apotheose seines Vorgängers anstellen, für den er sicherlich nur eine sehr mäßige Liebe empfand ... Aber da kommt Euch ein Besucher.
Michelangelo. Wieder ein Zudringlicher! ... Ich will ihn gehörig abführen ... Herr, wer Ihr auch seid, macht Euch nicht die Mühe, diese Leiter heraufzuklettern. Außerdem, daß sie holperig und nicht besonders haltbar ist, habe ich auch keine Zeit mit jemandem zu plaudern.
Machiavelli (unten ans der Kapelle seine Stimme erhebend). Hochverehrtester Herr Michelangelo, wollt Ihr einem alten Freunde, Kameraden und Landsmann nicht erlauben. Euch zu umarmen?
Michelangelo (oben vom Gerüste herabblickend). Es ist Herr Niccolo Machiavelli ... Kommt herauf, da Ihr einmal da seid. Ihr werdet, denke ich, gestatten, daß ich in meiner Arbeit fortfahre, und Euch wie mir die müßigen Komplimente sparen.
Machiavelli. Ich bin nicht so thöricht, solche zu riskieren; ich kenne Euren Sinn.
Michelangelo. Wo kommt Ihr her?
Machiavelli. Von Florenz ... Ich bin soeben aus dem Gefängnisse entlassen; Ihr habt es vielleicht erfahren.
Granacci. In der Tat ... Ihr seid in der Verschwörung Boscolis bloßgestellt gewesen.
Machiavelli. Infolge der abscheulichsten Verleumdung; ich bin der ergebene Diener des Hauses Medici.
Michelangelo. Ergeben? ... Hm! ... ergeben! Ich gratuliere ... Ihr seid auch andern ergeben gewesen.
Machiavelli (die Achseln zuckend). Wer von uns ist nicht jung gewesen? Ich habe mich auf dem Leim von Bruder Girolamo Savonarolas Irrereden fangen lassen, das weiß jeder.
Michelangelo. Irrereden, soviel Ihr wollt. Man redet irre, wenn man Ehrenhaftigkeit, Rechtlichkeit, Enthaltsamkeit anempfiehlt; und doch, der Glanzpunkt Eures Lebens, Herr Niccolo, es wird der Irrtum Eurer Jugend sein.
Machiavelli. Vielleicht habt Ihr recht, vielleicht habt Ihr unrecht; sicher ist, daß diese Art Verdienst, wie die Menschheit einmal ist, nichts Gutes weder für mich noch für die andern bringen konnte.
Michelangelo. So macht Ihr es Euch zum Vorwurf, einmal dem Segen der Religion nachgegangen zu sein? Ich hätte wohl große Lust, Euer Abbild irgendwo auf dieser Wand unter der Gestalt eines hohnlachenden Teufels zu verewigen.
Machiavelli. Viel Ehre für mich. In der rechtgläubigen Gottesgelehrtheit gilt der Satz, daß die geriebensten von allen Teufeln, die heutzutage am Ruhme der Hülle arbeiten, in ihren Anfängen gute kleine Engelchen gewesen sind, die nicht über ihre Nasenspitze hinaus sahen. Was hat sie verdorben? Die Erfahrung. Kurz, ich habe, wie Ihr, wie Granacci, wie so viele andere, an die Möglichkeit geglaubt, in Florenz zu leben und dabei seine Ehrlichkeit zu bewahren. Das war ein großes Unheil für mich, und ich habe mir da einen Unglückstrank bereitet, daraus ich von Zeit zu Zeit einen Schluck hinunterwürgen muß. Just das habe ich soeben getan. Nichtsdestoweniger habe ich den dritten Akt meiner Mandragola beendigt.
Michelangelo. Sie wird ein schönes Werk werden, Herr Niccolo; denn wenn Ihr auch ein dürftiger Politikus seid, so seid Ihr doch ein ausgezeichneter Litterat, und damit müßt Ihr Euch trösten.
Machiavelli. Ein dürftiger Politikus? Das Urteil scheint mir hart; aber vielleicht habt Ihr recht, alles wohl bedacht. Was! ich hätte nur darum soviel über die Geschichte nachgedacht, soviel den Livius ausgelegt, soviel in unseren Florentiner Annalen studiert, und die Charaktere und Regierungen aller Völker geprüft, um am Ende zu erkennen und mir selbst einzugestehen, daß ich nur ein dürftiger Politikus sei? (Er läßt sich nachdenklich auf einen Schemel in einer Ecke nieder und blickt mit gekreuzten Armen und Beinen starr vor sich hin). Ein dürftiger Politikus! Es ist mir in der Tat begegnet, daß ich mich täuschte, und was das Schlimmste, ich habe, auch wenn ich recht hatte, kein Vertrauen in meine Ideen einzuflößen vermocht. Ich könnte zu meiner Entschuldigung anführen, daß es keine mehr auf Vermutungen fußende Wissenschaft giebt als die Politik, keine, deren Mutmaßungen so dazu angetan sind, durch die unvorhergesehenen Zwischenfälle, durch den leisesten Windhauch über den Haufen geworfen zu werden. Da seht einmal! wenn die Sicherheit des Blickes, die Festigkeit in der Ausführung, die Genialität in der Anordnung ausreichten, den Erfolg zu sichern, so würde der Valentino ohne allen Zweifel ein italienisches Königreich begründet und unsere Zukunft entschieden haben.
Michelangelo. Das wäre gewesen, um Gottvater erröten zu machen.
Machiavelli. Gottvater hat Heliogabalus regieren sehen und ist nicht im allermindesten errötet; er sieht alle Tage die ärgsten Schelme und die gemeinsten Lumpen einander den Erfolg von Hand zu Hand reichen; er ist darum nicht um einen Deut weniger obenauf. – Nach dem Manne, den ich eben nannte, ist, was die Wichtigkeit der Absichten und die Wuchtigkeit der Taten anlangt, der selige Papst Julius II. von niemandem übertroffen worden.
Michelangelo. Das ist wahr.
Machiavelli. Er hatte nur Narren und gemeine Wichte, die ihm die Stirn bieten konnten; den Herzog von Ferrara nehme ich davon aus; aber von ungefähr war er alt, und er hat sterben müssen.
Michelangelo. Nie wird man wieder seinesgleichen sehn.
Machiavelli. Mag sein! Darum bleibt es nicht weniger wahr, daß die Welt sich weiterdreht und sich in das schickt, was sie vorfindet. Das ist heutzutage der Triumph der Dummköpfe. Sforza von Mailand gilt keine taube Nuß; Fregoso in Genua ist ein Ränkeschmied niederen Ranges, der, den Verrat in der Hand, das Ohr nach jedem Gerede hin, weder hoch noch weit zielt. Francesco Maria von Urbino, ein armseliger Plagiarius des Valentino, führt den Dolch ebenso flink, aber das ist auch alles; er wird auf seinen Beinen dahinschwanken, bis er fällt; die Medici von Florenz würden nicht drei Tage vorhalten, wenn sie nicht zu Rom mit dem Papste herrschten, die Venetianer leben und werden leben, sie werden stark, ruhmreich, mächtig sein, aber sie sind keine Schmetterlingspuppen, denen hinreichend starke Flügel bestimmt sind, um sich über die mittlere Luftschicht hinaus zu erheben; so daß schließlich in Italien nichts bleibt als drei Mächte: der Papst, die Franzosen und die Spanier.
Michelangelo. Ich höre Euch mit lebhafter Genugtuung reden. Nun wohl denn! Erklärt uns jetzt, wie Ihr jede dieser Mächte anseht und wem nach Eurer Schätzung das Scepter verbleiben wird.
Machiavelli. Ich wiederhole es Euch, ich habe auf meine Kosten erfahren, daß, wenn die Astrologie wenig sicher, die Politik kaum sicherer ist. Ich möchte nicht gerne den Propheten spielen. Was die Franzosen angeht, so sind sie für den Augenblick schachmatt, verjagt; bis auf die Citadelle von Mailand und drei oder vier Nester haben sie keinen Boden mehr bei uns. Ihr neuer König, der Angoulême, scheint es eiliger zu haben, Prahlereien loszulassen und sich gute Tage zu machen, als mutige Unternehmungen auszuführen; so glaube ich denn, daß Papst Leo X., der diese Leute haßt, teils weil er in der Schlacht von Ravenna ihr Gefangener gewesen ist, teils aus einer guten Anzahl anderer Nebengründe, sich als von ihnen befreit betrachten darf.
Granacci. Um so besser! Ich bin ein guter Florentiner und verwünsche diese eitlen Schreihälse. Sie sind nie offen und ehrlich weder mit den Republikanern, noch mit der Gegenpartei gewesen. Nun aber, was denkt Ihr von den Spaniern?
Machiavelli. Ihr König Karl ist ganz jung. Wer weiß, was er wert sein wird? Er ist der Sohn eines ziemlich nichtssagenden liederlichen Burschen und einer armen Verrückten. Eine unglückliche Vorbedeutung! Und was noch bedenklicher, mehr Flamländer als Castilianer; außerdem Burgunder und Österreicher; seine Interessen sind allerwärts zerstreut. Zieht man die Summe seiner Kräfte in Betracht, so könnte es ja scheinen, als wäre es Wunders was; aber die Glieder halten nicht zusammen und tun einander Schaden. Wenn der Besitzer solcher Bruchstücke nur ein wenig sorgsam seiner Interessen warten will, so wird er sein Leben damit zubringen müssen, von einem Orte zum andern zu eilen. Und auch dann noch wird es ihm nicht leicht fallen, immer zur rechten Zeit zu kommen. Um sich von Valladolid nach Brügge zu begeben, bedarf er der Erlaubnis des Königs Franz. Sodann erhebt sich eine andere Klippe in seinem eigenen Ehrgeiz, sofern er solchen hat. Wenn Kaiser Maximilian, sein Großvater, stirbt, wird der junge Karl ohne Zweifel auf die Kaiserkrone Anspruch machen. Da seht Ihr gleich den Streit: auch der Franzos hat ein Auge darauf geworfen; der Engländer macht sich Hoffnung darauf; die Kurfürsten haben ihre Pläne ... Diese Leute werden sich zerfleischen; König Karl, in jedem der unzähligen Gemächer seines eigenen Hauses schon so beschäftigt, wird zur Zielscheibe für eine Schar von Nebenbuhlern werden; folglich wird er in Italien nur geringe Macht besitzen, und daher schließe ich, daß Papst Leo X. nach seinem Gefallen darin herrschen wird. Ich weiß nicht, ob meine Berechnungen mich trügen, viel kann es nicht sein.
Michelangelo. Aber wenn von ungefähr Franz I. mehr gälte, als es Euch scheint, und es Karl seinerseits weder an Geist noch an Mut fehlte?
Machiavelli. Unter diesen beiden Voraussetzungen darf man nichts mehr weissagen. Alles wird von der Geisteskraft und dem Appetit dieser beiden Herren abhängen. Das Unmögliche kann zur geläufigen Alltagstatsache werden ... Große Fürsten kommen nicht oft vor.
Granacci. Ihr habt recht. Gleichwohl, in unserer Zeit haben selbst die Schwachen Kraft. Alles treibt aufs Große, und die Könige müssen es eher dazu bringen als die andern.
Machiavelli. Ich habe in meinem Leben mehr unfähige Menschen und mehr Eigentümer kleiner Hirne angetroffen, als ich wohl hätte erwarten sollen. So werdet Ihr mir erlauben, daß ich nicht allzuviel auf das Aufblühen des Talentes rechne und Euch wiederhole, daß für den Augenblick derjenige, der der Nächste ist, hier alles zu beherrschen, der Papst ist.
Michelangelo. Ich habe keine große Meinung von ihm.
Machiavelli. Ich ebensowenig; ich halte ihn ganz einfach für einen ehrenwerten großen Herrn von leichten Sitten, der seinen Geist pflegt, wie seine Hände. Aber ebenso, wie er neben besagten so wunderschönen Händen in seinem Körper ein Paar große, bis zur Stirn vorspringende Augen besitzt, die nicht das mindeste sehen – was ihn dem Nero ähnlich macht, mit dem er übrigens auch den Zug gemeinsam hat, daß er ein Liebhaber aller Kuriositäten ist –; ebenso gewahrt man an seinem so sehr und mit soviel Sorgfalt gebildeten Geiste Gebrechen, die für das Ganze mißlich sind. Er zeigt einen auserlesenen Geschmack in allen Dingen, und er ist gutmütig. Er redet mit ebenso gewaltigem Eifer mit den gemeinsten Possenreißern wie mit Sadoleto oder Ariosto; er trägt Euch Fresken und Statuen auf und wird bei Raffael Gemälde bestellen, weil das kostbares Spielwerk ist, und der heilige Vater, um mit noch mehr Ruhm zu prunken, sich gerne ein Gaukelmännchen aus einem Sterne machen würde; aber, davon dürft Ihr überzeugt sein, vor seinem Gewissen zieht er der Betrachtung Eurer Meisterwerke eine Hasenjagdpartie auf seinem Landgute zu Magliana oder ein feines Abendessen im Vatikan vor. Da werden dann Klöße von geröstetem Werg und Strohpastete serviert, daß die Gäste Gesichter schneiden, zur ungeheuren Freude des Papstes, während ein kräftiger Sturm burlesker Schmähreden die Talente Evangelista Tarasconis und Aretinos ins hellste Licht setzt.
Michelangelo. Das ist ungefähr dasselbe, was ich eben Granacci sagte. Von einem solchen Manne ist nichts zu erwarten.
Machiavelli. Verzeiht. Alles wohl erwogen, lassen sich die Ereignisse an, als wollten sie unter seinen Händen so wohlgefügig werden, daß er uns, ohne den Enthusiasmus Savonarolas, oder den entschlossenen Ehrgeiz des Valentino, oder die gewaltige Kraft Julius' II. zu besitzen, trotz seines Tändelns und Seifenblasenspielens, am Ende noch ein einiges Italien beschert. Er wird Neapel, als Lehen der Kirche, dem armen Karl von Spanien wieder abnehmen, der nicht weiß, wie er seine Habe wahren soll; und er kann nicht verfehlen – so leichte Arbeit hat er –, den König von England, einen dem heiligen Stuhle blindlings ergebenen Schulmeister und Schmierer, Frankreich so gehörig in die Weichen zu drücken, daß Franz I. niemals wagen wird, sein Land zu verlassen, um sich an dem unsrigen zu vergreifen. Dann wird Leo Mailand in Beschlag nehmen und es behalten, wie Julius es mit der Romagna gemacht hat.
Michelangelo. In einer Art ist das eine ganz hübsche Perspektive; aber sie macht mir keine Freude.
Machiavelli. Mir ebensowenig. Ich fühle und weiß, warum! Italien ist nie so herrlich gewesen, wie heute. Indessen, dieser Glanz ist nicht rein. Es giebt zu viele Laster, zu viel Verdorbenheit, und wenn wir in die Hände der verderbtesten aller Mächte und in Abhängigkeit von dem raubgierigsten Hofe, den es je gegeben, geraten, dann wird Italien zwar den Fremdling los und in ein Gebinde zusammengefaßt sein; aber binnen wenigen Jahren werden wir es ebenso moralisch wie physisch erschöpft sehen. Die Mönche und die Priester werden es dermaßen entkräftet haben, daß es sich nimmer davon erholt.
Michelangelo. Ich glaube Euch; ich bin ein getreuer Sohn der heiligen Kirche; aber solange die Kleriker bleiben, wie sie sind, wünschte ich sie nicht zu Regierenden. Alles in allem leben wir in einer höchst elenden Zeit.
Machiavelli. Über alle Maßen elend, und ich hoffe auf nichts mehr.
Granacci. Der Himmel sollte mit euch allen beiden Erbarmen haben! Wollte man euch Glauben schenken, so glitten wir dem Verfalle zu. Ei, Herr Niccolo, redet Ihr im Ernste? Und vor meinem Meister und in der Sixtinischen Kapelle haltet Ihr uns solche Reden? Habt Ihr eine größere Epoche gekannt? Geht mir, Herr Niccolo, das glaubt Ihr doch selbst nicht! Ich für mein Teil preise den Himmel jeden Tag, daß ich in einer solchen Zeit geboren bin. Wenn ich mit irgend jemandem rede, so begegnet es mir, daß ich nicht acht darauf gebe, was er mir erwidert; ich betrachte die Züge meines Partners und sage mir: das ist ein Mann, dessen Name auf einem Blatte der Geschichte bleiben wird! Ich verspüre einen Duft von Ambrosia und Unsterblichkeit in den Lüften; ich atme ihn ein, so tief ich kann. Allerwärts bewundere ich, freue ich mich, und ihr kommt da beide und behauptet ... Geht mir doch! Ihr seid grämliche Geister, krankhafte Phantasten, Undankbare, wahrhaftig ja, die ärgsten aller Undankbaren, denn ihr solltet euch erkenntlicher gegen Gott zeigen für die schönen Dinge, die er euch, jedem auf seinem Gebiete, auszuführen die Mittel gegeben hat.
Machiavelli. Ich weiß nicht, ob ich schöne Dinge ausführe; aber was ich ganz sicher weiß, ist, daß wenn der hochwürdigste Kardinal Bibbiena mir nicht diesen Morgen ein halb Dutzend Taler in die Hand gesteckt hätte, ich nichts zu Mittag haben würde. Das soll mein letztes Wort sein, und damit, Meister Michelangelo, und Ihr, mein liebenswürdiger Granacci, verlasse ich euch, freue mich, euch gesehen zu haben und wünsche euch allen beiden, daß ihr gesund bleiben möget.
Michelangelo. Lebt wohl, Meister Niccolo, mein Freund. Seid ja darauf bedacht, daß Ihr die Mandragola beendigt; sie ist Euer schönstes Werk.
Auf dem Monte Pincio.
Auf dem Rasen, unter Platanen- und Zypressengruppen, sind Gesellschaften verschiedener Stände, die lustwandeln und die Reize des Abends genießen wollen, weithin verstreut. Man sieht Bürger, Priester, Mönche, Frauen, junge Leute, Kinder; die einen auf Teppichen sitzend oder halb hingestreckt, die anderen sich ergehend; diese essen Früchte oder Kuchen, jene sind in ernsthafter Unterhaltung begriffen. Man hört lautes Gelächter. Das Wetter ist herrlich, der Gesichtskreis unabsehbar. Einer Gruppe von mehreren jungen Mädchen und Männern, zumeist mit Blumen bekränzt und fein gekleidet, liest ein Bursche von zwanzig Jahren Verse vor.
Der Bursche.
»Stern meines Himmels, hehre Zauberin!
Der Stirne Leuchten spiegelt Phöbus' Strahlen,
Der Augen Gluten Amors Flammen stahlen,
Der Lippen Süße reißt den Bacchus hin.
Der Locken Schwarz entzückt der Musen Sinn,
Mit Hand und Fuß mag jede Grazie prahlen,
Des Leibes kleinste Linie nachzumalen,
Der Künste höchstem Meister wär's Gewinn.
Dein Lachen quillt aus reiner Seele Bronnen,
Und all dein Reiz umwebt dich jederstund
Wie Demantstaub im goldnen Schein der Sonnen:
Und doch! Was gilt die Pracht, die allen kund,
Vor einem Wort, von Lächeln leis umsponnen –
›Ich liebe dich‹ – aus deinem holden Mund!«
(Beifall und Gelächter; ein junges Mädchen erhebt sich, klatscht in die Hände und eilt auf den Dichter zu.)
Das junge Mädchen. Für mich, Troilo, hast du das geschrieben? Für mich, für mich, für mich ganz allein?
Der Bursche. Meiner Seel', Giacinta, ganz gewiß ist es für dich und für keine andere!
Das junge Mädchen. Nun denn! Da hast' deinen Lohn!
(Sie wirft sich in seine Arme, drückt ihn ans Herz und setzt ihm einen Kranz aufs Haupt.)
Ein anderes junges Mädchen. Du, Emilio, verstehst es nun einmal nicht, das kleinste Verschen auf mich zu dichten, hoffentlich aber hast du wenigstens das Talent, uns eine Geschichte zu erzählen. Setz' dich dahin, und sprich, wir hören dir zu.
Emilio. Ich weiß nicht recht, was ich euch sagen soll.
Alle (in die Hände klatschend). Nichts da, keine Ausrede, erzählt, erzählt!
Emilio. Wenn es denn sein muß, so wißt, daß einstmals zu Verona ein alter Kaufmann namens Ser Jacopo lebte, der hatte eine sehr junge und sehr hübsche Frau. Sein Nachbar, einer der liebenswürdigsten Kavaliere der Stadt, hatte sich angewöhnt, über die Mauer in Ser Jacopos Garten zu sehen, und ...
(Die Geschichte geht weiter.)
(Drei Bürger spazieren vorbei, dicht nebeneinander gehend.)
Erster Bürger. Ich bin meiner Behauptung vollkommen gewiß. Mein Sohn Giulio ist erst zehn Jahre alt, und er wird eine der Leuchten des Jahrhunderts werden. Das ist Bruder Filippos Meinung. Er macht kein Hehl daraus und sagt es allen, denen er begegnet, immer wieder.
Zweiter Bürger. Mein Sohn Tommaso ist Eurem Sohne Giulio vollständig gleich, und er ist neun Jahre, keinen Tag mehr ... oder doch, ja! er ist acht Tage älter, denn er ist den 14. Juni geboren, gerade vor neun Jahren, und wir haben heute den 22. Er ist also neun Jahre und acht Tage, und Pater Roberto ruft mir jeden Morgen zu: Herr Pompeo, Euer Sohn ... Wie drücktet Ihr es doch aus, Herr Annibale?
Erster Bürger. Wird eine der Leuchten des Jahrhunderts werden!
Zweiter Bürger. Genau dasselbe ruft mir der Pater Roberto zu.
Dritter Bürger. Meine Herrn Gevattern und liebe Nachbarn, ich mache euch mein aufrichtigstes Kompliment. Bruder Filippo und Pater Roberto müssen sehr einsichtsvolle Leute sein.
Erster Bürger. Bruder Filippo ist der Beichtvater meiner Frau, seit diese angefangen hat, ihre erste Sünde zu begehen! Wir haben alles Vertrauen zu ihm. Nun bitte ich Euch doch einmal, ob er sich in einem solchen Falle irren könnte!
Zweiter Bürger. Das ist ganz genau wie bei uns. Als ich mich verheiratet habe, da war Pater Roberto schon sozusagen Herr im Hause. Meine Frau würde kein Ei kaufen, ehe sie ihn nicht um seinen Rat gefragt hätte, und wenn sie übler Laune ist, was ziemlich oft bei ihr vorkommt, so weiß ich nicht, was aus mir werden sollte, wenn Pater Roberto nicht da wäre, um sie zu beruhigen. Daher könnt Ihr Euch denken, daß, wenn er von meinem Sohne sagt, was er sagt, ich mich versichert halten darf, daß es wahr ist.
Dritter Bürger. Ich begreife, daß ihr euch dabei zufrieden gebt. Was mich angeht, ich habe zwei ganz gewöhnliche Jungen; der eine ist achtzehn, der andere sechzehn. Aus dem ersten will ich einen Kaufmann, und aus dem zweiten einen Notar machen.
Zweiter Bürger. Verzeiht, darin muß ich Euch durchaus tadeln! Pater Roberto würde die Achseln zucken, wenn er Euch hörte.
Erster Bürger. Und Bruder Filippo desgleichen. Es freut mich, daß er sich in diesem Punkte wieder mit dem Pater Roberto begegnet. Um nichts in der Welt würde er darein willigen, daß unser Sohn Kaufmann oder Notar würde. Der Gedanke allein würde ihn in die äußerste Aufregung versetzen!
Dritter Bürger. Aber welches sind denn die Gedanken eurer guten Mönche in betreff eurer Kinder?
Erster Bürger. Es sind Gedanken voller Weisheit. Mein Sohn wird Maler.
Zweiter Bürger. Und der meine wird Bildhauer. Nur die Künstler können in jetziger Zeit so ein schweres Geld verdienen, große Leute werden und sich um die ganze Welt nicht scheren.
Dritter Bürger. Allerdings nehmen zur Zeit die Künstler den ersten Rang ein. In meiner Jugend war das nicht so. Da betrachtete man sie wie Bettler und Hungerleider.
Erster Bürger. Bettler? Hungerleider? Schaut, bitte, einmal da unten hin, auf den Weg am Fuße des Hügels!
Dritter Bürger. Nun ja! ich schaue hin!
Erster Bürger. Was seht Ihr?
Zweiter Bürger. Ach! ja ... Da haben wir's! ... richtig! ... Sagt uns, was seht Ihr?
Dritter Bürger. Ich sehe nichts ... außer zwei Herren zu Pferde auf reichen Decken, mit Gefolge von bewaffneten Bedienten. Was ist daran Merkwürdiges?
Erster Bürger. Ihr haltet diese Leute für Herren? Wischt Euch die Brillengläser ab! Es ist Meister Marcantonio Raimondi, der Kupferstecher, und Meister Giulio, einer der Schüler Meister Raffaels! Keiner von beiden ist aus besserer oder auch nur ebenso guter Bürgersfamilie wie ich, und wahrlich, wenn ihre Eltern Kaufleute oder Notare aus ihnen gemacht hätten, würden sie nicht so in Saus und Braus leben.
Zweiter Bürger. Wißt Ihr wohl, was Meister Valerio Belli damit verdient, daß er kleine Figuren auf Gemmen abbildet? Und Meister Bridone und Marchetto, die Sänger und Guitarrenspieler? Und Pater Mariano, der bei einer einzigen Mahlzeit vierhundert Eier und zwanzig Karpfen verzehrt? Ich sage Euch, wenn man in dieser Welt eine Rolle spielen will, dann hilft nur, Künstler werden!
Dritter Bürger. Ohne Zweifel; aber nicht jeder kann sich einem solchen Geschäft widmen; es braucht dazu doch so 'was, wie ein angeborenes Talent, und was mich angeht, so bekenne ich ganz offen, wenn man mich zwingen wollte, zwanzig Karpfen zum Mittagessen herunterzuschlingen oder einen Dom zu bauen, so würde man mich in Verlegenheit bringen.
Erster Bürger. Das ist nur, weil es Euch an Übung fehlt. Pater Filippo hat mir hundertmal wiederholt, daß, wenn man mir's in meiner Jugend beigebracht hätte, ich sicherlich ebenso stramme marmorne Kerle machen würde, wie Meister Buonarroti selbst.
Zweiter Bürger. Das ist vollkommen richtig. Mein Sohn soll Bildhauer werden und beim Papste zu Mittag essen. Kein nur einigermaßen verständiger Familienvater, der heutzutage die Dinge nicht ansähe wie wir; meine Meinung ist, daß die Künste die hübscheste Sache sind, die es giebt, und ich bin entschlossen, die alten Vorurteile zu verachten und mit meiner Zeit zu gehen.
Unter einem Baume sitzen zwei Dominikaner und ein Augustinermönch; zwei Kardinäle reiten auf Maultieren mit prächtigem Geschirr plaudernd und lachend vorbei; neben ihnen auf einem spanischen Pferde ein vornehmer Venetianer, in schwarzen Sammet gekleidet; zahlreiche diensttuende Kammerherrn und Domestiken in schönen Livreen.
Erster Dominikaner. Ich kenne diese hochwürdigsten Herren nicht. Wißt Ihr ihre Namen?
Der Augustiner. Wirklich, Ihr kennt den Kardinal Sadoleto und den Kardinal Bibbiena nicht? Der Edelmann mit dem schwarzen Barte, der sie begleitet, ist Herr Andrea Navagero, Patrizier von Venedig, ein nicht weniger berühmter Litterat, als sie selbst.
Zweiter Dominikaner. Ich wäre begierig zu erfahren, was Sadoleto und Bibbiena an gottseligen Werken zu Tage gefördert haben, um ihre Kardinalshüte zu verdienen.
Der Augustiner. Der erste, mein Vater, die Gerechtigkeit muß man ihm widerfahren lassen, hat wenigstens kein großes Unheil angestiftet. Er ist ein guter Latinist; die Abgerundetheit seines lateinischen Ausdrucks findet fast die gleiche Bewunderung wie Bembos Feinheiten. Ein gutmütiger Mensch, ohne Galle; wenn man ihm nur sein Vergnügen läßt, tut er niemandem etwas zu Leide.
Erster Dominikaner. Bibbiena, den kenne ich nach dem, was wohlunterrichtete Leute mir von ihm erzählt haben. Von seinen Sitten ist nichts Vorteilhaftes zu melden. Er liebt ein lustiges und leichtes Leben, und hat die Calandra geschrieben; das ist eine hübsche Komödie, aber kein Werk eines Gottesgelehrten. Papst Julius II. hatte diesen Mann in sein Vertrauen gezogen; Papst Leo hat ihm das seinige immer geschenkt, so daß es kaum irgend welche Verhandlungen und Swapgeschäfte giebt, wo er seine Finger nicht im Spiel hat. Wenn er Zeit übrig hat, bringt er sie in Meister Raffaels Werkstatt zu, der sein großer Freund ist, wo denn mehr anstößige als erbauliche Dinge getan und geredet werden.
Zweiter Dominikaner. Welch ein Gepränge! welche Hoffart! welch ein Prunken mit Kostbarkeiten! Wo mögen diese Weltkinder, umgeben von ihren Sklaven, hin wollen? Was haben sie im Sinn, diese aufgeputzten babylonischen Satrapen, bei ihren lustigen Reden und ihrem schallenden Gelächter? Gewiß gehen sie nicht das heilige Meßamt abhalten!
Der Augustiner. Verzeiht, ehrwürdiger Bruder, gerade das wollen sie. Sie gehen das Meßamt abhalten ... Das heißt, ihr Meßamt. Eine glänzende Versammlung schöner Geister, Dichter, Künstler, Frauen, Prälaten und Herren kommt heute bei dem Bankherrn von Siena, Agostino Chigi, zusammen; und da beabsichtigt man der Göttin Venus eine Opferfeier zu veranstalten, mit Tauben, Milchspeisen, Blumen, Sonetten, Madrigalen, reichlichen sapphischen und adonischen Versen, griechisch, lateinisch und in der Volkssprache, und nicht ein Ritus wird bei dieser Gelegenheit erfüllt, dem die Gewähr irgend eines guten Autors fehlte. Herr Gabriello Merino, der um der Vortrefflichkeit seiner Stimme willen soeben zum Erzbischof von Bari gemacht worden ist, singt die Epoden und spielt das Heptachord; Francesco Paolosa, der neue Archidiakonus, läßt sich auf der Viola d'Amore hören; der Florentiner Pietro Aaron, Johanniterritter und Kanonikus von Rimini, begleitet die Lobgesänge auf die Göttin mit seiner Geige; zum Konzert wird's eine Menge Flöten geben, und die Teilnehmer werden mit Rosen bekränzt. Der Altar ist von weißem gelbgeädertem Marmor. Girolamo Santa Croce von Neapel hat, als er ihn gehauen, ein Wunder geschaffen. Das Festmahl, der Beschluß der Feier, wird von einer Fülle und Kostbarkeit, der berühmtesten Feinschmecker des Altertums würdig. Leo X. soll bei der Feier zugegen sein, aber unter einer Maske. Ich hoffe, ihr seid nun beruhigt über die Frömmigkeit unserer Kardinäle?
Erster Dominikaner. Welche Ärgernisse! Es ist gewiß, daß das alte Heidenwesen, dem die allgemeine Verderbnis zu Hilfe kommt, sich unser von allen Seiten wieder bemächtigt. Man hört von nichts als von Vorgängen, ähnlich dem, den Ihr uns da zur Anzeige bringt. Hier opfert man dem Apollo; weiterab der Pomona; in Venedig hat man sich nicht geschämt bis zur Herme des Gottes der Gärten sich zu erniedrigen. Es ist geschehen um alles, was ehrbar ist, und ich weiß nicht, was aus dem Glauben werden soll.
Der Augustiner. Er wird es machen wie der Stern, der durch die Regenwolken verdunkelt wird und dennoch am Himmel weiterglüht.
Zweiter Dominikaner. Die Verfinsterung, fürchte ich, wird recht lange Zeit dauern. Unser Vater Savonarola hat die Geißel bekämpfen wollen; er ist darüber zu Grunde gegangen. Wer möchte da triumphieren, wo dieser große Heilige eine Niederlage erlitten hat?
Der Augustiner. Vielleicht ein weit Geringerer. Man muß den Mut nicht sinken lassen; man muß den Kampf nicht aufgeben. Das Gute darf nicht schweigen vor dem Bösen.
Erster Dominikaner. Und doch schweigt es. Seit dem Tode unseres Verklärten erhebt niemand seine Stimme, und der Antichrist behält das letzte Wort.
Der Augustiner. Er mag sich vorsehen! ... Bringt euer Ohr näher, ihr Väter, und sprechen wir leise; ich weiß eine wichtige Neuigkeit. Kommt auf diese Bank, abseits ... Da ... hier sind wir alle drei in Sicherheit.
Zweiter Dominikaner. Ehe Ihr uns irgend etwas sagt, und wie zur Einleitung für die Hoffnungen, die Ihr in uns wieder anfachen zu wollen scheint, seht, bitte, welch schmachvoller Auftritt einige Schritte von hier sich breit macht! Seht Ihr, wie die Franziskaner da im Grase sich mit den rohen Burschen und den Weibsbildern tummeln, die diese bei sich haben? Wenn ich mich nicht täusche, so hört man einen dieser schändlichen Mönche in Versen, ebenso gemein wie er selber, das Lob des Montefiasconer Weines singen.
Der Augustiner. Das Übermaß des Übels bringt den Augenblick der Buße näher. Höret mich.
Zweiter Dominikaner. Mein Herz ist der Hoffnung wenig zugänglich.
Der Augustiner. Wir haben im Kloster wundersame Briefe von unseren Brüdern in Deutschland bekommen.
Erster Dominikaner. Was ist geschehen?
Der Augustiner. In unserem Ordenshause zu Wittenberg (das ist eine große Stadt im deutschen Lande, wo sich eine gar gelehrte Universität befindet) lebt ein Doktor, ein gewisser Dominus Martin Luther, Lehrer des kanonischen Rechts, einer der in den heiligen Schriften bestbewanderten Männer, die man in unserer Zeit kennt. Dieser große Mann hat sich soeben öffentlich und mit bewundernswertem Mute gegen den Ablaßkram erhoben, und, was höchst bedeutsam ist, er hat die Texte so geschickt angezogen und seine Zuhörer, als er auf die Gottlosigkeiten kam, die wir eben beseufzten, durch die Kühnheit seiner Sprache dermaßen hingerissen, daß zuerst seine Kollegen, dann in ihrem Gefolge das Volk, und was vorzüglich ins Gewicht fällt, Seine kurfürstliche Gnaden, der Herzog von Sachsen, sich unter seine Führung gestellt haben. Das war es, was ich euch anvertrauen wollte.
Erster Dominikaner. Haben die Franziskaner, die Einnehmer des Ertrages der Ablässe, nicht Einspruch hier erhoben?
Der Augustiner. Das haben sie. Wir haben natürlich unsern Ordensbruder verteidigt, und man versichert mich, daß der heilige Vater, voller Achtung für die Talente Domini Martini, nicht geneigt ist, ihm unrecht zu geben. Daraus schließe ich, daß der Himmel zum Herzen des Fürsten der Kirche spricht, daß er ihn vielleicht zum Nachdenken bringen wird, und diese Hoffnung macht mich vor Freude erbeben.
Erster Dominikaner. Möchte es euch mit euren Bemühungen glücken, teure Söhne des heiligen Augustin! Die engsten Bande vereinigen uns mit euch! Euer glorreicher Vater war es, der unseren heiligen Thomas begeisterte, und wenn wir, nach dem unheilvollen Tode Savonarolas, der durch die Leute des heiligen Franz zum Märtyrer gemacht worden ist, euren würdigen Luther den Tücken dieser nämlichen Verfolger ausgesetzt sehen sollen, so urteilt, wie schwer unsere Herzen gemeinsam mit den eurigen leiden werden!
Zweiter Dominikaner. Nein, Vater! überlaßt Euch nicht der Entmutigung; auch inmitten des furchtbarsten Sturmes schirmt Gott seine Kirche. Hoffen wir, daß die Augustiner das Heil der Religion erwirken, und trösten wir uns darüber, daß es uns selbst nicht geglückt ist, in dem Gedanken, daß wir es wenigstens versucht haben.
Der Augustiner. Das Blut eures Glaubenshelden hat dann die Ernte befruchtet.
Erster Dominikaner. Da läutet's das Angelus!
(Alle Glocken Roms beginnen zu läuten; die zahlreichen Gruppen, die auf dem Monte Pincio versammelt sind, halten in ihren Gesprächen inne; alle machen das Zeichen des Kreuzes und beten das Ave Maria, die Frauen knieend, die Männer entblößten Hauptes.)
Der Augustiner. Beten wir wie diese Menge, und fügen wir, wohl wissend, was wir vom Himmel zu begehren haben, die kurze Bitte hinzu: »Gieb, allerheiligste Gottesmutter, daß die Besserung der Kirche uns beschert werde, denn ohne dies Heilmittel ist es um das Christenvolk geschehen!«
(Die drei Mönche knieen nieder und bleiben in ihr Gebet versunken.)
Mailand.
Der herzogliche Palast.
Ein reich mit geschnitzten Schränken, Rüstungen, goldenen und silbernen Vasen geschmückter Saal; an einer kostbaren Tafel sitzt König Franz I., in Gesellschaft seiner Geliebten, Madame Marie Gaudin, Florimond Robertets, Clément Marots, mit de Piennes, de Lautrec und einigen anderen Höflingen lustig beim Abendessen. Truchsesse, Pagen in der Livree des Königs gehen zu beiden Seiten hin und her, den Gästen die Schüsseln reichend und einschenkend.
Der König. Nein! Der Papst war nicht darauf gefaßt, mich so bald ankommen zu sehen! Ich bin ebenso rasch über Italien hergefallen, wie meine Vorgänger; aber sie sind schnell wieder heimgekehrt, und ich werde mich nicht an die Luft setzen lassen.
Lautrec. Ich trinke auf den unbesieglichen Mars, den Ritter der Ritter!
Der König. Danke, Lautrec. Übrigens sind die Zeiten andere; ich will nicht mehr, daß man uns Franzosen wie Barbaren und Ignoranten behandle. Warum sollten wir nicht ganz ebenso gut, wie die Leute diesseits der Berge, anständige Gewohnheiten annehmen, uns die gemeinen Manieren abtun, und mit dem Studium der Litteratur vertraut werden können?
Clément Marot. Wenn man einen Degen zu führen und Lanzen zu brechen versteht, so ist das kein Grund, sein Lebenlang in der Rolle des Rüpels zu verbleiben!
Der König. Gewiß nicht; aber, auf Ritterwort, wir werden Mühe haben, diese Wahrheit in die dicken Köpfe unserer Kameraden hineinzubringen. Außer euch, die ihr heute Abend hier beisammen seid, und noch ein paar Leuten, sind unsere Franzosen ebenso viele Tölpel, unfähig irgend etwas zu lernen! Sie schätzen sich um so höher, je unwissender sie sind. Graf Castiglione sagte mir's letzthin Abends, und er hatte nicht unrecht.
Florimond Robertet. Er hatte nur zu sehr recht. Haben Euere Majestät das Lächeln bemerkt, das über die Lippen der Frau Herzogin von Ferrara glitt, als Ihr ihr neulich den Herrn aus der Picardie vorstelltet, der ihr eifrig erzählte, warum der heilige Maclou in seiner Dorfkirche bei Weitem schöner wäre, als Ghibertis Meisterwerk, das wir bewundern sollten? – Sapperment, rief der wackere Haudegen, und drehte sich den Schnurrbart, unser heiliger Herr Maclou ist von Kopf bis zu Fuß ganz bunt bemalt, und Eure Figur ist nichts als ein weißer Stein!
Der König. Ich gestehe dir, Robertet, als ich diese Worte hörte und Donna Lucrezias Miene sah, fühlte ich, wie ich bis über die Ohren rot wurde. Wahrlich, wir sind nur Dummköpfe! Aber ich will das alles ändern! Auf Ritterwort! ich will, daß Gallia ebenso schön werde wie Italia und nicht weniger fein geputzt. Was bis zu dieser Stunde in unserem Königreiche existiert hat, das wollen wir von Grund aus vertilgen, und Paris und meine lieben Städte, alle miteinander, sollen ebenso schöne Gebäude, ebenso viele Meisterwerke der Kunst den Blicken der Sonne zur Schau stellen, als man auf dieser Seite der Alpen zählt! Zum Teufel mit unseren alten Kathedralen, unsern Schlössern aus vergangenen Zeiten, mit all den plumpen Praktiken unserer Vorfahren! Wenn mir Gott das Leben schenkt, so werden wir, das verspreche ich euch, in der Welt nicht weniger angesehen sein durch unsere Verdienste um Apollo und seine neun hübschen Gefährtinnen, als wir es bis jetzt durch die um den Gott des Krieges gewesen sein mögen, und vielleicht auch um die Göttin der Liebe. Was meint Ihr dazu, Madame?
Marie Gaudin (halblaut). Mein Gott! Sire, wie Euere Majestät die Worte angenehm zu wenden weiß, und, was Sie sagt, ins Ohr fällt wie ein köstlicher Leckerbissen für den Geist!
Der König. Schmeichlerin! ... Wer war denn der feingeputzte Galan, den man heute Morgen zu Euch hineingehen sah?
Marie Gaudin. Zittert, Sire, es war ein Feind der Ungläubigen!
Der König. Dann habe ich nichts von ihm zu fürchten ... Aber wer war's?
Marie Gaudin. Ich sag's Euch ... Ein Johanniterritter.
Der König. Dieser tapfere Kämpe findet es angenehmer, schönen Damen seine Aufwartung zu machen, als die Türken aufzusuchen.
Marie Gaudin. Ihr behauptet zuweilen, daß das viel gefährlicher sei ... Wer sagt Euch, daß es weniger grausam dabei zugehe?
Der König. Auf Ritterwort! Ihr macht mich ganz toll.
Marie Gaudin. Herr Lautrec! ... Herr Lautrec! ... Der König ist eifersüchtig! ... Wißt Ihr, auf wen?
Der König. Gott soll mich verdammen, wenn ich eifersüchtig bin!
Lautrec. Man könnte es um einer weniger schönen Ursache willen sein.
Marie Gaudin. Ja, der König ist eifersüchtig auf einen Johanniterritter, der heut Morgen zu mir gekommen ist, und der Galan hat mir sogar zwei Pfänder hinterlassen!
Der König. Zwei Pfänder? ... Sein Herz und ...
Marie Gaudin. Das Herz gab er, denke ich, mit in den Kauf; davon ist nicht die Rede gewesen; und da ich einmal in der Plauderlaune bin, so will ich Euch alles gestehen: der schöne Bote kam mir nicht auf eigene Hand, sondern vielmehr im Auftrage eines andern.
Der König. In wessen Auftrage?
Marie Gaudin (lachend). Im Auftrage eines andern, sage ich Euch, neugieriger Quälgeist, der Ihr seid! Denkt Ihr, daß ich alles erzählen will?
De Piennes. Unser Herr sitzt auf glühenden Kohlen.
Der König. Der Teufel soll mich holen, wenn du wahr sprichst! Ich schere mich gerade soviel um den Absender, wie um den Abgesandten ... um den Herrn, wie um den Knecht ... Wer hat je den Einfall gehabt, Liebesbriefe durch einen Johanniterritter überbringen zu lassen?
Marie Gaudin. Ich habe Euch nicht gesagt, daß ich einen Liebesbrief erhalten hätte ... Jedoch ratet Ihr recht, was Euren Scharfsinn beweist ... Aber ich habe noch nicht alles gestanden! ... Da nehmt! schmachtet nicht länger! Schaut her!
(Sie setzt ein Schmuckkästchen auf den Tisch und behält ein Papier in der Hand, das sie durch die Luft schwenkt.)
Alle Gäste (auf einmal). Laßt sehen! laßt sehen!
Der König (das Kästchen nehmend). Ihr erlaubt wohl, meine Herren, daß ich's zuerst betrachte? Ich bin, wie mich dünkt, ein wenig dabei interessiert und zeige mich zu gutmütig. Um damit anzufangen, das Kästchen ist allerliebst ... geschnitztes Elfenbein, ausgelegt mit Silber und Gold ... diese Türkisen und Rubinen machen sich sehr gut ... Ein sehr hübsch ciselierter Schlüssel ... Darf ich aufmachen?
Marie Gaudin. Wie zaghaft Ihr seid! Öffnet, es soll Euch erlaubt sein!
Der König. Ich gehorche ... Ah! Alle Wetter! Das ist wunderhübsch! ... Nein! nein! nein! ... Wunderhübsch, das muß ich sagen! Nur die Italiener können die Sachen so machen und den Damen ihre Geschenke auf eine so feine Manier darbringen! Seht's euch genau an, ihr Herren! es ist das Bildnis des heiligen Vaters, von starken Diamanten eingefaßt.
Marie Gaudin. Ich weiß das Bildnis zu würdigen! aber auch die Fassung läßt mich nicht kalt.
Clément Marot. Seid gewiß, Madame, daß der Herr Papst das vorausgesehen hatte!
Florimond Robertet. Mein Gott, wozu dient sonst die Erleuchtung des heiligen Geistes?
Der König. Das also brachte der Johanniterritter?
Marie Gaudin. Mit dem Briefchen hier ... Ihr verdientet, daß man es Euch nicht gäbe ... Ihr habt nicht einmal die Gewogenheit gehabt, nur eine Minute unruhig zu werden!
Der König. Ist es unrecht, blindlings an die Treue des geliebten Gegenstandes zu glauben?
Marie Gaudin. Ich würde in einem fort schön die Betrogene sein, wenn ich mit dieser Tugend paradieren wollte. – Da! ... lest!
Der König (das Briefchen öffnend). »An die edle und erlauchte Frau, Frau Marie Gaudin ... unsere geliebte Tochter in Jesu Christo ...« Aha! wartet, laßt mich erst 'mal lesen! ... Der heilige Vater lobt Eure Schönheit ... Dann Eure Klugheit ...
Marie Gaudin. Letzteres hätte er sich schenken können.
Der König. Sodann teilt er Euch seinen Wunsch mit, Parma und Piacenza wiederzuerlangen, und bittet Euch mich darum anzugehen, daß ich sie ihm wiedergebe ... Nehmt's nicht übel, aber die Vermittelung wird ihm nicht viel helfen.
Marie Gaudin. Das hoffe ich auch; aber die Diamanten sind schön, nicht wahr, Meister Clement?
Clément Marot. Ach! Madame, nicht so schön wie Eure Augen!
Der König. Willst du wohl schweigen, Schlange? ... Kurz, unser guter Papst sucht mittels der bezauberndsten Hände, die es in der Welt giebt, die zerrissenen Maschen seines Netzes zu flicken ... Er weiß, daß diese kleinen Finger da meine Arme gefangen halten.
Marie Gaudin. Wirklich? die Arme, die jüngst bei Marignano so mit dem Schwerte dreingeschlagen haben?
Der König. Ja, dieser einzige kleine Finger, den ich mit Eurer Erlaubnis küsse, könnte mich schneller und besser niederwerfen, als die Hellebarden der Schweizerkantone, und doch ...
Marie Gaudin. Und doch erwarte ich von dem Rittersinn meines Helden, daß er nicht wird verleugnen wollen, was ich heute Morgen dem Abgesandten des heiligen Vaters erklärt habe.
Der König. Was habt Ihr denn erklärt? Ihr macht mir bange.
Marie Gaudin. Ich habe zu dem Johanniterritter gesagt: Herr, wenn der König, in seiner kindlichen Ehrerbietung gegen die Kirche, sich geneigt fühlen sollte, dem Wunsche des Papstes zu willfahren und ihm Parma und Piacenza zurückzugeben – wovon sein Vorgänger, König Ludwig, niemals etwas hat wissen wollen –, und wenn der König mir von ungefähr die Ehre antäte, mich darüber um meine Meinung zu befragen, so würde ich mich meinem Gebieter zu Füßen werfen und ihn anflehen, niemals irgend etwas von den Rechten seiner Krone zu opfern ... Und wie er ob der Lebhaftigkeit meiner Rede ein wenig in Erstaunen geraten war, habe ich ihm das Schmuckkästchen und den Brief hingehalten, aber er hat es nicht wiedernehmen wollen, und ist nach einer Menge Empfehlungen abgezogen.
Die Gäste. Sehr gut geantwortet! sehr gut gehandelt! Madame Marie Gaudin lebe hoch!
Der König (ganz leise). Morgen früh sollen Euch die Perlen gebracht werden, nach denen Ihr Verlangen tragt; auch laßt es meine Sorge sein, das Landgut zu bezahlen, das Ihr in der Touraine kaufen wollt.
Marie Gaudin. Ach! Sire, das ist ganz unnötig ... Ich könnte Euch nicht zärtlicher lieben! Habt Ihr da Vincis Gioconda angekauft?
Der König. Ja, und ich habe in Florenz Meister Andrea del Sarto beauftragt, alle Meisterwerke, die ihm bekannt werden, zu erwerben. Der König von Spanien hegt, wie ich weiß, die nämlichen Wünsche wie ich; aber seht Ihr, Freunde, ich will auf diesem Gebiete ebensowenig hinter ihm zurückstehen wie auf den übrigen. Nach dem Tode Maximilians – ein Ereignis, das nicht lange auf sich warten lassen kann – wird Karl die Kaiserkrone wollen; auf Ritterwort! ich werde sie bekommen! Alle meine Maßregeln sind getroffen. Auch trachtet der Sohn Johannas der Wahnsinnigen nach der obersten Gewalt in Italien; ich will ihm das Handgelenk verdrehen! Er will sich einen Namen damit machen, daß er die Gelehrten liebe und ihre Lobreden verdiene; ich will noch viel mehr als er in dieser Art tun, und mir wird die Ehre davon bleiben. Ha! ha! das wäre eine schöne Geschichte, wenn wir Salamanca gelehrter sehen sollten, als die Universität Paris!
Clemént Marot. Ich weine Freudentränen! Nie hat Frankreich einen solchen Monarchen gehabt! Euren Namen, Sire, wird man preisen bis auf der Menschen fernste Geschlechter!
Der König. Ach! Freunde, möchte Gott euch erhören und mich über alle meine Nebenbuhler erhöhen! Ruhm! Ja, Ruhm will ich! Viel Ruhm und viel Freude, und viel Scherz, und viel Lust, und überviel von allem, was das Leben reizend macht! Pracht, Geist, Glanz, Gepränge, Liebe, Liebe, mehr als das Herz fassen kann, in infinitum, himmelhoch, himmelhoch!
Marie Gaudin. Hoch lebe der König!
Alle. Hoch lebe der König!
Der König. Was den Mosjö Papst betrifft, mein schönes Kind, und ihr, liebe Freunde, so sollen ihm alle seine Liebenswürdigkeiten nichts nützen! Die Tage sind dahin, wo er die Völker schrecken und die Fürsten beugen konnte!
Florimond Robertet. Haben wir nicht Euren Vorgänger, den König Ludwig, von dem seligen Papste Julius wie ein unreines Tier in den Bann tun und sich drum nur um so wohler befinden sehen?
Der König. Jawohl haben wir's! Keiner unserer Untertanen hat sich daran gestoßen. Niemand in der Welt kümmert sich mehr um den Papst. Man weiß, was der Hof von Rom taugt, und worin seine Prälaten den Aposteln nicht sonderlich gleichen! Leo X. verlangt vom Christen weder den Glauben, noch die Hoffnung, noch die Liebe, sondern die Börse, und ich habe beschlossen, seinen Erpressungen Einhalt zu tun.
Lautrec. Ich will das Geld lieber in den Taschen des Königs und seiner Diener als in denen der Kardinäle sehen.
Florimond Robertet. Kein verständiger Mann denkt anders.
Marie Gaudin. Und eine verständige Frau ebensowenig.
Der König. Auf Ritterwort! wir können die Taler meiner Völker ganz ebenso gut springen lassen, wie die Borgia, die Rovere oder die Medici! Aber wißt ihr, daß die Deutschen auch anfangen, sich über die päpstlichen Einnehmer ganz schwarz zu ärgern? Ich bin neugierig zu erfahren, was mein Bruder Karl von den Unruhen in Wittenberg denkt!
Lautrec. Dumm genug, wenn er Euere Majestät nicht zu Rate zieht!
Der König. Ich würde gar nicht böse darüber sein, die Kirche auf den einfachen Fuß zurückgebracht zu sehen, den das Evangelium anempfiehlt.
Marie Gaudin. Der Papst sollte Euch die Herrlichkeiten schenken, die er im Grunde gar nicht nötig hat. Ihr würdet uns doch davon mitgeben, nicht wahr, Sire?
Der König. Auf Ritterwort! ich würde nie etwas für mich behalten! Alles für Euch, meine Liebste! und für meine Freunde!
Marie Gaudin. Ich will nur das Herz! Auf Euer Wohl, mein Gebieter!
Alle. Hoch lebe der König! tausend und aber tausend Jahre! und länger!
Rom.
Ein Saal im Vatikan.
Leo X. an einem Fenster sitzend; Kardinal Bibbiena, Kardinal Bembo, Kardinal Sadoleto. Im Hintergrunde des Saales, nahe der Tür, Herr Karl von Miltitz, ein Edelmann aus Sachsen, welcher darauf harrt, daß er herbeigewinkt werde.
Leo X. Ich werde mich selbst mit diesem Wittenberger Handel befassen und will ihm eine Wendung geben, die den Albernheiten, womit man ihn verwirrt hat, ein Ende machen soll. Dieser Lutherus, gegen den die Franziskaner so laute Beschwerde erheben, ist kein Dummkopf; er ist kein ungelehrter Mönch, wie die meisten unter ihnen. Er hat Geist, Kenntnisse und Verstand. Er hat mir im schicklichsten Tone geschrieben, und ich will ihn schützen gegen die Tetzel, die Eck und diese Bande lächerlicher Fanatiker! Solche Leute möchten Deutschland in Brand stecken! Aber so ist's nicht gemeint!
Bibbiena. Euere Heiligkeit scheint mir auf dem Wege, den Gerechtigkeit und Umstände vorzeichnen.
Leo X. Davon seid überzeugt. Es handelt sich hier nicht um eine religiöse Frage, es ist ganz einfach eine Formstreitigkeit. Unsere Leute haben es nicht richtig angefangen, sich das Geld zu verschaffen, das wir brauchen, und ich werde unseren Leuten unrecht geben.
Sadoleto. Wenn die Vorgänger Euerer Heiligkeit immer nach so weisen Grundsätzen verfahren wären, so hätten wir die unheilvollen Geschichten mit Johannes Huß und Hieronymus von Prag nicht zu beklagen gehabt.
Leo X. Und vor allem nicht die mit Savonarola. Seid gewiß, ich werde nicht gestatten, daß man sie wieder anfängt. Dieser Bruder Girolamo, der schließlich doch nur ein Besessener, ein Feind meines Hauses war, aus dem hat man glücklich einen Heiligen gemacht durch die abgeschmackte Strenge, mit der man gegen ihn verfahren ist. Martinus Luther soll aus meiner Hand die Ehre des Martyriums nicht empfangen.
Bembo. Der gute Pater schreibt einen wundervollen Stil.
Leo X. Die Empfindlichkeiten in Kloster und Sakristei sind mir im höchsten Grade zuwider. Der Papst ist ein großer Fürst, diese Wahrheit verliert nicht aus den Augen; in einigen Jahren wird es an Mächten nur noch ihn, den Kaiser, die Könige von Frankreich und England und den Türken auf Erden geben. Die übrigen Herrscher werden nur reiche Herren ohne Gewalt sein. Da ist es denn wesentlich, daß der Papst sein Benehmen nicht mehr nach den Ansichten und Vorurteilen der Mönche einrichte. Heißt Herrn von Miltitz näher treten.
Sadoleto. Tretet näher, Herr von Miltitz, Seine Heiligkeit verlangt Euch.
Miltitz. Ich bin zu Seiner Heiligkeit Befehlen, und bitte um die Gnade, ihm den Fuß küssen zu dürfen.
Leo X. (das Zeichen des Kreuzes über ihm machend). Herr von Miltitz, wir sind alte Bekannte. Ihr habt mir wohl gedient. Die Generalstatthalter der Kirche haben mir von Euren Taten, Euren Gaben und Eurer Treue so günstige Berichte gemacht, daß ich es bei einer wichtigen Veranlassung wie die, von der ich mit Euch reden will, nicht angemessen gefunden habe, mich der Ergebenheit irgend eines anderen zu bedienen.
Miltitz. Allerheiligster Vater, dieser Augenblick belohnt mich für alle meine Verdienste.
Leo X. Für den Auftrag, den ich Euch geben will, bedarf ich eines Kriegsmannes und zu gleicher Zeit eines feinen Höflings und eines Gelehrten. Ich finde diese drei Persönlichkeiten in Euch, und preise meinen Glücksstern darum.
Miltitz. Was ich vermag, steht sicherlich zu Euerer Heiligkeit Diensten.
Leo X. Ihr sollt Euren Landesherrn, den Herzog Friedrich von Sachsen, in meinem Namen aufsuchen. Er ist ein Fürst, ausgezeichnet an Weisheit, und ich freue mich, ihn von allen Kronen und denkenden Staatsmännern geehrt zu wissen. Ihr sollt ihm sagen, daß ich ihn mit Vergnügen unserem teueren Sohne in Jesu Christo, Domino Martino Luther, seinen Schutz gewähren sehe. Dieser Mönch vom Orden Sancti Augustini ist ein Gelehrter voller Kenntnisse; ich will nicht, daß er durch Schwätzer oder Tapse, wie der Inquisitor Tetzel, Eck, der Professor Hoffmann und andere zu sein scheinen, belästigt werde. Ihr sollt Seine Kurfürstliche Hoheit bitten, Euch mit Domino Martino in Verbindung zu bringen und zwischen uns und dem guten Pater zu vermitteln, damit das Einverständnis leicht wieder hergestellt werde. Es ist nicht nötig, daß die Übelgesinnten immerfort dem Rufe eines so fähigen Mannes schaden, indem sie das Gerücht verbreiten, daß er sich der heiligen Obergewalt entziehe, wozu er, wie ich weiß, völlig außer stande ist; und um dem ehrwürdigen Kurfürsten durch einen unwiderleglichen Beweis meine ganze väterliche Zuneigung zu bekunden, sollt Ihr Seiner Hoheit die goldene Rose einhändigen. Ich habe sie eigens für ihn bestimmt.
Miltiz. Der Kurfürst, mein Herr, wird gewiß von einer grenzenlosen Dankbarkeit durchdrungen sein.
Leo X. Verfehlt nicht, ihn wie Dominum Martinum nachdrücklich davon zu überzeugen, daß ich nicht beabsichtige, albernes Gezänk noch anstandswidrige Kontroversen hervorzurufen. Der heilige Vater ist davon unterrichtet, daß vieles Mißbräuchliche sich in die Meinungen eingeschlichen hat, welche mit mehrerem oder minderem Rechte von Gelehrten verteidigt werden, deren Rechtgläubigkeit vielleicht nicht vor jedem Vorwurf sicher ist. Gleichen wir unsere Meinungsverschiedenheiten ohne Lärmen und im Geiste gegenseitiger christlicher Liebe aus.
Miltiz. Es ist wahrscheinlich, daß, wenn Ihr es so anfangt, die Schwierigkeiten beseitigt werden. Euerer Heiligkeit Hauch geht so milde darüber hin, daß auch die leiseste Erregung keinen Bestand haben kann.
Leo X. Kardinal Sadoleto, gebt mir die beiden Briefe, die auf dem Tische da liegen.
Sadoleto. Hier sind sie, allerheiligster Vater.
Leo X. Ich übergebe sie Euch, Herr von Miltitz. Der eine ist an Herrn Georg Spalatin, der andere an den achtbaren Meister Degenhard Pfeffinger. Unter den Räten Eures Herrschers wüßte ich keinen, auf den man füglich gleich große Stücke halten könnte.
Miltiz. Sie verdienen vielleicht eine solche Ehre wegen ihrer Ehrerbietung gegen den heiligen apostolischen Stuhl und ihrer Hingebung für Eure geheiligte Person.
Leo X. Ich weiß das, ich weiß das, Herr von Miltitz. Ihr sollt sie in meinem Namen bitten, dem Kurfürsten den wahren Gesichtspunkt der Frage wohl vorzustellen. Es ist wichtig, daß weder er noch Dominus Martinus sich darüber täuschen. Ohne Zweifel ist mit dem Ablaßkram ein wenig Unfug getrieben worden, und namentlich sollte mich's nicht wundern, wenn sich in der Form des Verfahrens Ungehörigkeiten eingeschlichen hätten. Man schlage mir die schicklichen Mittel vor, und ich bin bereit, sie zur Anwendung zu bringen. Die Hauptsache ist, daß das Geld, das die päpstliche Schatzkammer nicht entbehren kann und will, uns hier wie gewöhnlich eingeht. Auf die Mittel kommt wenig an.
Miltitz. Ich möchte schon jetzt nicht annehmen, daß es in der Absicht des Kurfürsten liegen könnte, der päpstlichen Schatzkammer einen Ausfall an Geld zu bereiten.
Leo X. Ich glaube es ebensowenig, und in keinem Falle würde ich es zulassen, denn bei diesem Punkte, das erkläre ich Euch ganz aufrichtig, würden die ernstlichen Schwierigkeiten beginnen. So nachgiebig ich betreffs der übrigen Fragen bin, so streng würde man mich in dieser finden. Ihr habt lange genug in Rom und in meinen Staaten gelebt, um zu wissen, daß unsere Einkünfte und die Erhebungen, die die Kirche in den christlichen Landen betreibt, nicht vermindert werden könnten, ohne daß Unzuträglichkeiten herbeigeführt würden, mit denen die Kirche nicht zu beschweren mir eine Ehrensache ist. Das wäre denn also abgemacht. Ich bin geneigt, in allen Stücken versöhnlich zu bleiben, wenn nur die Bedürfnisse der päpstlichen Schatzkammer befriedigt werden. Lebt wohl, Herr von Miltitz.
Miltitz. Ich bitte um Euerer Heiligkeit Segen.
(Er kniet nieder und küßt den Pantoffel des Papstes.)
Leo X. (die rechte Hand erhebend und das Zeichen des Kreuzes über ihm machend). Benedico te in nomine ... Ich werde Euch einen ausgezeichneten Sicilianerwein senden, um Euren Reisemahlzeiten nachzuhelfen. Lebt wohl, Miltitz! Kardinal Bibbiena, Ihr kommt heute Abend zu unserem kleinen Konzert. Und Ihr, Bembo, jagen wir heute nicht zusammen?
Kardinal Bembo. Mich verlangt auf den Tod danach, allerheiligster Vater.
Leo X. So folgt mir, Nimrod. Es soll ein ausgezeichnetes Treibjagen geben; verlieren wir keine Zeit mehr. (Sie gehen.)
Bibbiena. Lieber Miltitz, Ihr begreift, daß uns nichts daran liegt, ob das Geld auf dem Wege des Ablasses oder anders eingeht; aber denkt daran, daß wir auf jeden Fall das Geld wollen, nur das Geld wollen, und es soll niemand sich einbilden, daß wir einen Deut von dem Gelde nachlassen.
Miltitz. Ich bin ein wenig in Verlegenheit, weil ich fürchte, daß der Kurfürst nicht, wie Ihr, mehr Wert auf diese Frage legt, als auf alle andern.
Bibbiena. Wenn das der Fall, um so schlimmer. Sagt Friedrich dem Weisen, daß er unsern Hunger nicht reize; wir würden Tiger werden.
Miltitz. Meine Beredsamkeit soll ihr Bestes tun. Lebt wohl, hochehrwürdige Herren; ich muß meine Vorbereitungen beendigen, um mich morgen früh auf den Weg zu machen. Ich küsse euch die Hand und empfehle mich eurem Wohlwollen. (Er geht.)
Sadoleto. Wenn er mit seinem Auftrag scheiterte?
Bibbiena. Es ist schwer abzusehen, wie er ihn glücklich ausführen sollte. Übrigens kracht alles unter unseren Füßen.
Sadoleto. Und dennoch arbeiten wir daran, unser Gebäude bis zum Himmel emporzuführen.
Bibbiena. Die Fundamente sind's, die verderben.
Sadoleto. Wir befestigen sie so gut wir können, mit Silberblöcken, schweren Silberblöcken, und jeden Tag wird das Bedürfnis nach diesem Baumaterial schmerzlicher fühlbar.
Bibbiena. Und jeden Tag wird es schwieriger zu Tage zu fördern. Wir machen alles zu Gelde. Die Auflagen steigen und steigen und steigen! Bürger und Bauern murren und drohen. Man bringt sie an den Bettelstab und der schwerbedrängte Handel stirbt dahin. Die Privilegien der Städte werden angegriffen, und durch die Risse, die wir machen, strecken wir alle zehn Finger aus, um uns des wenigen zu bemächtigen, das sich noch finden läßt. Wir verkaufen die Ämter, wir verkaufen die Pfarreien, wir verkaufen die Bistümer, wir verkaufen die Patriarchen-, wir verkaufen die Kardinalswürde, wir erfinden jeden Tag irgend eine geistliche Ware zum Verkaufen. Was verkaufen wir nicht? Wir haben den Kardinal Petrucci, zur Zeit des Krieges von Urbino, um der Verschwörung des Battista Vercelli willen ziemlich leichtfertig umkommen lassen, und wenn die Kardinäle de Saulis und Riario entkommen sind, so wißt Ihr, was die Rettung ihnen kostet!
Sadoleto. Ja, ihnen und vielen anderen; man hat auf Kosten des heiligen Kollegiums Kapital aus diesem unheilvollen Streiche geschlagen.
Bibbiena. Ihr habt recht. Entsinnt Ihr Euch der vierunddreißig Ernennungen, die infolge dieses Handels vorgenommen worden, unter dem Vorwande, uns treue Anhänger zu verschaffen? Der Ertrag dieser Finanzoperation ist bedeutend gewesen, aber niemals noch hatte das öffentliche Gewissen eine so schwere Bürde zu tragen gehabt. Betrachten wir nun die Weise, wie wir im Auslande vorgehen, so ist es durchaus die gleiche. Wir gucken in alle Taschen. Wir machen ein Profitchen an den Annaten, am Peterspfennig, an den Versetzungen, an dem berühmten Ablaß, der für den Augenblick der dunkle Punkt ist, und trotz so vielen Mühens und Sichbeimachens, nennen wir das Ding bei Namen, trotz so vieler Räubereien, ist uns nichts genug, es gelingt uns nicht, die Leere auszufüllen, und jeder Tag, der vergeht, treibt uns in immer jämmerlichere Not. Wir müssen kläglich um Hilfe rufen; unsere Armut quält uns, erdrückt uns; wir wissen immer weniger, wie ihr entrinnen, und – seid davon nur überzeugt! – wir werden uns am Ende einen heftigen Protest der entrüsteten Christenheit zuziehen; man wird uns mit einem allgemeinen Zetergeschrei in Schrecken jagen; die Regierungen, groß und klein, werden uns als letzten Urteilsspruch kundtun: ihr habt uns arm genug gemacht, ihr bekommt nichts mehr!
Sadoleto. Lieber Freund, darauf bin ich gefaßt. Man fragt sich bereits, welches Recht wir dafür anführen können, daß wir aller Welt das Mark aussaugen.
Bibbiena. Es ließen sich einige gute Gründe zu unseren Gunsten beibringen. Die Kirche vertritt die Intelligenz; die Schätze, die wir aufsaugen, dienen zur Nahrung und Stärkung der Wissenschaft, der Künste und der übrigen heilsamen Lehrmächte.
Sadoleto. Sie dienen auch, gesteht es nur, zur Verherrlichung und Mästung der Üppigkeit, des Lasters und der Verderbtheit.
Bibbiena. Ich lasse das gelten; aber es giebt keinen Stoff ohne Kehrseite. Jede gebildete Gesellschaft ist eine verdorbene Gesellschaft. Sollen wir deshalb zur Barbarei zurückkehren? Diese ist vielleicht unempfänglich für die bezahlten Koketterien der schönen Buhlerinnen; aber sie schlitzt den Kriegsgefangenen den Bauch auf und bemalt die scheußlichen Gesichter ihrer Götzen mit Blut ... Verzeiht mir, wenn ich hier unser Gespräch unterbreche. Ich habe unsern lieben Raffael zu mir bestellt; ich will ihn wegen eines gewissen Punktes auszanken. Wenn Ihr kein sehr dringendes Geschäft vorhabt, so kommt Ihr mit mir und helft mir bei meiner Strafpredigt. Was meint Ihr dazu?
Sadoleto. Gern, mein Freund; gehen wir hinunter.
Bibbiena und Sadoleto verlassen den Saal in würdevoller Haltung und durchschreiten die päpstlichen Galerien und Gemächer; die Menge der Beamten und Soldaten des heiligen Palastes macht ihnen Platz und grüßt sie ehrerbietig. Unten an der Treppe finden sie ihre eigenen Offiziere, Geheimschreiber, Schleppenträger, Kämmerer, Edelleute und Diener aller Grade. Maultiere mit Decken werden vorgeführt; einige aus dem Gefolge halten die beiden Würdenträger am Arme, um ihnen in den Sattel zu helfen. Der Zug macht sich auf den Weg und betritt die Straßen Roms. Das Gefolge bricht Bahn durch die Menschenmenge, die sich auseinander tut und wieder schließt. Von Zeit zu Zeit erhebt der eine oder der andere der beiden Kirchenfürsten den Arm und erteilt den Mönchen, den Frauen, den Kaufherrn, den Leuten aus dem Volke, die bei ihrem Anblick niedergekniet sind, den Segen.)
Bibbiena. Betrachtet dies bunte Gemisch von Gestalten und Trachten!
Sadoleto. Es ist ein Schauspiel, an dem ich mich nie satt sehen kann. Es scheint mir dazu angetan, die trägste Einbildungskraft rege zu machen. Wir sehen hier eine Musterkarte von allen Völkern des Erdballs.
Bibbiena. Wie anmaßend diese Spanier aussehen! Sie sind in unseren Tagen das herrschende Volk; und seit sie Neu-Indien entdeckt haben, giebt es keine Grenzen mehr, weder für ihren Hochmut, noch für ihre Raubgier. Der Geringste unter ihnen betrachtet sich wie einen kleinen König.
Sadoleto. Und dort, in der Ecke, die drei Portugiesen! Am Ausdruck ihrer Gesichter gewahrt man, daß die Eroberer von Goa und Diu ihren Nachbarn vom Guadiana an Hoffart und Dünkel nichts nachgeben. Aber schaut doch auch nach diesen Franzosen hin, wie sie die Nase hoch tragen, mit dem Säbel rasseln, scherzen und von sich selbst entzückt sind!
Bibbiena. Und dort! die wackeren Schweizer, mehr als zur Hälfte betrunken, wie sie sich mit den Deutschen anschnauzen!
Sadoleto. Und da, seht nun Ihr wieder die beiden Engländer, kalt wie Bildsäulen; sie sind dabei, mit Verachtung eine Gruppe Syrer und Griechen zu betrachten. Glücklicherweise ist da Herr Pompeo Frangipani mit seinen schweren Reitern; er rüttelt die Insulaner auf und schleudert sie zur Seite. Das ist ein großes Glück. Sie würden sich sonst den ganzen Tag nicht gerührt haben ... Wißt Ihr, welche Gedanken mir in den Sinn kommen?
Bibbiena. Mir eine Welt! Der Kopf möchte mir springen, wenn ich zumal diese langen Reihen prächtiger Paläste, diese Kirchen, diese dreistöckigen Türme, diese glorreichen Säulen betrachte, die durch die Gewalt der Zeiten ihrer zerfallenen Architrave beraubt sind und doch noch das Andenken des unnachahmlichen Altertums zu verkündigen scheinen. Welch ein Rahmen für ein so lebensvolles Bild!
Sadoleto. Ich frage mich, wie viele Jahre alle diese Leute von so ungleichartigem Herkommen noch anhänglich an die große Metropole bleiben werden, die ihnen keinen andern Dienst zu erweisen scheint, als ihnen wieder abzunehmen, was sie verdienen.
Bibbiena. Ich fürchte, die Jahre möchten bald nur noch Monate sein.
Sadoleto. Mein Gott! Ihr seid zu schwarzseherisch. Ist es denn wohl gewiß, daß diese Völker sich jemals Rechenschaft über das Nützliche und über das Schädliche geben? Seit langem lebt die heilige Kirche von ihrem Mark; und die Gewohnheit ist ein gar seltsames Joch. Es genügt, daß ein Ding sei, um die Mehrzahl der Geister daraus schließen zu lassen, daß es sein muß. Überdies, was verlangt denn der gemeine Mann im Punkte der Religion? Reinheit, Wahrheit? ... Er denkt nicht daran. Weder seine Sinne, noch sein Herz verspüren danach das geringste Bedürfnis. Er braucht hergebrachte Redensarten, und immer so ziemlich denselben Ballast von mehr oder minder albernen abergläubischen Gebräuchen, die wir vom Heidentum beibehalten haben, und die das Heidentum selbst von weiter her hatte. Das heißt den Massen Religion, und danach werden sie immer dürsten. Die gegenwärtige Gefahr besteht in einigen unaufhörlich wieder auftauchenden Ideen, dem Luxus einer Minorität, und eine Minorität braucht viel Zeit, um die allgemeine Narrheit in Bresche zu legen.
Bibbiena. Ich bitte Euch, gewährt doch der knieenden alten Frau da, die Euch ihre beiden Kinder hinhält, Euren Segen!
Sadoleto. Gern! ... Sie hat das allerachtbarste Aussehen ... Gebt ihr einen Dukaten ... Also weiter! Die Gelehrten stiften uns ein verzweifeltes Unheil mit ihrer maßlosen Vorliebe für das Vergangene.
Bibbiena. Ihr habt recht; und doch muß man's gestehen: der Stil der Kirchenväter ist erbärmlich, und der der Dekretalen gar setzt mich, offen gestanden, in die tiefste Beschämung.
Sadoleto. Ich leugne das nicht; aber wir leben davon, beachtet das wohl. Man schädigt uns unser Bestes; man macht es verächtlich ... Wir machen es selbst verächtlich, Ihr, Bembo, ich ... Was sage ich! der Papst noch mehr, wie wir alle. Er läßt sich nie einen guten oder schlechten Witz über die Mönche entgehen. Wer irgend Geist und Geschmack hat, macht es ebenso. Ich behaupte nicht, daß wir unrecht haben. Aber wie eine Einrichtung aufrecht erhalten, an deren Heiligkeit wir, wie wir von früh bis spät erklären, ganz und gar nicht glauben?
Bibbiena. Wißt Ihr ein Heilmittel?
Sadoleto. Es giebt Krankheiten, die von der Körperanlage herkommen. Der Körper der Kirche ist so angelegt, daß er von Irrtümern lebt. Es bedürfte so vieler Reformen! und so tiefgehender! Wie wäre es, wenn ich ein Reformator würde, der sich dazu verstände, Zeltweber zu werden, wie Sankt Paulus, und in einer schmutzigen Kneipe eine rohe Zwiebel zu Abend zu essen?
Bibbiena (lächelnd). Ihr macht mich schaudern.
Sadoleto. Urteilet, welche Antwort von Leo X. und einem jeden unter unseren hochwürdigsten Kollegen auf den Vorschlag, es ebenso zu machen, zu erwarten wäre! Ihre Entrüstung würde übrigens von allen Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten, Prioren und Pfründnern der Christenheit, wie auch von den Fürsten geteilt werden, die mich der Heuchelei, der Schwärmerei, der Volksverhetzung verdächtig finden und vielleicht nicht unrecht haben würden. Ich bin trotzdem nicht abgeneigt, zuzugeben, daß von Zeit zu Zeit ein Versuch mit der Askese seine Vorteile hat. Es ist nicht übel, wenn irgend ein Hansnarr, der in seiner Zelle übersinnliche Abenteuer sucht, eine Wasser- und Brotkur anfängt und sich aus Leibeskräften geißelt. Abgesehen davon, daß dergleichen Tollheiten dem gemeinen Volke gefallen, weil sie die Überlieferung der Einsiedler der Thebais – der Nachfolger der ehrenwerten Korybanten und all der Isispriester, die sich darin gefallen haben, sich selbst zu peitschen, solange die Welt Welt ist – lebendig erhalten, dient das später als Grund, um dem heiligen Manne schöne Kirchen von Porphyr, von Marmor zu weihen, ihm zu Ehren herrliche Gemälde, Statuen von wunderbarer Schönheit zu machen, und schließlich reiche Pfründen für Geistliche zu stiften, die mit ihrem Heiligen nichts gemein haben. Aber andere Ergebnisse? die vermag ich nicht abzusehen.
Bibbiena. Mein Gott! was die Menschen närrisch sind! Leben und leben lassen, giebt es etwas Besseres und Leichteres? Wo doch die Welt so schön ist! Wo es der Dinge, die das Herz erfreuen, aller Enden die Fülle giebt! Wo man seine Zeit, seinen Geist, sein Herz so angenehm, so mühelos verwerthen kann!
Sadoleto. Und würde nicht, wenn es mit dem übrigen nichts wäre, die Wißbegierde allein ausreichen, das Dasein reizend zu machen? Der Anblick der Welthändel ist über alle Maßen anziehend! Zum Beispiel bietet die Weisheit der Venetianer gar gewichtige Belehrung, die Unbeständigkeit der Florentiner eine Fülle belustigender Überraschungen! Und wie da die Franzosen, gleich uns, von Liebe zur Kunst ergriffen werden; und der neue deutsche Kaiser, Karl V., der junge Mann, von dem man noch nichts weiß, wie merkwürdig ist es, seine ersten Schritte zu beobachten! ... Aber Wehgeschrei? ... Was für ein Lärmen! ... Was macht Ihr denn, Ambrosio? Warum verhaftet Ihr diesen Mann?
Der befragte Offizier. Hochwürdigster Herr, es ist ein Dieb! Die Häscher verfolgen ihn, und er sucht zu entwischen ... Wir halten ihn fest!
Sadoleto. Laßt ihn laufen, den armen Dieb! ... Geh, mein Sohn, mach, daß du fortkommst, suche dich zu bessern ... Ich sagte also ... Aber da sind wir an Eurer Tür, und ich bemerke gerade Meister Raffael. Machen wir Halt.
Raffael (von einigen Schülern und Dienern gefolgt, nähert sich und begrüßt die beiden Kardinäle) Hochwürdigste Excellenzen, ich küsse euch die Füße!
Bibbiena. Sei mir gegrüßt, ich bin hoch erfreut, dich zu sehen.
Sadoleto. Seid mir gegrüßt, teurer Meister, gebt mir die Hand.
Die Kardinäle sitzen ab. Sie treten, einander bekomplimentierend, in den Palast. Raffael folgt ihnen, und alle drei steigen plaudernd die breite Stiege hinauf. Ihr Gefolge macht in einer großen Galerie Halt; sie setzen ihren Weg weiter fort und treten in einen mit Gemälden und Vergoldungen geschmückten Saal, mit mächtigen Türvorhängen von Stoffen aus der Levante.)
Bibbiena. Nehmt, bitte, in diesem Lehnstuhl Platz, Freund. Setze dich, Raffael, mein Kind; laß dich auf diesen Schemel nieder; du bist hierher citiert, um die Leviten gelesen zu bekommen.
Raffael (lächelnd). Ich dachte mir's wohl nach der Fassung Eures Briefchens ... Etwa wegen meines gestrigen Gesprächs mit zweien Eurer hochwürdigsten Confratres?
Bibbiena. Was hast du ihnen gesagt?
Raffael. Sie waren vor meinem Gemälde der Apostel und behaupteten, daß Sankt Peter und Sankt Paul zu rot wären. Ich habe ihnen erwidert, daß sie nicht anders sein könnten, da sie die Kirche so wie zur Zeit regiert sähen. Ich versichere Euch, daß die beiden Herren abgezogen sind, ohne etwas weiter zu begehren.
Bibbiena (zu Sadoleto). Hört Ihr's? Das ist der Kommentar zu unserem Gespräche. Jetzt, Raffael, handelt sich's um andere Dinge ... um dein Wohl, mein Kind! Der Kardinal Sadoleto will dir wohl, wie ich selbst, und wir können offen vor ihm reden.
Raffael. Ihr überhäuft mich alle beide mit Güte. Ich wäre der ärgste der Undankbaren, wenn ich es verkannte.
Bibbiena. Seit dem Tode deiner Braut, meiner lieben Nichte, meiner teuren Maria, weiß ich nicht, was ich für deine Versorgung ersinnen soll. Sag' uns selbst, hast du nicht irgend einen Plan in dieser Hinsicht? Es ist Zeit, daran zu denken. Du bleibst nicht immer jung, ja du hast es soeben auf siebenunddreißig Jahre gebracht. Ich meinerseits werde alt. Ich möchte deine Zukunft gesichert und deinen Lebenslauf fest, heiter, ruhig dir vorgezeichnet sehen, so wie du es bedarfst, um in Freiheit die Meisterwerke zu schaffen, die man ein Recht hat von dir zu verlangen, denn du bist ein einziges Geschöpf auf dieser Erde.
Sadoleto. Dich und Michelangelo, euch kann man nennen, wie Horaz die Dioskuren: Lucida sidera.
Raffael. Ich habe den frühen Tod meiner Braut, Maria da Bibbiena, beweint. Ich habe es beweint, das gute Mädchen, um seines eigenen Wertes willen, und auch, weil sie, die Euch so nahe angehörte, mir von Euch als Gattin gekommen wäre. Und dennoch, ich habe es Euch nicht verhehlt: ich habe niemals mit Vertrauen an die Ehe gedacht. Das sind Güter, die mich nicht locken. Ich liebe meine Freiheit. Ich liebe eine schrankenlose Ferne vor den Augen; ich liebe das Leben, und, um Euch das Innerste meines Herzens zu enthüllen, ich liebe bis zur Abgötterei das Andenken einer andern, die ich verloren habe, und die einzig in der Welt mich andern Sinnes hätte machen können.
Bibbiena. Sprich nicht von deiner armen Beatrice ... Sprich nicht von ihr ... Die Erinnerung betrübt dich.
Raffael. Wenn sie mich betrübt, so veredelt sie mich. Dies angebetete Geschöpf hat mir die Wohltat erwiesen, mich kennen zu lehren, wie weit es die edelste Neigung in Selbstlosigkeit und Güte zu bringen vermag; aus des Todes Schoße noch sendet sie mir das Gefühl einer himmlischen Schwermut, die reine Quelle, die ich ohne sie nimmermehr gekannt hätte. Ihr Andenken hüllt mich in einen Trauerschleier, dessen Falten nichts Drückendes haben, und den ich nicht entfernen möchte. Die Liebe, die uns vereinigt hat, brennt in mir gleich einer Lampe, am Lichte der Ewigkeit entzündet. Euch zu Gefallen hatte ich in eine Verbindung gewilligt, zu der, wie Ihr wohl wußtet, mein Wunsch mich nicht hinzog ... Der Himmel hat sie nicht zugelassen ... Reden wir nicht mehr von etwas dergleichen.
Bibbiena. So willst du in der haltlosen Unabhängigkeit der Jugend verbleiben? Ich achte deine Beweggründe, ohne mir doch verhehlen zu können, daß du dich darein findest, der Mann der Zufälligkeiten, der Abenteuer zu bleiben, und eine Lebensweise nie kennen zu lernen, die allein zu dem Ansehen im bürgerlichen Leben führt, dessen selbst das Genie nicht zu entraten vermag.
Raffael. Wie Ihr die Dinge nur so streng nehmen mögt, hochwürdigster Herr! und ich merke an Herrn Sadoletos Miene, daß er Eure Ansichten teilt.
Sadoleto. Mein Kind, die Kunst ist eine große Schöpfung Gottes, und nach meiner Meinung den schönen Wissenschaften an Würde und Macht vollkommen gleich. Nichtsdestoweniger bringt eine fest gegründete und ins rechte Gleichgewicht gebrachte Lebensstellung dem, der sie besitzt, die in den Nöten des Lebens unentbehrlichen Tröstungen ein.
Raffael. Mir scheint, daß das Ziel erreicht werden kann, ohne daß es nötig wäre, eine Frau zu nehmen. Die Zügellosigkeit der Sitten und Gewohnheiten ist mir ein Abscheu; sie ist eine Ursache der Unfruchtbarkeit für einen Künstler und die schlimmste der Knechtschaften. Aber es fehlt mir so wenig an der Möglichkeit, als am Willen, ihr zu entrinnen. Ich bin sicherlich der reichste der Künstler, und wenn ich auch auf einem etwas großen Fuße lebe, was mir für die Befriedigung meiner Liebhabereien und die Freiheit meines Geistes unumgänglich dünkt, so wende ich darum doch noch immer dieser Art Lebensfragen die angemessene Aufmerksamkeit zu. In diesem Augenblicke habe ich in der Stadt Rom ein Besitztum im Werte von zweitausend Dukaten, was mir ein jährliches Einkommen von fünfzig Goldtalern einbringt. Die Oberaufsicht über die Arbeiten von Sankt Peter ist mir seit Bramantes Tode vom Papste übertragen worden; sie verschafft mir eine jährliche Besoldung von dreihundert Dukaten, und ich bin auf dem besten Wege, binnen kurzem andere Vorteile der nämlichen Art zu erlangen. Indem mir Seine Heiligkeit einen neuen Saal im Vatikan zu malen in Auftrag gab, hat Sie mir zu diesem Zwecke zwölfhundert Dukaten bewilligt. Ich bin diese letzten Tage zum Aufseher der alten Denkmäler ernannt worden, ein Amt, das mir reichlichen Gewinn sichert, und von allen Seiten begehrt man Gemälde von mir, für die ich den Preis bekomme, der mir gefällt. In solcher Lage umgebe ich mich nach meinem Gefallen mit treuen und sorgsamen Dienern, ich führe ein Leben ohnegleichen und habe gar kein Bedürfnis, eine Frau und einen Haushalt – mehr eine Quelle der Sorgen als der Freuden – bei mir einzuführen. Und somit tätet ihr wohl, mit mir zur Besichtigung meiner Arbeiten in Sankt Peter zu kommen, und dann könnten wir in meiner Villa Sorbet trinken.
Sadoleto. Er redet nicht übel, was meint Ihr dazu? In Wahrheit, er ist ein Priester, wie Ihr, wenn er auch einer Profangottheit dient, und was ich von meinen geistlichen Pflichten am meisten schätze, ist das glückliche Unglück des Cölibates.
Bibbiena. Nun gut, so will ich denn von dem allen nicht mehr reden. Aber, Raffael, ich möchte dich besser für deine Gesundheit sorgen sehen. Du arbeitest zu viel, du gehst zu viel dem Vergnügen nach. Man erzählt mir beunruhigende Dinge von deinen Fieberanfällen; ich habe große Angst davor; du verzehrst dich schneller, als du solltest.
Raffael. Nie habe ich mich so kräftig, noch so Herr meiner Glieder gefühlt. Eben habe ich Ausgrabungen auf dem Campo Vaccino beigewohnt. Ich habe drei oder vier Stunden in den Gräben verweilt. Wie entzückt ich von diesem Morgen gewesen bin! Gehn wir jetzt nach Sankt Peter.
Bibbiena. Gut denn, gehen wir! Es ist wenigstens zwei Tage her, daß ich dich nicht gesehen hatte, mein Kind, und die Zeit kam mir lang vor.
Sadoleto. Bringen wir sie wieder ein! Ich will Euch heute Abend, wenn wir gut ausgeruht sind, die köstliche Elegie vorlesen, die unser Freund Guido Postumo Silvestri an den Papst gerichtet hat. Es ist eine der ergreifendsten lateinischen Dichtungen, die mir je bekannt geworden sind:
Heu! Quam nostra levis, quam non diuturna voluntas,
Quam juvat ingratum saepe quod ante fuit!
und in diesem Tone geht es immer weiter. Es ist wundervoll!
Die Werkstätte Michelangelos.
Ein kaltes, dunkles Stübchen. Es ist tiefe Nacht. Eine noch kaum aus dem Groben gearbeitete Statue, auf welche das Licht einer kleinen Kupferlampe fällt, die Antonio Urbino, der Diener des Künstlers, in der Hand hält. Dieser letztere ist damit beschäftigt, eine Art Helm von Pappe fertigzustellen, dessen Kamm offen und so eingerichtet ist, daß er als Behälter dient.
Michelangelo. Siehst du, Urbino? Du sagtest, daß mir's nicht gelingen würde! Es ist mir vollkommen gelungen. Jetzt gieb mir die Lampe.
Urbino. Sie wird dadrinnen nicht halten! Sie wird fallen und Euch das Haar in Brand stecken. Eine schöne Erfindung, die Ihr da gemacht habt!
Michelangelo. Ich sage dir, sie wird halten! Warum willst du, daß sie nicht hält?
Urbino. Nicht ich will, daß sie nicht hält, sie wird nicht halten.
Michelangelo. Schon gut! Starrkopf! Gieb mir deine Lampe, wickle diesen Eisendraht fest um den Fuß ... drehe noch einmal herum ... Gut! Jetzt bringe ich das Ding da hinein; befestige den Draht hier ... Gut! Siehst du? ... Das hält.
Urbino. Wenn Ihr Euch hin und her bewegt und das auf dem Kopf habt, werdet Ihr die Pappe anbrennen.
Michelangelo. Keineswegs! Die Öffnung ist breit, und die Flamme hat ganz den nötigen Raum, um nach rechts und links zu flackern. Das ist prächtig! In Zukunft arbeite ich die Nacht und mit Lichtwirkungen auf dem Marmor, die mir die schönsten Ergebnisse liefern sollen.
Urbino. Ihr tätet besser, Euch zu Bett zu legen. Ihr habt immer Einfälle, wie keiner sie hat.
Michelangelo. Es ist ganz bequem zu tragen. Mein Kopf fühlt sich vollkommen frei. Gieb mir den Hammer und den Flachmeißel ... hierher ... auf die Holzkiste!
Urbino. Ich sage Euch, daß Ihr besser tätet zu Bett zu gehen, anstatt zu arbeiten wie ein armer Tagelöhner. Ihr wißt wohl, daß Ihre Excellenz, die Frau Marchesa, nicht zufrieden ist, wenn Ihr Euch zu sehr anstrengt.
Michelangelo. Gut! Du sollst morgen früh hingehen und dich nach ihrem Befinden erkundigen, und sollst ihr sagen, daß meine Frau es nicht will, daß ich mich zu Bette lege.
Urbino. Eure Frau? Eure Frau? Was soll das heißen?
Michelangelo. Sie ist dort, mir zur Seite, und sieht mich mit ihren schönen großen Augen an; sie stößt mich an und sagt: arbeite, Michelangelo, arbeite für deinen und meinen Ruhm, und sie zeigt mir ein grünes Blättchen, das sie in der Hand hält und das vom Lorbeer ist.
Urbino. Das sind Redereien, die Euch nicht hindern, Euch auf den Tod abzuquälen.
Michelangelo. Seit langem war ich nicht so glücklich! Es ist tiefe Nacht, und beim Schimmer dieser kleinen Lampe gewahre ich Welten von Ideen ... Wieviel Uhr mag es wohl sein?
Urbino. Ich denke mir, es muß nicht weit von Mitternacht sein. Ihr tätet wohl, Euch zu Bett zu legen.
Michelangelo. Es gießt vom Himmel herunter. Man hört den Regen auf die Dächer schlagen und wie einen mächtigen Strom auf die Fliesen des Hofes fallen. Das Unwetter ist furchtbar gewesen. Blitze durchfurchen der Scheiben spiegelnde Finsternis. Aber inmitten dieses rauhen Getöses, welche Ruhe! Das ferne Dröhnen des Gewitters und sein majestätisches Gebrüll, aber nicht eine menschliche Stimme, nicht eine falsche, lügnerische, zänkische, hochtrabende oder albern anmaßende Stimme erhebt sich, um mich aufzubringen! Man kann schaffen ... hat den Geist frei ... ist glücklich! ... Man gehört ganz und gar dem, von dem sich beherrschen zu lassen der Mühe wert ist, und des Marmors dicht geschlossener Schoß öffnet sich; schon beginnt dies Haupt leibhaftig frei zu werden ... Weiß, weiß zuckt es unter dem Meißel, der es Zug um Zug erlöst ... Sie entrinnen der Materie ... sie reden! ... Urbino?
Urbino. Meister!
Michelangelo. Du schläfst auf dem Schemel ein. Du tätest gut, dein Bett aufzusuchen!
Urbino. Ich kann nicht. Wenn Ihr schlaft, will auch ich schlafen, aber nicht eher.
Michelangelo. Das ist ein sonderbarer Eigensinn!
Urbino. Freilich bin ich nicht mehr jung, und die Nachtwachen ermüden mich, aber die Frau Marchesa hat mir gesagt: wenn dein Herr nicht ausruht, so ruhe du auch nicht aus, und wir werden sehen, ob er die Kräfte seines alten Dieners mißbrauchen will.
Michelangelo. Gewähre mir noch einige Augenblicke; ich habe da noch etwas fertig zu machen.
Urbino. Einige Augenblicke, aber nicht mehr. Die Frau Marchesa wünscht ausdrücklich ...
Michelangelo. Gut, gut! ... Erzähle mir eine Geschichte, um dich wach zu halten.
Urbino. Ich bin heute zu Eurem Notar gegangen.
Michelangelo. Davon wollen wir nicht reden.
Urbino. Er sagt, daß die beiden jungen Mädchen, die Ihr ausgesteuert habt, recht achtbare Personen seien.
Michelangelo. Das ist mir lieb, Urbino. Ich wünschte, daß sie glücklich würden; es sind liebenswürdige Kinder, wenn auch sehr häßlich.
Urbino. Ich habe auch Euren Neffen gesehen. Er ist gekommen, während Ihr aus wart.
Michelangelo. Schon recht ... Wenn er zufällig wieder käme, so sollst du ihm sagen, er möge mich in Ruhe lassen und seinen Geschäften nachgehen.
Urbino. Er denkt, und mit Recht, daß sein dringendstes Geschäft sei, Euch für die dreitausend Taler zu danken, die Ihr ihm gegeben habt, und Ihr seid nicht reich.
Michelangelo. Er weiß, daß ich ihn lieb habe; er braucht mir nicht zu danken.
Urbino. Meister, die Uhr schlägt ... eine Stunde nach Mitternacht ...
Michelangelo. Ich bin fertig ... aber ich komme um vor Hunger. Hast du nichts zu essen hier? Sieh im Brotkasten nach.
Urbino. Ich will sehen ... Ach! Euer Haus ist nicht auf einen großen Fuß eingerichtet. Sobald Ihr Geld habt, müßt Ihr's dem ersten besten geben.
Michelangelo. Der Mensch bedarf nicht viel für seinen Körper. Aber seine Willenskräfte reichen nicht aus, um seinen Geist zu erheben.
Urbino. Da ist Brot ... es ist ein wenig hart ... und ein Stück Käse, und sogar ein Rest in der Flasche ...
Michelangelo. Das ist prächtig! Bring' mir das alles. (Er nimmt seinen Papphelm ab, setzt die Lampe auf ein Brett und ißt im Stehen, mit dem Blick auf seine Statue, es wird heftig an die Türe geklopft.) Wer kann zu dieser Stunde kommen? Sieh durch das Guckfenster.
Urbino. Wer klopft?
Eine Stimme. Ich bin's, Antonio Mini ... Öffnet, Meister! ... Ich bin's. Euer Schüler! Ich habe Euch wichtige Neuigkeit zu melden!
Michelangelo. Mein Schüler, Antonio Mini! Öffne! Ist's ein Unglück?
Antonio Mini (eintretend). Ach! Meister, ein großes Unglück!
Michelangelo. Was hast du? ... Du bist ganz blaß!
Antonio Mini. Raffael liegt im Sterben! Gewiß ist er in diesem Augenblicke schon tot.
Michelangelo. Raffael! Gott des Himmels!
Antonio Mini. Ich war in seiner Werkstatt mit zweien seiner Schüler, Timoteo Biti und Garofalo. Es mochte drei Uhr sein. Da kam ein Diener, um ihnen zu sagen, daß der Meister sich schlecht befände. Er hatte seit gestern Abend Fieber.
Michelangelo. Seit gestern? Das nimmt mich nicht Wunder. Er ist ein Mann von zarter Leibesbeschaffenheit, halb der eines Weibes, halb eines Kindes. Er verbringt zuviel Zeit bei der Arbeit und viel zuviel bei seinen Vergnügungen. Ich habe ihn vor vier Tagen angetroffen, wie er Ausgrabungen auf dem Campo Vaccino machte, und ich erinnere mich sogar, daß ich ihm warnend gesagt habe, er möge sich vor Erdarbeiten in solcher Jahreszeit in acht nehmen. Du sagst, daß er kränker ist?
Antonio Mini. Wenn er nicht tot ist, so wird er den Anbruch des Tages nicht erleben. Er hat sich in seine Werkstatt tragen lassen. Ich habe ihn gesehen, ja, ich habe ihn gesehen, weiß wie ein Leichentuch, halb erloschen, die Augen auf sein Gemälde von der Verklärung geheftet ... An dem Bette, das man ihm in der Eile hergerichtet, weilten seine Freunde, die Kardinäle Bibbiena, Sadoleto und Bembo, und andre Herren, die ich nicht kenne... am Kopfende war der heilige Vater. Leo X. weinte und trocknete sich die Augen.
Michelangelo. Urbino, gieb mir meine Mütze, meinen Mantel. Ich muß zu ihm hin! Raffael ... Raffael ... Sterben! Ach, mein Gott! Ist es möglich! ... Gieb schnell, gehn wir!
Urbino. Hier, hier, Meister! laßt mir Zeit, eine Laterne anzuzünden, ich will Euch leuchten.
Michelangelo. Du sagst, daß keine Hilfe mehr ist? Bist du dessen gewiß? Waren die Ärzte benachrichtigt worden? Was haben sie gesagt? was getan? Gehn wir!
Antonio Mini. Ärzte, daran fehlte es nicht; da war der des heiligen Vaters, Meister Jacopo da Brescia; dann Meister Gaëtano Marini und andere. Alle schauten sehr betrübt darein und schüttelten den Kopf, indem sie mit den Augen winkten, daß ihre Weisheit zu Ende sei.
Michelangelo. Auf! Urbino, bist du bereit?
Urbino. Hier bin ich, Meister!
Michelangelo. Geh voran, schnell! (Sie treten in das tiefe Dunkel der Straße hinaus, der Regen hat inzwischen aufgehört; in den vom Winde rasch übereinander hingetriebenen Wolken entsteht ein Riß und läßt einen Teil der Mondscheibe gewahren, deren weißes Licht die First der Häuser und den Weg ein weniges erhellt. Man hört lautes Geräusch von Schritten.) Was ist das für ein Auflauf?
Urbino. Wir werden es erfahren, wenn wir um die Ecke der Gasse sind!
Antonio Mini. Vorwärts! Hütet Euch vor dieser Wasserpfütze, Meister. (Er hält Michelangelo am Arm.)
(Ein starker Trupp von Offizieren, Soldaten, Dienern und Fackelträgern, deren Fackeln ein rotes Licht auf die Häuser werfen, zieht eilig und in Unordnung vorüber; inmitten dieses Zuges die päpstliche Sänfte mit geschlossenen Vorhängen.)
Michelangelo (zu einem Kämmerer). Was bedeutet das, Herr?
Der Kämmerer. Es ist der heilige Vater, der zum Vatikan zurückkehrt.
Michelangelo. Ist etwa Raffael...?
Eine Stimme. Raffael ist tot, und Michelangelo bleibt allein in Italien!
(Der Zug zieht vorüber. Michelangelo sinkt auf eine Steinbank. Die Wolken haben sich zerstreut. Der Mond erglänzt in einem tiefklaren Luftkreise.)
Michelangelo. Ich bleibe, es ist wahr ... Ich bleibe allein ... Letztes Jahr war es Lionardo ... Jetzt ist er's, und alle, die wir alle drei gekannt, die wir gehört haben, sie sind seit langem dahin. Es ist wahr, ich bleibe allein. Es war eine Zeit, wo ich es gern gehabt hätte, so der Alleinige, der Einzige, der Größeste, der ausschließliche Vertraute der Geheimnisse des schaffenden Himmelsgeistes zu sein! Ich stellte mir vor, daß, der Sonne ähnlich zu sein, im Mittelpunkt der Welt, ohnegleichen, ohne Nebenbuhler, das wundervollste Glückslos wäre, das man ersehnen könnte ... Als ob es etwas Schlimmeres gäbe, als allein zu sein auf Erden! ... Jahrelang liebte ich Lionardo nicht ... Ich haderte mit Raffael im Grunde meines Herzens ... Ich sagte mir immer wieder vor, um mich davon zu überzeugen, daß ich sie nicht schätzte ... Ja, ja, es hat Tage gegeben, wo du, Michelangelo, nur ein armseliger Elender gewesen bist, von kurzem und beschränktem Blick, geneigt zu tadeln und zu verkennen, was dir nicht ähnlich war, und, ich sage dir's, weil es wahr ist, was ganz gerade soviel und vielleicht mehr wert war als du! Jetzt habe ich, was meine Torheit wünschte! Die Sterne am Himmel sind erloschen, und ich bin allein ... ganz allein, und ich ersticke in meiner Vereinsamung! ... Da ist freilich noch Tizian; der ist ein großes Genie, ist ein großer Geist ... Da ist Andrea del Sarto ... Da ist ... Aber, nein, ach! Sie sind, so groß sie auch sein mögen, nicht Lionardos Gleichen und dessen, der dort unten sich bettet ... Ach! Der! ... Die Schönheit, die Zartheit, die Lieblichkeit, die Anmut und die Himmelssüße in seinen Reden wie in seinen Blicken! ... Alles, was ich nicht habe, alles, woran ich nicht reiche ... Alles, was ich nicht bin! ... Er, der so geliebt worden, und der es so verdient hat! ... Ach! mein Gott! mein Gott! Wie ist mir denn? Was regt sich in mir und entlockt Tränen diesen meinen Augen, die niemals weinen wollten? Was kommt mir bei? Ja, ein Schmerzensstrom bricht sich Bahn und wälzt sich hinab in meines Busens Tiefe; die Tränen entrinnen meinen Lidern, sie rieseln auf meine Wangen, sie fallen hernieder auf ihn, den ich immer grollend gemieden, und der so sehr der Bessere, der größere Liebling des Himmels war als ich! Sie hatte mir's gesagt ... Vittoria ... sie hat mir's immer gesagt, und ich wollte es nicht zugeben ... Aber ich weiß es wohl, im Innersten fühlte ich es, und jetzt, wo der Blitz des Todes zwischen ihn und mich gefahren ist, wo ich dageblieben bin, den Fuß im Schlamm der Welt, während seine edle, bezaubernde Gestalt mir in Gottes Schoße erscheint, strahlend in himmlischer Klarheit, da sehe ich, wie wenig aufrichtig, wie klein ich war! Nein ... nein, Tizian und die andern, so bewundernswert sie sein mögen, sie kommen den großen Männern nicht gleich, die jetzt dahin sind! Um sie, um mich, die wir bleiben, verliert das Licht seinen Glanz und weicht, die Schatten werden länger... Ja, ich bin allein, und der Eiseshauch des Grabes, das sich da aufgetan, schlägt mir ins Gesicht. Was wird aus den Künsten werden? Und wir, die wir soviel gehofft, soviel gewollt, soviel erdacht, soviel gearbeitet haben, was soll uns geglückt sein, was sollen wir der Nachwelt hinterlassen, die auf uns folgt? Nicht auch nur ein Viertel von dem, was wir hätten tun müssen!
(Er bedeckt das Gesicht mit den Händen.)
Urbino. Kommt, Meister, Ihr werdet Euch erkälten.
Antonio Mini. Gebt mir den Arm und laßt uns in Eure Wohnung zurückkehren.
Michelangelo. Ach ja, es ist wahr. Man muß seine Kräfte hüten und arbeiten, so lange die Kette des Lebens einen knebelt.
Die Piazza Navona.
Ein vornehmer Franzose, ein vornehmer Engländer, ein flamländischer Franziskaner. Ein Cicerone.
Der Cicerone. Ich habe mir gleich gesagt, als ich euch von weitem sah, hochwohlgeborene Herrschaften: das sind höchst gewichtige Persönlichkeiten, denen deine Pflicht dich verbindet allerbaldigst deine Aufwartung zu machen und deine Dienste anzubieten.
Der Franzose. Ich bin aus der Champagne, und mein Landgut Brandicourt ist wohlbekannt. Mein Freund kommt von London, und wir haben auf gemeinschaftliche Kosten diesen guten Pater in Dienst genommen; er begleitet uns, bürstet uns die Kleider und bringt die Beobachtungen zu Papier, die wir auf unsrer Reise machen.
Der Cicerone. Ich bin überglücklich, daß mir eine so schmeichelhafte Begegnung wie die mit eueren erlauchten Excellenzen zu teil geworden ist. Ich genieße in dieser Stadt eine ziemlich große Achtung, und mein Gott! ich darf es ja sagen, man erweist sie weit weniger meinem dürftigen Verdienst als meiner vornehmen Geburt und dem Ansehen, dessen sich meine Eltern beim heiligen Vater erfreuen. Ihr seht mich glücklich, euch alles was ich bin zu Füßen zu legen, ich werde euch alles haarklein zeigen, was Roms Stolz ausmacht, und euch seine Sehenswürdigkeiten Punkt für Punkt erklären.
Der Engländer. Das wäre sehr angenehm; aber vielleicht werdet Ihr uns sehr viel abverlangen?
Der Cicerone. Hochedle Herren, ihr mögt mir geben, was euch beliebt. In jedem Falle, seid davon überzeugt, werde ich mich für reichbeglückt durch eure Gunst halten. Ich trachte nur nach der Ehre, euch einen Dienst zu leisten.
Der Engländer. Das heißt, ich will alles kennen lernen!
Der Cicerone. Nichts leichter, als das.
Der Franzose. Ihr begreift: mein Freund und ich sind in keiner anderen Absicht nach Italien gekommen, als um nachher in den vornehmen Gesellschaften zu sagen: ich habe dies und das gesehen. Da wäre es denn sehr verdrießlich, hinterher von manchem zu erfahren, das wir nicht gesehen hätten.
Der Cicerone. Habt nur keine Sorge. Wir wollen gleich den Augenblick anfangen, wenn's euch beliebt. Biegen wir in diese Straße ein. Ich will euch im Vorbeigehen den Campo Baccino zu bewundern geben; das war der Ort, wo die alten Römer ihre Versammlungen hielten.
Der Engländer. Den will ich sogleich sehen!
Der Cicerone. Ihr sollt ihn im Augenblick sehen! Da wurde der berühmte Pompejus ermordet ...
Der Franzose. Pater Jean, notiert das auf Eure Schreibtafel. (Pater Jean schreibt.)
Der Cicerone. Sodann werden wir den Vatikan besuchen, wo einer meiner Vettern, der sehr hoch im Vertrauen des heiligen Vaters steht, uns für eine Kleinigkeit herumführen wird.
Der Franzose. Ich will die Gemälde des Malers sehen, der neulich gestorben ist, und dem man ein so schönes Leichenbegängnis bereitet hat ... Wie hieß er doch?
Der Cicerone. Ihr meint Meister Raffael.
Der Franzose. Er war, wie es heißt, ein sehr ... ein sehr ... geschickter Mann. Ich habe mir sagen lassen, daß sogar der König ihm zu arbeiten gegeben hätte.
Der Engländer. Ach! ja, es war ein Mann, den ich wohl gerne hatte sehen mögen ... Aber, schließlich, da er einmal tot ist ... Wenn wir den Vatikan besucht haben, wollen wir in dem Gasthof Mittag halten, wo man am besten ißt.
Der Cicerone. Das ist auch mein Gedanke, hochwohlgeborene Herren, und ich werde euch eine Mahlzeit auftischen lassen, die euch in Erstaunen setzen soll.
Der Engländer. Pater Jean, Ihr notiert die Gerichte und ihre Bereitungsart.
Der Franzose. Wollt Ihr uns nicht auch die Bekanntschaft einiger liebenswürdiger Damen verschaffen?
Der Cicerone. Ich überlege mir's eben. Ich kenne zur Zeit zwei, zu denen ich euch gleich heute Abend mitnehmen will, und ihr werdet von ihnen entzückt sein. Wir essen bei ihnen zu Abend; wir haben da ein Instrumentalkonzert, und ihr werdet mir euer Lebenlang für die Unterhaltung danken, zu der ihr Zutritt gehabt habt; denn ihr müßt wissen, daß es ausgezeichnete Personen sind und daß sie mit allem, was Rom Hervorragendes besitzt, in Verbindung stehen. Da sie die fremden Herren sehr lieben, so mache ich mir das Vergnügen, solche manchmal mit hinzubringen.
Der Engländer. Pater Jean, Ihr schreibt den Namen dieser Damen nieder, damit wir uns zu Hause etwas darauf zu gute tun können.
Der Cicerone. Wir wollen uns auf den Weg machen, wenn's euch gefällig ist; denn ich bemerke da rechts und links zwei Herren, die Willens sind, sich euch als Führer anzubieten, und ich möchte euch nicht in so schlechte Hände fallen lassen.
Der Franzose. Ei der Tausend! der hübsche Palast! Von wem ist er?
Der Cicerone. Er ist von Ammirato.
Der Franzose (zu dem Mönche). Schreibt, Pater Jean, daß wir einen Palast von Amurat gesehen haben ... Das ist der türkische Großsultan?
Der Cicerone. Ganz richtig, hochedler Herr! (Sie gehen weiter.)
Ferrara.
Das Gemach Donna Lucrezias im herzoglichen Palaste.
Donna Lucrezia sitzt an einem offenen Fenster, das auf einen inneren Hof geht. Sie ist in ein einfaches Gewand von schwarzem Tabin gekleidet, ihre Ärmel und ihre Halskrause sind von spärlich besticktem Musselin. Ihr schwarzes, unter ihrer Sammethaube sorgfältig geordnetes Haar läßt hie und da einen Anflug von Grau und Weiß gewahren. Der Ausdruck ihrer Gesichtszüge ist ernst und ruhig. Donna Lucrezia liest aufmerksam einem kleinen, in rotgelben Saffian gebundenen Band, dessen Rücken die Aufschrift De Imitatione Christi trägt. – Nach einigen Augenblicken legt sie das Buch offen auf das Fensterbrett, geht auf einen großen Tisch zu, setzt sich, zieht ein Blatt Papier hervor, taucht die Feder ein und schreibt den folgenden Brief:
An Seine Excellenz den Hochwürdigsten Herrn Kardinal Bembo zu Rom.
Wenn ich mich heute der lateinischen Sprache bediene, hochgeehrter und liebwerter Herr, so seid gewiß, daß ich nicht einem eitlen Wunsche nachgebe, mit meinen geringen Kenntnissen vor Euren Augen zu prunken. Noch weit weniger dürft Ihr denken, daß ich es wagen würde, an Beredsamkeit mit dem überlegenen Geiste zu wetteifern, welcher den schönen Stil und die gefällige Sprache dessen, der vor Zeiten über das Alter und über die Pflichten schrieb, wieder unter uns hat aufleben lassen. Ehedem fröhnte ich vielleicht solch nichtigen Gedanken; heute bediene ich mich des Lateinischen aus dem doppelten Grunde, weil es eine ernste und unserm Alter angemessene Sprache ist, und sodann weil sie Euch teuer ist und ich vor Eurem Geiste immer in einer Form erscheinen möchte, die geeignet wäre, mir eine gute Aufnahme zu erwirken.
Wenn ich auf Euren Brief vom 13. September nicht sogleich geantwortet habe, so war es, weil ich Sorgen hatte, mit denen ich Eure treue Anhänglichkeit nicht umdüstern wollte. Der Herzog ist leidend gewesen, und zwar so, daß er mir lebhafte Beunruhigung verursachte. Er ist nicht mehr jung, und die sich häufende Last der Kriegsstrapazen und der Regierungssorgen macht sich in allen seinen Gliedern empfindlich fühlbar. Ich habe traurige Tage an seinem Schmerzenslager verlebt; jetzt geht es ihm besser, und ich komme wieder zu Euch, ein weniges getröstet, gestärkt in meinem Mut, aber nicht zweifelsfrei gesundet. Das Leben hat sich mir zu lange hinausgezogen. Zuviele Klagen, zuviel Gram um so manches in der Vergangenheit lagerte sich schwer auf mein Gemüt. Die Liebe zu den Wissenschaften, so mächtig einst, um meine Mußestunden aufzuheitern, hat von ihrem Zauber verloren; einzig die Religion hält mich aufrecht; aber sie hat viele Drohungen neben ihren Verheißungen.
Dieses sind keine Eindrücke, die man gern einen so teuren Freund, wie Euere Hochwürdigste Excellenz, teilen läßt. Ihr habt Eure Mühen, Ihr habt Eure Sorgen; ich möchte sie gerne lindern. Sollte es dazu wohl das rechte Mittel sein, Euch mit meinem Herzeleid zu quälen? Ich glaube es nicht, und aus diesem Grunde schreibe ich Euch wenig; aber ebenso, wie ich vollkommen sicher bin, beständig in Eurem Gedächtnis zu leben, so dürft auch Ihr glauben, daß Euer Andenken unaufhörlich in den geheimsten Winkeln meines Herzens umgeht. Erinnert Euch also dessen, und erinnert Euch dessen vornehmlich in den Augenblicken, wo Ihr mich am Dienste Gottes teilnehmen lassen könnt. Gott allein hält mich aufrecht, ich hoffe auf Gott allein, ich will nur noch Gott allein, ich wundere mich, daß ich jemals meine Blicke anderswohin gerichtet habe. Ich zittere vor seinem Gericht, dessen Strenge ich ohne Zweifel nur zu sehr verdient habe. Aber Ihr habt mich gelehrt, auch auf sein Erbarmen zu hoffen, und mir scheint zuweilen, daß meine Fehler, indem sie mich der Wirkung seiner Güte mehr unterwerfen, mir wenigstens dazu dienen, daß sie die Inbrunst meiner Liebe zu ihm verdoppeln.
Lebt wohl, mein Freund. Verfehlet nicht, dem heiligen Vater für die liebreichen Worte zu danken, mit denen es ihm jüngst gefallen hat, seine Dienerin zu ehren, und nochmals betet für die, die dessen so bedürftig ist.
Gegeben zu Ferrara, den 31. Dezember.
Lucrezia Borgia, Herzogin von Ferrara.
Brügge.
Ein mit geschnitztem Eichenholz ausgetäfelter Saal.
Auf den Friesen die gemalten und vergoldeten Wappen der niederländischen Provinzen; über dem großen Kamin das Reichswappen; an der Wand, dem bunten Glasfenster gegenüber, ein großes Gemälde der deutschen Schule, das jüngste Gericht darstellend. Es ist Nacht. Auf einem Tische eine angezündete Lampe, offene Depeschen. Karl V., in einem Lehnstuhl vor dem Tische, mit Schreiben beschäftigt.
Ein Edelknabe (eintretend). Der Hochwürdigste Kardinal von Utrecht steht zu Eurer Kaiserlichen Majestät Befehl.
Karl V. Er trete ein!
Hadrian. Der Kaiser hat nach mir verlangt?
Karl V. Ich erfahre die Nachricht vom plötzlichen Tode Leos X. Ich will darüber mit dir beraten.
Hadrian. Leo X. ist tot? Das war unerwartet. Er war erst sechsundvierzig Jahr. Ist Euch das Nähere mitgeteilt worden?
Karl V. Meine Gesandten schreiben mir, der Papst sei vor Freude erstickt, als er die Kunde erhielt, daß Mailand genommen und die Franzosen von seinen Truppen in die Flucht geschlagen seien. Aber hier ist ein geheimer Bericht des Censors des päpstlichen Palastes, Paris de Grassis, der mir Grund giebt, an Gift zu glauben.
Hadrian. Man sollte den Papst ermordet haben, und weshalb?
Karl V. Hatte er nicht den Kardinal Petrucci ums Leben bringen lassen und viele ihres Eigentums beraubt? Wie dem auch sei, Leo X. ist tot. Setze dich. (Hadrian setzt sich an den Tisch.) Was denkst du von diesem Ereignis?
Hadrian. Die Christenheit bleibt in einem traurigen Zustande. Die Franzosen sind geschlagen; aber sie werden ihren Angriff erneuern.
Karl V. Du hast recht. Franz I. wird nicht in Frieden leben. Er ist ein händelsüchtiger Charakter; er hat viele Fehler, und Eigenschaften, die zu fürchten sind. Er wollte die Kaiserkrone. Ich habe sie bekommen. Er will Burgund, er will Flandern; alles, was er will, müßte er mir entreißen, und mit Gottes Hilfe werde ich das nicht zugeben.
Hadrian. Das sind ernste Erwägungen; aber ich bekenne Euch, Sire, daß ich in diesem Augenblicke, wenn ich so in meinem Sinne den Stuhl des heiligen Petrus, leer wie er ist, betrachte, um noch ernsterer Ursachen willen bekümmert werde. Nie war die Religion in einer so großen Gefahr. Seit Jahren wandelt sie verhängnisvollen Entscheidungen entgegen; sie ist am Rande angelangt.
Karl V. Sie ist am Rande angelangt, und der Abgrund hat keinen Boden. Du sprichst wahr, wenn du versicherst, daß diese Gefahr stärker und furchtbarer ist, als die andern, denn alles, alles auf Erden, alles im Weltall hängt an dieser Macht, der Religion, der es aufgegeben ist, zu herrschen über Himmel und Erde; und wenn diese Macht in Gefahr gerät, dann muß alles ohne Gnade zusammenstürzen. Ich werde es nicht zusammenstürzen lassen.
Hadrian. Ihr habt schon Großes in der Behandlung der religiösen Fragen in Deutschland geleistet.
Karl V. Die Gefahren sind ungeheuer von dieser Seite, und wenn ich nicht jäh dreinfahrend den Wagen wieder aufgerichtet hätte, den wilde Rosse mit sich fortreißen wollten, so wäre das Übel bereits unheilbar. Ich will die Ketzerei nicht dulden! Ich werde niemals mit den ärgsten der Rebellen unterhandeln, noch auch länger die Beschützer dieser schändlichen, giftigen, unverzeihlichen Ausschweifung in einer Ruhe, die mir Schaden brächte, zu Atem kommen lassen! Wie! Der Glaube Christi ist bedroht, und wer verteidigt ihn? Ich, der Kaiser! Der Stellvertreter der Apostel seinerseits findet (ich irre mich glücklicherweise! er fand, wollte ich sagen), daß Luther gut schreibe; er ergötzte sich an seinen Briefen, er sprach in betreff dieses Brandstifters nur von Milde und Geduld! ... Ich bin da! ... Ohne mich triumphierte die Hölle!
Hadrian. Gott hat Euch erweckt wie einen Gideon.
Karl V. Es ist seltsam, daß weder der Papst noch Franz I. begriffen haben, wohin diese Neuerungen uns führen. Und doch braucht man nur den Eifer zu sehen, mit dem die kleinen Fürsten sie sich aneignen und der Einzelne sich darein vernarrt. Diese abscheulichen Lehren atmen das Gift der Unabhängigkeit und der Anarchie. Sie würden den Kurfürsten gegen mich, den Vasallen gegen ihre Lehnsherrn, dem Gewimmel des Pöbels gegen die Bürger der Städte recht geben. Der Papst bildete sich ein, wenn er jedem das Recht ließe, nach Belieben in den Tag hinein zu reden, so entstünde daraus nicht mehr Unheil, als wenn man den Lumpen erlaubte, sich am Sonntag Abend einen Rausch zu holen. Aber es kommt ein Augenblick, wo der Trunkenbold so krank ist, daß er in Wahnsinn verfällt, und ich sehe es klar, es ist Zeit, die Zügellosigkeit zu ersticken ... Die Welt ist voll von den frechen Schmähschriften eines Ulrich von Hutten, die übrigen gar nicht zu rechnen. Bist du meiner Meinung?
Hadrian. Zweifelt nicht daran. Zwei Laster halten sich an einer Hand, während sie mit der andern den Aufruhr, den Todfeind der Religion und folglich der Welt, hegen und pflegen: die Verderbtheit der Kirche und die gottvergessene Toleranz, des bösen Wandels Schwester.
Karl V. Du lässest also meine Ansicht gelten, daß der zukünftige Papst mit den weltlichen Gewohnheiten der vorangegangenen Regierungen zu brechen haben würde?
Hadrian. Wenn er zaudert, sind wir verloren! Er muß ein Papst sein, und kein Fürst; ein Gottesgelehrter, und kein Schöngeist; ein Asket, und kein Wollüstling; muß von schimmeligem Brote und gemeinen Kräutern leben, und nicht von fein ausgeklügelten Gerichten, die sie auf goldenen Schüsseln auftragen. Nur hölzerne Schalen gönne ich ihm! Er muß mit seinem Bettelstabe die Götzenbilder der alten Heiden zerschlagen, mit denen, zum entsetzlichen Ärgernis der Gewissen, die heiligen Paläste angefüllt sind, muß, weit entfernt, den Phrasenschwall der Bembo und Vida mit Entzücken anzuhören, diese Leute in die Gefängnisse der Inquisition schicken und ihnen dort die bitterste Buße zu kosten geben! Ja, Kaiser, die Buße, die Buße, sie allein kann die Welt retten! Retten, meine ich, in diesem sterblichen Leben vor den schrecklichen Zuckungen, die die Ausschweifung hervorgerufen hat, sie retten im ewigen Leben vor den rächenden Flammen, deren Strafen wir mehr und immer mehr verdienen.
Karl V. Ein Papst, unbeugsam und heilig, ein Kaiser, entschlossen, seine Mühen zu teilen und nimmer schwach zu werden in der Verteidigung und Verherrlichung des Glaubens, denkst du, daß es diesen beiden Mächten, eng miteinander verbunden, gelingen könnte, die Welt zu retten?
Hadrian. Es giebt hienieden eine bestimmte Summe von Herrschaft; sie wächst nimmer, noch nimmt sie ab, aber die verschiedenen Epochen, die verschiedenen Staatsverbindungen verteilen sie auf mannigfache Art. Was in diesem Augenblicke die Luther und ihre Beschützer wollen, was die betörten Priester des päpstlichen Hofes geschehen lassen, das ist die Teilung und Wiederteilung dieser kostbaren Gewalt bis zum äußersten; sie wird in den Händen der Unwürdigen verloren gehen. Aber wenn der Papst und der Kaiser eins wären, um die höchste Gewalt ganz und ungeteilt fest in ihre Hand zu schließen und nur zum Siege des Kreuzes zu verwenden ... welch ein Schauspiel! welch ein Glück für alle Welt!
Karl V. Ich bin der Kaiser, und du bist der Papst!
Hadrian. Ich zage nicht, es auszusprechen: es wäre ein großes Unglück für mich, dessen letzte Jahre der Ruhe bedürfen. Aber es wäre ein Glück für die Seelen, denn ich würde keine Schonung kennen, wo es das Heil gälte.
Karl V. Du hast mich nicht verstanden. Lies diese Depeschen! Das Konklave hat sich unmittelbar nach dem Tode Leos X. versammelt. Ich habe den Kardinälen die Wahrheit vor Augen geführt. Sie haben sie erkannt. Sie haben dich ernannt. Der heilige Geist ist auf dich herniedergefahren. Du bist der Papst, sage ich dir, wie ich der Kaiser bin.
Hadrian (faltet die Hände und hält sie gegen seine Brust gepreßt. Seine Augen sind geschlossen, und seine Lippen murmeln leise ein Gebet. Ein Augenblick des Stillschweigens). Ich habe mich gesammelt. Welche Lebenslage könnte es von einer schwachen Kreatur mehr verlangen? Gottes Hand ruht auf mir; so geschehe es denn nach Seinem heiligen Willen. Ich weiß nicht, mein Sohn, ob in dem, was mir begegnet, Eure weltliche Weisheit nicht der Freiheit der Wahl entgegengewirkt hat. Es ist keine Zeit mehr, es zu untersuchen. Ich habe die Tiara nicht gewollt, ich habe sie nicht gewünscht. Mit Euch oder trotz Eurer, was Gott tut, ist wohlgetan. Ich bin ein armer Mann, ohne Herkommen, bis auf den heutigen Tag in den Nebeln der Städte des Nordens verloren; ich habe Italien nie gesehen und werde in den Vatikan einziehen gleich einem zerlumpten Landstreicher, dessen Anblick als eine Beschimpfung für den Glanz des Palastes der Könige erachtet wird. Ja, ich will ihn beschimpfen, diesen Glanz! Ich will ihn mit Strenge treffen! Und wenn es dem Herrn, der mich ruft, gefällt, so will ich an seine Stelle die christliche Demut und Einfachheit setzen, deren wir so hochbedürftig sind!
Karl V. Zählt auf mich, allerheiligster Vater, wie auf einen gehorsamen Sohn. Zusammen vermögen wir alles für das Gute; auch müssen wir alles dafür vollbringen! Des Kaisers Heere, Schätze, Geist, Gedanken werden für Euch arbeiten! ... Aber ich muß es Euch auch erklären, denn in diesem Augenblicke, Hand in Hand, haben wir einander nichts zu verbergen: werdet nicht schwach, weicht nicht zurück, fallet nicht! ... Denn ich gehe immer vorwärts, und wenn die Kirche wankt oder zaudert, so schleife ich sie nach, mag sie wollen oder nicht!
